Adolf Endler: Erwacht ohne Furcht
EINEM JUNGEN DICHTER
1
Die Wüste, mit Alkohol getränkt,
– trägt sie Frucht?
Fata Morganen, künstlich gelenkt;
mehr wird hier nicht gebucht.
Anderswo treibt man Kanäle ins Land,
Verse wie Spaten.
Du aber hebst drei Körner Sand
und siehst sie fallen wie gebannt…
Das sind so deine Taten.
Wie hast du deine brave Hand
jämmerlich verraten!
Du fängst,
aaaei, seht nur, wie geschwind,
dir eine Strähne Wüstenwind
und rollst sie fein, ein irres Kind,
um deinen kleinen Finger…
(Phantasievolle Wüstenbezwinger
glaubst du für Träume blind.)
Ach, lerntest du’s einzusehn,
wie kräftig bunt, wie schön
nützliche Träume sind!
2
Bürokraten der Poesie:
die Straße stört ihr Gedicht,
frische Luft, helles Licht,
also stimmt es nicht.
Sieh sie beim Werk,
hör die Sprachgelenke aufkreischen.
Da sterben Sätze in den Speichen
klippklappernder Silbermühlen.
Jagt sie von ihren festgenagelten Stühlen!
Zwingt sie dazu, ihren Mund, ihren Schlund
mit Straßenstaub zu spülen!
Laßt sie sich ruhig verkühlen!
Schnupfen ist ihnen gesund,
aaadie Welt ist bunt.
Oder klammert ein Zettelchen
an ihren Hintern:
aaa„Gib Zeichen,
aaawir weichen!“
Nur: Laßt sie nicht überwintern!
3
Zähes Würfelspiel ums klangvolle Wort,
um Rhythmus und Reim…
Dennoch: die Strophe verdorrt
schon im Keim.
Du hast dich zu lang
mit Stubenstaub, Stille genährt,
dich abgeschlossen.
Jetzt wird dir bang:
Wie das Stundenglas leise sich leert,
ist auch dein Vers, dein Gedicht
leergeflossen.
Preß deinem Leid
ein kärgliches Ströphlein noch aus…
Besser: Wirf alles beiseit!
Lauf,
such ein lebendiges Haus!
Fülle im Klassenstreit
deine trocknende Seele auf.
4
Blüte am kargen Stock!
O sie geben sich Mühe,
winden und winden und winden
Kränze ums dürre Holz.
Darauf sind sie stolz.
Doch daß das Holz erblühe,
mit bunten Früchten lab,
ist’s nötig, den Stab
in lebendige Erde zu binden.
Die fortwährenden Gleichschaltungsversuche
in den fünfziger Jahren
(…) Selbst ein Autor wie Adolf Endler (*1930), 1955 aus der BRD in die DDR übergesiedelt, am Leipziger Literaturinstitut diplomiert und schon in den anfangsechziger Jahren zur wesentlichen Schriftstelleropposition gehörend, schwamm in den Endfünfzigern noch voll auf der FDJ- und Parteiwoge. In seinem seitenlangen Poem „Wische – Bauplatz der Jugend“ sang er begeistert im Aufbau-Chor:
Die Partei hatte einen Plan,
wir hörten davon:
Bitte, laßt uns da mal ran!
Das schaffen wir schon!
Die Wische braucht Gräben?
Schwer sie auszuheben?
Schluß, keinen Ton mehr,
Schaufeln her.
Bitte gleich, sagte die Partei.
bitte gern!
Seid ihr Jungen
mal die Herrn.1
Und in der Kampagne zur Austreibung der nonkonformen Lyriker W. Hädecke und P. Jokostra, die sich rücksichtslos jeder gesellschaftlichen Verpflichtung zu entziehen suchten, brach Endler den Stab.
1958 war von P. Jokostra der Gedichtband An der besonnten Mauer erschienen, in dem er allgemeinhumanistische Positionen gegen den Faschismus als besondere Spielart des Totalitarismus bezogen hatte, dessen Dämonen und Projektile in ihm allnachts schreckliche Gewitter der Angst auslösten:
Dämmerung und Dämonen
sind dem Waldfreund nicht fremd,
so vertraut die schrecklichen Gewitter der Angst,
die gewaltigen Klagen des Schwarzspechts.
Brennesselwälder brennt die Erinnerung in mein Blut,
Bohrtürme, Bagger und Birkenbusch
und des Neumonds erkaltete Projektile. 2
Das galt als kompakter Angriff nicht nur gegen den sozialistischen Realismus, sondern darüber hinaus gegen die sozialistische Politik der Partei des Proletariats, und
quicklebendige Leute… die beispielsweise Agitationslyrik durch die Straßen von Halle transportieren oder sich in Karl-Marx-Stadt in die Redaktionsstuben der dortigen Presse drängeln, um schnell und wirksam auf die neueste Dummheit Adenauers oder die neuesten Erfolge beim Aufbau des Sozialismus in der DDR mit Reim und Vers reagieren zu können.3(489; 11/58/48),
wurden den Hädeckes und Jokostras entgegengesetzt. Darauf hin war denen des Bleibens nicht mehr sicher, und sie verließen die DDR. Das Nest war wieder rein.
Doch schon fünf Jahre später wird A. Endler die Bubenstreiche, zu denen er sich durch die Zeitschrift Junge Kunst hatte hinreißen lassen, reuevoll zurücknehmen:
Der Verse in langen Reihn
Als Mörtel zur MAUER trägt
Ach ach wie preist er den Stein
Mit dem man ihn dann erschlägt4
Und er wird sich angewidert abwenden von denen, die ihn wiederum zu mißbrauchen trachten zu sie bestätigenden Versen. Nein, nicht mehr dieses Fiebrige, Sündige.
Schaudernd erkennt man sich selber wieder und die eigene Verblendung; und man rätselt und rätselt, wie man dazu fähig sein konnte, als Fünfundzwanzigjähriger, als Dreißigjähriger noch, sich solchen Kokelores in die Tasche zu lügen.5
Und:
So etwas sind wir also auch einmal gewesen.6
Vorerst aber:
Einmal bald
und ich werde das papier hier zerreißen
aufenthaltsgenehmigung
kaderakte
passierschein
und da in die spree tun
(was geschieht dann mit mir genossen?)
und ich werde es tun7
Ein Großteil derer, die sich in der Jungen Kunst begeistert prostituiert hatten, wird später versuchen, diese Texte schamvoll zu unterschlagen. Wohl auch H. Müller seine z.T. bereits zynischen Gedanken über die Schönheit der Landschaft bei einer Fahrt zur Großbaustelle Schwarze Pumpe:
Wäldchen und Feldchen. Ochsen
Plagen sich vor dem Pflug. Bauern
Plagen sich hinter dem Pflug.
…
Hier sammelten die Alten Reisig
…
Hier werden die Brikettfabriken stehen in
5 Jahren und die neuen Kraftwerke.8
Aufbaustolz, vermengt mit Häme. Weg mit dem/den Alten! Obzwar er damals doch auch schon das über Partei und Staat im Sinn hatte, was er 1m Enthüllungsjahr 1956 einem jungen Maurer in den Mund legte (und dann, möglicherweise, bis 1971 überarbeitete):
Was soll ich machen. Sie ist eine Hure.
Ich hab gedacht, sie ist eine heilige Jungfrau.
Und angegeben mit ihr wie ein Idiot
Und keiner hat mir was gesagt und alle
Habt ihrs gewußt, du auch. Und krumm gelacht
Habt ihr euch über den Idioten, der
Sich eine Hure aus dem Rinnstein fischt
Und präsentiert sie als Heilige Jungfrau.
Habt ihr ihn nicht alle dringehabt bei ihr.
Weißt du, was das für ein Gefühl ist. Alter
Wenn du mit einem Engel durch Berlin gehst
Du denkst, sie ist ein Engel, schön wie keine…
Wenn dir zum Beispiel einer sagt, deine
Partei, für die du dich geschunden hast
Und hast dich schinden lassen, seit du weißt
Wo rechts und links ist, und jetzt sagt dir einer
Daß sie sich selber nicht mehr ähnlich sieht
Deine Partei, vor lauter Dreck am Stecken…
… Was soll ich machen.
Sie kriegt ein Kind. Sie sagt, es ist von mir…9
Das war doch harte, bittere, sarkastische Abrechnung mit eigenem Parteiflirt, die Niederschlagung des Volksaufstands vom 17. Juni wird beschworen (die Figur der Maurers von der Stalinallee), der Tanz mit dem Stalinismus, die Haßliebe zur Partei, die ganze Janusköpfigkeit jenes Jahrzehnts! Das Dennnoch-Bewußtsein. Und gewiß war das auch Auseinandersetzung mit und Antwort auf Brechts Resignation: Ich habe kein anderes Pferd als dieses schielende, lahmende, räudige, eben den Kommunismus10 Doch auch der Maurer Müller kam nur zu dem Schluß:
Und jetzt
Kommt das Verrückte: alles ist wie vorher.
Ich bin besoffen, wenn ich sie bloß anseh.
Auch ein J. Becker schrieb damals hämische Pamphlete gegen abseits Stehende11, und ein H. Czechowski begrüßte den Schießbefehl auch noch nach dem Mauerbau:
Schnee und Kälte werden uns nicht schaden,
Sommerhitze bleicht den Himmel, aber nicht
unser junges Haar, drum durchgeladen:
Üben wir uns in den guten Waffentaten,
daß es dem Herrn Strauß an Mut gebricht!12
Auch R. Bahro dürfte später kaum noch begriffen haben, was ihm einst naivgläubig per geblähter Majakowski-Strophe passiert ist:
Ich weiß, meine Freunde, wievielen
das Rot auf die Nerven geht,
das manchmal, an Feiertagen,
vom Dach unsrer Uni weht13
Und nirgends mehr fand sich später W. Werners Bekenntnis Wofür ich kämpfe:
In mir ist Haß, den will ich euch zeigen,
der wächst aus den Fäusten und spannt mein Gewehr…14
Das alles sei hier nicht ausgegraben, um nun ebenfalls mit Häme auf die einstigen Irrtümer und Verfehlungen späterer Oppositioneller mit dem Finger zu zeigen, sondern um den Zeitgeist in den Fünfzigern zu fassen, als es noch manche Hoffnung gab, eine soziale Vision realisieren zu können. Noch griffen bei vielen die marxistischen Glücks- und Heilsversprechungen, die große Sinn-Fiktion. Alle hier zitierten Autoren werden später öffentlich oder hinter Metaphern versteckt gegen die Parteidiktatur opponieren, werden Gebrauch machen von ihrem Recht auf Erschütterung, auf Rat- und Hoffnungslosigkeit, sie werden die Lüge Lüge nennen und Unterwerfung und Unmenschlichkeit beklagen. Vorerst aber stand ihnen nur die oktroyierte Offizial-Phraseologie zur Verfügung, die verarmte, ausgezehrte, sinnentleerte Heldensprache, die nichts weiter kannte als eklektische hymnische Formeln für Herrscherlob oder aggressive, kriegerische Kampfansagen, deren inhumane Diktion als Tugend begriffen wurde.
Solche schamvolle Rückbesinnung ist notwendig, weil vielleicht prophylaktisch. Es gibt Untersuchungen über das sogenannte Faschismus-Syndrom und über das Mitläufer-Phänomen, wie es Usurpatoren wie Hitler und Stalin gelingen konnte, Millionen aufgeklärter und ansonsten vernünftiger Menschen in ihren Sog zu bannen.15 Die Wirkung massensuggestiver Rituale – dazu gehört auch die Ritualisierung der Sprache – auf dem Untergrund kollektiver Begeisterung oder der Angst vor kollektiver Ausgrenzung ist dafür mitverantwortlich. Die mehrfachen konzertierten Aktionen in den endfünfziger Jahren (s. u.a. die Serie von Kulturkonferenzen mit ihren imperativen Programmen und Scherbengerichten) scheinen eine solche Suggestivwirkung befördert zu haben.
A. Endler berichtete von einer Schaffenseuphorie, die anläßlich des VI. Parlaments der FDJ in Rostock ausgebrochen war: 40 Meter Gedichte, Prosa, Skizzen, Karikaturen. Die Ursache: Es war uns gelungen, die Delegierten zum Dichten zu verführen! Die lapidare Aufforderung:
Gedichte schreiben, wie man sieht, ist nicht schwer.
…
Wir fordern Euch auf: Bitte sehr,
fangt an
Die zahlreichen poetischen Versuche der Delegierten bevorzugten… hymnische Töne. Zwischen Dichtern und dichtenden Delegierten kam es bald zu einer kameradschaftlichen Zusammenarbeit… Wenn ein Talent spürbar wurde, setzte sich ein Mitarbeiter der Jungen Kunst mit dem Kollegen zusammen und zeigte ihm, wie man Verse baut, wie man sie schön macht:
Schwarzrotgold ist auch die Fahne
im westlichen Teil unseres Vaterlands.
Unsre ist rein.
Wir laden alle Menschen in Westdeutschland
zum friedlichen Wettbewerb ein.
So werden wir die Sieger
über die Brandstifter sein.
Das war politischer Schwachsinn, und dafür gab es den Orden Für Reimeslust.16
Man könnte das alles unter Ulk und Spaß verbuchen, wenn man übersähe, daß hier die künftigen (auch: Kultur-)Funktionäre Niveauprägungen erhielten. In wenigen Jahren würden sie in Schulen, Betrieben, Brigaden, Verlagen Zensuren auch in literarischen Belangen erteilen. Es waren die Rezipienten und Rezensenten von morgen. Man hatte ihre Unwissenheit mit bornierter Arroganz ausgestattet, die sich bald auf den Funktionärsstühlen wiederfinden würde. Es war der Kreis, der künftig jede literarische Kreativität, die über Mittelmaß hinausführte, mit Mißtrauen beobachten würde. Es war die Generation der Stasioffiziere, die nach der Biermann-Ausweisung in den endsiebziger Jahren die Literatur und die Literaten observieren würde. Es waren die künftigen Deutschlehrer und Bibliothekare. Sie werden ihre Schüler wiederum zur Schnellreimerei verführen und ihnen einreden, daß da ein Weg zur Poesie langgehe; oder sie werden die Anschaffungslisten der Betriebsbibliotheken entsprechend zusammenstellen und die Buchbestände nach ihrem eigenen Minimalanspruch durchsäubern. Und schließlich werden aus dieser FDJ-Generation auch Autoren nachstoßen…
A. Endlers Bruch aber war hart, endgültig und bedingungslos. Sein Gedichtband Das Sandkorn, der sich als Sand im Getriebe verstand und mit mancherlei ironisch-höhnischer Abrechnung aufwartete, war 1974 mittels offizieller Nichtbeachtung so gut wie totgeschwiegen worden. Daß dann, 1981, seine Akte Endler (sic!)
überhaupt erschienen ist, gehört zu den Wundern, die man hin und wieder im Ländchen erlebt, Wunder, die selbstverständlich die Mitwirkung risikofreudiger Lektoren voraussetzen, wie es sie hier und da eben auch noch gibt.17
Schließlich siedelte er in den achtziger Jahren als Tarzan vom Prenzlauer Berg in einem Hinterhof, fraternisierte sich mit jungen Szene-Dichtern, wurde ihr Mentor, wie er in den sechziger Jahren zum Geburtshelfer und Mentor der innovativen sächsischen Dichterschule geworden war und sie gegen alle Angriffe und Verleumdungen unter seine Fittiche genommen hatte.
Nun Outcast und Ripper vom Prenzlberg, wurde er streng observiert.
Immer ausgeprägter das Gefühl, in einem Psycho-Thriller mitzuwirken, und zwar in der Hauptrolle, als Objekt, als Fliege im Spinnennetz.18
Und voller Bitterhohn – einer Gaunerzinke nicht unähnlich, Droh- und Warnformel gleichermaßen – pinnte er an seine Wohnungstür:
ADOLF ENDLER
MITGLIED DES INTERNATIONALEN P.E.N.,
A WORLDS ASSOCIATION OF WRITERS
P.E.N.-ZENTRUM DER DDR:
1080 BERLIN, FRIEDRICHSTRASSE 194–199.19
Und er betreute den körperlich und geistig immer hinfälliger werdenden E. Arendt in dessen letzten Lebensjahren seit den illegalen Wohnungslesungen, die bei E. Arendt in der Raumerstraße um 1976 ihren Anfang genommen hatten. Gefragt, warum E. Endler seinen Kiez und Krähwinkel nicht in Richtung Westen verlassen wolle wie so viele seiner jüngeren Dichterkollegen, antwortete er:
Nenne mir, bitte, den Weltwinkel, welcher der genießenden Lust am Zerfall und an geistiger Selbstzermatschung so viel zu bieten hat im Augenblick wie dieser mitsamt seinen Eselsohren sowie Trauerrand! So etwas gibt man nicht leichtfertig auf…20
Heute ist A. Endler ein wichtiger Zeitzeuge der DDR-(Literatur-)Geschichte, der seit seinem frühen Sündenfall über eine Katharsis der Erkenntnis in den frühen sechziger Jahren zur Oppositions- und schließlich zur alternativen Kultur gehört und den Abgang der DDR-Administration voller Bewußtsein mitbewegt hat.
(…)
Edwin Kratschmer: Dichter · Diener · Dissidenten. Sündenfall der DDR-Lyrik, Universitätsverlag – Druckhaus Mayer GmbH Jena, 1995
Dichter Endler
I
Immer sind die Römer da. Sie schreiten durch den Tag, klirrend, gelassen, hochmütig, gelangweilt, und sie stoßen den Fuß mit den Beinschienen in den Boden, als wollten sie die Erde durchtreten. Wenn unsere Köpfe an der Erde lägen, würden sie mit derselben Kälte über unsere Köpfe schreiten und den Fuß um nichts höher heben oder den Schritt weitersetzen.
Ich weiß, die Römer verachten uns so sehr, daß sie uns nicht einmal unsere Götter nehmen – oder unseren Gott. Denn wir behaupten, den einen und den alleinigen Gott zu haben. Da aber die Römer sehen, daß Streit ist zwischen uns über Fragen dieses Gottes, den wir nicht nennen dürfen; Streit, ob die Toten tot sind oder wiederkehren; Streit, ob sie noch im Tod leben; Streit, wie sie nach dem Tod leben, wenn sie leben; Streit über Hölle und den Schoß des Abraham, als das Zurückkehren alles dessen, was einen Blutes ist, in den Urquell dieses Blutes: – so sehen die Römer zu und lächeln spöttisch über dies Volk.
Sie denken, dies Volk ist wie alle Völker, über die wir unsere Legionen decken. Da es seinen Gott zerspaltet und seine Einheit spaltet um dieser Spaltungen willen, hat es viele Götter und ist ungefährlich. Denn das einzige Volk, das nur einen Gott hat, ist das der Römer. Ihr Gott ist das Eisen, (…) Wille und Eisen, und sie beuten aus, indem sie verwalten. –
Immer sehe ich die Römer. Und wenn wir uns auch die Augen verbinden und gegen Steine oder gegen ihre Schilde rennen, um die Verhaßten nicht zu sehen, so sind sie doch da – nur wir sind nicht da! Denn es ist der Haß die Macht der Machtlosen, das Mark der Marklosen. (…)
Ich hasse die Römer nicht.
Dies sind nicht Worte des wohlbekannten Adolf Endler sondern des unbekannten, des in beinahe vollständige Vergessenheit geratenen Paul Gurk. Die Einleitung wird Sie um so mehr befremden, als Gurks dem Judas Ischariot in den Mund gelegte Sätze (mit ihnen beginnt der Roman Judas) in der Abweisung des Hasses gipfeln. Endler dagegen will ihn. Aus dem Gedicht „Bald stürz ich“ schreit es:
meine Heizung: der Haß!
Überhaupt kann es nicht verwundern, daß Endlers Dichtung fratzenhaft, aggressiv, siedend genannt worden ist. Tatsächlich scheint ihr Tonfall nicht mit Tönung zu tun zu haben, sondern mit Fall, Wasserfall, mit Kaskadischem. Diese Gedichte sind nicht aus Stille gemacht – wie E. in scharfer Gegensetzung zu einem von breiten Leserkreisen favorisierten Lyrikband, Ich mach ein Lied aus Stille, betont –, sondern aus Grelle. Dies sind geläufige Attribute: schmerzend, glühend, brennend, gleißend. Selbst dort noch, wo die Sprachgebilde mit vertracktem Hintersinn daherkommen, sind sie schrill; noch das kauzigste Gekicher sirrt von tätlichem Ungestüm. Man kann sich A. E. gut seine Gedichte vortragend vorstellen: spitze Geste in den kleinen Armen, über ihnen der wirrhaarige Bakuninkopf weit vorn. Und aus dem schnellt die Stimme präzis, in diskantischer Zuschärfung.
Rosa und Beige kommen wieder in Mode? / Wie ich euch hasse mit Hirn und mit Hode, verlautbart das Gedicht „Absage“. Und tatsächlich sind sie Endlers Farben nicht, ebensowenig wie Umbra, Ocker oder – so jedenfalls scheint es – das Rembrandtsche Gold. Selbst in einem benehmend klagenden, gewiß am äußersten Rand des Lebens geschriebenen Gedicht („Elegie“) sind es frenetische Farben, aus denen und in die das fragile Gehäuse eines zeitgenössischen fassungslosen Hieronymus wegblaßt:
Lila, Giftgrün, Stahlblau, Schlohweiß.
Also, Endlers Dichtung scheint von schneidender Einhelligkeit. Und das Feuer, das hinter ihr lohen muß, ist nicht von der bengalischen Art – beispielsweise das Titelgedicht eines der wesentlichsten Gedichtbände der an wesentlicher DDR-Lyrik reichen siebziger Jahre zeigt es, Das Sandkorn. Dieses zerstörungsgierige Partikel durchwandert nichts Geringer gefügtes als den Staat. Dem könnte angst und bange werden:
Dein Kinn, o Imperator, Kleinbürger, fällt zur Brust.
Ich bin sadistisch, Bruder, und quäle dich mit Lust.
(…)
Ministerien, Magistrate, Theaterintendanz –
Ich find durch jede Türe, auch eiserne, ich kanns!,
(…)
Witz kritzelt glitzernd spritzend, Schmerz schlitzt dich auf, ein Blitz,
Gekicher, „O Erbarmen!“, ringsum vieltausendspitz –
Etage um Etage durchwandre ich den Staat;
Dich trifft es heut, wen morgen, mein leises Attentat?
Das ist blanker Aufruhr. Und wohl nur derjenige Staat wird ob solcher Verse die Gelassenheit nicht einbüßen, der auf sein berühmtes Absterben selber hinarbeitet. Diesen Staat erinnert, in Marxens Gefolge, Endler. (Oder er erinnert den Staat an diese Hinarbeit.) Ja, zwecks Anregung unseres Appetits setzt er die Utopie als verwirklicht:
Mein Ohr umsummt ein Sandkorn, so müde wie der Wind,
Der Wind wird mild, das Sandkorn summt lieblich wie ein Kind.
O wunderbare Flaute!
Was satanisch losgefuhrwerkt hatte – gewissermaßen im Vorgefühl von solchem tollen Glück ergeht es sich nun, durchheitert.
Das ist eigentlich unendlerisch und verwundert. Aber alsbald gerät man wieder ins Tosen. Es ist geradezu ein Blizzard von Wörtern mit der denkbar schrillen Lautgruppe RI, der im Gedicht „Für Edgar“ gegen diesen entfesselt wird, gegen den Sommerhausbesitzer, den Verächter meiner Reime, das Superschwein:
Geheime Schicksalssilbe RI, wen macht sie wild?
Wer, wenn er solch ein RI hört, schwankt, ja, wird zerknittert?
Jetzt wißt Ihrs: Edgar
dem Schwärzestes widerfahren kann dank der Silbe:
Ein Herzinfarkt vielleicht, Koliken – RI, RIff, RItze!
RI ist die Silbe, RI, die Edgars Alptraum nährt,
RI, Schwert des Damokles, RI, flinken Giftpfeils Spitze…
Ha! RIs in „pRIma hingetRImmt“ und TRictrac, hi!
RIesengebirges RI, ho, dies besonders fette!
Das RI aus Radebeul, Kara Ben Nemsis RIh!
RI in TRIstesse!, in TRIp, TRImalchio, TRIolette!
Ha! TRIpper, kombiniert mit hoch gRIppösem GRInd!
Ha! TRIllerpfeife eines Bobby, stRIkt, im ThRIller!
(Im KRIppenspiel der ChRIsten RIts gleich lindem Wind –)
Die vielen RIS im Lebenswerk von FRIedRIch Schiller!
Spätestens jetzt werde ich unsicher. Ist hier nicht ein martialischer Ulk angezettelt? Als das RI tolldreist zum Tätigkeitswort hochkatapultierr wird (es RIt], eben da wird dieses Verb lindem Wind verglichen. Und ist der Satz von den vielen RIs im Lebenswerk des Dichters der „Bürgschaft“ ernst gemeint? Zumal im weiteren der Endlern ganz ferne RIlke in die Klangekstase einkommt:
RI in Radieschen – nein, nun dies gerade nicht! –,
In Kaßler RIppenspeer, Rainer MaRIa RIlke!…
Hier kann man sichergehen, daß Edgar sich erbRIcht
(…)
Und RIndfleisch, RIesling, Pudding schRIll nach draußen würgt.
Rainer MaRIa RIlke!!! – muß ihn niederrammen
Wen? Den Edgar. Doch aus dem ist unter der Hand Eddy geworden (wie Endler von Freunden genannt wird); Sarkasmus hat sich in Ironie gekehrt, Selbstironie, und die wilde Tirade in müdweise Selbstbezichtigung. Aus ist es mit der eingangs vermeinten blitzenden Einhelligkeit. Der Wirbelsturm hatte uns in dessen Auge gesogen, und was man in dem sieht, heißt: Schmähung der Schmähschrift. Hier edler Freund, da Feind Superschwein – dies Polarisieren ist als Kinderei abgetan. Purer Feind ist Fiktion, er siedelt immer auch in der eigenen Brust. Die haßt man ungern. Und so scheint es, als sei es nicht Haß allein oder überhaupt nicht der Haß, der diese Dichtung heizt. Wir sollten nicht allzu überrascht sein, stellte sich heraus, daß ihr, dieser Dichtung, der Gurksche Satz vom Haß als dem Mark der Marklosen nahesteht. Beim Hasse sich nicht aufzuhalten heißt wirkliche Kraft entwickeln.
II
Endler ist Lyriker, (autodidaktischer) Literaturwissenschaftler (siehe sein Vorwort zum Buch Georgische Poesie aus acht Jahrhunderten) und Nachdichter (einer der Handvoll herausragender in unserem Land, spätestens Rainer Kirschs außerordentlicher Essay Das Wort und seine Strahlung belegt es). Mit Karl Mickel stellte er 1966 die gültige und eben deshalb zur Aktualisierung herausfordernde Anthologie von DDR-Gedichten In diesem besseren Land zusammen, zunehmend verschreibt er sich der Prosa (wie mittlerweile Zwei Versuche über Georgien zu erzählen [1976] und das bissige Glossenbüchlein Nadelkissen [1980] bezeugen).
Kaum mehr überschaubar ist die Reihe von Endlers Rezensionen und Essays zur Dichtung. Um wie Vieles weniger wüßten wir ohne sie über unsere lebenden großen Alten, Arendt und Tkaczyk. Und kennten wir die Gedichte Inge Müllers, und wann hätte sich, ohne Endler, das Werk Uwe Greßmanns erschlossen? Schon gar nicht kennte man den Namen Paul Gurks. A. E., der dem (wie er berlinsüchtigen) Mann ein Gedicht gewidmet hat, scheint der einzige im Lande, der wenigstens zu Teilen mit dessen umfänglichem Werk vertraut ist. Gurk: 1880 in Frankfurt/Oder geboren, gestorben 1953 in Berlin, vor allem Prosaist, stirnersch-anarchistische Sicht auf die Novemberrevolution; 1921 Kleistpreis für ein Müntzer-Drama; während des Nazismus innere Emigration. Nichts fällt dem Vergessen grundlos anheim, doch etwa die eingangs zitierte Passage aus dem Jahre 1931 sollten wir bewahren: Sehe ich recht, so beklagt einer das Heraufziehen des Faschismus; die Spaltung der deutschen Arbeiterschaft ist bitter vorempfunden.
Doch zurück zu Endlers Essays: Sie haben unsere Lyriklandschaft nicht nur ausgeleuchtet, sondern gemodelt. Der Dichtung der heute 30- bis 40jährigen haben sie durch Bewußtmachung von deren innersten Antrieben und zähes Drängen auf welthaltige Tiefenschärfe in einer Weise auf den Weg geholfen, die diese Arbeiten nicht ihrem Wesen, wohl aber ihrer Wirkung nach dem theoretischen Œuvre Georg Maurers zur Seite stellt.
Eine dieser Schriften, 1971 von Sinn und Form veröffentlicht, sorgte für Aufsehen. Endler brach in ihr, krachend, eine Debatte vom Zaun über die willfährige Verklemmtheit einiger Germanistik, die, statt durch Kunst hindurch die Welt zu sichten, diese – die Welt – kennen zu müssen meinte und unmißverständlich auf die Abspiegelung dieser ihrer kalokagathisch versüßten Sicht pochte. Ihre Prallhärte bezog diese Streitschrift aus der Überspitzung; es muß wohl übertreiben, wer vorantreiben will. Und Endler, fern jeglicher Elfenbeintürme, will das. Seine Verse (so befindet das schon erwähnte Gedicht „Bald stürz ich“) soll’n beißen, und nicht ungezielt um sich, sondern Eure säuischen Seelen wund! Das Gedicht „Läusesuchen“ scheint geradenwegs zu wachsen aus brandrot lodernder, grausamer Lust: Ich knack! Offenbar zu Unrecht war vorhin die Verve Endlerischer Verse in Frage gestellt.
Ich streck die Zunge meine Finger anzufeuchten.
Du setzt dich unter hellste Lampen, senkst den Kopf.
Ich faß die güldne Spange, zieh sie aus dem Zopf.
Das Licht entrollt dein Haar und läßt es brandort leuchten.
Ich such nach deinen Läusen, streichelnd deine Wange,
Im schmalen Strich des Scheitels hinterm Muschelohr.
Ich fang, zerknack sie, wink sie scharenweis hervor
Mit feuchten Fingernägeln; zwei sind eine Zange.
Wie schön, wie herzschlagstockend schön: Nach Läusen suchen!
Du zeigst den heiligen Hals, als würdest du gehenkt.
Du wirst begnadigt. Ich, der Henker, abgelenkt,
Fang deine Läuse wie Rosinen aus dem Kuchen.
Ich zähle dreizehn, zweiundzwanzig, fünfunddreißig,
Und du zählst hitzig mit und fragst: Schon wieder drei?
Ich zähl die Laus, das Läusekind, das Läuseei.
Die schlimme Zählwut macht mich grausamer und fleißig.
Ich such nach deinen Läusen, ach, wo ist die eine,
Die letzte listigste der großen Läusebrut?
Dein rotes Haar erglänzt wie viele Tropfen Blut.
Ja, deine Läuse fing ich dir. Jetzt fängst du meine.
Wahrhaftig lausige Zeiten sind angezeigt, man kann an die Jahre gegen Kriegsende denken. Das sanfte Herbeibiegen eines Halses assoziiert das Henkbeil leicht, beinahe von selber. Wie von anderer Welt nehmen sich da die glückhaften Gesten geborgener Zweisamkeit aus: das Streicheln der Wange, das Lösen des Haars und eben jenes Befreien vom Getier.
Aber geschieht dies nicht tatsächlich in einer anderen Welt: derjenigen seltsam unwirklicher hellster Lampen? Die güldene Spange – weist sie nicht auf Märchenhaftes? Das Läusesuchen ist ein Wunschtraum.
Doch wirklich ist es auch: Wir sehen das ja vor sich gehen zwischen feuchten Fingernägeln, unter hitzigem gemeinsamem Zählen. Wir atmen also auf.
Und in gleichem Atem erschrecken wir. Ich, der Henker, jetzt lediglich abgelenkt – dies wird nicht einfach so daherparliert. Was ein nichts als lichtes, ein schönes Paradoxon zu sein schien, nämlich ein winziges Blutbad einrichten zu müssen, um einander aus blutigen Zeiten zu ziehen, das irrlichtert plötzlich herzschlagstockend schön: Leicht, beinahe von selber hätten die beiden einander Opfer sein können. Es ist, als seien die Verhältnisse, deren fingergreiflicher Relikte sich zwei Betroffene soeben entledigen, von diesen Betroffenen auch herbeigeführt. Oder hätten von ihnen doch herbeigeführt werden können. Und das Läuseknacken ist das klare Beenden von Schlimmem sowie dessen unklare Verlängerung.
So irisiert am Grund dieses Gedichts Freiwerdung u n d Verschuldung. Der Glanz der vielen Tropfen Blut, in dem wir das von Blutsaugern freie Haar schließlich sehen, changiert von Vermenschlichung und Gefährdung (und das Sprachgebilde greift staunenmachend über den staunenmachenden Vorwurf, Rimbauds „Läusesucherinnen“, hinaus).
In solche Vielschichtigkeit eingeführt, lese ich nun manches andere Gebilde anders. Etwa das „Gedenken an zwei Stammgäste“ überschriebene. Einer vom Stammtisch berichtet die Ermordung eines Skatbruders, des Geschäftsmannes Betz. Dessen Ehefrau hat ihn erschlagen, obwohl Betz sie mochte. Geschäftstüchtig wie keine zweite!, so hatte er sie gelobt, ohne sie wär ich lange schon pleite! Die Seele des ganzen Geschäfts! Einwandfrei! Daneben, was bin ich?
Ein betulicher Ehemann, der keinem – und schon gar nicht seiner Frau – ein Leids antat. Die Frau muß also eine Bestie sein, die Tat geschuldet einem schon physiologischen Hirnversagen. Denn:
zackklack schlug sie zu mit dem Beil,
Als teilte sie nicht den Schädel von Betz,
Als zerkleinerte sie nur eins der Briketts,
Als spaltete sie ein paar Scheite…
Hier die Furie, dort der Gemütsmensch. Himmelschreiendes irrationales Unrecht geschieht. So empfinde ich, zunächst. Doch an der Abscheu gegen die Delinquentin vorbei spüre ich alsbald Mitleid ob ihres ungelebten Lebens. Gehuldigt wurde ihr durch die Bestätigung, sie biete keinen Anlaß für Einwände. Und nicht die Frau war gepriesen, sondern die Geschäftsfrau. Daß sie, wie man so sagt, der Rappel packt angesichts solch eines Partners (und seiner Kompagnons) und angesichts ihrer, der Frau, Willfährigkeit – das beginnt mir einzuleuchten. Das Greuel erhält etwas von einer Befreiungstat. Das Gedicht, indem es mithin Widerstrebendes gibt, gibt zu denken auf. Die Motive für Untat und Tatlosigkeit, nur scheinbar kraß voneinander unterschieden, müssen außerhalb der Tischrunde liegen.
III
Endler ist 1930 geboren, nahe Düsseldorf, und die Gegend seiner Kindheit umgibt allerlei Industrie. Früh erfährt er, wohin er, anders als sein kleinunternehmender Vater, gehört: zu jenen, die aufbrechen werden zum roten der Stürme. 1955 siedelt er in die DDR über, getrieben von Repressalien gegen den Linken und angezogen durch die Arbeit (zusammen mit Gerd Semmer) an einer Anthologie deutscher Gegenwartsprosa, die beim Aufbau-Verlag erscheinen sollte, sowie durch ein Studium am Leipziger Literatur-Institut. Hernach ist er an der Trockenlegung des Landstrichs Wische beteiligt, und es sind nicht unwirsch absolvierte Stippvisiten, aus denen seine Mitteilungen aus der Produktion kommen: chronistische Texte, die hinterm individuellen Lebenswandel den Wandel gemeinschaftlicheren Lebens ahnen lassen und nebenher Einblicke in das Werden Endlerschen Kunstverstands bieten. Den aufschauenden, auch formal schütteren ,„Winterlichen Notizen“ (1957) eines noch Außenstehenden folgen Anfang der sechziger Jahre handfeste Gebilde wie „Transportarbeiter“, die möglicherweise von Fühmanns Märchen-Ergründungen beeinflußte „Phantasie auf dem Schlackeplatz“ und „Nachts im Schwefel“, ohne die das scheinbar periphere „Damals die Balkone“ (1974), dieses gedrungene, prangend plebejische Stück, schwerlich hätte entstehen können. Ich lese den Text ohne weiteren Kommentar vor, einfach seiner Schönheit wegen:
Sonntags waren rotgesichtige Frauen
Pausenlos zu Gang in den Genisten
Ärmel aufgekrempelt und die Schlauen
Offne Blusen über ihren Brüsten
Ächzend da sie wild die Wäsche wrangen
Und gekrümmt als wärn sie so geboren
In den Hof wie hoch vom Himmel sprangen
Schwere Tropfen warm um unsre Ohren
Klatschend wehte dann und schlug die feuchte
Wäsche im Balkon nach aller Regel
Leuchte Wäsche der Proleten leuchte
Handtuch Hemd und Bett geblähtes Segel
Sehr nahe in ihrer selbstsicheren unangestrengten Kraftentfaltung diese Verse (aus dem Gedicht „Nachtschicht“): unsre fünferlei Schritte / Sind der Geräusche Kern, deren herrschende Mitte: auch dort noch, wo sie unhörbar sind, d.h. überall. Sie sind der Kern – heißt dies – allen Geschehens, mithin der Geschichte.
Sind diese Worte vom Kern aber aus dem Kern von Endlers Dichtung? Ich meine: ja. Freilich will besagte Souveränität in einem Gedicht wie „Laubenpieperfriedhof“ erst entdeckt sein:
Wenn wir hier sterben, haben wir es nah,
Noch weniger weit als bis zur S-Bahnstrecke,
Wir haben es bequem, Sie, wirklich, ja,
Kurz durch den Wald und einmal um die Ecke.
So sauber wie die Laubenkolonie
Die Gräber dort, gepflegt wie hier die Beete –
Ja, unser alter Friedhof! Wissen Sie,
Man zieht ganz einfach um – wie Wallners Grete
Vor einem Monat –, in den Wald hinein
heißt es in diesem Gebilde; und man hört kleinkarierte Zufriedenheit heraus. Kein Begehren, kein Aufbegehren. Leichtherzige Abgefundenheit mit dem Tod. Ich stelle mir vor, ein hutzliges Männlein hält mir die Ansprache, mit eingefallenem Mund.
Doch gleichzeitig geschieht jenes Man zieht ganz einfach um, und dies – ich formuliere es vielleicht zu riskant – geschieht mit den Schritten jener von der Nachtschicht. Der Tod wird als das Andere, das Aus nicht anerkannt. Er ist Fortsetzung des Lebens, indem er Furcht nicht einflößt. (Mir assoziiert sich des Chinesen Laudse kühner lässiger Satz gegen die Fürsten:
wenn das volk den tod nicht mehr fürchtet
wie wollt ihr es mit dem tod schrecken?
Der aufsässige Lukrez wußte, warum er den Leuten dringlich die Todesangst auszureden suchte.
„Laubenpieperfriedhof“, so scheint mir, handelt also von der Kraft der Niederen, die, auch wenn sie sich in Lethargie äußert, unabsehbar ist. Das verdient gesagt zu werden um so mehr, als Endler eben dieses Gedicht Paul Gurk gewidmet hat. In einer (recht ungelenken) Prosa, „Laubenkolonie Schwanensee“, erzählt Gurk den Untergang einer Gartenanlage vor der expandierenden Großstadt. Der greise „Laubenpieper“ namens Graumann tötet sich, als seine Laube fällt.
Erstaunlich nun, daß Endler das leicht larmoyante Sujet umstülpt. Der harsch-diesseitige Gestus der vorhin zitierten Judas-Passage klingt an. In Graumann irisiert der neutestamentliche Dränger.
IV
Im November 1965 arbeitet Endler das Gedicht „Die abgeschnittene Zunge“:
Dort meine Zunge – ich auf Räderachsen
Gespannt –, die wieder aus der Hand dir schnellt,
Dies zuckende Fetzchen mit der Farb von Lachsen.
Als könnt die Hand ein Mund sein, der sie hält!
(Hand, die nur würgen kann, nur schweigen machen.)
O mit dem Messer sie und mich zu trennen!
Ein Sieg? – Ich siege ohne Kriegsgesang:
Als meine Stimm hör deine Waffenlager brennen.
Ein Etwas, züngelnd, durch die Straßen sprang
Solch spitzes Flämmchen oder blutiges Lachen…
Wenn die abgeschnittene Zunge, dies zuckende Fetzchen, davonschnellt, züngelnd, zündend, ein spitzes Flämmchen oder blutiges Lachen werdend, dann spürt man nebenher, daß Endlers Lyrik weniger, als es scheinen mag, dem Surrealismus nahesteht. Dieser ließ, sozusagen bewußt ordnungswidrig, das Unterbewußte ins Kraut schießen, um aus dem „Dienst einer absurden Ordnung zu treten, die auf Ungleichheit (…) besteht“ (Eluard). So sehr diese Motivation Endler angeht – seine Bilder, auch dort, wo sie phantasmagorisch fluoreszieren, sind nicht rauschgeborene Gegenstücke der Dinge, wohl aber deren, der (freilich wie überhitzten) Dinge, genaue Hervortreibungen: man sieht, optisch, die materielle Gewalt der Lagerbrände aus der springenden Zunge hervorbrechen.
Wichtiger ist die Anmerkung, daß das sieghafte Frohlocken den Schmerz, den das Messer zugefügt hat, nicht unterschlägt. Das Lachen ist blutig. Man ahnt, daß Endlers Dichtung noch manch andere Art des Zungenschlagens mitteilt: lebendigstes zersingendes Hohnlachen u n d dessen Gegenteil, das Sich-bei-Atem-Halten, das Lebenbleiben durch Gesang: ich treib (…) meinen Atem mit Gesang, heißt es im Gedicht „Jessenin 23“. Die Unruhe Endlerschen Sprechens erschöpft durchaus den Doppelsinn des Worts: motorische Seele des Uhrwerks sowie Verstörung. Was Wunder, daß Bewegung in den Gedichten hier gelassen weitgreifend ist, da verwerfend. Ja, einerseits die Sehnsucht nach Ruhe, andererseits die Sehnsucht nach Bewegung:
Und einer steht auf er wittert
Nach fernen lautlosen Blitzen
Er winkt die Richtung ihnen Wir winken
Verzweifelt mit unseren Mützen
wie es im Gedicht „Beim Gräbenziehen in der Wische“ heißt.
Sichtlich fällt es schwer, e i n e n Nerv dieser Dichtung auszumachen. Denn höhnt sie, so desolat; und wo sie zirpt in schalksnärrischer Überdrehung, eben da ist sie schneidend provokant. Wenn Endler schroff anschreit (etwa die Kalten und falschen Seelenvollen in der „Ode auf eine vernachlässigte Sportart“), hört man im Oberton doch den besessen um kommunes Weltbessern einkommenden Moralisten heraus. Man beobachte, welch einander fernstehende Dichter A. E. vornehmlich konsultiert hat: Jarry u n d Theodor Kramer, Chlebnikow u n d Karl Kraus.
Ist es freilich nicht schon deshalb überflüssig, diese Gedichte auf einen Nenner bringen zu wollen, weil das zu Nennende ja ändert? Kunst, eben indem sie im Wirklichen wurzelt, formt sich um unter dessen Umformungen. Auch wenn sie nicht nach dem sogenannten Zeitgeist greift, dem sich ändernden – der hat sie in Beschlag. Und so ist Änderung geradezu der Kunst Gütesiegel. Dies sei vermerkt zumal in Betracht entschlossener Versuche, die Kunst unseres Landes und ihre Brüche zur Reaktion auf das Erlebnis (bzw. Nicht-mehr-Erlebt-haben) des Nazismus wegzuglätten.
Endlers (und seiner Generation) Zentrales ist (oder war) jedoch nicht die Bewältigung dieser Vergangenheit, sondern einer Zukunft, die, scheinbar in greifbarer Nähe, visionär im Oktoberlicht aufgeschienen war. Diese zu aller Anstrengung (und Überanstrengung) verlockende Vision hieß: innerhalb weniger Jahrzehnte sich verschwisternde Menschheit, hieß: marxsche erdumspannende Assoziation Gleicher und Freier. Wohin ging solche (zu) hochgespannte Erwartung über? In Trübsicht, in Klarsicht, ins Bewahren der Herausforderung in wütender Wonne. Es ist ein langer und symptomatischer Weg, den E.s Dichtung durchlaufen hat. Nicht durch 1956 und 1961 scheint der markiert zu sein, wohl aber durch 65, 68 und das schismatische Jahr 1976, das Jahr auch der Berliner Konferenz.
Eines von Endlers Gedichten handelt von dieser Wandlung: die 68 geschriebene „Ballade vom Zionskirchplatz“, die so beginnt:
Vier Freunde waren wir, wir waren Freunde, vier,
Am Zionskirchplatz im Gesträuch im Nieselregen,
Daß keiner, was auch kommt, den andern je verlier,
Acht Hände, die sich aufeinanderlegen –
Der Platz ein Rosenbeet!
Und unvermittelt der entsetzliche Schnitt:
Zwei Freunde sind dahin:
der eine außer Lands, der andre aus dem Leben. So heißt es schließlich steif:
Steif sitzen zwei Genossen nah der Kneipentür,
Stumm, steif, nervös
Und was einem zunächst nicht in den Sinn will, eben wegen der Fremdheit, mit der dies gesagt ist – zu denken ist nahegelegt: Einer der beiden ist Endler!
V
Endlers Gedichtbände – Erwacht ohne Furcht (1960), Die Kinder der Nibelungen (1964), Das Sandkorn (1974), Nackt mit Brille (1975), Verwirrte klare Botschaften (1979) und Akte Endler (1981), eine Bilanz im fünfzigsten Lebensjahr – ermöglichen es, eine vorläufige Summe zu bilden. Das Wesen dieser Dichtung – so meine ich – ist plebejisch, und durchtränkt ist sie vom Nicht-abtun-Können (und damit Wachhalten) uneingelöster großartiger Erwartung. Der sie uns vorlegt, mag aufrührerisch-baudelairescher Kain sein wollen: doch an den wuchtenden Gelenken schimmert, schön in seiner Verwundbarkeit, Abel hervor. Diese Dichtung gibt eher den Hautlosen zu erkennen als den Geharnischten. Bei purer Polemik jedenfalls hält sie sich nicht auf. Das kommt, weil Realismus noch immer über jedwede pappige Antinomie hinausuferte. Und Endler, wie vermutlich jeder wesentliche Künstler, ist – willentlich oder nicht – Realist. Sozialistischer? Der Begriff selber scheint bereits uferlos. Ich jedenfalls sehe kein Gedicht, in dem soziales Eingreifen nicht wenigstens mitschwänge, oder dessen Verhinderung. Die Gebilde, durch welche dieses Schwingen sich einem beinahe unmerklich mitteilt, in leisen, wie zerstreuten Widersprechungen, durchdringend wie Nieselregen – sie scheinen mir von Dauer. Man sollte sich den Genuß nicht versagen, gelegentlich den von brüderlichem Mitgefühl, nicht etwa Spott eingefärbten „Epitaph auf einen Schönfärber“ oder das irritierte Gebilde „Ich zog den Schlitten“ zu lesen, das das landläufige Zauberlehrlingslied entkindlicht und entaristokratisiert. Oder „Grenadierstraße 1966“, von der Unmöglichkeit zu sprechen und der Unmöglichkeit zu schweigen handelnd, oder das rigoros-schüchterne Selbstverhör im Gedenken „An T.“, jene verlangende Liebende, hinter deren Zügen unversehens die der (oder einer?) Mutter nestwarm aufleuchten. Wenn im Gedicht vom sterbenden Freund, „Des Freundes Wettlauf mit dem Schneemann“, das gaunerhaftungeschlachte Wort filzen vergeblich die Tränen zurückhalten soll – ist das nicht herzschlagstockend?
VI
Ich wollte m dieser Dreiviertelstunde Endler ausleuchten. Nicht anleuchten, sondern in ihn hinein. Was herausscheint, ist – so sehr ich mich auch gemüht habe – nicht. Endler, sondern mein Endler. Ich weiß nicht, in welchem Grade mein Bild von ihm das Ihre ist. Allenfalls können wir vereint Endlers Eigendefinition folgen (wie immer wir wiederum diese Definition definieren mögen). Mit jener Portion Eitelkeit, die sich freundlich entgegennehmen läßt, weil ihr, glaub ich, ein Portiönchen Selbstironie untermischt ist, sagt A. E. über seine Dichtung: sie ist endleresk.
Einbegreift dieses Wort die Erschütterung im Vers, der das Herz des Dichters meint und/oder unser Gestirn, vielleicht Leben überhaupt?:
Dies rote erkaltende Kugelherz hier
Einbegreift es die untröstlich-tröstliche Aufstörung angesichts des Hereinsickerns von Kältestem u n d Getautem, also Erwärmtem? Sagte ich angesichts? Das Sehen vergeht in dieser Verstörung, nurmehr gespürt und gehört ist der
FEBRUAR:
I
Die Weltraumkälte sickert ein in meine Haut
2
Ich hör dem Schnee der Erde zu Er taut und taut.
Peter Gosse, in Peter Gosse: Mundwerk. Essays, Mitteldeutscher Verlag 1983
Lebensgroß
Doch wenn ich lach, dann hört es Ninive.
„Hohnlachen“; 1972
1
Keiner im näheren Umkreis hat, um seiner habhaft zu werden, eine so monströse Figur aufgebaut wie Adolf Endler. Am liebsten alle sieben Todsünden auf einmal – zwanzig, fünfundzwanzig, dreißig Jahre, länger:
Ja. mit einundachtzig ist der alternde Belletrist, vorzüglich der einundachtzigjährige Lyriker zujeder Schandtat bereit, auch ohne Biermann zu heißen.
Jetzt ist er siebenundsechzig. „Zigeunergeiger, grund-melancholisch“, Django Reinhardtsch, oder „Mich laß die Rattenschnauze die hier meine hissen“ oder „Tarzan am Prenzlauer Berg“, „Irrer Fürst“ und „Sichdenberghinunterrollenlasser“ – zu klein! Zu klein? „Bubi Blazezak“ am Ende auch? Wird er sich je erreichen?
2
Die Ausgangslage war denkbar ungünstig. Kriege und Revolutionen nicht mitgemacht, keine Lagerhaft, keine Resistance, kein lateinamerikanisches Exil. Und statt der Stalinschen Großbauten des Kommunismus mit ihren Millionen rohrlegender, wüstenbewässernder Häftlinge, statt Maos Großem Sprung, statt Klima verändern und ein Milliardenvolk satt machen nur diese trockengelegte Wische, 350 Quadratkilometer altmärkischer Niederung – ein rüstiger Wanderer umkreist sie leicht in ein, zwei Tagen. Schilda läßt grüßen, die Lalen proben die Weltverbesserung. Wie soll da einer sich erreichen!
Da ficht kein „Erzkujon“ mit dir den „wüsten Zweikampf ohne Ende“ wie mit Endre Ady:
Wir kämpfen seit Babylons Zeiten
[…]
Seitdem ist Erzkujon mein Vater,
Mein Gott, mein Kaiser und Kumpan.
Da tastet sich kein „Emgión“. Gunnar Ekelöfs kurdischer Grenzfürst, „Hund genannt von Römern wie Seldschuken“, geblendet durch die Welt zwischen Orient und Okzident – und saß doch einst „auf einem Hengst aus Shammar-Geblüt mit einem Stammbaum zurück bis in die Zeit des Propheten“. Kein Gedanke an die blasphemischen Wildheiten der Russen: an Majakowskis Schreimaul Zarathustra, an Bloks Christus unter der roten Fahne, an Jessenins Rebellen Pugatschow, der – „Tamerlans Schatten“ – vor die Tore Moskaus tritt. Kein Eurasien zur Verfügung, keine zwei Amerikas, nicht einmal das eigene Land ganz.
3
Doch da war eine Chance. Es gab ein mächtiges Terrain, das so gut wie unbesetzt geblieben war, obwohl es ständig von jedermann durchquert werden mußte. Eine unheimliche Gegend zweifellos, die man lieber verließ als betrat. Niemandsland so gut wie öffentlicher Ort. Daß es hier nicht geheuer war, hing mit der Energiekonzentration zusammen, die jeden unvorsichtigen Schritt tödlich enden lassen konnte. Es war das Terrain des Kalten Krieges. Dieses Terrain mit seinen phantasmagorischen Organen und Nomenklaturen, mit seinem Sprachgebaren, Brauchtum und exzessivem Registraturwesen, dieses Pandämonium unseres Jahrhunderts hat Adolf Endler mit immer subtileren Methoden systematisch erkundet, beschrieben und – rekultiviert. Hier hat er seine monströse Selbst- und Weltbemächtigungsfigur angesiedelt. Sie agiert nirgends anders als auf dem ehemaligen Terrain des Kalten Krieges: Sie bannt die Dämonen. Wann die Sondierung dieses Terrains für den Aufbau der Figur begann, wird nur annähernd festzustellen sein. Immer sind es minimale semantische Verschiebungen, feinste Änderungen in den sprachlichen Mischungsverhältnissen, die das neue Unternehmen vorbereiten. Kein Kalkül am Anfang, eher ein Unbehagen. Daß er sich nur lachend sicher auf dem explosiven Terrain bewegen könne und lachend Freiheit (Lebensgröße?) gewinnen, dürfte den Dichter nicht überrascht haben. Mochte ihm 1961, als Schilda sich wie eine asiatische Despotie gebärdete und eine Mauer zwischen sich und die Welt setzte, das Lachen noch im Halse steckengeblieben sein – lange kann es nicht mehr gedauert haben, bis es sich zu dem Gelächter erhob, dem als Ohr nur Ninive genügte – die versunkene Hauptstadt der Welt, einst Stätte chaldäischer Weisheit, des Propheten Nahum mörderische Stadt, der ihre mächtige Mauer nichts genutzt hatte.
Eingeflogen dieser schlüsselfertige Delikat-Text mit unserem gelblichen Militärhubschrauber X34Strich80Strich30 am zwanzigsten Neunten dem Geburtstag Eddi ,P‘ Endlers aus Anlaß des siebenjährigen Jubiläums eines im Wettbewerb SCHÖNER UNSERE STÄDTE UND GEMEINDEN zwischen den Zähnen zu feinem Goldstaub zermahlenen fettaugenreichen Geheimnisverrats (Es meldete der Oberkommandierende Gefreiter André Breton bitte Uhrenvergleich).21
Fritz Mierau, aus Gerrit-Jan Berendse (Hrsg.): KrⒶwarnewall, Reclam Verlag Leipzig, 1997
AUFSTOSSER
für Endler
Am 13. August 87, im 26. Jahr neuer Sicherheiten unternahm Lektor he vom Mitteldeutschen Verlage den nicht gänzlich gedeckten Versuch mit der Linie elf (11 Fritz-Austel-Street, Devills lake, on the first floor) Eddy Pferdefuß Endler, PEN – DDR, ihn resch überrennend, ohne Dienstauftrag und Vorwarnung zur Aschenputtelei zu verleiten: Ins Töpfchen die schönen Nachdichtungen, so unverfänglich wie Okudshawa, Bedny, Petrarca und ordentlich grundgrammatisch steinzeitliche Debatten. Eitrige Seesäcke aber, Hausbuchkanibalismus wie andere Faulfrüchte auch in Rote Hälse jenseits der Mauer zu spucken. // Zurück nach Caffee a la turca und Karo passiv (er bot keine an) mit der Linie 22, also verdoppelt, mit steigendem Mütchen übern Hauptbahnhof stößt he auf, was der Verleger sieghaft gesagt hätte: SÄUBERLICH TRENNEN, HEISST DAS NICHT REDLICH ZUSAMMENHALTEN?! // und während ich’s aufschreib, reimgeschüttelt, verspätet in deutscher Mitropa, das Jubiläumspils schweppert: 750 Jahre Hauptstadt der DDR! faßt mich ein Raupenschlepper (Dgr. Major) von VEB Knast ins stählerne Auge: Sicher ist sicher. Gelle, Herr Endler?
Hinnerk Einhorn
PROTOKOLL EINER REISE
Für Adolf Endler
Wo sich der Bahnsteig verliert unterm Himmel
Stand unser Wagen Wir hatten Transitschecks
Die Bettkarten stimmten Der Schaffner
Trug eine Jacke mit Litzen die schwarz war
Er stand im Dienst der Sowjetischen Staatsbahn
Dann kam er in unser Abteil brachte uns Tee
Er trug eine Jacke die weiß war Später
Tauschte er diese in eine braune da
War er beim Zoll Wir verlosten die Plätze Der Zug
Setzte sich langsam in Fahrt Märkische Wälder
Später das Bruch die polnische Grenze Die
Lokomotiven wurden gewechselt Hüben und drüben
Beamte in grünen Monturen Wir merkten
Polen ist flach vorzüglich dort wo wir fuhren
Viel Wasser vor Warschau Niederungsland.
Überschwemmtes Gelände jährlich
Mindestens zweimal E. las Theodor Kramer ich
Erheiterte mich an H.s Memoiren Warschau
Vom Zug aus war eine Postkarte wert
Der Bahnhof hieß Gdanska Es wurde
Sehr heiß im Abteil doch der Schaffner
In weißer Jacke bedeutete uns daß die Fenster
Wegen der Kälte auf keinen Fall
Geöffnet werden dürften Wir schwiegen
Die Landschaft war immer noch flach
Vereinzelte Hütten Kaum Industrie Auf den Bahnsteigen
Die Bauern sahn aus wie bei Roth Die Dunkelheit
Schluckte das Land Unsere Pässe
Reichten wir schlaftrunken aus unsern Betten Im Nebenabteil
Der alte Franzose sah aus wie Gabin Die Schritte
Der Posten knirschten vor unserem Fenster Terespol
Letzte Station auf polnischem Boden Abermals
Wurde die Lokomotive gewechselt Eine Diesellok
Zog uns über den Bug In Brest
Standen wir mehrere Stunden Wer wollte
Konnte den Zug jetzt verlassen Wir hörten
Metallenes Klopfen Jetzt sagte einer jetzt
Spuren sie um Wir gingen über den Bahnsteig
Beschienen von einigen kugligen Lampen Palmen
Träumten im Wartesaal Tschaikowskis
Italienischen Frühling Der Alkoholausschank
Hatte geschlossen Zwei Eisenbahner
Flaschen in Zeitungspapier unterm Arm wurden sehr schnell
Von Milizionären den Augen
Neugieriger Touristen entfernt (Jagd in den Wäldern
Von Bialostok) Der Geldwechsel (Change)
War noch geöffnet Wir tauschten
Einige Mark DNB gegen Rubel Westmark
Hatten wir nicht desgleichen Pfunde Dollars Francs und andre
Begehrliche Währung Erst zwischen Minsk und Mochaisk
Wurde es Tag doch völlig dunkel
War es übrigens niemals Der Schnee
Nahm zu Wir fuhren an zerschossenen Mauern vorbei Unter dem Schnee
Ahnten wir noch die Reste zerschossener Panzer
Was Einbildung war Doch die Namen
Vieler Stationen saßen wie Kletten unter der Kopfhaut
Als hätten wir gestern
Die Wehrmachtsberichte gehört Der Tag
Verlor sich im Klopfen der Räder Stationen
Rasten vorbei Die Luft
War vom Heulen der Lokomotive erschüttert Der Schaffner
Kassierte den Tee Riesige Feuer
Loderten auf den Perrons Zwischen den Fichten
Sahen wir Datschen Kleinere Städte Dann
Fuhren wir durch eine Kurve dahinter
Der Fluß seine Brücke Die erleuchteten Fenster
Der Metro verschwanden im Tunnel
Wir fuhren die Twerska ja lang Geringes Gefälle Unser Hotel
Lag am Bolschoi Teatr Geruch
Von Wärme und Pelzen Die Brille beschlug
Wir stellten uns Tschechow vor und Isaak Babel aßen
Was Benjamin einstmals beschrieben Mit
hochgeschlagenem Kragen
Die Mütze über den Ohren gingen wir
Übern Manegeplatz besahn uns das GUM bis uns der Frost
Unters Hemd kroch Später
Die Flasche stand auf dem Tisch verbrannten
Sie Kisten im Hof daß die Flammen zu unserem Zimmer-
Fenster emporschlugen Erschrocken
Sagte E. das wäre in Halle nicht möglich Unter der Haut
Spürte ich Blut Vom Parterre
Hörten wir noch den armenischen Jazz
Heinz Czechowski
In der Reihe „Die Jahrzehnte. Das deutsche Gedicht in der 2. Hälfte des XX. Jahrhunderts“ präsentierten Autoren je ein frei gewähltes „fremdes“ und ein eigenes Gedicht aus einem Jahrzehnt. So entstanden Zeitbilder und eine poetologische Materialiensammlung zur Dichtung eines Jahrhunderts. Das Gespräch zwischen Stephan Hermlin, Adolf Endler und Karl Mickel fand 1992 in der Literaturwerkstatt Berlin statt.
Gespräch im LCB am 16.9.2008 zwischen Adolf Endler, Maike Albath, Cornelia Jentzsch und Gerrit-Jan Berendse über Endlers Erfahrung in einem totalitären Staat und seine Vorstellungen von Literatur.
Gerhard Wolf: Die selbsterlittene Geschichte mit dem Lob. Laudatio für Elke Erb und Adolf Endler zum Heinrich-Mann-Preis 1990.
Fakten und Vermutungen zum Autor + Archiv + KLG + IMDb +
Internet Archive + Kalliope
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Galerie Foto Gezett +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + Keystone-SDA +
deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Adolf Endler: FAZ ✝ FR ✝ Die Zeit ✝ Basler Zeitung ✝
Mitteldeutsche Zeitung ✝ Süddeutsche Zeitung ✝ Spiegel ✝
Focus ✝ Märkische Allgemeine ✝ Badische Allgemeine ✝
Die Welt ✝ Deutschlandradio ✝ Berliner Zeitung ✝ die horen ✝
Schreibheft ✝ Partisanen


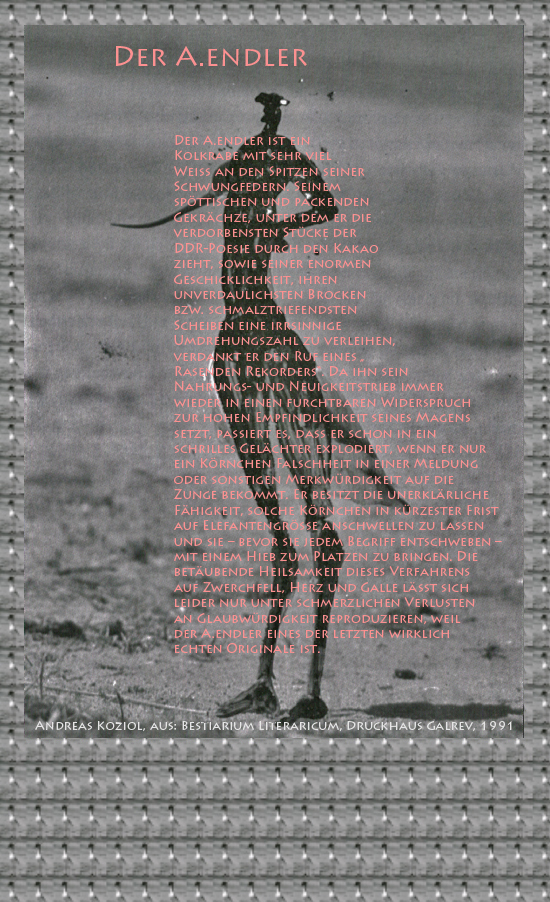
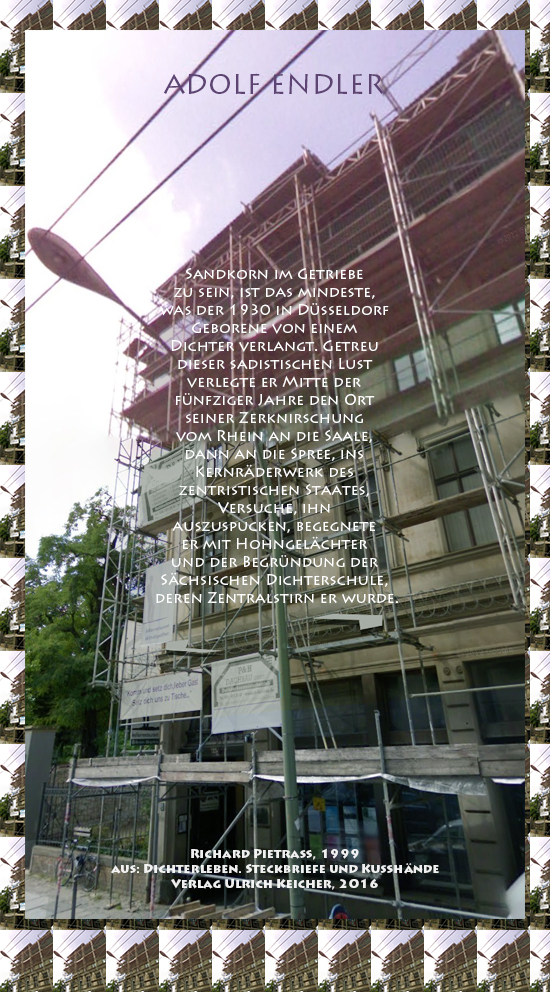












Schreibe einen Kommentar