André Schinkel: Löwenpanneau
IWAN GOLL UND JAMES JOYCE LAUFEN
ANEINANDER VORBEI
Zeitlupenaug’ – hektischer Hiob des europäischen
Schmerzes der andre. Einmal liefen sie
Aneinander vorbei, in Zürich, Paris,
Im unteren Tal der Ardèche, der ungeduldige
Junge voraus, in der Nähe ein Hund.
Der blinde Odysseus, den gelehrte Bitternis
Fraß, der randlose Schatten, den das eigene Blut
Im Innern zehn Jahre nach der ewigen
Blindnis des andern zerriß. In der Grotte
Pech Merle ruht, noch nicht entdeckt, die fehlende
Hand, auf den Rücken des Zossen gespuckt.
Zwei Etrangers der uralten Jagd, zehn Sekunden
Die Blickruder gesenkt, entrückt und verbannt,
Geblendet, verfolgt, in der vorgeschalteten
Welt nur auf Zeit abgestellt.
Weiße Pünktchen
– Adnoten zum Löwenpanneau –
1
Der Kern der im Löwenpanneau vorliegenden Texte entstand im Zeitraum von 1996 bis 2006, einige ältere Fassungen von Gedichten gehen auf 1990, also den Beginn der ,ernsthaften Besessenheit‘, zurück. Während des Prozesses der Zusammenstellung des Buches im Februar 2007 entstanden noch einige Gedichte, sie sind im zweiten und vierten Kapitel eingefügt und korrespondieren bereits mit der Schreibbewegung der Lyrik der Unwetterwarnung, die die Arbeiten der Raniser Zeit sammelt und sichtet. Auf den Umstand ihres Charakters als Zusammenstellung hin besehen, unterscheidet sich die vorliegende Auswahl aus insgesamt 300 Gedichten von den vorhergehenden Lyrikbänden durch ihre nicht-zyklische Gestalt, ist es das erste Mal, daß es mir scheinen will, daß mir die Erfüllung des Tatbestands der Gedichtvereinzelung halbwegs von der Hand gegangen ist. Das Gedicht ist im Urgrund ein Sonderling der magischen Künste, es hat wie wenige andere Handreichungen der Magie sich am Rand zu befinden, im Idealfall kühl und einsam und fern aller überflüssigen Korrespondenz. Das wird nicht immer gelingen, geht doch jedes Produkt des Schreibers durch den einen Kopf, Solarplexus, den Mund; und stellt doch diese Schnittstelle mit der Welt eine erhebliche Fehlerquelle dar. Nicht der einzige störende Faktor beim Auslegen der lyrischen Bändertone, der offensichtlichste wohl, der notwendigste zugleich, und derjenige auch, über den sich neben der künstlerischen Vermessenheit auch Unsicherheit und der tägliche Wahnwitz der Anwesenheit kanalisieren.
2
Das Dilemma des kreativen Individuums spiegelt sich in seiner Zerrissenheit – der Künstler will Fleisch und Luftwesen zugleich sein; und in seinen Anfängen sucht er auch im Ablicht der Kunst nach Sicherheit: weil ihm der Weg noch zu aberwitzig erscheint, der sich ihm aufdrängt, und weil er ahnt, daß es ihm nicht mehr gelingen wird, jenen Weg, wenn es ihm ernst genug ist, zu verlassen. Mich erschreckte diese Erkenntnis leider recht früh, und ich suchte dem zeitigen Diktat des Schreibens durch strenges Klassifizieren der Möglichkeiten zu begegnen. In den Jahren, in denen ich über mein Vorhandensein wenig wußte, wurde die Lyrik zur täglichen Anwesenheitsübung, und eine gute Idee schien es mir, vorauszubauen und meine literarischen Ahnungen in Pläne umzuschreiben. Es war die Zeit, da ich Gedichtbände im Dreivierteljahrestakt anfertigte und mich so gewissermaßen mir selbst versichern konnte. Einer, der schreibt, hinterläßt was. Wünscht er sich. Ist die Hoffnung dahinter. Im Fall der Texte, die sich im Buch Die Spur der Vogelmenschen finden, ging es mir so, daß sie mir damals als die dringlichste und vollendetste Fingerübung in Gedichten erschienen, nun, zwölf Jahre später, sind mir gerade diese Poeme unheimlich fremd. Es liegt in ihrem Autismus, sage ich mir. Aber sicher bin ich mir nicht. Ich hatte noch keine drei dieser Sachen geschrieben, da hatte ich zwingend das Gerüst für den gesamten Band parat, ich brauchte es nur noch Stück um Stück mit Texten zu füllen, was ich auch tat.
3
Aber das ist nun anders. Nun bin ich hier. Und habe den Salat. Denn: was ist über den Sprung zu sagen, den man – vielleicht – mit den Jahren vollzieht und der sich als möglicher Prozeß einer wie auch immer gearteten Reife angeblich, womöglich und aufgesetzt folgerichtig in dieser Textur niederschlägt? Was über die Zweifel, die weißen Pünktchen auf dem Weg dorthin, die es zwölf Jahre lang nicht erlaubten, nach dem Ende des Vogelmenschen-Exzesses, das zugleich das Ende der ,glücklichen Blindnis‘ bedeutete, einen Raum und Rahmen für ein schlüssiges Gedichtband-Konzept zu finden, von ein paar Abwegen einmal abgesehen? Und schließlich: was bleibt über den möglichen Adressaten dieser Bewegung und Neu-Findung zu sagen, den man doch sucht und der man, wie befürchtet, oft selbst ist? Im Sommer 1996, auf dem Höhepunkt dieses Bewußtseins, an einem Kreisende zu sein, und im Herbst danach noch glaubte ich, die Lyrik aufgeben zu müssen… und in dieser Verfassung schrieb ich die erste Fassung der Eklipse, die damit, ahnungslos und unfreiwillig, zum Keim der Sammlung wurde. Gottlob wußte ich damals nicht, was mich im Leben erwartet, denn ich hätte, aus der Rück-Sicht zumal, aber auch in der Voraussicht, wohl Verzicht geübt, und aus mir wäre noch etwas Vernünftiges geworden, spät, aber immerhin. Die Eklipse konnte ich indes erst 1998 beenden, sie mußte zuvor durch den Filter einer wirklichen Mondfinsternis; und heute scheint es mir so, als trüge sie bei aller Rabiatheit und Verlorenheit ihres Sprechens einen Schimmer dessen, was ihren Urheber in den kommenden Jahren an Höhen und Tiefen erwartet. Sie setzt den Anfang des vereinzelnden Parlierens… und was ich im Hier und Jetzt meine, ist das Auf und Ab des real existierenden Existierens, das mich nun traf und vor dem mich das nach Leben oder Verderben keifende Delir der früheren Texte seltsam geschützt hatte. Ich wurde Vater und: veränderte mich. Ich begriff, daß das Image eines Dauerstudenten auch etwas Filziges hat, die Beendung der Studien immerhin die Entscheidung bringe zwischen Chance und Desillusion. Ich lebte und genoß, neben dem Reichtum der Vaterschaft, die temporäre Erfüllung in der Liebe… eine Sache, die mir vorher so nicht aufgehen konnte: die Früchte der Liebe waren eine Zeitlang ihr Katalysator zugleich. Begriff etwas von der Trauer über diesen gesichtslosen imperialen Dreck, der der Fäulnis der Ismen nachfolgt, durchsetzt mit der alten Angst und dem kühlen Mut der Versprengung. Wetzte das Mütchen in der Vision der Absage nach überallhin. Und gierte zugleich nach dem Überallhin, zeitweise erschien es mir, der ich es nicht ausleben konnte, wie der Spiegel der Welt. In dieser Wirrnis aus Glück und Trübnis, die mir anheim war, war es mir offenbar unmöglich, äußere Gestalten für Gedichtbände zu finden. Dafür begegneten mir über die Jahre neue Formen und Vorlieben: der zunächst vage, dann immer vehementer werdende, neue Hang zum Reim, zur pindarischen Übung und nicht zuletzt zur Lust an der Formulierung von Zeit- und philosophischem Bewußtsein, was ja eine Abkehr vom Autistischen ist. Ich, der Lebensfeigling, der sich gleich einem intellektuellen Nacktmull in apologetischen Tunneln verkrochen hatte, tat einen Blick aufs Leben, nun doch, litt daran und profitierte davon und erweiterte, noch im Moment der Angst, jede Fähigkeit zu verlieren, den Saum des Erreichbaren, Erwartbaren. Der Moment der Erkenntnis dessen ist selten und flüchtig, man wird ihn nie vollends beschreiben. Darüber möchte man einmal alles gesagt haben dürfen, das ist wohl der Urtraum jedes Gedichtproduzenten. Die Arbeit daran erscheint mir nun, trotz der großen Distanzen zwischen den Texten, ihren Facetten und Entstehungszeiten, auf eine paradoxe Weise hochkonzentriert.
4
Es ist nichts darüber zu sagen, sagt der Spartaner hingegen, denn es steht alles in den Gedichten. – Aber nochmal von vorn: die zyklische Arbeitsweise bedingt eine gewisse Läßlichkeit gegenüber schwächeren Texten, da sie als Bindeglieder einen festen Platz in der Konstruktion behaupten können und im Verbund sogar so etwas wie eine Aufgabe besitzen: zu stabilisieren… zu zementieren, wenn man so will. Vereinzelt man diese schwächeren Gebilde, fallen sie zusammen, verschwinden, entziehen sich dem Auge, ähnlich wie der Staub, aus dem Wollmäuse gemacht sind. Und: sie geben der Arbeit eine bestimmte Sicherheit, da sie über Untiefen, trügerische Unklarheiten ob ihres füllenden Wesens hinweghelfen können. Verschleiern den Blick für das nicht fertig Gedachte. Eben das soll das Anliegen der Gedichte im Löwenpanneau nicht mehr sein. Ein vermessener Satz, fürwahr; und ich höre schon das Hummelgeschwader der postliterarischen Wortzerkrümler kichern. In der Tat dürfte es aber so sein, daß die Vereinzelung Genauigkeit zeugt. Die Positionierung der Eignung des Zyklus als Erzeuger der Anderswelt wird aufgegeben zugunsten einer kleineren Struktur, die umgekehrt proportional einen größeren Welt- und Genauigkeitsgehalt einfordern kann. Eine solche Befähigung macht verdächtig und einsam, fordert zugleich viel intensivere Beschäftigung mit jeder lyrischen Regung, legt ganz andere Gewichte auf jeden Vers, jede Strophe als im fortwährenden Schielen nach dem nächsten Baustein, der, womöglich, die Makel des vorangangenen auswetzt und immer so fort. Jedenfalls schien es mir so, nachdem ich glaubte, begriffen zu haben, daß ein zweiter Kreisgang ein anderer zu sein hatte. Abseits davon entwickelte ich eine Passion für die Nachdichtungsarbeit und konnte plötzlich, indem ich in die Aufzucht zweier Kinder involviert bin, für Kinder schreiben… bei des Übungen in Demut, die auch dem Löwenpanneau dienten. Ich schrieb, plötzlich und unerwartet, auf den Kern dessen, was mich umtrieb, von mehreren Seiten zu. Es erschien mir wie eine ungeheure Befreiung. Vielleicht war es meine Art Pasado en claro. Was ich gewann, ist die Liebe zur Klarheit: die Gedichte, glaube ich, kommen zu mir und sprechen nun mit mir, jedes für sich, ohne sich zu verbrauchen. Das ist der Schritt, der mit Abstand einzige vielleicht, den diese Gebilde tun. Im Augenblick erscheint er mir wichtig.
5
Schreiben heißt Unter-Druck-Sein. Gelassenheit, will es scheinen, ist etwas für Germanisten, jene philologische Kaste, die entweder das darbende Schicksal des Schreibers teilt… oder von der Durchdringung der Literatur hinlänglich gelabt und selbstvergessen am einträglichsten lebt und nach und nach gelinden Abstand von der Urheberschaft ihres Wohlstands hält. Ein Gedicht entsteht in einer Minute, es quält sich eine Zeitlang und scheitert vielleicht, oder es geht seinem werten Verfasser über Jahre nicht aus dem Kopf, ohne die Garantie, am Ende nicht doch abzustürzen oder, im einfachsten Fall, in den Schubladen des Geistes irgendwann liegenzubleiben. Was Reim und Form betrifft: mit Ausnahmen ist die gereimte Form die schnellere, sie fordert offenbar eine strenge Disziplin der möglichst zackigen Ausführung, während die mit antiken Elementen spielende Epistel-Variante im Buch nach Besinnung und Breite verlangt und sich damit eine gewisse Weltgedichtigkeit zumißt. Das muß nicht heißen, daß der Urheber damit einverstanden wäre, allein, was soll er tun! Er will auch mit seiner Arbeit fertig werden und beschwert sich nicht, wenn ihm die Reime schnell von der Hand gehn oder die Mühsal mit dem Anspruch auf Welthaltigkeit erträglicher wird. Es wird ihn der Zweifel treffen ob der Richtigkeit seines derzeitigen Zustands, aber der trifft ihn mit der Regelmäßigkeit von kürzer werdenden Intervallen so oder so. Die interessanteren Texte sind indes die Ausnahmefälle: das simple „Morituri“ etwa benötigte vom Skizzieren der Idee bis zur gültigen Stufe acht Jahre… Jahre, von denen es zugegebenermaßen einige verschlief. „Das Paradies und der Dämon“ zum Beispiel blieb dreißig Monate unbeendbar. „Wächterstraße“ hingegen, ein in der Beschau recht schwerer pindarischer Bolzen, an einem halben Maitag geschrieben, wog die Mühen an den anderen, teils viel leichteren, Episteln um ein Vielfaches auf. Andere Texte wurden nie vollendet, sie dümpeln nun in den Kladden der Vergessenheit und erwarten den jüngsten Tag ihrer Erweckung. Der Blitz und das schleichende Hadern – zwei unabdingbare Seiten einer solchen Arbeit. Es ist, will ich meinen damit, etwas Elendes um die Kunst. Man kann keine Absprachen mit ihr treffen, und wenn, kann man sich auf sie nicht verlassen. Man kann eben nur versuchen, sich in ihr zu spiegeln.
6
Gerhard Bosinski hat es gesehn, er gehört zu den fünf bis zehn Auserwählten, die wirklich das Löwenpanneau sahn. Das muß ein gewaltiger Augenblick im Leben eines Archäologen sein, in einen Raum vordringen, in dem seit 30.000 Jahren die Zeit steht. Die Kienfackeln wie eben erloschen, der Rausch des Künstlers grade verflogen, die Farben frisch wie je, das Tanzen der Tiere im Licht, als wären sie nie von der Erde verschwunden. Dafür beneide ich Gerhard Bosinski unendlich, so, wie ich ihn bewundere, daß er mit diesem Privileg im Sinne einer höheren Kenntnis gelassen umgehen mag. Auch das steht in den Gedichten dieses Buchs. Uns, die wir, aus einsehbaren Gründen, keinen Zutritt zum Allerheiligsten haben, bleiben die Visionen und Träume davon, mit denen wir uns aus Sehnsucht behelfen. Wir werden es niemals zu sehen bekommen, das muß uns klar sein. Weh uns, wir können nur Gedichte darüber schreiben. Gerade Chauvet, die Heimathöhle der Löwenpirsch, hat in der Reihe der Jahrhundertfunde am Ende des letzten Centenniums wie kein anderes Objekt die Gemüter der Schreiber erregt. Das liegt daran, daß die Grotte ein Kettenglied zur alten Magie offenhält, in das man sich einklinken mag oder nicht. Im Gegensatz zu vielen Moden und Strömungen der uns umspülenden und mitreißenden Gegenwart, die ihren Kollaps spielerisch sieht, steht das Gesamtkunstwerk der Grotte Chauvet weit, weit jenseits und über der Zeit, von keinem, jedenfalls keinem uns bekannten, Trend eingetrübt, ein Urbild für Erfüllung und Hoffnung auf Befreiung durch die Kunst. Und Gerhard Bosinski hat es gesehn.
7
Was ich sagen wollte: Löwenpanneau ist kein gewachsenes Buch oder vielmehr: ein in einem anderen Sinne gewachsenes Buch, ein aus der Fülle und dem Abraum ,gewordenes‘, keines mehr aus der Notwendigkeit des Zukleisterns der Leere. Kein horror vacui, nein, ein Klauben in den bedrohlichen Kjökkenmöddingern einer fünfzehnjährigen, beständigen Arbeit gegen den Zweifel, die unausrottbare Hoffnung auch, gegen sich selbst. Am Ende dieser Arbeit steht die Erschöpfung, aber auch die zunehmende Reduzierung des Zweifels. In einem Stadium, da das Tasten vorüber sein dürfte, beginnen die Eindrücke zu wirken; das Erfühlte, Geträumte kommt nun zur Sprache… gottlob, sagt der Frömmler, und der Abgeklärte atmet vielleicht ein oder zwei Mal tief durch. Es ist zugleich ein gefährlicher Punkt – nirgendwo lauert die edle Zufriedenheit so sehr wie im Bewußtsein eines durchschrittenen Ödfelds. Auf Ödnis folgt Ödnis, das muß man begreifen, und das Grün zwischen den Halden reduziert nur den Wind; was nicht heißen will, daß kein Wind mehr da ist. Ermutigend erscheint mir diese Vision: die Lyrik, im unendlichen Überschlag des dritten Jahrtausends eigentlich sinnlos geworden, behält ihren Weg bei, mit dem Trotz einer verlorenen Sache führt sie die ihr zugewiesene und – als Gegenpol zum Einerlei sogar mit neuer Nahrung beladen – seismographische Aufgabe fort, kündet von den Dingen zwischen Stimme und Haut und bleibt dem sonst nur schwer zu Nennenden treu – ein Mammut, eine Wollmaus zwischen den Cyborgs der Satisfaktion. Auch wenn dieser Vorausblick nicht ganz der meine mehr ist, weil er blinde Erwartungen schürt, die überwunden gehören: ich will ihm eine Zeitlang, für eine Schweigeminute vielleicht, in der mühevollen Gefügtheit des Löwenpanneaus, folgen.
André Schinkel, Spätsommer 2007, Nachwort
Die von 1990 bis 2007 entstandenen Gedichte,
kühl, einsam und fern aller überflüssigen Korrespondenz, zeigen die Begabung André Schinkels, der in dieser Zeit einen desillusionierenden Blick aufs Leben tat und diese Chance begriff.
Das Ergebnis ist ein größerer Welt- und Genauigkeitsgehalt, mehr Klarheit. So ist Löwenpanneau ein aus der Fülle und dem Abraum gewachsenes Buch, keines mehr aus der Notwendigkeit des Zukleisterns der Leere.
Mitteldeutscher Verlag, Ankündigung
Mitteldeutscher Zirkelschlag – André Schinkel im Gespräch
– Ein Interview mit dem Schriftsteller André Schinkel – über das Literaturland Sachsen-Anhalt und seinen Band Löwenpanneau. –
Nils-Christian Engel: André Schinkel, die vergangenen zwei Jahre waren für Dich durchaus erfolgreich – 2006 hast Du den Cuxhavener Joachim-Ringelnatz-Nachwuchspreis für Lyrik erhalten, 2007 sind zwei Bücher erschienen, zum einen der Lyrikband Löwenpanneau, dessen Entstehung auch durch eine Förderung der Kunststiftung Sachsen-Anhalt unterstützt wurde, zum anderen die Sammlung Unwetterwarnung, den Ertrag Deines Stadtschreiberstipendiums im thüringischen Ranis. Kann man aus diesen Erfolgen schließen, dass Sachsen-Anhalt gute Bedingungen für Literatur bietet?
André Schinkel: Diese Erfolgsgeschichte, wenn man sie so nennen will, hat mich auch erst einmal überrascht. Was ich zum Substrat dieser Arbeit und dieses Erfolgs sagen kann, und was das mit Sachsen-Anhalt zu tun hat, ist, dass ich schon glaube, dass das Land einen sehr guten Boden für Kultur bietet. Das hat sowohl historische wie auch aktuelle Gründe: als Bestandteil von Mitteldeutschland ist es altes Kulturland, und die Kultur guckt hier an jeder Ecke und an jedem Ende heraus. Der aktuelle Grund ist, dass Sachsen-Anhalt ein guter Boden für kulturelle Regungen geblieben ist, auch für neue Literatur. Das hat damit zu tun, dass sich dieses Land in einem Zwiespalt befindet zwischen Versinken und Aufbruch. Dieses Feststecken zwischen den tradierten Dingen, die lange eine geringere Rolle gespielt haben und nun langsam wieder ans Licht kommen, dieses Wegbrechen vieler Dinge und das Sehen neuer Möglichkeiten, die man ja aber erst einmal für dieses Land nutzbar machen muss, ist reizoll. Da ich ein Bewohner dieses Landstrichs bin, denke ich, dass für mich die Bedingungen, in Halle zu schreiben, schon sehr gut sind. Ich komme mit der Ambivalenz, die diese Stadt bietet, gut zurecht. Ich glaube, es gibt nur wenige Orte, an denen ich ähnlich arbeiten könnte. Einer dieser Orte ist Leipzig. Leipzig und Halle sind ja – wenn man das in diesem Journal sagen darf – ungleiche Schwesterstädte. Die Differenz und zugleich, was man an gemeinsamer Geschichte hat, sind ein Anlass für den Austausch zwischen diesen sich immer mal abhanden gekommenen Städten.
Engel: Leipzig ist ein Literaturstandort von unzweifelhaft überregionaler Bedeutung, Leipzig assoziiert man mit Literatur – Halle und Sachsen-Anhalt viel weniger. Wie steht es um die überregionale Beachtung, die Literatur aus unserem Land findet?
Schinkel: Ich glaube, dass es vor allem in dem Jahrzehnt nach der Wende schwer war für sachsen-anhaltinische Literatur, ein überregionales Podium zu finden. Aber ich sehe auch, dass sich das in den letzten Jahren verändert hat. Ich bemerke es daran, dass es einen Austausch gibt, der mittlerweile bundesweit stattfindet, vor allen Dingen zwischen jungen Autoren. Das hat damit zu tun, dass sich insbesondere in den großen Städten im Land eine junge Literaturszene etabliert, die sich aus der Ambivalenz dieses Landes nährt, und dass diese Szene nun zunehmend auch überregional zur Kenntnis genommen wird. Es gibt mittlerweile schlagkräftige Beweise dafür, dass es hiesige Autoren weit außerhalb der Region zu Anerkennung bringen können.
Engel: Versinken und aufbrechen sind wichtige Motive auch in Deinen Texten, zum Beispiel im Gedicht „An der Saale“ aus dem Band Löwenpanneau. Der Text kreist um einen an sich wenig spektakulären Ort, eine Stelle am baumbestandenen, grasbewachsenen Saaleufer. Im Gedicht wird aus ihm ein Ort der Geister, der Ahnen, ja der aufflackernden Urgeschichte. Nun gehören Landschaftsbilder zu den literarischen Topoi mit einer denkbar breiten Tradition, nicht nur in der deutschsprachigen Lyrik, und sie dienen nicht zuletzt dazu, Unterschiedliches in Beziehung zu setzen, oft im Dienst eines größeren philosophischen oder ästhetischen Entwurfs. Dem gegenüber ist der hohe Grad an Innerlichkeit und Selbstreflexivität – im präzisen Wortsinne als Wiederspiegelung –, der dieses Gedicht ausmacht, erstaunlich. Oder liegt gerade darin die poetische Magie eines Landstrichs, in dem man – wie Du an anderer Stelle gesagt hast – „für seinen Wohlstand an Geschichte und Kultur nicht immer Zeit“ hat?
Schinkel: Diese Beziehung zur Saale ist eine innige, das hat damit zu tun, dass der Fluss eine magische Ausstrahlung für mich hat. Ich habe die Saale sowohl hier als auch im thüringischen Raum recht intensiv kennengelernt und studiert. Die Saale ist der Ersatz für den Fluss meiner Kindheit, die Mulde, die einen etwas anderen Charakter hat. Ich glaube, dass die Saale als Symbol sehr gut für diesen mitteldeutschen Landstrich stehen kann; und für mich schießt am Saaleufer der Komplex aus Geschichte und Gegenwart, der Anwesenheit der Geister und der eigenen Befindlichkeit zusammen. Es gibt traumhafte Gegenden und zugleich apokalyptische, verlassene Landschaften, durch die sich die Saale in einer schnellen Folge bewegt. Das macht diesen Grundreiz aus. Damit ist man ja wieder bei dieser Spaltung – das Ewige, das durchhält, und das Kurzlebige, das eben dann auch zusammengebrochen am Flussrand steht. Wasser übt, durch seine Bewegung und den Ursprungsgedanken, der in ihm steckt, schon immer eine große Faszination auf mich aus, sowohl in Form des Flusses als auch in seiner ins Zeitlose gesteigerten Form als Meer. Flüsse und Meere spielen in meinen Texten oft eine wichtige Rolle, nicht selten in Verbindung mit Mythos und Magie.
Engel: Dieses Magische findest Du in einer Landschaft, die von historischen Wechseln geprägt ist. In seiner Laudatio anlässlich der Verleihung des Joachim-Ringelnatz-Nachwuchspreises für Lyrik hat Wolf Biermann Dich als „ein echtes DDR-Produkt“ bezeichnet, für das er angesichts einer gemeinsamen Tradition „die richtigen Ohren“ habe. Tatsächlich gehörst Du zu der Generation, für die der Schritt ins Erwachsenenleben in einen neuen Staat, in ein radikal verändertes Gesellschaftssystem führte. Was sind die schriftstellerischen Konsequenzen dieser biographischen Situation? Stellen die DDR und „ihre“ Literatur bzw. der „verwestlichte Osten“ (Biermann) Bezugspunkte für Dein Schreiben dar?
Schinkel: Als Bezugspunkt, als Ort für mein Schreiben, steht, wenn ich mich regional einordnen müsste, Mitteldeutschland, als historische Landschaft. Da ich gebürtiger Sachse bin und in Sachsen-Anhalt als zugezogenes Landeskind gelte, auch das Raniser Jahr sehr wichtig war und ich so eine Art Thüringer auf Probe bin, habe ich für mich so etwas wie den mitteldeutschen Zirkelschlag gezogen. Zur DDR: ich kann natürlich die Herkunft aus diesem Land nicht verleugnen und würde das auch nie tun. Ich sehe heute keine getrennten Literaturen in dem Sinne, dass man sie gegeneinander ausspielen müsste. Wenn mir nach Strittmatter ist, dann lese ich Strittmatter, und wenn mir nach Thomas Kling ist, dann lese ich Kling. Allerdings ist mir höchst selten nach letzterem – das hat jedoch nichts damit zu tun, dass er ein Westdeutscher war. Es gibt Dichter, die Autoren beider Deutschländer waren, Wolfgang Hilbig zum Beispiel oder Bernd-Dieter Hüge, die überdies mitteldeutsch geprägt waren. Ich weiß, dass diese sächsische Herkunft für mein Schreiben sehr wichtig ist, aber sie soll nicht als Lokalpatriotismus herhalten. Ich bin kein Lokalpatriot, ich bin – das gebe ich zu – bekennender Sachse und auch ambivalent bekennender Hallenser. Aber das ist nicht der Aufhänger für die mentale Wichtung meiner Texte: die ist schon ins Größere angelegt.
Engel: Wie würdest Du als Redakteur der Literaturzeitschrift Ort der Augen die gegenwärtige Literaturszene in Sachsen-Anhalt beschreiben? Siehst Du neue Tendenzen, kristallisieren sich bestimmte Themen heraus?
Schinkel: Die Szene ist sehr reichhaltig, es gibt in Sachsen-Anhalt etwa 150 praktizierende Schriftsteller, in allen Gattungen und Facetten, die man sich vorstellen kann, vom Unbedarften bis zum großen Dichter ist alles dabei, so dass es schwierig ist, zu sagen, ob es eine einheitliche Tendenz gibt. Vor allem in der Lyrik sind im Grunde die gleichen Tendenzen zu beobachten wie in Deutschland insgesamt. Da gibt es junge, selbstbewusste Schreiber, die die Formen wiederentdecken und diese auch herstellen können, wie andere Brot essen, was ich durchaus als neu und bereichernd ansehe. Es gibt eine kleine klassizistische Schule und mit Schriftstellern wie Wilhelm Bartsch Autoren, die den Anschluss an die bundesweite Szene halten. Dieter Mucke würde ich auch dazu zählen, der wie Bartsch im gesamten deutschsprachigen Raum ein Begriff ist. Es gibt zudem eine Tendenz zu Kinder- und Jugendliteratur, die wird sich in den nächsten Jahren noch verstärken. Über Ort der Augen besteht die Möglichkeit, die Strömungen zusammenzuführen und darüber hinaus zu arbeiten. Die Zeitschrift ist nicht auf Sachsen-Anhalt allein ausgelegt, sondern schon international, wir haben Autoren aus zwanzig Ländern zu Gast gehabt, und wenn es einen regionalen Fokus geben muss, dann ist Ort der Augen im Kleinen auf Mitteldeutschland ausgerichtet und im Großen für alles offen, was passt. Und gleichzeitig eine Zeitschrift, in der große Namen neben Debütanten stehen sollen, wofür in Sachsen-Anhalt gute Chancen bestehen, da es hier auch sehr viele junge Leute gibt, mit der Entfaltung ihres Talents beschäftigt sind.
(…)
destinatio, 15.1.2008
Holger Benkel: die motive des gräbers
Lesung und Gespräch mit André Schinkel im Literaturhaus Halle am 22.4.2020
Verleihung der Dr. Manfred Jahrmarkt-Ehrengabe 2021 an André Schinkel am 5.11.2021 im Deutschen Literaturarchiv Marbach
Fakten und Vermutungen zum Autor
Porträtgalerie: Dirk Skibas Autorenporträts
shi 詩 yan 言 kou 口 1 +2
In der Zwischenzeit: Poesie – mit André Schinkel.


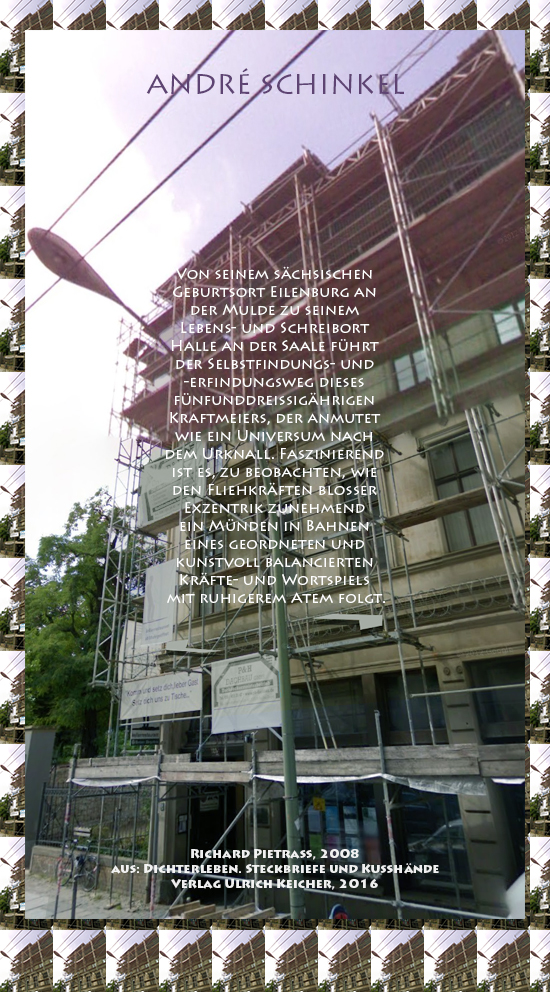












Schreibe einen Kommentar