Andrea Zanzotto: La Beltà / Pracht
GROSSE WORTE ÜBER: DIE ZIELLOSIGKEIT,
DAS PRINZIP „WIDERSTAND“
I
Doch was ist dieses Zucken, der Himmel
ist blau ohne Unheil nie Unheil
oder raucht friedlich.
Und ballen und formieren,
wie alles konspirierte sie heil zu lassen.
Ich sehe nichts und mit dem Leben
plag ich oder plag mich nicht.
Wir wissen nicht: bloß blauer-Himmel
und zerschlagene Erde am Ende an den Rändern doch blau.
Steigen, Rauch, Steigen Kringel um Kringel da oben;
Singen, Bach-Grille, Baumeln, Feige.
Röslein rot, Rote auf der Heide
dorne mich ich halte still.
Halt Besuch verwehrt Sperrgebiet
weder deutsch noch italienisch, alle sind wir Winzlinge
wie der Grashalm Winzling ist, wie der Tau.
Der Mensch kommt vor und kommt
du hüpfst über die Straße den Graben
den Erdwall und Rauch.
Ein Huschen
doch ich hab dich gesehen.
„Sehen.“
Ein größeres übersetzerisches Unternehmen
nimmt seinen Lauf
und tritt im Herbst 2001 mit dem ersten einer auf neun Bände angelegten Edition an die Öffentlichkeit: das Werk des italienischen Dichters Andrea Zanzotto – Gedichte, Erzählungen, Essays – soll den deutschsprachigen Lesern in einer repräsentativen Auswahl zugänglich gemacht werden. Den Beginn setzt, zum 80. Geburtstag des Autors, der Gedichtband La Beltà / Pracht, 1968 in Italien erschienen, von Pier Paolo Pasolini in Rom dem Publikum vorgestellt, von Eugenio Montale im Corriere della Sera gefeiert.
Das Werk des 1921 im Veneto geborenen Andrea Zanzotto ist einem hohen Anspruch verpflichtet: Rettung zu versuchen, mittels der „Droge Sprache“ Rettung des ursprünglichen Feuers, Rettung des Raums einer Andersheit, Rettung des Lebens vor der Geschichte. Dichtung zeigt etwas, „was sich hartnäckig und kontinuierlich den Vorherbestimmungen und Bestimmungen der Geschichte entzieht, obwohl sie selbst aus dem tiefsten Golf der Geschichte entsteht“.
Die Übersetzungen geben Einblick in verschiedene Zonen von Zanzottos Schreiben: In seine frühen, im Veneto situierten Erzählungen, in die zunehmende Sprachthematik und Suche nach Sprache und Laut – nach einem Denken vor dem Denken -, in seine komplexen poetologischen Überlegungen, die nach einer neuen Begründung und Sicherung des Poetischen streben, in seine literarischen Beobachtungen und Lesarten. Ein Werk, das aus dem Keim des Sprachlichen entsteht, aus der Sprache denkt, ins Originale, Unartikulierte, Anders-Wahre taucht, dabei auch in den Dialekt des Dorfs taucht und ins Kindersprachliche, ins Lallen, in das Halb-Unsinnige, ins Gekritzel kleiner Zeichen, ins Nicht-Wissen, ins Entwerden, in die Ent-Würfe, ins Unverfügbare, wie es vor wenigen Jahrzehnten noch der Mond darstellte, bis das Alles-kaufen-Wollen und Alles-haben-Wollen den Mond erreichte, bis die Supermärkte den Mond erreichten. Auch unsere Erde war einmal Mond – ist ein Mond – war einmal Mond.
Die Edition Planet Beltà umschließt die Gedichtbände La Beltà (1968), Gli Sguardi i Fatti e Senhal (1969), Il Galateo in Bosco (1978), Fosfeni (1983), Idioma (1986) sowie einen Band mit vermischten Gedichten; hinzu kommen die Erzählungen Sull’Altopiano (1954) sowie Essays zur Poetik und literaturkritische Essays.
Andrea Zanzotto und als Übersetzer Donatella Capaldi, Ludwig Paulmichl und Peter Waterhouse wurden 1993 mit dem Preis der Stadt Münster für Europäische Poesie und ihre Übersetzung ausgezeichnet. Die Herausgeber und Übersetzer dieser Ausgabe haben zum Erscheinen des ersten Bandes von Planet Beltà das Zuger Übersetzer-Stipendium 2001 der Dialog-Werkstatt Zug erhalten.
Ein Kopfsprung, ein Lallen und eine wirklich phonische Droge
− Wie man dem lastenden Gedächtnis der Wörter entkommt: Zum Beginn der deutschen Werkausgabe des Dichters Andrea Zanzotto. −
Pier Paolo Pasolini hat, wie Andrea Zanzottos Übersetzerquartett im gemeinsamen Nachwort berichtet, von einer „Erfahrung des Nichtwissens“ gesprochen, als er dessen Gedichtband „La Beltà“ (Pracht), 1968 erschienen, las. Pasolini formulierte damals seine Ratlosigkeit: „Man weiß nie, in welchem semantischen Feld man sich befindet: der Leser gerät in einen beispiellosen Zustand der Entfremdung von seinen Gewohnheiten.“ Wenn wir heute „La Beltà“ lesen, erfahren wir die gleiche Verwirrung, die gleiche Ratlosigkeit. Wer Zanzotto nach der Verleihung des Preises der europäischen Poesie in Münster erlebt hat – redselig am hinteren Tisch einer Kneipe, das Glas Rotwein vor der Nase, die Baskenmütze auf dem Kopf –, kann jenes Bild eines liebenswürdigen italienischen Landmannes kaum zur Deckung bringen mit diesem Gedichtband, seinem vierten, in dem er nichts anderes als eine neue Sprache versucht, jenseits von Bedeutungen und an Objekte gebundenen Wahrnehmungen. Daraus resultiert zunächst eine enorme Freiheit, eine von Zanzotto beim Leser freigesetzte Freiheit – und eine Musik. Luigi Nono hat noch kurz vor seinem Tod Zanzotto als den größten lebenden Dichter Italiens bezeichnet, wohl weil hier parallele Recherchen vorliegen – neue Sprachen, neue Töne zu finden.
Zanzotto zitiert – in dem Gedicht „Gleichwohl noch der Schnee“ – Hölderlin: „Ein Zeichen sind wir, deutungslos“, und fügt etwas an, das sein Programm sein könnte: „wo aber treten die Achsen zusammen? / Kann es denn sein? Und was wird mit uns? Und du warum, warum du? / Und was und warum tun die riesigen Körper und all die Sachen-Ursachen / und das Funkelnde und das Flunkernde?“
Ja, diese Texte funkeln. Zanzotto ist ein mit allen Wassern der Poesie, der Linguistik, des Films, der aktuellen Musik und der bildenden Kunst gewaschener Poet. Es gibt in seinen Gedichten durchaus eine normale, allen verständliche Sprachebene. Es gibt auch eine Ebene, die aller Esoterik abgewandt ist und von Dingen unserer Welt wimmelt: von Barbie bis Milupa, von Interspar, Tevau (TV) bis Fallschirmabsprüngen. Es gibt schließlich auch eine Ebene, die fast die des Heimatdichters ist: Wir finden sein Städtchen (Pieve), seine Landschaft (Treviso), seinen Fluss (Soligo), seine Hügel, Felder, Ernten, Jahreszeiten, Gewitter und Schnee. Aber dann gibt es noch eine Ebene, die diese Gedichte unverwechselbar und einzig macht. Man könnte sie oberflächlich als experimentelle, verstörende, Sprache neu ordnende Ebene bezeichnen. Sie ist, falls wir uns darauf einlassen, fast so etwas wie eine vorsprachliche Ebene, eine Ebene des lallenden, stammelnden Suchens. Das meinte wohl Zanzottos berühmter Kollege Eugenio Montale, als er dessen Lyrik als „wahren Kopfsprung in jenen Vor-Ausdrucksbereich, der dem artikulierten Wort vorausgeht“, begrüßte. In diesem Sinne ist das Gedicht „L’elegia in Pétel“ – Die lallende Elegie — das geheime Zentrum dieses Bandes, Scharnier zwischen all den eigenen Ausdrucksmöglichkeiten.
Im Grunde will Zanzotto dem langen Gedächtnis der Jahrhunderte, mehr lastend auf einem italienischen Dichter als vielleicht auf Dichtern anderer Sprachräume, misstrauen, dem Fluch der historischen Erinnerung der Wörter entgehen und zurückfinden zu einem verlorenen Gedächtnis der Kindheit, das ein Zugehen auf die Zerstörungen der Gegenwart erlaubt. Viele Passagen in diesen Gedichten zeugen von einem tastenden Sinn, von ungefügen Versuchen, die „biophysische Struktur der Sprache“ wiederzufinden, um mit dem Schreiben zu beginnen. Der Dialekt des Veneto, der betörende Singsang der venezianischen Wiegenlieder helfen ihm bei diesen Versuchen. In einer autobiografischen Notiz benennt er, der nicht leicht „ich“ sagt und in der dritten Person spricht, den fernen Ursprung dieser erinnerten, zusammengefügten, erfundenen Sprache:
„Er empfand etwas ganz unendlich Süßes, als er Kinderreime, nicht gesungene, nur gesprochene oder einfach vorgelesene kleine Strophen und Lieder hörte, gerade wegen ihrer harmonischen Verbindung mit der Funktion der Sprache, mit ihrem inneren Gesang (…) Und die Großmutter, die eben jene Form von Kultur besaß, die sehr oft noch in den unteren Volksschichten zu finden war (…), trug ihm die Strophen Tassos vor … Diese Harmonie des ‚illustren‘ Toskanischen sickerte durch ihn wie ein wahrer, ein wirklicher Traum, eine wirkliche phonische Droge zusammen mit Fragmenten anderer Sprachen, wirkliche Xenoglossien.“
Wir können uns vorstellen, was für eine Herausforderung diese tönende Droge, dieses Amalgam aus verschütteten Kindheitsworten, Bildsplittern, Relikten der literarischen Erinnerung, magischen Formeln für die Übersetzer darstellte. Ohne sich selbst gewährte Freiheiten, ohne Erfindungstollheit und ohne Spaß wäre das Übertragen der „Pracht“ gar nicht möglich. Das Eröffnungsgedicht des Bandes wird gleich in fünf deutschen und einer englischen Fassung vorgestellt. Um darauf einzustimmen, dass es hier „eine“ Übertragung nicht geben kann? Gewiss ließe sich akribisch viel für und auch ein wenig gegen diese Übersetzungskünstler und -künste sagen. Warum zum Teufel gibt es zum Beispiel immer wieder englische Wendungen in der deutschen Fassung, wo Zanzotto ganz ohne diese Globalisierungssprache auskommt – zum Beispiel „unwritten“ für „mai cuciti“. Aber solche Details, die gewisse auf Lautmalerischem gründende Überhitztheiten bloßlegen, treffen letztlich nicht den Punkt. Hier haben sich vier Leute enorm viel Mühe gemacht und bewundernswerte Lösungen gefunden. Man denkt an Felix Philipp Ingolds Ausspruch, dass nämlich die Übersetzung, „stumm in der Schwebe zwischen dem zu übersetzenden und dem übersetzten Text, sich als ein ausgeschlossenes Drittes denken lässt, das weder vom Autor noch vom Übersetzer ‚begriffen‘ und folglich auch nicht ‚verraten‘ werden kann.“ Dies ist der erste einer auf neun Bände angelegten Gesamtausgabe. Ein solches Projekt hat immer auch etwas Erschlagendes. Die ersten Bände werden beachtet, dann erlahmt das Interesse der Rezensenten. Das darf bei diesem tollkühnen Projekt nicht passieren. Leser, Kritiker, wacht auf!
Joachim Sartorius, Süddeutsche Zeitung, 5.12.2001
Andrea Zanzotto: Beltà / Pracht
Fragt ein Mann: „Freust du dich, auf der Welt zu sein?“ – Antwortet das „Bübchen“: „Ja, weil’s ein INTERSPAR gibt.“ So lautet das Motto für eines der Gedichte von Andrea Zanzotto, der zu den wichtigsten lebenden Autoren Italiens gehört. Es ist die Welt der Werbung, der wir tagtäglich ausgesetzt sind. Aber diese banale Wunderwelt kann – ja, muss vielleicht sogar! – Teil der Dichtung sein. Gerade recht zu Zanzottos 80. Geburtstag starten die Verlage Urs Engeler und Folio eine neunbändige Ausgabe seiner Werke. Der erste Band ist soeben erschienen. Es sind Gedichte, versammelt unter dem Titel „La Beltà / Pracht“. Das ist ein Wort, wie man es gerne hat: „Pracht“, das ist das „Prachtweib“ aus Film und Fernsehen, das ist der Manager, der sich immer „prächtig“ fühlt, das ist auch der Militär, der nach dem Abwurf eines Bombenteppichs die Lage „ganz prächtig“ findet. Und da ist Andrea Zanzotto, der dies alles seismographisch aufzeichnet.
Der Gedichtband „La Beltà“ wurde erstmals 1968 publiziert. Einige Gedichte daraus sind bereits ins Deutsche übersetzt worden, aber erst jetzt, wo sozusagen die „ganze Pracht“ der lyrischen Sprache Zanzottos dem deutschsprachigen Leser zugänglich wird, ist man erstaunt über die Aktualität des dichterischen Wortes. Vielleicht deswegen weil in der Werbesprache und dem Vokabular der Gewalt sich die Sehnsüchte und Ängste der Menschen hartnäckiger halten als anderswo. Das Uniforme dieser Sprache betrifft auch die ganz Kleinen unter uns, diejenigen, die noch gar nicht wissen, was eine Uniform ist und die noch gar nicht sagen können, ob ihnen der tägliche Milupa-Brei schmeckt oder nicht. Über diese armen Winzlinge schreibt Zanzotto folgendes:
Schneewittchen Sonnwittchen Nivea
Und schwupp sind die Winzling-linge
Im Supersüßmarkt drinnen
– zu Füßen süßer Wälder –
wo es Milupa gibt süß und verlockend
für euch Babies Barbies breiberechtigt
und breibereit, Milupa
gnadenlos für Millionen, für euch (sniff sniff
gnam gnam yum yum slurp slurp)
Zanzotto geht es um die sprachlichen Leckerbissen, die den Unmündigen hineingewürgt werden und hinter denen die verborgenen Sehnsüchte der Erziehungsberechtigten schlummern. Egal, ob Familie oder Staat, immer dort, wo sprachliche Erziehungsarbeit vorgenommen wird, fährt das dichterische Wort dazwischen. Zanzotto verschmäht dabei weder Ausflüge in die Unsinnspoesie noch die Urlaute der Comicsliteratur. Er nimmt Hölderlin-Verse, zerschneidet sie und setzt sie wie in einem Puzzle neu zusammen. Er holt sich Sprichwörter aus fremden Sprachen und übersetzt sie wortwörtlich in sein Italienisch – sein Italienisch, das auch den Dialekt der Heimat, der Region Veneto, miteinschließt. Und das ist eben auch „Pracht“ – dichterische Pracht durch sprachliche Vielfalt.
Diese prächtigen und wortmächtigen Gedichte adäquat ins Deutsche. zu übertragen ist keine Kleinigkeit. Dem österreichischen Autor Peter Waterhouse, der sich seit Jahren mit Andrea Zanzotto beschäftigt, ist dies restlos gelungen. Waterhouse und drei weitere Übersetzer haben sich nämlich eine Strategie des Autors zu eigen gemacht. Zanzotto sagt es ganz offen in einem seiner Gedichte: Er sei im lyrischen Sprachspiel der „Joker“. Er ist die zusätzliche Spielmarke, die eigentlich alles und jedes bedeuten kann. Nur eben nicht nichts. Denn Zanzotto präzisiert: Er sei der „Golem-Joker“. Der Dichter ist nicht wie der klassische Golem aus Lehm gemacht, sondern aus Sprache. Er ist Teil seiner eigenen, Sprachwelt und wandelt sich in ihr. Und wer wie Waterhouse Zanzottos Gedichte in eine andere Sprache hinüberträgt, der muss selbst sprachmächtig sein, listig und lustvoll erfinderisch – so dass mit der Übersetzung etwas Neues entsteht. Joker zu Joker lautet die Devise.
Man könnte sagen: Zanzotto, der „Golem-Joker“, ist auch ein Vampir, der den Wörtern an die Gurgel geht. Und so lautet eines seiner Gedichte: „Im mulmigen Reich der Vampire“. Alles verpackt der Autor genüsslich in seine Verse: „Wolken von Mull“, einen „Zahn aus feinem Elfenbein“, „Verführung Geld und Süßes im Tabernakel“, nicht zu vergessen „Mister Kukident“. Der Leser wird Zeuge „eines blutigen Handels, Hämoglobal“, wie Zanzotto schreibt. Doch an dieser Stelle zuckt der Leser zusammen. Denn der Farbstoff der roten Blutkörperchen heisst doch eigentlich Hämoglobin? – Freilich, nur für Zanzotto ist das ein bereits „ausgelaugtes“ Wort. „Hämoglobal“ hingegen strahlt hämisch und global zugleich, hat Teil an der sprachlichen Hemisphäre – und: ist himmlisch unsinnig. Und dieser Unsinn zeigt schon seinen Sinn, wenn man einem Dichter wie es Andrea Zanzotto ist – bis zum Schluss folgt. Denn am Ende des Vampir-Gedichts ist zu lesen:
Götter Welten und Seelen: verfehlte Ziele. Doch war
jener große enthüllte Morgen und mich bedeckt
sein himmlisches Plasma, und dauert.
[…]
Andreas Puff-Trojan, Österreichischer Rundfunk, 30.12.2001
Andrea Zanzotto: La Beltà
Man muss schon ein schwerer Fall von Lyrik-Liebhaber sein, um La Beltà / Pracht von Andrea Zanzotto zu lieben. Diese Gedichte bereiten harte Arbeit – nichts von hineinlesen und sich wohlfühlen. Zanzotto schafft eine neue Sprache aus zuckenden Wortblitzen, er zertrümmert nichts, setzt aber so geradlinig neu, dass Verstörung die unausweichliche Folge ist. Ein aufregender, liebevoll gestalteter Band in italienischer und deutscher Sprache, dessen Übersetzung als kongenial gelobt wird.
Gudrun Norbisrath, Westdeutsche Allgemeine Zeitung, 1.12.2001
Andrea Zanzotto: La Beltà
Planet Beltà heißt die Edition der gesammelten Werke des 1921 geborenen italienischen Dichters Andrea Zanzotto, deren erster Band nun erschienen ist. Die dichterische Welt, die Zanzotto entwirft besteht aus Himmeln und Hügeln, Lautpoesie, Schrott des Alltags und der Psyche. Moderne und archaischer Epos sind hier gleichermaßen anwesend.
In einem seiner rätselhaftesten Gedichte, einer poetischen Reminiszenz an den späten Hölderlin, hat einst Paul Celan die Vision eines sinnfreien Sprechens entworfen, das sich von Begriff und Bedeutung befreit hat. Es geht darin um die Regression in einen vorsprachlichen Bereich, in dem Lautgestalt und Bedeutung eines Worts noch ungeschieden sind. Am Ende des Gedichts wird die Entstehung des Menschen in einen unmittelbaren Zusammenhang mit dem Lallen gebracht, dem frühesten Stadium des kindlichen Zur-Sprache-Kommens: „Käme, / käme ein Mensch/ käme ein Mensch zur Welt, heute, mit / dem Lichtbart der/ Patriarchen: er dürfte, / spräch er von dieser/ Zeit, er / dürfte / nur lallen und lallen, / immer-, immer- / zuzu.“ Schließlich wird die Schlusszeile des Gedichts in Klammern gesetzt, und wie von fernher tönt eine fremdartige Stimme: „Pallaksch. Pallaksch.“ Dieses sinnlose Wort „Pallaksch“ hat im Deutschen keine Konnotation, es taucht nur im Wahnsystem des späten Hölderlin auf und kann dort entweder „Ja oder „Nein“ bedeuten.
Es gibt in der deutschsprachigen Lyrik der Moderne kein vergleichbares Konzept, das in ähnlicher Weise eine Poetik des ungestalteten Wortstoffs entwickelt und zu diesem Zweck mit Koselauten, Gestammel und Wortexaltationen arbeitet. Ihr weltliterarisches Pendant findet die poetische Kühnheit eines Celan einzig in der Dichtung des italienischen Lyrikers Andrea Zanzotto, eines Dichters von höchstem Rang, der hierzulande trotz einiger bedeutender Auszeichnungen immer noch ein Schattendasein führt. 1921 in dem kleinen Dorf Pieve de Soligo in Venetien geboren, hat Zanzotto seit seinem erstem Gedichtband 1951 ein Werk geschaffen, das, so sein berühmter Zeitgenosse Eugenio Montale, „einen wahren Kopfsprung (riskiert) in jenen Vor-Ausdrucksbereich, der dem artikulierten Wort vorausgeht“. In Zanzottos Poetik der Sprachmagie bilden die Elemente kindlicher Kosesprache eine Hauptrolle. So trägt eins seiner Gedichte, das ausdrücklich den Bezug zu Textfragmenten des späten Hölderlin herstellt, den Titel „Die lallende Elegie“.
Die sehr spezielle Legierung von Zanzottos Poesie, die einerseits starke regionale Wurzeln hat und sich aus den dialektalen Eigenheiten seiner venetischen Heimatregion speist, sich andererseits aber in die komplexen Texturen der sprachreflexiven Moderne einschreibt, hat die Rezeption seines Werks in Deutschland lange Jahre behindert. Den Weg des Dichters Zanzotto in die deutschsprachige Lyrikwelt bahnte erst der Dichter Peter Waterhouse, der im Herbst 1984 bei einer zweisprachigen Lesung in Wien erstmals auf die Texte Zanzottos stieß – eine Begegnung, die er später, etwa in seinem Essaybuch „Die Geheimnislosigkeit“, als lyrisches Erweckungserlebnis und als „Ankunft einer neuen Sprache“ beschrieben hat. Waterhouse darf auch als Anreger der jetzt begonnenen zweisprachigen Werkausgabe Andrea Zanzottos gelten, die auf insgesamt neun Bände angelegt ist. Für dieses enorm riskante, weil extrem kostenintensive Unternehmen haben zwei kleine Verlage, der Schweizer Lyrik-Editor Urs Engeler und der Wiener Folio Verlag, alles in die Waagschale geworfen. Und man kann nur hoffen, dass diese Pioniertat der Zanzotto-Edition nicht auf jene ungute Melange aus öffentlich bekundetem Respekt und heimlichem Abwinken trifft, mit dem anspruchsvolle Weltpoesie im Literaturbetrieb gewöhnlich abgefertigt wird.
Schon der erste Band der Zanzotto-Werkausgabe, eine Übertragung der in Italien 1968 erschienenen Gedichtsammlung „La Beltà“, demonstriert auf höchst faszinierende Weise die fluiden Aggregatzustände der Wörter und sprachmagischen Energien, die in Zanzottos Dichtung wirksam sind. Die Sprachlandschaft von Zanzottos Gedichten hat fließende Konturen. Der Autor hält die Übergänge zwischen den Wörtern und Versen offen, und diese Unbegrenzbarkeit der einzelnen Fügungen gestattet immer neue sprachalchemistische Verbindungen. So kommt es, dass gleich das erste Gedicht in „La Beltà“ in fünf höchst unterschiedlichen Versionen dargeboten wird, wobei allerdings ausgespart bleibt, wer von dem Übersetzer-Quartett Donatella Capaldi, Maria Fehringer, Ludwig Paulmichl und Peter Waterhouse für welche Version verantwortlich ist. Was im Nachwort emphatisch als „Paradiessprache“ Zanzottos beschrieben wird, meint den Versuch, alle vorgängigen Bedeutungen der Wörter aufzulösen zugunsten einer autonomen Assoziationsbewegung der sprachlichen Kräfte im Gedicht selbst Sprache soll keine Definitionsgewalt mehr ausüben über die im Gedicht aufgerufenen Gegenstände, sondern sich als „deutungslose“ Sprache des „Machtverzichts“ entfalten. Wenn der Dichter Andrea Zanzotto, wie es an einer Stelle heißt, „die Rätsel durchstöbert von Zeit und Natur“, dann hält er inne bei der kleinen, unscheinbaren Einzelheit, beim winzigen Naturding oder beim Sprachpartikel, dessen Würde verteidigt wird gegen die Gewalt des großen Sinn-Zusammenhangs. Der beschworene „Winzling“ kann ein „Grashalm“ sein, ein „Schnee-Blitzchen“, ein „Tauflieglein“ oder das „zimbrische Windisch“ der Himmel. Es können aber auch die Sprachereignisse selbst sein, die „Phonem- und Monemprozessionen, / in jederlei Sinn Richtung Spielart“. Hier, in den ephemeren Dingen einer marginalisierten Schöpfung, in den Koseworten der Kindheit, in Naturbildsplittern und magischen Sprachformeln, findet Zanzotto „La Beltà“, die „Pracht“ und „Schönheit“, die er zur schwierigen Textur seiner Dichtung verwebt. Inmitten all der „Kling-Dinge“ und Kose-Laute tastet der Dichter nach einer „intimen Sprache“ der Berührung:
„Ich sehne. Und beginne den Himmel zu sehnen. Stehe/ im Himmel. In allem was mir gab einen Himmel zu sehen / allem was mich hier im Wohligen ließ. / Gestern: Rücken Geiziger-Geliebter- (ist weiblich), unleidliche Zuwendung heute, Leier- / Lyrik leier-leier. Aber wir werden uns finden / oder ich und meine entfernteste Fee. Fee-Ich.“
(7.32)
Moderation
Wir treten ein in eine Sprach- und Innenwelt. Zanzottos Dichtungen entdecken eine Kindheit der Sprache, sie deuten nicht, sie wissen um die unmittelbaren Reflexe der Intimität, lassen die andere Welt in Ruhe und widmen sich dem Tod in seiner unendlichen, prachtvollen Vielfalt.
Michael Braun, Westdeutscher Rundfunk 3, Gutenbergs Welt, 20.1.2002
Die Vollkommenheit der Schneeflocke
− Andrea Zanzottos Gedichtband La Beltà auf Deutsch. −
Wie manchmal in Italien kommt das Neue von den Rändern der Republik. In Pieve di Soligo, einem kleinen Ort in Venetien, arbeitet in den Jahren des italienischen Wirtschaftswunders ein Lehrer an seinem vierten Gedichtband. Unter Eingeweihten ist Andrea Zanzotto längst kein Unbekannter mehr, aber als die Sammlung „La Beltà“ im April 1968 herauskommt, wird er plötzlich landesweit berühmt. In allen grossen Tageszeitungen bespricht man die aufsehenerregende Publikation, Eugenio Montale schreibt im „Corriere della Sera“ eine Eloge, enthusiastisch macht sich die Literaturwissenschaft über den Band her, sogar im „Times Literary Supplement“ und in „Le Monde“ erscheinen Rezensionen. Vor allem Anhänger avancierter Sprachtheorie und lacanianischer Psychoanalyse stürzen sich begierig auf die hochkomplexen Texte – endlich ein Triumph der Signifikanten, endlich ein veritables Gleiten des Signifikats, endlich ein Beleg für ihre Theoreme.
In der Tat sind die Gedichte der „Beltà“ ungeheuer schwierig, und die Heidegger’sche Formel – „die Sprache als Sprache zur Sprache bringen“ – passt zu den Textbewegungen. Zanzotto hat die Psychoanalyse am eigenen Leib erprobt, das vor-bewusste Sprechen ist ein Scharnier seiner Gedichte, die dennoch eine grosse Konkretion besitzen. Das lyrische Ich operiert unter der Ägide Dantes, der gleich im Eingangsvers des Proömiums zitiert wird: Es geht um die Suche nach dem Wahrhaftigen. Wie beim assoziativen Sprechen in der psychoanalytischen Redekur ist das Zentrum fortwährend spürbar – es wird umkreist und ex negativo heraufbeschworen. Zanzotto formt eine Art Sprachmagma aus Anspielungen auf die illustre Lyriktradition von Dante über Tasso bis zu Leopardi und Pascoli, aus Zitaten eigener Texte, Werbeslogans, Produktnamen, Schlagern und Filmen. Die Landschaft, seit dem Frühwerk letzter Hort des Ursprünglichen, ist nunmehr infiziert von den Folgen der Zivilisation. Das Schöne überlebt höchstens in Form einer verkapselten Zyste.
Den materiellen Charakter der Sprache inszeniert der Dichter, indem er englische Begriffe verwendet, comichafte Interjektionen, stotternde Wiederholungen, Alliterationen, Reihungen von verwandten Vokabeln, falsche Etymologien und isolierte Prä- und Suffixe. Wie eine Stimme aus dem Off wirken die Fussnoten, mit denen Zanzotto zu seinem eigenen Exegeten wird.
Eine sprachphilosophische Interpretation der „Beltà“ greift viel zu kurz. Schliesslich handelt es sich um ein stark autobiographisch geprägtes Buch; immer wieder tauchen Sinninseln auf, thematische Substrate, Mikrogeschichten, sogar Figuren aus dem Dorfalltag wie der – tatsächlich existierende – Bauer Nino. Wie in einem architektonischen Bauwerk, das im Verlauf mehrerer Jahrhunderte entstand, überlagern sich in jedem Gedicht mehrere Schichten; jeder Vers birgt eine ungeheure Dichte an Anspielungen, Bezügen auf frühere Texte und theoretische Hintergründe. Der Bedeutungsradius eines Motivs wie „Insekt“, „Blut“ oder „Schnee“ reicht bis in die fünfziger Jahre zurück.
Danteske Wanderung
Mit dem sprachzerstörerischen Gestus der italienischen Neoavanguardia, gegen deren ideologische Schlagrichtung Zanzotto schon 1962 heftig polemisierte, hat seine danteske Wanderung durch die allmählich schwindende venetische Landschaft nichts zu tun. Sein Ich richtet sich an ein ungreifbares Objekt und vermutet das Wahre, Absolute immer jenseits des eigenen Standpunktes. Dieses Absolute nimmt aber ganz konkrete Formen an: Es kann das weibliche Geschlecht sein, das Gedicht an sich, die lyrische Tradition, die Mondgöttin Diana, die Restbestände der Landschaft oder der perfekte Kristall der Schneeflocke. Eine traumatische Kriegserfahrung – in einem Maisfeld verborgen, überlebte Zanzotto die Erschiessung einiger Kameraden aus dem Widerstand – taucht in verschiedenen Variationen auf. In der Mitte des Bandes, gewissermassen als Nabel des Ganzen, findet sich die „Elegia in petèl“, eine Elegie in der Ammensprache, wie sie in Venetien Mütter mit ihren Kindern sprechen.
Die Nachahmung der frühkindlichen Laute bietet so etwas wie eine Schutzzone, in der die Sprache noch unberührt von konventionalisierten Bedeutungen ist. Der flüssige, milchartige Charakter dieses Lallens schlägt sich lautlich in dem Gedicht nieder. Die Regression, auch für Zanzottos Patron Hölderlin-Scardanelli die einzige Zufluchtsstätte, kann aber von traumatischen Erfahrungen nicht befreien. Die Alltagssprache und die Sprache der klassischen Dichtung bleiben trotz den Verstümmelungen durch die Geschichte der (oft negative) Referenzhorizont.
Wie soll man ein derartiges Buch übersetzen? Nach der Lektüre des wagemutigen Unterfangens von Peter Waterhouse, Maria Fehringer, Donatella Capaldi und Ludwig Paulmichl stellt sich die Erkenntnis ein: vielleicht gar nicht. Das Quartett, bereits mit der preisgekrönten Zanzotto- Anthologie „Lichtbrechung“ hervorgetreten, beginnt mit diesem Band gar eine Werkausgabe des venetischen Dichters. Wiederzuerkennen ist die atemraubende Stimme Zanzottos in der deutschen Ausgabe häufig nicht. Und warum man auf ausführliche Kommentare und Erläuterungen verzichtet, obwohl in Italien inzwischen ein hervorragend edierter Zanzotto-Band der Reihe „I Meridiani“ vorliegt, bleibt unverständlich. Fragwürdig ist bereits die Titelwahl: „Pracht“ für „La Beltà“ klingt viel zu barock und überzuckert angesichts des strengen Begriffs, in dem etwas Lateinisches mitzuschwingen scheint und der auf Leopardi anspielt. Beltà ist eine archaische Variante von bellezza, „Schönheit“. Das Wort „Schönheit“ wäre zwar eher eindimensional, entspräche aber mehr dem Gestus. Weil Beltà ein Leitmotiv ist, setzt sich dieser falsche Ton durch die gesamte Sammlung fort.
Vielleicht aus Ratlosigkeit bieten die Übersetzer gleich vier Fassungen des ersten Gedichts, „Oltranza Oltraggio“, an. An zwei Stellen sind dieselben Texte doppelt abgedruckt, sowohl auf Deutsch als auch auf Italienisch – unverständlicherweise, da in Abweichung von der Originalausgabe der „Beltà“. Vielleicht wollte man den zyklischen Charakter der Sammlung betonen. Waterhouse, Fehringer, Capaldi und Paulmichl spielen sich damit aber als Mitautoren des Bandes auf, was nicht ohne Peinlichkeit ist. Vor allem die Schnee-Gedichte weisen zahlreiche übersetzerische Übergriffe auf. Aus dem kühlen „La perfezione della neve“ wird ein schwülstiges „Das Reichtum des Schnee“ (warum, um alles auf der Welt, „das“, und warum nicht einfach „die Vollkommenheit“?). In dieselbe Richtung geht „Königreich“ für „perfezionato“, es ist immer noch die Rede vom Tanz der Schneeflocken. Die deutsche Variante nimmt dem Vers den abstrakten Charakter; dabei führen die Motive Schnee und Eis immer in die Bereiche der Mathematik und des Abstrakten.
Für Zanzotto bieten Fachbegriffe häufig einen Ausweg aus dem Dilemma, mit zerschlissenen Wörtern operieren zu müssen (vor allem in der fünfzehn Jahre später erschienenen Sammlung „Fosfeni“). Der Anfang desselben Gedichtes, „Quante perfezioni, quante / quante totalità“ (in der Zanzotto-Forschung als Anspielung auf Dante gewertet, Par. XXIII, Vers 130), heisst bei Waterhouse „Solche Reichtümer, solche / solche Alle.“ „Vollkommenheiten“ und „Totalitäten“ würde der Sache näher kommen, denn es handelt sich – wie bei Dante – um ein Staunen über die Blendung durch den Schnee (bei Dante ist es das Licht). Die Vokabel „vita“ wird häufig mit „Dasein“ übersetzt. Die deutschen Begriffe lösen völlig andere Assoziationen aus. Das „grande magazzino“, ein Kaufhaus, ist bei Waterhouse & Co. ein „Süssmarkt“. „Stagione“, die „Jahreszeit“ oder „Saison“, ein Schlüsselbegriff, der mit Zanzottos Verständnis von Landschaft, dem Wechsel der Jahreszeiten und geschichtsphilosophischen Positionen zu tun hat, wird in der deutschen Fassung zu „Alljährlichkeit“, weil das lateinische Etymon statio einfliessen soll. Die „quiete marginale“, eine „marginale“ oder „nebensächliche Ruhe“, worin die „Quiete dopo la tempesta“ Leopardis mitschwingt, wandelt sich zu einem „Saum der Stille“.
Mystisches Raunen
Bei allen Lösungen entsteht der Eindruck des Mystischen – ein raunender Zanzotto ist das Ergebnis. Hinter der Dunkelheit des Dichters verbergen sich aber häufig Fragestellungen, die wie Paradoxa formuliert sind und sich nach einer absurden Logik auflösen lassen. Die philosophische, manchmal auch psychoanalytische Spitzfindigkeit des Autors, der immer das Gegenteil des Gesagten mitdenkt, ist in „Pracht“ kaum zu spüren, ebenso wenig wie seine Ironie und sein sarkastischer Witz. Aber damit noch nicht genug.
Der Anfang des VII. Gedichts der Reihe „Possibili prefazi o riprese o conclusioni“ lautet im italienischen Original folgendermassen: „Più e meno che oniricamente / dal versante del voi- vero dell’io-forse / più o meno, a fondo e di striscio, / riallaccio e preservo faseggiare e atteggiare: / non sta il punto di equilibrio mai là: non apporsi accingersi / a te bella, beltà“. In der Auseinandersetzung zwischen dem Ich und der Landschaft – la beltà – geht es um frühere ästhetische Positionen und neue Möglichkeiten der Dichtung. Bedeutungsschwankungen ergeben sich aus der aufgelösten Hierarchie der Satzteile sowie der Neubildung faseggiare (von fase – Phase) und der Verwendung nichtreflexiver Infinitive wie apporre und accingere als reflexive. Eine weitere Schwierigkeit dieser Verse ist die Doppeldeutigkeit verschiedener Begriffe: versante meint sowohl den „Berghang“ als auch die „Seite“ im abstrakten Sinn, a fondo e di striscio ist eine wunderschöne Umschreibung von Gegensätzen, „in der Tiefe und knapp daneben“ etwa, kann aber auch „gründlich und oberflächlich“ heissen.
Eine interlineare Übersetzung der Passage: „Mehr und weniger als onirisch / auf der Seite des Ihrwahr des Ich-vielleicht / mehr oder weniger, tiefgründig und knapp daneben / knüpfe ich an und behalte bei das Phasenhafte und Sich- eine-Haltung-geben / der Punkt des Gleichgewichts ist niemals dort: man beginne nicht man setze nicht / auf Dich Schöne, Schönheit“. Die Übersetzung von Waterhouse verfälscht das Original grundlegend: „Grösser als ein Traum und kleiner als ein Träumchen / auf der Wiese des ihr-Wirklich des ich-Vielleicht / ein grösserer und kleinerer, vergraben oder oberflächlich / halte und behalte ich die Splitter und Gesichtchen: / doch nie ins Gleichgewicht gebracht: nicht bestimmen, nicht erstreben / dich prachtvolle, dich Pracht“. Abgesehen von den grammatischen Umformungen und den Hinzuerfindungen passen die Diminutive nicht zu dem Ton des Gedichtes.
Vielleicht ist Zanzotto tatsächlich unübersetzbar. Versucht man es dennoch, müssten die Stimmen seiner deutschen Väter mitschwingen: Hölderlin und Celan. Andernfalls bleibt Zanzotto für die deutschen Leser stumm oder verliert sich in wirren Zeugnissen. Doch um das Sprechen und Gehörtwerden kämpft er ja gerade: „Una riga tremante Hölderlin fammi scrivere“, „eine zitternde Zeile Hölderlin lass mich schreiben“.
Maike Albath, Neue Zürcher Zeitung, 14.3.2002
Andrea Zanzotto: Beltà
Ein großes, auf neun Bände angelegtes Unternehmen unter dem Gesamttitel Planet Beltà – Friedrich Schlegels Diktum von der Romantischen Poesie als Progressiver Universalpoesie scheint hier eingelöst zu werden, unter Wörtern und Versen, zwischen den Sprachen, gerade dort, wo sich die Übersetzung nicht „richtig“ oder „gekonnt“ zuwendet. „Die kleinen Kräfte der Sprache werden bekräftigt“, heißt es im Nachwort. Zwischen den tönenden Groß-Wörtern, den Angebern und sich fortzeugenden Vielsilbern, und dem Partikel-Stottern, der (Sprach-)Winzigkeit sucht die Stimme Brüche und Brücken, wird Verstehen listig zum anderen, das auch betörtes, weises Spiel ist, gelockt. Albernheit, die um das Bewusstsein des Gegenteils, der Negation, ja der Negativen Dialektik Reifere (weshalb Adorno sie liebte – oder umgekehrt: weil er die Albernheit liebte, zur Negativen Dialektik stieß): Albernheit führt Regie in dieser fröhlichen Poesie-Wissenschaft des Andrea Zanzotto-Scardanelli: „Holla die Explosion des Bedeutens des Bildens / für die Kinder von Mittenwald, / holla Pädagogien!“ „Ich soll nunmehr den Fehlern im System Eros-Anmut, / im Mehrungsmurmeln und im Pracht-Gepränge / wie es viele tun / mit – angeblich sinnvollem – Spott begegnen? / Nein, ich lehne nichts ab, ich billige nichts. / Ich unterstütze, wie es viele tun, mit einem – angeblich sinnvollen – Stoff, einem Klebstoff.“ Bis zum letzten Wort „madre-norma / Mutter-Muster“ sind die Salti dieses Gedichtbandes von 1968 so inspirierend in sein deutschitalienisches Wechselspiel gebracht, in Vokabelwitz, Meta-Verstand und das beschwingte Dazukommen der Einzelheit, dass die Begeisterung sich anpasst und statt von der Insel Utopia vom Planet Beltà zu schwärmen bereit ist… – Aber ist nicht die Turbulenz, die den gewohnten Zusammenhängen, den ermüdeten, und gerade den politischen, quasi mit Fellini-Intelligenz und Pasolini-Pathos anarchisch und bis in jede Groß-Einzelheit mitspielt (vielmehr: die Spielregeln nimmt), gegenüber der, so scheint es, aufgerufenen Instanz: Hölderlin und seiner bescheiden in Satzform hingespannten und tief denkenden Poesie – ein Sakrileg? Merkwürdigerweise nicht; und schon gar nicht gegenüber dem Hölderlin, den uns inzwischen Dieter Sattler zugänglich gemacht hat. Irgendwann während der lauten und leisen Lektüre hast du die Reflexion dieser Dichtung, ihre Ruf- und Springlust, bestiegen; vielleicht mit dem wiederholten und deutsch-italienisch gegenübergestellten „Auf die Welt / Al Mundo“, mit dem Anfang: „Welt, sei, und jetzt brav; / schön brav bestehen, / hopp hopp, versuch’s nur, auf geht’s, alles mir sagen, / und schau wie ich umwarf unfolgsam war / und jedes Verpuppte ganz / genauso rumorte wie jedes Entpuppte;“ oder erst mit dem Schluss: „Auf, Bella, auf. // münchhausen, steig.“ Dann stellt sich doch Andacht, eine andere zwar, und sogar eine gewisse Reinheit der Empfindung, das poetische Gefühl also, ein. „Die lallende Elegie“ beginnt: „Süßes elegisches Wandeln wie in Elegien wandelt der Herbst, / ein gründliches Sammeln ein goldenes Lichten, / den Ernteberg und den Untergang gewichten / auch wenn ich längst mein Fasten und die Leere lehre. / Und hier steh ich aufseiten des Zusammenhangs auch wenn / ich System und festen Grund nicht mag: / das Nichtausdemleimgegangene, die Beinahen, dahinter: / ich werde ausgesetzt inmitten eines Götter- / Gesocks, heilloser Heiligkeit. / Ursprünge da – Nie hat es Ursprung gegeben.“ Nun gibt es auch für uns diesen angesprungenen Planeten voller Pracht – und Noten; denn selbst Erläuterungen und Hinweise, das Wissen vom halben Sinn und vom halben Unsinn hat der Autor mit den Übersetzern zu teilen.
Hugo Dittberner, Literaturtipps der Göttinger Sieben (KLG-Redaktion)
Gegen das Geschwätz
− Gedichte von Andrea Zanzotto. −
Aus dem Krähwinkel seines norditalienischen Heimatorts Pieve di Soligo hat der Dichter Andrea Zanzotto in den Jahren 1968/1969 die „Eroberung“ des Monds und damit die Entmythologisierung eines hoch poetischen, mit reichster Symbolik befrachteten Himmelskörpers in Echtzeit mitverfolgt. Dies war, unabhängig vom Standort des Beobachters, möglich, weil die Mondflüge der Nasa in vielfacher Ausstrahlung am Fernsehen spektakulär vorgeführt wurden. Die Inflation der einschlägigen Bilder und Kommentare hat Zanzotto damals zur Niederschrift eines langen polyphonen Gedichts angeregt, das der Entzauberung (der „funktionalen Entweihung“) des Monds entgegenwirken sollte. Dem medialen Gequassel wurde Paroli geboten durch eine Vielzahl von Stimmen, die der Autor zu einem dissonanten Chor vereinigte, dessen delirierender Sang am Rand des Nonsens den grösstmöglichen Kontrast zur wissenschaftlich-technischen Eroberungsrhetorik bildete – dichterischer Hermetismus wider das automatisierte „Geschwätz der Zeit“. Nur der hermetische Text, der den Un-Sinn riskiert, kann überhaupt noch, wie Zanzotto in seiner Nachbemerkung zum Gedicht festhält, einen Sinn annehmen. Was vorliegt, ist ein tatsächlich radikal jeder voreiligen Verständigung sich verweigerndes Stück Literatur, das vom Leser ebenso radikal angeeignet und überhaupt erst mit Sinn bedacht werden muss. Einzig so kann man wohl heute noch „genesen an Poesie die siehe da Massaker ist Gewaltakt“. Ein Gewaltakt ist nicht zuletzt die Übersetzung des grossen Gedichts – auch sie eigensinnig bis zum Nonsens, auch sie letztlich nur eine Lesart von vielen. Allein dass sie gewagt wurde, sollte Ermunterung genug sein zu kritischem Nach- und Gegenlesen, zu produktivem Weiterlesen ohnehin.
Felix Philipp Ingold, Neue Zürcher Zeitung, 16.1.2003
Pracht-Band
− Neu übersetzt: Lyrik von Andrea Zanzotto. −
Manche Bücher brauchen Jahrzehnte bis sie uns erreichen: im Jahre 1968 erschien in Italien die Gedichtsammlung „La Beltà“ des hierzulande kaum bekannten Dichters Andrea Zanzotto und wurde als sprachliches Ereignis gefeiert. Jetzt liegt der Band in einer bemerkenswerten „Übersetzung“ diesseits der Alpen im deutschsprachigen Raum vor. „Pracht“ heißt der Eröffnungsband, der auf insgesamt neun Bände angelegten Edition „Planet Beltà“, die zwei kleinere muntere Verlage aus der Schweiz und Österreich gemeinsam auf den Weg gebracht haben.
Bereits im Jahr 2000 wurde dieses Transitunternehmen bereits mit dem Zuger Übersetzer-Stipendium belohnt. Denn einiges an der von Donatella Capaldi, (der leider viel zu früh verstorbenen) Maria Fehringer, Ludwig Paulmichl und Peter Waterhouse geleisteten Übersetzung ist auch gewagt und überrascht den Leser, führt ihn ins Zentrum jedes Übersetzens, hin zu der Frage, ob und wie die Vermittlung zwischen und in zwei Sprachen überhaupt möglich sei.
Diese Schwierigkeit wird um ein Vielfaches durch die lyrische Sprache Zanzottos selbst gesteigert. Versuchen doch die Gedichte ihrem Sprechen etwas abzulauschen und (wieder) zu entdecken, das als Potential tief verschüttet darin schlummert. An den Bruch- und Leerstellen semantischer und grammatikalischer Ordnung scheinen „Babel und Antibabel“ zugleich auf. Hochkomplexe Gebilde entstehen, mit einer vielschichtig oszillierenden Vagheit, die im Hinblick auf eine evozierte Wirklichkeit eben nicht die Unterscheidung wahr /unwahr leisten wollen: „Es brannte das Wunder und die Realität“. Hier ist der Dichter Zanzotto Archäologe, Alchemist und ein dem Spiel mit der Mutter(-)Sprache hingegebenes Kind. Das Bestaunte ist die Pracht, von der er mit Rilke weiß, daß sie „des Schrecklichen Anfang“ ist: „nur dieses entleerte, unangeglichene Wort, (…) das entreißt, unterbricht / und enteint, eins, (…) Pracht, Napalm, / wo die Phiole die Zyste geplatzt ist, / die Zeit geplatzt das Überdauern geplatzt ist.“
„La Beltà“ versammelt Langgedichte und Gedichtzyklen, die Zanzotto als einen Naturlyriker zeigen. Tief verwurzelt in der provinziellen Heimat seines Dorfes im Veneto überblickt er zugleich die Horizonte klassischer Bildung und zeitgenössischer Diskurse. Es begegnen sich Wortschätze, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten: aus Dialekt und Werbung, aus Fachsprachen und Literatur, Comics und Kindersprache. Dieses Sprachmaterial befindet sich in einem andauernden Transformationsprozeß und offenbart dabei seine elementarste Verbindung: im Lautlichen.
Zwischen den Polen von sprachphilosophischer Reflexion und Sprachmagie, in der Durchdringung, ja im Durcheinander der Bedeutungsebenen, stellt sich beim Leser, wie Pier Paolo Pasolini formulierte, ein „beispielloser Zustand der Entfremdung von allen Gewohnheiten“ ein. Der poeta doctus Zanzotto, der die Gedichte zu ihrem eigenen Spiegelkabinett werden läßt, macht unter Verzicht auf falsche Idyllik oder Avantgardistik jenes Krisenbewußtsein der Moderne kenntlich, das mit Sprachskepsis, Fragmentierung und Dissoziierung aller überkommenen Sinn- und Identitätsgefüge oft beschrieben wurde.
Aber mehr noch wollen diese Gedicht-Sprach-Räume etwas namhaft machen, das an den Rändern zur Stille, zum „Unerhörten“, wie es unter Anspielung auf Dantes „Paradiso“ heißt, angesiedelt ist. Dem Meta-Physiker Zanzotto ist dies die Schnittstelle, wo äußere Wahrnehmung und inneres Erkennen konvertieren, wo die Wunde des Bewußtseins vielleicht in ein wunderbares „Denken vor dem Denken“ aufgeht. Gerade die sinnlich erfahrbare Totalität der eigenen Körperlichkeit verbürgt im Sprechenkönnen und Schweigenmüssen die Teilhabe an einem umfassenden, wenngleich nie zu erfassenden Ganzen. In Zanzottos Naturlyrik wird die romantische Suche nach einer universalen Natursprache fortgeschrieben. Seine Gedichte sind Echolote, gerichtet auf das Unsagbare. Er gibt trotz der radikalen kulturellen Umbrüche der Gegenwart die utopische und paradoxe Hoffnung nicht auf, daß dort, wo Sprache und Welt Gefahr laufen unterzugehen, sie auch gerettet werden können.
Nicht von ungefähr ist Hölderlin (und Scardanelli) ihm ein ständiger Begleiter und Ansprechpartner. Wie jener sucht er mit ebenso anarchischem wie zartem Furor die sprachliche Berührung der Welt, die materiale Konkretheit der Dinge in ihren Namen, eine Form der Übersetzung auch. Es ist ein antikes, bukolisches Erbe mit dem Glauben an eine im „ekstatischen“ Sprechen verbürgte Präsenz und dem Lachen des Satyr über sich selbst: „Und prachtvoll dieses Liegen im Lächerlichen, im Verehren“.
Andreas Kohm, Südkurier, 24.5.2003
Andrea Zanzottos La Beltà
„tutto fronzuto trotterellante di verdi visioni“ – in diesem Vers bewegt sich etwas trippelnd oder in leichtem Traben durch grüne Bilder oder Wälder und Dickicht. In einem der ersten Übersetzungsversuche ins Deutsche hieß das: unter Blättern trippelnd durch grüne Bilder, also „tutto fronzuto“ übersetzt zu „unter Blättern“ oder vielleicht „unter Laub“. Aber wer hier durch den Wald schlüpft, der mit dem Trippelschritt, ist ja gar nicht zu unterscheiden von diesem „tutto fronzuto“, von den Blättern, sondern er selbst ist es, der Blätter hat, der Gehende selbst trägt die Blätter und gleicht dadurch ein wenig einem Baum – so hieß der Vers dann in der deutschen Übersetzung: „dicht belaubt schlüpfend durch grüne Erscheinung“. Der Geher ist mit den Blättern ausgestattet, trägt das Laub. Vielleicht ist es ein Vorgang der Assimilierung. Wenige Zeilen später in diesem Gedicht sagt dieser Spaziergänger, nein, dieser Zappelnde und Atemlose, fast Neugeborene: „ei die Anhöhen, Weiches an die Nase zu halten beschnuppern / assimilieren“, die kleinen Höhen des Veneto sind hier wie süße Pfirsiche vielleicht oder wie ein Spielzeug, das die kleinsten Kinder in den Mund nehmen. „ei die Anhöhen, Weiches an die Nase zu halten beschnuppern / assimilieren wie es tat jenes Alte: das Ich, / das Ich das schon immer zwischen Wäldern und Hirten“ – und am Schluß dieses Verses fehlt das Verbum, also nicht das Ich, das zwischen den Wäldern und Hirten ging oder wohnte oder lebte. Sondern es ist eigentlich gebildet aus dem Stoff der Wälder und der Hirten, es ist dort „intra“, inmitten, es ist aus diesem Waldstoff und Weltstoff, es ist mehr eine Substanz als ein Subjekt. Und die Sprache, wie sie in den Gedichten von Andrea Zanzotto zu hören oder zu lesen ist, ist wohl eine Art, jenes nicht subjektive Ich zu erlernen, eine Assimilierung an jenes Ich, ein Gleichwerden, ein Erlernen der Sprache des Planeten, ein Zuhören dem Planeten und dann Zugehören. Nicht das Ich-Ich spricht, sondern ein anderes Ich aus Wald, Hügeln, Licht, Gärten, Blüten, Wein, Knospen, Mandeln, Schneeflocken, Bächen, Kalligrammen, venezianischen Kanälen und Atollen, Kindern, Meer und Sand und süßen Pfirsichbergen. Und was sagt dieses landschaftliche, landschriftliche Ich? Darauf gibt vielleicht Andrea Zanzottos sehr berühmter Gedichtband „La Beltà“ Antworten, der Gedichtband „Pracht“. Die Welt scheint nämlich eine Pracht-Sprache (fast so etwas wie eine „Spracht“) zu kennen und zu sprechen, überhaupt an eine paradiesische Ordnung zu erinnern, an besondere Reichtümer und Potentiale. In einem der Gedichte in „La Beltà“ wird dieses andere Ich als ein unscheinbares Werk angesprochen, als eine andere Geschichte, und der Sprecher des Gedichts sagt von diesem Werk: „mir schien es wie ein begründetes System, / wie ein Weg, ein Dickicht oder mehr. / Eine nährende Speise“. Sprache-Speise. Aber es gibt auch einen Hinweis auf Jacques Lacans Begriff des „Spiegelstadiums“, das einen Abschnitt im Leben des etwa dreijährigen Kindes darstellt, wenn das Kind in einem Spiegel an der Wand die visuelle Einheit seines Leibes entdeckt und erfindet, die Einheit seiner ganzen Artikulationen. Ich glaube allerdings, daß in Andrea Zanzottos Gedichten ein anderer Spiegel ist und eine ganz andere Einheit entworfen wird, die lang wie das Leben ist. Es ist nicht der silberne Spiegel im Haus, sondern das Spieglein Spieglein der Landschaft, welches ein Gesamtbild der Pracht entwirft.
Im Gedichtband „La Beltà“ wird das Spiegelstadium auf die folgende Weise angesprochen: „Das in der Psychologie sogenannte „Spiegelstadium“/ in seiner Bedeutung für die Funktion des Ich. / Mit Unterthänigkeit.“ Mit dieser Formel von der Untertänigkeit und mit dem Namen Scardanelli hat Friedrich Hölderlin viele seiner späten Gedichte gezeichnet, genauer gesagt unterschrieben. Es sind die Gedichte aus den Jahren 1812 – 1843, als Hölderlin von dem Tübinger Schreinermeister Ernst Zimmer und seiner Frau Elisabeth Zimmer beherbergt und in Pflege genommen wurde. Ein paar Zellen später übersetzt Zanzotto diese Untertänigkeit ins Italienische als soggezione, und in dem italienischen Wort erkennt man das Subjekt/soggetto, welches kein Ich ist, sondern ein unter dem Einfluß der Welt stehendes Etwas ist, etwas in die Welt Eingekapseltes ist. Es ist kein tuendes Ich, sondern ein unter einem Tun stehendes, ein untertuendes oder untertanes Ich. Welches Tun ist das, in welchem das Ich befangen und aufgehoben ist? Vielleicht: das Natur-Tun, die Herrlichkeit, die Pracht, das Paradies. Und daraus die Folge: menschliches Tun, es sei denn, es ist georgisches Tun wie in Vergils „Georgica“, ein Tun also, das die euphorischen Stoffe stärkt und die Endorphine, menschliches Tun ist anderenfalls das Gegenteil von Schönheit. Scardanelli ist in diesem Sinne ein Euphoriker, die Gedichte sind erfüllt von – wörtlich – Pracht, Glanz, Schmuck, Vollkommenheit, Verschönerung, ungemessener Weite, Herrlichkeiten, „und prächtig ist das Meiste, / Das grüne Feld ist herrlich ausgebreitet / Da glänzend schön der Bach hinuntergleitet. // Die Berge stehn bedeket mit den Bäumen, / Und herrlich ist die Luft in offnen Räumen“. Diese Herrlichkeitsgedichte schrieb Hölderlin aber, als – wie sein Freund Sinclair in einem Brief schrieb – sein „Wahnsinn eine sehr hohe Stufe erreicht hat“, oder anders gesagt, Hölderlins, Scardanellis Ich die untere, die untertänige Stufe erreichte.
Manchmal ist der große Spiegel der Landschaft schneeweiß im Veneto, und zu diesem Ereignis hat Andrea Zanzotto vor einigen Jahren einen kleinen Januar-Essay geschrieben, in welchem er das Ich als eine andere Ordnung zu charakterisieren versucht: „Der Januar, sieht man von seiner Anfangsphase ab, die von Festen ganz verstopft ist – auch in der Vergangenheit schon – und jetzt noch verroht wird durch das Schneegewerbe (welches meine Gegenden nicht berührt, aber doch ein Gefühl der Unruhe vermittelt, als ob der ganze Gebirgshorizont von Würmern zerfressen und von Ameisen durchwühlt würde angesichts der Massen, die sich in der einen oder anderen Art dort tummeln), ist immer noch einer der angenehmsten und ausgeglichensten Monate. Höchste Spannungen bauen sich auf in den Lichtern und Farben – blau, violett, rosa, indigo in allen unausdenkbarsten Varianten -, setzen sich dann und nisten sich ein in jeden Winkel der Landschaft; und daraus entspringt eine Ordnung, die fortwährend umgestaltet wird, dabei aber immer etwas Definitives in sich trägt, in beruhigenden Ewigkeitsformen. Es ist kein Geheimnis, daß der Winter eben nicht die Zeit des Todes der Dinge, ihres Untergangs ist, sondern im Gegenteil ein mächtiger Verweis auf eine Zeit darüber hinaus. Und im Januar bekommt man ein Gespür dafür, daß jener immer wieder in sich selbst mündende Ring, das Jahr (im Italienischen sind die beiden Wörter etymologisch verwandt), entzweibricht, sich unterbricht und zurücktritt vor dem großen Gesetz unendlicher Stabilität, die jedoch eine Leere, ein Auseinanderklaffen in sich birgt. Und es scheint, daß sich darin die letztendlichen Gründe offenbaren, die, von einem Anderswo her, gewiß nicht gegen das Leben sprechen, sondern ‚für‘ eine andere Form von Leben, in der ersteres, jenes eingekerkerte, auf immer bewahrt würde, blendend vor Wahrheit und Licht, die unter einem Zauber ‚erstarrt‘ sind, dabei stets bereit, wenn es so weit sein wird, sich zu lösen in der Wärme und Feuchte eines neuerlichen Keimungsprozesses.“
Andrea Zanzotto ist im Veneto zur Welt gekommen, auf der terra ferma nördlich von Venedig in einem Dorf, das vielleicht genau in der Mitte zwischen dem adriatischen Meer und den Gebirgsstöcken der Dolomiten liegt. Er hat diese Landschaft und das Dorf selten und nicht gern verlassen, er lebt auch heute im Dorf seiner Kindheit. Man wird ihn nicht zu den mobilen zählen. Es hält ihn ein Nichtentfernenkönnen vom Prächtigen in diesem Gesichtskreis fest. Man kann sich an den englischen Dichter John Clare erinnert fühlen, der 1793 in Helpstone zur Welt kam und als Neununddreißigjähriger das Dorf verließ und ins drei Meilen entfernte Nachbardorf Northborough übersiedelte und durch diese geringe Veränderung eine große Veränderung erfuhr und große Desorientierung und krank wurde für den Rest seines Lebens. Spricht man von Nähe, Verknüpfung und Spiegelung, so muß man auf Zanzottos Schreiben im Dialekt hinweisen und auf seine Zellen in PetèI, der Ammensprache, die ihre Bedeutung nur im Lallen und in den Lauten und im Melodischen hat. Im Dialekt spricht das Ich regional, örtlich, privat, zugleich aber geht dieses Sprechen ins Überindividuelle, Anonyme über, nicht mehr das Ich spricht, sondern die Klänge und Tönungen des Landstrichs. Ebenso in der Ammensprache: da spricht nicht das Ich – weil es von dem Kind vermutlich noch gar nicht gebildet ist – sondern das Klingende, Unintentionale, fast Bedeutungsfreie, das aber in seinen Bedeutungen vom Kind, vom Nicht-Ich des Kindes vielleicht, sofort verstanden oder vernommen wird als Medium der Verbundenheit und als Herrlichkeit und als Grenzenlosigkeit, auch als vollkommene Rede ohne Klage, wie sie auch ertönt im HölderlinScardanelli- icht-Ich Vers: „Und die Vollkommenheit ist ohne Klage“, oder: Die Vollkommenheit ist voller Klänge.
Die Dialektgedichte Andrea Zanzottos befassen sich mit Freunden, die irgendwo in der Ferne sind, Montale zum Beispiel, mit Verstorbenen, Pier Paolo Pasolini zum Beispiel oder mit den ausgestorbenen Formen des Handwerks im Dorf, mit der 1975 verstorbenen Opernsängerin Toti dal Monte. Der Dialekt stiftet in diesen Gedichten Kohäsion, und es ist beinahe so, als könnte er die Entrissenen festhalten und eine andere Zeit gewinnen. Beim Begräbnis der Sängerin ist die Szene auf einmal wie ein Kinderspiel, wie ein „funeralino, / fatto da alcuni bambini“, fast wie ein Begräbnisspiel einiger Kinder. Das ist wie die Umkehrung der Zeit in Scardanellis extremen Rückdatierungen seiner Gedichte, im 19. Jahrhundert geschrieben, aber rückdatiert in einem Fall sogar bis in den Januar 1676, als es dieses schreibende Ich noch gar nicht gab.
Andrea Zanzottos Werk besteht aus Gedichten, Essays, Erzählungen und ist in Italien in zahlreichen Ausgaben erschienen, zuletzt 1999 in einem mehr als 1800 Seiten umfassenden Überblick in der Reihe „I Meridiani“ unter dem Titel „Le Poesie e Prose Scelte“, herausgegeben, ausführlich kommentiert und bibliographiert von Stefano Dal Bianco und Gian Mario Villalta. Diese Ausgabe erkundet auch Zanzottos sehr großes Nebenwerk, nämlich die nicht wenigen faszinierenden Interviews, die Beiträge in Zeitschriften und Zeitungen, vor allem im Corriere della Sera, und ermöglicht einen Einblick in das reiche Archiv des Dichters, das von Liedern über Hegel und Freud als Kinder, fast universalistisch, bis zu einer „Archeoligia vinaria“, einer Studie über die verschwundenen Weinreben reicht.
Peter Waterhouse, April 2000
Zanzottos Dichtungen sind hochkultiviert,
eine wahre Immersion in den Vor-Ausdruck, der den artikulierten Wörtern vorausgeht und sich dann mit Tiraden von Synonymen zufriedengibt, mit Wörtern, die sich allein durch phonische Affinitäten zusammentun, mit Gestammel, Interjektionen und vor allem mit Wiederholungen. Er ist ein perkussiver, aber kein lärmender Dichter. Sein Metronom ist vielleicht der Herzschlag.
Eugenio Montale, Kommentar zu „La Beltà“
L. Paulmichl und P. Waterhouse über ihre Übersetzungen von Andrea Zanzotto
„Etwa durch einen Plastiksack“
OLTRANZA OLTRAGGIO
Salti saltabecchi friggendo puro-pura
nel vuoto spinto outré
ti fai più in là
intangibile – tutto sommato –
tutto sommato
tutto
sei più in là
ti vedo nel fondo della mia serachiusascura
ti identifico tra i non i sic i sigh
ti disidentifico
solo no solo sì solo
piena di punte immite frigida
ti fai più in là
e sprofondi e strafai in te sempre più in te
fotti il campo
decedi verso
nel tuo sprofondi
brilli feroce inconsutile nonnulla
l’esplodente l’eclatante e non si sente
nulla non si sente
no sei saltata più in là
ricca saltabeccante là
L’oltraggio
So sehr Andrea Zanzottos Dichtung als schwierig gilt, sogar als dunkel, so viele Lichtpunkte, Aufhellungen und Schnee gibt es in ihr. Der 1968 veröffentlichte Gedichtband La Belta, ein Buch, das zu jenen „unübersetzbaren“ Gedichten zählen könnte, denen Theresia Prammers Studie mit Fragen begegnet, „viel besprochen und dennoch ungebrochen rätselhaft“, führt im ersten Gedicht schon und mit dem ersten Wort in einen Bereich von viel Licht und Klarheit. „Oltraggio“, das Titelwort des ersten Gedichts, kommentiert der Autor in den Noten am Ende des Buchs, rückt es ein in den siebenundfünfzigsten Vers des dreiunddreißigsten Gesangs des „Paradies“ der Divina Commedia, so dass man im schwierigen Gedichtband, gleich an seinem Anfang, Dantes Verse über das große Schauen mitlesen kann. Jener Vers im „Paradiso“ ist Teil eines Satzes, der folgendermaßen lautet:
Da quinci innanzi il mio veder fu maggio
Che il parlar nostro, ch’a tal vista cede,
E cede la memoria a tanto oltraggio.
In der Übersetzung von Hermann Gmelin:
Von jetzt ab war mein Schauen noch viel größer
Als unsre Sprache, die ihm nicht gewachsen,
Und das Gedächtnis weicht dem Unerhörten.
„Oltraggio“ also, die im Titel angekündigte Sache des Gedichts, ist etwas, vor dem das Gedächtnis zurückweicht, das die Erkenntnisfähigkeit des Gedächtnisses überschreitet. Mit Gedächtnis, Erinnerung gelangt man nicht zum „oltraggio“. „Oltraggio“ ist gedächtnisfrei, darum auch, wie Gmelin übersetzt hat, „unerhört“ (obgleich die Übersetzungskritik, wie sie heute in durchschnittlichen Buchbesprechungen zu finden ist, hier einen Fehler festlegen würde, „geht es doch nicht um das Hören (Unerhörtes), sondern um Sehen“, zitiert nach Zürcher Zeitung, Frankfurter Zeitung, Hamburger Zeitung, Woche für Woche). Überaus viel Erkenntnis, „tanto oltraggio“, nicht allein Unerhörtes, sondern so viel Unerhörtes – unsere Sprache bricht davor ab, hat dafür keine Worte, Begriffe, unser Gedächtnis kennt eine solche Erscheinung nicht.
Keine Sprache dafür, kein Gedächtnis dafür. Ist also der Titel des Buchs, La Beltà, welches ja kein Wort der Sprache ist und eine Erscheinung, für die es Erinnerung und Gedächtnis zu geben scheint, ist das Titelwort gar nicht so recht der Titel für das, was es im Buch gibt? Müsste der Titel des Buchs eher weiß sein, ein weißer Umschlag, ein dem Unerhörten Weichendes, „il mio veder fu maggio / che il parlar nostro“? Das Buch wäre eigentlich beinahe titellos, das erste Gedicht wohl auch titellos? Das Gedicht auch objektlos, referenzlos? Wenn diesem Gedicht, zum Erreichen seines Themas und Titels, „il parlar nostro“ und unsere Sprache nicht zureicht, wie strebt das Gedicht dennoch nach Erfüllung? Nicht mittels Sprache, sondern mittels Wiederholung, sehr vieler Wiederholungen. Das kleine erste Gedicht des Gedichtbands La Beltà greift nicht weit und hoch hinaus nach dem Unerhörten, sondern scheint sich zu beschränken auf Wiederholungen. Fast könnte man den Eindruck haben, es bestehe ausschließlich aus Wiederholungen. Schon der Titel führt zweimal das Wort „ultra“ an, spricht vom Ultra-Gelegenen nicht bloß einmal, sondern wiederholt seine Sache: „Oltranza oltraggio“. Kein Gedächtnis, doch Wiederholungen? In der ersten Gedichtzeile: „salti“ – „saltabecci“, „puro“ – „pura“. Dann weiter: „ti fai più in là“ – „sei più in là“ – „ti fai più in là“ – „strafai più in te“ – „sei più in là“, „tutto sommato“ – „tutto sommato“ – „tutto“; „ti identifico“ – „ti disindentifico“, „solo no“ – „solo sì“ – „solo“; „si sente nulla“ – „non si sente – no“; „saltata“ – „saltabeccante“, Wiederholungen, doch könnte man diese sprachlichen Erscheinungen nicht auch klassifizieren als Übersetzungen, auch als Variationen? Was wird variiert und übersetzt? Vielleicht wird fortwährend das erste Wort „salti“ variiert, die springende Bewegungsform, mit der sich die Sache, das Unerhörte, das Ungedachte, das Du, die Referenz entzieht? Du springst: hüpfst: bist weiter drüben: bist weiter drüben: bist nicht zu berühren: nicht zu identifizieren: bist weiter drüben: entspringst: verschwindest: bist nichts: man hört nichts: springst weg. Am Schluss des Gedichts noch einmal Wiederholung: Das Titelwort „oltraggio“ wird in das letzte Wort des Gedichts übersetzt, wie wenn das Entsprungene entspringen könnte – am Ende des Springens und am Ende der Sprache und des Gedächtnisses: ein Entspringen.
Dass diese Bewegungsform – auch dieser Weg zum Entspringen – Übersetzung sein könnte, das Herbeiholen des Unerhörten, das Überdiegrenzegelangen tatsächlich eine Übersetzung sein könnte, das wird in einem kleinen französisch-italienischen Übersetzungsprozess gezeigt: In der zweiten Hälfte des Gedichts steht die Zeile: „fotti il campo“. Ihr widmet der Autor eine Anmerkung:
fotti il campo, non-traduzione, mezzo senso e mezzo nonsenso, sul francese ,foutre le camp‘, squagliarsela: Nicht-Übersetzung, halb Sinn und halb Unsinn, des französischen ,foutre le camp‘, verduften.
Diese Nicht-Übersetzung, ein Phänomen, welches immer noch nicht in die Klasse der Übersetzungen gereiht wird, liefert kein Abbild des Originals, auch keine Wiederholung oder Variation des französischen Originals, aus dieser Übersetzung und diesem Überspringen entspringt etwas Neues, ganz Neues, Unerhörtes, etwas Größeres als parlar nostro, als unsere Ausgangssprache, etwas nicht im Gedächtnis der ersten Sprache Vorhandenes, eine Bedeutung, welche die französischen Worte gar nicht haben. Die Übersetzung springt über eine Grenze, springt auch aus einem Gedächtnis hinaus, etwas Neues entsteht. Aus dem Französischen „verduften“, „verschwinden“, „entspringen“ wird im italienischen Gedicht, unter Verwendung und Wiederholung ganz derselben Worte: du bespringst, du fickst, du zeugst, du lässt entstehen und entspringen. Diese kleine zanzottianische Übersetzung geht über die Gedächtnisgrenze.
Dieses Gedicht übersetzt – setzt über? Wie wird man ein solches Übersetzendes übersetzen? Indem die Übersetzer nicht nach einem deutschen parlar nostro, nach der eigenen deutschen Sprache streben? Wann übersetzt eine Übersetzung? Übersetzt sie dann, wenn ihr Text dem Original gegenübersteht? Ist aber das nicht eher eine Setzung als eine Übersetzung? Das italienische Original, im vorliegenden Fall, sitzt nicht und hat sich nicht gesetzt, sondern es springt. Bei dem italienischen Gedicht handelt es sich um Übersetzung wie um Überspringung. Und doch ist das viele Über und Hinüber ein Weg zu sich selbst. Am Ende des Gedichts kehrt das selbige Wort aus dem Titel wieder: „oltraggio“. Was ganz ultra ist, ganz drüben, kehrt wieder, das Gedicht blickt sich beinahe ins Gesicht. Vielleicht wie am Ende der Divina Commedia die Schau ins Äußerste, Fernste, ins oltraggio, das eigene Angesicht erscheinen lässt:
Pareva in te come lume riflesso,
Dagli occhi miei alquanto circonspetta,
Dentro da sè, del suo co lore stesso,
Mi parve pinta della nostra effige,
Per che il mio viso in lei tutto era messo.
… wie rückgestrahlte Helle,
Und den mein Aug ein wenig überschaute,
Der ist mir in sich selbst mit eigner Farbe
Mit unsrem Angesicht bemalt erschienen,
Weshalb ich ganz den Blick in ihn versenkte.
(H. G.)
Unfixierbar. Die deutsche Übersetzung von La Beltà versucht in etwa so zu übersetzen, wie das Original übersetzt. Da es sich bei diesem deutschen Versuch um Bewegung handelt, hat die auf mehrere Bände angelegte Übersetzungsedition den Titel Andrea Zanzotto / Planet Beltà bekommen. Der Planet ist, wörtlich, der Bewegliche, der Unfixierte, der durch den Weltraum oder Himmel Fliegende und immer Übersetzende. Noch im Erscheinungsjahr von La Beltà, 1968, schrieb Zanzotto, unter dem filmischen Eindruck des NASA Programms und der ersten Berührung mit dem Mond, dem Planeten, dem Beweglichen, also mit dem oltraggio vielleicht, das Gedicht „Gli Sguardi i Fatti e Senhal“, 1969 dann in quasi unsichtbarer – gegensichtbarer – Edition an winzigstem Ort, im kleinen Städtchen Pieve di Soligo, also unter eingeschränkten Bedingungen, wie als Gegengewicht und Redimensionierung derart eingeschränkt, als Privatdruck fast unmedial, unöffentlich veröffentlicht. Mehr verinnerlicht als veröffentlicht. In diesem Zusatzprotokoll zum großen Gedichttext von La Beltà wird deutlich, dass die Benennung von „oltranza“ und „oltraggio“ und ultra, dass die Ausführungen der NASA und die Eroberung der ersten Mondfelder eine Form von Gewalt und Vergewaltigung sind.
Nicht Welt, sondern Unerreichbarkeit. Im Prosa- und Erzählband Auf der Hochebene und andere Orte liegen die Orte näher als Jenseits, näher als in der Entrückung und Übersetzung, befinden sich anscheinend im Veneto, sind auffindbar, fixierbar. Doch macht schon das Wort „Hochebene“ den Leser vorsichtig, der im Veneto gereist ist. Auch der Ausdruck „andere Orte“ scheint nicht so sehr anzuzeigen, dass es sich um weitere und noch mehr Orte handelt, also um eine Quantität, als tatsächlich um Orte, die anders sind, Orte, die nicht unser sind und nicht parlar nostro. Auch Venedig ist einer dieser anderen Orte, ein verschwimmender Planet, der im Titel angesprochen wird als „Venezia, forse“, „Venedig, vielleicht“. Was hier Hochebene genannt wird, altopiano, ist vielleicht eher ein altropiano, eine andere Ebene. Der Prosatext „Venedig, vielleicht“ setzt ein mit den folgenden Sätzen:
Allein eine lange Einübung in Versetzung, Entwurzelung, Bruch mit jeder gesicherten Perspektive und Gewohnheit könnte uns vielleicht in die Nähe dieser Orte bringen. Vielleicht, um etwas zu verstehen, müsste man dorthin wie zu anderen Zeiten gelangen mit Mitteln anderer Zeiten, durch Sümpfe, Kanäle, Kräuter, fließend in notwendigerweise heimlichen Booten, nach der Durchquerung der Entdeckung eines Raums, wo im verwunderlichen Chaos alle Unterscheidungen in Zweifel gezogen werden und zugleich miteinander leben, gespiegelt und gelöscht, die einen in den anderen wechselseitig.
Diese Annäherung an Venedig also kein NASA Programm, sondern eine Versetzung, Übersetzung, kein geradliniger Weg zum Ziel. „Nur (..) zu Fuß oder als Schwimmer oder zur Hälfte eingetaucht wankend, von Portogruaro aus, wäre man genügend vorbereitet, um dieses undenkliche Keimen zusammenzuckender, hochgereckter, vom Irrealen zerfressener Wirklichkeiten zu streifen, zu berühren.“ Doch die Annäherungsweise, welche die Unerreichbarkeit und das Vielleicht und die Ferne nicht verletzt, macht dann eine intime Begegnung möglich, die jenem Angesicht zu Angesicht zu Angesicht am Ende der Divina Commedia zu vergleichen ist. Ultra-Venezia, in welchem trotz aller NASA-Blicke, Photo-Blicke, trotz des Bilder-Kriegs und der notorischen Berühmtheit und Verfügbarkeit die intime Frage, in jener langen Einübung in die Versetzung und den Bruch der Perspektive, gestellt wird:
wie soll ,irgendein‘ Ich, ein minimales Ich, eines ohne Ansprüche, jenen einzelnen Stein Venedigs wiederfinden, jenen einzelnen Blitz Venedigs, der imstande ist, die Stadt dem Ich als die seine erkennbar zu machen, zugleich es zu einer Selbsteinsicht zu führen? Denn mit süßester und fast seifiger Überredungskunst, durch Ketten von Schocks, aus einer Summe unterschiedlichster Elemente bereitet, und zugleich durch Ketten von Entzügen, Zweifeln, Stummheiten, ,Unentscheidbarkeiten‘, liegt es in der Macht Venedigs, jeden einzelnen zu einem höchsten Augenblick seiner eigenen inneren Geschichte und einer anderen ,Geschichte‘ zu bringen, jeden, im Wohl- wie Ohnmachtsgefühl, zu einer Bestätigung der eigenen Unersetzbarkeit zu bringen, der Notwendigkeit ,auch‘ dieser seiner Augen, Augen aus nichts, um die Stadt anzusehen.
Einer der „anderen“ Orte befindet sich inmitten der Euganäischen Hügel. Der Prosatext mit dem gleichnamigen Titel beginnt so:
Es gibt wirklich bestimmte Orte, besser noch, bestimmte Konkretionen oder Archipele von Orten, in denen es, wie sehr man dort auch eindringen oder wie sehr man sie denken und wieder denken oder sie alle gemeinsam als ein Modell aus der Vogelperspektive wahrnehmen möge, niemals gelingen wird, eine echte ,Landkarte‘ auszumachen, gewisse Routen festzulegen.
Zu einem dieser planetarischen, übersetzerischen „anderen“ Orte kurvt der Erzähler im Automobil mit seinem Freund Marco und „sieht“, „entdeckt“ eine topographische, geologische Besonderheit, die „Dreiförmige“ – „drei geometrisch perfekte Kegel (…) Da, die Euganäische Trimurti! Hier im Veneto sind es nicht, oder doch?, die drei hinduistischen Götter Brahma, Vishnu und Shiva, hier ist die sanskritische Trimurti ein Ort, eine Stelle in Italien. Die indische ist hier eine euganäische Trimurti. Nach langer Betrachtung beschließt der Erzähler, bald zurückzukehren zu dieser Stelle. Vielleicht als Gedächtnishilfe – doch weicht an dieser Stelle das Gedächtnis nicht gerade zurück vor dem Unerhörten, „il mio veder fu maggio / Che il parlar nostro (…) E cede la memoria a tanto oltraggio“? – fertigt der Erzähler eine Skizze an. Später kehren beide viele Male zurück, doch:
Lange in Betrachtung, und ich möchte fast sagen, im Gebet versunken, beschlossen wir, mit mehr Ruhe, aber sehr bald schon wieder hierher zurückzukehren. Ich brachte eine grobe Skizze zu Papier, die der steilen und strengen Exaktheit, dem feinen und launischen Hochmut jener Wesenheiten vergeblich hinterherlief. Wir kehrten viele Male zurück und trafen sie nie mehr wieder an. Es schien, dass… aber nein… es zeigten sich partielle Ähnlichkeiten, Kratzer von Enttäuschungen. Es blieb nur, auf einen anderen Tick der Götter zu hoffen. In Wirklichkeit sind dies Phänomene, die sich kontinuierlich zu jeder Zeit an jedem Ort zeigen können, vor allem in den Bergen: Es wechseln sich ständig ab Stunden, Lichter, Jahreszeiten, Kleinigkeiten, die uns auf tragische Weise spüren lassen, dass es nichts gibt, das Bestand hat, dass alles, auch wenn es reglos ist, sich verändert, denn alles ist auf ein unerreichbares In-sich projiziert.
Welches Sinnesorgan oder welches intelligible Vermögen braucht es, um oltraggio wahrzunehmen? Braucht es die „Augen aus nichts“ aus der Venedig-Prosa? Weiß jener Bauer irgendwo in Italien, von dem in Auf der Hochebene kurz berichtet wird, von solchen „Augen aus nichts“? Neben seinen Feldern lässt er einen Plastiksack zurück, den er, vielleicht unbedacht, vielleicht geistesabwesend, über eines der Messinstrumente des Landesforschungszentrums für Hydrologie und Meteorologie in Teòlo gestülpt hat. Was löst er mit dem Plastiksack aus? Dort im Zentrum „registriert man, sieht man jede atmosphärische Bewegung vorher in kribbelndem Geflimmer und Farbspielen der Computer, das ständige Beben der Himmel wiedergegeben, gesammelt gleichzeitig im ganzen Land von hunderten an den verschiedensten Orten errichteten Vermessungsstationen, Stationen, deren Aufnahmefähigkeit manchmal aufgehoben ist, etwa durch einen Plastiksack, den irgendein Bauer auf den ,Augen des Instruments‘ zurückgelassen hat.“ Der Bauer „löst aufgehobene Aufnahmefähigkeit“ aus. Bedeutet uns Übersetzern jener Bauer mit seinem Plastiksack etwas Beherzigenswertes?
Die Übersetzung unter einem Plastiksack, die lange langsame Übersetzung zusammen mit einer jener seltenen Verlagskoproduktionen – Engeler und Folio –, die für die Langsamkeit noch geeignet sind? Ändert sich unter dem Plastiksack und in der Langsamkeit die Interpretation vielleicht, verliert den Charakter der Eroberung? Wird langsam zur Übersetzung?
Übersetzung und dabei Annäherung an den „anderen Ort“. Im Gedicht „Perfezione della neve“ (im Gedichtband La Beltà/Pracht) – der deutsche Titel des Gedichts ist „Das Reichtum des Schnee“ und das fehlende – fehlende? – Genetiv-s des Schnee ist der Übersetzung zuweilen zum Vorwurf gemacht worden, dabei steht es doch da oder fast da, fast wie da oder eingetaucht ins Schneeweiß der Seite, verschneit wie verneint wie scheinend –, in diesem Gedicht, welches beginnt mit einer Überfülle und Überwältigung und blendenden Helligkeit: „Solche Reichtümer, solche / solche Alle“, findet sich dann eine Art von übersetzendem Wort oder übersetzerischem Wort im Italienischen. An diesem Übersetzerwort erweist sich ein weiteres Mal die Möglichkeit eines Wegs zum oltraggio, zum anderen Ort oder zur weißen Nicht-Welt. Das Gedicht geht zum Schluss in ein Telefongespräch über: „Hier bin ich. Wer spricht? Wieder schließen.“ „Pronto. A chi parlo? Riallacciare.“ Das Verbum riallacciare springt hin und her, hinüber und herüber, zwischen zwei so gut wie gegensätzlichen Bedeutungen. Eine Bedeutung ist etwa: auflegen, den Hörer auflegen, das Gespräch und die Verbindung unterbrechen und abbrechen. Aber eine zweite Bedeutung gibt es: die unterbrochene Verbindung wiederherstellen, wieder zusammenknüpfen. Das Gespräch schließt also, bricht auseinander. Oder Wiederanschluss. Im Wort riallacciare gibt es Abschluss und Anschluss. Ein paradoxer Zusammenschluss durch Schließung, Öffnung durch Blockade, Erkenntnis durch Vergessen. Ist hier eines der „Augen aus nichts“? Tatsächlich ist das Telefongespräch mit jenem Schließen nicht zuende, geht weiter, jemand sagt das Wort Hallo. Doch wer – die Anruferin, die Angerufene? „Hallo. / Der, der Erreichten.“ Die Erreichte: Ist sie Teil jenes „Reichtum des Schnee“? Spricht sie das Wort Hallo? Wird ihr das Wort Hallo zugerufen? „Der, der Erreichten“, das ist ja nicht bloß ein bisschen gestottert, sondern eine Unentschiedenheit zwischen Genitiv und Dativ. Das Hallo der erreichten Person könnte das Wort sein, welches sie selbst sagt. Der Erreichten: das könnte das Zurufen zu jener Person meinen – der erreichten Person zugerufen. Zuruf und Zuruf begegnen einander, wie von Angesicht zu Angesicht. Das Gedicht endet dann mit: „Das ist alles, ihr könnt gehen.“ Alles hier im Sinn von: alles. Oder im Sinn von: mehr nicht, sehr wenig vielleicht, fast nichts. Sehr viel und sehr wenig springen hier unerhört zusammen.
Ja: jetzt seh ich die Welt warm wie ein Ei, / Dotter lieblich gewürzt und beschützend.“ Das spricht eine Person unbekannter Identität oder ein Niemand Nr. 8 in dem Gedicht „Im mulmigen Reich der Vampire“. Hier ist es also zunächst nicht der Reichtum oder das Reichtum, sondern das Reich der Macht, das eroberbare Gebiet der Welt. „… jetzt seh ich die Welt“: Im langen ersten Teil des Gedichts erweist sich solches Sehen als ein Blutsaugen womöglich, das Gesehene und Sichtbare befindet sich im Zustand des Blutens und Verblutens (die Besitzwelt verblutet). „… seh ich die Welt“ ist also eine trügerische Behauptung? Genauer gesagt: „Welt“ ist eine trügerische Behauptung? Wenn also Teil I dieses Gedichts vielleicht die Welt behauptet (und sie durch Besitz verliert), was ist dann zu sehen in Teil 2?
Infra und Mega Strukturen, und Strukturen
bis ans Ende der Blicke Finger Verführungen,
und unsereins stülpt sich um und streicht aus,
es ist ein Lächeln
das ich erfuhr eines Morgens als Kind
einerlei ob Mai oder Winter.
Ausgelaugtes Hämoglobin, Mull
Seren, schweigt still: ich erinner
erinnere alles: es ist etwas das ich eines Tages erfahren
so intensiv so endgültig
dass im bloßen Abglanz davon
ich mich, uns, lustig machen kann über alles was gilt.
Peinigungen Erscheinungen das Glauben das Nichtglauben;
Götter und Welten und Seelen: verfehlte Ziele. Doch war
jener große enthüllte Morgen und mich bedeckt
sein himmlisches Plasma, und dauert.
Das Lächeln, erfahren eines Morgens, und der große enthüllte Morgen: sind diese Zeilen immer noch nah jenem „noch viel größeren Schauen“ am Ende der Divina Commedia, wo das Licht zu lächeln vermag:
O luce eterna che sola in te siedi,
Sola t’intendi, e da te intelletta
Ed intendente te ami ed arridi!
O ewiges Licht, das sich nur selbst bewohnet,
Nur selbst begreift, und von sich selbst begriffen
Und sich begreifend sich auch liebt und lächelt!
Was es ist, das da im zweiten Teil des Gedichts von Zanzotto erinnert wird, wird fast nicht gesagt, ist fast wie ein Vergessen, ist so intensiv gewesen, dass es keine Wiederholung geben kann, nur Abglanz. „Ich erinner“ heißt es in einer Zeile, aber dieses Erinnern hat keinen Gegenstand, kein Thema, gleicht darin beinahe dem Vergessen. „Erinnere alles“, die große Dimension dieser Aussage wird nach einem Doppelpunkt sogleich verkleinert, neuproportioniert: „es ist etwas das ich eines Tages erfahren“, aber das etwas wird nicht bestimmt. Ein paar Zeilen danach folgen „Bestimmungen“, „Themen“, „Inhalte“:
Götter und Welten und Seelen: verfehlte Ziele. Doch war.
Welten, oder die im ersten Teil des Gedichts gesehene Welt: sind Inhalte oder Themen eines Zielens und Sehens – ohne Angesicht zu Angesicht, ohne Zusammenschluss, ohne Verbindung. Demgegenüber sagt das Gedicht lapidar und abbrechend: „Doch war“. Nicht bestimmen, jedoch alles erinnern: das ist wie im Vergessen alles erinnern. Angesichts der nicht geringen Schwierigkeiten, das schweigende Gedicht zu übersetzen, über die hier nicht gesprochen werden soll, haben wir nach den stummen Elementen im Gedicht gesucht, nach den Anagrammen oder Quasi-Anagrammen, danach, was Saussure den insgeheim genannten Namen eines Gedichts genannt hat, der sich in einer Art von anagrammatischem Zustand verbirgt, in „Paragrammen“, „Logogrammen“, „Antigrammen“, „Homogrammen“, „Kryptogrammen“. „Saussure nimmt an, dass das lautliche Material der Texte so ausgewählt wurde, dass es immer diejenigen Worte oder Namen ,paraphrasiert‘ oder ,imitiert‘, die in einer Passage, implizit oder explizit, wichtig sind.“ (Johannes Fehr in dem brillanten einleitenden Kommentar zu Ferdinand de Saussures Notizen aus dem Nachlass, auf Deutsch erschienen unter dem Titel Linguistik und Semiologie). Der anagrammatische Name ist in der deutschen Übersetzung La Beltà/Pracht auf zwei eigenen Seiten dargestellt. Es zeigt sich, dass der versteckte Name oder das Anagramm velato und totale lauten könnte (wobei der jeweils fehlende Buchstabe in beiden Wörtern in ihrer Aneinanderreihung zu finden wäre: velatototalevelatototale): verhüllt/verdeckt/unsichtbar – allumfassend. In dem Anagramm wird Abwesenheit/Unerreichbarkeit und Anwesenheit/Erreichbarkeit hin und her übersetzt. Offen bleibt auch, ob nicht im velato/verhüllt ein vedo/sehe versteckt ist.
Das Gedicht „Auf die Welt“, das Gedicht mit dem schwierigen Wort im Titel. Wie wird man die deutsche Übersetzung des Gedichts, vor allem die graphische Darstellung der Übersetzung beschreiben? Auf Seite 91, einer rechten Seite, das italienische Gedicht „Al mondo“, dem auf Seite 90 etwas ganz anderes gegenübersteht. Auf den Seiten 92 und 93, wohlbehalten einander gegenüberstehend – aber darum etwa glaubwürdig, darum ohne optische Täuschung? – deutsch „Auf die Welt“ und italienisch „Al mondo“. Auf Seite 94, einer linken Seite, die deutsche Übersetzung „Auf die Welt“ (noch einmal?), der auf Seite 95 etwas ganz anders gegenüber steht, nämlich der Beginn des folgenden Gedichts „In una storia idiota di vampiri“. Trifft heute, mit allzu wenig Ausnahmen, zu denen Peter Szondi zu zählen ist, auf die Beschreibung von Übersetzung zu, was Saussure über die Beschreibung von Sprache geschrieben hat:
Die absolute Belanglosigkeit der geläufigen Terminologie, die Notwendigkeit einer Reform, die zeigen soll, was für ein Gegenstand die Sprache im allgemeinen ist, verdirbt mir ständig mein (…) Vergnügen.
Trägt diese Übersetzung zur optischen Täuschung bei? Sprechen derartige Übersetzungen für den Erfindungsreichtum der Übersetzer? Oder für den Verlierensreichtum? Das Verlierreichtum? Theresia Prammers Untersuchung zu „Andrea Zanzotto in deutschen Übersetzungen“ (und zur Rückwirkung der Übersetzung in die Originale) setzt ja ein mit der Frage nach der Beschreibung von Übersetzungen:
Es muss Begriffe geben, mit denen Übersetzung beschrieben werden kann, sie müssen nicht ,treu‘, ,äquivalent‘, ,adäquat‘ oder gar ,kongenial‘ heißen, doch sollten sie, innerhalb des jeweils vorgegebenen Rahmens, adäquat sein. Unter Verzicht auf ein solches Instrumentarium versiegt das Gespräch über Übersetzung bzw. versandet erst recht in jenem stereotypen Phrasenwust, dessen plättender und normierender Gestus ja bekämpft werden soll.
Vorschlag zur Begriffsbildung: Verlierreichtum, das; Neutrum.
„Im dunklen Wald aus (…) wildestem Licht“; „während eines Spiels mit trevisanischen Karten nicht-gespielt von Spielern die es nicht gibt“; „im Weitwinkelobjektiv entrissen“ – man kann im Werk Andrea Zanzottos beständig auf die unmöglichen Wendungen, auf die Paradoxien, auf das nicht-sehende Sehen achtgeben. Auch in seiner Prosa kann der Leser und Übersetzer getäuscht werden und in vielen Wörtern die andere, selbstwidersprüchliche Seite sehen:
Es war Sonnenuntergang, der Sturm drückte auf die Hochebene, Don Emanuele sprach einige Gebete fast im Laufen, und ich hielt nur mühevoll mit ihm Schritt; wir hatten uns gerade unter dem Vordach des Pfarrhauses in Sicherheit gebracht, als die ersten Hagelkörner bereits auf dem Pflaster hüpften.
Hagel? Das Wort im italienischen Text ist „grandine“. Und ist das nicht ein Wort mit einem Selbstwiderspruch: grande – groß, ine – wie ein Suffix, welches Verkleinerung anzeigt. Könnte es im Deutschen anstatt Hagel auch Großlein heißen? Großlein so wie es auch ein nicht-gespieltes Kartenspiel gibt und Spieler, die es nicht gibt, und ein dunkler Wald blendendes Licht ist? So wie es auch ein Weitwinkelobjektiv gibt, das nicht aufnimmt und Aufnahmen möglich macht, sondern raubt und wegnimmt? So ist vielleicht das für unsere erste Übersetzung von Gedichten Andrea Zanzottos titelgebende Gedicht „Lichtbrechung, Rötung“ ein Text, der in der Lage ist, das Weggenommene, Nichtaufgenommene, vor dem die Erinnerung zurückweicht, das Vergessene auszusprechen. Darum die vielen Unmöglichkeiten, Paradoxien, Selbstwidersprüche: Weil in dieser Dichtung eine Sprache des Vergessens geschrieben wird? „E cede la memoria a tanto oltraggio.“ Darum einige Schwierigkeiten der literarischen Kritik, auf das Werk Andrea Zanzottos angemessen zu antworten: Weil in den europäischen Erinnerungsgesellschaften die Sprache des Vergessens nicht verstanden wird? Lieber eifrig erinnern, vor allem an gewissen Tagen. Manche Länder erklären ein ganzes Jahr zu einem tabufreien Gedenkjahr. Der Autor aber schreibt eine Tabu-Sprache, die nicht-sprechbare Zonen zulässt. Vermutlich ist das lange Gedicht „Lichtbrechung, Rötung“ ein Prozess des Vergessens-Erratens, der im ,Gasthof Schlaflos‘ stattfindet, in einem Zustand der Übermüdung, Erschöpfung, Verwirrung von Dunkelheit und Blendung, geminderten Bewusstsein, traumlos träumend in Bildern, die zeigen wie gleichermaßen verlöschen. Das Vergessen ist dabei wie das Mischen eines Kartenspiels – die ausgespielte Karte dann kein Erinnerungszeichen, eher ein wiedergefundenes Vergessen. Die erste Spielkarte der trevisanischen Karten, die in diesem Nicht-Spiel ausgespielt wird, ist das Ass der Schwerter, eine Karte, die einen Spruch enthält: „Non ti fidar di me se“. Der Spruch (auf der eigentlichen Spielkarte vollständig) ist im Gedicht unvollständig wiedergegeben, halb-vergessen, er endet mitten im Satz bei dem Wort „wenn“: „Vertrau mir nicht wenn“ (also vielleicht: misstrau mir in jedem Fall). Die zweite irgendwann später ausgespielte Karte ist das Ass der Becher, sie enthält eine Redewendung, die das Gedicht nur zur Hälfte wiedergibt: „Per un punto Martin“: „Um Haaresbreite verloren“. Misstrauen, verlieren – die nächste Karte ist das Ass der Schellen, der Spruch handelt vom Nichtwissen: „Non val saper a chi ha fortuna contra“: „Es lohnt sich nicht zu wissen wie das Glück steht“. Die Spielkarten beinahe wie Auslöser von Vergessen oder Auslöser unwillkürlicher Zonen. Die letzte ausgespielte Karte ist das Ass der Stöcke, auch diese handelt vom Verlieren, Sichvergessen: „Se ti perdi tuo danno“: „Verlierst du dich so ist’s dein Schaden“. Vier von Nicht-Spielern ausgespielte Karten eines Nicht-Spiels (besonderes Zanzotto-Kino. Nicht-Spiele) in einer Vergessens-Partie – in a guessing party, in einem Errätselungsspiel. Tatsächlich handelt es sich bei dem deutschen Wort „Vergessen“ und dem englischen „to guess“ um dasselbe Wort. „To guess“ geht zurück auf die Grundbedeutung „ergreifen, erfassen, in Besitz nehmen, haben“, dann auch „im Gespräch berühren“, und wird schließlich zu „erraten“, Im deutschen „vergessen“ liegen also Reste der alten Bedeutung: nicht haben, nicht besitzen, nicht ergreifen. Liegen hier also einige der Gründe, warum die Dichtung von Andrea Zanzotto, im eigenen Land wie in den Ländern der deutschen Übersetzungen, als schwierig aufgefasst wird: Man weiß nicht, was sie einem sagt, und es gilt als sehr schwierig, in Kategorien des Nichts zu denken. Die Reichtum und Geld sammelnden, Profite und Gewinne akkumulierenden neuen europäischen Gesellschaften benötigen als geistiges, ideologisches Fundament: Erinnerung („Erinnerungskultur“), Archive, Gedenktage, Bibliotheken, Datensätze, Datenschätze, große Speicherkapazitäten, megabytes, Wissen, Information, aber kein Vergessen, das eine ungreifbare und unhabbare Sache ist. Das Vergessen darf es nicht geben; dabei ist es vielleicht die stillere, eindringlichere, weniger gewaltsame Form des Denkens.
Man könnte fast die Abschaffung aller offiziellen Gedenkfeiern vorschlagen, die sozusagen mit Menschenopfern verbunden sind. Die Opfer dulden, gerade im Hinblick auf ihre unendliche ,Entfernung von der Geschichte‘, deren Grundlage (?) sie bilden, keine Form von Annäherung oder Wiederannäherung durch eine bloße Gedenkfeier, umso weniger, wenn sie rituell und zyklisch geworden ist (wie zum Beispiel das Fest der Befreiung in Italien, am 25. April). Aus Zuneigung zu ihnen und unbesorgt um sie sollte man die Geopferten ihrem Anderswo überlassen, ihrem Rätsel. (Anmerkung im Gedichtband Idioma)
Äquivalenz? Gleichwertigkeit mit was, wenn das italienische Wort voll von Tabu ist, Selbstwiderspruch, Vergessen, oltraggio? Welches Äquivalent haben „Augen aus nichts“? Kein Äquivalent? Ist dieses Kein-Äquivalent ihr Äquivalent?
Vielleicht haben die Übersetzer sich bei diesem langen und langsamen, unübersichtlich werdenden Versuch, Zanzottos Dichtungen zu übersetzen, verloren, in jenem Sinn verloren, dass wir nicht mehr wussten, was wir im Lesen finden wollten, ganz anders als jener Leser, den der von Theresia Prammer zitierte Vittorio Spinazzola beschreibt: „Com’è noto, in ciò che leggiamo ognuno di noi trova solo e proprio ciò ehe aveva voluto trovarvi“. Bekanntlich findet jeder von uns in dem, was wir lesen, nur und eigentlich das, was er hat finden wollen. Besser zu verstehen ist Theresia Prammers Satz, der den ersten Teil des Kapitels „Zur Übersetzung von Lyrik“ beschließt:
Zustande kommen dabei bestrickende Sequenzen, ,eine Sprache fast wie in Miniatur gearbeitet‘, der sich, mit den Begriffen ,Annäherung‘, ,Auseinandersetzung‘ und ,Umsetzung‘ nur beschränkt beikommen lässt und die soviel Überraschungs- und Überrumpelungspotential in sich birgt, dass selbst der routinierteste Leser darin Nie-Gesuchtes entdecken kann.
Was ist es, das dann in dem Vergessen erraten, errätselt wird, was befindet sich im Vergessens-Volumen: Das Gedicht „Lichtbrechung, Rötung“ berichtet und erzählt bruchstückhaft Märchen und Legenden. Das unzugängliche Andere, das oltraggio erscheint in diesem Gedicht als (ein Wald von) Legenden, unsichere, unpersönliche, unvollständige, halb-erinnerte, veränderliche Legenden, unkontrollierbare Legenden: eine erzählt von Dieben und Räubern im Wald, eine vom Hexenmeister Onkel Dummkopf, wieder eine erzählt von der Alten Namens Cian „mitten im Wald“ vermischt mit der sehr undeutlichen Erinnerung an die Erzählung von einem Diebstahl, der sich im 19. Jahrhundert zugetragen hat. Im Vergessen beginnt die Legende, die andere, vielleicht unbeherrschte Geschichtsschreibung und Erinnerung. „Man weiß nicht warum“, „mehr ist nicht bekannt“, „Rätsel das ich nie verstand“, „welche Rolle spielte sie in dieser Sache?“ Das Gedicht erzählt in einer seiner Strophen von Streuung sowie von Fügung, von Gedächtnisverlust wie von Erinnern: „demenza del ricordare“, vielleicht also von einer Weise des Gewinnens durch Verlieren und Informationslosigkeit. Das lange Gedicht enthält an mehreren Stellen die Kürzel „Dne“, jeweils in einem Kontext einer Gebetsformel. So dass zunächst klar ist, dass dieses „Dne“ die Abkürzung von Domine ist. In der Note zum Gedicht allerdings steht: „Dne: ist Domine“. So klar gesagt scheint es doch wieder falsch zu sein. Augenscheinlich, buchstäblich, oberflächlich betrachtet ist das kurze Wort gerade nicht dem langen Wort gleich. Ist also „Dne“ vielleicht etwas Anderes? Eine geheime Formel für… Vergessen, die besonders zerstreute Denkform des Vergessens? Mane nobiscum Dne – Bleib bei uns Vergessen? Noli, Dne, iudicare. Gott: Vergessenheit?
Historie in dem Gedicht? Zu Beginn von „Lichtbrechung, Rötung“ ist kurz von den Provveditoren die Rede, den venezianischen Verwaltungsdirektoren. „I gravissimi Provveditori / EMO GRITTI RENIER“. In der Note zum Gedicht relativiert der Autor, erklärt nicht, wer Renier war, wer Gritti und Emo waren, ob es sich tatsächlich bei allen drei Vertretern des padanischen Adels um Provveditoren handelt, ob damit jeweils keine Individuen, sondern die Familien angesprochen sind, er lenkt ab (beugt das Licht), verweist woandershin: „Hinweis auf die ,Oda Rusticale‘, Strophe 31“, verweist also in ein Gedicht, präzise in die 31. Strophe, verweist also in einen anderen Raum als den geschichtlichen. Verlässt den geschichtlichen Raum, flieht ihn, „quo fugiam“. Verlässt den Raum der Tatsachen, Ereignisse: „Von diesen und anderen Ereignissen / – wenn es Ereignisse sind –“, mit dieser Fraglichkeit scheint der Satz abzubrechen, die mit der Präposition „von“ beginnende Satzkonstruktion findet keine rechte Fortsetzung: Was also ist „von diesen Ereignissen“ –: jedenfalls nicht die Rede, von ihnen ist gewissermaßen nichts. Es beginnt nach diesem abgebrochenen Satz eine eckige Klammer, in welcher kaum eindeutig vom Gedränge an einem Kartenschalter und Eingang zum Sportplatz die Rede ist und vom abgesagten Spiel und vom Unmut darüber, aufkommender Panikstimmung in der Menge. Dann wird die Klammer geschlossen und der Satz, nicht mehr recht greifbar angeschlossen an seinen präpositionalen Beginn, anders fortgeführt mit der Vorstellung von einer sternbildlichen Fügung der Ereignisse, von einem Mandala der historischen Ereignisse und von der Beendigung der Verdrängung in einem Mandala, in einer Konstellation (Mandala, Sanskrit, bedeutet Kreis, Polygon, Gemeinschaft, Verbindung, ein Ort mit vier an den Himmelsrichtungen orientierten Eingangstoren, die vielleicht vergleichbar/entgegensetzbar sind dem Kartenschalter/sportello im Gedicht, vier Tore in einen anderen Raum). Was tut sich auf an diesem Tor, am Kartenschalter (Spielkartenschalter?), am Eingang in den vergesslichen Raum: „wird man mit der Zeit gewahr: “. Auf den Doppelpunkt folgt eine sehr lange weiße Strecke, wortlos. Die Nicht-Erinnerung? Die im Mandala zu findende Bildlosigkeit und Leere?
„Lichtbrechung“. Unter Lichtbrechung (oder Beugung) versteht man die Ablenkung von Lichtwellen an einem Hindernis. Zur Brechung oder Beugung kommt es durch die Entstehung neuer Wellen am Hindernis (Spalt, Gitter, Fangspiegel usw.) und deren Interferenz. Die Lichtbrechung: Information über den inneren Aufbau des Vergessens? Was für ein Stoff ist Vergessensinformation? Venedig ist vielleicht seit jeher der Ort der Häresie, Ort der Abweichung, um 1600 auch der Abweichung von der päpstlichen, römischen Lehre (Giordano Bruno, Galileo Galilei, der Mönch Paolo Sarpi, dessen kirchliche Laufbahn endete, als man ihn bei der Inquisition geheimer Kontakte zu Protestanten bezichtigte, und den die Republik Venedig zum theologischen Berater machte, sind Mitglieder eines intellektuellen, von Ockham und Duns Scotus beeinflussten Kreises, der sich „Ridorto Morosini“ nennt). Am Rande des Wald- und Bergrückens genannt Montello (der „bosco“ des Gedichtbands Il Galateo in bosco) liegt auf der terraferma das Städtchen Nervesa della Battaglia, dessen Abtei zu Beginn des 17. Jahrhunderts der im Gedicht genannte Archiprior, Dämonologe, Marcantonio Brandolin, vorstand, Conte di Valmareno e Signore di Solighetto, Organisator eines Kongresses von „Häretikern“, „Zauberern“, „Zombies“, „Mördern“, „Schamanen“. Venedig erließ ein Gesetz, welches verbot, Immobilien an die Kirche zu veräußern, und den Klerus unter die Rechtssprechung der Stadtrepublik stellte. Es löste einen Konflikt zwischen Kirche (Papst Paul V) und Republik aus: welche der beiden Autoritäten besaß die Gerichtsbarkeit? Das Gedicht, wohl selber ein Kongress von Zauberern, Zombies, Schamanen, selber ein Wald für Abweichungen, Übertretungen spricht die Formel: Noli, Dne, quaeso, iudicare. Das Urteil lautet vielleicht: kein Urteil sprechen.
Vielleicht eine schamanistische Praxis: der Eintritt ins Vergessen? Gegen Ende des Gedichts werden die Zonen oder Ereignisse des Vergessens als weiße Zwischenräume sichtbar:
Ereignisse
die doch genaue Beachtung verdienen
wenn sie sich sammeln im richtigen Sternbild
im Mandala am Kartenschalter wenn die Verdrängung endet
wird man, mit der Zeit, gewahr: – Vorgänge der Zeit
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaals der Montello ein Blättermeer war…
Die weißen Zwischenräume scheinen das richtige Sternbild und das Mandala zu formen. In diesen vergessenen, weißen Zonen: endet die Verdrängung. Es wird versucht, der verdrängenden Energie der Sprache und der Erinnerung etwas entgegenzusetzen. In seiner Zerbrechlichkeit, Lichtzerbrechlichkeit antwortet das Gedicht der Gewalt und Verdrängung. „Diffrazioni, eritemi“ findet seinen Platz zwischen dem Gedicht „Gnessulógo“ (Kein-Ort) und einem schlecht und verzerrt gedruckten Faksimile einer „Canzone montelliana“ (von Carlo Moretti verfasst), die wie eine Vergessensspur dasteht. „… a significare qualche cosa di lontano“, sagt der Autor darüber in einem Interview.
Ein Zufall war es vielleicht, dass wir drei Übersetzer DC, LP, PW ganz zu Beginn unserer Zusammenarbeit, lange bevor wir die Vierergruppe DC, MF, LP, PW bildeten, sehr lange bevor die sehr geliebte Maria Fehringer (MF) an einer kaum ein paar Wochen dauernden Krankheit starb, das Gedicht „Cosi siamo“ zu übersetzen versucht haben und dann, halbwegs versteckt, 1985 veröffentlicht haben, ein Gedicht über die Unerreichbarkeit. Im Rahmen von Theresia Prammers Studie sind diesem kleinen Gedicht „über den Tod eines nahen Menschen“ einige besondere Zeilen gewidmet:
Jede Hoffnung auf Erkenntnis durch die Sprache ist hier emblematisch aufgegeben, die Kondition des Trauernden ist das Nichts, doch dieses Nichts ist erst der Auftakt zu aller Sinnsuche. Hier wurzelt die Analogie zwischen der Kondition des Dichters und jener des Toten: im Jenseits der Sprache. Der Titel selbst ist die Besiegelung dieses stillen Paktes mit dem Nichts. Kryptisch bleibt, als völlig bereichsfremde Metapher, das ,Nadelöhr des Nein‘: Vielleicht ist damit ja tatsächlich die typographische Form des ,e‘ (bez. des ,o‘ aus ,no‘) angesprochen: die Augen mögen sich noch so sehr in seine Schlaufe versenken, sprich: so sehr man auch versucht, dieses Wörtchen, dieses Partikel auszuweiten, es tiefer, vielsagender, bedeutungsschwer zu machen: es ist nicht der Mühe wert, das Nein des Todes bleibt doch ungesagt, und der Tote stirbt, als ein ins Jenseits der Sprache Verwiesener […] noch ein zweites Mal. –
E così sia: ma io
credo con altrettanta
forza in tutto il mio nulla,
perciò non ti ho perduto
o, più ti perdo e più ti perdi,
più mi sei simile, più m’avvicini.
Die Theresia Prammers Studie wohl immer wieder antreibende Frage ist die nach der „Disposition der Sprache zur Verbergung“; nach ihrer Disposition, das Ziel nicht zu erreichen: Wird in dieser Blockade ein Bereich (ein Reichtum) bewahrt, gebildet? Ist das Abdecken zweierlei zugleich: Verdecken und Entdeckung?
Peter Waterhouse, Februar, März 2005, aus Theresia Prammer: Lesarten der Sprache, Verlag Königshausen & Neumann, 2005
DIE WENDE ( Mai 2003)
Welche Wende machtest du in Beltà, in Pracht?
Ein Blinder starrt hinaus aufs Meer,
auf die Wellen, ihre Schaumkronen –
Zu Bett diese Lieder –
und was mit dem Nebel der vergibt
oder nur vorgibt?
Diese Wendung, leichte Schräge des Kopfs,
die wilden Beeren, jene essbar,
diese nicht. Könntest du, könnte irgendwer
gewusst haben dass es dahin käme –
die Fragmente und Gesänge,
dies Klingen
das in Beltà, in Pracht
bindet und löst,
umarmt und beiseiteschiebt?
Und das Herumtasten, die hellen, sich entwirrenden Fäden,
der Geschmack der im Mund weilt,
diese Wendung zuletzt Richtung weit.
Zu viele Stunden im Gedicht.
Letztes wieder wach gelassen.
Michael Palmer
Übersetzung aus dem amerikanischen Englisch von Rainer G. Schmidt
Fakten und Vermutungen zu Donatella Capaldi
Fakten und Vermutungen zu Maria Fehringer
Fakten und Vermutungen zu Ludwig Paulmichl + Kalliope + Facebook
Fakten und Vermutungen zu Peter Waterhouse + KLG
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Galerie Foto Gezett +
Dirk Skiba Autorenporträts + Keystone-SDA +
deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Peter Waterhouse liest beim Tanz um das goldene Nilpferd am 10.3.2012 im Klagenfurter Ensemble.
Fakten und Vermutungen zum Autor + KLfG + IMDb + Facebook +
Internet Archive + Kalliope
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA
Nachrufe auf Andrea Zanzotto: der Standart ✝ NZZ ✝ stol ✝ Die Welt ✝
Chicago Review ✝ Park ✝
Andrea Zanzotto zu seinem 88. Geburtstag.


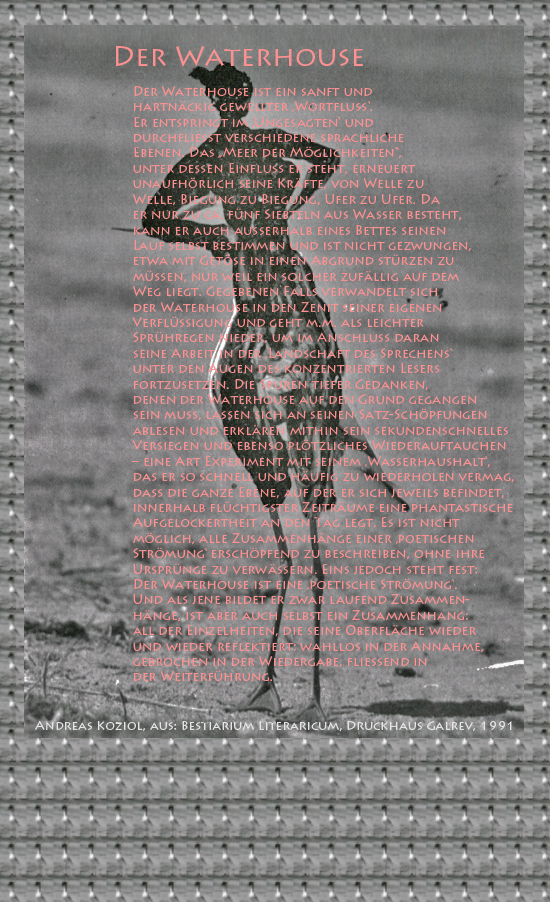













Schreibe einen Kommentar