Anna Achmatowa: Gedichte
DIE MUSE
Wie nur leb ich mit dieser Last,
Und sie nennens noch MUSE, das,
Sie sagen: In Wiesen Inspiration,
Sie sagen: Göttliches Lallen –
Sie wird dich wie Fieber befallen,
Und dann wieder ein Jahr lang kein Ton.
Übersetzung: Rainer Kirsch
Nachwort
Achmatowa is the kind of poet that simply „happens“.
Joseph Brodsky
Geboren am 11.(23.) Juni 1889 in Bolschoi Fontan bei Odessa, gestorben am 5. März 1966 in Domodedowo bei Moskau: Anna Andrejewna Gorenko, die sich auf Drängen des Vaters ein schriftstellerisches Pseudonym zugelegt hat und mit dem klangvollen tatarischen Namen ihrer Urgroßmutter mütterlicherseits – Achmatowa – in die Literaturgeschichte eingegangen ist. Die Kindheit und Jugend verbringt sie in Zarskoje Selo bei Petersburg, wo sich die Sommerresidenz der Zaren befindet und Puschkin einst das Lyzeum besuchte. Später erinnert sie sich an die „Parkanlagen mit ihrer nassen grünen Pracht, die Weide, zu der mich die Kinderfrau führte, die Rennbahn, auf der kleine, scheckige Pferde galoppierten, den alten Bahnhof“, an die „grüngemusterte Stille in des Jahrhundertanfangs kühlem Kinderzimmer“. Als die Eltern sich 1905 trennen, übersiedelt Achmatowa mit ihrer Mutter und den Geschwistern auf die Krim, dann nach Kiew. Sie beginnt ein Jurastudium, das sie jedoch zugunsten der Literatur aufgibt. 1910 heiratet sie den Dichter Nikolaj Gumiljow und schließt sich der Lyrikergruppe der Akmeisten an. Reisen führen sie nach Paris, wo sie von Modigliani porträtiert wird, und nach Venedig, Florenz und Pisa, deren Architektur sie bewundert. 1912 kommt ihr einziger Sohn Lew auf die Welt, im selben Jahr erscheint auch ihr erster Gedichtband Abend (Večer). Achmatowa wird über Nacht berühmt. Die verhaltene Schönheit ihrer klassischen Verse überzeugt ebenso wie die Vornehmheit und stille Selbstsicherheit ihres Wesens. Im Kriegsjahr 1914 veröffentlicht sie den Band Rosenkranz (Čëtki), im Revolutionsjahr 1917 die Sammlung Weißer Schwarm (Belaja staja). Es beginnen schwierige Zeiten. Achmatowa trennt sich von Gumiljow – der 1921 als angeblicher Verschwörer von der Tscheka erschossen wird – und nimmt eine Stelle als Bibliothekarin an. Jetzt schon weiß sie, daß sie trotz lockender Stimmen nicht emigrieren wird. Ihre Gedichtbände Wegerich (Podorožnik) und Anno Domini MCMXXI stehen auf der Seite der Not.
Zwischen 1922 und 1940 erscheint von Achmatowa kein Buch. Über diesen schwierigsten Abschnitt ihres Lebens schweigt ihre kurze Autobiographie. Doch ist bekannt, daß sie – trotz ihrer Bleibe im Leningrader Fontany Dom – gleich einer heimatlosen Nomadin von Freunden zu Freunden zieht, mit ihrem einzigen Gepäckstück, einem „abgewetzten kleinen Koffer voller Notizbücher, Hefte mit Gedichten und Skizzen zu Gedichten, größtenteils ohne Ende und Anfang“ (Kornej Tschukowski). Sie liest viel – Puschkin, Dante, Shakespeare, Dostojewski, die Bibel –, sie interessiert sich für bildende Kunst und Architektur. Ihre literatur- und kunsthistorischen Kenntnisse schlagen sich in mehreren Puschkin-Studien nieder. Derweil greift der politische Terror immer mehr um sich. Freunde wie Ossip Mandelstam kommen im Lager um, ihr Sohn Lew wird, zusammen mit ihrem damaligen Lebensgefährten, Nikolai Punin, 1935 verhaftet, kurz darauf freigelassen und 1938 erneut verhaftet. Siebzehn Monate steht sie Schlange vor den Gefängnissen von Leningrad, um zu erfahren, daß Lew den Weg nach Sibirien antreten muß. Lidija Tschukowskaja hat diese Bitt- und Bußgänge herb und genau protokolliert; Achmatowa selbst tat es, stellvertretend für viele, im Poem „Requiem“ (Rekviem, 1935–1940), das in der Sowjetunion 1987 schließlich vollständig erscheinen konnte. Wie der spätere Zyklus „Totenkranz“ (Venok mërtvym) – mit Erinnerungsgedichten an Marina Zwetajewa, Michail Bulgakow und andere verstorbene Freunde – ist es ein einziges Epitaph; der Tod hat sich „aus einer Sprachfigur in eine Figur, die sprachlos macht“, verwandelt (Joseph Brodsky). Während der Blockade von Leningrad wird Achmatowa nach Moskau ausgeflogen, dann – bis 1944 – nach Taschkent evakuiert. Ihre Gesundheit macht ihr zu schaffen, dennoch ist sie voll Anteilnahme, liest verwundeten Soldaten Gedichte vor. Schockierend die Rückkehr ins zerstörte Leningrad. Beim Anblick des „gespenstischen Antlitzes“ ihrer Stadt beginnt sie, Prosa zu schreiben. Daß sie 1949, bei der dritten Verhaftung ihres Sohnes, sämtliche Skizzen verbrennt, ist ein Requiem für sich. Von Parteisekretär Shdanow als „Nonne und Hure“ verunglimpft, als Hindernis beim Aufbau des Sozialismus gebrandmarkt, laut ZK-Beschluß vom 14. August 1946 als „Gegnerin des Sowjetregimes“ zusammen mit Michail Sostschenko aus dem Schriftstellerverband ausgeschlossen, weiß sich Achmatowa als gebranntes Kind. Den Sohn will sie nicht zusätzlich gefährden. Zurückgezogen arbeitet sie an Übersetzungen und an ihrem Lebenswerk, dem „Poem ohne Held“ (Poėma bez geroja) – einem Tableau des Jahrhunderts, einem lyrischen Epos über das Vergehen der Zeit, das – chiffriert – auch ihre eigene Biographie enthält. Dieses poetische work in progress mit zahlreichen Varianten und Zusätzen begleitet sie fast bis zum Ende. Zu den Lichtblicken ihres Alters gehört das Erscheinen von drei Gedichtsammlungen sowie 1964 eine Reise nach Italien, 1965 nach England und Paris. In Sizilien nimmt sie den Ätna Taormina-Preis entgegen, in Oxford wird ihr das Ehrendoktorat verliehen. Hier kommt es zur Wiederbegegnung mit dem Historiker Isaiah Berlin, der in den vierziger Jahren Sekretär an der englischen Botschaft in Moskau gewesen war und sie im Fontanny Dom verbotenerweise aufgesucht hatte. Achmatowa sah in diesem „wunderbaren“ und „fatalen“ Besuch die Ursache für zahlreiche Schikanen, selbst für die Verhaftung ihres Sohnes, konnte den „Gast aus der Zukunft“ aber nie vergessen. Es ist einer jener vielen Verzichte und Verluste, die sie mit Würde ertragen und kryptisch in ihr „Poem ohne Held“ eingeschrieben hat.
Schon die frühen Gedichte sind elegisch gefärbt. Von Liebe ist die Rede, aber meist von unerfüllter, oder Achmatowa skizziert eine Abschiedsszene von dramatischer Dichte. In zwölf Versen entwirft sie eine Mini-Novelle, was Ossip Mandelstam zum Ausspruch bewogen hat, sie habe am meisten von den russischen Romanciers des 19. Jahrhunderts gelernt. Joseph Brodsky, der ihr selber einiges verdankt, attestiert ihr aufgrund der Klarheit und Kohärenz ihrer Sprache Qualitäten einer Jane Austin. Immer wieder wird die Lyrikerin der frühen Liebeselegien wie auch der späten Geschichtsdichtung mit Erzählern verglichen.
Das narrative Element, vor allem ihrer frühen Lyrik, äußert sich darin, daß sie Eifersucht oder Liebeskummer in Episoden veranschaulicht, zu Sujets konkretisiert. Diese erscheinen häufig als einprägsame Ausschnitte aus komplexen autobiographischen Geschehnissen, mit einem quasi offenen Anfang („und“, „aber“, „nein“) und einem epigrammatischen Schluß, wobei Ton und „Erzähl“-Perspektive an Brief und Tagebuch erinnern. Sprachlich zeichnen sich diese epischen Miniaturen durch eine ungezwungene Intonation aus, durch einen auf das sinnliche Detail ausgerichteten gegenständlichen Wortschatz, der Abstrakta vermeidet. Die Hutfeder, die das Wagendach streift, der linke Handschuh auf der rechten Hand, eine rote Tulpe im Knopfloch, oder bewußte Prosaismen wie „Benzinduft“, „die sonnenverbrannten Beine der Muse“ werden zu plastisch-visuellen Chiffren einer Stimmung, einer Situation. Der Eindruck unterkühlter Emotionalität, ironischer Distanziertheit ist Absicht und verrät – wie das Metrum und Reim überspielende Parlando – den Einfluß Puschkins und der Petersburger Schule. Diese Genealogie kann nicht unerwähnt bleiben, sei es auch bloß als „Hintergrundinformation“. Achmatowa hat eine Tradition, ein Umfeld – zu dem in erster Linie Innokenti Annenski, Alexander Blok und Ossip Mandelstam gehörten – durchquert, um als Dichterin des kontrollierten Wahnsinns vollkommene Eigenständigkeit zu erlangen.
Der Weg dahin ist auch der Weg einer Frau. Schon bei der frühen Achmatowa fällt die Rekurrenz von Bildern und Metaphern auf, die der weiblichen Existenz positiv oder negativ zugeordnet sind: das Haus, das Interieur, der Spiegel, der Schleier, die Maske; das lyrische Ich sieht sich als „Muse im löchrigen Tuch“, als Sklavin (eines tyrannischen Mannes), als Bettlerin, Pilgerin, Nonne. Es herrscht nicht ein Ton der Anklage, sondern der Klage, Leiden ersetzt – in lakonische, niemals larmoyante Sätze gefaßt – die Leidenschaft. Später verbindet Achmatowa auf eindrücklichste Weise die Rolle der „klagenden Muse“ mit beinahe biblischem Sendungsbewußtsein. Das Intimistische ihrer Lyrik weitet sich, nimmt neue zeitliche und räumliche Dimensionen an. Im Zyklus „Requiem“ spricht die Dichterin als Mutter für Tausende anderer Mütter, die ihre im Gulag festgehaltenen oder umgekommenen Söhne beweinen, und das Bild der Kreuzigung schiebt sich fast unauffällig in diese herbe Szenenfolge. Hier übrigens erreicht der kontrollierte Wahnsinn seinen Höhepunkt: das Oxymoron – bevorzugte Stilfigur schon der jungen Achmatowa – wird zum Symbol für die grausamen Paradoxa der Epoche, die Schizophrenie des weiblichen Ichs, die sich im „Spiegelland“ der frühen Gedichte andeutete, zur monströsen Tatsache:
Nein, das bin nicht ich, das ist eine andere, die da leidet.
Ich könnte das nicht so. Aber das, was geschehen ist,
Sollen schwarze Tücher bedecken,
Und man soll die Lampen wegtragen…
Nacht. (1940)
Kein Pathos, immer noch dasselbe leise, gebethafte Parlando, das in Schweigen übergeht. Oder gelegentlich eine Frage:
Wo ist mein Haus? – Und wo ist mein Verstand?
Achmatowas Lyrik ist frei von imposanter Rhetorik, von der Prätention eines besserwisserischen Dichter-Ichs. Sie ist politisch, indem sie über den Alltag, über alltägliche Schrecken spricht. Im scheinbar Gewöhnlichen entdeckt sie die Signifikanz.
Und wüßten Sie, wie ohne jede Scham
Gedichte wachsen, und aus welchem Müll!
Wie durch das Zaunloch gelber Löwenzahn,
Wie Melde und Dill.
Falls das eine Poetik genannt werden kann, bezeugt sie seltene Bescheidenheit. Nur weiß Achmatowa um das Paradoxon, daß sich der „Müll“ in „königliche Worte“ verwandelt und zäh überlebt. So wie sie um jenes andere Paradoxon weiß, daß das Vergehen der Zeit in der Prosodie des Verses zum Stillstand kommt.
Die Zeit, der lautlose Wandel der Epochen, die Schwellensituation dessen, der sich zu erinnern versucht, bestimmt ab 1940 thematisch und formal die Lyrik Achmatowas und kulminiert im Gedichtroman „Poem ohne Held“. In diesem großangelegten symphonischen Triptychon, dessen drei Teile ihrerseits in mehrere Kapitel mit Mottos und einem Intermezzo aufgeteilt sind und als komplexe Textarchitektur alle früheren zyklischen Kompositionen in den Schatten stellen, entfaltet Achmatowa grandios ihre epischen Fähigkeiten und erweist sich als eine Geschichtsdichterin, die ohne ideologisch-moralisches Pathos auskommt, vielmehr aus der Verbindung von Schwäche und Heroik die Legitimation für ihr Schreiben bezieht. Für Pathos fehlt im übrigen eine eindeutige Erzählinstanz. Das lyrische Ich erscheint gleichsam in drei Hypostasen – als Verfasser, handelnde Person und Doppelgänger seiner Figuren. Der Held des heldlosen Poems aber ist die Zeit, konkretisiert im Jahr 1913, dem „Vorabend“ des Ersten Weltkriegs, der den Zusammenbruch des zaristischen Rußland einleitete, sodann im Jahr 1941, dem Jahr des Überfalls der Hitlertruppen, deren Besiegung durch die Sowjets den Zweiten Weltkrieg beendete. Wie nun das Gedächtnis die Zeit beschwört, inszeniert, labyrinthisch rekonstruiert und zu einem schwebenden Netzwerk verwebt, macht den Zauber und die unverminderte Modernität dieses Poems aus, das „Trauermarsch“ ist und „höllische Harlekinade“, Libretto für ein tragisches Ballett und Palimpsest, Kaleidoskop biographischer und zeitgeschichtlicher Episoden sowie ein zitatenreicher Dialog nicht nur mit der russischen, sondern mit der Weltliteratur.
Im ersten Teil, der „Petersburger Erzählung“ des Jahres 1913, geistert die Zeit in Gestalten von Masken vorbei, gespenstisch wie bei Goya, phantastisch wie in den hoffmannesken Novellen Gogols und Dostojewskis. In diesem Neujahrsspuk der Petersburger Kulturelite erkennt man unter anderem Alexander Blok als Harlekin und „tragischen Tenor der Epoche“, den Pierrot und „Dragonerkornett“ Wsewolod Knjasew und als Colombine die Schauspielerin Olga Glebowa-Sudejkina – ein „Liebesdreieck“, das aus Strawinskys tragischer Ballettfarce Petruschka zu stammen scheint, obwohl der Prototyp Pierrots, der Dichter Knjasew, sich 1913 tatsächlich das Leben nahm. – Nicht um Fabeln und individuelle Schicksale geht es hier, sondern um das Bild einer – längst untergegangenen – Epoche, deren Beschwörung dadurch erfolgt, daß Realien – Namen, Ereignisse, topographische, architektonische u.a. Details – in komplexe Beziehung zueinander sowie zu Sujets der Dichtung und Musik gesetzt werden. Zahlreiche intertextuelle Bezüge – zu Alexander Blok, Puschkin, der Don-Juan-Legende – konstituieren die fiktionale Ebene, die durch Widmungen, Digressionen und ein Nachwort aufgebrochen, durch metapoetische Aussagen verfremdet wird. – Der zweite Teil des Poems, „Kehrseite“ (Reška) genannt, spielt im Januar 1941, mitten in der „großen Schweigerin-Epoche“, im Fontanny Dom. Das lyrische Ich reflektiert über die Maskerade, den Schattenspuk, von dem – Paradigma für den Untergang des alten Rußland – keine Spur übriggeblieben ist:
Es sieht im Traum nur der Spiegel den Spiegel,
Die Stille die Stille bewacht.
Und es reflektiert über die kryptischen Bedingungen des Schreibens unter Stalin, „mit sympathetischer Tinte“, „in Spiegelschrift“. Die einundzwanzig – in manchen Fassungen vierundzwanzig – Strophen aus sechs dreihebigen Versen heben sich in ihrem ruhigen Duktus eklatant vom karnevalesken ersten Teil ab. – Der Epilog und dritte Teil beschwört aus siebentausend Kilometer Distanz, aus Taschkent, die weiße Nacht des 24. Juni 1942 im bombardierten Leningrad. Die Stimme des Autors spricht mit den Stimmen verstorbener oder verbannter Freunde, mit dem eigenen Doppelgänger im sibirischen Lager. Im Echo der Zeit, im Dialog der Spiegel, im Wahn der Schuld wird auch die Identität zu einem fragwürdigen Begriff. Und doch bewirkt gerade diese Spaltung oder Auflösung der lyrischen Ich-Instanz, daß sich individuelle Traumen in kollektive Erinnerung transformieren. Das geschieht, auf bedrängend großartige Weise, im Schlußteil des „Poems ohne Held“:
Lang war der Begräbnisweg, endlos,
Ein feierliches, kristallenes Schweigen
Fesselte rings das SIBIRISCHE LAND.
Fort von dem, was Staub war,
Marschierte, gepackt von tödlicher Furcht,
Wissend um die Frist der Vergeltung,
Die tränenlosen Augen gesenkt –
Vor mir her nach Osten, das
Die Hände ringende Rußland.
So wird dieses elegische Epos mit seinen vielfältigen subjektiven, ja intimen Bezügen, mit seinen literarischen Assoziationen und verborgenen Zitaten, das nicht allein dem Nichtrussen Entzifferungsprobleme aufgibt, zur epochalen Botschaft. „Das Poem enthält keinerlei dritten, siebten oder neunundzwanzigsten Sinn“, schrieb Achmatowa statt eines Vorworts. Es verhindert den Gedächtnisverlust, weil es mit Zeit – im weltlichen und metaphysischen Sinn – gesättigt ist. Und es hat Zukunft, weil nach Joseph Brodskys Worten „Sprache älter ist als der Staat und die Prosodie die Geschichte allemal überdauert“.
Ilma Rakusa, Nachwort
Inhalt
Die Gedichte von Anna Achmatowa (1889–1966), neben Zwetajewa, Mandelstam und Pasternak die bedeutendste russische Lyrikerin, wurden in ihrer Schlichtheit Vorbild auch für die jüngste Generation russischer Lyriker. Achmatowa hat sich – in einer Zeit politischer und moralischer Umwälzungen – der künstlerischen und geistigen Aussage verpflichtet.
Suhrkamp Verlag, Ankündigung
Poem ohne Held
Anna Achmatowa, die große russische Dichterin, verdient allemal unser Interesse. Ihre frühen Gedichte brachten einen neuen Ton in die russische Poesie. Nach den metaphysischen und geschichtsphilosophischen Spekulationen der Symbolisten artikulierte sie als junge Frau mit großer Nüchternheit ganz einfach ihre Gefühlsregungen. Das Private gerann zu Poesie. Gesten und Gegenstände des Alltags erschienen als Indizien innerer Vorgänge.
An diesem Prinzip des dichterischen Ausdrucks hat Anna Achmatowa auch dann festgehalten, als ihr eigenes Schicksal in den Strom der politischen Katastrophen und Umwälzungen gerissen wurde: Krieg und Revolution; die Erschießung ihres ersten Mannes, Nikolaj Gumiljow, 1921; Diffamierung seitens der proletarischen Schriftstellervereinigung RAPP; Verhaftung und Verfolgung ihres Sohnes und ihrer engsten Freunde, darunter Ossip Mandelstam; Evakuierung während der Blockade Leningrads; neue Angriffe nach dem Zweiten Weltkrieg, da sie offiziell zur Gegnerin des Sowjetregimes erklärt und von Andrej Shadanow als „Nonne und Hure“ geschmäht wurde. Einen Weg der Leiden hat diese Dichterin durchmessen, ehe sie in den sechziger Jahren in der Sowjetunion rehabilitiert und in der Welt gefeiert wurde. Anna Achmatowa starb 1966.
Kurz hintereinander erscheinen jetzt zwei Bände mit Gedichten der russischen Lyrikerin, unterschiedlich in der Auswahl und im übersetzerischen Umgang mit den schwierigen Texten, einig in dem Entschluß, dem Leser nicht nur deutsche Versionen, sondern parallel dazu die russischen Originale zu bieten. Fast will es scheinen, als hätten die Herausgeberinnen beider Bände ihre Auswahl abgestimmt, denn es bestehen zwischen ihnen kaum Überschneidungen; in mancher Hinsicht ergänzen sie einander.
Die von Ilma Rakusa betreute Gedichtauswahl enthält nur wenige Stücke aus der frühen akmeistischen Phase, stellt vielmehr deutlich auf die Dichtungen seit den dreißiger Jahren ab. Ihren wichtigsten Akzent erhält sie durch das in den Jahren 1940 bis 1962 niedergeschriebene „Poem ohne Held“. Auch die kleinen, doch bedeutsamen Zyklen „Im Jahr vierzig“, „Kriegswind“, „Cinque“, „Nördliche Elegien“, „Berufsgeheimnisse“ und „Den Weg aller Welt“ findet man erstmals in einer westdeutschen Ausgabe. Die Nachdichtungen wurden früheren (zum Teil ostdeutschen) Ausgaben entnommen und stammen von Sarah Kirsch, Rainer Kirsch, Uwe Grüning und Heinz Czechowski.
Wie sehr es sich bei diesen „Nachdichtungen“ um Notbehelfe handelt, wird durch die Konfrontation mit den russischen Originalen auf Schritt und Tritt belegt. Sie vermitteln weder den genauen Sinn noch den poetischen Charakter der herb-schönen Gedichte der Anna Achmatowa. Am ehesten vermag noch die Nachdichtung des „Poem ohne Held“ von Heinz Czechowski zu überzeugen. Diese schwierige Dichtung, Rekonstruktion der Petersburger belle époque am Vorabend des Ersten Weltkrieges, gipfelnd im Selbstmord des jungen Dichters Wsewolod Knjasew, stellt ein kunstvoll geknüpftes Gewebe von Anspielungen auf andere Texte dar. Das Authentische der Epoche, hier wiederum als das Private der einstigen Akteure eingefangen, erschließt sich letztlich nur dem Kenner der biographischen Verhältnisse. Ob die von der kundigen Herausgeberin beigesteuerten Kommentare ausreichen, das, Sinngeflecht des Gedichtromans zu durchdringen, darf bezweifelt werden. Wie Ossip Mandelstam, dem sie in der Verschlüsselung der konkreten Vorgänge hier sehr nahe kommt, läuft mit diesem Werk auch Anna Achmatowa Gefahr, zur Dichterin für Literaturwissenschaftler zu werden.
(…)
Reinhard Lauer, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 30.7.1988
zu den gedichten der anna achmatowa
die französische auswahl (pierre seghers, collection autour du monde, übersetzt und herausgegeben von sophie laffitte) ist zur beurteilung der gedichte ohne allen zweifel unzureichend. aus den übertragungen geht nicht einmal hervor, ob die verse gereimt sind oder nicht. auch die einleitung gibt keinerlei sachlichen aufschluß, nur tiraden. was in der französischen version von den texten übrig bleibt, ist ,frauenlyrik‘ im ärgerlichsten sinn des wortes; zumeist werden konventionelle liebesmotive vor symbolistischer kulisse abgehandelt. bevorzugte topoi: das verlassene ufer eines teichs; die sonne, die im herzen untergeht; kerzenschein im schlafzimmer; rote tulpe im knopfloch; das verwelkte rosa der lippen; die kalte gleichgültigkeit der menge; „ich bin deines schluchzens nicht würdig.“ diese versammlung von gemeinplätzen deutet, wenn nicht auf banalität, so darauf hin, daß es sich um lyrik des 19. Jahrhunderts, um lyrik vor rimbaud handelt. allenfalls lassen die übersetzungen eine gewisse tournüre erraten, die nicht ohne den charme der einfalt ist.
später wird die symbolistische (oder müßte es eher heißen: neuromantische?) attitüde nicht aufgegeben, doch sie tritt zurück zugunsten einer schlichtheit, deren zauber in dem maß nachläßt, als sich die volkstümliche absicht breitmacht. es ist eine schlichtheit, die sich bis ins herzige verirrt: die dichterin fragt den kuckuck, wie lange sie noch leben wird; malt ein genrebildchen von ihrer katze, die sie händeleckend und schnurrend begrüßt; und führt während der offensive von 1942 gegen die deutschen eindringlinge neben patriotischem hochgefühl schneemänner und nikoläuse ins feld, eine harm- und hilflosigkeit, die angesichts solcher themen unerlaubt wirkt.
wie unvollkommen freilich die übersetzung ist, auf der diese eindrücke beruhen, zeigt ihr vergleich mit dem einzigen original, das ich dazu finden kann, und dessen italienischer übersetzung. der italienische übersetzer gibt das gedicht an vielen stellen so verändert wieder, daß eine der beiden versionen oder auch beide wertlos sein müssen. übrigens zeigt der originaltext, daß das gedicht auf russisch gereimt ist, wovon die übersetzer keine notiz nehmen.
soweit die unterlagen, die ich habe, ein urteil zulassen, kann es nur negativ ausfallen. der ruhm der verfasserin ist mir unbegreiflich
8.1.1960
Hans Magnus Enzensberger, Lektoratsgutachten aus dem Siegfried Unseld Archiv abgedruckt in Tobias Amslinger: Verlagsautorenschaft. Enzensberger und Suhrkamp, Wallstein Verlag, 2018
Die Exkommunikation
Am Abend des 7. August 1946 betrat Anna Achmatowa die Bühne des Großen Dramatischen Theaters in Leningrad. Die Stadt gedachte des 25. Todestags von Aleksandr Blok, Begründer des russischen Symbolismus. Achmatowas Auftritt in Leningrad erwies sich als eine direkte Fortsetzung ihrer Moskauer Erfolgsserie. „Als sie auf der Bühne erschien“, so erinnert sich der Literat Dmitrij Maksimov, „erhoben sich alle Anwesenden und begrüßten sie voller Leidenschaft und Begeisterung mit einem nicht enden wollenden Applaus… Sie begann zu lesen, und viele im Saal murmelten mit halbgeschlossenen Augen die Verse mit, die sie auswendig konnten“:
Von dem Dichter eingeladen,
kam ich mittags. Es war Sonntag.
In dem weiten Raum war Stille,
Hinterm Fenster herrschte Frost.
Eine himbeerrote Sonne
Über grau-zerfetztem Rauche…
Wie der Hausherr auf mich schaute,
Schweigend mit dem klaren Blick!
Und die Augen dieses Mannes
Kann man nimmermehr vergessen.
Besser ist’s, ich bin behutsam,
Schaue nicht in sie hinein…
Worin lag die besondere Faszination dieser Gedichte? Vielleicht mehr noch als vom lyrischen Niveau waren die Zuhörer von den Themen und von der Individualität angetan. Die russischen Liebhaber der Poesie waren nicht gerade verwöhnt. Die durchschnittliche sowjetische Dichtung der vierziger Jahre roch, um einen dezenten Ausdruck zu verwenden, nach Tendenz, und die Lyriker äußerten sich als Sprachrohre eines Staates, der sich als das Nonplusultra gebärdete. Außerdem besangen neun von zehn Gedichten den Krieg. Dieser wurde in der Regel ähnlich abgehandelt wie im „Lied der Mutigen“ von Aleksej Surkow:
Drohende Wolken sich ballen,
Blitze durchzucken die Luft,
Staubwolken wirbeln, drin schallet
„Alarm!“ der Trompeten Ruf.
Tod dem Faschismus! Die Mutigen
Rufe in den Kampf der Sowjet.
Mutige fürchtet die Kugel,
Tapfere das Bajonett.
Den „Tapferen“ und den „Mutigen“ hingen Dithyramben dieser Art schon längst zum Halse heraus. Vor allem in der Blockadestadt Leningrad mit ihren fünfhunderttausend Toten entstand nach dem Krieg eine Art seelischer Vitaminmangel, ein Drang nach ursprünglicher Intimität, und sei es auch nur in der Poesie. Anna Achmatowas Hommage an Blok, geschrieben im Januar 1914, strahlte die Wärme und Melancholie jener versunkenen heilen Welt aus, als deren letzte Vertreterin die Dichterin selbst galt.
„Es war eine Begegnung“, fährt der Zeitzeuge fort, „mit einer halb vergessenen, halb wiedergefundenen Dichterin.“ Für die meisten aus dem Publikum war dies die letzte Begegnung mit Anna Achmatowa. Ihre nächste öffentliche Lesung ließ beinahe zwanzig Jahre auf sich warten.
Noch am selben Abend schickten zwei führende Kulturbürokraten, Grigorij Aleksandrow und Aleksandr Jegolin, ein Arbeitspapier „Über den unbefriedigenden Zustand der Zeitschriften Swesda und Leningrad“ an Andrej Schdanow, den Sekretär des Zentralkomitees. Darin kritisierten sie zahlreiche Leningrader Autoren, unter ihnen Michail Soschtschenko und Anna Achmatowa – wobei letztere keineswegs die wichtigste Zielscheibe ihrer Angriffe war. Für den 9. August wurden die Leningrader Parteiführer, die Vorstandsmitglieder des lokalen Schriftstellerverbands sowie die Redakteure der beiden inkriminierten Journale dringend nach Moskau beordert. Dort fand eine Sitzung des Organisationsbüros der Partei statt, an der neben anderen Mitgliedern des Politbüros Jossif Stalin persönlich beteiligt war. Das Gremium erarbeitete ein Dokument, das am 14. August als Beschluß des Zentralkomitees „Über die Zeitschriften Swesda und Leningrad“ das Licht der Öffentlichkeit erblickte. Andrej Schdanow wurde beauftragt, den Leningrader Intellektuellen diesen Beschluß zu erläutern.
In der darauffolgenden Woche begannen einige Kulturfunktionäre, an die Autoren, Künstler und Redakteure Leningrads Einladungen zu einer „wichtigen“ Versammlung zu verteilen. Niemand benannte konkret den Gegenstand der Veranstaltung. Der Schriftsteller Michail Soschtschenko, offiziell noch Redaktionsmitglied der Swesda, bat um eine Eintrittskarte. Doch mit Vorwänden unterschiedlichster Art suchte man ihn von einer Beteiligung abzuhalten. So fand am 16. August 1946 die Begegnung der Leningrader Intelligenz mit dem Parteiführer ohne ihn statt.
Genau um fünf Uhr am Nachmittag betrat Andrej Schdanow den Großen Saal des Smolnij, in dem einst Lenin die Machtübernahme der Sowjets verkündet hatte. Er nahm den Vorsitz ein, umgeben von prominenten Autoren und Literaturfunktionären. „Bereits die ersten Minuten im Smolnij stimmten uns vorsichtig“, berichtet ein Zeitgenosse, der es sogar noch 1977, als er seine Erinnerungen einer exilrussischen Zeitschrift anvertraute, vorzog, anstelle seines Namens die geheimnisvollen Initialen „D. D.“ zu verwenden.
Die historischen Räumlichkeiten, die dreimalige Ausweiskontrolle am Eingang, die große Zahl der eingeladenen Autoren, Mitarbeiter von Zeitungen, Film, Rundfunk, Verlagen, die ganze feierlich-strenge Atmosphäre verlieh der Sitzung keinen Arbeitscharakter, sondern zeugte von etwas Höherem. (…) Der Zuschauersaal war stumm, starr, eisig und verwandelte sich während jener drei Stunden in ein Stück weißen, harten Stoffs. Einer Autorin wurde plötzlich übel, sie suchte taumelnd den Ausgang, der jedoch von bewaffneten Soldaten versperrt war. Die Veranstaltung dauerte, zusammen mit den liebedienerischen Redebeiträgen und hysterischen Selbstkritikübungen der beteiligten Autoren, fast bis Mitternacht. Einige hundert Menschen verließen das Gebäude langsam und lautlos. Ebenso schweigend gingen sie über die lange, gerade Allee bis zum nächsten Platz, um noch mit den letzten Trolleybussen und Autobussen nach Hause zu fahren.
Ich komme nun zur Frage des literarischen ,Schaffens‘ von Anna Achmatowa, Ihre Schriften erscheinen in letzter Zeit in den Leningrader Zeitschriften in ,erweiterter Auflage‘. Sie gehört zur literarischen Gruppe der sogenannten Akmeisten, die seinerzeit aus den Reihen der Symbolisten hervorging, und ist Bannerträger einer hohlen, ideenlosen Salonpoesie, die der Sowjetliteratur absolut fremd ist. (…) Sie ist eine Vertreterin dieses ideenlosen, reaktionären literarischen Sumpfes. Die Thematik Anna Achmatowas ist durch und durch individualistisch. Das Register ihrer Poesie ist bis zur Armseligkeit beschränkt, es ist die Poesie der wildgewordenen Salondame, die sich zwischen Boudoire und Betstuhl bewegt. Ihre Grundlagen sind erotische Motive, die mit Motiven der Trauer, Schwermut, des Todes, der Mystik und der Verlorenheit verbunden sind. Das Gefühl der Verlorenheit, ein verständliches Gefühl für das gesellschaftliche Bewußtsein einer aussterbenden Gruppe, die düsteren Töne der Hoffnungslosigkeit Sterbender, mystische Erlebnisse, gepaart mit Erotik – das ist die geistige Welt Anna Achmatowas, ein Stück aus den Trümmern der unwiederbringlich und für alle Ewigkeit versunkenen Welt der alten aristokratischen Kultur, der „guten alten Zeiten unter Katharina“. Sie ist halb Nonne, halb Dirne, oder richtiger Dirne und Nonne, bei der sich Unzucht und Gebet verflechten. (…) Das ist Anna Achmatowa mit ihrem kleinen engen persönlichen Leben, mit ihren nichtigen Erlebnissen und ihrer religiös-mystischen Erotik. Die Poesie der Achmatowa ist dem Volk vollkommen fremd.
Als Schdanow gegen Ende der ersten Stunde seiner Rede an diesem Punkt angelangt war, hatte er Michail Soschtschenko bereits als „nichtsowjetischen Schriftsteller“, „Heuchler“, „abgeschmackten Kleinbürger“, „Schurken“ und sogar als „Deserteur“ – während der Leningrader Blockade – zur Strecke gebracht. Der infame Vorwurf der Desertion blieb im Zusammenhang mit der auf die Rede folgenden Hetzkampagne auch der Dichterin nicht erspart. Dabei läßt sich dokumentarisch eindeutig nachweisen, daß Soschtschenko und Achmatowa zur Zeit der Blockade auf direkte Anordnung des Zentralkomitees nach Alma-Ata bzw. nach Taschkent evakuiert worden waren.
Was Soschtschenko betraf, so machte man ihm eine Erzählung zum Vorwurf, welche die Zeitschrift Swesda in ihrer Ausgabe Nr. 1/1946 aus dem Kinderjournal Mursilka übernommen hatte. Sieht man von dieser Tatsache sowie von dem humoristischen Charakter der kleinen Novelle ab, dann kann man für die Funktionäre ein gewisses Verständnis aufbringen. „Die Abenteuer eines Affen“ ist die groteske Schilderung des Leningrader Nachkriegsalltags mit den Augen eines dem Zoo entflohenen Tieres. Die hauptberuflichen Zeitschriftenleser, denen Soschtschenkos Art, offizielles Pathos und ideologisierte Sprache zu vulgarisieren, schon früher auf die Nerven gegangen war, reagierten auf jeden neuen Text ohnehin mit sprungbereiter moralischer Entrüstung. Deshalb war für sie der Nachdruck in der Swesda ein gefundenes Fressen, ein hervorragender Anlaß, alte Rechnungen mit dem Autor begleichen zu können.
Soschtschenkos Tragödie lag in der Natur seines Talents. Der Protagonist seiner besten Erzählungen aus den zwanziger und dreißiger Jahren war der sowjetische Kleinbürger, und Gegenstand seiner Satire war die Art und Weise, wie sich diese sehr zahlreiche Spezies die offiziellen Sprachregelungen in ihrer jeweils gültigen Aktualität in ihr spießiges Vokabular einbaute. Seine Gegner verdammten Soschtschenko deshalb als kleinbürgerlichen Schriftsteller, und er wiederum versuchte diese Demagogie mit der ebenfalls unrichtigen Schutzbehauptung zu widerlegen, er sei bloß ein Kritiker der sowjetischen Kleinbürgerlichkeit. In Wirklichkeit ging seine Kritik viel weiter: Sie enthüllte die verlogenen ideologischen Floskeln auf semantischer Ebene.
So plappert der kleine Mann die offizielle Version der sowjetischen Geschichtsauffassung folgendermaßen nach:
Ich habe schon immer mit den zentralen Überzeugungen sympathisiert. Nicht mal damals in der Epoche des Kriegskommunismus, wie sie da die NÖP einführten, hab ich protestiert. Wenn NÖP, dann eben NÖP. Ihr müßt’s ja wissen. Und wirklich, unter dem Kriegskommunismus, wie frei ging’s da zu, in Bezug auf Kultur und Zivilisation. Wollen mal sagen, im Theater brauchte man sich nicht ausziehen – sitz doch, in was du hergekommen bist. Das war eine echte Errungenschaft.
Oder der Ausländer mit den Augen des homo sovieticus:
Einen Ausländer kann ich immer von unseren Sowjetmenschen unterscheiden. Diese bourgeoisen Ausländer haben was Eigenartiges in der Visage. Die ist, wie soll ich sagen, unbeweglicher und guckt verächtlicher als bei uns. Wenn so einer, wollen mal sagen, einen bestimmten Gesichtsausdruck angenommen hat, dann betrachtet er damit auch alle übrigen Gegenstände.
Und schließlich: Auszug aus der Festansprache des Vorsitzenden einer Wohnungsgenossenschaft zum hundertsten Todestag von Aleksandr Puschkin.
Also, ich komme zum Schluß, Genossen. Puschkins Einfluß auf uns ist gewaltig. Das war ein großer, genialer Dichter. Man möchte bedauern, daß er nicht unter uns lebt. Wir würden ihn auf Händen tragen und ihm ein märchenhaftes Leben einrichten, natürlich nur, wenn wir wüßten, daß wirklich ein Puschkin aus ihm wird. Es kommt ja vor, daß die Zeitgenossen auf jemand hoffen, ihm ein anständiges Leben einrichten, ihm Autos und Wohnungen geben, und nachher stellt sich raus, er ist nicht Fisch noch Fleisch. Sondern wie man so sagt, nichts bei ihm zu holen. Überhaupt, Dichter ist ein finsterer Beruf. (…) An Sängern hat man viel mehr Freude. Die singen, und man sieht gleich, was die für ’ne Stimme haben.
Wenn man bedenkt, daß Soschtschenko diesen offen kulturfeindlichen Monolog mit leicht faschistischen Untertönen im Jahre 1937 schrieb, als er selbst noch zu den Privilegierten gehörte, kann man sich leicht vorstellen, was er von der Kehrseite dieses „Auf-Händen-Tragen“ erwartete. Am wenigsten konnte er darauf hoffen, daß das subversive Potential solcher Quasi-Zitate aus der sowjetischen Alltagssprache bei den Zensoren langfristig unbemerkt bleiben würde. Es ist geradezu ein Wunder, daß der Name Soschtschenko erst ab 1943 in der geheimen Korrespondenz der obersten Partei- und Zensurbehörden auftauchte.
Doch welche Texte konnte man Anna Achmatowa ernstlich zum Vorwurf machen? Schdanows Rede enthält insgesamt vier Zeilen als direktes Zitat, drei Gedichte werden unmittelbar angesprochen, ein viertes indirekt erwähnt.
Vom kommunistischen Standpunkt aus bot noch am ehesten jenes Gedicht den geeigneten Anlaß zur Kritik, in dem sich die Autorin an das alte Petersburg erinnert. Schdanow zitiert daraus eine einzige Zeile:
Alles geplündert, verkauft und verraten…
Allerdings war dieses Poem im Jahre 1921 geschrieben und gedruckt worden. Bereits damals hatten sich Kritiker aus dem Lager des Proletkults gefunden, welche die Dichterin „konterrevolutionärer Inhalte“ bezichtigten. Gegen diese Anschuldigungen hatte sich der Rezensent Ossinskij im zentralen Parteiorgan Prawda vom 4. Juli 1922 verwahrt und war nicht einmal vor der zutreffenden Aussage zurückgeschreckt:
Im Chaos der Revolution wurde tatsächlich vieles „geplündert, verkauft und verraten“.
Dies war eine Tatsache, mit der damals noch viele Kommunisten offen umgehen konnten.
Ein anderes Gedicht, veröffentlicht in der Zeitschrift Leningrad, war für Schdanow ebenfalls ein Stein des Anstoßes. Die Dichterin schildert darin ihre Einsamkeit während der Evakuierung in Taschkent, die sie mit einem schwarzen Kater teilen mußte. „Über einen schwarzen Kater hat Achmatowa auch im Jahre 1909 schon geschrieben“, erläuterte der Kulturpapst bedeutungsschwer seinen Argwohn. Nichtsdestoweniger muß seine Behauptung, daß ein solches Einsamkeitsgefühl zur Zeit des Großen Vaterländischen Krieges illegitim gewesen sei, selbst für die Zuhörer des Jahres 1946 befremdlich geklungen haben.
Ein echter Wutausbruch ereilte Schdanow, als er einige Zeilen aus dem Gedichtband Anno Domini vortrug:
Ich schwöre dir bei dem Garten der Engel,
Ich schwöre bei der wundertätigen Ikone,
Bei dem feurigen Rauch unserer Nächte…
Sinnigerweise vergaß der Chefideologe in seiner heiligen Empörung, den Inhalt des Eides zu nennen:
Ich kehre niemals zu dir zurück.
Zu sehr war er darauf versessen, die religiöse Metaphorik des Gedichtes zu entlarven. Dieselben Verszeilen aus der ansonsten sklavisch treuen DDR-Übersetzung der Schdanow-Broschüre klingen durchaus anders:
Aber vor dir, englischer Garten
verneige ich mich.
Verneige mich vorm wundertätigen Ikon
und unserer heißen Nächte Sohn…
Die unfreiwillige Obszönität dieser Nachdichtung soll vermutlich – unter freiwilligem Mißverstehen des Wortes „englisch“ in seiner Doppelbedeutung – ein Katzbuckeln der Dichterin vor dem britischen Imperialismus beweisen.
Selbstverständlich verschwieg Schdanow, daß dieses Gedicht ebenfalls aus dem Jahre 1921 stammte, also recht wenig mit seiner Kritik an den beiden Leningrader Zeitschriften zu tun haben konnte. Dies ist besonders auffällig, wenn man bedenkt, daß die ganze persönliche Haßtirade gegen Achmatowa, insbesondere das Schimpfwort „Dirne“, ausschließlich an diesen drei Zeilen hängt. Damit entsteht der Eindruck, als sei es Schdanow in seiner Philippika nicht um die Dichtung gegangen, sondern um die Dichterin selbst.
Zur ganzen Wahrheit gehört es, darauf zu verweisen, daß sich Andrej Schdanow bei seinen verunglimpfenden Äußerungen einer recht vornehmen Quelle bediente. Der Literaturwissenschaftler Boris Eichenbaum war es, der in den zwanziger Jahren den Zusammenhang zwischen mystisch-religiösen und erotischen Elementen in Achmatowas Dichtung analysiert und daraus folgende Konsequenz gezogen hatte:
Hier können wir schon den Beginn des paradoxen oder, korrekter, des widersprüchlichen doppelten Bildes der Heldin sehen – halb ,Dirne‘, vor Leidenschaft brennend, halb Bettelnonne, die zu Gott um Vergebung betet.
Für jeden geübten Leser ist eindeutig, daß Eichenbaum hier über die Heldin Achmatowas, das heißt über ihr lyrisches Ich spricht. Der Unterschied zwischen einer natürlichen Person und ihrer poetischen Abbildung ist ungefähr so groß wie die Differenz zwischen Dichtung und Wahrheit, Traum und Wirklichkeit schlechthin. Wenn Schdanow – ob in böser Absicht oder aus schlichter Unkenntnis – das „lyrische Ich“ der Dichterin mit deren Person identifiziert, dann wirkt selbst das biblisch angehauchte Wort „bludniza“ (= Dirne, Sünderin, unkeusches Weib) vulgär. Und wenn es ein Mann mit gespitztem Mund ausspricht, wirkt es in seiner Labialität ähnlich wie seine modern-obszöne großstädtische Entsprechung „bljadj“ (= Hure). Schdanow hat sich hier auf den primitivsten sexistischen Masseninstinkt einer von erotischen Tabus und Geheimniskrämereien geprägten Gesellschaft bezogen. Weil im öffentlichen Bewußtsein die Rede Schdanows und der ZK-Beschluß ein und dasselbe waren, wurde die Doppelinjurie „Nonne – Dirne“ in den Rang der offiziell bestätigten „Charakteristik“ der Dichterin erhoben. Achmatowa wurde sozusagen zur „Nonne und Dirne“ ernannt.
Um nichts besser erging es Anna Achmatowa mit dem Begriff „Erotik“. Bei Eichenbaum war dieses Wort Teil des normalen Vokabulars eines gebildeten Menschen. Die Sowjetzeit bereitete der Möglichkeit des wertfreien Wortgebrauchs ein jähes Ende. Selbst Lexikonartikel bekamen einen offiziös-ideologischen Klang. Geradezu gespenstisch mutet das Stichwort „Erotik“ in der Neuen Sowjetenzyklopädie an – als hätten die Herausgeber des Jahres 193 5 bereits Achmatowa und die Schdanowrede im Hinterkopf gehabt:
Bei den sich in Auflösung befindenden Klassen (…) trägt die Erotik den Charakter einer raffinierten Perversität, (…) verbindet sich häufig mit Mystizimus (…) und dient als Mittel der Flucht vor der Wirklichkeit.
Die spätere Ausgabe des unentbehrlichen Handbuchs (1957) geriet noch lapidarer und für Achmatowa noch weniger günstig:
Erotik in der Kunst – offene, manchmal grobe Schilderung der Liebe und des sexuellen Lebens.
Kurz vor ihrem Tod behauptete Anna Achmatowa, sie habe „nie eine erotische Zeile“ geschrieben. Diese Aussage, die zum großen Glück für die Weltliteratur nicht der Wirklichkeit entspricht, ist eine Geste der Abwehr gegenüber der offiziellen Obszönität.
Die damalige Öffentlichkeit wußte nicht, daß der ZK-Beschluß von 1946, was Achmatowa betraf, ein längeres Vorspiel, gewissermaßen eine Generalprobe gehabt hatte. Dies kann anhand der unlängst veröffentlichten Geheimmaterialien der Agitations- und Propagandaabteilung des ZK der sowjetischen KP schlüssig belegt werden.
Als es Achmatowa im Mai 1940 gelungen war, nach neunzehn Jahren Pause ihren Gedichtband Aus sechs Büchern zu veröffentlichen, entstand für sie eine Situation, die in vielerlei Hinsicht ihren kurzen Nachkriegsruhm vorwegnahm. Nachdem sie bereits zu Beginn des Jahres Mitglied des Schriftstellerverbands hatte werden dürfen, wurde sie von so prominenten sowjetischen Autoren wie Aleksej Tolstoj und Aleksandr Fadejew für den Stalinpreis vorgeschlagen. Boris Pasternak war damals sogar der Meinung, die neuen Vergünstigungen für die Dichterin, die nicht ohne Stalins Wissen möglich gewesen wären, könnten letztlich auch Lew Gumiljows Entlassung aus der Lagerhaft bewirken.
Offenbar befand schon bald jemand auf einer höheren Machtetage, daß um die Achmatowa zu viel Rummel gemacht werde. Ende September 1940 sandte der ZK-Mitarbeiter Krupin eine recht tendenziöse Auswahl aus dem neuen Gedichtband an Schdanow und bemerkte dazu:
Achmatowas dichterischer Müll ist auf zwei Quellen zurückzuführen, denen ihre ganze ,Poesie‘ gilt: Gott und die ,freie‘ Liebe. Die poetischen Bilder hierzu sind aus der kirchlichen Literatur entlehnt.
Darauf folgten drei Seiten mit Beispielen für diese These, unter ihnen jene Verszeilen aus dem Zyklus „Anno Domini“, die sechs Jahre später von Schdanow im Smolnij zitiert werden sollten. Doch zunächst begnügte dieser sich damit, Krupins Papier mit einer Randnotiz zu versehen und an die Leiter der Abteilung Agitation und Propadanda zu senden. Sein Kommentar war ebenso lakonisch wie instruktiv:
Es ist einfach eine Schande, daß solche, mit Verlaub, Gedichtbände erscheinen können. Wie konnte diese ,Unzucht mit Gebet zu Gottes Ruhm‘ Achmatowas das Licht der Welt erblicken? Wer hat sie gefördert? Was ist der Standpunkt des Glavlit? (der obersten Zensurbehörde, G. D.) Bitte klären und Vorschläge unterbreiten.
Die Genossen Aleksandrow und Polikarpow formulierten den entsprechenden Beschluß, und die restliche Auflage der Gedichtesammlung Aus sechs Büchern wurde unauffällig aus dem Verkehr gezogen.
Anna Achmatowa vertrat beharrlich bis ans Ende ihrer Tage die Ansicht, der ZK-Beschluß, Schdanows wüster Angriff, ihr Ausschluß aus dem Schriftstellerverband und schließlich Punins und Lew Gumiljows Verhaftung Ende 1949 seien auf ein und dieselbe Ursache zurückzuführen: Alle verhängnisvollen Ereignisse dieser Jahre seien hauptsächlich, wenn nicht ganz und gar, auf Isaiah Berlins Besuch im Fontannij Dom begründet. Während ihres Oxford-Aufenthalts im Juni 1965 behauptete sie sogar gegenüber ihrem Gastgeber, daß sie und er durch ihr nächtliches Gespräch Ende November 1945 Stalins Zorn und damit den Kalten Krieg entfesselt hätten.
Sir Isaiah Berlin hat diese Ansicht in seinen Erinnerungen und auch im persönlichen Gespräch mit einigen neutral-deskriptiven Sätzen kommentiert, aus denen ich das ungläubige Kopfschütteln des Rationalisten herausspüre:
Sie meinte das genauso, wie sie es sagte, und beharrte auf der Korrektheit ihrer These. Sie betrachtete uns beide als Gestalten der Weltgeschichte, vom Schicksal dazu bestimmt, eine folgenschwere Rolle in einem kosmischen Konflikt zu spielen – und in ihren Gedichten aus jener Zeit spiegelt sich das wider. Das war ein fester Bestandteil ihrer historisch-philosophischen Weltsicht, auf dem ein großer Teil ihrer Poesie beruhte.
Tatsächlich schien Achmatowa keine Zweifel an der welthistorischen Bedeutung ihrer Begegnung mit dem „Gast aus der Zukunft“ zu haben. In ihrer „Dritten Widmung“ des Gedichtes „Poem ohne Held“ formuliert sie sehr deutlich:
Nun hör ich auf vor Furcht zu frieren,
Will lieber Bachs Ciacona spüren,
Da kommt ein Mensch bei mir vorbei.
Er wird mir nie zum süßen Gatten,
Gemeinsames Verdienst wir hatten:
Jetzt bricht das Jahrhundert entzwei.
Der Historiker in mir protestiert mit jeder Faser gegen die absurde Annahme, eine Affäre wie diese könne überhaupt den Konflikt zweier Supermächte beeinflussen. Gleichzeitig aber spüre ich in der eigenen Ablehnung etwas Verdächtiges, nämlich jene Überheblichkeit des jungen marxistischen Fatalisten, der seinerzeit alle nicht streng dialektischen oder historisch-materialistischen Erklärungen der Welt – Apage Satana! – von sich gewiesen hat. Eine solche Haltung setzte voraus, daß man bestimmte Marxsche Thesen – etwa die Verelendungstheorie hinsichtlich der Entwicklung in den kapitalistischen Ländern oder die Theorie vom allmählichen Absterben des Staates im Laufe der sozialistischen Entwicklung – für unabdingbar hielt und im Sinne eines religiösen Bekenntnisses fest daran glaubte. Doch heute erscheint mir keines dieser Axiome rationaler als zum Beispiel der Glaube an einen Feuergott.
Achmatowas Überzeugung hingegen, das nächtliche Gespräch mit Berlin im Fontanij Dom habe den Kalten Krieg ausgelöst, wurzelt in der realen Denkweise ihrer Zeit. Die Begegnung dieser bedeutenden Dichterin mit einem westlichen Diplomaten zur Zeit der wachsenden Spannungen zwischen den Alliierten war eine symbolhafte Handlung und damit in der Sowjetunion ein politisches Ereignis ersten Ranges. Wenn der Erste Sekretär der britischen Botschaft es sich erlauben konnte, in Begleitung von Randolph Churchill, dem Sohn des Erzrivalen, in Leningrad frei herumzuspazieren, dann mußten im Kreml ohnehin alle Zeichen auf Alarm stehen.
Für dieses Gefühl der Bedrohung spielte das tatsächliche Gefährdungspotential eines solchen Gespräches keine Rolle, ebensowenig sein Inhalt, falls er den Behörden hundertprozentig bekannt geworden wäre. Boris Pasternak traf sich im Spätsommer und Herbst 1945 wöchentlich mit Isaiah Berlin, sprach mit ihm über nichts Geringeres als über seinen halbfertigen Doktor Schiwago und blieb völlig unbehelligt. Etwas Willkürliches oder Zufälliges – etwa die gute Laune oder eine positive Affinität des höchsten Entscheidungsträgers – konnte hierbei von Bedeutung gewesen sein.
Das Stalinsche System war keine moderne institutionelle Diktatur, sondern eine archaische Despotie, in der Wohlwollen oder Wut des Herrschers durch Dutzende oder gar Tausende von Befehlsempfängern weitervermittelt und umgesetzt wurden. Wichtig daran war nicht einmal, ob eine bestimmte Entscheidung von Zahnschmerz, Alkohol oder irgendeiner Befindlichkeit beeinflußt worden war, sondern die Tatsache, dar es keine gesellschaftliche Kraft gab, die sich gegen die Willensäußerungen des Diktators durchsetzen konnte. Wir können heute nicht mehr nachvollziehen, ob Stalins Empörung über das Duo Achmatowa-Berlin tatsächlich eine negative Wirkung auf die sowjetisch-britischen Beziehungen ausübte. Aber wäre Stalin auf die Idee gekommen, die Begegnung im Fontannij Dom als Vorwand zum Einfrieren dieser Beziehungen zu benutzen, dann hätte niemand diesen Prozeß aufhalten können. Dies war Anna Achmatowa bewußt, stößt jedoch bei westlichen Beobachtern auf Unverständnis und löst, wie bei Isaiah Berlin, allenfalls ein höflich-skeptisches Lächeln aus.
Ein Zusammenhang zwischen dem nächtlichen Besuch des britischen Diplomaten bei Anna Achmatowa und der Tatsache, daß die Dichterin wenig später in Ungnade fiel, ist naheliegend. Die Legende dazu lautet: Gleich nach Isaiah Berlins Erscheinen im Fontannij Dom erstattete Schdanow dem „Hausherrn“, wie Stalin von seinen engsten Mitarbeitern genannt wurde, darüber Bericht. Er sagte angeblich:
Unsere Nonne empfängt neuerdings britische Spione.
Stalin soll daraufhin dermaßen unflätig geflucht haben, daß sich Anna Achmatowa noch zwanzig Jahre später genierte, seine Worte gegenüber Sir Isaiah wiederzugeben.
Der Satz „Unsere Nonne empfängt neuerdings britische Spione“ ist der Natur der Dinge entsprechend nicht aktenkundig. Er gehört demselben Legendenreigen an wie die angeblichen Erkundigungen, die der Georgier über die wichtigste Dichterin seines Imperiums einzuziehen beliebte. In der verbalen Überlieferung wird der Satz, der solche Erkundigungen immer eingeleitet haben soll, wegen der größeren Authentizität um einen überbetonten georgischen Akzent ergänzt:
Schto delajet nasa manachinja? (Was macht unsere Nonne?)
Einer anderen Legende zufolge war Stalins Zorn auf Achmatowas wachsende Popularität zurückzuführen. Ihr Moskauer Triumphzug war ihm rasch zu Ohren gekommen. Nika Glen, Nina Ardowa und Lew Gornung berichten übereinstimmend, daß das Publikum bei Anna Achmatowas Erscheinen auf der Bühne zehn oder fünfzehn Minuten lang stehend applaudiert habe. Als Schdanow darüber Bericht erstattete, soll Stalin gefragt haben:
Wer hat den Applaus und das Aufstehen organisiert?
Dies teilt Nadeschda Mandelstam als Anekdote aus Soschtschenkos Mund mit und fügt hinzu:
Meines Erachtens ist dieser Satz „zitatverdächtig“, wie Pasternak es nannte, das heißt, es ist ein Satz, der in der Tat ein Ausspruch des Menschen sein kann, dem er zugeschrieben wird.
Doch möglicherweise spielte hier nicht nur Stalins gekränkte Eitelkeit eine Rolle, sondern ebenso einige systembedingte Prestigeerwägungen. Das Protokoll öffentlicher Kundgebungen in der Sowjetunion regelte die Hierarchie des Beifalls: Applaus, stürmischer Applaus, lang anhaltender stürmischer Applaus, stürmischer Applaus, bei dem sich alle Anwesenden von den Plätzen erheben, und als Höhepunkt begeisterter, nicht enden wollender stürmischer Applaus, der schließlich in stehende Ovationen einmündet. Außerdem war klar geregelt, wer auf die einzelnen Gradabstufungen des Beifalls ein Anrecht hatte. Auf den politischen Veranstaltungen der fünfziger Jahre standen oft Applausbrigaden in Bereitschaft, die auf einen Wink aus dem Präsidium hin ihre Aufgabe wahrnahmen. So etwas nannte man „gelenkte Spontaneität“.
Die Dichterin Achmatowa hatte sowohl im Polytechnischen Museum als auch im Kolonnensaal der Gewerkschaften alle Stufen übersprungen und gleich das Maximum an Zustimmung erfahren. Sie selbst reagierte darauf mißtrauisch. Natalia Rosskina erinnert sich:
Die prophetisch veranlagte, politisch überhaupt nicht naive Achmatowa fühlte sofort, daß diese Begeisterung ihr nichts Gutes offenbarte.
Dieser Abend im April 1946 sollte sich für sie schon bald als schicksalhaft erweisen. Im Nachhinein kommentierte sie ein Foto, auf dem sie gemeinsam mit Boris Pasternak im Club der Schriftsteller zu sehen war, mit den Worten:
„Und hier verdiene ich mir gerade den ZK-Beschluß.“
Wenn ich von Legenden rede, so meint dies keineswegs die Unwahrheit. Es gibt eine Vielzahl von Tatsachen, die, wie Sir Isaiah Berlin sagt, unter den Bedingungen einer äußerst strengen Zensur nur in der verbalen Tradition überleben. Die berühmten Telefongespräche zwischen Stalin und Bulgakow oder Stalin und Pasternak sind grundlegende und nicht bestreitbare Tatsachen der russischen Literaturgeschichte. Doch jahrzehntelang existierten sie nur auf der Ebene der Folklore, waren in keiner Weise verifizierbar und veränderten ihre Konturen, ja sogar ihre Inhalte von Erzähler zu Erzähler. Der ihnen gemeinsame unabdingbare Wahrheitsgehalt lag in der Tatsache des spezifischen, beinahe intimen Verhältnisses der sowjetischen Machthaber zu den Literaten, wenn auch nicht immer zur Literatur. Dieser Zusammenhang ist inzwischen dokumentarisch belegbar.
So berichtet Oleg Kalugin, Generalmajor des KGB außer Diensten, in seinem Moskauer Vortrag vom April 1993, die Wohnung im Fontannij Dom sei nach Berlins Besuch mit Abhörgeräten versehen worden, und etliche Spitzel hätten sich überaus rührig um Anna Achmatowa gekümmert. Tatsache ist, daß der britische Diplomat fast selbstverständlich als Spion eingestuft wurde und Achmatowa – auch das wissen wir von Kalugin – ebenfalls unter diesen Verdacht geriet. Es gibt genügend Beweise, daß zu dieser Zeit in der Sowjetunion sowohl die Spionage als auch die Literatur als politisches Problem in die Zuständigkeit der höchsten Machtebene fielen. So brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn der erste Mann des Staates bereit war, mit dem zweiten über das „enge, kleine Privatleben“ einer alternden Dichterin zu tratschen.
Daß Stalin ein besonderes Interesse am Fall Achmatowa hatte zeigt das Protokoll jener Tagung des Organisationsbüros, die sich mit den angeblich renitenten Leningrader Journalen befaßte.
PROKOFJEW: (Vorsitzender des Leningrader Schriftstellerverbands) Was die Gedichte angeht… Ich glaube nicht, daß wir mit der Veröffentlichung der Gedichte von Anna Achmatowa eine so große Sünde begangen haben. Sie ist eine Dichterin mit leiser Stimme, und Gespräche über die Traurigkeit sind auch für den Sowjetmenschen typisch.
STALIN: Außer daß Anna Achmatowa einen altbekannten Namen hat – was kann man noch an ihr finden?
PROKOFJEW: Unter ihren Werken aus der Nachkriegszeit gibt es einige gute Gedichte (…).
STALIN: Ein, zwei, drei Gedichte – das war’s? Mehr nicht?
PROKOFJEW: Sie hat wenig Gedichte mit aktuellen Themen, Jossif Wissarionowitsch. Aber sie ist eine Dichterin vom alten Schlag mit bereits geformten Anschauungen und hat daher nichts Neues mehr zu bieten.
STALIN: Dann soll sie anderswo publizieren. Warum ausgerechnet in der Swesda?
PROKOFJEW: Ich muß sagen, daß das, was wir bei der Swesda abgelehnt haben, später die (Moskauer) Snamja gedruckt hat.
STALIN: Die Snamja kriegen wir schon auch noch. Wir kriegen alle.
PROKOFJEW: Das ist auch gut so.
Prokofjew versuchte offensichtlich, Stalin davon zu überzeugen, daß es unangemessen sei, die Schärfe der bevorstehenden Auseinandersetzung gegen Anna Achmatowa zu richten. Grob gesagt versuchte er, dem Diktator zu vermitteln, daß die Partei mit einer Anti-Achmatowa-Kampagne propagandistisch keine Kopeke gewinnen konnte – daß die auserkorene Gegnerin zu alt, zu schwach und zu harmlos sei. All diese Einwände ließ Stalin von sich abprallen. Mit geradezu kindischer Hartnäckigkeit wollte er Achmatowas Exkommunikation um jeden Preis durchsetzen – als wollte er sie für etwas Bestimmtes bestrafen, ungeachtet jeder politischen Zweckmäßigkeit und außerhalb des Kontextes der beiden Zeitschriften.
Zu den bereits erwähnten Motiven Stalins gehört ein weiterer, eher atmosphärisch bedeutsamer Umstand: Der junge Ssosso Dschugaschwili hatte eine poetische Ader und schrieb Gedichte. Sobald er jedoch in Tiflis mit einem marxistischen Zirkel in Verbindung kam und seine ersten fulminanten Artikel in der georgisch-sozialdemokratischen Zeitschrift Akhali Zchowreba erschienen, kehrte er dieser edlen Kunstgattung den Rücken. Allerdings wurden seine Erstlingswerke auch von zeitgenössischen literarischen Autoritäten wahrgenommen, und ein romantischer Gedichtzyklus – über die Liebe zu den Bergen des Kaukasus und zur Freiheit – gelangte sogar in eine repräsentative Anthologie. Der Autor war damals achtzehn Jahre alt.
Stalin verfügte zweifellos über eine gewisse literarische Bildung und individuellen Geschmack. So ist zum Beispiel bekannt, daß Walt Whitman sein Lieblingsdichter war – möglicherweise eine Erklärung dafür, daß er die avantgardistisch-aktivistische Dichtung von Majakowskij, anders als der geschmackskonservative Lenin, emphatisch aufnahm. Sein Wertebewußtsein äußerte sich in direkten Interventionen zugunsten des ausreisewilligen Samjatin oder des erwerbslos gewordenen Bulgakow – letzteren nahm er sogar öffentlich gegenüber Angriffen von Verfechtern des Proletkults in Schutz.
Es spricht einiges dafür, daß Stalin um die poetischen Qualitäten Achmatowas wußte. Nicht zufällig kam die Dichterin auf die Liste der Autoren, die in den panischen Herbsttagen 1941 aus den bedrohten Städten Leningrad und Moskau evakuiert werden mußten. Angesichts der eingeschränkten Transportmöglichkeiten wurden vor allem Schriftsteller bevorzugt, die – so hieß es in den „persönlichen Richtlinien“ des ZK – „einen literarischen Wert besitzen“. Die Richtlinien wurden von Aleksandrow erarbeitet, die Liste von Jegolin zusammengestellt – beide Funktionäre sollten später in Achmatowas Biographie eine verhängnisvolle Rolle spielen. Die Durchführung der Evakuierungen lag in der Verantwortung von Fadejew, der Stalin direkt über den Verlauf Bericht erstattete.
Noch eine weitere Geschichte ging damals um: Als Anna Achmatowa mit Typhus im Taschkenter Krankenhaus lag, soll Stalin sich nach ihrem Gesundheitszustand erkundigt haben („Was macht unsere Nonne?“). Resultat dieser Allerhöchsten Fürsorge war das Erscheinen einer Leselampe über ihrem Krankenbett. Selbst wenn diese Geschichte nur eine schön abgerundete Legende sein sollte, so spiegelt sie doch eine reale Konstellation wider: der gute Zar und die auf seine Gnade angewiesene „Bettelnonne“. Jedenfalls ist bekannt, daß Achmatowa damals mit Hilfe einflußreicher Kollegen ein Einzelzimmer im besten Spital der Stadt erhielt – ein schier unglaubliches Privileg, das tatsächlich Einmischung von höchster Stelle voraussetzte.
Stalin seinerseits kann von folgenden Überlegungen geleitet worden sein: Als literarisch bewanderter und großzügig denkender Staatsmann hatte er 1940 die bereits vergessene Dichterin Achmatowa wiederauferstehen lassen. Trotz der Beschlagnahmung ihres Buches durfte sie Mitglied des Schriftstellerverbands bleiben. Die Kriegsjahre konnte sie in der ruhigen usbekischen Hauptstadt verbringen. Nach ihrer Rückkehr im Mai 1944 wurde ihr ein Ruhm ohnegleichen zuteil, den sie zwar mit ein paar russisch-patriotischen Gedichten, niemals jedoch mit einem plakativen Engagement im sowjetischen Sinne erwiderte (bei Bulgakow und Pasternak fehlte es nicht an direkten, wenn auch rein formalen Bekenntnissen zu Stalin).
Nun traf sich diese Dichterin mit dem Vertreter einer zumindest potentiell feindlichen Großmacht und pfuschte damit in der großen Politik herum. Dies muß Stalin zumindest irritiert, wenn nicht verärgert haben, und vermutlich beschloß er, die Undankbare beim ersten sich ergebenden Anlaß zu bestrafen. Angesichts der Tatsache, daß öffentlicher Tadel in der Sowjetunion bei weitem nicht zu den grausamsten Maßnahmen gehörte, konnte Stalin das von ihm initiierte Verfahren sogar noch für fair und human halten.
Als der Diktator die rhetorische Frage an Prokofjew richtete, ob Achmatowa „nur“ ein, zwei oder drei gute Gedichte geschrieben habe, verriet er jenen spezifisch sowjetischen Zugang zu Kunstwerken, der nicht nur für die Auseinandersetzung um die Swesda und Leningrad, sondern für die gesamte Kulturpolitik charakteristisch war. So wurde das Erscheinen der Zeitschrift Leningrad infolge des Augustbeschlusses mit der demagogischen Begründung eingestellt, in der Stadt gäbe es zur Zeit nicht genügend Talente, um die Seiten von zwei Journalen regelmäßig füllen zu können. Einige Jahre später wurden die staatlichen Drehgenehmigungen für Spielfilme von annähernd hundert auf zwölf pro anno gekürzt, um die Zahl der „schlechten“ Filme radikal zu verringern – so die „plausible“ Begründung einer drastischen Sparmaßnahme.
Die Argumente waren meist vorgeschoben, die quantitative Sichtweise war jedoch echt. Das Schulbeispiel stammt aus einer Rede von Andrej Schdanow, in der er Wano Muradelis Oper Die große Freundschaft tadelt:
In dieser Oper sind nicht nur die überaus reichen orchestralen Mittel des Moskauer Großen Theaters, sondern auch die großartigen stimmlichen Möglichkeiten seiner Sänger ungenützt geblieben. Das ist ein großer Fehler, um so mehr, als man die Talente der Sänger des Großen Theaters nicht vergraben soll, indem man sie halbe Oktaven, zwei Drittel einer Oktave singen läßt, wenn sie zwei Oktaven beherrschen. Man soll die Kunst nicht verarmen. (sic!)
Als unausgesprochenes Modell für das musikalische Kunstwerk wird hier die Ökonomie, die Herstellung materieller Werte suggeriert. In seiner Smolnij-Rede gibt Schdanow diesen Zusammenhang offen zu:
Einigen Leuten erscheint es sonderbar, daß das ZK solche strengen Maßnahmen in der literarischen Frage ergriffen hat. Daran ist man bei uns nicht gewöhnt. Man ist der Meinung, wenn in der Produktion Ausschuß erzeugt wird oder das Produktionsprogramm für Massenbedarfsartikel oder der Holzbeschaffungsplan nicht erfüllt werden, so sei es ganz natürlich, einen Verweis dafür zu erteilen (zustimmende Heiterkeit im Saal), wenn aber in der Erziehung der Jugend Ausschuß produziert wird, sollten wir das dulden.
Offensichtlich waren die Apparatschiks bestrebt, die literarische Industrie mit planwirtschaftlichen Mitteln zu lenken und dafür zu sorgen, daß im Sinne der Ideologie möglichst wenig Ausschuß produziert wurde. Hier eine Siegesmeldung der Abteilung für Agitation und Propaganda:
Allein im Jahre 1943 wurden aus dem Plan der zentralen Verlage 432 Bücher und Broschüren herausgenommen – als nicht aktuell oder zum Druck ungeeignet. Viele schlechte Bücher wurden beim Durchsehen der Manuskripte oder Korrekturfahnen aussortiert. (…) Es wurde auch eine beträchtliche Zahl von Zeitungs- und Journalartikeln kassiert.
Trotz solcher Präventivmaßnahmen blieb die Literatur unberechenbar. Weder mehrfache Zensur in Aktionseinheit mit der panischen Wachsamkeit der Redakteure noch die Vorsicht der verängstigten Autoren gewährte die Garantie, vor Überraschungen sicher zu sein. Am Ende des Krieges kam noch ein weiteres Phänomen hinzu: Das berechtigte Siegesgefühl der Sowjetmenschen drohte in ein neues ziviles Bewußtsein hinüberzuwachsen. Wer einmal in irgendeiner Form daran teilgehabt hatte, als über dem großdeutschen Reichstag die rote Fahne gehißt wurde, war nicht mehr wie früher gewillt, idiotische Instruktionen von ungebildeten Bürokraten ohne weiteres zu befolgen. Bei vielen Staatsbürgern entstand die Fiktion, man habe gewisse Rechte erworben. Der Kampf gegen Nazideutschland galt aus dieser Sicht als ein Verdienst vor dem Staat, das dieser gefälligst mit Gegenleistungen zu honorieren hatte.
Dies war selbstverständlich keine volksweite Bewegung, sondern nur ein Stimmungsumschwung. Dennoch bereiteten unerwartet freizügige Äußerungen den Funktionären viel Kopfzerbrechen. So berichtete der entrüstete Jegolin im August 1945 dem ZK-Sektretär Malenkow, der Stückeschreiber Wsewolod Wischnewskij, ansonsten Inbegriff der Parteitreue, habe auf einem Plenum des Schriftstellerverbands ausgerufen:
Wir haben gekämpft, wir haben gerungen – gebt uns die Freiheit des Wortes!
Gegen die Gefahr, die in solchen Forderungen steckte, konnte die alltägliche bürokratische Drohgebärde wenig ausrichten. Es galt vielmehr, Exempel zu statuieren, abschreckende Maßnahmen zu ergreifen, alte Tabus zu bekräftigen, neue Tabus zu etablieren. Als einzig geeignetes Mittel kam vorläufig die zentral gelenkte Hetzkampagne in Frage.
Es war der zweite Nachkriegssommer, friedliche Gurkensaison. Die Behörden hatten die inländischen Reisebeschränkungen der Kriegszeit nach und nach gelockert, und vor den Fahrkartenschaltern der Bahnhöfe standen lange Schlangen.
Anna Achmatowa war in Leningrad geblieben und war dort in jenen Tagen allein. Sie hatte viel zu tun. Zwei Gedichtbände gleichzeitig sollten binnen kurzem erscheinen: Ein umfangreiches Buch im Leningrader Staatsverlag mit zehntausend Exemplaren und ein dünnes Heft in der Schriftenreihe des Journals Ogonjok mit der märchenhaften Auflage von hunderttausend Exemplaren. Selbstverständlich war die Lizenz für die Herausgabe der beiden Bücher bereits zurückgezogen worden, als Achmatowa begann, ihre Gedichte für die Edition durchzusehen.Auf die nächste Auswahl mußte sie zwölf Jahre lang warten.
Am Tag der Veröffentlichung des ZK-Beschlusses ging Anna Achmatowa ins Haus des Literaturfonds – der Institution, die für die Sozialversicherung der Autoren zuständig war –, um dort etwas zu erledigen. Eine der Anwesenden, Silwa Gitowitsch, in späteren Zeiten eine Vertraute der Dichterin, erinnert sich, daß die Mitarbeiter dieser Institution die Geistesgegenwart Achmatowas bewunderten. Besonders beeindruckt waren sie von ihrer ruhigen, würdevollen Art. Immerhin war sie an diesem Tag in jeder zentralen Zeitung des Riesenreiches wüsten Beschimpfungen ausgesetzt. Einige Jahre später erläuterte Achmatowa der Freundin Silwa Gitowitsch ihre Haltung:
Ach, mein Gott! Ich wußte doch von nichts. Die Morgenzeitungen hatte ich nicht gelesen, Radio gehört hatte ich auch nicht, und offensichtlich traute sich niemand, bei mir anzurufen. So habe ich mit ihnen völlig unbedarft gesprochen.
Unterwegs nach Hause, auf dem Newskij-Prospekt, traf Anna Achmatowa plötzlich Michail Soschtschenko. In Anbetracht der sichtlich trüben Stimmung des Prosaikers glaubte sie, er habe wieder mal Krach mit seiner Frau gehabt. „Dulden und ausharren!“ mahnte sie ihren Schicksalsgefährten, ohne zu wissen, wie sehr dieser christliche Rat für sie selbst aktuell war. Dann kaufte sie etwas zum Mittagessen ein und setzte ihren Weg in das Fontannij Dom fort. Erst als sie zu Hause den in Zeitungspapier gewickelten sauren Hering auspackte, erblickte sie in der Zeitung ihren Namen.
Irina Punina reiste mit ihrer kleinen Tochter Anja und der Cousine Marina am 15. August nach Lettland, um eine Verwandte zu besuchen. Zwei Tage lang hatten sie Schlange gestanden, um die Bahnkarten kaufen zu können. In Riga angekommen, sagte plötzlich das sechsjährige Mädchen:
Im Radio sagt man dauernd Achmatowa und Soschtschenko.
Daraufhin kaufte die Verwandte eine Zeitung und zeigte ihnen:
Hier ist eure Achmatowa.
Um die Fahrkarten nach Leningrad schwarz beschaffen zu können, mußte Punina fast alle ihre Kleidungsstücke verkaufen. Trotzdem kam sie erst Ende August zusammen mit ihrer Tochter in der Stadt an.
Akuma lag im großen Zimmer, sie traf sich mit niemandem und sprach mit niemandem.
Ebenso ahnungslos war die Moskauer Schauspielerin Nina Ardowa, bei welcher Achmatowa meistens wohnte, wenn sie in Moskau war. „Ich war mit den Kindern auf Urlaub in Koktebel“, erzählte sie später in einem Interview.
Ich schickte Wiktor (ihrem Ehemann, G. D.) einen Brief und ein Telegramm nach dem anderen. Ich fragte, wie es Anna Andrejewna gehe, ob sie schon in Moskau angekommen sei oder ob sie erst losfahren wolle. Plötzlich schickt sie mir ein Telegramm: „Lies Zeitungen, Dummkopf!“ So las ich den Beschluß. (…) Ich begann schnell mit den Vorbereitungen zur Rückreise. Es war schwer, mit den Kindern zusammen die Fahrkarten zu organisieren. (…) Bin angekommen und bereitete gleich die Weiterreise nach Leningrad vor. (…) Es dauerte einige Tage, bis ich abreisen konnte. Ich verbrachte drei Tage bei Anna Andrejewna und nahm sie dann mit zu uns nach Moskau.
Irina Punina erinnert sich, daß Achmatowa und Ardowa als erstes beinahe reflexhaft begannen, Papiere zu verbrennen. Neben Briefen und Manuskripten handelte es sich dabei wahrscheinlich um Anna Achmatowas berühmte Zettel, auf denen sie alles aufschrieb, was sie nicht laut aussprechen wollte. Einige Jahre später sollten die Ermittler der Lubjanka den Sohn Lew extra wegen jener Handvoll Asche quälen, zu der ein Teil der Gespräche seiner Mutter mit ihren engsten Vertrauten geworden war. Die Papierverbrennung zeugt davon, daß Achmatowa eine Hausdurchsuchung erwartete; doch auch eine Verhaftung wäre nicht auszuschließen gewesen.
In der Tat wunderten sich zahlreiche Zeitgenossen, daß nach dem ZK-Beschluß vom 14. August, der Schdanowrede vom 16. August, dem Ausschluß aus dem Schriftstellerverband und dem Literaturfonds am 4. September keine Verhaftung erfolgt war. Diese relativ kulante Verfahrensweise hing einerseits eng mit dem Zeitpunkt des Augustbeschlusses zusammen: Im zweiten Nachkriegsjahr befand sich die Sowjetunion immer noch im Zenit ihres internationalen Ansehens. Für viele meinungsbildende intellektuell-westliche Kreise galt sie – nicht ganz zu Unrecht – als die eigentliche Siegerin über Hitlerdeutschland und damit – völlig zu Unrecht – als ein grundsätzlich humanes Staatswesen.
Die Beteiligung am Nürnberger Prozeß gegen die Hauptkriegsverbrecher, die – allerdings nur kurzzeitige – Abschaffung der Todesstrafe, die relative Toleranz gegenüber der russisch-orthodoxen Kirche und nicht zuletzt die Existenz des Jüdisch-Antifaschistischen Komitees ließen den sowjetischen Staat in einem bis dahin unbekannten Maße salonfähig erscheinen. Die Außenpolitiker des Kreml waren nun damit beschäftigt, dieses günstige Image weiterhin zu pflegen. Dies änderte nichts daran, daß Zigtausende von ehemaligen Kriegsgefangenen, displaced persons und von den Westalliierten ausgelieferte Kosaken weiterhin wahllos in sibirische Lager geschickt wurden. Aber es wäre ein Schlag gegen die intellektuellen Verbündeten und Mitläufer des Kommunismus im Westen gewesen, jetzt Schriftsteller zu bestrafen – und dann noch ausgerechnet für etwas Geschriebenes.
Andererseits verfolgte die Partei im Falle Soschtschenko-Achmatowa ein begrenztes und klar umrissenes Ziel: Alle Literaten sollten von jeder Art der Ketzerei abgeschreckt werden. Gleichzeitig sollte ihnen deutlich vor Augen geführt werden, daß sie und ihre Privilegien nicht angetastet würden, solange sie sich an die Normen der offiziellen Kunstauffassung hielten. Dazu brauchte man als Memento einen lebendigen Soschtschenko und eine lebendige Achmatowa: Der Galgen wurde durch den Pranger ersetze.
Statt Anna Achmatowa zu verhaften, wurden „die Instrumente gezeigt“. Für den Monat September 1946 versagte ihr der Schriftstellerverband die Lebensmittelkarten. Dies sollte demonstrieren, daß Achmatowa aus ihrer relativ privilegierten Situation als Schriftstellerin plötzlich ins soziale Nichts fallen konnte. Autoren erhielten normalerweise ein sogenanntes „Arbeitslimit“ in Höhe von fünfhundert Rubeln, außerdem zweihundert Rubel für Taxifahrten. Jetzt war Achmatowa auf die Hilfe ihres ehemaligen Gatten Nikolaj Punin angewiesen, der jedoch als Kunsthistoriker nur über das „Wissenschaftlerlimit“ verfügte, also über Lebensmittelkarten im Wert von dreihundert Rubel. Außerdem hatte Achmatowa nach dem 4. September als „gewesene Schriftstellerin“ kein Recht mehr auf ein Einzelzimmer. Zum Glück konnte Lew Gumiljow als Frontsoldat ein Zimmer für sich beanspruchen. Der unmittelbare Druck ließ erst Ende September nach, als Achmatowa einen Anruf vom Schriftstellerverband erhielt, sie möge ihre Lebensmittelkarten abholen. Im Oktober wurde sie mit Fadejews Unterstützung wieder in den Literaturfonds aufgenommen.
Die sowjetische Geheimpolizei beobachtete Achmatowas Reaktionen auf diese Maßnahmen sehr genau. Ein zusammenfassender Bericht enthielt die Schlußfolgerung, moralisch sei die Dichterin ungebrochen:
Das Objekt Achmatowa hat den Beschluß schwergenommen. Sie war lange krank: nervliche Erschöpfung, Herzrhythmusstörungen, Furunkulose. Äußerlich hielt sie sich jedoch munter. Sie erzählte, daß ihr unbekannte Menschen Blumen und Obst geschickt hätten, daß man sich nicht von ihr abgewandt habe, daß man sie nicht verraten habe. „Mein Ruhm ist nur größer geworden“, sagte sie.
Der Ruhm einer Märtyrerin. Allgemeines Mitleid. Bedauern. Sympathien. Ich werde nun sogar von Leuten gelesen, die früher nicht einmal meinen Namen kannten. Offensichtlich wendet man sich eher vom Wohlleben als vom Elend ab.
Vor allem ließ sie sich in dieser akuten Phase der Ächtung nicht von der offiziellen Schimpfkanonade beeindrucken. Über Soschtschenko, der sich angeblich das Leben nehmen wollte, soll sie der geheimpolizeilichen Quelle zufolge gesagt haben:
Arme Leute, sie wissen gar nicht, daß all das schon einmal dagewesen ist, beginnend mit dem Jahr 1924 (tatsächlich 1925, als Achmatowa von der Autorin Marietta Schaginjan zum ersten Mal von einem angeblichen Publikationsverbot für ihre Werke hörte, G. D.). Für Soschtschenko war das wirklich ein schwerer Schlag, aber für mich war es nur eine Wiederholung von irgendwann bereits gehörten Verdammungsurteilen und Moralpredigten.
In der Tat hatte der Parteibonze Schdanow starke Konkurrenz, was die öffentliche Beschimpfung und Verunglimpfung Achmatowas betraf. Der Kritiker Wiktor Perzow hatte die Dichterin bereits 192 5 „eine Frau, die entweder zu spät geboren ist oder nicht rechtzeitig sterben konnte“, genannt. In Lilja Briks staatssicherheitlich geduldetem Literatursalon sprach man von ihr als „innerer Emigrantin“ zu einer Zeit, als das Wort „Emigrant“ wie „Landesverräter“ klang. Trotzdem halte ich es für wahrscheinlich, daß Achmatowa die Auswirkungen des August 1946 auf ihre seelische Verfassung gezielt bagatellisierte, um ihren geheimen Gegnern keinen Gefallen zu tun. Realistischer als ihre eigenen Äußerungen ist wohl Nadeschda Mandelstams Einschätzung:
Achmatowas Gedächtnis registrierte das jahrzehntelange Anathema, und sie empfing den Beschluß, wie es sich gehörte, das heißt ohne Emotionen und mit der natürlichen Angst vor den Konsequenzen. Sie fürchtete für ihre Angehörigen und auch für sich selbst – man kann das Zittern nicht loswerden, wenn aus allen Richtungen eine dumpfe todbringende Kraft näherrückt, um einen aus dem Bett zu holen und in das Nichtsein zu zerren.
Anna Achmatowa hat einmal geäußert, die Menge der Pamphlete, die nach dem Spätsommer des Jahres 1946 gegen sie veröffentlicht wurden, könne man nur mit einer vierstelligen Zahl ausdrücken. Doch das Ausmaß des Unrats, den man über dem Haupt dieser alternden, kranken und leidgeprüften Frau ausschüttete aufgrund von Publikationen in zwei Literaturjournalen von regionaler Bedeutung, können wir nur mit Hilfe der altbewährten quantitativen Sichtweise wirklich erfassen. Im Jahre 1946, so prahlt die Große Sowjetenzyklopädie, erschienen in der Sowjetunion 26 überregionale Zeitungen mit insgesamt 6,89 Millionen täglichen Exemplaren und 123 regionale Tageszeitungen mit 3,8 Millionen täglichen Exemplaren. So müssen wir am Tag der Veröffentlichung von Schdanows Rede mit mindestens zehn Millionen Lesern rechnen.
Zusätzlich wurde der Beschluß selbst von allen zentralen Zeitschriften gedruckt, einige davon mit millionenstarken Auflagen – so zum Beispiel das Magazin Ogonjok, die für die Frauen bestimmte Rabotnica und die Jugendzeitschrift Smena, Schdanows Rede erschien gleichzeitig auch als Broschüre in mindestens einer Million Exemplaren. Doch auch die Lesemuffel wurden bedient: Mehr als hundert Großstationen des sowjetischen Rundfunks sendeten die beiden Dokumente, täglich 25 bis 30 Millionen Sowjetbürger saßen vor ihren Geräten oder standen vor den berühmten Lautsprecheranlagen. Auch nachdem die Kampagne abgeblasen worden war, um Raum für neue Themen zu schaffen, feierte man regelmäßig den Jahrestag des Beschlusses, der in allen Mittelschulen und geisteswissenschaftlichen Fakultäten zum Pflichtstoff gehörte. Die beiden Unworte „Nonne“ und „Dirne“ wurden mit den Mitteln einer großindustriellen Ideologieschmiede in das Bewußtsein der Bevölkerung eingehämmert.
Gegenüber dieser grandiosen Propagandakampagne verfügte die Dichterin über keinerlei Möglichkeiten der Selbstverteidigung. Sie mußte wortlos zuhören, als man von ihr behauptete, sie habe nach der Oktoberrevolution zwanzig Jahre lang geschwiegen – obwohl sie in Wirklichkeit zum Schweigen gebracht worden war. Man warf ihr vor, im „Poem ohne Held“ die eigene innere Leere hinter einem ausgeklügelten Codesystem verborgen zu haben, doch wurde ihr zu Lebzeiten niemals das Recht eingeräumt, das „Poem“ im Volltext zu publizieren.
In die öffentliche Besudelung wurden nicht nur Literaten und Funktionäre einbezogen, sondern auch sogenannte „einfache Werktätige“, die Achmatowas Dichtung offensichtlich nur aus Schdanow-Zitaten kannten – etwa der Genosse Kuschner, Planingenieur des Betriebs Nr. 451:
Zu den Gedichten von Achmatowa kann ich eines sagen: Diese ihrer Vernunft beraubte ,Herrin‘ ist ein Stück der alten, sich in Auflösung befindenden Intelligenz, sie sieht überhaupt nicht das jetzige Leben und sehnt sich nur in ihrem Nichtstun nach ihrer Vergangenheit zurück, während sie andere Leute beim Arbeiten stört. Der Beschluß des ZK der Partei und das Referat des Gen. Schdanow haben diese Schädlinge und abgeschmackten Literaten rechtzeitig entlarvt.
Es gab auch noch die feinere Art der Lüge, vorgesehen für den liberalen Westen. Der ungarische Journalist Ivan Boldizsár hielt sich im Frühjahr 1947 in Moskau auf und berichtete in seinem Buch mit eindeutiger Sympathie für die Gastgeber über eine Pressekonferenz im Club der Schriftsteller:
(Edward) Crankshaw, Korrespondent der News Chronicle, fragt (den Literaten und Kulturfunktionär, G. D.) Boris Gorbatow: „Also, bei Ihnen darf man nur aus patriotischem Pflichtgefühl heraus schreiben? Über den Krieg, über die Produktion, über das Heldentum?“
Jetzt mischt sich Gorbatow ein, versöhnlich lächelnd: „Bei uns kann man über alles schreiben! Über die Landschaft, über den Menschen oder, wenn Sie wollen, über Hunde. Mein Freund Prischwin schreibt beispielsweise nur über Hunde, aber er liebt den Menschen. Wir haben das Gefühl, daß Madame Achmatowa, die zusammen mit Soschtschenko unseren Verband verlassen mußte, den Menschen, jenen Sowjetmenschen, der nach dem siegreichen Krieg seine Heimat wieder aufbaut, nicht liebt.“
Selbst die Stimmungsberichte der Partei, die der absoluten Geheimhaltung unterlagen, enthalten kaum etwas, was nicht in die künstlich genährte Lynchatmosphäre gepaßt hätte. Und doch gab es tröstliche Ausnahmen. Die eine war der Prosaiker Paustowskij, der den Auftrag erhielt, für die Prawda einen Aufsatz über den Beschluß zu schreiben. Seine ebenso witzige wie waghalsige Ablehnung lautete:
Zur Zeit studiere ich die Geschichte der Partei, und ich werde sie noch lange studieren.
Eine Studentin der Naturwissenschaftlichen Fakultät der Moskauer Universität, eine gewisse Baschenowa, Mitglied des Komsomol, sagte in einer Gruppe von Studenten, die von der Rede des Genossen Schdanow angeblich begeistert waren:
Auf mich hat das Referat keinen Eindruck gemacht. Ich habe die Gedichte der Achmatowa geliebt und werde sie weiterhin lieben. Ihr aber habt euch zu schnell umgestellt, denn es ist nicht sehr lange her, daß auch ihr von ihren Gedichten entzückt wart.
Anna Achmatowa, so berichtet die bereits zitierte anonyme Quelle „D. D.“, verhielt sich stoisch:
Es ist bekannt, daß die Frauen die Leningrader Blockade verhältnismäßig leichter als die Männer ausgehalten haben. Die erste Blockade erduldete Achmatowa in Taschkent, die zweite – persönliche – hier.
Zu ihrem Glück war die offiziell organisierte Blockade nicht lückenlos. Außer ihrem direkten Umfeld – der Familie Punin und ihrem Sohn – hatte sie Freundinnen, Freunde und Bewunderer um sich. Emma Gerstejn befand sich immer in erreichbarer Nähe, Nina Ardowa stellte ihr Moskauer Haus jederzeit zur Verfügung, alte Verehrer wie Lew Gornung, der hunderte Fotos von ihr machte, und auch die Dichterinnen Olga Berggolz und Margarita Aliger ließen sich nicht von der Stigmatisierung beeindrucken. Und sie hatte einen besonders treuen Freund, den Dichter Puschkin, über dessen „Steinernen Gast“ sie unmittelbar nach dem Augustbeschluß zu schreiben begann. Aleksandr Sergejewitsch hatte ihr bereits in den zwanziger und dreißiger Jahren geholfen, ihre schweren Depressionen zu überwinden.
Im Sommer 1948 erhielt sie auf Boris Pasternaks Intervention hin dreitausend Rubel Krankengeld aus dem Literaturfonds. Das Geld kam rechtzeitig, denn im November lag die Dichterin mit einer schweren Lungenentzündung darnieder. Nach ihrer Genesung begann sie mit der Übersetzung der französischen Briefe des russischen Aufklärers Radistschew ins Russische – seit vielen Jahren die erste literarische Auftragsarbeit. Das Buch erschien zunächst ohne ihren Namen, erbrachte jedoch eine kleine Aufbesserung der spärlichen Rente, die nur siebenhundert Rubel betrug. Den sechzigsten Geburtstag am 23. Juni 1949 feierte Anna Achmatowa im engsten Kreis. Sie war müde, krank und traurig, aber der Würgegriff, in dem sie ihr Leben verbrachte, schien sich nun ein wenig gelockert zu haben.
Am 26. August 1949 wurde Nikolaj Punin verhaftet. Am 6. November holte man Lew Gumiljow ab, als er in der Mittagspause vorn Museum für Völkerkunde gerade nach Hause kam, um etwas Warmes zu essen. Die Hausdurchsuchung wurde schnell durchgeführt. Irina Punina erinnert sich:
Akuma lag in Ohnmacht. Ich half Ljowa, seine Sachen zu packen und zog seinen Pelzmantel hervor. Er verabschiedete sich von der Mutter und kam dann in die Küche, um sich von mir zu verabschieden. Man führte ihn ab. Beim Weggehen sagte der ranghöchste Mitarbeiter zu mir: „Bitte kümmern Sie sich um Anna Andrejewna, passen Sie auf sie auf!“ Ich war von dieser Fürsorge verblüfft. Dann schlug man die Wohnungstür zu.
Isaiah Berlin erfuhr von alledem recht wenig. Nach der Rückkehr aus Rußland brach er seine kurze diplomatische Laufbahn ab und verstand sich wieder ausschließlich als Wissenschaftler. Aus Moskau und Leningrad drangen nur spärliche Nachrichten bis zu ihm durch, und kein Ausländer traute sich in das Fontannij Dom.
Bei unserem Gespräch in London sagte Sir Isaiah, daß er sich wegen Achmatowas Schicksal schwere Vorwürfe gemacht und jahrelang jeden Kontakt mit der Sowjetunion bewußt gemieden habe. Einige an ihn adressierte Briefe aus dieser Zeit bestätigen indirekt diese Schuldgefühle. So schrieb ihm ein Bekannter, vermutlich ein Diplomat – ohne Datum, doch muß es unmittelbar nach dem Augustbeschluß gewesen sein:
Wegen der Nachricht, daß Achmatowa in Ungnade gefallen ist, befinden Sie sich sicherlich in einem Zustand der Aufregung. Was ich am meisten befürchte: Sie beschuldigen sich selbst, daß Sie in einer unklaren Weise dazu beigetragen hätten. Ich bin jedoch sicher, daß Sie sich irren. Eine Maßregelung war bereits zu erwarten, und ich glaube nicht, daß persönliche Erwägungen dabei eine Rolle spielten – höchstens, was aber selten vorkommt, als begünstigende Faktoren. Manchmal haben selbst die Leute im Kreml ihre Schwächen.
Brenda Tripp vorn Moskauer Büro des British Council versuchte Berlin beruhigende Nachrichten zu übermitteln: „Achmatowa geht es gut“, schreibt sie am 12. Februar 1947, „sie lebt glücklich und ruhig in ihrer Wohnung und hat eine staatliche Rente von monatlich sechshundert Rubel.“ Auch Brenda Tripp sagt Isaiah Berlin, er solle sich wegen der schwierigen Situation der Frau Achmatowa nicht schuldig fühlen.
Mit Boris Pasternak Kontakt aufzunehmen, war vermutlich Anna Kai in gelungen. Die Informationen von seiner Seite waren lückenhaft und ungenau:
19. Februar 1947. Anna Achmatowa ist es erlaubt, in ihrer Wohnung zu bleiben, aber ihre Lebensmittelkarten wurden eingezogen, und auch die übrigen materiellen Bedingungen sind hart.
In Wahrheit war es genau umgekehrt: Die Lebensmittelkarten erhielt sie zurück, aber die Wohnung wollte man ihr wegnehmen.
Ansonsten ist mit ihr alles in Ordnung, so weit B. L. weiß. Die ,Bukinisty‘ haben die Genehmigung, ihre Bücher zu verkaufen.
Gemeint sind damit wahrscheinlich frühere Achmatowa-Ausgaben.
Doch wer sind die „Bukinisty?“ Die Quelle dieser Information konnte nur ein „Bukinist“ sein, und zwar Gennadij Mojsejewitsch Rachlin, „der kleine rothaarige Jude“, von dessen Autorenbuchhandlung Isaiah Berlins Weg seinerzeit zum Fontannij Dom geführt hatte.
Bereits ihr „Poem ohne Held“ hatte Anna Achmatowa „mit sympathischer Tinte“ geschrieben, mit einem komplizierten Codesystem aus Allusionen, Widmungen und Halbzitaten ausgestattet, um seinen Inhalt über die düsteren Zeiten zu retten. Für die Aufbewahrung ihres Schlüsselerlebnisses und der damit verbundenen Mystifizierung verblieb ihr nur eine einzige Möglichkeit: das Schweigen. Selbst Äußerungen gegenüber ihren engsten Vertrauten waren rar.
„Der geheimnisvolle ,Gast aus der Zukunft‘ zieht es vor, ungenannt zu bleiben“, erklärt sie 1961 in ihrer „Prosa über das Poem“. Wollte jemand den Versuch unternehmen, auf einer Computerdiskette mit sämtlichen Achmatowa-Texten den Namen Sir Isaiah Berlin zu finden, dann würde er sehr wahrscheinlich immer dieselbe Antwort erhalten: „Suchbegriff nicht gefunden“. Der geliebte Mann wird namentlich nicht erwähnt.
Doch dürfte seit der schicksalhaften Begegnung kaum ein Tag vergangen sein, an dem Anna Achmatowa nicht an Isaiah Berlin gedacht hätte. Der russische Jude aus Riga, Professor in Oxford, wurde ausgerechnet durch die von ihm unbeabsichtigt verursachte Katastrophe zum sinngebenden Element der großen Dichterin. Anna Achmatowa mit ihrer außergewöhnlichen Empfindlichkeit für Symbole und kosmische Zusammenhänge verlegte die Begegnungen mit ihm in die Sphäre des Spirituellen.
Im Oktober 1946 besuchte die Dichterin Margarita Aliger Achmatowa im Fontannij Dom und fand sie in einem Zustand tiefster Lethargie. Sie verließ kaum noch die Wohnung und hatte keine Lust auf Kontakte mit der Außenwelt. Jetzt aber geschah etwas, womit die Besucherin nicht gerechnet hatte:
Plötzlich sagte Anna Andrejewna, daß sie mit mir ein wenig ausgehen wolle. Es hatte an diesem Tag nicht geregnet, aber unter den Füßen quatschte die in Leningrad übliche Feuchtigkeit des Herbstes. Wir bogen von der Fontanka auf den Newskij-Prospekt ab und standen vor der Autorenbuchhandlung. Mich veranlaßte irgendetwas, vor dem Schaufenster stehenzubleiben. Anna Andrejewna schlug vor, hineinzugehen, und ich war mit Freuden einverstanden. Kaum waren wir eingetreten, stellte uns die Garderobenfrau und forderte uns auf, die Überschuhe auszuziehen. Dies bezog sich nur auf Anna Andrejewna, ich hatte nämlich Gummischuhe an, sie aber schwere Stiefel, und sie sagte, sie seien schwer auszusziehen, so daß es besser wäre, überhaupt nicht hineinzugehen. Ich hätte jemanden holen lassen müssen, um eine Ausnahme zu bewirken, aber ich war irritiert. Hätte ich es getan, so wäre Anna Andrejewna damit vielleicht nicht einverstanden gewesen. So gingen wir im Menschenstrom auf dem Newskij weiter.
An der Oberfläche geschah etwas Banales und Skandalöses zugleich: Rußlands größte Autorin durfte die Autorenbuchhandlung ihrer Stadt nicht betreten. Sicherlich war Anna Achmatowa davon nicht sehr beeindruckt, ist doch gegen die Machtgelüste von Hausmeistern und Garderobenfrauen kaum ein Kraut gewachsen. Doch an diesem Tag war Anna Achmatowa etwas Wichtiges gelungen: Zum ersten Mal seit ihrer öffentlichen Ächtung verließ sie das Haus aus eigenem Antrieb. Zur Autorenbuchhandlung nahm sie denselben Weg, den Isaiah Berlin Ende November 1945 gegangen war – nur in umgekehrter Richtung. Dieser Weg mußte sie an die Begegnung erinnern, die ihr gerade wegen ihrer „Verderben bringenden“ Folgen als von einem höheren Sinn erfüllt vorkam. Und weil sie auf ihrem Rückweg „links von der Brücke“ abbog, war sie gezwungen, an diesem Tag dem „Gast aus der Zukunft“ in die Augen zu schauen. Wahrscheinlich war es kein Zufall, daß sie an diesem kritischen Punkt ihres Lebens alle schöpferischen Kräfte einem Aufsatz widmete, über dessen Thema sie bereits mit Berlin gesprochen hatte: Er beschäftigte sich mit dem Puschkin-Stück Der steinerne Gast.
Die Dichterin Achmatowa teilte ihre Gedichte auf in solche, von denen sie wußte, wie sie entstanden waren und solche, von denen sie es nicht wußte. Doch gab es noch eine weitere Kategorie: Gedichte, die sie am liebsten nicht geschrieben hätte. Insgesamt sechs waren es, und sie gehörten dem Zyklus „Ruhm dem Frieden“ an. Sie erschienen als Erstveröffentlichung 1949 und 1950 in der Wochenschrift Ogonjok. Eines dieser Gedichte trug den Titel „21. Dezember 1949“ – das war Stalins 70. Geburtstag.
Selbstverständlich war dieser erbärmliche Zyklus durch Lew Gumiljows Verhaftung erzwungen worden. Achmatowa verstand ihn als „Gnadengesuch auf den höchsten Namen“, wie man früher Petitionen nannte, die direkt an den Zaren gerichtet waren. Wieder war sie in einer ähnlichen Situation wie bereits in den dreißiger Jahren, als sie nach Lew Gumiljows erster Lagerhaft in ihrem „Requiem“ schrieb:
Seit siebzehn Monden schreie ich,
„Kehr’ heim!“ ruf ich dir zu.
Zu Henkers Füßen warf ich mich,
Mein Sohn, mein Schrecken, Du…
Anna Achmatowa wurde ein Leben lang von der Vorstellung gequält, ihre poetische Integrität, wenn auch nur für einen historischen Moment, aufgegeben zu haben. Ihr ausdrücklicher Wille war, daß der Zyklus „Ruhm dem Frieden“ niemals in eine zensurfreie Ausgabe ihrer Gedichte aufgenommen werden möge – ein Wunsch, der bis heute unerfüllt geblieben ist. Aus Gründen des Respekts werde ich keine Zeile aus diesem Zyklus zitieren. Hier handelt es sich nicht um Dichtung, sondern um eine, wie Jurij Tynjanow gesagt hätte, „literarische Tatsache“.
Auch verzichte ich auf direkte Zitate aus jenem Archivdokument, das von der tiefen Verzweiflung der Dichterin im Spätherbst 1949 zeugt. Nach Punins Verhaftung meinte sie, Schlimmeres verhindern zu können, als sie in einem Brief an Ilja Ehrenburg die Absicht äußerte, sich öffentlich von ihren westlichen Anhängern distanzieren zu wollen. Ehrenburg sandte den Brief an Fadejew, den Vorsitzenden des Schriftstellerverbands, der wiederum das Politbüromitglied Suslow von Achmatowas Wunsch unterrichtete. Zur Information legte Fadejew einige Gedichte aus dem Ogonjok bei. Allerdings unterstützte er das Anliegen der Dichterin nicht, da die westliche Empörungswelle wegen des Schdanow-Beschlusses bereits mehr als zwei Jahre zurücklag, und so konnte ein öffentlicher Kotau Achmatowas „uns keinen großen Nutzen bringen“. Über die beigelegten Gedichte schrieb er im wohlwollend-herablassendem Ton:
Die Gedichte sind schlecht, abstrakt, aber gleichzeitig zeugen sie doch von einiger Bewegung in ihrer ,Denkweise‘.
Mit diesen verächtlichen Gänsefüßchen war für Fadejew die Angelegenheit erledigt. Im Januar 1951 wurde Anna Achmatowa wieder in den sowjetischen Schriftstellerverband aufgenommen. Einige Monate später erlitt sie in Moskau ihren ersten Herzinfarkt.
Lew Gumiljow wurde zu zehn Jahren Lagerhaft verurteilt und verbrachte seine Haftzeit zunächst in Karaganda, später in der Nähe der sibirischen Stadt Omsk. Weder Gedichte noch Eingaben seiner Mutter hatten ihm helfen können.
Die letzte große Terrorwelle der Stalinzeit wütete fast wahllos. Im Verlauf der Kampagne 1948 gegen die „heimatlosen Kosmopoliten“, worunter die jüdischen Intellektuellen zu verstehen waren wurde unter anderem der Buchhändler Rachlin verhaftet. Ihm wurden klandestine Kontakte zu Golda Meir vorgeworfen, der ersten Botschafterin des Staates Israel, anläßlich eines Besuchs derselben in Leningrad. Selbst jene lokalen Parteiführer, die sich seinerzeit um die Exkommunikation Achmatowas und Soschtschenkos verdiene gemacht hatten, fielen der Säuberung zum Opfer. Die sogenannte „Leningrader Sache“ kostete viele von ihnen das Leben.
Doch damals geschah noch etwas Furchtbares, das in vollem Umfang erst 1994 durch die Forschungen des Historikers Gennadij Kostyrtschenko über die „antizionistische Kampagne“ ans Tageslicht gekommen ist. Im Sommer 1950 verhaftete die sowjetische Geheimpolizei mehrere Ärzte der Moskauer Klinik für Diätologie, unter ihnen den Direktor Dr. Pewsner. Pewsner war verwandt mit Mendel Berlin, dem Vater von Isaiah Berlin. Zu Beginn der dreißiger Jahre hatten sich beide in Karlsbad getroffen, wo der Moskauer Arzt dienstlich zu tun hatte. Ihre private Begegnung wurde nun in den entzündeten Hirnen der KGB-Schergen zum Teil einer weitverzweigten Verschwörung. Pewsner sollte sich angeblich dem von Mendel Berlin vertretenen britischen Geheimdienst zur Verfügung gestellt haben. Doktor Pewsners Geständnisse, unter der Folter erzwungen, belasteten Mendels Bruder, Dr. Lew Berlin, der in derselben Moskauer Klinik arbeitete.
Von Sir Isaiah Berlin weiß ich, daß sein Vater, der Geschäftsmann Mendel Berlin, im Jahre 1935 zum ersten Mal nach der Oktoberrevolution die Grenze seines Geburtslandes überquerte. Sein Aufenthalt in Moskau, unter anderem die Besuche bei seinem Bruder, wurde von den Organen präzise registriert. Zehn Jahre später versuchte der damalige sowjetische Außenminister Molotow, die Akkreditierung von Isaiah Berlin zu verweigern mit der Begründung:
Wir wollen keine Ehemaligen.
Damit meinte er ehemalige Bürger des zaristischen Rußlands. Dieser Verhinderungsversuch wurde von Molotows Beratern mit dem Argument, der zu erwartende ausländische Diplomat sei während der Oktoberrevolution noch ein Kind gewesen, erfolgreich abgewehrt. Dennoch mußte Berlin, der bereits im Juni nach Moskau reisen wollte, mit seiner offiziellen Anerkennung als Botschaftsangehöriger bis zum 8. September warten. Wir können sicher sein, daß der KGB den neuen Sekretär der Britischen Botschaft vom ersten bis zum letzten Augenblick seines Aufenthalts besonderer Aufmerksamkeit gewürdigt hat. Es ist auszuschließen, daß ein Treffen des Neffen mit seinem Onkel unbeobachtet geblieben wäre.
Dr. Lew Berlin wurde im Januar 1952 verhaftet und wegen Spionage zu fünfundzwanzig Jahren Lagerhaft verurteilt. Später, als bereits die „Theorie“ dominierte, die jüdischen Ärzte wollten im Auftrag der imperialistischen Geheimdienste die sowjetischen Führer, unter ihnen Stalin, „zu Tode behandeln“, brachte man den Gefangenen aus dem sibirischen Taischet nach Moskau und folterte ihn vier Tage lang, damit er zugab, Mittelsmann zwischen den jüdischen „Verschwörern“ und dem britischen Spion Isaiah Berlin zu sein. Allerdings verfügte Lew Berlin für den Todestag des Diktators über ein perfektes Alibi – er war nämlich erst im Frühjahr 1954 aus der Lagerhaft entlassen worden.
Für den Oxforder Professor sollten diese Ereignisse, von denen er spätestens während seines zweiten Rußlandbesuchs erfahren haben mußte, nur die Annahme bestätigen, daß jede seiner Kontaktaufnahmen in der Sowjetunion katastrophale Folgen nach sich ziehen konnte – nicht gerade ein beruhigender Gedanke für den Bürger eines klassischen Rechtsstaates. Dem Sowjetregime war es hier in seiner kriminellen Rolle als Geiselnehmer gelungen, die Grenzen der Unfreiheit bis nach Oxford hin auszudehnen.
(…)
György Dalos, aus György Dalos: Der Gast aus der Zukunft. Anna Achmatowa und Sir Isaiah Berlin. Eine Liebesgeschichte, Europäische Verlagsanstalt, 1996
Joseph Brodsky spricht über Anna Achmatowa.
Hans Magnus Enzensberger: Überlebenskünstlerin Anna Achmatowa
Hans Gellhardt: Achmatowa – Pasternak – Zwetajewa
Zum 2. Todestag der Autorin:
Jürgen P. Wallmann: Die Stimme des Leidens Russlands
Die Tat, 2.3.1968
Zum 100. Geburtstag der Autorin:
Ilma Rakusa: Kompromisslos im Leben und im Wort
Tagesanzeiger, 21.6.1989
Birgitta Ashoff: Anna von ganz Rußland
Die Zeit, 23.6.1989
Fakten und Vermutungen zur Autorin + dekoder + Kalliope
Porträtgalerie: Keystone-SDA
shi 詩 yan 言 kou 口
Anna Achmatowa Begräbnis.
Fakten und Vermutungen zur Herausgeberin + KLG + Interview +
DAS&D
Laudatio: 1, 2 & 3 + Lesung + Archiv
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Dirk Skibas Autorenporträts + Brigitte Friedrich Autorenfotos
shi 詩 yan 言 kou 口
Ilma Rakusa – Verleihung des Schweizer Buchpreises 2009.


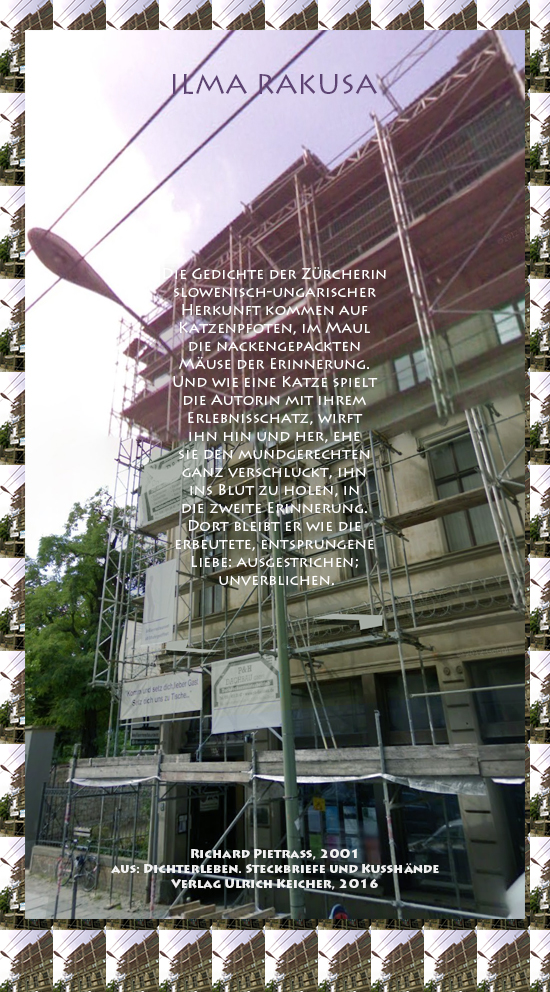












Schreibe einen Kommentar