Christian Lehnert: Der Augen Aufgang
POSTKARTEN AUS DRESDEN
(Zwinger)
Das abgegriffene Mauerwerk ist kalt
wie ein Gehirn, von Menschen abgewandt.
Wir schauen aufgeregt durch einen Spalt
auf nackte Nymphen: Haut in Fels gebannt,
ergraut im Frost, die Brauen abgeplatzt.
Die Schritte hallen wider in dem Bauer,
wie eine Nadel auf der Platte kratzt,
zurückspringt, weiterkratzt… Was hätte Dauer?
Ein schwereloser Kopf? Das Karussel
des Landes dreht sich, du steigst aus und ein
am selben Fleck – ein helles Echo, schnell
vergessen, plappern Lippen im Gestein.
Das Kronentor steht golden vor dem Nichts.
Ein Fisch starrt aus dem Eis, bis es sich löst.
Nur Atlas wehrt sich, brüchig, des Gewichts
der Kugel, die er endlos von sich stößt.
Christian Lehnerts formstrenge Gedichte
sind fragile Gebilde, die genau jene Stille erzeugen, in der sie wirken können. Nicht zufällig laufen viele der Texte, deren Themen und Sprechweisen einen weiten Bogen spannen von der Antike bis in die Gegenwart, vom Christlich-Abendländischen bis hin zu jüdisch-arabischen Kulturen, immer wieder auf Fragen aus. Der junge Dichter lauscht unserer Welt Antworten ab, mit Präzision und Sinn fürs Detail; und er scheut nicht den weiten Blick, das Pathos. Einen Sonettenkranz kann heutzutage niemand unbefangen riskieren, wenn Lehnert dies tut, zeigt das, wie sicher er sich seiner sprachlichen Mittel ist.
Suhrkamp Verlag, Klappentext, 2000
Virtuelle Frömmigkeit
Wenn der Lyriker von seinem leeren Blatt aufsieht, steht womöglich ein Engel in seinem Zimmer. Wenn auch nur „unterste Charge“, wie bei Enzensberger. Was dem Altmeister recht ist, kann den Jungen nur billig sein. Wenn nicht alles täuscht, kehren religiöse Themen in die Lyrik zurück. Ein Beispiel dafür gibt der junge Dresdener Christian Lehnert. In seinem zweiten Band Der Augen Aufgang bemüht er Novalis und Paulus als Eideshelfer. „Vielleicht beginnt ein neues Reich“, hofft der Dichter mit Novalis, und von Paulus zitiert er den wunderbaren Satz vom „Spiegel in einem dunklen Wort“.
Damit uns die Augen aufgehen, führt uns der Dichter im titelgebenden Zyklus zunächst einmal in die Wüste. Sie ist mit mancherlei topographischen Elementen versehen, aber wesentlich sprachlich halluziniert. Eine innere Landschaft, so recht geeignet für eine Suchbewegung. Das Schlußstück kommt auf Paulus zurück:
Im Lichtkreis eines Sterns, im Schatten, den meine
Sprache wirft, laufe ich über einen dunklen Spiegel.
Aber zu welchem Ende?
Aus dieser Dialektik von Licht und Sprache resultiert zwar das Sinnbedürfnis, aber nicht der Sinn selbst. Noch weniger der Glaube oder gar die religiöse Inbrunst. Die Frage bleibt dominant. Emphase ist Lehnerts Sache nicht, eher so etwas wie Neugier. Ihn interessieren die Schnittmengen von Religionswissenschaft, Orientalistik und Theologie. Es sind eben die Fächer, die Lehnert studiert hat, und gern breitet er das erworbene Wissen aus. Manche seiner Gedichte sind Skizzen eines Ethnologen, der die „Sandgefäße eines Beduinen“ ebenso würdigt wie den „Opferplatz Zibb Atuf“ oder „Drei Vitrinen im Israel-Museum“. Der kalte Blick befindet dort: Was „einst Gott war“, ist nun „Exponat“, also tot.
In „Lichteinfall“ sucht der Autor einen anderen Ansatz: aus dem Widerstand der Form metaphysische Funken zu schlagen. Er bemüht dazu die kunstvollste Form der abendländischen Lyrik, den Sonettenkranz. Anfang und Schluß von vierzehn Sonetten ergeben die Summe, das Meistersonett. Lehnert hat sich durchaus ehrenvoll aus der Affäre gezogen. Seine Verse bewegen sich gelenkig in den Scharnieren der Form. Aber da die Kunst nicht per se Sinn stiftet, fühlt das lyrische Ich sich im „virtuellen Raum“ gefangen. Und mit ihm das „neue Reich“ eines Novalis. Der lyrische Artist markiert noch einmal die Grenze der Kunst.
Ohne Zweifel hat Lehnert das Zeug zum Virtuosen. Vor einem Bild in der Dresdener Galerie Alter Meister gelingen ihm geschmeidige Verse wie:
Die blasse Venus fügt sich weich den Händen,
sanft gegenwärtig im Quadrat aus Gold.
Wie wunderschön! sagt man, und im gleichen Atemzug: Könnte das nicht von Stefan Zweig sein? Lehnert kann viel, er wird vielleicht auch lernen, was man nicht können kann.
Harald Hartung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 23.4.2001
Schwankender Boden
– Christian Lehnert, geb. 1969 in Dresden, lebt in Müglitztal bei Dresden. Zwei Gedichtbände, zuletzt: Der Augen Aufgang, Suhrkamp-Verlag, Frankfurt am Main 2000. Erhielt mehrere Förderpreise, den Dresdener Preis für Lyrik und das Hermann-Lenz-Stipendium. –
Der Umgang mit traditionellen lyrischen Formen ist bei nur wenigen jungen Autoren so überzeugend wie bei Christian Lehnert. Vor allem kann er Sonette schreiben, eher an Shakespeare als an Petrarca geschult, die das Metrum und den Charakter der Kontradiktion tatsächlich auch bedienen; oder Zweizeiler im daktylisch fallenden Rhythmus, die das Distichon nicht erreichen, da sie in alternierende Betonungen wechseln, aber erahnen lassen; oder gar Alexandriner. Wir finden eine breite Skala an Reimen, vom Kreuzreim liedhafter Quartette bis zum Binnen- oder Stabreim, oder Reimandeutungen, die einer Harmonisierung des Inhalts wieder entgegenarbeiten.
Zum Beispiel folgt einem im Grunde schwer erträglichen Reimpaar „Schlamm“ / „Schwamm“ sofort die Halbbindung „draußen“ auf „hausen“, womit es rückwirkend zerstört wird. Vielleicht ist nicht alles so gekonnt, wie es gekonnt sein will – allein das ernsthafte Bemühen um eine formale Bewältigung von Texten, die andernfalls in einer mäandernden Finsternis verloren gehen könnten, ist ebenso bestechend wie die Lösungen oft originell sind. Die Form ist hier also ganz und gar keine Liebhaberei eines Oberseminaristen der Germanistik, sondern einziges Korrektiv zügelloser Bewusstseinsverfassungen, so wild und durchbrechend wie ein reissender Fluss in der Landschaft. Und gerade dadurch, dass sie dem Gedicht auferlegt wird, erhält es die Chance, zu sich selbst zu kommen und im surrealen Gewebe aus Bildern und Worten den Gedanken zu finden.
Dabei geht es nicht um diskursive Verständlichkeit, sondern um eine Bewegung von höherer und symbolischer Ordnung, die die Welt zu einer Formel fasst und das Gedicht in den Status einer generalisierenden Metapher erhebt. Oder wie sollte man sich das „Ich“ im hier abgedruckten Gedicht körperlich vorstellen? Ist es Treibholz im Strudel des Wassers oder eine Schnake im Schilfgras, die zufällig bewusstseinsbegabt ist und spricht? Was ist eine „Aussicht, als Halde“, die „Augen zurück“ gibt, und wer verbirgt sich hinter dem Personalpronomen Plural im ersten Satz? Es hat keinen Zweck, auf diese Weise ist das Gedicht nicht lesbar. Es kann nur als eine sprachliche Figur aufgefasst werden, die konkret ist und Reales mit Imaginärem souverän verknüpft, wie bei Luis Cernuda etwa oder wie im vor allem spanischen Surrealismus überhaupt.
Christian Lehnert aber ist kein Andalusier zu Beginn des vorigen Jahrhunderts, auch wenn er eine Zeit in Spanien verbracht hat, und sein Stoff ist auch nicht die Beschreibung von Natur als einem Gleichnis der menschlichen Seele, wenngleich religiöse Motive eine tragende Rolle bei ihm spielen. Sein Erfahrungshintergrund ist der stupide sprachliche Alltag des DDR-Ostens mit seinen öden Gleichklängen und Tautologien. So fängt Lehnerts erster Gedichtband auch an mit dem Satz: „überhaupt, das gesicherte / vokabular besagt nichts“, um auf diesem schwankenden Boden eines notorisch gefährdeten Sprechens seine im Ton leisen und in der Geste zweifelnden Gedichte zu schreiben. Jetzt ist etwas hinzugekommen, was in der zeitlichen und räumlichen Differenz liegen muss: dass der Blick von der Sprache abgewandt ist und die Wirklichkeit als eine Sprache entdeckt wird. Und damit ist die Besitzergreifung des Vergangenen zumindest in der Gegenwart des Textes auch erfolgreich. „Dresden, Landnahme“ eben.
Neue Zürcher Zeitung, 20.10.2001
Ein Nachfahre der Mystik
„O daß wir unsere Ururahnen wären“, dichtete einst der junge Gottfried Benn, „Ein Klümpchen Schleim in einem warmen Moor. / Leben und Tod, Befruchten und Gebären / Glitte aus unseren stummen Säften vor.“ Das war aus der Perspektive des Nietzscheaners gesprochen, der dem Leiden an den Qualen des Bewußtseins, am Denkenmüssen und an den Zwängen der „Verhirnung“ seine Auflösungsphantasien entgegensetzte. Seine dionysische Flucht vor der positivistischen Welt der Moderne führte Benn in den Gesängen von 1913 zur Regression ins Animalische, Vorzeitliche. Auch in seinen frühen Essays träumte Benn von den Zuständen der Depersonalisation und einem rauschbereiten Ich:
mythen-monoman, religiös, faszinär.
Von den pflichtgemäß ernüchterten Schriftstellern unserer Tage werden solche dionysischen Programme meist des Irrationalismus verdächtigt, der vorsätzlichen Flucht vor den Zeichensystemen einer medial beschleunigten Gegenwart. Vielleicht ist es aber gerade dieser hartnäckig retroverse Blick, diese Suche nach visionärer Innenschau, was die suggestiven Vorzeit-Bilder in den Gedichten Christian Lehnerts so faszinierend macht.
Auch Christian Lehnert ist – wie der frühe Benn – ein mythen-monomaner, religiöser, von theologischen und mystischen Motiven umgetriebener Dichter. Mitte der 90er Jahre fand der junge Dichter, inspiriert durch religionswissenschaftliche Studien, in den Landschaften der jüdischen und arabischen Welt seine Orte poetischer Verheißung. Angeregt durch den Besuch heiliger Stätten des Judentums und des Islams, etwa auf der Halbinsel Sinai, entstanden lyrische Zyklen, in denen das poetische Subjekt immer wieder Motive der Schöpfungsfrühe und der Geburt des Menschen imaginiert. Auch das vorliegende Gedicht spricht von einem Rücksturz in die prä-humane Sphäre, von der Auflösung des Ich in den Organismen des Meeres, vom pantheistischen Zerfließen und Oszillieren des Subjekts. In Lehnerts großen Zyklen „bruchzonen“, „befunde“ und „Der Augen Aufgang“ finden wir immer wieder solche Vorstellungen von der Entrückung des Ich in animalische oder planetarische Ursprünglichkeit, wobei, anders als beim Agnostiker Benn, die Bilder göttlicher Schöpfung zum positiven Bezugspunkt dieser Poesie werden. Auch in den „bruchzonen“ sinkt das Ich hinab in jene heilige Sphäre, die für die allermeisten unserer Gegenwartspoeten völlig tabu ist. Die letzten beiden Zeilen des Gedichts rufen den Namen Gottes in Erinnerung: Jahwe, der von Lehnert mit der Tautologie „Ich bin, der ich bin“ übersetzt wird:
wie ein vergessener name hinab in
das gedächtnis eines vagen ich bin, der ich bin
Christian Lehnert rekonstruiert in seinen dunkel dahinströmenden Ursprungsbildern und halluzinatorischen Phantasien Einsichten und Erleuchtungen der Mystik, seine Texte haben die Innigkeit und visionäre Kraft von Gebeten. Es gehe darum, so schreibt Lehnert über ein Gedicht von Angelus Silesius, „die Fragmente frühester Erinnerungen mit den Fraktalen der Wahrnehmung zu verbinden – ein Klanggewölbe für die Stimmen der poetischen Mystik“. Die Thesen über den frommen Liederdichter und Mystiker Angelus Silesius lassen sich auch als Selbstinterpretation lesen. Insofern trifft auch das Diktum des Literaturwissenschaftlers Peter Geist zu, der zu Christian Lehnert bemerkt: Dieser Dichter steht Meister Eckarts „unio mystica“ näher als den Meistern unserer Avantgarde.
Michael Braun, der Freitag, 7.5.1999
Lagebesprechung
CHRISTIAN LEHNERT
Mein Verhältnis zum Fluß trennte uns. In Mäandern,
mit zäher Strömung, trieb mich der Sog, das Land
Fortzuschwemmen, auszuwaschen das warme Gerinnsel,
harte Grinde der Ufer, neben zwei Vogelschatten, an
dem ohne Ende gedachten Gefälle, Ich sah vom Schilf-
rand hinab; die Luft schien fiebrig, infiziert von stetig
wandernden Strahlern, blinkenden Grüßen ins All…
Seit wann verglüht? So ließ die Aussicht, als Halde,
die Augen zurück, weil sie im Sehen störten: vertikaler Horizont
von Brandmauern, sixtinisches Schweben, an
Kellern gestoppt, des Vergessens wegen, fuhr ich fort,
wo jedes Fremdsein stets sich selbst das nächste ist…
(„Dresden, Landnahme“)
Der Umgang mit traditionellen lyrischen Formen ist bei nur wenigen jungen Autoren so überzeugend wie bei Christian Lehnert. Vor allem kann er Sonette schreiben, eher an Shakespeare als an Petrarca geschult, die das Metrum und den Charakter der Kontradiktion tatsächlich auch bedienen; oder Zweizeiler im daktylisch fallenden Rhythmus, die das Distichon nicht erreichen, da sie in alternierende Betonungen wechseln, aber erahnen lassen; oder gar Alexandriner. Wir finden eine breite Skala an Reimen, vom Kreuzreim liedhafter Quartette bis zum Binnen- oder Stabreim, oder Reimandeutungen, die einer Harmonisierung des Inhalts wieder entgegenarbeiten. Zum Beispiel folgt einem im Grunde schwer erträglichen Reimpaar „Schlamm“ / „Schwamm“ sofort die Halbbindung „draußen“ auf „hausen“, womit es rückwirkend zerstört wird. Vielleicht ist nicht alles so gekonnt, wie es gekonnt sein will – allein das ernsthafte Bemühen um eine formale Bewältigung von Texten, die andernfalls in einer mäandernden Finsternis verlorengehen könnten, ist ebenso bestechend wie die Lösungen oft originell sind. Die Form ist hier also ganz und gar keine Liebhaberei eines Oberseminaristen der Germanistik, sondern einziges Korrektiv zügelloser Bewußtseinsverfassungen, so wild und durchbrechend wie ein reißender Fluß in der Landschaft. Und gerade dadurch, daß sie dem Gedicht auferlegt wird, erhält es die Chance, zu sich selbst zu kommen und im surrealen Gewebe aus Bildern und Worten den Gedanken zu finden. Dabei geht es nicht um diskursive Verständlichkeit, sondern um eine Bewegung von höherer und symbolischer Ordnung, die die Welt zu einer Formel faßt und das Gedicht in den Status einer generalisierenden Metapher erhebt. Eine Annäherung der Art, die poetischen Bilder am Realen zu messen, würde nur Unsinn erzeugen. Oder wie sollte man sich das „Ich“ im hier abgedruckten Gedicht körperlich vorstellen? Ist es Treibholz im Strudel des Wassers oder eine Schnake im Schilfgras, die zufällig bewußtseinsbegabt ist und spricht? Was ist eine „Aussicht, als Halde“, die „Augen zurück“ gibt, und wer verbirgt sich hinter dem Personalpronomen Plural im ersten Satz? Es hat keinen Zweck, auf diese Weise ist das Gedicht nicht lesbar. Es kann nur als eine sprachliche Figur aufgefaßt werden, die konkret ist und Reales mit Imaginärem souverän verknüpft, wie bei Luis Cernuda etwa oder wie im vor allem spanischen Surrealismus überhaupt. Christian Lehnert aber ist kein Andalusier zu Beginn des vorigen Jahrhunderts, auch wenn er eine Zeit in Spanien verbracht hat, und sein Stoff ist auch nicht die Beschreibung von Natur als einem Gleichnis der menschlichen Seele, wenngleich religiöse Motive eine tragende Rolle bei ihm spielen. Sein Erfahrungshintergrund ist der stupide sprachliche Alltag des DDR-Ostens mit seinen öden Gleichklängen und Tautologien. So fängt Lehnerts erster Gedichtband auch an mit dem Satz: „überhaupt, das gesicherte / vokabular besagt nichts“, um auf diesem schwankenden Boden eines notorisch gefährdeten Sprechens seine im Ton leisen und in der Geste zweifelnden Gedichte zu schreiben. Jetzt ist etwas hinzugekommen, was in der zeitlichen und räumlichen Differenz liegen muß: daß der Blick von der Sprache abgewandt ist und die Wirklichkeit als eine Sprache entdeckt wird. Und damit ist die Besitzergreifung des Vergangenen zumindest in der Gegenwart des Textes auch erfolgreich. „Dresden, Landnahme“ eben.
Kurt Drawert, Ostragehege, Heft25, 2002
Jessica Brautzsch im Interview mit Christian Lehnert: „Ich sehe ihren Glanz“
Otto Friedrich im Gespräch mit Christian Lehnert: „Hineinsprechen in das Ungesagte“
Richard Kämmerlings: „Schreiben gehört zu den vorletzten Dingen“
Fakten und Vermutungen zum Autor
shi 詩 yan 言 kou 口
Dichter im Porträt: Christian Lehnert.


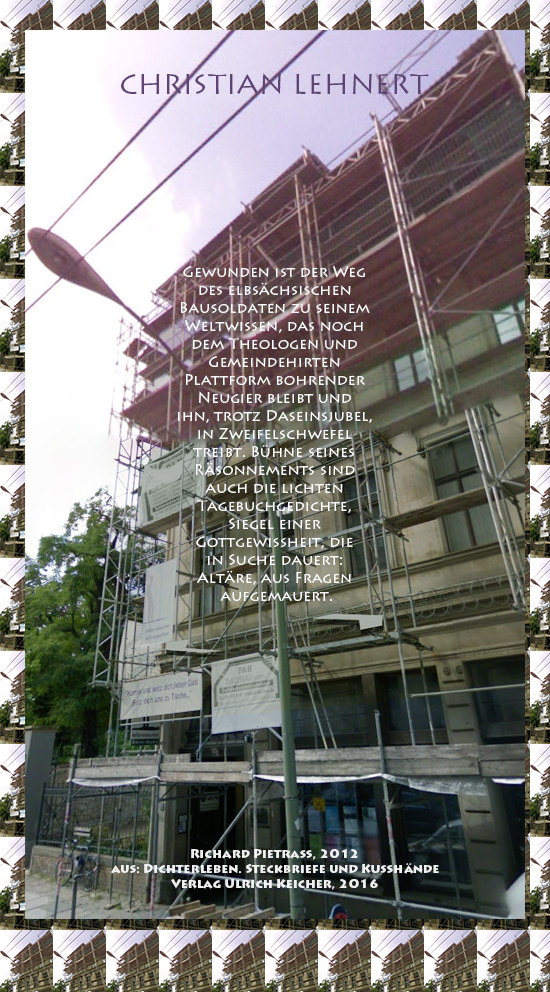












Schreibe einen Kommentar