Dorothea Grünzweig: Sonnenorgeln
ES SCHREIBT SICH nichts
weil es zu helfen weiß
es ist nur das Gedicht
ein Sehschlitz durch den
Klarheit scheint
damit wir fest umfühlen können,
was weint
und Fühlen ist schon Handeln
Fuchsfeuer überm Laubraum
Wie Gedichte sich bilden
Es ist das Nordlicht, das mir einfällt, wenn ich an Gedichte denke – jetzt, wo das Sehen des Nordlichts, des Polarlichts in einem finnischen Dorf ohne Straßenlampen für mich ein zwar nicht alltägliches, aber doch mögliches Ereignis ist. Das Nordlicht, Aurora borealis, heißt im Finnischen revontulet – Fuchsflammen, Fuchsfeuer. Aus repo, der Fuchs – mit dem Stufenwechsel p zu w, das v geschrieben wird – und tuli, das Feuer. Ein Kompositum, das im Plural steht. Bei Sonneneruptionen, Sonnenstürmen tauchen revontulet auf und haben eine beeindruckende Stärke. Bei geringer Sonnenaktivität bleiben sie aus. Im letzten Jahrhundert waren sie einmal über ein Jahr ganz verschwunden. Sie entstehen beim Aufprall von den aus den Sonneneruptionen entstandenen Partikeln auf die äußerste Erdatmosphäre, die Ionosphäre. Denn diese Partikel werden gegen die Pole der Erde und ihre Magnetfelder getrieben. Für einen Augenblick gibt es einen wuchtigen oder zarten Energiestau und beim Entladen dieser Spannung entstehen Lichtfiguren, die sich über den Himmel ergießen.
Das Nordlicht, welches Alexander von Humboldt auch „magnetisches Gewitter“ nannte, erinnert mich an den Vorgang der Inspiration und was er auslöst. Erinnert mich an die Geburt und das beginnende Wachsen und Sichformen von Gedichten. Sinneseindrücke, Erinnerungen, Ideen, Signale eines wachen körperlichen und seelischen Zustands knallen auf die Sprache, die Sprachmaterie. Und es entstehen Gebilde, die leuchten und im Fluss sind – und, was zumindest das Hören angeht, wieder verschwinden. Aber im Gedächtnis bleiben sie.
Die Formen, die beim Nordlicht entstehen, gehören zu einem riesigen Spektrum von Mustern aus Licht, die sich scheinbar wiederholen und wie ein Echo auf andere sind: Kernfelder, Knotenpunkte treten hervor, auf die Licht zuläuft oder von wo aus es abebbt und ausbleicht. Aus der Horizontlinie steigen grüne Hügel, Bergkronen, aus denen helle Zacken treiben. Rote Lichtstämme und -stümpfe, auslaufend in Peitschen und Dochte. Rohre, Stauden und schwankendes Astwerk, blaue Teppiche, schleierleichte Draperien, Lichtgischt, die – manchmal knisternd, schwirrend oder brausend – das Dunkel besetzen, benetzen. Es noch dunkler erscheinen lassen. Und die in es verlöschen. In ständigem Wandel begriffen, wie ich die Vielschichtigkeit von Gedichten auffasse, das nie ganz Auszulotende. Und wenn man sie über das Gehör aufnimmt, wird diese Wahrnehmung potenziert.
Der Himmel hat eine Eingebung. Er ist illuminiert, denke ich, wenn ich auf den zugefrorenen Seen stehe oder auf einem Höhenrücken oder in unserem dem Wald abgerungenen Garten und das Nordlicht, das Fuchsfeuer betrachte.
Das finnische Wort revontulet erklärt sich landläufig so: Der Feuerfuchs ist ein mythisches, von den Jägern hochbegehrtes Tier. Erlegt man es, darf man sich außergewöhnlichen Glücks gewiss sein. Es hat die Eigenschaft, mit seinem Fell, wenn dies Bäume und Schneedecke streift, Milliarden von Funken zum Himmel zu sprühen.
Die finnische Schriftstellerin Britta Polttila hält eine andere etymologische Erklärung für revontulet bereit, die meinen Assoziationen entgegenkommt. Sie stellt die Behauptung auf, dass es sich hier um ein Dialektwort handele. Es sei bei den in der Wildnis, im sydänmaa, im Herzland, im Kernland lebenden Holzfällern, den sogenannten Waldfinnen, gebräuchlich gewesen. Und bedeute gar nicht Fuchsfeuer, sondern stamme von dem Verb revoitella – zaubern. Genauer: Zaubersprüche aufsagen. Sei also etwas Sprachliches. Und somit könnten wir behaupten, dass über den Himmel Zaubersprüche flackern. Oder, das Sukzessive des Hörens vergessend: der Himmel, eine riesige Ohrmuschel, wird überströmt von flammenden, magischen Sprüchen und Zauberlauten. Revontulet – die Zauberfeuer.
Hätte ich in Island über dieses Thema nachgedacht, wären mir vielleicht zuerst die Geysire eingefallen – oder noch eher die Vulkane, welche unter den Gletschern harren und ihr Erscheinen lange vorher ankündigen. Mit einem Schlag brechen sie dann aus. Sprengen die Gletschermassen und jagen Eissäulen und Schneewolken hoch in die Luft, verursachen gewaltige Flutwellen.
Diese Bilder stimmen und stimmen nicht. Doch geht es ja nur um ein Nachspüren von Eindrücken und inneren Schwerpunkten, die sich in der eigenen Wahrnehmung herausgebildet haben. Schwerpunkte des Empfindens, die neben anderen Schwerpunkten liegen.
Als Hugo Dittberner mich zum Wolfenbütteler Kolloquium der Lyrikpreisträger 2004 einlud, bat er mich, in meiner Rede auf das Thema Form Bezug zu nehmen, aus meiner Sicht. Der Sicht einer, wie er meinte, „eher rhapsodisch schreibenden“ Dichterin.
Ich will davon sprechen, ohne auf den großen Bereich des Schreibens unter Verwendung der strengen Form mit festem Strophenbau, Metrum und Reim einzugehen – auf den Gewinn eines solchen Schreibens. Dass ich diese Art des poetischen Schaffens in der Lyriktradition schätze, versteht sich von selbst. Und natürlich spreche ich über dieses Thema, ohne zu wissen, wie sich meine Arbeitsweise in Zukunft gestalten wird.
Zuerst einmal werde ich aufteilen. Aber eigentlich geht es nicht um streng Getrenntes. Nur um Verdichtungen und Polarisierungen, um das Aufzeigen von Tendenzen. Denn alles hängt zusammen und spiegelt sich ineinander. Auf der einen Seite Formfreiheit, Formauflösung. Auf der anderen Seite Formwille, Formbindung. Im Fortlauf wende ich mich dann der umfassenden Frage zu, wie Gedichte sich bilden, sich formen. Wie sie keimen und – so sagt man im Finnischen – „geboren werden“. Wie sie sich entwickeln…
Dorothea Grünzweig aus einem Werkstattessay, als Rede gehalten 2004 in der Bundesakademie für kulturelle Bildung Wolfenbüttel.
Nachbemerkung
Neue Gedichte wachsen beständig. Sie brauchen Zeit. Deshalb sind sie in diesen Auswahlband nicht mit aufgenommen. Ich empfinde die Zeitspanne ab der Drucklegung eines Gedichtsbands bis zu der des nächsten als eine Einheit. Die sich bildenden Gedichte regen sich gegenseitig an, reifen – auf manchmal unsichtbare, manchmal sichtbare Weise – vernetzt miteinander. Es geriete etwas aus dem Gleichgewicht, nähme ich vorzeitig Texte aus diesem Entstehungsprozess heraus.
Dorothea Grünzweig
Seit 1997
sind vier Gedichtbände der in Finnland lebenden Autorin im Wallstein Verlag erschienen. Die ersten beiden, Mittsommerschnitt (1997) und Vom Eisgebreit (2000), sind seit geraumer Zeit vergriffen. Grund genug, die Entwicklung und den Bestand des lyrischen Werks von Dorothea Grünzweig in einer Sammlung aus ihren ersten vier Büchern zu sichten und zusammenzufassen.
Sprachverlust und Wiedergewinnen der Sprache, der Wechsel aus der „Vatersprache“ in neue sprachliche Beheimatung, das Herüberleiten sprachlicher Traditionen in neue Kontexte, all diese Bewegungen kennzeichnen das Werk von Dorothea Grünzweig.
Der Essay „Fuchsfeuer überm Laubraum“, der den Band abschließt, bietet eine eingehende Auskunft der Autorin über ihr eigenes Schreiben und über die Entstehung von Gedichten allgemein.
In zahlreichen Veranstaltungen ist Dorothea Grünzweig gemeinsam mit dem Akkordeonisten Antti Leinonen aufgetreten. Dies dokumentiert die beigelegte CD.
Wallstein Verlag, Klappentext, 2011
Sonnenuhren oder Sinnbilder der Weltharmonie
Ein existenzielles Weltverhältnis spricht aus den Versen der 1952 in Korntal bei Stuttgart in einem protestantischen Pfarrhaus geborenen Dorothea Grünzweig. 1989 zog sie nach Helsinki und lebt seit 1998 als freie Schriftstellerin und Übersetzerin in Finnland. Die Auswahl aus ihren vier Gedichtbänden dokumentiert den Prozess ihres Schreibens: den Ursprung ihrer Poesie aus der zweifachen Erfahrung von Fremdheit. Fremd war ihr anfangs das Land, das sie gewählt hatte. Fremd wurde ihr aber auch das deutsche Vaterland, je mehr sie sich das Grauen der Geschichte vergegenwärtigte.
Die lyrischen Figuren kommen aus der eigenen Biografie. Der Vater wird immer wieder neu erinnert. Er erscheint als ein „Wortausrichter“, ein „Mann aus Wort“. Nach Schutz und Wärme in Worten sucht die Dichterin auch heute noch. In einer Metaphorik aus Eis und Schnee singt sie „in Polar-Dur“. Sonnenuhren stehen neben Schattenuhren. Das „ungebärdige Gestehn / von Wünschen und Verzweiflung“ schließt eine Ballung von Komposita ein, die scheinbar Unvereinbares zusammenzurren. Sinnlich vollkommenen Gesang vernimmt man nicht. Das verhindern nicht zuletzt die verzwickten Adjektive.
Im sprachlichen Bewegungsraum zwischen Finnland und Deutschland hört man es knirschen: „auf harschstege treffen grate aus granit“ („Die Wildpartitur“). Mit lebhaften Bewegungen reist die Dichterin in vielerlei Wort-Varianten durch äußere und innere Landschaften und hält sich dabei an einen die „Leibsprache“ prägenden Rhythmus. Nichts Abschließendes soll die Beweglichkeit einschränken. So spielt Grünzweig unverdrossen auf der Sonnenorgel und bezieht dabei finnische Wort- und Klangfolgen ein. Im Wunder der Tonkunst sahen die Romantiker ja das Sinnbild einer verlorenen und wieder herzustellenden Weltharmonie.
Dorothea von Törne, Die Welt, 20.8.2011
Auf Stimmenfang
– Zu Dorothea Grünzweigs Gedichten. Laudatio. –
Als Bob Dylan einmal für kurze Zeit mit dem Plan umging, ein eigenes Plattenlabel zu gründen, nannte er sein Vorhaben Ashes and Sands – ein Emblem der Vergänglichkeit sollte dieser Name sein; „alles ist eitel“, sagte auch dieser Prediger.
Auch im Titelgedicht von Dorothea Grünzweigs Gedichtband Glasstimmen lasinäänet ist von „Asche und Sand“ die Rede, von „unseren Stimmen“, die „zu Asche und Sand zerfallen können“. Und auf einmal gewinnt die Vanitasmetapher wieder eine Wörtlichkeit und Anschaulichkeit, die alle Angst bannt und die Trauer vor der Vergänglichkeit mit leidenschaftlicher Hoffnung widerlegt. Denn gerade aus Asche und Sand entstehen hier ja, gleichsam vor unseren lesenden Augen im Verlauf des Gedichts die titelgebenden „Glasstimmen“, die gläsernen Glocken mit ihrem „Gongen Klingeln“, ihrer „Klangglast“, ihrem „Glockenschimmer“. Aus dem Inbegriff des Zerfallens und der Vergängnis entsteht, aufersteht hier die wunderbare Erkenntnis, „dass / die gläserne See und die tönenden / singenden Stimmen der Kinder / aus einunddemselben Gemenge sind“. Und wer das Gedicht bis zu Ende liest, der kann diese Stimmen auch hören, im fremdartigen Zauber der finnischen Beschwörungsformeln:
kellojenkieli kilisee helisee
kilkatus kimallus
Glas lasi lasinäänet
Es ist ein überaus komplexes Gebilde, dieses Gedicht, das so bedächtig einsetzt („Glas lasi lasst uns erzählen“) und das dann von Vers zu Vers an Tempo und Verve gewinnt. Was anfängt wie die einfache Erinnerung an einen Frühlingsausflug in die finnischen Wälder, zum alljährlichen „Glashüttenfest“ eben, steigert sich zur Vision einer weitläufigen Landschaft, von schwindelerregender Schärfe und Tiefe des Bildes, unter dem Leuchten der Maisonne, im „Fernwehn des Windes“ und „inmitten der / gläsernen Weite des Meeres“. Und es steigert sich zur Audition der Kinderstimmen, die wie eine Verheißung von Leben und Freiheit tönen („Kappen sind oft auch auf unseren Mündern / während der Mund der Kinder / freigesprengt ist“). Und auf unsere Erwachsenenwelt aus zerbrechlichem Glas, aus „ashes and sands“ fällt das Licht der Auferstehung. Viermal erklingt in diesen weit ausholenden Strophen das Grundmotiv des finnisch-deutschen Wortpaares, zart und eindringlich wie ein gläserner Gong, und jedesmal wird es sinnreich variiert: „Glas lasi“, „lasinäänet Glasstimmen“, „Glas lasi lasinäänet“ und am Ende diese Trias noch einmal, eingebettet in die ganz ins Finnische übergegangenen Schlussverse. Durchsichtig werden die auf den ersten Blick so fremden Wörter in diesem Prozess: „lasi“ erweist sich als Lehnwort aus dem deutschen „Glas“, die Stimme des einen Landes, der einen Sprache, klingt in der anderen wie ein verfremdetes Echo wieder an, die Sprachen antworten einander, durchdringen sich. Denn, wie ein nicht weit entferntes Gedicht uns belehrt, „Namen gibt es die gegentönen / man muss nur das Ohr an sie liegen“.
Dies, meine Damen und Herren, scheint mir ein zunehmend deutlicher hervortretendes poetologisches Prinzip von Dorothea Grünzweigs Gedichten zu bezeichnen: dass sie das Ohr anlegen an die Namen der Welt und dass sie empfänglich sind für das Gegentönen. Auf buchstäblich zauberhafte, zauberische Weise gehen diese Gedichte auf Stimmenfang. Eine ganze Abteilung trägt hier die Überschrift „In Horchhäuschen“. Vom Erlernen der „Schneesprache“ handelt ein Gedicht; „Ich sprech in Winterzungen“, antwortet ein anderes. Umzingelt von „Mutterzungen“ findet sich die Sprecherin in einem Tagelied, ein anderes Mal fährt sie in die Mondnacht hinein, „wo alles in den schönsten Tönen / schweigt“. Was diese Dichterin wiedererlernen – und womöglich uns, die Leser, lehren – will, das ist „das Kinderhören / das Hören der leiblichen Namen der Dinge“. In zunehmendem Maße ist die Welt dieser Gedichte nicht von Bildern, sondern von Klängen erfüllt, von Stimmen, die singen und reden und tönen. Schon in den beiden früheren Bänden hob dieses Tönen an, das freudige Heulen der Möwen und das „Eisgesinge“ des Winters, das Jubilieren der „Finsternisamseln“ und der „Nachtigallnächte“; schon dort war das die tröstende, erleichternde Antwort auf nächtliches Entsetzen, auf Lebensangst und Totenstille. Und dennoch, scheint mir, sind die Klänge reicher und voller geworden im jüngsten, dritten Band Dorothea Grünzweigs, reicher an Zuversicht und hoffnungsvoller. Damals, vor vier Jahren, lag die Welt dieser Gedichte noch in tieferen Schatten, unterm Eisgebreit, und ihre Lichtquellen waren eher die Reflexionen von Schnee und Eis. Damals war die Stille eher bedrohlich als beruhigend; und wenn damals eine Sommernacht widerhallte, dann von den „Stimmen der Nachtigall die nichts anderes sind / als die Stimmen der Toten“.
Im jüngsten, dem Glasstimmen-Band, haben die Klänge dagegen eine wahrhart symphonische Fülle erlangt, reich orchestriert ist die Welt nun. Hier sind „Sonnenorgeln“ zu hören und „Schattenorgeln“, Kirchenglocken „im Auferstehungskampf“ und das „Freudenheulen“ des Mondes über dem Eisfeld des Winters – Dorothea Grünzweig ist überhaupt die einzige mir bekannte Dichterin, die den Mond nicht zuerst schimmern sieht als den schönen, stillen Gefährten der Nacht, sondern die ihn heulen hört (und die uns das auch sogleich hörbar macht, in einem Wort wie „Freudenheulen“ eben). Selbst „Das Moos ist mit Lauten / vollgesaugt mit Gegentönen“, mit Lauten also, die – so lesen wir weiter – „die mit des Ohrhalters Herz / eine Verbindung eingehen“. Sie bemerken: Wer Dorothea Grünzweigs Verse liest, der muss zum Ohrhalter werden. In einer Kultur, die überflutet wird von Bildern, lautet ihr leiser, aber kategorischer Imperativ: Wer Ohren hat zu hören, der höre.
Mit einem Ostergedicht beginnt dieser Band, unter der Überschrift „Winterschmelze Grüngewalt“. „Die Osterworte haben Flügel“, lautet eine der Zeilen, und gemeint sind die Flügel der Wasservögel, die in dieser gewaltigen Frühlingsszenerie, wie man sie vielleicht nur in einem Land mit langen, dunklen Wintern erleben kann, „die sterbliche Hülle des Winters“ davontragen. Eben weil das Erlebnis von Kälte und Finsternis, von Verlassenheit und Angst so übermächtig zu werden droht in diesen Gedichten, sind die Bilder von Leben und Hoffnung so leuchtkräftig. So naturtrunken die Verse erscheinen, die geschichtliche Welt liegt immer in Sicht- und Hörweite. Mitten in den Schilderungen der finnischen Wälder blitzt unversehens das Bild der „von Stalin Fernverbannten“ auf. „Es ist ein Sterben angebrochen“, beginnt ein Gedicht und fährt fort: „der Erdball unter uns ist / klein geworden / kommt es vom Druck der / Menschenschwere von Atemnot“. „Katastrophen- und Bombenbilder“, liest man, „führen bei mir ein Eigenleben / ausgeprägt ungezähmt“; ein ganzer Zyklus vergegenwärtigt auch in diesem Band – wie im vorangegangenen – die Ängste und Alpträume einer Kindheit im deutschen Pfarrhaus, mit einem gequälten und darum manchmal quälenden Vater, „mit Priesterworten Worten der Schrift / die mir als Bußekeulen dienten Sühnekeulen“ und die sich hier sonderbar vermischen mit den Schrecken der Geschichte von Krieg und Holocaust, mit dem, was ein einziges Wort hier resümiert als das „Höllengeweide“. Als Gottferne und Kreuzesnot hat ein Gedicht im vorigen Band diese Erfahrung beschrieben, die des Vaters und die des Kindes mit dem Vater, ja geradezu, mit einem hier ganz schauerlichen biblischen Wort, als „Kindsopferung“. Darauf, auf diese erinnerten und gegenwärtigen Bilder von Kindheitsschrecken wie von geschichtlichen Zerstörungen antworten hier, wie auf den Anblick von Asche und Sand, die Osterworte.
Die Klangwelt, die in diesem Sprachgeschehen hörbar wird, ist von Märchen und Mythen erfüllt. Welcher Vertrautheit mit der reichen finnischen Volksüberlieferung sich das verdankt, kann man erahnen, wenn man liest, wie im Nachwort der schönen Neuübersetzung des Kalevala, die Gisbert Jänicke kürzlich vorgelegt hat, ausdrücklich der Dichterin Dorothea Grünzweig für ihre Hilfe gedankt wird. Wie in den finnischen Mythen also, so sind auch in ihren Gedichten Menschen und Bären noch (oder wieder) Verwandte – und das gilt für die irdischen Bären wie für den großen am Nachthimmel. Manchmal ist es, als „flöge ein Ren / zum Tal mondwasserweiß“, und manchmal ertönt die Stimme der Mutter „vom schlohweißen Meer“ her, „aus dem Kindbett des Eises“. Über der kummervollen Menschenwelt erheben sich hier „die in Schneeblüte stehenden / wehenden Berge“; und in manchen Gedichten des jüngsten Bandes finden wir uns wieder „in den dachfreien Sommersälen / grad wenn das lodernde Grün / auf alles überspringt“. Selbst das Gewitter hat in dieser märchenhaften, in aller Unheimlichkeit doch sonderbar anheimelnden, heimatlichen Welt etwas Personenhaftes:
Über das Korntal her… kommen
den Donner dicht bei sich die Blitze
blank grad wie von anderer Welt
umstellen das Haus
In einem längeren Essay, der soeben bei Ulrich Keicher erschienen ist, hat die Dichterin sich vor nicht langer Zeit mit den beiden Sprachen befasst, die ihrer Ansicht nach „früher“, in mythischen Zeiten, die Welt bestimmt haben: der „Allerweltssprache“ und der „heiligen Sprache“. Und es verwundert nicht, dass sie wie einen Nachkömmling dieser letzteren die finnische Sprache auffasst, in einer sehr schönen und bezeichnenden Mischung aus wörterbuchkorrektem und poetisch-assoziativem Verständnis. Im finnischen korpi für „Wald“ fühlt sie das corpus. Und (dieses Beispiel entnehme ich einem ihrer Gedichte) noch im finnischen Wort für „erhängen“, hirttää, vermag sie den Nachklang eines „guten Hirten“ zu hören. Es ist eine poetische Etymologie, die hier am Werk ist.
Ich bin nicht ganz sicher, ob Dorothea Grünzweig, wenn sie sich im selben Essay als „Bürgerin zweier Sprachwelten“ vorstellt, damit das Deutsch ihrer schwäbischen Heimat meint, die sie vor fünfzehn Jahren verlassen hat, und das Finnische ihrer Wahlheimat, in der sie seitdem lebt – oder nicht am Ende doch die Allerweltssprache und die heilige der Hulden. Ein Wort jedenfalls zieht sie aus dem Wortschatz der letzteren hervor, das ganz einzigartig ist; sie nennt es „das wichtigste Wort der heiligen Sprache“: Gehört habe sie es, berichtet sie, freilich zuerst in einer denkbar alltagssprachlichen Situation, als Ausruf eines verzweifelten KFZ-Mechanikers: „Jumala auta!“ lautet es, „Gott hilf!“ Dieses Wort, ohne Vergleich und Verwandtschaft in allen uns Westeuropäern sonst bekannten Sprachen, sei ihr zugleich ganz fremd und voller geheimnisvoller Beziehungen erschienen: Jumala. „Es war“, schreibt sie, „Allah in ihm anwesend und Jupiter und das französische jumelage. Eine Verschwisterung verschiedener Kulturen.“ Und sie fügt hinzu, da sei ihr handgreiflich aufgegangen, was bislang nur Theorie gewesen sei: „das Wort jumala ist nicht identisch mit Gott. Auch das Wort Gott ist nicht das Wesen, das damit bezeichnet wird. Würden wir alle Bezeichnungen für Gott in allen Sprachen der Welt kennen, die Dialekte dazu, und sie gleichzeitig sprechen – was wir ja nie schaffen – vielleicht kämen wir dann dem ein Stück näher, der von sich sagt: ,Ich werde sein, der ich sein werde.‘“ Wie immer man es mit diesem Gedankenexperiment hält – ganz gewiss hat Dorothea Grünzweig hier einen zweiten Grundzug ihrer eigenen Poetik angedeutet, der Sprach- als einer Kulturen-Verschwisterung in ihren Gedichten und der darin immerfort betriebenen Suche nach der verlorenen heiligen Sprache.
Dorothea Grünzweigs Gedichte entwerfen ein Wörterbuch der „Hulden“-Sprache. Die huldu folk nämlich, von denen man im inneren Finnland noch erzählt, die „Holden“ (von denen hierzulande leider nur noch das Gegenstück erhalten geblieben ist, die „Unholde“): für Dorothea Grünzweig sind sie auf geheimnisvolle Weise verwandt, vielleicht identisch mit den Worten dieser heiligen Sprache: koboldhaft heilige Wortwesen, eigenwillig und freundlich; und wer sie zu wecken versteht, weckt die Lebensgeister.
Heidnische Wortkobolde und der Name dessen, der über allen Namen ist – in Dorothea Grünzweigs doppelter Sprachwelt gehen, wie man sieht, mythische Beschwörungen und christliche Dichtung, alltägliche Notate und die Zauberformeln des „lasinäänet“ sonderbare und schöne Allianzen ein. So sonderbar und schön, als seien die Schwierigkeiten einer, sagen wir behelfsweise und mit Argwohn gegenüber der einfachen Rubrizierung: religiösen Naturdichtung, über die in den letzten Jahrzehnten soviel Tinte vergossen worden ist, einfach gegenstandslos wie die Frage, wo genau die Grenze verläuft zwischen religiöser Erfahrung, Welt-Frömmigkeit und Sprachmystik.
Dies alles, meine Damen und Herren, sind keineswegs esoterische Vorgänge. Im Gegenteil, es geht überaus gesellig zu in diesen Gedichten; und auf Geselligkeit, auf Gesellschaft sind sie alle aus. Das beginnt schon mit dem Heimischwerden im neuen Land, das sich geradezu von Band zu Band verfolgen lässt, von Mittsommerschnitt 1997 über Vom Eisgebreit 2000 bis zu den Glasstimmen in diesem Jahr. War noch im Mittsommerschnitt vom „Fremdland“ die Rede und im Eisgebreit vom „Stiefland“, so liest man in Lasinäänet einen Dank an das, was nun das „Ankommland“ heißt:
da wo ich jetzt bin
im Ankommland
sind meine Worte leicht
sind aufgehoben
Die Erfahrung des Angekommenseins in einer offenen, leichten, freundlichen Welt, in einer von Leben übersprudelnden Natur; die Erfahrung der Gemeinschaft mit anderen Menschen; die Erfahrung der leichter werdenden, über den Ländern schwebenden Sprache: für Dorothea Grünzweig sind sie, scheint mir, alle drei Varianten, Erscheinungsformen einer Welt-Erfahrung, die auf andere, freiere Weise als in der bedrückten und bedrückenden Väterwelt des Vaterlandes, wieder religiös bestimmt ist. „Singt was das Zeug hält“, ruft eine Strophe unvermittelt aus, „denn / wenn wir auch mitten im Tod / sind Kinder sind wir trotzdem von / Leben umgeben“ – und da klingt plötzlich, wie aus Versehen und darum ganz rührend, ein Reim auf. „Mitten wir im Leben sind / mit dem Tod umfangen“, lauteten die Verse des evangelischen Psalmliedes. Hier, im Ankommland, im Land der Hulden: hier ist es der Tod, der von Leben umgeben wird, im Klingen der Stimmen, im hörbare Gemeinsamkeit schaffenden Gesang.
Einmal wird hier das Atmen „ein Singen“ genannt – das darf, denke ich, auch umgekehrt gelten. Im Singen, dem der menschlichen Stimmen wie dem der fremden und oft unheimlichen Natur, vernehmen diese Verse einen Atem. Das Angeredetsein erfahren sie zugleich wie einen Anhauch, die Ahnung einer Wärme, die Leben einhaucht in den toten Lehm.
Ebenso bezeichnend aber ist die Atemwende, die hier jedesmal mitzudenken ist, wenn vom Stimmenhören die Rede ist. Derselbe Mond, der im einen Gedicht vor Freude heult in der Winternacht, erscheint im anderen als „das Himmelsohr“: als warte er auf Antwort. Das Gedicht ist diese Antwort. Mit ihm wird die Erfahrung des Angeredetseins zum Gespräch. Mit dem Mond, warum nicht, mit der Welt und nicht nur mit dieser allein, und mit uns, den lesenden Hörern. Allerdings: Es gibt Zuhörer, so weiß eines dieser Gedichte zu berichten, deren „Hören ist ein Lauschangriff. Also seien wir auf der Hut, und nehmen wir uns ein Lese-Vorbild an der Hinhörkunst dieser Verse, am Himmelsohr.
Meine Damen und Herren: der erste Kronzeuge meiner Überlegungen ist Bob Dylan gewesen. Der zweite und letzte, Sie haben es erwartet, muss Christian Wagner sein. Vieles verbindet sein Werk mit dem Werk der heute mit dem nach ihm benannten Preis zu Ehrenden, und es wird immer mehr, je näher man hinschaut. Nicht nur die aus Hingabe genaue Wahrnehmung der Natur in ihren landschaftlich-weitläufigsten und wegrainhaft-nahen Erscheinungen, nicht nur der zugleich unheimliche und vertraute Umgang mit den „Hausgespenstern“ („Die Bilder der Toten, wie nie zuvor, / Sie treten aus des Rahmens Tor“) und die Neigung zu den sprachlichen und den lebensweltlichen Hulden („Es lassen mich kalt die Fluren, / Es lässet mich kalt der Wald; / Ich folge nur einzig den Spuren / Der seligen Huldgestalt“) – sondern auch die Schilderungen der Daseinsangst und des Entsetzens vor der Vergeblichkeit, auf deren dunklem Grund erst die Farben der Naturerlebnisse zu leuchten beginnen und aus denen die dankbare Liebe zum Lebendigen erwächst. In den Gedichten, die davon sprechen, hat Christian Wagner einen Vers geschrieben, den er – es kann nicht anders gewesen sein – in prophetischer Schau adressiert haben muss an diese Bürgerin zweier Sprachwelten. „Wann der Abend nach den Talen schreitet, / Bachentlang ein Rosenglanz sich breitet: // Wassernelken, schön wie Oleander; / Nord und Süd, wie gleicht ihr doch einander!“ Dafür, dass sie mit ihrem lyrischen Werk diesen Vers entfaltet und beglaubigt, ehren wir die Dichterin Dorothea Gründzweig dankbar mit dem Christian-Wagner-Preis.
Heinrich Detering, Laudatio auf die Preisträgerin des Christian Wagner Preis 2004, Warmbronner Schriften 15, 2005
Fakten und Vermutungen zur Autorin
shi 詩 yan 言 kou 口

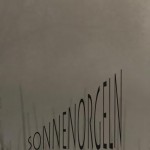
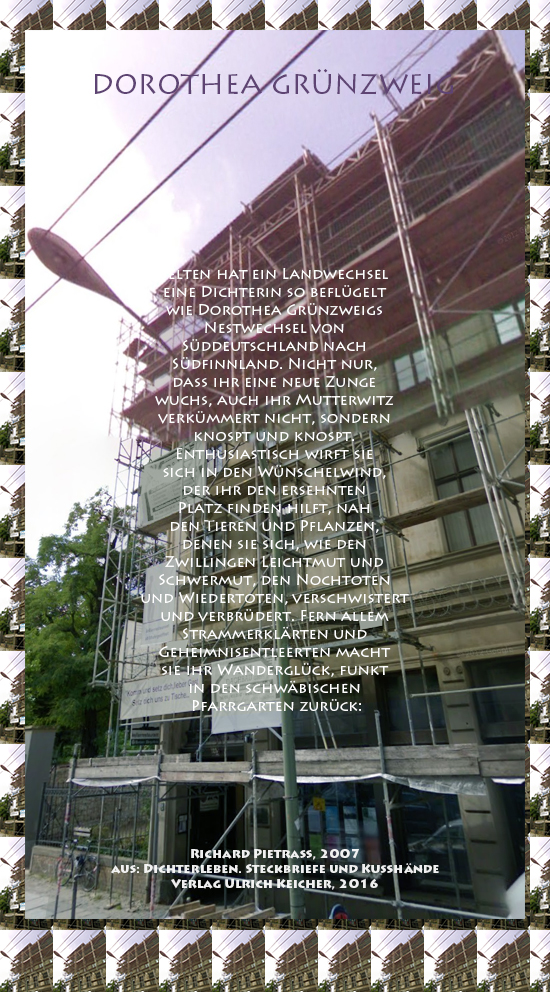












Schreibe einen Kommentar