Durs Grünbein: Cyrano oder die Rückkehr vom Mond
MÖBIUS
Was ist der Mond? Der treue Hund der Erde,
Faktotum, Außenspiegel, schwankender Geselle,
In seiner Kahlheit eine wandelnde Beschwerde.
Ein Gong auch, lautlos, korrodierte Narrenschelle,
Ins All gehängt von dem Maestro allen Schwebens.
Mal nah, dann fern: Und plötzlich groß zur Stelle,
Wenn er schon fast vergessen schien und aufgegeben.
Ein grauer Riesenpilz, ein Diagramm der Tage,
Die sich zum Monat runden. Das war sein Diktat.
Er hält die Pole, macht das Meer zur Wasserwaage.
Die Erde wäre unbewohnbar ohne ihn –
Geht ein Gerücht, das älter ist als Platons Staat.
Er war das Himmels-Jo-Jo, Spielzeug aller Pharaonen,
In jeder Rolle gut, als Bonze, Rabbi, Muezzin.
Schreib einen Brief an den Mond. Schreib Cyrano…
„Es gibt nur eine Sensation: die der Heimkehr.“
Was ist da los? Die Amerikaner verlassen den Mond, überlassen Nachzüglern den scheintoten Begleiter der Erde. Zeit zum Rekapitulieren: An einem Sonntagnachmittag in Berlin, auf dem Flugfeld des stillgelegten Aeroports Tempelhof, macht der Dichter Durs Grünbein eine folgenreiche Beobachtung. Was, wenn die Menschheit immer nur zurückkehren wollte von ihren Abenteuern der Raumerkundung? Gestern der Mond, morgen der Mars und übermorgen…? Da begegnet ihm Cyrano de Bergerac, der spöttische Reisende durch die Planetenreiche der Imagination, ein Zeitgenosse des René Descartes. Er ruft ihm über die Jahrhunderte hinweg zu: Es gibt nur eine Sensation – die der Heimkehr, alles andere sind Phantastereien! Und plötzlich öffnen sich alle Schleusen in Raum und Zeit, die Feier des Hierseins beginnt. Dort draußen die Unwirtlichkeit und die Krater (benannt nach den Helden der Wissenschaftsgeschichte, den Pionieren der Raumfahrt) – und hier unten die fragilen Elegien einer Spezies, die allmählich begreift, dass sie mutterseelenallein ist im All.
Durs Grünbein hat einen neuen Gedichtzyklus geschrieben, der von der Sehnsucht ausgeht, von den verlorenen Erkenntnismühen einer im Kern romantisch gebliebenen Aufklärungskultur, die nichts anderes will, als zurückfinden zu sich, den Mond betrachten, als sei er immer noch da.
Suhrkamp Verlag, Ankündigung
Gammler des Universums
– Durs Grünbein entwickelt sich zum Romantiker in der Tradition von Novalis. In seinem Gedichtband Cyrano oder Die Rückkehr vom Mond schwelgt er in Sinnbildern. –
Der Mond ist ein seltsam Ding. Seit Menschengedenken wacht er über Schlaf, Träume und Gezeiten. Er gibt uns irdische Sehnsüchte ein, die über sich hinaus gelangen wollen, und er ist selbst Gegenstand eines himmlischen Fernwehs, dessen Abenteuer uns umso weniger locken, je erreichbarer die Raumfahrt sie gemacht hat. Doch so verbraucht er als Symbol inzwischen ist und so geheimnislos als Gestirn – er gehört zum unauslöschlichen Inventar, innerlich wie äußerlich.
Darin ist Durs Grünbein ganz Romantiker. Im Motto seines neuen Gedichtbands Cyrano oder Die Rückkehr vom Mond fragt er denn auch mit Novalis:
Wir träumen von Reisen durch das Weltall. Ist denn das Weltall nicht in uns?
Es sind die Worte, die 1798 in den „Blüthenstaub“-Fragmenten einen Kernsatz der deutschen Frühromantik einleiten:
Nach innen geht der geheimnisvolle Weg.
Das Werk, auf das sich Grünbein vor allem bezieht, ist allerdings noch rund 150 Jahre älter.
Die Reise zum Mond des Voraufklärers Savinien Cyrano de Bergerac, 1657 postum erschienen, gilt als einer der ersten Science-Fiction-Romane der Weltliteratur – und hat sein Pendant in einem ebenso legendären Sonnenroman. Grünbeins Tribut an die Gegenwart liegt in einer Art Nachruf auf die bemannte Mondfahrt – auch wenn Indien und China derzeit neue Expeditionen planen. Die Lehre, die die Menschheit aus dem Aufbruch der Amerikaner zog, dürften sie nicht in Zweifel ziehen. Eugene Cerman, 1972 Kommandant der letzten Apollo-Mission, resümierte nach seiner Rückkehr:
Wir brachen auf, um den Mond zu erkunden, aber tatsächlich entdeckten wir die Erde.
Das ist nicht weit entfernt von dem, was Cyrano einst imaginierte – die Erleichterung, auch wieder zurückkehren zu dürfen. In dieser Trias, die sich an der Umkehrung des Sehnsuchtsblicks versucht, sind Grünbeins 84 Gedichte quer durch die Kulturen und deren Bildspeicher angesiedelt. Selbst die unbewohnbarste Erde, suggerieren sie, ist wohnlicher als der Mond.
„Nachts aber strahlen die Städte“ versprechen etwa die Verse von „Tacchini“.
Ein geiles Glitzern
Dringt aus den Ballungszentren durch die Sphären,
Dass die Sterne verblassen, der Mond ergraut.
Sie nennen es Lichtschmutz, und meinen den Dunst,
Der die Erde umschleiert. Von ihrer Raumstation
Schaut die Crew voller Wehmut herab auf das Fest.
Weithin sind die Urstromtäler erhellt, elektrifiziert
Die Küsten, in den Wüsten die Casino-Oasen.
Tritt ein, Cyrano, in den Kristallpalast Erde.
Wie alle Gedichte ist es in freirhythmischen, mit Binnen- und gelegentlich Endreimen spielenden Terzinen abgefasst, die mit dem Namen von Mondkratern überschrieben sind und zumeist drei Strophen umfassen. Aufgeladen mit kulturhistorischen, technischen und ökologischen Motiven, kommen sie in der Summe aber nicht über virtuose Stilübungen hinaus. Denn sie verhalten sich zu dem nachgestellten Essay, der mit einem Spaziergang über das Tempelhofer Feld beginnt und mit Otto Lilienthals Absturz „auf den Schwingen der Transzendenz“ endet, um den Aufbruch in die Raumfahrtära zu markieren, wie die Illustration zum Programm. Die in Mehrdeutigkeit schillernde „Lyrische Libration“, die der Essay in Anspielung auf die lunare Libration, das eingebildete Taumeln des Mondes, im Titel beansprucht, lösen seine metaphorisch überreich orchestrierten Verse nicht ein.
Grünbein buchstabiert sich durch ein ganzes Lexikon der Sinnbilder. Der Mond ist für ihn „ein kalter Koloss“, „der goldne Thron“, „der Gammler des Universums“, „der treue Hund der Erde“, „der alte Pfannekuchen“, „der bleiche Unbekannte“, ein „fahles Monochrom“ oder „ein grauer Riesenpilz“. Er ist direkt aussprechbar, in seiner ganzen Pracht und seinem ganzen Elend – als hätte er seit Eichendorffs Tagen nicht an Strahlkraft eingebüßt. Der Bildungsfuror, mit dem Grünbein seine kulturelle tour d’horizon antritt, führt ihn gerade nicht dazu, die Erfahrung des Mondes zu historisieren.
Zwischen Tokio und Totem Meer, Gesualdos Gesängen und Adam Elsheimers gemalter „Flucht aus Ägypten“, leuchtet er intensiver denn je. Rolf Dieter Brinkmann, der leidenschaftlichste Mondpoet der jüngeren deutschen Lyrik, war in der Aufgabe, die romantische Naturerfahrung jenseits des platten Illusionsbruchs vom Himmel auf die Erde zu holen, mit Gedichten wie dem berühmten „Mondlicht in einem Baugerüst“ da schon einmal sehr viel weiter.
Gregor Dotzauer, Der Tagesspiegel, 19.4.2014
Die Großmacht verschrottet ihre Weltraumfähren
– Einmal ins All und zurück? Dafür haben wir jetzt Durs Grünbeins neuen Lyrikzyklus Cyrano oder die Rückkehr vom Mond: 84 Gedichte über den Blick auf den wandelbaren Trabanten. –
Durs Grünbeins neues Buch kommt aus einer älteren Zeit. Und das nicht bloß mit seinem Titel Cyrano oder Die Rückkehr vom Mond. Solche Doppeltitel, die das „oder“ eher verbindet als trennt, waren einst Mode. Die Aufklärung liebte ihre Ambivalenz. So schrieb Rousseau Émile ou De l’éducation und Lessing seine Minna von Barnhelm oder Das Soldatenglück. Auch Grünbein hat der fast verschollenen Mode schon einmal geopfert: in seinem Langgedicht „Vom Schnee oder Descartes in Deutschland“ (2003). Da sollte der Name des Philosophen die Geburt des Rationalismus aus dem Geist des Schnees beglaubigen. Und siehe, der lyrische Zauber gelang.
Auch Cyrano oder Die Rückkehr vom Mond operiert mit der Dialektik seines Doppeltitels. Der Text beschwört einen Zeitgenossen von Descartes, nämlich Cyrano de Bergerac, einen aufklärerischen Freigeist, der phantastisch-utopische Romane über seine Reisen zu den Bewohnern von Mond und Sonne verfasste. Durch Edmond Rostands Versdrama und zahllose nachfolgende Bearbeitungen des Stoffes durch Film, Musical und Oper ist Cyrano als Figur bis heute populär.
Doch Grünbein hat weder Medienkunst noch Oper im Sinn, sondern das Genre eines Gedichtkreises. Der umfasst 84 Gedichte in acht Teilen und ist in freien Terzinen geschrieben: man darf an Dante denken. Wie Cyrano hat Grünbein den Mond im Sinn; aber nicht als Thema von Science-Fiction, sondern quasi szientifisch. In die Welt des Mondes und der Selenographie begibt er sich nicht als Fabulierer, sondern als poetischer Lexikograph. In einem Personallexikon lässt er bekannte wie höchst entlegene „Mondsüchtige“ Revue passieren. Die Lemmata reichen von Abeneza, Avicenna, Avogadro und Armstrong bis zu Tycho, Ulugh Beg, Wargentin und Zeno.
Grünbein gibt, einschüchternd belesen, den Polyhistor. Doch er lässt den Leser nicht allein. Er kommt ihm mit einem ausführlichen Nachwort zu Hilfe. Man tut gut daran, damit anzufangen. Da spricht der Dichter vom Tag seiner Inspiration fast im Ton der Schöpfungsgeschichte
Am Anfang stand ein Tag in Berlin.
Grünbein mischt sich unter das Sonntagspublikum auf dem Rollfeld des stillgelegten Flughafens Tempelhof. Er plaudert über alles Mögliche, was Mond und Raumfahrt betrifft. In der Nacht nach seinem Sonntagsspaziergang hat der Autor starke Träume. Er wundert sich, dass ihm, dem notorisch Vielgereisten, der Mond, ob in Oslo, Osaka oder auf der Südhalbkugel, immer nur die Identität mit sich selbst gezeigt habe. „Der Mond“ – so paraphrasiert er Gertrude Steins Diktum über die Rose – „war der Mond war der Mond“. In Wahrheit aber zeige er eine lunare Libration, eine wenn auch scheinbare Schwankung der Mondscheibe infolge der elliptischen Form der Mondbahn.
Was uns der wissenschaftliche Terminus soll? Vor allem eins: Der Dichter kann ihn ins Poetische wenden. Wie es die Mondscheibe tut, so oszillieren, je nach Neigungswinkel des Lesers, auch die Wörter und ihre Bedeutungen. Und wenn somit das Gedichtlesen „dem Blick aufwärts zum Mond“ gleicht, tut dies das Schreiben auch. Poesie machen ist wie zum Mond blicken. Anregend wie einst für Schiller der Geruch fauler Äpfel.
Im Nachwort erfahren wir auch Genaueres über Cyranos Leben und Werk; aber eben nur in Prosa. Zwar wird Cyrano auch im Lyrikteil etliche Male erwähnt, aber die neun Zeilen des ihm gewidmeten Gedichts kommen über Anekdotisches nicht hinaus:
Und dann kam er mit Neuigkeiten vom Mond,
Clown, den jeder gern zum Freund gehabt hätte.
Denn sein Unsinn war unbedingt – lustbetont.
Cyrano war also eher Dandy denn Freigeist? Kann eine solche Figur einen ambitionierten Gedichtkreis tragen? Kaum. Man sucht also nach einem Ordnungsprinzip des Ganzen.
Etwas davon mag in den vier Figuren der ersten Gedichtgruppe stecken. Da ist Euklid, der antike Mathematiker, der in den „Elementen“ das mathematische Wissen seiner Zeit systematisiert. Bei den Folgenden mag man etwa in ein Gelehrtenlexikon schauen. „Riccioli“, nämlich Giovanni Batista Riccioli, entwickelte mit seiner Mondkarte die noch heute gebräuchlichen Begriffe der Selenographie. „Tesauro“, nämlich Emanuele Tesauro, lieferte eine erste Theorie der Metapher. „Cassini“ schließlich, der Astronom Giovanni Domenico Cassini, bestimmte die schon erwähnte Libration des Mondes.
Freilich wird der Leser des frisch erworbenen Wissens nicht recht froh. Die Figuren bleiben blass. Grünbein hat sich zu Kurzgedichten von allenfalls achtzehn Zeilen entschlossen, die Miniaturen, Snapshots oder Epigramme nahelegen. Leider sind sie nicht von jenem Zugriff, der sonst Grünbeins Stärke ist. Von der Metapher heißt es etwas schlicht:
Wer kann durchs Fernrohr der Metapher sehen,
In dem das Ferne nah – das Nächste fern erscheint,
Kausalitäten sich verknoten und Ereignisse?
Mancher Name bleibt ohne erkennbare Verbindung mit dem ihm zugedachten Gedicht. Die Kryptik verblüfft, überzeugt aber nicht ästhetisch. So werden unter dem Stichwort „Fermi“ die alten Wörter für Monat (mensis – mani, mén und mon) mit der ägyptischen Zeitrechnung zusammengebracht; zuletzt folgt ein krasser Reim auf „Mond“:
(…) So trocken
War keine Frau, daß sie nicht kreißte wie gewohnt.
Was das mit dem Atomforscher Enrico Fermi zu tun hat, erschließt sich nicht. Immerhin hat Fermi die bedenkenswerte Frage gestellt:
Sind wir Menschen die einzige fortschrittliche Zivilisation im Universum?
Eine Frage auch für Dichter.
Grünbein jedoch präzisiert lieber seine Wissenschafts- und Geschichtsskepsis am Beispiel von Mond- und Raumfahrt. Die Schlussgedichte sprechen vom möglichen Ende der Welterkundung. „Amerika verschrottet seine Weltraumfähren“, heißt es, und ein anderes Gedicht bilanziert:
Der Ehrgeiz ist erloschen. Um die leeren Hallen,
Die feuerfesten Rampen wird das Unkraut wachsen.
Prophetie oder Wunschdenken?
Das Buch ist, wie es nun einmal ist: zwiespältig. Und der Gedanke ist nicht von der Hand zu weisen, dass der Doppeltitel Cyrano oder Die Rückkehr vom Mond genau die Problematik des Ganzen bezeichnet. Er zerfiel schon beim Lesen in seine Teile. Das „oder“ im Titel versöhnt nicht poetisch das Getrennte, es trennt vielmehr das Heterogene: eine rudimentäre Cyrano-Phantasie und einen reduntanten Zettelkasten. Dabei konnte die Poesie nur verlieren. Der Mond steht noch immer über dem Tempelhofer Feld. Doch Cyrano ist uns nicht erschienen.
Harald Hartung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 8.4.2014
Der treue Hund der Erde
– Eine fantastische Reise mit Durs Grünbein in 84 Gedichten zum Mond und wieder zurück. –
Was kümmert uns der Mond? Manche Kinder vielleicht kriegen noch Peterchens Mondfahrt vorgelesen, den vor 99 Jahren erschienenen Klassiker von Gerdt von Bassewitz. Und andere vielleicht kennen den Kindermondklassiker von Hergé, der uns Tim und Struppis legendäre Reise zum Mond zeigt. Auch die liegt schon lange zurück.
Struppi war der erste Hund auf dem Mond. Die ersten Menschen waren Neil Armstrong und Buzz Aldrin, und als sie 1969 mit taumelnden Schritten das ungemütliche Gelände betraten, war die Welt hingerissen. Ein alter Traum der Menschheit hatte sich erfüllt. Doch die Ernüchterung folgte rasch. Seitdem ist der Mond gründlich entzaubert. Wir haben gesehen: Er ist wüst und leer, der Mann im Mond ist eine Schimäre.
Und niemand mehr schreibt ein Lied an den Mond, niemand mehr singt von jener Mondnacht, in der es war, als hätt’ der Himmel die Erde still geküsst, und niemand lässt den weißen Nebel wunderbar aus den Wiesen steigen, wie Goethe und Eichendorff und Claudius es noch vermochten.
Der Dichter Durs Grünbein findet sich damit nicht ab. Cyrano oder Die Rückkehr vom Mond nennt er seinen neuen Gedichtband und will damit sagen: Auf dem Mond gewesen zu sein heißt nicht viel. Zurückgekehrt zu sein und die Erde als die Heimat der Menschen neu entdeckt zu haben: Das ist die eigentliche Sensation.
Nur wer zurückgekehrt ist, kann von seiner Reise erzählen – so wie es Cyrano de Bergerac in seinem postum (1657) erschienenen Bericht von seiner Mondfahrt getan hat. Cyrano, der Erfinder dessen, was man heute Science-Fiction nennt, ist Grünbeins Held, und er widmet ihm ein beglückendes Nachwort. Die Mischung aus Fantastik und Wissen, aus Emphase und Witz, die Cyrano kennzeichnet, beflügelt auch Grünbein. Er ist ein Astronaut, der sich auf den Flügeln der Poesie über die Erde erhebt und hineinfliegt in den Kosmos, hinein in die Tiefe der Mythen, der Wissenschaftsgeschichte und der menschlichen Entdeckungslust.
Grünbein beginnt mit der Heimkehr des Mondfahrers:
Jemand hat ihn gesehen
Hinter den Hangars, wo die Fallschirmseide
Im Herbstwind raschelt
Und dann heißt es:
Getrocknet sind ihm die Freudentränen.
Doch hört man ihn atmen,
konzentriert wie nie.
Er singt uns die Hymne, sein Wiederkehrlied.
Aber hört jemand zu? Schaut noch jemand hin, wenn der Mond, „der alte Pfannekuchen“ strahlt?
In allen Kinohöhlen sitzen Träumer. Jeder übt
Das Staunen dort im Abglanz des Planeten.
Wo sonst zeigt sich die Elegie der Erde ungetrübt?
Es sind ja, so heißt es am Ende des Gedichts, nur noch die Verliebten und Astronomen, die sich für den Mond interessieren. „Der Rest lebt hinterm Mond. Ein gutes Omen?“
Wer den Mond näher betrachtet, sei es durch das Teleskop, sei es auf den Bildern, die das Netz bereithält, den weht etwas Unheimliches an, eine Kälte, eine Ahnung des Nichts. Davon spricht auch Grünbein:
Tycho tritt aus dem Schatten. Der mondene Tag
Fängt mit Enthüllungen an: nacktes Gestein,
Eine Landschaft, von Meteoriten zerhackt.
Das ist das Eine – reines, anorganisches Sein.
So viele Schlaglöcher, Krater, stumme Vulkane,
Und kein Empedokles, der den Weg hinab bahnt.
Licht fällt auf lila Gestein, das für keinen glänzt
Im Wechsel der Jahreszeiten im Niemandsland.
Kosmisches Koma, Geröll ohne Transzendenz.
Tycho ist der Name eines Kraters. Er hat einen Durchmesser von 86 Kilometern und ist 4850 Meter tief. Allein auf der Vorderseite des Mondes gibt es ungefähr 300.000 Krater. Die kartografierten tragen die Namen von Astronomen, Philosophen, Dichtern, Mathematikern und mythischen Gestalten. Anders als im Weltall, wo die fernen Gestirne nur noch Nummern tragen hat man die Landschaften des Erdmondes mit erdähnlichen und menschenähnlichen Zügen ausgestattet. Es gibt das Meer der Gefahren und den Ozean der Stürme, das Meer der Heiterkeit und das Meer der Ruhe, und die Krater heißen Euclides oder Cyrano, Rabbi Levi oder Novalis.
Manche dieser sprechenden Bezeichnungen gehen auf konkrete Vorstellungen zurück, andere sind völlig willkürlich. Und willkürlich sind auch die meisten Titel von Grünbeins Gedichten. Alle tragen sie Namen von Mondkratern. Manchmal kümmert er sich überhaupt nicht darum, ein andermal spielt er auf den Namensgeber an, etwa, wenn er in dem Gedicht „Kepler“ sagt:
Dann kam ein Dämon aus Levania, der zog
Im Kegelschatten der Eklipse – alles schlief,
In jedem Jahr sich einen Träumer mit nach oben.
Er war es, der die Regenbögen bog,
Die See zum Rückzug von den Wattenküsten rief.
Kepler schrieb eine Art Roman, eine fantastische Traumerzählung, Somnium. Sie berichtet von einer Fahrt nach Levania, zum Mond.
So gleicht dieser lyrische Zyklus einem Rätselspiel, einer Schnitzeljagd, und der Leser wandelt auf Grünbeins Spuren, fliegt ihm hinterher, schlägt bei Wikipedia nach, blättert in Lexika, studiert Mondkarten und betrachtet zum Beispiel Adem Elsheimers Gemälde Die Flucht nach Ägypten (1609), auf dem sich der Vollmond nachthell im Wasser spiegelt.
Der Mond stand kopf in jener numinosen Nacht
Mit Joseph und Maria auf der Flucht. Auch sah
Ägypten aus wie ein Stück deutscher Wald.
Im Erdkern Sturm – und doch fand alles Halt:
Die Hirten um das Feuer und im See der Mond…
Ein anderes Gedicht betitelt er „Oresme“, nach einem Krater auf der Rückseite des Mondes, der nach dem Bischof und Naturwissenschaftler Nikolaus von Oresme benannt wurde. Doch nicht von ihm erzählt das Gedicht, sondern vom Meister des Madrigals, von Gesualdo:
Und einer sammelte die Stimmen in der Nacht
Auf seinem Schloß – die sublunarischen Dämonen.
„Sublunarisch“ ist ein schöneres Wort für Gesualdos Musik als „überirdisch“.
Obwohl sich der alte Mondzauber nicht mehr einstellen will – der Dichter bleibt dem Mond gewogen und schreibt am Ende:
Was ist der Mond? Der treue Hund der Erde,
Faktotum, Außenspiegel, schwankender Geselle,
In seiner Kahlheit eine wandelnde Beschwerde.
Ein Gong auch, lautlos, korrodierte Narenschelle,
Ins All gehängt von dem Maestro allen Schwebens.
Die 84 Gedichte sind aphoristische Mini-Essays und philosophische Reflexionen, poetische Flugmanöver und abenteuerliche Exkursionen. Ganz und gar leichtfüßig sind sie. Souverän spielt Grünbein mit der von Dante erfundenen Form der Terzine, lockt mit Endreimen, mit Binnenreimen und Assonanzen, bleibt aber ganz frei und heiter, evoziert den Hallraum der Tradition und denkt, spricht sie fort. Der aparteste Reim, der ihm hier gelungen ist, lautet:
Fern von Ägypten, allerorts, wo nun in drinks
Der Tag sich löste und die Nacht zerran,
Sah er den Mond, vergaß den Flugsand um die Sphinx.
Neoromantische Nostalgie also liegt Durs Grünbein fern, dem wahrscheinlich sprachfähigsten, kenntnisreichsten und am meisten gebildeten Poeten unseres Sprachraums. Ebendies, dass er an die Tradition anknüpft und mit ihr umgeht, als wäre sie nie erloschen, macht ihn manchen Kritikern verdächtig. Sie mögen es nicht, wenn jemand mehr weiß als sie, und der Begriff bildungsbürgerlich ist ihnen ein Schimpfwort.
Das Gedicht bietet Raum für vieles. Nicht allein das zagende Ich hat darin Platz, sondern auch das denkende und forschende. Wer Bildungsreisen nicht verachtet, sollte sich Grünbein anvertrauen, und diese hier ist äußerst erhellend, preiswert außerdem.
Ulrich Greiner, Die Zeit, 3.4.2014
Sind wir nicht alle ein bisschen Luna?
– Wo steckt Ulf Merbold? In seinem Gedichtband Cyrano erkundet Durs Grünbein den Mond. –
Über eine renommierte Hamburger Wochenzeitung schrieb Lorenz Schröter einmal:
Man kann bei den Artikeln eine Zigarettenschachtel auf den ersten Absatz legen und landet dann dort, wo der Artikel beginnt. Falls wirklich was drinsteht.
Was diese boshafte Kritik völlig verkennt, ist gerade das, worauf es ankommt. Nämlich: Den Lesern gefällt’s. Deswegen soll nun auch hier nach der besagten Methode verfahren werden, sie wird im Folgenden sogar hyperimitiert. Das heißt: Wenn Sie, verehrte Leserin, verehrter Leser, in dieser Rezension zu Durs Grünbeins neuem Gedichtband Cyrano etwas über Durs Grünbeins neuen Gedichtband Cyrano erfahren wollen, überspringen Sie doch bitte einfach die nächsten paar Absätze. Vielen Dank.
Der 22. Juli 2007 war ein herrlich heißer Sommertag! Die Menschen gingen spazieren usw., alles war total toll. Und doch war Marcel Reich-Ranicki aus irgendeinem Grund besonders schlecht gelaunt. Die FAS druckte an diesem Tag in ihrer populärsten Kolumne – „Fragen Sie Reich-Ranicki“ – vier Fragen ab. Die erste stellte Sigurd Trebitsch aus Ingolstadt:
Sind Ihnen neben Wedekind weitere Fälle bekannt, in denen Schriftsteller als Werbetexter arbeiteten?
Reich-Ranicki antwortete sinngemäß:
Ja.
Namen nannte er keine. Denn Frau Trebitsch hatte einen unverzeihlichen Fehler begangen. Sie hatte lediglich gefragt, ob ihm solche Fälle bekannt sind. Sie hatte aber nicht gefragt, welche Fälle ihm bekannt sind. Selber schuld.
Die zweite Frage stellte Eckhard Berkenbusch aus Göttingen:
Die deutsche Nachkriegsliteratur ist zum großen Teil furchtbar langweilig. Wie kommt es, dass die deutsch-jüdische Literatur nie langweilig gewesen ist?
Nun wurde Reich-Ranicki zu Recht unwillig:
Dies ist kompletter Unsinn, und ich bin nicht bereit, mich darauf einzulassen.
So bündig antwortete er selten.
Die dritte Frage stellte Antje Prast aus Düsseldorf:
Warum erinnert sich niemand mehr an Otto Julius Bierbaums Zäpfel Kern? Reich-Ranicki murrte:
Das weiß ich nicht, und ich möchte es auch nicht wissen.
Und er schob noch hinterher:
Ist das Buch wirklich von Bierbaum? Ich habe es in keinem Nachschlagebuch und in keiner Literaturgeschichte gefunden.
Frau Prast aber war so klug als wie zuvor.
Die letzte Frage schließlich stellte Jens Grimstein:
Warum bleibt Durs Grünbein immer noch ein Nischenlyriker? Meine Freunde und Bekannte kennen ihn alle nicht.
Nun gab Reich-Ranicki endlich eine klare Antwort:
Vielleicht überfordert er seine Leser. Ihre Bekannten, die nicht einmal seinen Namen kennen, haben keine Ahnung von zeitgenössischer Literatur.
Überfordert Durs Grünbein seine Leser? Machen wir die Probe aufs Exempel. Sein neuer Gedichtband trägt den Titel Cyrano oder Die Rückkehr vom Mond. Gegenintuitiv denkt man: Ein abgetrabteres Gedichtthema als den Mond gibt es ja gar nicht, also muss doch wohl mehr dahinterstecken als die schlechte alte Sehnsucht der Romantiker? Man kommt der Sache wahrscheinlich näher, wenn man es so sieht: Durs Grünbein will seine Leser nicht überfordern, sondern inspirieren. Sein neuer Gedichtzyklus umfasst 84 Gedichte, deren Titel einen flotten Ritt durch die Wissenschaftsgeschichte versprechen: Von „Thales“ und „Kepler“ geht es über „Jules Verne“ bis zu „Armstrong“, es fehlt eigentlich nur noch ein Gedicht mit dem Titel „Ulf Merbold“. Der Gedichtband trägt, wie gesagt, den Titel Cyrano oder Die Rückkehr vom Mond. Vielleicht inspiriert das ja auch den ein oder anderen dazu, sich noch mal den Kostümschinken Cyrano de Bergerac mit dem berühmten russischen Schauspieler Gérard Depardieu anzusehen. Allerdings geht es Grünbein, anders als dem Film, weniger um die Biografie Cyranos, eines Science-Fiction-Autors aus dem 17. Jahrhundert, als vielmehr um Cyranos wunderbaren Roman Die Reise zum Mond.
Dem anregenden Essay am Ende ist zu entnehmen, was genau Grünbein an Cyranos Erzähler so fasziniert: Er sei der Erste gewesen, der „den Aufstieg zum Mond in aller Stille plante, während er die Rückkehr an die große Glocke hängte als das wahre Spektakel“. Nun sind, wie bei Grünbein fast nicht anders zu erwarten, viele der Gedichte, in die er diese Faszination umsetzt, recht materialüberfrachtet, im Grunde ist jedes Gedicht ein komprimierter Essay. Und doch wirken sie hier zwischendurch immer wieder einmal – dem Sujet angemessen – schwerelos, sogar andeutungsweise witzig, etwa wenn sie von „Außermondischen“ künden oder Teleskope „ins Überall“ äugen. Erfreulich unromantisch wird es schließlich, wenn dann noch Quirinus Kuhlmann oder Kühlmann ein Denkmal gesetzt wird. Über diesen halben Zeitgenossen Cyranos und „Kühlpsalter“-Autor, einen wunderbaren panreligiösen Utopisten bzw. Spinner, der halb Europa durchstreifte, um sein der Höllenhitze entgegengesetztes himmlisches Kühlsystem zu propagieren (bis man ihn in Moskau verbrannte), heißt es:
immer folgte er dem Mondkalender
Da sieht man, wohin so was führen kann.
Joseph Wälzholz, Die Welt, 12.4.2014
„Ich glaube an die Kunst, als letzte Religion“
– Der Dichter Durs Grünbein spricht im Interview über seine Immunität gegen Ideologien, falsche Utopien und Reisen zum Mond. –
Was macht der vielleicht grösste lebende Dichter deutscher Sprache, der Mann, den die FAZ einen „Götterliebling“ nannte, nach einer Lesung aus seinen Gedichten, am Rande eines Utopie-Festivals auf dem Monte Verità? Er führt ein Tratschgespräch mit Kollege Joachim Sartorius in der Aussenanlage seines Hotels in Ascona über die deutsche Lyrik-Szene. Unwirtlich verhüllen die meisten Sitzplätze hier eine Art Stuhlverkleidung – man sähe es wohl lieber, wenn die Herrschaften drinnen trinken würden. Durs Grünbein (51) raucht eine Zigarette, filterlos, dann raucht er eine Zigarre, dazu trinkt er Rotwein. Die Uhr geht gegen zwölf, da verabschiedet sich Sartorius: Gute Nacht, und das Interview beginnt. Mit geschlossenen Augen redet Grünbein vor sich hin, den eigenen Worten, über Utopien und den Mond, folgend.
Benedict Neff: Herr Grünbein, Sie sagen, „Utopie war für mich die Planung von Verlusten“. Können Sie das genauer erklären?
Durs Grünbein: Utopie ist für viele im Westen ein abstrakter Ausdruck, eine reine Papierfantasie, ein Philosophentraum, der keinem wehtut. Für unsereins aber, die wir hinter dem Limes aufwuchsen, war sie eines Tages bittere Realität. So wurde Utopie, ob es mir gefiel oder nicht, zu einem Lebensthema. Was geschieht, wenn die Politik den Traum der Geschichte zu erfüllen versucht? Mir ist aufgefallen, dass alles, was mich betraf, seit ich geboren bin, damit zu tun hat, dass andere Menschen radikale Ideen hatten, wie eine Gesellschaft zu verbessern sei. Man wollte den alten Menschen mit den Wurzeln ausreissen und ihn von Grund auf erneuern. Das 19. Jahrhundert hatte die Pläne und die Manifeste dafür geliefert, im 20. Jahrhundert wurde das Experiment ausgeführt. Am Anfang waren es nur Einzelne, die wurden Kommunist oder Faschist, so wie man einen Schnupfen bekommt, und der andere hat ihn nicht. Dann aber wurde daraus eine Epidemie, eine Massenbewegung, ein System aus Parteiprogrammen, Strassenkampfformen, politischen Aktionen. Als ich dazukam, war alles bereits Resultat, und ich hatte nicht darum gebeten. Utopie funktionierte nur mit gefälschten Wahlen. Der sozialistische Staat war nun da, die neuen Gesetze gab es, eine neue Architektur, ihr zentrales Bauwerk war die Berliner Mauer. Der Verlust, den ich meine, war ein Verlust von Lebensmöglichkeiten, von körperlicher Freiheit, gedanklicher Leidenschaft.
Neff: Waren Ihre Erfahrungen mit dem Sozialismus in der DDR damals schon explizit mit dem Begriff der Utopie verknüpft?
Grünbein: Der Begriff war von Anfang an da. Er tauchte im Schulunterricht auf und war dort absolut positiv besetzt. Man sprach ihn im Zusammenhang mit den marxistischen Ideen aus, die man auch utopische Ideen nannte. Bemerkenswert war, dass viele dieser utopischen Ideen in der DDR als schon verwirklicht galten. Die Regierung gestand zwar ein, dass noch nicht alles perfekt sei, dies und jenes noch weiterentwickelt werden müsse, aber mit der Diktatur des Proletariats war das Wichtigste schon verwirklicht. Seit der Schulzeit fühlte ich mich als Geisel einer Entführung nach Utopia. Ich hatte keine Wahl: Ich musste mit den Geiselnehmern über deren Vorstellungen diskutieren. Das war eine vollkommen erpresserische Situation.
Neff: Utopie erlebten Sie also primär als Propaganda-Begriff?
Grünbein: Keineswegs. Die Utopie war ja ganz real, sie steckte in allem. Sie war die Luft, die man atmete, der seltsame Geschmack des Wassers, das überall aus den Hähnen kam. Die Verfassung, das Militär, sämtliche Institutionen exekutierten die Utopie auf allen Ebenen und quer durch die Gesellschaft. Die Utopie war die Nahrung, die man täglich zu sich nahm – eine Art Hundefutter für Menschen.
Neff: Dennoch sagen Sie, dass Sie an die Kunst als letzte Utopie glauben. Wie sieht diese Utopie aus?
Grünbein: Ich glaube an die Kunst, als letzte Religion für den heillos individualisierten Menschen. Sie ist das Einzige, was den modernen, mit allen Wassern der Aufklärung gewaschenen Menschen einen überraschenden Sinn vermittelt. Sie kann Trost, Erkenntnisgewinn, punktueller Halt sein. Sie gibt uns etwas diesseits der Religionen mit ihren starken Zwangsaspekten und Geboten. Die Kunst stiftet einen Zusammenhang zwischen Menschen, der über die ethnischen Zuordnungen und spirituellen Identitäten hinausgeht, mit denen die Religionen die Menschen zusammenschweissen. Was die Menschen innerlich am meisten beschäftigt, sind Kunsterlebnisse. Weil dies der letzte einigermassen freie Erlebnisraum ist.
Neff: Hat der Markt die Kunst denn nicht auch schon vollkommen vereinnahmt wie alle anderen Bereiche des Lebens?
Grünbein: Als Autor hat man irgendwann verstanden, dass es um den eigensinnigen Moment des Schreibens geht. Der gerät dann an die Öffentlichkeit, und auf diesem Weg erreicht man hier und da und über grosse Entfernungen hinweg bis nach Kyoto, Santa Fe oder Lemberg, durch den gesteuerten Betrieb hindurch, seine Leser. Das funktioniert nach dem Prinzip Fernstenliebe, ein Wort, das Nietzsche aufgebracht hat.
Neff: Fernstenliebe im Gegensatz zur christlichen Nächstenliebe?
Grünbein: Fernstenliebe ist, wenn sich Menschen über Jahrhunderte und grosse Zwischenräume hinweg begegnen und metaphysisch ergreifen. Wenn Sie heute ein paar Zeilen von Montale, Mandelstam oder Ovid lesen und die Lektüre Sie unmittelbar anspricht. Dass es das gibt, ist die gute Nachricht. Ein Literaturfestival wie dieses auf dem Monte Verità hat den Charme, dass Begegnungen stattfinden. Begegnung bedeutet immerhin eine Möglichkeit: Es treffen sich Menschen, die ein bestimmtes Interesse verbindet. Das sind dann fast schon utopische Momente. Wir könnten die Welt gemeinsam verändern, aber am andern Tag reisen wir lieber ab.
Neff: Sie sagten einmal, das System der DDR habe Sie vergiftet. Welches Gift wirkt in Ihnen nach?
Grünbein: Ich habe gesagt, dass mich die Erfahrung der Diktatur immunisiert hat. Ich bin nun einigermassen resistent gegen Ideologien aller Art, gegen Utopievorstellungen, von denen wir wissen, dass sie ins Nichts führen oder ins Verderben vieler. Ich habe meine Lektion gelernt und ich bin übrigens dankbar für diese Erfahrung. Als ich in den Westen kam, war ich verblüfft, wie viele Linke dort immer noch so taten als ob. Als ob wir nicht begriffen hätten, was aus den radikalen Theorien wird, wenn die Macht sie ergreift. Ich habe mit Neo-Stalinisten und Leninisten aller Couleur gesprochen, die kamen aus bürgerlichen Verhältnissen und fanden die extremen sozialistischen Theorien immer noch bedenkenswert und hoch spannend. Man sagte Gulag, und sie verdrehten die Augen. Einige hatten noch nicht einmal das Stichwort Kolyma gehört, und kaum einer kannte Warlam Schalamow, den grössten Erzähler der sowjetischen Straflager. Von der biblischen Realgeschichte der marxistischen Utopie wussten sie nichts.
Neff: Sie sprechen jetzt von den 90er-Jahren?
Grünbein: Ja, da ist mir das oft begegnet, in geradezu böswilliger Form. Wir sprechen von den Auschwitz-Leugnern, der schärfsten Form antisemitischer Geschichtsverfälschung, aber was ist mit der Kolyma-Vergessenheit in weiten Teilen der westeuropäischen Linken? Dabei wollten diese Leute uns, den Boatpeople der realsozialistischen Geschichte, weismachen, wir hätten leider einfach nur im falschen Kino gesessen.
Neff: Aus Ihren Erfahrungen leiten Sie eine gewisse antiutopische Moral ab?
Grünbein: Es gefällt mir nicht, dass die grossen Ideen der Menschheit exekutiert werden auf Kosten der Körper wehrloser Menschen. Sicher, nicht alle landen im Gulag, aber es reicht ja, wenn alle Bürger eines Staates ein Leben führen müssen, das sie niemals so wollten. Utopie schaltet, wenn es nach dem Willen einer Weltverbesserungselite geht, jede Form der Mitbestimmung aus. Sobald man Politiker zu derart radikalen Lösungen ermächtigt, steht man als Einzelner auf dem Spiel. Das betrifft übrigens auch die Utopisten selbst: Der Altbolschewist war das erste Opfer des Stalinismus nach dem Muster: Die Revolution frisst ihre Kinder. Die Westlinken, die ich kennenlernte, wären am nächsten Tag sofort erschossen worden. Das Grundübel aller Utopien ist, dass sie nur unter restriktivsten Bedingungen funktionieren. Wer Schwierigkeiten macht, wird zurückgelassen. Er muss geopfert werden, damit der Rest es schafft ins Gelobte Land. Utopie hat immer mit Selektion und Opfern zu tun, sie organisiert die Verluste, die notwendig sind im Namen des höheren Ziels.
Neff: Sie sind ein Fan dystopischer Filme. Was fasziniert Sie an diesen Filmen?
Grünbein: Mich begeistern die schmutzigsten Fantasien über das Schiefgehen unserer Kultur. Da kann es mir gar nicht wild und trashig genug zugehen. Einer meiner Lieblingsfilme ist die südafrikanische Kinosatire District 9 von Neill Blomkamp. Ein riesiges ausserirdisches Raumschiff steht wie ein Menetekel über Johannesburg, und heraus kriechen lauter Aliens, die den Weissen mehr Probleme bereiten als alle Schwarzen in den Townships vor ihrer Haustür. Das ist die Anti-Utopie par excellence.
Neff: Und diese Filme bedeuten Ihnen mehr als alle Wagner-Opern zusammen?
Grünbein: Dystopie entspricht meiner Lebenserfahrung, ich fühle mich gemeint und frohlocke sofort. Seltsamerweise mag ich es, wenn alles kaputtgeht, was die Ordnungshüter der Geschichte sich für uns ausgedacht haben. Ich verfolge das wie ein Länderspiel, wo ich der Mannschaft, die am übelsten foult, den Daumen halte. Gegen die klassischen Science-Fiction-Filme habe ich hingegen eine regelrechte Aversion. Die frühen Science-Fiction-Filme hatten alle so etwas Idealistisches: Hinaus, hinaus in die neuen Räume! Mein Gott, was für ein Stumpfsinn. Mittlerweile überwiegt selbst in diesem Genre die Epik des Dystopischen: Der letzte Mensch in New York nach einem Fallout. Oder die Reise auf einen anderen Planeten, und sofort führt das zu einem einzigen Hauen und Stechen und nur der Skrupelloseste darf überleben. Na danke, das ist ja genau die Erzählung, die meiner heutigen Realität entspricht – von der ich glaube, dass sie für niemanden gut ist. Nehmen wir nur Die Tribute von Panem. Eine vollkommen faschistoide Fantasie, auf die aber leider meine eigene Tochter hereinfällt. Die Vorstellung, dass nur die Stärksten überleben sollen, ist der reine Horror für mich – und die Jugendlichen beten dies eins zu eins nach. Die Gesamtfantasie unserer Gesellschaft geht leider genau in diese Richtung.
Neff: Sprechen wir über Ihren neuen Gedichtband. Es ist ein Buch über den Mond. Was kann man darüber noch schreiben?
Grünbein: Ein früher Höhepunkt in meiner Kindheit war die Mondlandung: der erste Mensch auf dem Mond. Das war etwas Besonderes, das so nie wiederkehrt, ein symbolischer Menschheitsmoment. Zu begreifen, was dieser Moment bedeutete, darum geht es mir in dem Buch. Mir scheint, der Augenblick, da die beiden Amerikaner da oben waren, ist bis heute nicht endgültig ausgedeutet. Ein surrealistisches Kapitel der Geschichte: Es war der Höhepunkt all der Raumfahrt- und Raketenprogramme, auf das alles hinauslief. Und wie wir heute erst begreifen, ein rein symbolischer Akt, der mit einer Pressemeldung beendet war.
Neff: Ihre Gedanken kreisen ja vor allem um das Motiv der Rückkehr.
Grünbein: Die Rückkehr ist das Grundmotiv. Die Vertreter der Menschheit sind aufgebrochen, um zurückzukehren. Kolumbus ist aufgebrochen, um zurückzukehren. Dieser zweite Teil der Reise wird immer unterschlagen. Es wird so getan, als sei der Aufbruch das Entscheidende. Aber die Rückkehr ist wahrscheinlich viel entscheidender. Kolumbus kehrt zurück, und Europa besinnt sich zum ersten Mal auf sich selbst. Man kehrt zurück von der Welteroberung, und siehe da, alle bisherigen Mythen, Erzählstoffe haben sich über Nacht verändert. Auf einmal gibt es den Pfeffer, die Kartoffel, die Tabakspfeife, und nichts ist mehr, wie es war. Das ist ein dialektischer Sprung: aufbrechen, um zurückzukehren. Die ganze Anstrengung der sogenannten Entdecker diente wohl nur dazu, uns allen gemeinsam ein Gefühl zu geben von diesem Erdball. Magellan war der Erste, der die Welt umsegelte. Danach hatte man begriffen, es geht einmal rundherum. Dreihundert Jahre, was ist das schon, in so kurzer Zeit hat sich die ganze Transporttechnik beschleunigt, auch die Luftfahrt war nur eine Frage der Zeit, dann kam die Idee der Rakete auf, und damit konnte man zu den Sternenräumen reisen. Alles läuft auf eine Vertikalbewegung hinaus. Ohne Raketentechnik keine Marsmission. Dabei bleibt es doch so: Niemand von uns reist vertikal. Wir alle kleben in unseren Normalleben an der Erdoberfläche.
Neff: Das Buch heisst Cyrano oder die Rückkehr vom Mond. Cyrano personifiziert diesen Rückkehr-Gedanken. Sie schreiben, er sei ein Mann, der den Aufstieg zum Mond in aller Stille plante und die Rückkehr an die grosse Glocke hängte.
Grünbein: Man muss zurückkehren, um etwas erzählen zu können, darin besteht die Dialektik des Mitteilens. Einer macht eine Reise zum Südpol, ein anderer geht um den Küchentisch wie keiner zuvor, ein Dritter lotet das Reich des Begehrens aus, erzählt uns etwas von den Entfernungen zwischen Mann und Frau, zwischen Antike und Gegenwart, zwischen den Quellen des Blauen Nils und dem Bach vor seinem Geburtshaus in Thüringen, darum geht es beim Erzählen. Dabei gibt es so viele Unternehmen, die nicht erzählt wurden, weil die Leute verloren gingen auf ihren Reisen.
Neff: Nun ist es ja so, dass die neuen Raumfahrten mit der Idee eines No Returns spielen. Rückkehr wird fraglich.
Grünbein: Die heutigen Astronauten müssen so weit ins All vorstossen, dass ihre Rückkehr ungewiss ist. Die nächste Frage ist, ob es heute noch Menschen gibt, die sich für solche Expeditionen bereit finden. Den möchte ich kennenlernen, der einen Vertrag unterschreibt und sagt: Schickt mich hinaus zum Mars, zum Saturn! Darum sind die kommenden Expeditionen so schwer zu motivieren. Wo sollte das Heldentum herkommen, das ein Leben investiert ohne die Gewissheit, rechtzeitig zum Dinner mit der Queen wieder da zu sein.
Neff: Ist der Mond entmystifiziert seit der Mondlandung?
Grünbein: Ja und er ist auch ausreichend metastasiert und durchmedialisiert. Wen das interessiert, dem macht die Nasa exakte Mondkarten zugänglich. Wer ein Mondfreak ist, kann ab jetzt alles im Netz studieren.
Neff: Würden Sie gern auf den Mond fliegen?
Grünbein: O nein, ich bleibe lieber zu Hause. Das Rendezvous mit dem Mond ist eine platonische Dichterliebe. Sie gehört ins Reich der Phantasmagorien. Er war und ist uns ein blosser Vorwand für unsere Sehnsucht. Das war er auch für die Dichter aller Zeiten – oftmals ein reiner Kunstgriff, ein Ablenkungsmanöver, um die Erzählung in Gang zu setzen. Er ist das Nullobjekt vieler Gedichte, ein einsilbiger Wohlklang. Wenn einer fragt, worum geht es in Ihren Gedichten, worum dreht Dichtung sich überhaupt, könnte man immer antworten: Um den Mond, es geht um den Mond. Seit den Apollo-Missionen ist der Mond en detail kartografiert. Und doch wird er uns ewig fremd bleiben.
Darum finde ich es bemerkenswert, dass tatsächlich schon ein paar sehr reiche Leute die Reise dorthin gebucht haben. Einige Millionäre werden sich demnächst den Kurztrip leisten können. Die erste Mondfahrtmission war eine enorme zivilisatorische Leistung. Jetzt aber ist den Raumfahrtbehörden das Geld dafür ausgegangen, vielmehr sie investieren in andere Projekte. Das ist die Stunde der Privatwirtschaft, die den Mond als Touristenziel vermarktet. Was aber erfährt man auf einem Raketenausflug? Das Erlebnis der geringeren Schwerkraft – man kann höher springen und seltsam taumelnd herumhopsen als Michelin-Männchen dort oben. Dann den Staub – man sinkt mehrere Zentimeter tief ein. Die gespenstischen Lichtverhältnisse, die extrem monotone Landschaft. Da ziehe ich einen Urlaub am Mittelmeer vor.
Basler Zeitung, 30.5.2014
Der Er ist der Mond, auch wird er bewohnt
– Was ist ein Mondkänguruh? Und wieso versteht man Wörter und weiß trotzdem nicht, wovon die Rede ist? Gedanken zu Durs Grünbeins Mond-Gedichte-Buch: Cyrano oder die Rückkehr vom Mond. –
Ich verstehe kein Wort. Falsch, ganz falsch. Ich verstehe – fast – jedes Wort, aber dennoch verstehe ich nichts. Das beginnt bei der Überschrift. Riccioli sind Locken, aber schon Hangar muss ich nachschlagen: „Ein Hangar ist eine große Halle aus Metall, Holz, Beton oder ähnlichem Material für Flugzeuge aller Art sowie Hubschrauber, Luftschiffe und Space Shuttles“, erklärt Wikipedia auf.
Was haben die Locken mit einem Flugzeug zu tun? Was ist ein Mondkänguruh? Wer ist dieser er, der zurückgekehrt ist, dem die Freudentränen getrocknet sind und dem die Erdenluft sagt, es gibt nur sie?
Da das Buch Cyrano oder die Rückkehr vom Mond heißt, scheinen die Fragen leicht zu beantworten. Vom Spätheimkehrer Cyrano de Bergerac ist die Rede, der 1657 einen Roman veröffentlichte über „Die Staaten und Reiche des Mondes“.
Aber was heißt „ist die Rede“? In Wahrheit hört der Leser eine Stimme, die ihn einlullte, wenn nicht alles, was sie sagte, bei aller Präzision der Worte so verwirrend unklar wäre. Da ist der freundlich einnehmende Klang der Verse und da sind die wilden Assoziationsketten, die dagegen pochen und hinausdrängen aus dem meist reimlosen, maßvollen Einerlei.
Die Bedeutungen bleiben in der Schwebe. Wer sich dagegen nicht wehrt, wer nicht verzweifelt alles tut, um am Boden haften zu bleiben, wer also an der gegen die Evidenz dieser Verse an der Idee festhält, jedes Wort habe nur eine einzige Bedeutung, der hebt ab. Mit einem Mal ist ihm klar: Es ist ein Mondgedicht. Der Er ist der Mond.
Die ersten drei Zeilen sind mit einem Male nicht mehr rätselhaft, sondern einfach schön:
Er ist zurückgekehrt. Jemand hat ihn gesehen
Hinter den Hangars, wo die Fallschirmseide
Im Herbstwind raschelt, ein Ballon sich bauscht
Jetzt schlage ich das Mondkänguruh nach. Es entstammt einem Kinderbuch des Jahres 1987 von Simon und Desi Ruge. Dort hält es den Mond im Gleichgewicht. Ich schlage auch gleich nach, was ich zu wissen glaubte. Riccioli sind hier keine Locken.
Es geht um den Theologen und Astronomen Giovanni Battista Riccioli (1598–1671). Und, so zeigt sich, auch nicht um ihn, auch nicht um Gassendi, Grimaldi oder Sacrobosco, alles Wissenschaftler, deren Namen über den Gedichten stehen. Nach ihnen wurden Mondkrater benannt.
Die Namen vervielfältigen die Spielmöglichkeiten. Da ist das Gedicht mit dem Titel „Love“. Wer Bescheid weiß, erwartet Anspielungen auf den Mathematiker Augustus Edward Hough Love (1863–1940). Stattdessen:
Schlaflos liegen viele nachts auf ihren Laken, nass,
In Gedanken an den mörderischen Karneval
Auf den Straßen, halten einsam Sternenwache.
Aber vielleicht gehören auch Mathematiker zu denen, die nachts allein, nass und schlaflos auf ihren Laken liegen. Mister Love war unverheiratet. Seine Schwester führte ihm den Haushalt.
Ein Gedicht sei ganz zitiert, „Leibniz“:
Schneewolken bargen ihn, wenn im Gebirge
Musik das Thema Mond anschlug im letzten Satz.
Dort ging er, der Romantiker, ins Unbewusste,
Ging da und variierte, Satz für Satz, den Mond,
Bis von ihm nur der Laut blieb, mundgeblasen, Glas.
Durch viele Sprachen lief dasselbe Wispern
Der Wanderer von Berg zu Tal. Der stille Schein
Drang durch die Wolken, gab als Klang den Sätzen
Die Richtung: Dichtung – Imperator de la lune.
Das „Richtung: Dichtung“ mag ich überhaupt nicht. Aber ich könnte es auch gerade mögen. Es zerstört kantenscharf die Romantik von Wanderer, Berg, Tal, Wolken, Klang und stillem Schein.
Wäre es schöner, wenn man wüsste, wer da durchs Gebirge geht? Wahrscheinlich. Schließlich würde ich trotzdem nicht vergessen, bei Durs Grünbeins Zeilen an Beethoven, an den Vierwaldstätter-See, an Nietzsche zu denken, und an Isoldes „unbewusst – höchste Lust“.
Andere werden andere Assoziationen haben. Leser sind frei. Sie sind es aber nur dann, wenn sie in jenem Schwebezustand bleiben und nicht bereit sind, sich oder gar den Autor festlegen zu lassen aufs Definitive.
Durs Grünbein schreibt:
Vielleicht geht es ja um die flüchtige Teilbarkeit der Worte. Sie gleichen den Atomkernen, die von Bedeutungsteilchen umkreist werden, und nie lassen Ort und Impuls, Ausdrucksposition und Gefühlsanlass, sich punktgenau und deckungsgleich bestimmen.
Das Nachwort erzählt vom Ursprung der Idee, ein Buch über den Mond zu schreiben. Es war die Öffnung des riesigen Geländes des ehemaligen Flughafens Berlin-Tempelhof fürs Publikum. Mit einem Male so viel Raum. Unten. Aber auch oben.
Für Lukrez bestand die Welt aus Atomen und der Leere dazwischen. Wenn plötzlich mitten in der Stadt so viel Abstand entsteht, dann bekommt diese Einsicht eine Wendung ins Makroskopische. Mit einem Male wird klar, wie weit wir auseinander sind, wie einsam dabei und doch wie abhängig von einander.
Er fühlte sich der Schwerkraft ledig, startbereit
In höhere Regionen. Strahlen zogen ihn hinauf
In eine äußere, neuweltliche Unendlichkeit –
Die sich im Innern wiederfand als Blutkreislauf.
Ein großes Tier war dieses All, von Stern zu Made
Derselbe Zwischenraum. Man konnte in ihm baden.
Arno Widmann, Frankfurter Rundschau, 15.9.2014
Großes Tor und kleine Tür
– Mondsüchtig: Der Gedichtzyklus Cyrano von Durs Grünbein. –
Azophi, Macrobius, Sasserides, Inghirami. Klangvoll fremde Namen, wie auch Endymion, der ewig schöne Liebhaber der Mondgöttin Selene. Namen von Mondkratern, Dutzende, sie stehen über den Gedichtanfängen – wie auch Namen von kühnen Träumern ins himmlisch Unbefestigte: Kepler, Verne, Ziolkowski, Fermi, Gagarin, Armstrong.
Cyrano oder Die Rückkehr vom Mond heißt der neue Gedichtzyklus von Durs Grünbein. Der Dichter durchquert das große Ganze mit Blick für die geringen Dinge, immer begegnen in diesen Versen das Mächtige und das Marginale einander. Die Sprache schwingt, sie schlägt weite Assoziationsbögen. Sie spielt mit Klugheit, bekennt sich souverän und immer wieder überraschend gleichniserregt zu einer enzyklopädisch befestigten Lust am Denken, am Durchwandern der Geografien und Bildungsgüter. Gelassen und offen für eine Flut von Fragen nach Materie und Gedächtnis.
Der Dichter entwirft ein Panorama der Mond-Süchtigkeit durch alle Zeiten hindurch, er stimmt einen Gesang an auf eine berauschend romantische Verlorenheit, die in Traum- und Tateinheit mit wissenschaftlicher Intelligenz alle irdische Gebundenheit aufkündigt. So, als lösten sich sämtliche Enttäuschungen übers Leben spielerisch auf in den Fantasien von größtmöglicher Entfernung. Als gründe sich Rettung in jener höhenfliegerischen Vorstellung, die uns aus der Banalität und Gleichförmigkeit unserer nichtigen Verrichtungen heraushebt. Abenteuer, Reise, Expedition. Wir fahren hinaus und wollen davon lesen – weil wir nicht akzeptieren wollen, dass aller gegenwärtige Aufruhr unserer Sinne, unserer Gedanken, unserer Seinskraft letztlich eingebettet bleibt in eine ewige Gleichgültigkeit der Welt gegenüber allem, was wir waren, wollten, wirkten.
Das Reisen als sinnerschütternde „Pause im Sterben“, wie Durs Grünbein in einem Essay schrieb. Aber hat er nicht auch schon geschrieben, Reisen sei „ein Vorgeschmack auf die Hölle“? Denn:
Dem Körper ist Zeit gestohlen, den Augen Ruhe,
das genau Wort verliert seinen Ort
Sich abzustoßen, bleibt zweischneidig. Es ist eben nicht zu mindern, dies Spannungsfeld zwischen dem großen Tor, das wir frech-forsch aufstoßen, und der kleinen Tür, an die wir bittend klopfen. Der Mond als nächtlicher Intimfreund unserer Blicke – und zugleich doch der kältestmögliche Spiegel, in dem wir uns zurückgeworfen sehen ins Grund-Lose unserer Existenz.
Den vorliegenden Zyklus beendet Grünbein mit einem Aufsatz, „Lyrische Libration“; darin schildert er die Mondfantasien des Cyrano de Bergerac – mit besonderem Augenmerk auf die Euphorie, mit der dieser „Gedankenreisende“ seine Rückkehr aus dem Weltraum schilderte. Ein laut freudiger Besessener der Heimkehr und somit für Grünbein ein Pionier der Relativität – jener wichtigsten Voraussetzung möglichen Glücks.
Immer wiederkehrendes Widerspruchspaar im Buch: das Wirkliche und das Mögliche. Da ist durchdringend von Aufbrüchen die Rede, von gefährlichen Finsternissen aller Wege, von der Kraft einer Natur, die am Ende unserer Kultivierungsmühen doch nichts weiter bleibt als sie selber. Wir in ihr: eine Verwitterungsgemeinschaft. Visionen vom glücklichen Beginnen kreuzen sich mit Versen rund um jene Gefangenschaft des Menschen in unausweichlichen Gesetzen seines Verschwindens – im Kreislauf einer größeren Ordnung der Dinge.
Immer schon war dem Poeten Grünbein die Heimat ein Transitraum für Ausfahrten in die Welt – die freilich hinter allen glänzenden Fassaden Pompeji ahnen lassen; im Atemzug, der den Ursprung singt, zittert immer eine Prophetie vom apokalyptische Ende mit.
Die Poesie Grünbeins ruft den Rationalismus an und verwandelt ihn zurück ins Geheimnis. Aufklärung als Anlass, um über die Unergründlichkeit der Existenz zu befinden. Der Aufklärungsgegenstand, einverleibt ins grundsätzlich Unerklärliche. Dichter gelten dem Dresdner als „verlorene Wissenschaftler, die ohne Fußnote arbeiten“. Und immer ist der Fortschritt etwas, das wettgemacht werden muss „im Trümmerregen“. Im „Schlepptau der Träume“: Schrott.
Der Dichter spricht im erwähnten Aufsatz von der Kraft der Lyrik, das Wort in Schwingungszustände zu versetzen, die das Sprachempfinden des Lesers elektrisieren, indem sie die Unterschiede zwischen Nähe und Ferne aufheben. Den Mond anschauen, als sei das Sehen dem Hören ähnlich, und was wir da hören, ist das Rauschen der Abgründe – die sich auch in den Höhen auftun, die wir fortwährend versuchen. Müssen wir sie denn versuchen? Mit dieser Frage bleibt der Dichter ein Mensch im Stande der Unentschiedenheit. Wie der wahre Leser.
Hans-Dieter Schütt, neues deutschland, 12.3.2014
Die Aufgabe der Dichtkunst
– Zu Durs Grünbeins Cyrano oder Die Rückkehr vom Mond. –
Die Aufgabe der Dichtkunst ist wesentlich, so viel ist evident. Desweiteren ist aber weniger offensichtlich, worin sie bestehe in ihrer Wesentlichkeit. Nun, man pointilliere sich einen Pfad in die Leinwand. Durs Grünbein, vermutlich der bekannteste deutsche Dichter, den man 2014 noch einer Vivisektion unterziehen kann, hat einen neuen Gedichtband einschließlich eines Begleitessays verfasst. Er handelt vom Mond, und er portiert eine These. Systematisch werden die Krater des Mondes abgeklappert und unter den Titeln ihrer Namen von Thales bis Armstrong bedichtet. Einer der Krater heißt Cyrano, was Grünbein den Anlass gibt, Cyrano de Bergerac einzuweben, den selbst erfabelten Mondbesucher des 17. Jahrhunderts. Wie Grünbein in seinem Essay nahelegt, war Cyrano besonders bedacht, seine Rückkehr auf die Erde zu verhandeln. Daraus zieht Grünbein in seinen Gedichten die folgende Konsequenz, die These eben des Buches: Der Mond ist auf der Erde interessant, aber nicht auf dem Mond. Als Sehnsuchtsort und Projektionsfläche ist er erledigt, sobald der Mensch durch sein Geröll stapft.
Damit wäre ein möglicher Aufgabenbereich der Literatur gefunden, nämlich, eine Aussage über die Welt zu machen. Entsprechend neigt Grünbein auch zur Philosophiererei:
Wer kann durch das Fernrohr der Metaphern sehen,
In dem das Ferne nah – das Nächste fern erscheint,
Kausalitäten sich verknoten und Ereignisse?
Wie vieles übereinstimmt im Verschiedensein.
(„Tesauro“, S. 12)
Ein großes Tier war dieses All, von Stern zu Made
Derselbe Zwischenraum. Man konnte in ihm baden.
(„Isidorus“, S. 17)
Wußte er von der Vielheit der Welten? Wie Läuse
Den Wald auf dem Kopf eines Bettlers bewohnen,
Wirbelte mehr als nur ein Volk um die Sonne.
(„Grimaldi“, S. 18)
Selbstverständlich möchte Grünbein ab und an den Titelhelden der Krater und Poeme seine Reverenz erweisen, indem er wiedergibt, was er für ihre denkerischen Kernpunkte hält. Aber das Verfahren wirkt zufällig. Manchmal geht er auf die Genannten ein, dann wiederum enthält er sich jeder Bezugnahme. Unter anderem deshalb, aber auch, weil nur schon ein Ansatz von Distanzierung von den Paraphrasen, sofern es sich denn um solche handelt, nicht zu erkennen wäre, scheinen die philosophierenden Passagen direkt vom Dichterich verantwortet. Leider bestehen sie aus nichts als möchtegern-profundem Nonsense (siehe oben); sie sind einfach enorm schlechte Philosophie. Sollte der Wert der Literatur sein, schlechte Philosophie anzubieten? Ich hoffe nicht. Parmenides hat seinerzeit gute Philosophie gedichtet, und es wäre vielleicht mit Mühe denkbar, dass heute jemand Ähnliches wieder geschehen lassen könnte, obwohl ich um die Existenz eines solchen Ambidextren nicht weiß. Jedenfalls ist Grünbein keiner von ihnen (siehe oben). Ich würde vorschlagen, die Philosophie den Philosophen zu überlassen und die Kosmologie den Physikern. Unsinnige Pseudoweisheiten, sofern ernst gemeint, sind unlesbar und verderben Gedichte.
Aber natürlich erschöpft sich Grünbein nicht im Maximenhaften. Vielleicht die am weitesten verbreitete Forderung an die Lyrik ist, dass sie Erlebnisse und Gefühle fassbar machen soll, die allen bekannt sind, aber gemeinhin nur vage getroffen werden. Bei Grünbein fungiert der Mond als Bezugspunkt für ein solches gemeinschaftlich menschliches Fühlen. Einerseits bietet er durch seine Ubiquität die Geborgenheit eines Fixpunkts, andererseits stellt sich angesichts seiner Kälte und Unvergänglichkeit Verlorenheit ein:
Vielleicht war er der Ruhepunkt, den alle suchten
Ein Leben lang, und dann doch bald vergaßen.
Sie blickten auf und sahen – sahen ihn nicht mehr.
…
Ach ja, der Mond, sie kannten ihn – das war
Dies bleiche Osterei. Es hing wie ausgeblasen
Über dem Lichterdunst der Städte, Jahr um Jahr.
(„Sacrobosco“, S. 85)
Wer kann sagen, wie es auf dem Mond wohl roch?
…
Und kein meerweites Flüstern. Geologische Stille.
Nichts zum Erinnern – und nun? Keine Topographie
für die Irrfahrt des Ichs, gebucht auf ein Du.
(„Hevelius“, S. 86)
Solcher Appell ans Gemeinschaftsgefühl kann Trost leisten. Ich bin häufig traurig und weine in der Trauergondel vor mich hin; und dann hilft es, wenn man sieht, der andere habe auch schon als Mondlandschaft auf einem staubigen Marmorklotz gestanden, während vor seinen geschätzten Augen Brangelina umarmt durch lauwarm beschattete Lauben schlendert; es hilft also, wenn man sieht, es geht dem armen Tropf so wie mir.
Möchte man die Aufgabe der Musenkinder darin sehen, ein Gemeinschaftsgefühl gegen die Einsamkeit zu produzieren, besteht nur die Gefahr, dass sie doch wieder mit dem Weisheitendreschen zusammenfällt. Die Plattitüde „Das Menschsein ist ein Strudel im Siphon“ ist der Plattitüde „Ach, ich sehe deinen Rockzipfel, und mir wird so rosa“ an Plattitüdität nicht überlegen. Dann ist die Dichterei zwar nicht schlechte Philosophie, da sie gar nicht Philosophie ist, aber immerhin banal und langweilig, vielleicht wie empirische Ratgeberliteratur. Wiederum wäre zu hoffen, dass die Aufgabe der Lyrik nicht darin besteht, uns mit Binsen zu flagellieren.
Es gibt allerdings einen leichten Ausweg für Schriftsteller. Eine Binsenwahrheit wird interessant, wenn sie gut geschrieben ist, nicht propositional interessant natürlich, aber poetisch interessant, und das ist doch alles, was man letztenendes von der Poesie erwarten darf. Wir sollen uns nicht alle in den Ästhetizismus flüchten, aber der Verdacht bleibt bestehen, dass das Eigenständige, das die Literatur leisten kann, im Grund sprachlich ist. Sie ist in der Lage, Justierungen an herkömmlichen Ausdrücken vorzunehmen und ihnen neuen Lack überzuziehen, und gelingt es ihr nicht, ist sie eben matt und schal. So gibt es eine Leere der poetischen Banalität geradeso wie der philosophischen. Es entspricht der banalen philosophischen Aussage der banale Satz, der Hausfrauenwahrheit die Hausfrauenidiomatik. Wenn wir von den momentan nicht verfügbaren ambidextren Poeten-Philosophen absehen und realistischere Ansprüche walten lassen, wäre also die Aufgabe des Dichters, keine sprachlich banalen Sätze zu schreiben.
Leider finden sich bei Grünbein wenige Sätze oder nur schon Wortgruppen, die davon zeugten, dass hier besonders interessant mit der Sprache gearbeitet wurde. Ein, zwei Hyperbata fallen auf, manchmal ein Aufprall der Ernsthaftigkeit im Bathos, aber insgesamt stößt einen doch beinahe nichts in interessante Richtungen; es mangelt an den kleinen Wendungen, durch die dem Bestehenden Neues abgewonnen werden kann, und an Verknüpfungen, die nicht auf Anhieb offensichtlich gewesen wären. Einige Metaphern sind geglückt, bestimmt, und schlecht ist keines der Gedichte, dafür sind sie viel zu professionell konstruiert. Aber zuletzt wird in diesem Band gedanklich wie sprachlich, philosophisch wie poetisch, nur das Hergebrachte repetiert. Daraus erwächst kein Trost und kein interessanter Platz für die Literatur.
Ich hätte gerne kleine Überrumplungen durch Verben, Nomen, leicht schräg über Hügel gleitende Präpositionen. Eine Imperfektion am richtigen Ort, ein umgebautes Idiom hie und da, daraus fliegen doch die Funken, mit deren Hilfe wir unsere Würste braten. Die Aufgabe der Dichtkunst ist, das Wassereis zu sein, das vom Stiel rutscht, ins Dekolleté.
Samuel Meister, larmoyanz.blogspot.de, 14.7.2014
Druckfrisch: Cyrano oder Die Rückkehr zum Mond von Durs Grünbein
Durs Grünbein: Brief über Cyrano
logbuch-suhrkamp.de
Dichter-Duett: Lukas Bärfuss und Durs Grünbein. Ein „intergalaktischer Propagandist“ und ein „terrestrischer Melancholiker“ treffen sich im Rahmen von Zürich liest 14 auf der Bühne des Theaters Neumark in Zürich.
Durs Grünbein: Cyrano oder Die Rückkehr zum Mond, Buchpremiere am 25.3.2014 im Literarischen Colloquium Berlin, moderiert von Horst Bredekamp
Einführung von Horst Bredekamp
Durs Grünbein liest und erläutert Gedichte aus Cyrano
Gespräch über die Anlage des Bandes, die Titel der Gedichte und die Philosophie von Expansion und Rückkehr
Durs Grünbein liest und erläutert Gedichte aus Cyrano
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Eberhard Geisler: Warten auf den Dichter
die tageszeitung, 29. 4. 2014
Lothar Müller: Katze und Ei
Süddeutsche Zeitung, 2./3. 10. 2014
Fakten und Vermutungen zum Autor + Archiv + KLG + IMDb + ÖM +
Facebook + DAS&D + Georg-Büchner-Preis 1 & 2 +
Orden Pour le mérite + PIA
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Galerie Foto Gezett +
deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Durs Grünbein–Sternstunde Philosophie vom 14.6.2009.


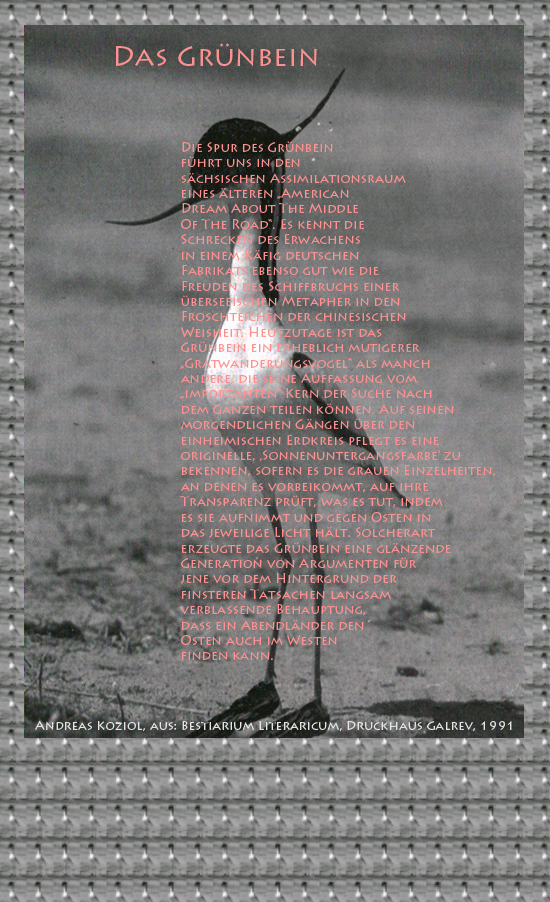
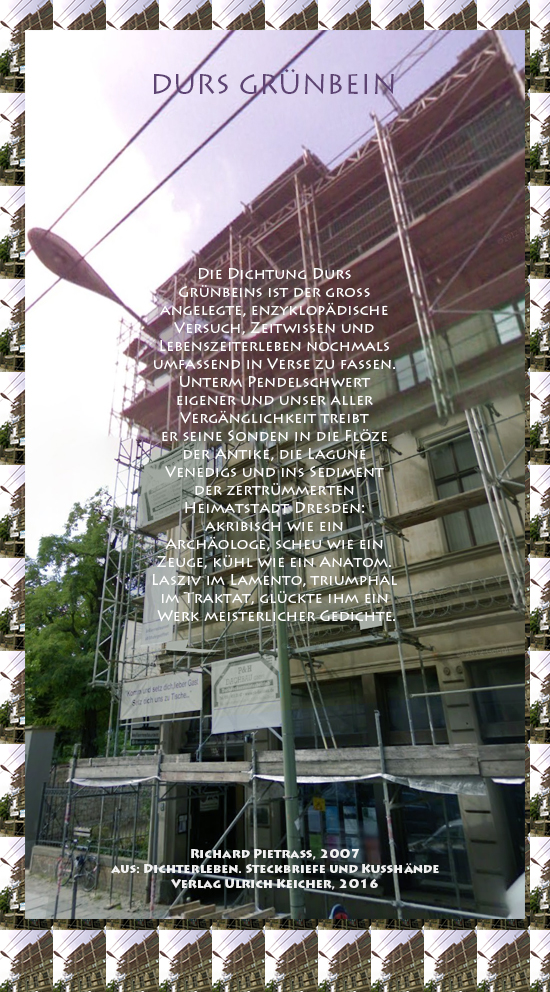












Schreibe einen Kommentar