Durs Grünbein: Porzellan. Poem vom Untergang meiner Stadt
1
Wozu klagen, Spätgeborner? Lang verschwunden war
Die Geburtsstadt, Freund, als deine Wenigkeit erschien.
Feuchte Augen sind was anderes als graues Haar.
Wie der Name sagt: du bist zu flink dafür, zu grün.
Siebzehn Jahr genügten, kaum ein Jugendalter,
Auszulöschen, was da war. Ein strenges Einheitsgrau
Schloß die Wunden, und von Zauber blieb – Verwaltung.
Nicht aus Not geschlachtet haben sie ihn, Sachsens Pfau.
Flechten wuchsen, unverwüstlich, über Sandsteinblüten.
Elegie, das kehrt wie Schluckauf wieder. Wozu brüten?
„Komm ins Zentrum.
Und wo liegt das? Unterm Stolperstein / Dir zu Füßen, tief im Erdreich.“ Der hier auffordert, ihm in die Unterwelt, an den Ort der Orte zu folgen, sieht mit dem inneren Auge das glanzvolle und düstere Bild einer, seiner Stadt: er sieht das Augusteische Dresden, den Ursprungsort des weißen Goldes, ein Zentrum des Erfindungsreichtums und Gewerbefleißes, das Elbflorenz der Vedutenmaler und der Flaneure – und er sieht das Dresden der totalen methodischen Zerstörung, den ausgebrannten Skelettbau. Es ist dieses Menetekel, die bis heute nicht gelöschte Flammenschrift auf Dresdens Steinen, die den Dichter nicht ruhen läßt: „Was hätte sein können, wenn – “
Aber diese 49 Strophen errichten kein urbanes Erinnerungswerk, sind weder Hymnus noch Abgesang auf etwas unwiderruflich Verlorenes. Was wäre auch im Wort zu retten von der einst schneeweißen Galatea, den kurvenreichen Porzellanfiguren, den Muscheln und Delphinen?
Suhrkamp Verlag, Ankündigung
Aschen-ABC
− Wie Durs Grünbein Dresden Verse flicht. −
In der Nacht vom 13. auf den 14. Februar 1945 widerfuhr der sächsischen Barockstadt Dresden jenes verheerende Bombardement durch 773 alliierte Flieger, das im Zusammenhang neo-revisionistischer Geschichtsdeutungen – Stichwort: Hitler als unflätig herumbrüllender, ansonsten eher kauziger Untergangsgreis im neuen, deutschen Filmbunker – als Ausdruck „terroristischer“ Kriegspraktiken gegen eine „unschuldige“ Bevölkerung ins Treffen geführt wird. Das verheerende Geschehen erfährt im Kontext solcher Schriften wie Jörg Friedrichs Der Brand eine naturalisierende Neudeutung. Das Entfachen des Feuersturms über Dresden gilt, bei konsequenter Ausblendung des NS-Vernichtungskrieges, als Barbarei auch gegen Kulturwerte.
Ein umso verzwickterer Befund, als die Lyrik des gebürtigen Dresdners Durs Grünbein (geboren 1962) sich auf Dresdens beispiellosen Kulturschatz beruft, wenn sie in geradezu beschämend eleganten Sechs- und Siebenhebern zumeist trochäischen Ursprungs die Unwiederbringlichkeit von „Elb-Florenz“ evoziert: „Sprich mir nach: es braucht nicht viel, aus einer Stadt / Eine Mondlandschaft zu zaubern (…)“, heißt es da in gesucht lapidarem Ton, oder auch:
Gell, da staunt ihr? Was denn, fragt sich der Tourist,
Das soll Dresden sein, Venedigs Schwester, Elbflorenz?
Dies Provinznest, in Beton ergraut, sowjetisch trist?
Eine solche lyrische Auflistung gedankenimpulsiver Erinnerungsfundstücke lässt ihre Ungerührtheit auch jenen Protagonisten zuteil werden, die man, einem üblen DDR-Witz zufolge, im Nachhinein höhnend zu bedeutenden Städteplanern ausrief. Bombergeneral Sir Arthur Harris erfährt von Grünbeins antikisierender Seite aus eine Begütigung, die dem Witz in nichts nachsteht: „Nur du hast den Salat / Terror-Onkel, Bingo-Bomber, Schreibtisch-Luftpirat.“
Das Entwirren der unterschiedlichen Zeitebenen fördert wenig Erhellendes zutage: Grünbein, dem Büchner-Preisträger von 1995, geraten die Anlassfälle der Historie umso mehr aus dem Blick, als er seit einiger Zeit eine Art Freundschaftsdiskurs mit Wahlverwandten wie dem römischen Stoiker Seneca unterhält, die ihm als Gewährsleute dienen sollen für seine eigene Ungerührtheit. Wahrnehmungsfragen werden nicht mehr politisch, sondern gattungstechnisch gestellt: „Überhaupt, Erinnerung. Das kommt aus Hirnregionen / Und kehrt zurück dahin. (…)“ – das ist so wahr, wie es im Ungefähr der Wissenschaftsgläubigkeit folgenlos versickert. Vergessen scheint in diesen 49 Zehnzeilern, dass der große W.G. Sebald einst auf die Notwendigkeit hinwies, der Erfahrung des Bombenkrieges literarisch nachzuspüren: Unterlassungssünden, die Grünbein untauglich ausgleicht.
Ronald Pohl, Der Standart, 17./18.9.2005
Gibt es eine Sprache für das Inferno?
− Ein Poem auf Dresdens Untergang von Durs Grünbein. −
Als Durs Grünbein vor einiger Zeit von der Literaturzeitschrift Lose Blätter um einen Rückblick auf sein erstes Buch gebeten wurde, überraschte er mit einer Unbarmherzigkeit gegen sich selbst, die keine mildernden Umstände gegenüber den Mängeln seines Erstlings gelten liess. Mit ungewohnter Heftigkeit, die der Apodiktik eines Verrisses gleichkam, geisselte der Dichter die vermeintliche Unreife seines Débuts Grauzone morgens, das im Herbst 1988, also gleichsam am Vorabend der Wende, erschienen war. In seiner „jugendlichen Vers-Anarchie“ und metaphysischen „Dürftigkeit“, liess Grünbein wissen, empfinde er das ganze Werk als eine „Peinigung“, als niederschmetterndes Dokument ästhetischer „Unmündigkeit“.
Klassizistischer Formwillen
Dass ein frühzeitig zum „Götterliebling“ nobilitierter Dichter vom Ungestüm seiner literarischen Anfänge abrücken möchte, scheint zunächst nicht weiter verwunderlich. Im Falle Grünbeins ist diese Distanzierungswut aber von einiger Brisanz, gibt es doch Leser, die gerade die Grauzone-Gedichte, diese verwackelten Momentaufnahmen aus der Endzeit der DDR, zu seinen aufregendsten Werken rechnen. In diesen Gedichten, organisiert in freien, typografisch aufgefächerten Versen, bewegte sich ein nomadisierendes Ich durch die grauen, zerfallenden Industrielandschaften Dresdens und zeichnete das Bild einer Stadt im realsozialistischen Fäulnisstadium. Die flüchtige Impression, der poetische Augenblick waren noch nicht jenem strengen Formbewusstsein unterworfen, das der Autor in seinen späteren Gedichten ausgebildet hat. Und dennoch haben diese impressionistischen Streifzüge eines renitenten Flaneurs ihre schöne Rauheit bewahrt.
Warum der Autor die überstürzte Flucht vor seinem Erstling angetreten hat, kann man nun seinen jüngsten Gedichten und Essays entnehmen, die in ihrem klassizistischen Formwillen um strenge Abgrenzung gegenüber einer offenen Poetik bemüht sind. Das nervöse Grossstadtpoem gilt dem Autor nun als Jugendsünde, sein ästhetischer Fixpunkt und lyrischer Tabernakel ist seit etwa einem Jahrzehnt die antike Dichtung, die „unübertroffene Kunstform der Alten“. Das Streben nach Klassizität artikulierte sich schon in den Gedichtsammlungen Nach den Satiren (1999) und Erklärte Nacht (2002), die sich wie Huldigungen eines Nachgeborenen an die Meisterdenker der römischen Kaiserzeit lesen. In diesen Gedichten hatte Grünbein nicht nur „einige Atemlängen zwischen Antike und X“ ausgemessen, wie es in einem seiner Essays heisst, sondern das Antikisieren seines bildungsreisenden Ich zu schwärmerischen Reminiszenzen ausufern lassen.
Seiner „wichtigsten Schreiblektion“, der Begegnung mit dem „Straffen und Vorwärtsdrängenden lateinischer Verse“, hat Grünbein nun auch einen Grossteil der Essays gewidmet, die in seinem Band Antike Dispositionen gesammelt sind. Dem römischen Philosophen Seneca, dessen Maske er bereits in einem Rollengedicht des Bandes Erklärte Nacht aufgesetzt hatte, widmet er eine hinreissende Hommage, als habe er dessen Habitus einer stoischen Souveränität auch für seine eigene Poesie adoptiert. Bei aller Skepsis gegenüber Senecas prekärer Doppelrolle als Philosoph der Seelenruhe einerseits und als politischer Helfershelfer Neros andererseits ist Grünbeins Diktion bis in die Syntax hinein von tiefer Verehrung bestimmt. Was auch immer der Autor hier essayistisch umkreist, gerät zur Liebeserklärung. Die träumerische Empathie für seine römischen Helden geht so weit, dass er in seinem Versuch über den Satirendichter Juvenal sogar einen August-Spaziergang des Dichters durch die Metropole Rom imaginiert – eine jener ästhetisch riskanten Übungen, die der Lyriker Thomas Kling einmal nicht ohne Grund als „Sandalenfilme aus den Grünbein-Studios“ verspottet hat.
Gerade am Juvenal-Porträt, das zu den konzisesten Arbeiten in Grünbeins Essaybuch gehört, lässt sich der lyrische Paradigmenwechsel des Autors am deutlichsten zeigen. Denn Juvenal wird hier als erster Grossstadt-Poet neuen Typs beschrieben. In seinen frühen Essays hatte Grünbein den „neuen Künstler“ noch als Streuner in den „urbanen Gefahrenzonen“ der Gegenwart angesiedelt. Dieses „millionenfach zerlegte“, den Reizen im „Transitraum“ der Gegenwart ausgelieferte Ich wird im Juvenal-Essay historisch rückprojiziert in die Antike, wo es wieder feste Kontur gewinnt als souveränes, ungeteiltes Dichter-Subjekt: „Sein Idiom war das des Sarkasten, der sich zähneknirschend durch das urbane Stimmengewirr frisst, keinem der Zirkel ganz zugehörig und doch ihnen allen verfallen.“
Eine markante Abweichung gegenüber früheren Perspektiven offenbart auch Grünbeins Poem vom Untergang meiner Stadt, in dem in 49 Strophen der Zerstörung Dresdens im alliierten Bombenkrieg gedacht wird. In einem Abschiedsgedicht des Bandes Schädelbasislektion (1991) hatte Grünbein seine Heimatstadt noch als „Barockwrack an der Elbe“ beschrieben. Ihre Auslöschung im Flächenbrand wird hier nur sehr kühl, aus einer historisch-objektivierenden Perspektive angesprochen:
Auch Dresden ist ein Werk des Malerlehrlings
Mit dem in Wien verstümperten Talent
Der halb Europa seinen Stilbruch aufzwang.
In diesem Fall ergab sich wie von selbst
Die Technik flächendeckender Radierung
Durch fremde Bomber, Meister ihres Fachs
In einer Nacht mit schwarzem Schnee im Februar.
Elegischer Weichzeichner
Diese kontrollierte, die Einfühlung meidende Anrufung des Schrecklichen weicht in Grünbeins Untergangs-Poem Porzellan einem elegischen Ton, der für die mörderischen Vorgänge im Februar 1945 eine Sprache der Trauer finden will. Zwar geraten die Stimmen, die hier das versunkene „Elbflorenz“, die „Schönheitstrunkene“ und die „stolze Stadt“ beschwören, in inneren Widerstreit, zwar wechselt Grünbein mitunter die Tonlage hin zu Spott und kühlem Fatalismus. Aber nirgendwo vermag das Poem eine angemessene Sprache für das Trauma des Untergangs zu finden. Denn das Spiel mit Formen und Reimen wirkt bei der Beschwörung des Furchtbaren kontraproduktiv. Die traumatischen Urszenen der Vernichtung verdunsten in bemühter Feierlichkeit und unfreiwilliger Komik. Über die Pogromnacht im November 1938 heisst es: „Nein, kein Polterabend war, was Volkes spitze Zungen / Die Kristallnacht nannten, jener Glückstag für die Glaser.“ Der sarkastisch gemeinte Vergleich von „Polterabend“ und „Kristallnacht“ wird in seiner metaphorischen Peinlichkeit nur noch durch die Allegorisierung der zerbombten Stadt zu einer Mätresse überboten: „Bombe, Bombe – blankpoliert, fiel durch den Schacht / Tonnenweise Schrott in den Mätressenschoss“.
Besonders prekär wird der elegische Weichzeichner, wenn auch noch sachliche Fehler hinzukommen. An einer Stelle räsoniert das lyrische Subjekt, ein „Träumer“, über das mögliche Gelingen des Hitler-Attentats vom 20. Juli 1944:
Waffenstillstand, Ende gut, und Dresden stünde noch?
Kein Berlin-Finale, keine Landung in der Normandie,
Über Nacht verscheucht die Geister, die man rief?
Kein noch so erfolgreiches Attentat hätte indes die Landung der Alliierten in der Normandie verhindert – fand die doch schon sechs Wochen vor Stauffenbergs Aktion statt. Der Umstand, dass im zitierten Gedicht ein „Träumer“ spricht, mildert nicht den historiographischen Schnitzer. Dem Inferno von Dresden, so lehrt uns Durs Grünbeins Poem, ist mit solchen Elegien nicht beizukommen.
Michael Braun, Neue Zürcher Zeitung, 22.9.2005
Trauer mit Goldrand
− Durs Grünbein versucht sich am Untergang seiner Heimatstadt Dresden. −
Bei den Dichtern aus Dresden gibt es eine „Dresdener Haltung“ zum Untergang ihrer Stadt. Karl Mickel, Volker Braun, Heinz Czechowski und B.K. Tragelehn zeigen sie am deutlichsten. Thomas Manns Lehre von Coventry, „dass alles bezahlt werden muß“, haben sie verinnerlicht. Aber für die fast gleichaltrigen Kriegskinder bleibt der Untergang ihrer barocken Heimat im Februar 1945 ein Weltschreck. Nichts vergeht mit der Zeit. Man kann ihr poetisches Schmerzgedächtnis auch als Folge einer in Permanenz erlebten Katastrophe verstehen. Als wiederkehrendes Nachzittern kommt es aus der Tiefe, entzieht sich in seinem Grauen aber der großen Form. Die Gedichte bleiben konzis bis fragmentarisch. Es wird niemals leichter. Der Mahnung W.G. Sebalds vor „ästhetischen und pseudoästhetischen Effekten aus den Trümmern einer vernichteten Welt“ haben sie nicht bedurft.
Der 1962 in Dresden geborene Durs Grünbein suchte früh Abstand zu dieser Dresdener Haltung. In seinem vor gut fünfzehn Jahren geschriebenen „Gedicht über Dresden“ heißt es:
Das beste Depressivum ist der genius loci
An einem Ort, gemästet mit Erinnerungen,
Schwammfäule, schön getönt als Nostalgie
Narkotisch wie die psychotropen Jamben,
Die anglo-sächsische Version von nevermore.
Aber auch hier perspektivische Strenge, keine sich fortschreibende Beschleunigung der Effekte.
Jetzt präsentiert Durs Grünbein mit dem Band Porzellan poetische Lektionen aus vierzehn Jahren zum Inferno in der sächsischen Residenz. „Leise, jedes Jahr im Februar trifft von weit her / Einen Nerv der Loreley-Ruf Dresden, Dresden…“ Das ist keine Sammlung, sondern ein in neunundvierzig Strophen verflochtenes Poem vom Untergang seiner Stadt. Grünbein sucht für den Höllenkreis von Dresden eine große Form, wie er sie für sein Versepos Vom Schnee oder Descartes in Deutschland gefunden hatte. Dort war der Krieg Mathematik, der Schnee eine Tabula-rasa-Metapher für den anbrechenden Rationalismus – und die Gelehrten-Biographie des Descartes gab den Rahmen. Ein besonders gelungenes Stück vergessener Blankvers-Kunst.
Im Poem Porzellan ist alles anders. Es gibt keinen Anfang und kein Ende. Die brennende Dresdener Canaletto-Silhouette lebt in den Köpfen der Davongekommenen und Nachgeborenen als Endlosschleife. Meißner Porzellan, die Grundausstattung sächsischer Herrlichkeit, führt als Metaphernansatz zu mehrdeutigen Bildern: Feudaler Prunk en miniature, bürgerliche Kaffeetafel, Scherbengericht. Trauer mit Goldrand. Auch von der Pogromnacht im November 1938 ist es mit dieser fragilen Metapher für Grünbein „nur ein Sprung“ zur brennenden Stadt. „Porzellan, viel Porzellan hat man zerschlagen hier / (…) Unschuld, sagt ihr? Lag die Stadt nicht längst geschändet?“ Die scharfgemachten Kolonnenmenschen zerschlugen in ihrer „Reichskristallnacht“ mehr als nur Porzellan. In der Kunststadt Dresden war das nicht weniger brutal und grundsätzlich als sonst im Reich. Die Bruchstellen der Zivilgesellschaft gehen tiefer als ein Scherbengericht.
„Schwammfäule, schönt getönt als Nostalgie“
Auch im britischen Einsatzbefehl stand etwas über Dresden als „früher bekannt für sein Porzellan“. Doch das ist Beiwerk. Der Luftangriff auf die italienischste der deutschen Städte war die verspätete Morgengabe Churchills zum Treffen der alliierten Kriegsherren in Jalta. Im Februar 1945 standen die Amerikaner am Rhein, die Russen an der Neiße, hundertzwanzig Kilometer vor Dresden. „Nicht aus Not geschlachtet haben sie ihn, Sachsens Pfau.“ Luftmarschall Harris’ Order enthält auch den Satz, „nebenbei den Russen (…) zu zeigen, was das Bomberkommando tun kann.“ Fünfunddreißigtausend Menschen oder mehr sind in vierzehn Stunden unter den drei Angriffswellen verbrannt, erstickt, verschüttet. Das 750 Jahre alte Dresden, dieses gepriesene „Elbflorenz“ verglüht, versinkt, versteppt.
Was vermag hier der Dichter? Auch antike Untergänge verbrauchen sich.
,Donnerschlag‘. Das wars. Und von der Stadt am Morgen
Wie von Troja blieb, Pompeji, nur ein Trümmerfeld.
(…)
Eingestürzt das meiste, manches schwankt noch, andres fällt
Erst nach Tagen. Niemand singtWie liegt die Stadt so wüst’.
Kein Aeneas, huckepack den Vater, zukunftsfroh…
Schrecklich für die eigne Blindheit haben sie gebüßt.
Und fünf Wochen lang, am Altmarkt, schauen Pferde zu,
Wie auf Eisenrosten Leichen brennen, scharren Stroh.
Leichen auf Eisenrosten – das bringt die SS aus dem Vernichtungsfeldzug im Osten als Handwerk mit nach Dresden. Da schweigt der Fundus der Antike. Verstummt hier nicht jedes Poem?
Aber Grünbeins Blankvers bricht nicht ab, verfängt sich vielmehr bei Dresdner Blitzmädel und Fronturlauber, in der Gleichzeitigkeit von Vernichtung und kleinem Glück im Kriegsalltag. Wird das auch noch mit persönlicher Bedeutung beliehen, rutscht die Dichtung unaufhaltsam ins Elegische. Der Angriff und das Private:
Du im Flakturm, Mädel, du auf Fronturlaub, Soldat −
Beide zitternd, und der Rundfunk spielte Rosenkavalier.
Sempers Oper liegt verdunkelt.
Dieser gewisse Schauer, dieser Violinton als leises Schluchzen klingt wie ein O-Ton bei Guido Knopp. Durs Grünbein weiß um die Gefahren, versucht immer wieder groteske Brechungen.
Linke Buben, sprich Studenten, brechen ein Tabu:
„Thank you Harris!“ heißt ihr Gruß zum Weltkriegstag.
Ach, die Arme, denkt man sich, versteht sie keinen Spaß −
Liest man von der Dresdnerin, die auf Verhöhnung klagt.
Aber nicht an solchen grotesken Verfremdungen oder Abschweifungen scheitert das Poem von Dresdens Untergang, es sind Grünbeins ästhetische Überzeugungen, die der Unbeherrschbarkeit des Stoffes ausweichen. Er versucht sie vielmehr durch marathonhaftes Weiterschreiben anzupassen, Ausweitung möge Ungenauigkeiten ausgleichen. Der Dichter kennt die Risiken des Verfahrens, aber er kokettiert zu sehr mit ihnen.
Sieh dich vor, du! – raunt der Mann im Ohr, ein Realist.
Leicht verletzt sich, wer wie du mit alten Scherben spielt.
Merkst du auch, wann du zu weit gegangen bist?
Zumindest Sebalds Warnung vor den „Effekten aus den Trümmern einer vernichteten Welt“ hat der poetische Kriegsberichterstatter zu leicht genommen oder nicht bemerkt. Auch wenn bei ihm nicht alles literarisch stürzt und einige eindringliche Bilder vom Untergang gelingen, erzielt Durs Grünbein mit seinem Poem Porzellan letztlich jene Wirkung, die überdimensionierten Denkmälern eigen ist: Gedächtnis und Gedenken werfen diffuses Licht.
Jürgen Verdofsky, Frankfurter Rundschau, 19.10.2005
Grünbein zerdeppert Porzellan
Durs Grünbein ist ein Dichter der sarkastischen Attacke. Eine Liebeserklärung an Dresden zu schreiben, liegt ihm fern. Wenn er ein Poem über „seine Stadt“ schreibt, überschüttet er sie mit Spott. Zu groß ist sein Unbehagen an nostalgischem Schmerzton, allzu rosiger Porzellanwelt und Generationsüberheblichkeit, die nur die eigene Erfahrung gelten läßt.
Da Grünbein sich seit mehr als zehn Jahren dem antikisierenden Vers widmet, liegt ihm das Provinzielle fern. Und so nennt er Dresden in einem Atemzug mit Troja und Pompeji, stellt Zusammenhänge her zu antiken Tragödien und in der Weltgeschichte wiederkehrenden Vorgängen von Aufstieg und Zerfall von Kulturen. Hier aber geht es um Extremfälle von Terrorakten in jüngerer Geschichte. Mit der Zerstörung Dresdens im Bombenhagel der Nacht vom 13. zum 14. Februar 1945 assoziiert er das Inferno von Guernica, Warschau und Coventry. Aber weder Thomas Manns Lehre von Coventry, „daß alles bezahlt werden muß“ noch W.G. Sebalds Warnung vor „ästhetischen und pseudoästhetischen Effekten aus den Trümmern einer vernichteten Welt“ kümmern den Dichter sonderlich. Er ist der Vertreter einer Generation, die sich dem Thema scheinbar unvorbelastet und mit großem Abstand nähert.
Der zum Poem vereinte Zyklus von 49 miteinander verflochtenen Gedichten entwirft eine kleine Kulturgeschichte der Stadt im Zeitraffer und ein Bilderrätsel sächsisch sinnenfroher Lebensart. Doch ob Grünbein nun die Silhouette der Stadt nachzeichnet, die filigranen Nuancen porzellanener Meisterwerke oder die Spur großer Geister aus Literatur, Musik und Handwerkerkunst vergangener Jahrhunderte, immer ist eine deutliche Abwehr zu spüren, die Ironie und Sarkasmus hervortreibt. Der Genius loci spricht zu ihm als Kakophonie von Stimmen. „Sprich mir nach“, „Komm ins Zentrum“ fordert ein erzählendes Subjekt den Leser auf, und dann verschwindet es, verliert sich im Tausch von Zeiten und Räumen. Dabei kommt ihm das Maß abhanden. Die Rede von Narr, Träumer und Nazi wechselt in rascher Folge, wird kontrastiert mit Goethe-, Hölderlin, Eichendorff- , Rudolf Borchardt- und Celan-Zitaten.
Permanenter Perspektivwechsel narrt Augen und Ohren. Selten ist zu erkennen, wer da eigentlich spricht, zu forsch treibt der Blankvers voran zum nächsten O-Ton, zur folgenden Figurenrede. Grünbein zelebriert ein provokantes Verwirrspiel, zusammengehalten von klassizistischem Formwillen.
Noch im Band Nach den Satiren (1999) entlarvte die Wortwahl verschiedener Sprecher deren Denkweisen mittels Satire. Jetzt aber hetzt der flotte Rhythmus den mehr oder weniger gelungenen Reimen nach. Nicht der Reimzwang, den der Autor übrigens im satirischen Gedicht Nr. 27 karikiert, sondern das Mensch-Sein, die Humanität des Johann Sebastian Bach-Gedichts Nr. 36 wünschte man sich als strukturbildend für das Poem. Von der Kristallnacht als „Glückstag für die Glaser“ zu sprechen, wie im Gedicht Nr. 4, ist angesichts der historischen Tatsachen der folgenden Judenvernichtung eine Ungeheuerlichkeit, wen auch immer Grünbein da zitieren mag. Manche Vergleiche sind mehr als makaber. „Sind das Menschen, prasselnd da wie Eßkastanien“ im Gedicht Nr. 22 gehört dazu und das Bild von den auf Eisenrosten brennenden Leichen, dem allzu salopp die Schlußwendung folgt: „Larmoyanz? Ach, spätes Seelchen du, gib endlich Ruh.“ (Nr. 38).
Die naturalistische Sicht auf Details, die schon in Den Teuren Toten metaphorisch aufleuchteten, gerät hier zur Pornographie. Der Blankvers kichert angesichts von Ungeheuerlichkeiten. Das ist fatal.
Antikes Versmaß, saloppe Umgangssprache und tragischer Gegenstand des Schreibens widersprechen einander. Die Rolle des nüchternen Geschichtsschreibers, dem Mnemosyne die Feder führt, wird durch die Eigendynamik von naturalistischen Szenen und unwidersprochenen O-Tönen ausgehebelt. Kräftige surrealistische und naturalistische Bilder einerseits und Reimseligkeit andererseits spielen die Göttin der Erinnerung an die Wand. Zum Vorschein kommt sie erst wieder in Gedichten, die Kriegssprache verdichten.
Erschreckend, wie viele Worte sich – wie „Bombenaussicht“ – in die Umgangssprache eingeschlichen haben. Erstaunlich, wie viele deutsche Verben durch die zynische Sprache von Militärs wohl für immer ihre Unschuld verloren, darunter „plattmachen“, „ausradieren“ und „aufrollen“. Die Gedichte 25 und 26 wirken wie Wortarchive des Krieges und des Terrors. Das Sprachbewußtsein des Autors bleibt hier wach. Angesichts der oben genannten Mißgriffe aber lobe ich mir Durs Grünbeins Essaysammlung Antike Dispositionen, kluge Aufsätze in klarer Sprache, die fast zeitgleich mit Porzellan erschienen sind.
Dorothea von Törne, Die Welt, 24.12.2005
Regenrinnen im Schädelinnern
„Weltgeschichte ist Stadtgeschichte“, schreibt Oswald Spengler. „Ach, Geschichte“ heißt es in einem von 49 Gedichten, die Durs Grünbein angeblich während der letzten dreizehn Jahre auf seine Heimatstadt Dresden geschrieben hat und die nun unter dem großgestischen Titel Porzellan. Poem vom Untergang meiner Stadt zu einem elegischen Memorial zusammengefasst erschienen sind.
„Ach, Geschichte“ wäre eine vertretbare Haltung gewesen. So ein resignativer Seufzer, der kühle Distanz und persönliche Bezugnahme zugleich ermöglicht hätte – gerade bei diesem nicht unheiklen Thema. Es geht schließlich nicht zuletzt auch um geschätzte dreißigtausend Tote und, eben, um Geschichte. Stattdessen zielt Grünbein auf das große Panorama entlang der schlanken S-Kurve im Elbtal. Enzyklopädik statt sprechendem Detail: von Baumeister George Bähr bis Bomber Harris. Die Frauenkirche samt Glocke, Zoo und Zwinger, Zauberflöte in der Semperoper. Bach darf noch einmal eine Orgel probieren, und zwischendurch wird ein kleiner Junge zu Bett gebracht. Alles zieht dahin im trochäischen Gleichmaß. Und natürlich auch das titelgebende Porzellan, das sich so schön idiomatisch zerschlagen lässt. Überhaupt die Redensarten: Auch den Kalauer von der „Bombenaussicht auf den Flickenteppich Stadt“ kann Grünbein sich nicht verkneifen.
Das Hauptproblem scheint gerade dieser verunglückte Zynismus, mit dem er eine Position zu seinem Stoff sucht und dabei zuweilen wie geschmiert ins Peinliche abrutscht. Da wird die „Kristallnacht“ zum „Glückstag für Glaser“, und ganz ohne Anführung oder Kursiva steht andernorts ein „Blitzkrieg, hei!“ Die Frage nach dem möglichen Sprecher wird zur Frage nach einem „Schlitzohr, ist er Sachse?“ Und die Nazis rudeln auch schon mal als „Lumpenpack“. Sicher, das ist anverwandeltes Reden in Zungen. Aber derart niedlich und betulich dürfte selbst in den Vierzigerjahren kein Mensch ernsthaft gesprochen haben, zumal nicht darüber. Wenn dann auch noch Troja und Pompeji als Vergleichsgrößen bemüht werden, ist man als nun schon deutlich weniger geneigter Leser geneigt, das Buch mit jenem Seufzer „Ach, Geschichte“ in die Ablage zu befördern.
Traurigerdings ist rein handwerklich an den Gedichten kaum etwas auszusetzen. In der historischen Ereignisfolge geht manchmal etwas durcheinander, und auch ein paar Bildfügungen sind mitunter, nun ja, gewagt: „Porzellan: das ist, als ob man durch ein Brennglas schielt.“ Das wird in solcher Transparenz doch sehr erlesenes Tongut gewesen sein. Aber schon wie Grünbein Reime zu setzen weiß, gerade die unreinen, ist schrecklich elegant. Wenn sich beim Gedankenlesen „im Schädelinnern“ „Regenrinnen“ wiederfinden oder ein „Komponist“ mit seinen vier letzten Liedern „von Geschichte angepißt“ im Raum stehen bleibt, leckt Lyriklesers Zunge sich genüsslich die vorgelagerten Lippen.
Allein, der Sound bleibt hohl. Was dieses Sujet an Widerständigem, Schmerzhaftem zu bieten gehabt hätte, ruht wohl weiterhin im Elbschlick. Unter der sorgsam polierten Oberfläche bleiben die Texte seltsam fad, wie Stellwanddokumentationen in Geschichtswerkstätten. And by the way: Soweit bekannt ist, gibt es Dresden noch.
Nicolai Kobus, taz-Magazin, 24./25./26.12.2005
Der Tourist auf dem Dichterthron
Gab es je einen Autor, dem der Weg zum Klassiker so widerstandslos gebahnt worden wäre wie Durs Grünbein? Wenn ein Suhrkamp-Band einen längeren Text von Lucius Annaeus Seneca und einen kürzeren von Durs Grünbein vereint, dann versteht es sich längst von selbst, dass Grünbeins Name auf dem Titel groß und zuerst erscheint, derjenige Senecas hingegen in kleinerer Schrift als zweiter. Dabei liefert Grünbein im Grunde kaum mehr als ein Nachwort.
Und doch taucht das Langgedicht „An Seneca: Postskriptum“ in seinen neuen Veröffentlichungen gleich zweimal auf – außer in dem Double Feature mit Senecas „Kürze des Lebens“ auch noch in dem Band Der Misanthrop auf Capri, worin der Jungklassiker seine Gedichte mit antikem Bezug gebündelt hat. Sieben Seiten nimmt das „Postskriptum“ jeweils ein, was viel ist für zwei Publikationen von je nur um die hundert Seiten Länge; vor einem Jahr wurde es übrigens auch schon mal gedruckt.
Grünbeins Glück von Anfang an: dass jemand aus dem frisch geöffneten Osten, so jung, überhaupt etwas für das klassische Altertum übrig hatte, wurde weiland als ein Faktum gewertet, das ihn an sich schon als Universalerben des Wahren, Guten und Schönen designierte und ihm sogleich eine feste Position im Kosmos der zeitgenössischen Literatur sicherte. Die scheinbare Simplizität der klassischen Versmaße, die Heiterkeit der Antike, ihr Grundsatz des „Ars lateat“ (die Kunst soll verborgen bleiben), dazu der emphatische Zuspruch, der dem „Götterliebling“ (FAZ) entgegenkam: dies alles könnte Grünbein zu der Meinung verführt haben, das Bedeutende würde ihn nichts als die durchgehaltene Manier kosten.
(…)
Porzellan-Bijou im Elefantenladen
Grünbeins individueller Umgang mit der Antike führt ihn zu grandiosem Leichtsinn in Form und Inhalt. Ahnt er eigentlich nicht, mit wem er in Konkurrenz tritt, wenn er eine mehrseitige Moritat mit dem Titel „Bericht von der Ermordung des Heliogabal durch seine Leibgarde“ verfasst? Er bekommt es hier mit Stefan George zu tun. Der hatte seine kühnste Gedichtsammlung Algabal genannt, deren namengebender Held wiederum niemand anderer war als der, den Grünbein nun als „Dreckschwein“ und „syrische Tunte“ etikettiert. Bei George las es sich so:
Hernieder steig ich eine Marmortreppe.
Ein Leichnam ohne Haupt inmitten ruht.
Dort sickert meines teuren Bruders Blut.
Ich raffe leise nur die Purpurschleppe.
Grünbein dagegen:
Nur dem Caesar war alles egal. Schadenfroh sah er
Rom, die Weltstadt, verkommen wie irgendein Fremder,
Ein Tourist auf dem Thron.
Fremd wie ein Tourist – das scheint auch Durs Grünbeins Fall zu sein. Begriffslos tappen seine Verse durch Orte, Zeit und Raum, und nicht anders als Caesar ist auch dem Dichter „alles egal“: der Tourist auf dem Dichterthron. Dessen Versschmiedekunst verwandelt sich jeden Gegenstand in preziösen Schnappschüssen an, das Verwackeln wird vom hoppelnden Reimverfahren besorgt. Auf dem langen Umweg über Karthago und Heliogabal kehrt der Dichter zuletzt in seine Heimatstadt Dresden zurück, zu deren Zerstörung im Jahr 1945.
Porzellan. Poem vom Untergang meiner Stadt nennt sich der Band, und schon an diesem Titel ist alles faul: die Gattungsbezeichnung „Poem“, die dem Gedichteten einen Drall ins Auratische geben soll; das „Porzellan“ als katastrophal untermaßstäbliche Metapher für den Untergang Dresdens in der Nacht vom 14. auf den 15. Februar; und dann noch das Pronomen „mein“ – als wäre dieser Untergang ganz speziell gerade diesem empfindsamen Nachgeborenen angetan worden. Unterlegt ist dem geschwungenen Schriftzug auf dem Umschlag ein Craquelé wie bei einer zart vergilbten Delfter Kachel: ein Porzellan-Bijou im Elefantenladen.
Noch das Harmloseste sind die Stilblüten: „Frauenkirche: wahrlich Frau war sie.“ Und warum? Weil sie mit dem endgültigen Zusammenklappen noch ein paar Tage wartete, um ihren Lieben ein gutes Beispiel zu geben: „Die Lektion war: so wie sie die Haltung wahren“! So weit der pädagogisch wertvolle Aspekt des Desasters, dem weitere überraschende Einsichten folgen: „Leise, jedes Jahr im Februar trifft von weit her / Einen Nerv der Loreley-Ruf Dresden, Dresden…“ Diese Loreley ist nicht nur unter die Zahnärzte gegangen, sondern überdies vom Rhein an die Elbe umgesiedelt. Ihr Ruf „Dresden, Dresden“ muss sich auf „trösten“ reimen, und gleich hört man heraus, dass es sich dabei durchaus nicht um einen unreinen Reim handelt – der ortsüblichen Aussprache folgend, ist dieses Pärchen völlig identisch.
Die sprachlichen Schräglagen sind das eine. Beunruhigender ist der Eindruck, dass da ein Warnsystem versagt hat, das den Autor vor Missgriffen hätte bewahren können:
Steig hinab, noch einmal. In den Luftschutzkeller. Sieh:
Deine Vorfahrn, eng gedrängt, in ihrem letzten Hemd,
Volksgenossen, Geiseln einer Massenhysterie,
Wie sie fluchen, schluchzen, eben noch enthemmt,
Wenn der Führer, im Mercedes der Messias kam.
Über den leicht hämischen Affekt der Passage mag man streiten. Davon aber, was ein Brand ist, hat Grünbein definitiv keine Ahnung. Sein „Sieh“ – nur eine wichtigtuerische Sprachgeste. Der Reim von „enthemmt“ auf „letztes Hemd“ – ohne Gehör für unfreiwillige Komik. Und die „Geisel“ und die „Hysterie“? Gewiss kann jemand zugleich Geisel und hysterisch sein (sogar hysterisch, weil Geisel). Doch wie hat man sich eine Hysterie vorzustellen, die selbst zur Geiselnahme schreitet?
„Wozu brüten?“
Dass sich so etwas wie ein Formproblem ergibt, weil dem ungeheuren Feuersturm die stanzenartige Strophe, ohne Variation neunundvierzigmal in wackligem Metrum wiederholt, nicht gemäß sein könnte: das scheint Durs Grünbein gar nicht einzufallen. Wohlgemut legt er los:
Wozu klagen, Spätgeborner? Lang verschwunden war
Die Geburtsstadt, Freund, als deine Wenigkeit erschien.
Feuchte Augen sind was anderes als graues Haar.
Wie der Name sagt: du bist zu flink dafür, zu grün.
Statt „Wozu?“ hätte er lieber genauer fragen sollen: Mit welchem Recht steht es dem Verschonten an, Klage zu führen? Auch: kann er es? Aber warum lang herumfragen. Hier geht es doch nur um einen lockeren Einstieg.
Das Ende der ersten Strophe – „Elegie, das kehrt wie Schluckauf wieder. Wozu brüten?“ – scheint Grünbein ein wahrhaft kindliches Vergnügen zu bereiten. Und der Leser denkt bei sich: Schon recht, dass das „Flinke“ und „Grüne“, das eigentlich ja einer frühen Lebensphase angehört, sich beim über Vierzigjährigen zum Daseinszustand verfestigt hat. Das ist das herbe Los des Wunderkindes.
Burkhard Müller, Literaturen, Januar/Februar 2006
Ja, es tut noch weh
− Poetisches Gedächtnis: Durs Grünbeins Dresdner Elegien. −
Als „Komplizen der Vergänglichkeit“ hat sich der „Silbenschmied“ Dürs Grünbein einmal bezeichnet. Dazu paßt, daß er sich noch immer emphatisch als Dresdner versteht, obwohl er schon seit 1985 in Berlin lebt. In Porzellan erscheint „die ruinierte Stadt“ als Chiffre eines poetischen Ingeniums, das nicht vergessen kann und will, was doch unwiederbringlich verloren und nie wiedergutzumachen ist. Diese Bindung ans Vergangene zeigt sich in Form und Gehalt des Erinnerns zugleich. In der Tradition der „Tableaux Parisiens“ Charles Baudelaires versammelt der Band neunundvierzig Dresdner Bilder in je zehn unregelmäßig gereimten trochäischen Sechshebern, in denen sich Altes und Neues traumhaft überlagern. „Diese heiklen Formen. Worum geht es hier? – Einer lauscht, / Was die Töchter Mnemosynes ihm diktieren. / Und er tauscht die Zeiten, Räume, Maße, tauscht und tauscht.“ Für „Nimmerwiederkehr“ aber weiß der Dichter nur ein anderes Wort: „heute“.
Diese Elegien sind aber weder sentimentale Klagen um den Zustand der einst schönheitstrunkenen Stadt noch gar empörte Anklagen gegen ihre Zerstörung.
Nein, Erinnerung, der Vorrat an Legenden
Ist längst aufgebraucht, und jede Heimkehr wird bestraft.
Das lyrische Ich erscheint in verschiedenen Haltungen distanzierter und desillusionierter Beobachtung und Untersuchung. Der Dichter ist wechselweise Flaneur, Chronist, Archäologe, Geograph oder Historiker, seine Verfahren sind Sondierung, Beschreibung, Abtragung von Schichten und Analyse der Quellen und Sachreste. Die Zerstörung Dresdens durch britische Bomber ist den Gedichten eingeschrieben, aber das Datum ist nicht unhintergehbar. Schon vorher wurde in Dresden viel Porzellan zerschlagen und Kristall. „Unschuld, sagt ihr? Lag die Stadt nicht längst geschändet?“ Doch noch immer verursacht die Erinnerung Schmerzen:
Ja, es tut noch weh.
Und dennoch entziffert der poetische Cicerone in der ruinierten Gestalt Dresdens und des Elbtals immer wieder die Merkmale der Schönheit und der unerschütterlichen Haltung. So erinnert der Blick auf die Elbe noch immer an Hogarths Ideal der schönen Form, und die zerstörte Frauenkirche kann zum Emblem einer eigentümlichen Würde und Standhaftigkeit werden.
„Lange ist sie so, gebrochnen Rückgrats stehengeblieben.“ Das sind Bilder Dresdens, die man traumvertraut nur mit geschlossenen Augen sehen kann und die sich dem touristischen Blick nicht erschließen.
Das soll Dresden sein, Venedigs Schwester, Elbflorenz?
Dies Provinznest, in Beton ergraut, sowjetisch trist?
Der Genius loci Dresdens ist ein Restaurator jenseits des Wiederaufbaus von Gebäuden.
Nicht dort draußen spielt sie, die Musik – im Schädelinnern.
Hier, mémoire involontaire, hier geht sie aus und ein.
Solche Erinnerung geht mehr noch als die Prousts über Zeiten und Räume hinweg und begreift auch die Städte in das Gedächtnis des Leidens ein, die das Schicksal Dresdens auf die eine oder andere Weise teilen mußten: Troja, Pompeji, Lissabon, Coventry, Guernica oder Warschau.
Dresden aber ist die Stadt, in der lauter Kurfürsten wohnen, die man um den Thron gebracht hat. Was ihnen bleibt, ist Spielraum für eine Phantasie, der die Zeitläufte nichts anhaben können. So ist sie auch der Ort für einen Lyriker, der wohl weiß, daß mit seiner Kunst kein gesellschaftlicher Lorbeer mehr zu erringen ist. Das imaginative Dresden Durs Grünbeins wird so zum Reflexionsmedium eines produktiven Aushaltens und Verwindens, eines unheroischen poetischen Widerstands gegen die zerstörerische Macht der Zeit und des blinden Interesses.
Von wegen Tragik, pah! Wo, wenn nicht hier, war man
Der Hans-im-Glück, dem Zeit nichts nehmen kann?
Die Gedichte bringen in ihrem Ineinander traditioneller Form und heutigen Ausdrucks das Haben zur Anschauung, das im Verlorenhaben steckt, und so sind sie auf höchst kunstvolle Weise tröstlich, nicht nur für Dresdner.
Friedmar Apel, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 18.2.2006
Bomben, blankpoliert
− Durs Grünbein kittet Dresdner Porzellan zusammen. −
Eine Stadt wurde vernichtet. Mehr als sechzig Jahre danach wird dem Ereignis ein Zyklus von Gedichten gewidmet: „Stell dir vor“, heißt es darin,
es hat
Eine Opernpause nur gedauert, Zeit zum Zigarettenholen,
Und auf Straßen, Todesfallen, brodelte der Teer.
Eben Frost noch, blau am Fahrradlenker klebt die Hand.
Dresden heißt die Stadt, und jeder weiß es. Ihr Untergang im Februar 1945, der Tod von mindestens mehreren zehntausend Zivilisten, der Schrecken – das alles ist dokumentiert und bekannt und bildet, spätestens seitdem der Schriftsteller W.G. Sebald im Herbst 1997 eine große Sprachlosigkeit der Literatur angesichts des Luftkriegs bemerkte, einen beliebten Topos im öffentlichen Nachdenken über den Zustand der aktuellen Dichtkunst: und zwar vor allem im Reden über das Schweigen. Dabei ist es keineswegs erwiesen, dass die Literatur die Pflicht habe, ein getreues und vollständiges Bild der ihr vorausgehenden Wirklichkeit zu zeichnen. Vom Untergang Dresdens spricht nun auch Durs Grünbein. Porzellan. Poem vom Untergang meiner Stadt, heißt der Band. Das Possessivpronomen im Titel überrascht. Denn in der Regel vermeidet es dieser im Jahr 1962 an ebenjenem Ort geborene Dichter, das lyrische und erst recht das eigene Ich in seinen Versen auftreten zu lassen. Das Possessivpronomen signalisiert nun nicht nur eine Betroffenheit, sondern auch eine Inbesitznahme: Das Leid, die Toten, die Vergangenheit, das alles soll jetzt auch zu ihm, dem „Spätgeborenen“, gehören. Schon hier, beim Titel, stellt sich der Verdacht ein, es gehe in diesem Werk nicht ganz redlich zu. Das Unbehagen wächst, wenn man erfährt, wie diese Gedichte zustande gekommen sein sollen. Seit über zehn Jahren, so lautet die zum Gedichtzyklus gelieferte Legende, und stets im Februar, habe Durs Grünbein an diesen Versen gearbeitet. Ein poetischer Totenkult? Ein geheimnisvolles Ritual, ein Wirken dunkler Kräfte, die man nur bei blassem Winterlicht wahrnehmen kann? In den vergangenen Jahren hat Durs Grünbein einen leicht erkennbaren Stil entwickelt: den antikisierenden Vers, den er benutzt, um eine Vergangenheit lebendig werden zu lassen, in Szenen, Stimmen, kleinen Allegorien. Das klingt jetzt so:
Klar die Frostluft: unterm Flügel, Augenweide,
Lud der Fluß, ein schlankes S, die Bomberstaffel ein.
Nachts der Stadt blieb keine Zeit, sich anzukleiden.
Besenhexe kocht, Metall, Asphalt und Stein.
Auf diese Weise geht es fort und fort, und Vers wird mit Vers verknüpft, so, als wäre hier eine empfindsames Nähmaschinchen am Werk, das, nicht streng, aber immer hübsch jambisch, ein Stückchen ebenso vergangener wie poetisierter Erlebniswelt nach dem anderen zusammenfügt. Wo aber ist der Gewinn, der sich mit dieser Dichtkunst einstellt? Was fügt die lyrische Form einem Bericht hinzu? Oder stehen hier nur deshalb Verse, bietet hier einer seine beträchtlichen dichterischen Fähigkeiten und historischen Kenntnisse nur deshalb auf, um bei einem mit Lyrik wenig vertrauten, aber kulturbeflissenen Publikum mächtig Eindruck zu machen? Schon dieses Misstrauen ist fatal. Und es sieht sich schnell bestätigt: in der Leidenschaft des Dichters für das grelle, allzu eindringliche, aufdringliche Bild. Die Stadt Dresden, die nicht angekleidete Frau, über die sich die feindliche Luftwaffe wirft, mag dabei gerade noch angehen. „Porzellan, viel Porzellan hat man zerschlagen hier, / Püppchen, Vasen und Geschirr aus weißem Meißner Gold“ – das ist peinlicher, ganz abgesehen davon, dass das um des Binnenreimes willen nachgestellte „hier“ den Rhythmus zerschlägt. Und „Bombe, Bombe – blankpoliert fiel durch den Schacht / Tonnenweise Schrott in den Mätressenschoß“: Das ist, in seiner Verbindung von Massensterben und Geilheitsmetapher, schon sehr weit jenseits von Poesie, um von Geschmack erst gar nicht anzufangen. Was an solchen Stellen passiert, ist falsches Pathos, Dienst an der Sensation, schlechter Journalismus.
Das Verfahren hat ein Prinzip, das von vornherein angelegt war in Durs Grünbeins Projekt der antikisierenden Verlebendigung. Dieses Prinzip ist – man muss es so deutlich sagen – wesentlich pornographisch. Denn es geht hier um eine radikale Überhöhung des Realistischen um der Wirkung willen, um eine Aufhebung der intellektuellen wie der ästhetischen Distanz, darum, dass hier ein Künstler am Werk ist, der seinen Leser nicht mehr zur ästhetischen Reflexion, sondern zum direkten, unverstellten, fassungslosen Hingucken zwingen will.
Sieh: / Deine Vorfahrn, eng gedrängt, im letzten Hemd.
Und was man sieht, wenn man so blickt, das muss, eben jener Überwältigung wegen, das Erwartbarste, das Klischee schlechthin sein, und so kommt der „Führer“ zu dem albernen Attribut „im Mercedes der Messias“, und die „Urgroßmutter“ erhält ihre „Kasserolle“. Diese Art von Pornographie ist der Kunst grundsätzlich nicht fremd. Die Maler des Mittelalters, Matthias Grünewald etwa, haben sich ihrer bedient, als sie die Wunden der Geißelung am Körper Christi darstellten, als seien sie Pestbeulen, und die Finger des am Kreuz hängenden Herrn sich in äußerstem Schmerz verkrampfen ließen. Aber auch diese Kunst muss sich die Frage gefallen lassen, warum sie das tut. Und die Antwort muss lauten, dass der überhöhte Naturalismus nicht der Reflexion dient, sondern im Gegenteil der frommen Wirkung und der Propaganda wegen veranstaltet wird. Das geht auf, solange der Wirkung eine Intensität des Glaubens entspricht, die sich in den Details des Schreckens bestätigt sieht. Beim modernen Dichter aber liegt der Fall anders: Er hofft und kalkuliert, sein Gedicht möge an die Stelle dieser Intensität treten – und deswegen ist es so grell, so bunt, so kunstgewerblich.
Einmal ist Durs Grünbein mit dieser Technik etwas Großartiges gelungen: Im Langgedicht „Vom Schnee“, vor zwei Jahren erschienen, beschrieb er die Entstehung der Philosophie von René Descartes, als dieser zu Beginn des Dreißigjährigen Krieges im Winterlager bei Neuburg an der Donau lag. Auch dieses Gedicht war szenisch, redete in Stimmen, sprach in belebten Bildern. Aber hier schuf die Poesie etwas, was vorher nicht da war, ließ etwas Neues entstehen, indem sie die Konsequenzen eines radikalen Skeptizismus schon im Augenblick seiner Entstehung sichtbar werden ließ: Wie René Descartes in immer wieder dieselben Zweifel stürzte, wie er in seinem Denken nichts Festes mehr zu greifen bekam, wie er Rettung in der sinnlichen Gewissheit suchte und sich drehte und drehte und nicht mehr weiterkam – das war hier zu lesen und zu hören und bildete am Ende eine poetische Phänomenologie eines von vornherein hoffnungslosen philosophischen Unternehmens.
Aber schon in den Historien (1999), und Neuen Historien (2002), Durs Grünbeins poetischen Anverwandlungen der Antike, lag der Fall anders. Auch sie sind im Grunde nicht lyrische, sondern epische Wiederbelebungen eines hinreichend erschlossenen Materials. Ihr Reiz mag wohl vor allem darin liegen, dass der Leser das noch heute Menschliche in einer für heutige Zwecke ausgeguckten und herausgeputzten Antike wiedererkennen darf:
Und kommst du endlich, um Jahre gealtert, nach Haus
Steht der Germane in deiner Tür, und es winkt dir
Das strohblonde Kind deiner Frau.
Gleichwie, dieses Verfahren ist harmlos, solange es dabei um Seneca auf Korsika oder Tiberius auf Capri geht, denn diese Stoffe sind derart in die abendländische Überlieferung eingeschmolzen, dass sie eine weitere Kultivierung ohne weiteres vertragen.
Aber schon Wolfgang Borcherts kleines Drama Draußen vor der Tür – erzählt es nicht auch von einem sehr unwillkommenen Kriegsheimkehrer? – würde seine Verwandlung in antikisierende Verse, seine Verarbeitung zu Kunstgewerbe nicht ertragen – und zwar weniger, weil die Toten des Zweiten Weltkriegs noch lebendig wären, sondern vor allem, weil der Stoff noch immer politisch ist. Und dann so etwas?
Nein, kein Polterabend war, was Volkes spitze Zungen
Die Kristallnacht nannte, jener Glückstag für die Glaser.
Polterabend? Ach, Quatsch. Eine äußerst preziöse Form der lyrischen Verwurstung stellt dieser Gedichtband dar, an einem denkbar unpassenden Gegenstand.
Thomas Steinfeld, Süddeutsche Zeitung, 6.10.2005
Requiem für Dresden
Ein eindrücklicher Gedicht-Zyklus des Büchner-Preisträgers Durs Grünbein über die Zerbombung seiner Geburtsstadt Dresden drei Monate vor Ende des Zweiten Weltkriegs. Seit 1992 hat der Autor daran geschrieben. Im Jahr der Fertigstellung der Dresdner Frauenkirche hat er ihn vollendet. Mit widerstreitenden Gefühlen blickt Grünbein auf seine Heimatstadt. Die Tonlagen und Stimmungen der einzelnen Gedichte variieren von Sarkasmus zu Melancholie, von Emphase zu Skepsis. Sein Zyklus ist Klage als auch Anklage, die nicht nur den englischen Bombengeschwadern gilt, sondern vor allem der „eignen Bande“, den Deutschen, die die prächtige Kunststadt aufs Spiel setzten, als sie die halbe Welt mit Krieg und Vernichtung überzogen.
Wer mehr über die Hintergründe von Porzellan wissen will, der greife zu dem Insel-Band Die wüste Stadt. Sieben Dichter über Dresden (hrsg. von Renatus Deckert). In einem langen, nachdenklichen Gespräch spricht Grünbein über sein Verhältnis zu Dresden, der „Sandsteinschönen“, die er in einem frühen Gedicht einmal als „Barockwrack an der Elbe“ bezeichnet hat.
August Friebel, amazon.de, 21.10.2006
Vom Untergang meiner Stadt
− 1992 beginnt Durs Grünbein mit der Arbeit an dem soeben erschienenen Gedichtzyklus Porzellan – Poem vom Untergang meiner Stadt, der von Dresden handelt. Gewidmet hat der Autor dieses Langgedicht, in dem es Zwiesprachen mit den Eltern und der Großmutter gibt, seiner Mutter. −
Bertolt Brecht hat angesichts der Zerstörung der deutschen Städte durch alliierte Bomber von einer Radierung Churchills nach einer Idee Hitlers gesprochen.
Dieser Gedanke ist mal in einem frühen Gedicht von mir aufgenommen. Das hat diesen merkwürdigen Titel „Gedicht über Dresden“. Das steht in dem Band Schädelbasislektion und war damals als Endpunkt gedacht. Und seither hatte ich eine Art Moratorium. Ich hab mir geschworen: Nie wieder, aber auch nie wieder über diese Stadt zu schreiben, weil es mir zu nahe gegangen war. Das war damals ein ganz klarer Endpunkt. Und es hat viele Jahre gedauert bis ich wieder anfangen konnte, über Dresden zu reden.
Der Lyrikband Schädelbasislektion von Durs Grünbein, in dem sich das erwähnte „Gedicht über Dresden“ findet, wurde 1991 veröffentlicht. Ein Jahr später beginnt der Autor mit der Arbeit an dem soeben erschienenen Gedichtzyklus Porzellan – Poem vom Untergang meiner Stadt, der erneut von Dresden handelt. Gewidmet hat Durs Grünbein dieses Langgedicht, in dem es Zwiesprachen mit den Eltern und der Großmutter gibt, seiner Mutter. Die 49 Strophen, die aus jeweils zehn Zeilen bestehen, sind immer im Umfeld eines bestimmten Datums entstanden. Dann drangen die Stimmen von Untergegangenen an des Autors Ohr, meldeten sich die Toten aus einer versunkenen Stadt: „Leise, jedes Jahr im Februar trifft von weit her / Einen Nerv der Loreley-Ruf Dresden, Dresden…“, heißt es im Gedicht.
Zunächst mal ist das kein Gedichtzyklus im üblichen Sinne, dass man einfach nur ein Thema mit Variationen durchspielt, sondern diese einzelnen Teile sind über einen langen Zeitraum entstanden. Die waren zunächst mal eine Art Ritual, so ein Erinnerungsritual um den 13. Februar herum – so sind die meisten davon entstanden. Und später dann auch gibt es so ganze Strecken, wo hintereinander dann komponiert wurde. Aber das war nie als ein zyklischer Ablauf so geplant. Es sind mindesten sieben, acht Jahre gewesen vom allerersten bis zum letzten. Und der Untertitel ist z.B. erst später dazugekommen. Zu dieser Chiffre Porzellan, die für mich sozusagen der Inbegriff dieses kulturellen Dramas Dresden ist, eine feine, modellierbare Masse, der Inbegriff der barocken Kleinkunst ja auch, kam dann als Grundmotiv natürlich hinzu dieser Untergang der Stadt. Deshalb heißt es Poem vom Untergang meiner Stadt. Sehr emphatisch: meiner Stadt, weil ich da herkomme und weil mir dann Dresden offenbar auch zum Schicksal geworden ist.
Das einst prächtige, in barockem Glanz erstrahlende Dresden existierte bereits nicht mehr, als Durs Grünbein 1962 in der Stadt an der Elbe geboren wurde. Ihm zeigte sich Dresden nicht mehr in verzückender Schönheit, sondern in tristem sozialistischen Einheitsgrau, einer Farbe, die zum Grundthema seines ersten Gedichtbandes Grauzone morgens wurde. In dem neuen Poem Porzellan werden auch diese frühen Stadterfahrungen und -beziehungen aufgerufen, wird ihnen Platz im Hallraum Dresden eingeräumt, in dem sich viele Stimmen Gehör verschaffen.
„Ich war dabei, als Hitler an die Macht kam. Ich war dabei,
als meine jüdischen Nachbarn abtransportiert wurden. Ich
war dabei, als Dresden unterging.“ Friedrich Reck
Einmal ging er dort, gelangweilt á la Baudelaire…
Postplatz, Altmarkt, Prager Straße, einst ein Boulevard.
Im Beton verrecken werden sie. Es ward ihm schwer,
Sein entblößtes Herz, für so viel leeren Raum zu zart.
This heart sails, verlasst euch drauf, bis übern Rand.
Unerschütterlich, hat es sich angewöhnt zu büßen
Für so gut wie alles, was je schiefging hierzulande.
Alltag, Alltag… klingt nach Streß und Psychoanalyse.
Damals dachte er noch, diesen Frieden, jede Wette,
Überlebst du, in den kalten Krieg tief eingebettet.
Durs Grünbein spannt in Porzellan einen historischer Bogen zwischen August dem Starken und Churchills Zerstörung der Stadt. „Auch Dresden“, heißt es in dem frühen „Gedicht über Dresden“, „ist ein Werk des Malerlehrlings / Mit dem in Wien verstümperten Talent“. Diese Koordinaten werden zu Ausgangspunkten, um gelegentlich noch weiter in die Geschichte zurückzugehen, zum Beispiel bis zu den Assyrern. An anderen Stellen wiederum tastet sich Grünbein an jenes Dresden heran, das er aus eigenem Erleben kennt. Allerdings hat er bei dieser lyrischen Geschichtsrekonstruktion auch immer wieder Zweifel. Der Nachgeborene ist sich nicht sicher, ob er für diese Annäherung an Dresden, in der das Inferno jener Februarnacht des Jahres 1945 ein immer wieder aus verschiedenen Perspektiven dargestelltes Zentrum bildet, legitimiert ist.
Stop, wer spricht da? Dieses Schlitzohr, ist er Sachse?
Beißt sich durch die Gestrigkeiten, Clown und Historist,
Scherbensammler, Freizeit-Christ. Treibt seine Faxen
Mit der Scham, der Schande. Was uns Schicksal ist,
Scheint ihm Hekuba, dem Pimpf da, Pionier. Das flennt
Dicke Tränen und weiß nichts vom Heulen der Sirenen.
Keinen Schimmer, was das ist: die Stabbrandbombe.
Diese Brut, die Krieg nur aus Kinosesseln kennt,
Popcorn futternd dort im Dunkel, weit zurückgelehnt −
Schatten, Schulstoff-Wiederkäuer, Nachkriegs-Zombies.
Der Zweifler, als der sich Grünbein zu erkennen gibt, weiß, dass er bei dieser archäologischen Grabungsarbeit, in der er sich in die Untiefen der Geschichte begibt, Schaden nehmen kann. Aber das ist nicht die einzige Schwierigkeit, vor der er steht. Denn bei aller Nähe im Umgang mit der Geschichte der Stadt muss er gleichzeitig auf Distanz zu ihr gehen. Diese Gratwanderung ist für den Autor zur Herausforderung geworden. Denn er wollte in der Klage zugleich auch die Anklage formulieren, im Respekt vor den Opfern von ihrer Mitschuld sprechen und ihnen gerade wegen der unverständlichen Sorglosigkeit im Umgang mit ihrer Stadt Unschuld nicht zugestehen. Weil sich in der Geschichte nichts voraussetzungslos ereignet, konzentriert sich Grünbein im Gedicht nicht allein auf jene Schreckensnacht im Februar, sondern er verweist konsequent darauf, was der Katastrophe vorausgegangen ist. Es sind die Widersprüche, die ihn reizen. So erkennt es in der „Sandsteinschönen“ Dresden auch eine „Mätresse“, die sich zur Schau stellt und die verführerisch mit dem Feuer spielt. Geradezu lasziv lagert sie an den Ufern der Elbe, dem Fluss, der sich schlangenlinienartig durch die Landschaft windet und an Hogarths Linie der Schönheit erinnert – in der Februarnacht 1945 orientieren sich die Bomberpiloten am Flusslauf der Elbe, um Dresden nicht zu verfehlen.
Klar die Frostluft: unterm Flügel, Augenweide,
Lud der Fluß, ein schlankes S, die Bomberstaffeln ein.
Nachts der Stadt blieb keine Zeit, sich anzukleiden.
Besenhexe kocht. Kocht Glas, Metall, Asphalt und Stein.
Bombe, Bombe – blankpoliert, fiel durch den Schacht
Tonnenweise Schrott in den Mätressenschoß.
Augusts Pracht… „Nie gutzumachen diese Nacht“.
Schwarz vom Phosphorbrand: das sandsteinhelle Schloß.
Spaniens Himmel flammte auf, und Coventry und Guernica.
Von der Bella ante bellum – nichts mehr da.
Nach der Bombardierung Dresdens fanden sich in den Ruinen in großer Zahl Scherben, die Reste von Kaffee- und Speiseservices. Für das Gedicht sind gerade die Scherben zu Trägern von Botschaften geworden. Wie der Benjaminsche Allegoriker wendet der Dichter die gefundenen Bruchstücke in seiner Hand hin und her, und nimmt, was er gefunden hat zum Anlass, daraus Geschichte zu rekonstruieren. Dabei sind ihm die Scherben Teile eines ehemals Ganzen, denen neben zahlreichen anderen Botschaften immer auch die Chiffre „Untergang“ eingeschrieben ist.
Diese Verse selber sind sozusagen die Scherben nur noch. Die sind nur noch Splitter oder Abbreviaturen von einem viel größeren Zusammenhang, auch dem des Sprechens. Hier wird ja immer nur in wenigen Zeilen ein Gedanke verfolgt, so dass jedes einzelne Stück eben wie eine Porzellanscherbe ist. Und diese Porzellanscherben sind so ein Symbol und zugleich eine Realität. Das ist allerdings auch eine noch viel größere Chiffre, weil Porzellan oder Tonscherben ein Grundelement der Archäologie sind. Das ist das, worauf die Ausgräberschaufel immer wieder stößt.
Weil aber die einzelnen Teile kein Ganzes mehr ergeben und selbst genaueste Rekonstruktion die Bruchlinie nicht kaschieren kann, klingt in Grünbeins Versen beim Lesen zwar ein bestimmter Rhythmus an, doch versagt der Dichter dem Text eine durchgängige Rhythmik. Anzeichen dafür lässt er zu, aber konsequent unterbricht er, wenn die Sprache in einen bestimmten Rhythmus fallen will, und lässt sie ins Leere laufen. Dadurch werden Erwartungen nach Vollendung vom Autor nicht eingelöst, so dass sein Text einem Scherbenbett gleicht. Grünbein lässt in der Metrik des Gedichts zwar immer wieder eine klassisch-vollendete Form anklingen, aber der Dichter, der sich in der Tradition von Paul Celan auch als „Entreimter“ begreift, muss diese Form verweigern, weil das Gedicht angesichts der Katastrophen, von denen es handelt, Vollkommenheit nur noch andeuten kann.
Das ist auch ein Text, der poetologisch eine Gratwanderung macht, wo also Form und Inhalt idealitär – wahrscheinlich nicht immer, aber sehr oft – an solche Grenzen kommen des Möglichen. Wie sie übrigens nur gehen in metrischer Sprache. Allmählich wird mir das immer klarer: Man kann die zerstörten Formen nur wieder aufnehmen, indem man sie vorsichtig abtastet. Und deshalb meine ich, es geht hier nicht darum, ein für alle Male zu verzichten auf klassische Formen, es geht darum, die klassische Form eben ganz vorsichtig wie Scherben zu drehen und zu wenden, auf ihre Brauchbarkeit wieder zu prüfen. Eigentlich ist dieses Gedicht wie aus Splittern aufgebaut, die hier und da nur nebeneinander gelegt werden und manchmal sogar melodisch verklebt – aber die brechen wieder auseinander. Diese innere Formdynamik ist dem Ganzen eingeschrieben.
Durs Grünbein wechselt in dem Poem ständig die Tonlagen. Das reicht von äußerstem Sarkasmus bis hin zur Melancholie. Dann wiederum gibt es neben der Faktentreue, die dem Gedicht eingeschrieben ist, und einer an verschiedenen Stellen auffälligen dokumentarischen Kälte auch Passagen von eigenwilliger Emphase. Aber nicht nur die Tonlagen wechseln, sondern es gibt auch einen ständigen Stimmenwechsel, wenn das lyrische Subjekt Fragen aufwirft, sich selbst in Frage stellt, sich ins Wort fällt, Zeitgenossen zitiert und sich in Dialoge mit historischen Personen begibt. Durs Grünbein hat sich mit dem Poem Porzellan in die Schar jener Künstler eingereiht, die seit Jahrhunderten fasziniert sind von der barocken Schönen an der Elbe. Doch seine Faszination ist gebrochen durch die Nacht vom 13. auf den 14. Februar 1945. Angesichts dieser Zäsur rekonstruiert er das Schöne mit Blick auf den Untergang und vermag von Anmut nur im Angesicht des Todes zu sprechen.
Eine Schönheit war sie, schwatzhaft, üppig, provinziell.
Um die Hüfte, silbern, lag als Schärpe ihr der Fluß,
Der bei Vollmond lockte. Und wie hat man sie entstellt,
Arme Galatea. Springt man so mit Frauen um?
Schwäne zierten sein Service – und so aus einem Guß
Wie des Grafen Brühl Geschirr war sie, die kurvenreiche.
Schokoladenmädchen, stolzes, bist vor Schreck verstummt,
Als die Muscheln platzten und die Schnecken und Delphine
Berstend in die Tiefe sanken, die kein Wort erreicht
Wer versteckt schon Munition in Porzellan-Terrinen?
Michael Opitz, Deutschlandfunk, 27.09.2005
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Hans-Dieter Schütt: „Und tauscht die Zeiten, Räume, Maße“
Neues Deutschland, 31.8.2005
Beat Mazenauer: Poem auf die Heimat
Volltext, Heft 6, 2005
Katharina Döbler: Forchtbar [sic!] klassisch
Die Zeit, 26.1.2006
Friedmar Apel: Zerdeppertes Porzellan
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 4.4.2006
Friedmar Apel: Ja, es tut noch weh
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 18. 2. 2006
Michael Eskin: Streets of china
The Times Literary Supplement, 9. 6. 2006
Dora Osborne: „Diese heiklen Formen“. Destruction and desire in Durs Grünbeinʼs Porzellan
The Germanic Review, Heft 1, 2014
Ein Gespräch mit Durs Grünbein
Olga Olivia Kasaty: Poesie wird als Flaschenpost, Einmachglas, Widerspruch, Verdichtetes, Lied, als Kunst des Unvorhersagbaren, als Weltsprache bezeichnet. Sie ist jedenfalls etwas Wunderbares, weil sie Dinge aufzeigt, die man sonst übersieht. Wie definieren Sie Poesie?
Durs Grünbein: Poesie ist eine Form der imaginativen Erkenntnis. Es ist eine Form zu denken, absolut gleichrangig der Philosophie. Man weiß, dass die Philosophie und die Poesie aus einer Wurzel kommen aus frühester vorsokratischer Zeit – und bis heute gibt es Indizien dafür, dass sie beide aus einer und derselben Quelle schöpfen. Das Problem der Poesie gegenüber der Philosophie ist, dass sie immer wieder im Subjektivismus verschwindet, das heißt, selbst die größten Dichter der Welt sind am Ende nur Beispiele für sich selbst. Einige von denen sind modellhaft geworden, wie Homer oder Dante, oder auch Dichter des 20. Jahrhunderts wie Rilke, Benn – diese Dichter könnten theoretisch wie die Philosophen Schulen gebildet haben, aber ich glaube, die Rezeption von Poesie ist eine andere, als die von Philosophie. Man kann sich schwerlich vorstellen, wie und von wem Poesie argumentativ rezipiert wird. Sie wird interpretiert, sie wird nicht in dem traditionellen Sinne gelehrt. Es gibt offensichtlich verschiedene Formen der Aufnahme von Poesie und von Philosophie, aber es ist auffällig, wie oft die Poesie mit der Philosophie flirtet. In guter Poesie stecken inklusive eine Erkenntnistheorie, eine Ethik, eine Morallehre und eine Seinslehre und sogar eine Logik. Eine sehr gute Poesie – all diese Elemente sind ihr im Grunde inhärent. Das findet sich in Poesie, aber eben stark subjektiviert, deshalb kam Schulbildung. Wir können von Aristotelismus, Platonismus, aber wir können nicht von Dantismus sprechen, und wir würden nie von Baudelaireismus sprechen. Darin sehe ich die Schwierigkeit, dass Dichtung immer wieder marginalisiert wird, und sie hat auch zu viele falsche Liebhaber. Es scheint so zu sein, dass Poesie für die meisten Menschen nichts mit strengem Denken, nichts mit intensivem Fühlen und Empfinden zu tun hat, sondern eher eine Liebhaberei ist.
Kasaty: Poesie ist ein Elixier für die Seele, nach Michael Lentz gar „Lebenselixier“. Ist das eben nicht das Schöne, ja Mitreißende an Poesie, dass man ihr verfällt, dass man sich von ihr verführen lässt? Besteht in dieser Verführungskraft nicht gerade das Magische, ja Überwältigende der Poesie? Sie scheinen hingegen den gehobenen Anspruch zu vertreten, Poesie mit strengem Denken zu verbinden und mit der Philosophie auf eine Stufe zu stellen?
Grünbein: Ja, das ist schon richtig, aber es ist das alte Versprechen der Poesie, dass sie sehr intim sei, bzw. ein Zwiegespräch, was sie oft auch ist, auch die gute, aber aus dieser Intimität wird abgeleitet, dass jeder ihr gleich nah ist, jeder sich sofort auskennt und jeder sofort mitspielt.
Kasaty: In der Antike schrieb man den Dichtern eine direkte Verbindung mit den Göttern, dem Gott zu. Diese ersten griechischen Dichter, Aoiden, mussten immerfort ihren privilegierten Kontakt mit den Göttern beweisen.
Der Ursprung der Lyrik liegt darüber hinaus im sakralen Bereich, auch wenn die Volksdichtung sie immer wieder auftauchen ließ. Glauben Sie, dass auch heute Dichter Auserwählte sind, die aus einer inneren magischen Kraft schöpfen?
Grünbein: Es gibt offenbar einen Dämon, wie Sokrates sagt. Des Menschen Dämon ist sein Schicksal, d.h. in dem jeweiligen ist eine Kraft, nennen wir es Seelenkraft, nennen wir sie Manie, oder Monomanie, oder alles Andere; wir können sie auch negativ bezeichnen, aber etwas ist in ihm, das sich definitiv abspaltet, um dann im zweiten Schritt sich wieder mit der Menschheit zu verbinden. Ich glaube, dass Dichter unter extremen Schuldgefühlen leiden, weil sie derart abgespalten sind, aber am Ende wollen sie idealerweise die ganze Menschheit umarmen.
Kasaty: Sich im Dienste der Kreativität abzugrenzen, bedeutet häufig Vereinsamung und Einzelgängerexistenz. Ist dieser Hang zum Einzelgänger eine unerlässliche Voraussetzung für die Dichtung?
Grünbein: Ja, sicherlich. Aber es ist schon auffällig, dass die großen Dichter eine seltsame Sprache gesprochen haben, die kein Mensch recht versteht, die lächerlich wirkt, manieriert. Nehmen wir drei Fälle: Hölderlin, Mallarmé oder Celan. Das sind drei Versuche, eine eigene Sprache zu entwickeln. Ein deutscher Dichter hat einmal gesagt: Hölderlin spricht eine dem Deutschen verwandte Sprache. Es ist definitiv so – drei Dichter, die sehr weit gekommen sind, extrem weit gegangen sind, sich speziell auszudrücken, und einige lieben sie dafür bedingungslos, und diese bedingungslose Liebe ist ein Zeichen für eine gute Dichtung, so dass man sich streiten kann, wer der größte Dichter sei.
Kasaty: Von Joseph Brodsky stammt der wunderbare Satz, dass Lyrik die schönste Form der menschlichen Rede sei. Sie sind Dichter, Übersetzer, schreiben Essays, arbeiten auch für das Theater. Der Kern Ihrer Arbeit liegt bei Ihnen aber mit Sicherheit in der Dichtung?
Grünbein: Natürlich in der Dichtung. Am liebsten würde ich immerfort nur Gedichte schreiben. Ich habe angefangen Essays zu schreiben, zunächst um mir selbst Klarheit zu verschaffen. Allmählich habe ich bemerkt, dass die Menschen aus meiner Umgebung mich darin kennen lernen konnten; und dann habe ich das getan, um transparenter zu sein für meine Zeitgenossen; aber Essays sind nicht wichtig. Es war so, als würde ich in dem Moment die Maske fallen lassen, und all die scheinbar strengen, durchdachten und durchgearbeiteten Gedichte würden in diesem Moment banalisiert, durch diese Art von offener Prosa. Das Schreiben von Essays liegt an unserer Zeit, alle großen Dichter des 20. Jahrhunderts taten das – weil der Leser wissen will, wo man herkommt, wie man lebt, welche Erfahrungen man gemacht hat. Man versucht, durch Essays Sachen, die man schafft, besser zu erklären.
Man tut das entweder mit Literaturgeschichte, Poetologie oder Biografie, weil es nur diese drei Strömungen in der Essayistik gibt. Aber das, was ich mache, nenne ich gar nicht Essayistik; ich habe von Anfang an gesagt, das sind alles nur Aufsätze.
Kasaty: Sie haben auch bis jetzt keine Prosa geschrieben. Können Sie sich denn ausmalen, einmal einen Roman zu schreiben?
Grünbein: Ich habe bis heute meine Scheu vor der reinen Prosa. Ich weiß, wie genau und wie präzise man Worte setzen muss, wenn man Prosa schreibt. Die Poesie ist eine Art Äquivalent zur Mathematik.
Ich beobachte, wie es immer wieder zu merkwürdigen kleinen Prosatexten kommt, aber das ist lange nicht die große Erzählung.
Kasaty: Lag der Ursprung Ihres Schreibens in der Enge, der bedrückenden Ausweglosigkeit der Heimatstadt – wenn ich Sie zitieren darf:
Es kam, wie es kommen musste, ich blieb in der Enge, im Schatten einer chinesischen Mauer, territorial eingeschränkt auf einen Raum, der nur wenig größer und für Fremde kaum weniger unheimlich war wie Albanien. Und eines Tages, urplötzlich und unangekündigt, begann ich Gedichte zu schreiben, wie jemand, der sich einer eigenen Sache zuwendet, nachdem er gemerkt hat, dass alle anderen ganz gut ohne ihn auskommen.
oder hat Sie doch das Lesen zum Schreiben geführt?
Grünbein: Natürlich das Lesen! Jeder, den ich kenne und der so sehr mit Literatur verbunden ist, wie ich das bin, hatte ganz lange Phasen der Lesezeit. Zwischen meinem fünfzehnten und siebzehnten Lebensjahr war ich versunken in Romane; ich habe damals vor allem Prosa gelesen – viel Dostojewski, Thomas Mann, auch Tschechow, Balzac, Dickens und Stendhal – und schon damals habe ich gedacht: Ich möchte eines Tages große Romane schreiben. Das Problem ist nur, dass ich bis heute die lyrische Dichtung als Romanvermeidung betrachte. Eines Tages, wenn alle Ausdrucksmittel in Bewegung sind, kann man anfangen, als Dichter ins Erzählen überzugleiten. Es gibt große Prosa, Proust ist ein Beispiel – in seinem Werk spielte die Dichtung eine tragende Rolle, das heißt, für ihn stehen im Zentrum ein paar der dichtesten Formulierungen, ein paar Vorzeichen, was heißt, er komponierte seine Prosa um diese konzentriertesten Momente des Ausdrucks herum. Joseph Brodsky hat das sehr schön und sehr russisch ausgedrückt – Poesie ist die Zuchtmeisterin der Prosa. Sie erzieht auch den Prosaschriftsteller zum genauen Ausdruck.
Kasaty: „Ich habe Bücher gehortet wie ein Mönch hinter Klostermauern im Mittelalter. Immer wieder habe ich ihn (Ezra Pound) gelesen, wie ein Klosterschüler die Psalmen“, sagten Sie neulich. Als literarische Vorbilder nennen Sie Elias Canetti, Ossip Mandelstam, Joseph Brodsky und als eine frühe, aber prägende Lektüre LTI von Victor Klemperer. Welchen Autoren räumen Sie in Ihrem Schreiben noch einen besonderen Einfluss ein?
Grünbein: Goethe ist für mich die wichtigste Figur in der deutschen Literatur. Immer! Auch als Mensch. Er konnte zum Beispiel nicht ertragen, wenn Leute am Tisch über Politik redeten, weil er wusste, wie schnell so ein Gespräch die Menschen in Parteien spaltet. Alles, was Goethe geschrieben hat, lese ich jetzt über ein ganz anderes Prisma, und ich traue mich zu sagen, dass ich einer seiner besten Leser bin. Ich würde gerne mit ihm sprechen und ihm alles zeigen, woran ich gerade arbeite.
Ein zweiter Kronzeuge ist Ossip Mandelstam, der sagte: Dieses ganze Dichterdasein läuft offenbar auf einen Dialog hinaus – und das ist eine Grunderkenntnis. Der Dialog schützt uns vor dem Versinken in der Nichtigkeit der Subjektivität, das heißt, wir sind gezwungen zu dialogisieren, versteckt oder offen, innerlich oder äußerlich. Es ist ein Paradox – es ist nicht denkbar, dass ein Autor alles andere ignoriert, und schon die Idee der Ignoranz setzt voraus, dass ich weiß, was ich ignorieren muss – und das ist das Paradox.
Kasaty: 1988 wurden Sie – dank Heiner Müller – zur Frankfurter Buchmesse eingeladen, was Ihnen die Gelegenheit bot, aus der sozialistischen Enge herauszukommen, Dresden und die ehemalige DDR temporär zu verlassen. Heiner Müller spielte damals und spielt wahrscheinlich auch heute noch eine sehr wichtige Rolle in Ihrem Leben. Nach einem freien Wunsch gefragt, antworteten Sie:
Ich würde gerne noch einmal ein paar Worte mit Heiner Müller reden.
Was macht die herausragende Bedeutung Heiner Müllers für Sie aus?
Grünbein: Heiner Müller war vor allem ein großer Kommunikator. Ich habe keinen Menschen mehr getroffen, der so verbindlich war. Er hat alles verbunden – Osten und Westen, rechts und links, Vergangenheit und Zukunft, jung und alt, alles!
Er war die liebenswürdigste Person, die mir unter Dichtern begegnet ist. Er hat mir sekundenschnell ein Gefühl gegeben, dass alles sich lohnen würde, wenn man nur festhält am Wort. Irgendwann las ich eines seiner Interviews; es war auf Englisch geführt, und dann ganz zum Schluss kam der Moment, wo der Interviewer ihm ein Wort in den Mund legt und sagt „so you would say you are“? Und Müller antwortete: „yes. The last German poet“.
Dieses Bewusstsein, jemanden im Leben getroffen zu haben, der einen durch die Zeiten trägt, bei dem man die Grundkraft der Literatur am Werk gesehen hat, und das ist das aller Wichtigste – es lohnt sich, es geht weiter, es ist da!
Heiner Müller war auch derjenige Autor, der mir das Gefühl vermittelt hat, das Ganze hat einen Sinn…
Kasaty: Sie sind im Oktober 1962 in Dresden geboren und im Dresdner Vorort Hellerau aufgewachsen, in dem die sowjetische Armee einen Manöver- und Übungsplatz unterhielt. Aus Ihrer Kindheit gibt es vermutlich viele mit Panzern, Manövern und Patronenhülsen verbundene Erinnerungen. Es war einerseits eine fröhliche Kindheit, andererseits auch eine leider nur durchlebte Kindheit, so kommentierten Sie sie 1995 in Darmstadt selbst. Ist es demnach eine hergeholte Vorstellung, dass Ihnen die Poesie in die Wiege gelegt wurde?
Grünbein: Ja – ich bin aufgewachsen weitgehend unter Naturwissenschaftlern und rational denkenden Menschen. Der Vater ist Ingenieur, die Mutter ist Chemielaborantin, und obwohl alle in der Familie lasen, war die Frage nie geklärt, was das alles eigentlich soll. Natürlich war das ein reiner Zeitvertreib, sowohl das Lesen, als auch mein Schreiben. Ich will nicht sagen, dass es peinlich war, aber es ist selbstverständlich für einen tiefrational denkenden Menschen eine Peinlichkeit.
In der ganzen Antike hatte Poesie eine stark geprägte Unterhaltungsform, weil die Menschen ohne Radio, ohne Fernseher und ohne Zeitung lebten, und die Menschen waren auf die Anderen angewiesen, die ihnen etwas vorsangen, erzählten und die es schafften, mit forciertem Ausdruck, in ihnen Gedanken und Gefühle wachzurufen, und diese Menschen – Dichter eben – galten in der Gesellschaft durchaus als wertvolle Mitglieder. Nehmen wir die Römische Kaiserzeit – und den Ovid, Properz, Horaz, die waren am Kaiserhof deshalb, weil sie perfekte Unterhalter waren; viele der Kaiser schrieben selbst, das heißt, es war eine Art Wettkampf. Niemals hätte man das infrage gestellt. Später aber, in christlichen Zeiten, in frühbürgerlichen Zeiten, stellte man Poesie gerne infrage, Poesie galt als süßer Zeitvertreib. Heute kehren der Spaß, die Lust und die Libido an der Literatur zurück, aber auf eine ganz andere Weise. Das sieht man genau an der Dichtung – es herrscht wenig Notwendigkeit, wirklich einzigartig im Ausdruck zu werden; der große Effekt genügt schon, aber es ist nicht neu. Die Avantgarden liefen auf Effektvergröberung hinaus, weil es schon eine ausdifferenzierte und verfeinerte Form gab, so sind die Avantgarden natürlich dagegen gegangen. Es ging um Neoprimitivismus, starke Sensationen, Dadaismus, Ausschreien, Brüllen und Schockieren. All das hat sich jetzt erledigt, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es bereits wieder ein Formgefühl gibt. Heute wird die Dichtung gern infrage gestellt – warum tust du das?, warum machst du nicht etwas anderes, etwas Vernünftiges? Warum musst du dich ständig zurückziehen und diese komischen und schwierigen Texte schreiben, die vielleicht 200 Leute lesen?
Mir wurden auch solche Fragen gestellt – wovon willst du eigentlich leben? Soll das dein Lebensinhalt sein? Heute beruhigt es mich ein wenig, dass ich davon leben kann, was ich mache, und dass ich das tue, was ich machen wollte.
Kasaty: Das ist schlicht und einfach ein großer Erfolg! Uwe Kolbe sagte neulich:
Mit Gedichten erreicht man nur selten irgendwelche Bestsellerlisten, es sei denn, man heißt Grünbein oder Enzensberger.
Sind Sie darüber von Zufriedenheit erfüllt?
Grünbein: Ja, sicher, aber da kehrt wieder die Unzufriedenheit zurück. Die kehrt immer wieder, auf allen Stufen und in allen Lebensphasen. Ich kenne keinen Menschen, der mit sich komplett zufrieden wäre. Und dieses tägliche Ringen um Ausdruck kann als solches niemanden zufriedenstellen. Ich glaube manchmal, dass Dichter die unglücklichsten, kränksten und versponnensten Menschen überhaupt sind. Da haben sie etwas zustande gebracht, was heißt: „wie großartig“, aber es nützt ihnen nichts. Sie leiden weiter, sie meinen, dass sie immer noch nicht das Richtige gesagt haben. Sie werden oft von dem Gedanken geplagt, dass sie es niemals schaffen werden.
Kasaty: Die Fülle des Buchmarkts ist schier unüberschaubar. Lässt sich diese verwirrende Vielfalt qualitativ ordnen? Existieren Kriterien, die eine Dichtung zur meisterhaften Dichtung erheben und derer sich ein Dichter systematisch und frei bedienen kann?
Grünbein: Vor allem müssen wir bei dieser Frage auf einen Unterschied achten! Wir müssen unterscheiden zwischen bloßer Textproduktion und den seltenen Momenten der Intuition und der Meisterschaft. Nennen wir das einfach: die Begegnung mit einer höheren Instanz. Nichts davon ist verfügbar! Ich glaube, die wichtigsten Texte, die ich geschrieben habe, habe ich nie planen können, zumindest nicht so. Mich ängstigt die Vorstellung, dass alles sogleich konsumiert und verwertet wird. Ja! Wenn ich mir ansehe, welche Bücher in den Schaufensterauslagen nebeneinander liegen, dann bekomme ich Angst – alles scheint gleichwertig zu sein.
Aber man erkennt instinktiv, was gut oder schlecht ist. Man spürt es. Es gibt Vierzeiler, die ein ganzes Weltbild erfassen können – und das ist die gute Dichtung. Danach suche ich. Wichtig ist die Komplexität des Ausdrucks.
Kasaty: Ähnlich wie Heiner Müller haben Sie in der Frühmoderne einen Ausweg aus Ihrer sozialistischen Herkunft erkannt, was die Frage nach Ihrer ganz privaten Theorie der Moderne nahelegt. Handelt es sich bei der Moderne um eine datierbar-historische Epoche oder eher um eine grundlegende mentale Disposition?
Grünbein: Die Moderne ist transhistorisch, sie zieht sich durch alle Epochen. Es gibt viele Modernen in der Literaturgeschichte – nehmen wir Horaz, der auf seine Weise absolut modern war, und nicht weniger modern war, sagen wir, Leopardi. Es ist Unsinn zu bestreiten, dass Shakespeare modern war. Jeder, der eine neue Sprache fand, war auf seine Weise modern, auch wenn er die ältesten Dinge aussprach. Ich bin überzeugt, dass die Moderne sich zu Sternbildern am Himmel formuliert – über den Zeiten. Diese Punkte der Moderne leuchten mit großer Intensität.
Die Menschheit ist schon sehr lange erwachsen; diese Vorstellung heute, dass man glaubt, erst jetzt seien wir erwachsen und akzeleriert, und all die anderen seien nur wie Kinder gewesen, ist selber kindisch. Ich glaube sogar, dass diese Zeit weniger erwachsen ist, als alle anderen Zeiten das waren. Erwachsensein ist eine starke Form, eine starke Energieform des Menschen in der Zeit. Die besten Dichter unserer Zeit wussten das alles, und das macht sie so großartig. Es war ihnen bewusst, was da ist, was alles man wahrnehmen muss, womit man reisen muss durch diese Zeit; nichts davon darf vergessen werden, nichts davon war kleiner als man selbst ist – keinesfalls! Nur dieses tägliche Aufrichten an dem, was da ist, bringt etwas.
Kasaty: Was halten Sie persönlich für Ihr wichtigstes Werk?
Grünbein: Das ist sehr vorläufig, aber im Moment ist es mein langes Gedicht über Descartes. Hier habe ich vieles konzentriert, was ich je wollte. Mein Hauptwerk ist aber Vom Schnee – auch wenn das das unbekannteste Werk in Deutschland ist. Dieses Buch ist wie ein Fremdkörper eingeschlagen. Es liegt als Findling auf den sauberen Fluren der deutschen Literaturlandschaft.
Kasaty: Sie haben bis jetzt drei große Werke ins Deutsche übersetzt: Aischylos Die Perser (2001), Seneca Thyestes (2004) und Aischylos Sieben gegen Theben (2003). Was bedeutet für Sie Übersetzen – manche Dichter erzählen, es sei eine Art Fingerübung. Für andere ist Übersetzen einfach eine besondere Form passionierten Lesens. Was ist Übersetzen für Sie?
Grünbein: Übersetzen ist im idealen Fall Nachdichtung – was ein Dichter einem anderen Dichter in seiner Sprache wieder erschafft. Es gibt ja mittlerweile Übersetzungstheorien, auch eine Philosophie der Übersetzung, denken Sie mal an Walter Benjamin, in der alle Paradoxien und alle Unmöglichkeiten der Übersetzung durchgespielt werden, und im Grunde die Verzweiflungsrolle der Übersetzung gezeigt wird. George Steiner spricht von der „Traurigkeit der Übersetzung“, und diese Traurigkeit der Übersetzung besteht darin, dass der Übersetzer weiß, er wird das niemals schaffen, es ist nicht zu schaffen, er kann es nur transponieren in seine Sprache. Poesie hat sehr viel mit dem Eingeweihtsein zu tun; man muss sich sehr lange und sehr intensiv mit dieser anderen Sprache, mit dem anderen Geist und oft auch mit der anderen Zeit so beschäftigen, dass man es wagen kann, überhaupt einen Versuch zu unternehmen, mit Hilfe der eigenen Muttersprache eine parallele Welt aufzubauen.
Kasaty: Sie sind für Ihre Vorliebe für die römischen Dichter bekannt, zu deren Lebzeiten Liebe bereits zu den Hauptthemen der Dichtung gehörte. Enheduanna, die erste weibliche Dichterin schrieb Liebesgedichte, ebenso Pioperz, Catullus und Sappho. Liebe figuriert also als eines der ältesten Themen der Poesie, wiewohl sie in der Literatur oft unerfüllbar bleibt!
Grünbein: Liebe – das ist eigentlich das Einzige, was wirklich interessiert. Die Frage lautet – gibt es hier draußen ein paar Menschen, denen ich mich so verständlich machen kann, dass wir einander erkennen bis auf den Grund?
Bei den Troubadour-Dichtern sieht man es genau: je unmöglicher die Liebe ist, desto inniger ist der Ausdruck. Die wahre Arie der Troubadoure hat mit der Unerreichbarkeit der Angebeteten zu tun. Literatur hat Wege gefunden, Liebe darzustellen, zu feiern, heilig zu halten, ohne das sie erfüllbar war. Ja, die große Literatur hat immer etwas mit der Unerfüllbarkeit zu tun, aber erfüllt in der Literatur selbst – in der Darstellung.
Ja, oder noch besser – zum Bereich des Erhabenen. Das Erhabene hat als Bild das Gebirge oder das Meer; die Unendlichkeit. Es ist ein Topos in der ganzen Lyrik – die Unendlichkeit, und die ist bedrohlich. Liebe ist nämlich ein totaler Angriff auf das Individuum. Der Mensch löst sich im Grunde auf, eine kontrollierte Liebe wäre nur lächerlich. Die Liebe kann nicht kontrolliert werden. Wenn sie stattfindet, wird alles stehen und liegen gelassen; Familien werden gesprengt, die Körper zerrissen. Eros ist eine ungeheure Kraft – das sahen schon die ältesten Philosophen. Ähnlich einem Vulkanausbruch, einem Waldbrand. Vielleicht liegt es daran, dass die ganz glücklichen Menschen keine Literatur schreiben können, und wo die Liebe gelingt, gibt es keine Notwendigkeit mehr, etwas anderes zu tun als diese Liebe, dann braucht man keine Anstrengung mehr. Und nicht nur die große Dichtung, sondern auch Malerei, Musik und Kunst überhaupt – haben immer etwas mit einer unerfüllbaren Liebe zu tun. Nehmen wir Tristan – ein Monument einer unerfüllten Liebe. Diese Geschichte lebt davon, dass diese Liebe von Anfang an nicht gelebt werden kann. Bei Wagner ist die Grundidee, dass Liebe und Tod in eins gehen, das heißt: in dem Moment, in dem die größte Innigkeit erreicht wird, ist klar, dass die beiden sterben müssen. Aber mit diesem Tod ist wenigstens die Liebe gerettet.
Und Liebe ist ohne Eifersucht nicht zu denken. Eifersucht ist ein Begriff, der dazu gehört. Es gibt allerdings mehrere Facetten der Eifersucht, und bei der Liebe ist Eifersucht die Angst, jemanden an jemand Anderen zu verlieren, aber auch alles zu geben, damit der Andere das Gefühl kriegt, er ist der Beste, der Schönste und der Klügste. Dieses Spiel geht in der Tat übers Religiöse, und das Schöne daran ist, dass Religion und Libido oder Religiosität und Hedonismus zu gleichen Teilen dabei sind.
Wenn man aber über Liebe spricht, dann muss man sofort über die Sexualität, den Eros sprechen – und das ist das Nächste, wo ich glaube, dass Römische Dichter, nehmen wir jetzt Ovid als Beispiel, extrem weit in der Darstellung gegangen sind. Sie haben ein ganzes Feld erschlossen. Wenn man es daran misst, sieht man, dass vieles, was scheinbar modern ist, sehr mangelhaft zugespitzt ist.
Kasaty: Liebe ist wahrscheinlich das am meisten überschätzte Gefühl der Welt. Sie fungiert als eine Art Passepartout, und jedermann setzt voraus, dass sein Nächster weiß, worum es in ihr geht. Wie lautet Ihre private Definition der Liebe?
Grünbein: Liebe ist eine Definition von Zeit – die Zeit der Liebe ist eine sehr kurze; das ist das Zeitfenster. Man ist so verliebt, dass alles Erträumte stattfindet, und dieser hormonelle Zustand der Verliebtheit ist der Höhepunkt der Liebe, der sehr kurz andauert und sich nicht künstlich herstellen lässt. Ich glaube, Liebe funktioniert so, dass es diesen absoluten hormonellen Ausnahmezustand gibt, dann gibt es bei manchen große Treue, die lebenslange Erinnerung daran ist. Es ist eine sehr nostalgische Angelegenheit – sich immer wieder daran zu erinnern, wie es war.
Kasaty: Manchen Büchern der 1990er Jahre bescheinigt man, dass sie die neue Generation in Deutschland widerspiegelten. Eine Generation, die kommunikationsunfähig sei, die irgendwie in Liebe und Angst befangen das wirkliche Leben verfehle und das Scheitern der eigenen Lebenspläne mehr melancholisch beobachtend als trauernd erlebe. Haben wir es seit den 1990er Jahren mit einer verlorenen, zur Liebe unfähigen Generation in einer gesättigten Konsumgesellschaft zu tun?
Grünbein: Es gibt keine Gesellschaft ganz ohne Liebe, und wir erleben hier, dass Liebe in ganz kleine Portionen aufgeteilt wird. Jeder liebt irgendwie, und jeder hat irgendwie ein wenig Liebeserfahrung und hat ein wenig Liebe gemacht. Die Frage ist, wieviel davon ist unbedingt? Davon zehrt die ganze Kultur-Industrie. Da, wo die Liebe stattfindet, machen die Menschen Dinge, die sie sonst niemals tun würden, dass man alles, was eben noch Ordnung war, plötzlich infrage stellt. Es gibt offenbar mehr Kräfte in der Gesellschaft, die Liebe einhegen wollen, reglementieren oder normieren, und sicher ist das die latente Tragik der meisten aufgeklärten modernen Menschen, dass sie sehr wohl wissen, was die Liebe ist, aber der Liebe niemals Raum gegeben werden darf. Rein philosophisch gibt es ein Problem zwischen Liebe und Freiheit, dann gibt es einen Konflikt zwischen Liebe und dem organisierten Leben, zwischen Liebe und Karriere, zwischen Liebe und Beruf, zwischen Liebe und Sicherheit. Ich glaube, dass Liebe eine dieser Kategorien ist, die alle Diskurse sprengen.
Kasaty: Es ist weiterhin eine Generation, die in eine neue Realität katapultiert wurde, von heute auf morgen eine neue Heimat „verpasst“ bekam; Honecker musste abdanken, ohne dass Kohl schon eine vertraute Größe darstellte. In Ihrem Gedichtband Falten und Fallen (1994) wird der Mensch zum zoologischen Wesen, das sich verloren in der Metropole, in der durchvisualisierten Welt zu bewegen versucht, das gleichzeitig aber nur ein winzig kleiner Teil der allgegenwärtigen Verkehrsströme ist.
Grünbein: Dieses Volk hatte 40 Jahre lang die Erfahrung der Teilung gemacht – aus historischen Ursachen, die aus dem Ausgang des Zweiten Weltkrieges stammen; die Menschen, die geografisch gesehen im Osten lebten, sind von Russen okkupiert worden. Die anderen hatten das Glück oder die Chance, von den Westalliierten befreit zu werden, und diese Befreiung war in der Tat auch die Befreiung zu sich selber. Das heißt, die hatten und haben die Möglichkeiten, die alle Menschen in Westeuropa haben, mit der viele nichts anfangen können oder wollen, aber sie haben sie. Während unser Teil Deutschlands zu diesem ganzen riesigen östlichen Gulag-System – von Thüringen bis Wladiwostok – gehörte. So sind zwei Mentalitäten entstanden, zwei verschiedene Arten, sich mit einer Sprache, derselben Muttersprache, die Welt zu erklären, und das schlägt bis zu jedem Einzelnen durch. Jeder Einzelne hat eine Erfahrungsdifferenz und muss das anders verarbeiten. Nach meiner Beobachtung begannen schon in den späten 1970er oder Mitte der 1980er Jahre viele damals westdeutsche Schriftsteller, sich sehr intensiv für den Osten zu interessieren, weil dort die viel interessanteren Stoffe für den Roman und für die Erzählung lagen. Scheinbar liegen mehr Geschichten im Osten als im Westen auf den Straßen – es ist aber nur eine Frage der Methodik. Oft ist es viel interessanter, amerikanische oder westeuropäische Schriftsteller zu lesen, die mit dieser überregulierten Welt von heute zu tun haben. Die müssen ganz andere Strategien des Erzählens entwickeln und kommen oft auf viel interessantere Lösungen. Die Erfahrung der Teilung war für mich seelisch immer sehr nah, und ich wusste, ich gehöre zu diesem Teil der Menschen mit dazu. Für mich gab es jedoch diese Teilung innerlich niemals! Ich werde es nie akzeptieren, nicht einmal nachträglich.
Ich kann jetzt rein kulturhistorisch ein paar Unterschiede feststellen, und ich glaube, dass ich anders sozialisiert bin, und ich glaube auch, dass in mir drin eine ganz andere Aktualität der Welt abläuft; ich glaube z.B., dass mich der ganze russische Osten mehr interessiert als viele meiner westdeutschen Kollegen. D.h. mein Weltbild ging immer vom äußersten russischen Osten, bis hinüber an den Pazifik nach Kalifornien. Es war für mich immer gleich wichtig. Mich hat der damals unbekannte Westen damals natürlich noch viel mehr interessiert, aber er hat mich nicht viel mehr interessiert als der für mich unbekannte Osten. Ich habe mich immer als jemand begriffen, der innerlich zwischen Moskau und New York im Geist pendelt.
Mehr kann ich dazu nicht sagen – dieses Volk ist auf Grund von eigenem Verschulden geteilt worden – und das zu Recht, diese Art von Buße musste sein für das, was getan worden war. Es hat kein anderes Volk im 20. Jahrhundert so sehr gegen die Menschheit gesündigt wie die Deutschen. Das Volk wurde dann zwischen den Alliierten zerrissen – und das ist ein eindeutiges Ergebnis. Ich finde das völlig gerecht! Auch wenn die Russen ihren Teil bis zuletzt kontrollierten, diese 40 Jahre endeten pünktlich da, wo die Russen sagten, wir wollen nicht mehr kontrollieren. Und ich bin mir sicher, dass der polnische Aufstand ein entscheidender Impuls für die Auflösung war, aber für die DDR war entscheidend, dass Gorbatschow entschieden hat: Wir greifen nicht mehr ein. Das war eine große historische Sternstunde, großartig für alle, und in diesem Moment war die Strafe beendet. Das deutsche Volk, d.h. das ostdeutsche Volk, hatte eine Gefängnisstrafe bekommen – und die ist pünktlich 1989 aufgehoben worden. 1989 ist der ostdeutsche Teil der Deutschen sozusagen begnadigt und aus seinem Gefängnis entlassen worden.
Kasaty: Und wie würden Sie kurz hervorstechende Merkmale unserer Zeit umreißen?
Grünbein: Wir leben in einer Zeit, in der alles gleich wichtig ist. Der Papst, die Pornografie, die Mode, eine philosophische Idee, ein politischer Standpunkt – all das ist in dem neuen Kommunikationsnetz gleich wichtig und kommt jeden Tag mit derselben Intensität vor.
In unserer Zeit, oder in der Zukunft, wird alles passen. Es sind alle Sprachen, Stile, auch alle Retrospektiven erlaubt. Die Menschheit hat einmal alles ausprobiert, und jetzt kann alles wiederholt oder verbessert oder neu gemischt werden. Die Avantgarden sind definitiv ans Ende gelangt, Avantgarde ist etwas von gestern. Von jetzt an geht es um immer neue Bruchstücke eines gemeinsamen Universalismus, und daran können alle mitarbeiten. Es gibt einzelne erstaunlich gute Bücher in unserer Zeit. Es häuft sich, dass große einzelne Würfe vorkommen, aber die Kontinuität des einen Werkes gibt es kaum noch. Und dann sind wir leider in einer Zeit, die eine Blütezeit der Retrospektiven ist; nie zuvor hat die Menschheit so viele Retrospektiven erlebt, die großen Ausstellungen von Cézanne, neue Gesamtausgaben von Kavafis oder Pessoa – es gab zuvor nie eine Zeit, die alles derart gründlich abgearbeitet hat. Ich glaube, es ist extrem schwierig für neue Dichter und neue Autoren, die sich in einer Zeit der ununterbrochenen Retrospektiven und der Musealisierung aller großen Künste behaupten wollen. Zu jedem Debütband gehört schon wieder die neue vorbildliche zuvor gegebene Gesamtausgabe von XY oder Z; das alles geschieht immer zugleich.
Kasaty: Das Feuilleton hat das Jahr der Wende schon 1990 als eine „zweite Stunde Null“ für die deutsche Literatur bezeichnet. Wie würden Sie die literarischen Veränderungen der 1990er Jahre beschreiben?
Grünbein: Für mich ist immer falsch, wenn Kritiker zu wissen meinen, wie die Literatur beschaffen sein soll. Das ist ein übles Merkmal unserer Zeit, dass Kritiker oder Literaturwissenschaftler programmatische Richtlinien aufstellen und sagen: Das soll jetzt so geschehen, oder das ist jetzt nicht mehr möglich. Gott sei Dank werden sie nicht beachtet! Der Kritiker ist heute in einer sehr exklusiven Lage, er überschaut das ganze Feld, wenn er belesen ist, weiß er Bescheid über alles, was schon da war, und beobachtet jetzt von so einem hohen Beobachtungsposten aus alles, was gerade entsteht. Das hat es in der Form noch nie gegeben; das Ganze ist aber oft nur ein statistisches Verhalten zur Kunstwelt, und hat nichts zu tun mit dem, was wir am Ende der Romantik hatten, das war ein ganz anderer Typus von Kritik als der, den all diese Menschen produzieren, die heute im Feuilleton über Bücher schreiben.
Ich habe auch das Gefühl, es war noch nie so vergeblich zu schreiben wie heute, weil alles scheinbar erkannt wird. Weil es für die meisten Menschen schon eine deja-vu-Reaktion gibt, und da, wo sie sich überraschen lassen, stellt sich am übernächsten Tag heraus, dass es doch keine Überraschung war. Die Situation hat nichts mit der Gesellschaft zu tun, das Ganze hat offenbar damit zu tun, dass sich zu viele Menschen darum kümmern, was Literatur eigentlich ist oder sein soll, und auch damit, dass einfach zu viel Literatur entsteht. Ich glaube, es gab noch nie zuvor eine Zeit, wo so viel geschrieben wurde.
Kasaty: Sie sind auf eine eher sanfte und mit Sicherheit wünschenswerte Art in den Literaturbetrieb hineingeraten. 1989 nahmen Sie als Anfänger am Wettbewerb „Leonce-und-Lena-Preis für junge Lyrik teil, ohne jedoch ausgezeichnet und bemerkt zu werden. 1991 erhielten Sie dagegen die erste bedeutende Auszeichnung, den Förderpreis zum Bremer Literaturpreis, 1992 den Marburger Literaturpreis, 1993 den Nicolas-Born-Preis, und nach dem Gedichtband Falten und Fallen (1994) wurden Sie von den Kritikern als Junggenie bezeichnet. Anerkennung und Lob fanden mit dem Georg-Büchner-Preis (1995) einen Höhepunkt. 2004 wurden Sie mit dem Friedrich-Nietzsche-Preis ausgezeichnet, 2005 wurde Ihnen der Friedrich-Hölderlin-Preis zuerkannt. Wie würden Sie im Licht dieser Erfahrung die Literaturkritik in Deutschland kurz skizzieren?
Grünbein: In Deutschland gibt es nur den einen Diskurs, in dem Literatur als Ästhetik und Unterhaltung behandelt wird. Es geht niemals um Ethik, es geht niemals um Religion, es geht selten um Persönlichkeit. Der beste Weg für einen deutschen Autor ist, früh zu sterben. Die jüngsten Legenden, die wir haben, haben immer damit zu tun, dass derjenige oder diejenige sehr früh gestorben ist, oder verrückt geworden ist, sich zu Tode gesoffen hat, oder unter die Räder gekommen ist, und dann kommt sofort die Legendenbildung, und das ist die einzige religiöse Form der Rezeption. Alles andere ist, sozusagen, eine Art journalistischer Herangehensweise, was bedeutet, jede Literatur, die in Deutschland geschrieben wird, stößt zu allererst auf eine riesige Barriere von Journalismus. Aber der Journalismus ist ja eine Erfindung des 21. Jahrhunderts, das heißt, nie zuvor war der Einfluss des Journalismus so total wie heute. Der Totalitarismus des Journalismus und des journalistischen Gestus gegenüber allem Geschaffenen ist ein neues Phänomen. Sogar Akademiker drängen immer mehr in den Journalismus, alte Professoren schreiben Rezensionen. Es geht hier um die Tatsache, dass der Journalismus uns sofort in seine Fänge nimmt, d.h. es gibt keine Zeit des Abwartens, es gibt keine Zeit der Annäherung an etwas Neues, Anderes oder Fremdes, alles muss sofort bearbeitet werden, möglichst noch früher als von der Konkurrenz. Alle Zeitungsredaktionen bemühen sich bei gewissen Autoren sofort, die Ersten zu sein. Es gibt kaum noch Traditionsbildung. Der Journalismus arbeitet an der Ununterscheidbarkeit. Jeder Einzelne mag für sich glauben, dass er seine Vorlieben hat und sich auf das oder dies konzentriert, aber die Gesamtwirkung ist Neutralisierung. Das Publikum, das außerhalb steht, hat ein feines Gefühl dafür, wie sozusagen über jegliches Geschriebene ein journalistischer Sprühnebel gelegt wird, und der Effekt ist tatsächlich Abnutzung, Ermüdung, Neutralisierung. Diese ewigen Bestseller-Listen, Gremien und Jurys, die ständigen Sofort-Bewertungen.
Kasaty: Es ist eine vornehme Aufgabe der Literaturkritik, eine Brücke zwischen Text und Leser zu schlagen. Wie sollte Ihrer Meinung nach die Literaturkritik funktionieren? Was würden Sie persönlich sofort an diesem betriebsamen System ändern?
Grünbein: Da kann man nichts ändern. Es ist ein soziologisches Phänomen, dieses Feld des Journalismus, wie Pierre Bourdieu dies einmal genannt hat, und es wird in diesem Feld ununterbrochen an der Neutralisierung von Kunst gearbeitet. Das kann man nicht vermeiden, weil das mit neuen Medien zu tun hat, neuen Lebensentwürfen, mit ganz anders geartetem, aufgefächertem Berufsfeld unserer Zeit. Die Literaturkritiker sind wie Ameisen oder Raupen, die ganze Zeit damit beschäftigt, jedes einzelne Blatt eines jeden Kunstwerkes zu zermahlen, sie fressen das von allen Seiten an, zerlegen es, und transportieren es an den Bau, kompostieren es – und das einzige, was wächst, ist der Haufen – und der Haufen ist unsere Kultur.
Es ist aber ein positives Bild und genau das ist ja auch Kultur, deswegen weiß ich keinen Ausweg. Wir können die Situation nur vergleichen mit Zeiten, wo es anders war. Der Pariser Dichter Baudelaire stand eines Morgens in einem Kaffeehaus in Paris, und da saßen Leute mit großen Zeitungen vor der Nase, den ersten Gazetten. In diesem Moment eilte er nach Hause und wollte Selbstmord begehen. Er wohnte mit einem Freund zusammen, der hielt ihn, Gott sei Dank, davon ab sich umzubringen. „Das ist doch das Ende der Literatur“, sagte ihm der Dichter. Erstens lesen die Leute da etwas anderes; sie können sich nicht auf künstlerische Texte konzentrieren, zweitens wird die Zeitung alles aufsaugen, auffressen, und drittens ist sofort der sogenannte Auraverlust des literarischen Textes besiegelt, was alles Baudelaire wahrscheinlich sofort vorausgeahnt hat.
Was macht später Baudelaire? Er ist einer der ersten, der sogar seine Gedichte in Zeitungen publiziert, natürlich wirft er sich damit selber in den riesigen Kritikerkampf, schreibt selbst Rezensionen, er schreibt über Pariser Salons. Als Autor kann man sich nämlich ganz zurückziehen – oder eben mitspielen. Und die einzige Chance ist, einfach mitzuspielen, und wer sich verweigert, wird entweder besonders bewundert oder besonders verfolgt. Wenn jemand nicht will, gibt es sofort einen Verdacht gegen ihn, aber die Gesellschaft würde sich selbst nie unter Verdacht stellen, Kultur kann sich selbst nie verdächtigen, nur der einzelne Teilnehmer in der Kultur kann diese Kultur verdächtigen, und die werden dann ihrerseits unter Verdacht gestellt – das ist ein ewiges Spiel. Alles zusammen arbeitet unermüdlich daran, dass das Singuläre und das Besondere möglichst nicht stattfindet. Der Text wird heute als ein Gegenstand des Konsums begriffen; Texte werden konsumiert wie Speisen oder Modeartikel, und sie bilden nur für die wenigsten die Aufforderung – ändere dein Leben, du musst dein Leben ändern, was die Idealform der Literatur ist. Es gibt keinen einzigen Text, der ausgenommen ist – außer der Bibel. Die Bibel wird nicht rezensiert, auffällig, oder? Sie bleibt unangetastet, wird aber sehr oft gelesen. Es geht aber nicht darum, dass Texte unangetastet bleiben, sondern es geht darum, wie sie behandelt werden, ob sie wirklich ankommen, oder ob sie neutralisiert oder abgetrieben werden. Ich glaube, dass der tägliche Kulturbetrieb in Deutschland eine große Abtreibungsmaschinerie ist.
Kasaty: Heute arbeiten ganze Teams an Projekten, die früher ein einzelner Mensch vollbracht hat. Die Feststellung trifft vergleichbar auf Philosophie und Kunst zu. An dieser Stelle erhebt sich die Frage, wie viele Kants oder Chopins wird es noch geben?
Grünbein: Das sind gar nicht so dumme Fragen – jeder fühlt sich sofort betroffen. Es scheint so zu sein, dass unsere Zeit ein so gewaltiges Lebenswerk gerade nicht hergibt. Wir haben lauter Kleinmeister, Meister der kleinen Form, des gezielten 200-Seiten-Romans, der gelungenen Novelle oder der schönen Gedichtzyklen. Ich sehe mich selbst in einer Zeit der Kleinmeister, in der ich mich als Kleinmeister versuche, und gebe mein Bestes. Die Zahl der Publikationen spielt auch eine große Rolle – wenn wir jetzt Autoren wie Grass oder Walser nehmen, die werden jetzt, am Ende ihres Lebens, wahrscheinlich schon 20 Bände als Lebenswerk hinterlassen. Aber die Frage heißt – inwieweit sind diese 20 Bände tatsächlich für die Zukunft der Menschheit reichhaltig genug, wie unter den Werken des 19. Jahrhunderts die von Balzac. Wir müssen davon ausgehen, dass nie zuvor so viele Menschen geschrieben haben, ambitiös geschrieben haben, die nicht lesen, die nie gelesen haben, die nichts kennen. Es müsste doch Regeln geben – auch für dieses Spiel.
Kasaty: Haben Sie auch eine eigene Definition für Literatur? Eine erneute Diskussion über Bedeutung und Funktionen von Literatur wurde ca. 1968 ausgelöst. Damals propagierte man, Literatur sei überflüssig und bedeutungslos, es sei denn, sie diene der unmittelbaren Vorbereitung politischer Praxis. Den genauso einseitigen Gegensatz dazu bildete die These, dass Literatur l’art pour l’art sei, also selbstgenügsam in sich/um sich kreisende Kunst. Was ist Literatur für Sie? Welche Funktionen, welche Bedeutung hat sie für Sie?
Grünbein: Literatur ist ein Versuch, einen Moment festzuhalten, den absoluten Augenblick von jetzt, den Stil des Jetzt.
Kasaty: Erzählen Sie bitte noch kurz für die Leser, denen Ihre Vita nicht bekannt ist, ein bisschen von Ihrem Elternhaus und Ihrer Kindheit in Dresden. Ihren Erinnerungen nach wissen wir schon:
Die Provinz hieß übrigens Sachsen, eine alte Kulturlandschaft, aschgrau geworden, darin ein Brandherd von städtischem Ausmaß oder was nach dem Krieg übriggeblieben war von einer Stadt namens Dresden. All meine Bildung in ihr, die Schuljahre und Bibliothekstunden, das Abitur und die langen Wanderungen, hat schließlich nur zu dem einen, leicht rachsüchtigen Fazit geführt. In einem Abschiedsgedicht sah ich die Stadt als das, was sie war, ein Barockwrack an der Elbe.
Grünbein: Das war doch ein Zufall, das war ein biografischer Zufall, dass ich in Dresden aufgewachsen bin. Meine Eltern waren sehr jung und damals wollten viele tüchtige Menschen in den Westen. Mein Vater hat sich noch kurz vor dem Mauerbau erkundigt, ob er in Westberlin studieren kann, und man hat ihm dann erzählt, er müsse in Dresden noch zwei Semester weiter studieren, und in dieser Zeit wurde die Mauer gebaut, und die Grenze war zu. Ich hatte aber das Glück, dass meine Eltern ideologisch unverblendet waren, die hatten mit dieser Partei nichts zu tun. Ich bin 100% stalinismusfrei aufgewachsen. Ich fand sogar eher viele Ideen von sehr linken Schriftstellern in der DDR wie Heiner Müller fast exotisch und faszinierend, aber es war mir fremd, weil ich eigentlich aus einem verhinderten bürgerlichen Elternhaus kam. Das waren Menschen, die mit dem Ganzen nichts anfangen konnten, weil sie nur durch Zufall in dieses System, in diesen Schlamassel, hineingeraten waren. So bin ich aufgewachsen und habe mich immer gefragt, wann hört das auf? Ich wollte eigentlich immer nur weg. Und ich habe mir geschworen, hier darfst du nie zum Opfer werden.
Und ich bin kein Opfer geworden! Das war das Wichtigste im Leben: nie Opfer werden!
Meine Eltern haben mich im Denken klar gemacht; zu Hause hatte ich immer Rückhalt. Es gab die Schulversion, und wenn ich nach Hause kam, konnte ich über alles offen reden. Meine Zunge musste ich nur in der Schule hüten. Es war völlig schizophren! Zu Hause wurde etwa der Deutschland-Funk gehört, ich habe Willy Brandt gelauscht, und dann musste ich in die Schule gehen und über Marx und Engels nachdenken. Ich habe üble Sachen erlebt, und was mich am meisten verstört hat, war der Moment, wo der Staat mit seinen langen Tentakeln durch das Elternhaus auf einen zugriff. Es gab ja die Wehrpflicht, und ich musste 18 Monate der Volksarmee dienen. Damals bin ich nach Innen gegangen, habe versucht, mich innerlich zu verstecken. Eines meiner Lebensmottos kommt von Descartes: „larvatus prodeo“ – ich trete nur maskiert vor, ich zeige mich nur mit Maske.
Kasaty: Wir sind alle maskiert – ist das nicht die gängige Überzeugung?
Grünbein: Wenn man sich verständlich machen will, muss man die Maske wieder ablegen, damit die Leute sehen können, hinter der Maske steckt ein Mensch. Ich habe lange Zeit bemerkt, dass es sehr gut ist, maskiert zu sein… Gerade in dieser Welt!
Kasaty: Ihre Heimatstadt und Ihre Vergangenheit sind immer wiederkehrende Themen Ihres Schaffens. So wie Sie in Ihrem Debüt Grauzone morgens (1988) über Ihre Heimatstadt schrieben, so ist Ihr neuestes Buch Das Porzellan. Poem vom Untergang einer Stadt (2005) ein Poem für diese Stadt:
Porzellan – zerbrechlichstes. Warn sie nicht früh verloren,
Diese heiklen Formen. Worum geht’s hier? – Einer lauscht,
Was die Töchter Mnemosynes ihm diktieren.
Und er tauscht die Zeiten, Räume, Maße, tauscht und tauscht
Grünbein: Nach dem Descartes ist „Porzellan“ die zweite große Konfession. Dieses Buch handelt vom Untergang meiner Stadt. Dresden gehört zu den schönsten Städten in Nordeuropa. Es ist die Stadt meiner Herkunft, und sie hat mich nie losgelassen. Das Buch ist eine späte Liebeserklärung an diese Stadt. In letzter Zeit habe ich bemerkt, wie sehr ich Städte mag, und es ist nicht nur Dresden, das ich so liebe. Ich habe mich heillos in Venedig, in Sankt Petersburg und in Paris verliebt. Berlin kann man nicht lieben, dort lebe ich. Aber es gibt Städte, zu denen mich meine Gefühle immer wieder zurück bringen. Dresden ist das Urmodell, das ist die Stadt, die mich lieben gelehrt hat. Und ich fühle mich stark mit den Stadt-Dichtern verbunden, etwa mit Joseph Brodsky, dem St. Petersburger, oder Baudelaire, dem Pariser; sie sind für mich Brüder.
Kasaty: Zum Schluss würde mich noch interessieren, wie Sie arbeiten?
Grünbein: Es gibt Phasen, wo ich Tag und Nacht arbeite, und dann gibt es ganz schauerliche Phasen, wo ich in tiefe Depressionen versinke. Früher war es problematisch – ich arbeitete am liebsten nachts, alle mussten weg sein, ich musste nur für mich da sein, um zu arbeiten. Jetzt habe ich eine kleine Arbeitswohnung, und es ist besser geworden. Wenn ich mich im Alltag verliere, dann kann nichts Großes entstehen.
Eine der Nebenwirkungen dieser Erfahrung – mit den Musen sein oder nicht mit den Musen sein, inspiriert sein und gerade nicht inspiriert sein – führt allmählich dazu, dass es offenbar ein Problem gibt mit der Gesellschaft. Ich kenne Innen- und Außenzustände. Ich stehe neben mir auf einer Party, schalte auf „innen“ und bin wieder weg, und in diesem Moment liebe ich alle Menschen um mich herum, aber ich bin hinter einer Trennwand, und da rinnen die Tränen herunter, Menschheitstränen am Glas, und in solchen Momenten beginnt plötzlich irgendetwas.
Das Dichten hat immer mit einer Absenz zu tun. Die Idee der Absenz ist im Zentrum des Schaffens, das Schrecklichste für einen Dichter ist, wenn diese Absenz ausbleibt. Alle Dichter klagen, wenn sie diesen Zustand nicht mehr erleben, dass sie austrocknen, dass sie Angst haben, dass der Besuch der alten Damen nicht mehr kommt.
Kasaty: Treibt auch Sie manchmal die Sprache in die Enge oder zur Verzweiflung? Flaubert zum Beispiel fiel in tiefe Depressionen, wenn er wieder nach dem vermeintlich einzig passenden Wort suchen musste. Suchen auch Sie manchmal nach diesem schier einzig adäquaten Wort?
Grünbein: Ja, genau, die ganze flaubertsche Ausdrucksgruppe. Er warf sich bekanntlich aufs Sofa und lag tagelang da, weil ihm der nächste Satz nicht gelang. Das hatte zu tun mit der Angst, nicht standhalten zu können mit den präzisesten Momenten von metrischer, also lyrischer Sprache.
Kasaty: Was lesen Sie augenblicklich?
Grünbein: Ich muss ein Geleitwort schreiben zum Satyrikon und lese wieder Petronius und zwar ganz genau. Ich lese viel Philosophie.
Kasaty: Mit welchen Stichworten wollen Sie das Gespräch beenden, Herr Grünbein?
Grünbein: Geistesgegenwart ist ein Stichwort, das ich sehr gern mag, aber man muss es philosophisch sehen. Ich glaube an Geistesgegenwart – das ist ein schönes komplexes Wort – und das bedeutet auf der Alltagsebene, dass jemand ganz wach ist, auf alles reagiert, was ihn umgibt, und der schnell im Denken ist, der sofort begriffen hat. Auf der philosophischen Ebene heißt das dann – ich halte das gegenwärtig, was der menschliche Geist an vielen verschiedenen Facetten hervorgebracht hat.
Zur Geistesgegenwart: Goethe hat einmal eine sehr gute Beobachtung gemacht, er stellte fest, es ist der Geist, der früh altert und das Alter verjüngt. Übersetzt heißt das, durch den Geist altert man sehr früh, aber er verjüngt auch das Alter.
Berlin, 26.8.2005, aus Olga Olivia Kasaty: Entgrenzungen. Vierzehn Autorengespräche über Liebe, Leben und Literatur, edition text + kritik, 2007
Hinweise auf ein Stück Gedankenmusik
– Gespräch mit Durs Grünbein. –
Hans-Jürgen Heinrichs: Als Ausgangspunkt für unser Gespräch habe ich eine Überlegung von George Steiner gewählt. In seinem Buch „Warum Denken traurig macht“ knüpft er an Schelling an, der vom „Schleier der Schwermut“, von der „tiefen, unzerstörlichen Melancholie alles Lebens“ gesprochen hat. Steiner schreibt:
Diese fundamentale Traurigkeit gibt den dunklen Grund ab, in dem Bewußtsein und Erkenntnis wurzeln. […] Wir sind gleichsam ,traurig‘ erschaffen. In dieser Vorstellung ist zweifellos die ,Hintergrundstrahlung‘ der biblischen Beziehung spürbar zwischen der verbotenen Aneignung von Wissen, von analytischem Urteilsvermögen, und der Verbannung der menschlichen Spezies aus unschuldiger Glückseligkeit.
Entspricht eine solche Hintergrundstrahlung auch der Situation, in der Sie schreiben? Würden Sie die Gestimmtheit, in der Sie kreativ sind, in dieser Weise umschreiben? Erfahren Sie sich bei Ihrer Arbeit „in einem ununterbrochenen Sog und Gegensog von Sein und Nichts zwischen dem, was ins Sein gerufen wurde, und der völligen Abwesenheit“ traurig, schwermütig oder leicht, glücklich, optimistisch, daß das Vorhaben gelingen wird?
Durs Grünbein: Zu dem Titel „Warum Denken traurig macht“ fällt mir Wittgenstein ein, der gesagt hat, Philosophie sollte man eigentlich singen oder dichten. Also selbst ein so analytischer Philosoph, der der Sprache wirklich auf den Grund geht, kommt zu dem Schluß, daß man sich dem Ganzen, dem unerreichbaren Ganzen, nur nähern kann, wenn man den Worten wieder eine musikalische Dimension gibt. Bei Nietzsche finden wir ähnliche Sätze. Das eine Nachdenken, das Reflektieren der Reflexion, das alte Geschäft der Philosophie von Platon über Kant und Hegel bis heute, macht traurig, so war wohl die These. Vielleicht, weil sich dabei herausstellt, daß es immer schwerer wird, die Dinge zu begreifen, daß ihre Komplexität den Menschen überfordert und Philosophie keineswegs zum Glücklichsein führt. Platon ist dem Dilemma entgangen, indem er das Philosophieren kombiniert hat mit dem Gastmahl und mit dem Vortragen von Gedichten. Die Griechen wußten, daß man das philosophische Sprechen nur aushält, wenn es mit künstlerischen und mit kulinarischen Darbietungen und mit Erotik verbunden ist. Erst seitdem diese Dinge getrennt sind, schleicht sich der Verdacht ein, daß Denken grundsätzlich zu Melancholie führt. Es kann also sein, daß der Denker, der melancholisch wird, etwas falsch macht, weil er die anderen Facetten des Lebens nicht integriert.
Heinrichs: Schön, daß Sie gleich zu Anfang den Ton einer Art philosophischer Meditation anschlagen, auf den ich mich in unserem Gespräch erst langsam einstimmen wollte. Sie nennen in Ihrem einfühlsamen und poetischen Nachwort Steiners Essay das „Produkt einer persönlichen Ästhetik (samt zugehöriger Idiosynkrasie)“, ein „Stück Gedankenmusik“. Ich hatte mir bei der Lektüre an den Rand geschrieben: „reflexive Meditation“. Sie erwägen auch Gattungsbezeichnungen wie Essay, Traktat, Manifest und Predigt. Haben wir nicht in diesen grenzoffenen, grenzüberschreitenden, in sich beweglichen Textformen viel größere Chancen, Wirklichkeit angemessener und komplexer darzustellen als in sich selbst streng disziplinierenden Formen? Ihr Schreiben sucht sich in jedem Neubeginn immer wieder einen Ort, im Text-Feld von Gedichten, Essays, Reportagen und Recherchen, Erzählungen, Miniaturen, Charakterbildern, Historien, Aufzeichnungen und Libretti. Auch stellen Sie zum Beispiel das Prosastück „Aus einem alten Fahrtenbuch“ in eine Gedichtsammlung und offenbaren damit einen spielerisch-poetischen Umgang mit Formen.
Grünbein: George Steiner gehört bestimmt zum Typus des begehrenden Denkers. Er beschäftigt sich mit Literatur, mit den Künsten, weil er sie begehrt. Im Umkehrschluß von einem Defizit zu sprechen ist gefährlich, denn jeder Mensch hat eine Grundausstattung, die er sich nicht aussuchen kann. Ich glaube nicht, daß ein großer Kunsthistoriker auch ein großer Maler geworden wäre, wenn er sich nur anders entschieden hätte. Aber interessant ist, daß man aus der Sprache des Kunsthistorikers dieses Begehren der Kunst heraushören kann. Das ist bei Steiner, mutatis mutandis, ein Charakteristikum seiner Literaturtheorie. Genauso wie bei gewissen Philosophen, die das Objekt ihres Denkens auf vehemente Weise begehren und deren Sprache sich dadurch verändert. Auch bei Nietzsche war das in hohem Maße der Fall. Bei ihm sieht man, wohin es führt, wenn sich einer seinem Objekt als Philologe, als Philosoph nähert und dann herausfindet, daß dieses Objekt das Leben selber ist und ganz andere Ausdrucksformen verlangt. Dann werden neue Gattungen gefunden. Daher die hymnische lyrische Rede, die Aphorismen. Ähnlich ist es mit Steiners Buch. Man sieht deutlich eine Art musikalischen Ansatz. Er umkreist sein Thema wie ein Komponist, und der Text wird zur Partitur. Schon darin muß ein Glück gelegen haben. Das tut man nur, wenn man eine Sache gut kennt und die Beschäftigung mit ihr wirklich befriedigend ist. Selbst dem trockenen Hegel würde ich unterstellen, daß er seine „Phänomenologie des Geistes“ mit großer nicht nur analytischer, sondern auch kompositorischer Lust geschrieben hat. Das sieht man am Arrangement, an seiner Leidenschaft, dieses gewaltige Feld wie ein Künstler zu durchqueren, der sich immer wieder neue Aussichtspunkte sucht.
Heinrichs: Es gibt bei zahlreichen Denkern Formulierungen, die darauf hinauslaufen, daß Denken ursächlich an Begehren gebunden ist. Ich erwähne nur Edmond Jabes’ Aussage „Es gibt keinen Gedanken ohne Begehren (Begiere).“ Im Französischen stellt sich die Sache durch den Begriff désir noch etwas komplexer dar. Begehren ist ein Dreh- und Angelpunkt des Denkens. Steiner konzentriert sich auf Wissenschaft und Kunst gleichermaßen, wobei für ihn die Kunst eindeutig Priorität hat. In seiner Autobiographie Errata schreibt er, er habe seine Literaturtheorie in tiefem Mißtrauen gegen alle Theorie entwickelt. Er stellt das Kunstwerk in jedem Fall über die Theorie, ohne jede Einschränkung. Mit anderen Worten, theoretische Widerlegungen der Literatur, theoretische Beweise gegen sie kann es nicht geben. Für ihn ist alles Verstehen vorläufig und unzulänglich; die Beziehungen zwischen Wort, Zeichen und Welt bleiben so gesehen undurchsichtig. Es sei, bemerkte er, als ziehe das Gedicht, das Gemälde, die Sonate rings um sich „einen letzten Kreis, einen Raum für unverletzte Autonomie“. Alle Theorien blieben „unheilbar sprachlich, dem Wort verhaftet“. Einmal schreibt er:
Ich habe meine emotionalen, intellektuellen und beruflichen Angelegenheiten im Mißtrauen gegen die Theorie geführt.
Grünbein: Wir müssen bedenken, daß es Theorien gibt, die wie Kunstwerke gebaut sind. Das heißt, am Ende gibt es gar kein Defizit, weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Es ist nicht so, daß alle Theorie, wie Goethe sagt, grau ist. Wir kennen inzwischen sprachlich wie strukturell hochartistische, geradezu schillernde Theorien. Das ist, glaube ich, sogar ein Wesensmerkmal epochaler theoretischer Werke. Mit ihnen beschäftigt sich die Menschheit immer wieder. Nehmen wir den Tractatus logico-philosophicus von Wittgenstein oder die Kritik der Urteilskraft. Das sind Kunstwerke der Theorie.
Manche Theoretiker würden die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn sie diese Gleichsetzung horten. Ich will gar nicht von der Ästhetisierung der Theorie reden, ich will nur fragen, was die Meisterwerke der Theorie zu dem macht, was sie sind. Offenbar enthalten sie ein besonderes performatives, artistisches Element. Wir kennen die großen Symphonien der Theorie. Nicht zufällig haben sich so viele Philosophen auf die Musik konzentriert, als sei das Nachdenken über Musik essentiell für das Philosophieren. Das muß auch mit der Methodik zu tun haben.
Heinrichs: Claude Levi-Strauss etwa hat sich explizit auf die Musik bezogen und vom Komponieren eines Werks gesprochen. Die Niederschrift seines Hauptwerks Mythologica erfolgte beim Wagner-Hören. Seine Analyse der Mythen liest sich teils wie ein Musikstück, teils wie eine musikalische Abhandlung. Ein Denken, das eine Vorstellung vom schöpferischen Tun hat, kann gar nicht anders, als dem Künstlerischen Tribut zu zollen. Die Unterscheidung zwischen wissenschaftlichem und literarischem Sprechen ist sekundär und hat sich erst später herausgebildet.
Grünbein: Vielleicht mit einer Einschränkung. Die meisten Künstler und vor allem Autoren wissen wohl, daß das, was sie tun, nur die Andeutung einer Erfahrung, einer Beschreibung, eines Gegenstands ist und vom Leser ergänzt werden muß. In der Philosophie dagegen scheint eine gewisse Allergie gegen das Andeutende vorzuherrschen. Man will weg von den frühgriechischen Denkern, wo die Andeutung noch ein Faktor war und es einen viel größeren Schwingungsraum des Sinns gab. Die Philosophiegeschichte ist dadurch gekennzeichnet, daß sie immer mehr von der Andeutung zur Definition voranschreitet. Selbst Hegel würde seine Begriffsverflüssigung abgrenzen von diesem andeutenden Schreiben, das wir aus der Literatur kennen. Zu diesem gehört, daß ein Detail konkret erfaßt sein kann. Aber in der Regel ist es ein unwesentliches Detail. Hier wird nicht das Wesen, die Substanz erfaßt. Die Philosophie hat diesen Ehrgeiz. Da sehe ich einen gewaltigen Konflikt.
Heinrichs: Gehen wir einen Schritt weiter in den poetologischen Überlegungen und in bezug auf Ihre Arbeiten. Wieviel Theorie geht in den schöpferischen Prozeß ein? Welchen Anteil haben etwa die Theorien zur heutigen Alltags- und Medienwirklichkeit an der künstlerischen Arbeit? Spielen sie bei Ihrem Schreiben eine Rolle, oder ist das nur ein Subtext, ein Film, der im Hintergrund mitläuft?
Grünbein: Bis jetzt war noch jeder Mensch, dem ich begegnet bin, ein Phänomenologe seiner selbst. Gerade Künstler, erst recht, wenn sie über genügend Temperament und Charakter verfügen, bauen das aus und totalisieren das. Sie sind sich zunächst selbst genug als Phänomenologen ihres Erlebens, ihrer Welt; dann rüsten sie hie und da auf, indem sie benachbarte Theorien aufnehmen. Zumeist geschieht das nach dem Prinzip der Wahlverwandtschaften. Nur selten quält sich jemand mit etwas, das ihm völlig fremd ist. Wobei es das auch gibt, in der Konzeptkunst, aber dort kommen Theorien anderer Künstler hinzu. Manchmal scheint es umgekehrt zu sein: Der junge Beckett verlangt sich ein enormes Pensum an Theorien und philosophischen Lehren ab, bevor er etwas schreibt. Für ihn war das offenbar wichtig, weil das Schreiben automatisch kam. Er brauchte Hindernisse. So versuchte er, sein Schreiben zu konzentrieren. Zumindest Beckett ist ein schönes Beispiel dafür, wie jemand durch Theoreme und Philosopheme zum Schreiben kommt, ja Philosopheme gleichsam zu literarischen Texten ausformuliert, so daß diese den aufgegriffenen Philosophemen ebenbürtig sind. Das ist ein untypischer Fall, aber er ist klassisch geworden. Autoren sind eher wie Schwämme, sie saugen dieses und jenes auf. Bei Thomas Mann werden Philosopheme meist auf die Figuren verteilt, aber sind sie wirklich strukturbildend?
Heinrichs: In dem Schlußwort zu Ihrem Gedichtband Schädelbasislektion schreiben Sie, daß bestimmte politische Situationen und eine bestimmte Dynamik von Zeitereignissen mitunter „hochkomprimierte Mitteilungsformen“ erforderten. Die strenge Versform sei bei Ihnen plötzlich, wie von selbst, da gewesen: Können Sie diesen Augenblick der Formwerdung, der Entscheidung für eine bestimmte Darstellung von Wirklichkeit, genauer beschreiben?
Grünbein: Der Dichter, so wie ich ihn kenne, wie ich mich kenne, nimmt alles um sich herum wahr, also auch, was medial geschieht. Er läßt historische Prozesse extrem nahe an sich heran, und Revolutionen im Bereich der Theorie, der Philosophie lassen ihn nicht kalt. Dieser Typus – ein Beispiel ist Gottfried Benn – hat im 20. Jahrhundert ungeheuer viel gleichzeitig verarbeiten müssen. Man kann das durch eine Anhäufung von unbearbeitetem Material im Text leisten oder durch eine Fragmentierung des Schreibens, man kann aber auch nach einem gleichsam alchimistischen Verfahren verdichten, wie das der Visionär William Blake tat. Für das größere Publikum ist das schwierig zu entschlüsseln, aber man muß diesen Dichtern, zu denen auch Baudelaire gehört, glauben, daß es die Fülle an Material, neuen Eindrücken, Krisen, Konflikten war, die zu dieser oder jener sehr festen Zeile geführt hat. Diese Menschen wurden nicht geschwätziger, sondern konzentrierter, kompakter, autarker, auch hermetischer, also völlig lichtundurchlässig. Wir kennen Verse von Blake, von Baudelaire, die zunächst rätselhaft sind, die man aber besser erfaßt, wenn man sich die Grundsituation des modernen Dichters klarmacht – in der Großstadt, all diesen Einflüssen ausgesetzt. Der Übermut des Dichters ist nur, dies auf die Spitze und ins Rätselhafte zu treiben. Das gehört zur großen, inzwischen langen Geschichte des Hermetismus. Es ist ja nicht künstliches Verrätseln von Dingen, sondern der Versuch, der Überfülle in Formeln Herr zu werden. Dichtung muß in knappen Formeln sprechen. Es gibt gerade im 20. Jahrhundert Gegenbewegungen, wo Gedichte immer mehr ausufern, wo es enorme Langzeilen gibt wo ganze Themenfelder sequentiell bearbeitet werden, etwa in Pounds Riesenwerk der Cantos. Es gibt Cantos über Wucher und Wirtschaft, über italienische Malerei oder Architektur. Das ist ein Verfahren, das der Fülle durch eine epische Form Herr zu werden versucht. Das andere ist das der mantrischen Form, des knappen Versgedichts: Blake, Baudelaire, Benn, in gewisser Weise auch Rilke. Bei ihm können wir diese Inkubationszeit gut studieren: wie lange er brauchte, bis er wieder eine Duineser Elegie schreiben konnte. Hier schwimmt ein Wal durch die Welt und muß ungeheuer viel Plankton filtern, damit er einen so kurzen Text niederschreiben kann. In unserer Zeit ist diese Form der Produktion unattraktiv geworden, weil der Künstler eben nicht dazu aufgerufen ist, zu verdichten, kompakt zu formulieren, sondern dazu, das Arbiträre, Zufällige, Flüchtige in neuen Formen der Flüchtigkeit von sich zu geben, sozusagen eins zu eins in Echtzeit aufzunehmen und dann wieder auszuspucken.
Heinrichs: Wir könnten das von Ihnen Angesprochene unter den Gesichtspunkten des Heterogenen, der Simultaneität, Synchronizität und des Palimpsests vertiefen. Oder auch mit Hilfe der von Virilio eingeführten Begriffe „Ereignislandschaft“, „Fluchtgeschwindigkeit“ und „Rasender Stillstand“. Wir haben heute sicher eine komplexere Vorstellung vom Verhältnis zwischen Zeit, Raum, Ereignis und Beziehungsgeflecht und müssen uns verabschieden von statischen Modellen der Wirklichkeit und der Gesellschaft. Die Quantenphysik und die moderne Biologie zwingen uns, diese Lektion endlich zu lernen, sie wissenschaftlich und praktisch umzusetzen.
Grünbein: Ich habe das mal auf eine Formel gebracht, es war eine Baudelaire-Paraphrase, nämlich auf die vom babylonischen Hirn. Wir haben immer das Bild vom babylonischen Turm, aber jeder von uns trägt längst ein babylonisches Hirn mit sich herum. Die vielen Sprachen, die vielen Orte – jedes Gehirn auf dieser Erde ist sozusagen ein Schauplatz der Globalisierung.
Heinrichs: Man könnte sogar von einem globalen Zungenreden, einer globalen Glossolalie sprechen. Die Literatur hilft uns, einen adäquaten Zugang zur Wirklichkeit zu bekommen, gleichsam implizite Wirklichkeitstheorien zu entwickeln. Ich denke, das ist eine gute Voraussetzung, sich Ihrem großen Poem vom Untergang der Stadt Dresden, „Porzellan“, zuzuwenden. Wollen wir ein paar Zeilen als paradigmatisch herausgreifen, zum Beispiel Kapitel 19 und 20?
Grünbein:
Schlafenszeit – wie oft hast du aus Mutters Mund
dieses Zauberwort gehört.
Es war der Schlußakkord nach dem letzten Lied.
Da half kein aber mehr, kein und.
Zugeklappt das dicke Märchenbuch –
schon war sie fort.
Tiefes Dunkel. Und das Kind dort im zerwühlten Bett
fing zu grübeln an:
Wo bin ich hier? Wie war das noch?
Blutwurst sprach zu Leberwurst: Wenn ich dich hätt –
damals wars, daß das Einzelkind den Braten roch.
Still begreifend, dass es sterben würde
wie im Krieg. Dresden! Dresden!
Wehrlos in den Schlaf gewiegt.
Überhaupt Erinnerung.
Das kommt aus Hirnregionen und kehrt zurück dahin.
Und Herkunft, Heimat sind ein Häuflein Sand
in einer Wanderdüne aus Neuronen.
Blind von Kind an, folgt man seit sie auf der Rinde
eingezeichnet sind den frühen Wegen
Ortssinn meint nicht dort draußen spielt sie, die Musik,
im Schädelinnern.
Hier, mémoire involontaire, hier geht sie aus und ein.
Wie Gedankenlesen ist das, wenn aus Regenrinnen
nachts am Tresen Dresden aufersteht, ein ferner Gruß
über Zeit und Raum hinweg
aus Hypothalamus.
Heinrichs: Wie würden Sie, ausgehend von diesen Passagen, Ihr literarisches Verfahren beschreiben? Helfen uns dabei Begriffe weiter, die Sie unlängst in dem Gespräch mit Ulf Erdmann, dem Autor des aufsehenerregenden Debütromans Hamburger Hochbahn, gebraucht haben? Ich möchte Ihnen zwei Ihrer Kennzeichnungen für diesen Roman jetzt fragend zurückspielen: Dokumentarist nennen Sie den Autor, und seinen Stil bezeichnen Sie als kompakt. Streben Sie eine poetische Dokumentation des Geschichtlichen und des Seelischen an?
Grünbein: Wenn man solche Zeilen zum ersten Mal hört, kann man sich vielleicht besser vorstellen, daß die Dichtung, so wie ich sie verstehe, in wenigen Zeilen ein Maximum an Seelenleben ausdrückt. Das ist ein schöner Begriff, nicht nur in der Romantik, sondern auch in der Philosophie. Immerhin ist das innere Seelenleben eine Kategorie bei Husserl. Das ist jener große Raum, in dem sich für uns Dinge wiederholen, die draußen stattgefunden haben. Dichtung lotet ihn aus. Natürlich sind das immer nur Abkürzungen. Man kann in so wenigen Zeilen nicht die Totalität des Erlebens evozieren. Nur der Dichter hat dem Moment das Gefühl, er habe alles gesagt. Man müßte Essays schreiben über das Aufwachsen in einer Stadt, die 1945 zum großen Teil zerstört wurde und die – das ist die Idee hinter dem Zyklus – nicht irgendeine Stadt ist, sondern eine, die zur Kulturgeschichte der Menschheit gehört. Sie war immer schon größer als das, was ihre Bewohner von ihr wahrnehmen, eine der klassischen mittleren Metropolen, in denen ein wichtiger Teil von Deutschlands Kunstgeschichte stattgefunden hat, eine Arche Noah für Stilformen, Gemälde, Architektur, Literatur, die große Geister angelockt hat. Das hat Dresden mit den anderen Städten gemeinsam. Nur ist es zufällig die Stadt, in der ich geboren wurde, die ich irgendwann verlassen habe und für die ich mich erst später zu interessieren anfing. Dem gingen Reisen voran und mußten es auch. Der Déjà-vu-Effekt, den ich in St. Petersburg, in Paris, in Wien, in Venedig hatte, brachte mich zum Nachdenken darüber, wo ich herkomme und warum mich in anderen Städten diese Dinge ansprechen. Heute würde ich sagen, diese Städte sind wie große Installationen, wie Museen, die aufeinander reagieren. Dresden ist eine Phantasie der Italianità. Kurfürst August der Starke war in Florenz, in Rom, in Venedig und beschloß als junger Potentat: Etwas Ähnliches will ich auch haben. Und nur deshalb ist es entstanden, mit den entsprechenden Finanzen, auch mit höchster Verschuldung, ein Beispiel, daß Kultur nicht nur auf Krieg, sondern auch auf Pump und auf Projektemacherei, vielleicht sogar auf Hochstapelei beruht. Von dieser Vergangenheit lebt das Ganze, und als ich geboren wurde, war schon der letzte Akt geschehen. Man sieht hier, wie ein solcher Herkunftsraum verschwindet und sozusagen als Phantombild weiterlebt in den Erzählungen und Berichten der Bewohner. Alexander Kluge hat das an seiner Heimatstadt Halberstadt demonstriert. Im Familienkreis wurde halt immer die große Zeit beschworen. Natürlich reagiert ein Nachgeborener zunächst mokant und sagt: Was interessiert mich das alles? Was sollen diese Trümmer? Macht euch nichts vor! Dann kommt der Zeitpunkt, wo man sich die Sachen wieder aneignet. Das gehört zur Schriftstellerei.
Heinrichs: Zum Begriff des Phantombildes könnte man den des Phantomschmerzes hinzunehmen. Ihre Beziehung zu Dresden ist von einem tiefen Schmerz geprägt, der bleibt, auch wenn sich ein Teil der Erinnerung von Ihnen ablöst.
Grünbein: Ja, ein Schmerz, bei dem ich herausfinden mußte, inwiefern er mein eigener ist. Ich mußte viele Gespräche führen und hören: Na ja, nur weil Sie da geboren sind, interessiert Sie das so sehr? Ich verstehe, daß das Menschen, die nicht von dort kommen, relativ kalt läßt. Kalt lassen uns die Dinge eigentlich immer. Ich denke, viele haben ein sehr kaltes, unemotionales Verhältnis zum Holocaust. Eine der Aufgaben im Leben ist es, herauszufinden, wie man beteiligt ist an diesen Dingen. Inwiefern gehen sie mich in der Einmaligkeit meiner Existenz etwas an? Da gibt es ein leicht narzißtisches Moment. Ich kenne den Dresdner Lokalpatriotismus, der sich im Schmerz verschließt und den Hinzugekommenen immer wieder sagt: Das werdet ihr sowieso nie verstehen. Ich meine, das sind falsche Gefühlsbilder. Man muß es an sich selber ergründen.
Heinrichs: Es gibt den Begriff des „Berührungsmoments“, der in den dreißiger Jahren vom Collège de Sociologie, von Bataille, Kojève, Caillois, Leiris und Laure geprägt wurde. Wir müssen, so etwa war ihre Idee, bei der Beschreibung der Wirklichkeit, anders als die Soziologen, von den Berührungsmomenten ausgehen. Wo werden wir von der Wirklichkeit, von der Geschichte so tief berührt, daß wir an ihrer Gestalthaftigkeit kreativ mitarbeiten wollen? Wenn die Menschen nicht von der Geschichte berührt werden, von der Erleidensseite her, dann erfahren sie sie letztlich nicht. Ich würde die von Ihnen genannten Wirklichkeitsbezüge gern noch um den Begriff der Physiognomie erweitern. Ihrem Aufsatz über Heiner Müller haben Sie die Zeile vorangestellt:
In seinen Augen sah ich das zerschossene Berlin, die Geisterstadt, zerrissen von vier Mächten.
Können wir aus der Physiognomie wegweisender, visionärer Dichter die Wirklichkeit und die Entwicklungslinien einer Zeitströmung in Ansätzen herauslesen? Ich frage das auch im Hinblick auf die ganz unvergleichliche Physiognomie Antonin Artauds, dem Sie eine berührende Passage in diesem Text widmen. Sie sprechen von der „infernalischen Atmosphäre“, die Artauds Stimme in dem berühmten Hörspiel Schluß mit dem Gottesgericht von 1947 verbreitete. Und Wolfgang Rihm, der Texte von ihm vertont hat, spricht von der „genuinen Musik eines fremden Volkes, das Antonin Artaud heißt“. Artauds Stimme steht stellvertretend für seinen Körper, seine Seele und seinen Geist. Diese Stimme vermochte Sie zu überwältigen – sich überwältigen zu lassen ist die Grundstimmung des Pathos. Dies geschehe äußerst selten, schreiben Sie. Ich frage mich: Wie kann man denn anders auf Literatur reagieren, die über das Individuum hinausreicht und andere, bisher noch nicht betretene Räume erschließt?
Grünbein: Dieses überschwengliche Porträt Heiner Müllers hat damit zu tun, daß ich einen Dank abgestattet habe. Ich habe nie wieder einen etablierten Autor kennengelernt, der so großzügig war zu den Unbekannten, Neuen, Jungen. Das ist mir ein Ansporn geblieben. Er war ein gastfreier Mensch, die Leute konnten kommen und gehen, wie sie wollten. Er war mit einer großen Neugier begabt. Insofern fühlte ich mich auf eine Weise willkommen, wie ich es nie zuvor erlebt hatte. Das war für mich wichtig, weil ich den Osten abgeschrieben hatte. Ich wußte gar nicht, wie ich weitermachen sollte. Ich wollte nur weg, wollte raus. Ich schrieb sehr intensiv. Durch Zufall kam er zu meinen Texten und streckte sofort die Hand aus, wollte mich kennenlernen. Wir trafen uns mehrfach, und dann ging es ganz schnell. An diese Großzügigkeit habe ich mich einige Wochen nach seinem Tod wieder erinnert; die war absolut aufbauend, absolut konstruktiv. So etwas ist nicht ersetzbar durch den Betrieb oder durch finanzielle Förderung oder ein Stipendium. Das ist eben etwas anderes. Ich wünsche mir, daß jeder in der Kunst die Erfahrung macht, daß es diese Verbindung zwischen den Generationen noch gibt. Nur dann hat man ein Gefühl der Weitergabe. Ich habe Beckett erwähnt; er hat dieselbe Erfahrung mit Joyce gemacht. Da war für ihn klar: Auch wenn ich alles anders mache und ihm in vielen Punkten widerspreche, habe ich doch das Gefühl einer Kontinuität. In diesem Moment kann man beinahe physisch den Strang bis zu Dante spüren. Man erfährt durch solche Momente der Weitergabe das Allerwichtigste: die Sinnhaftigkeit des Ganzen. Brecht sagt:
Wenn der Sinn für Literatur in einem Menschen sich erschöpft, ist er verloren.
Interessant, daß er das in einer wachen Minute ausgesprochen hat. Ich merke mir selten ein Brecht-Zitat, aber dieses hat mich beeindruckt. Wir können ja als Künstler in eine Krise kommen, wo alles sinnlos erscheint. Da helfen Physiognomien. Ich bin aber ein echter Physiognomiker. Ich kann nur auf der Basis des Werks urteilen, und – jeder tut das – überblende ich es mit dem Gesicht und versuche aus dem Gesicht den Entwicklungsgang der Kunst herauszulesen. Unter Dichtern gibt es solche Spiele. Es gibt enorme Physiognomien: den fast kahlen Schädel Benns. Rilkes merkwürdige wulstige Lippen, sein seltsames, fast slawisches Gesicht. Solche Spekulationen führen nicht weit, weil wir Unvergleichbares vergleichen, nämlich Texte und Gesichter. Bei Artaud kommt ein fast pathologisches Moment hinzu, die Fotografien aus der Anstaltszeit zeigen ein von Krankheit gezeichnetes Gesicht, seine ausgezehrte Physiognomie mit den brennenden Augen, das Gesicht eines Menschen, der psychotische Schübe hat. Da kommt auch die Physiognomik definitiv an ihre Grenze. Durch Lavater war sie einst in Mode, und selbst Goethe hat sie eine Weile mitgemacht, bis er sich dezidiert gegen diese Lehre wandte. Mich hat fasziniert, daß schon der junge Rembrandt gern Altersgesichter gemalt hat. Das wurde dann ein bißchen zur Manie, und er ist auch darin ein Meister geworden. Das ist wohl die essentiellste Form der Vergegenständlichung von Zeit, die wir haben, die in einem Menschengesicht. Das ist die einzige individualisierte Zeit. Alles andere ist sozusagen abstrakte Zeit.
Heinrichs: In unserem vom Visuellen geprägten Zeitalter und in der medialen Fixierung auf Gesten, Haltungen, Körper und Physiognomien wird das Ganze pervertiert: die Ausstellung eines Gesichts soll für den Menschen und sein Denken stehen. Auch die großen Philosophien und Literaturen verbinden wir mit Gesichtern. Gesichter kann man nicht nur zeigen, man kann sie auch verhüllen. Einer Ihrer Texte trägt den Titel „Variation auf kein Thema“, Variation also auf etwas, das verdeckt ist und erst durch die Variation sich ein Stück weit enthüllt. Ist der Autor nicht immer einer, der in wechselnden Kostümen auftritt und gerade dann, wenn er uns nackt und unverhüllt erscheint, ein besonders raffiniertes Gewand trägt? Ich erinnere Sie nur an Michel Leiris, den wohl radikalsten Bekenner und Selbstentblößer in der Literatur des zwanzigsten Jahrhunderts. Was müssen wir nach seinem Tod und der Publikation seines Journals erkennen? Alle Entblößungen verhüllten den Kern seines eigentlichen Dramas, den innersten Kern seines Lebens. Wirklichkeit ist doch immer konstruierte, verstellte, maskierte Wirklichkeit. Ist das ein Motiv weiterzuschreiben? Man schafft immer neue Variationen, zieht immer weitere Kreise, doch das Thema wird nur umspielt? Wenn man das erkannt hat, hört man dann auf zu schreiben?
Grünbein: Solche Fragen kann man nicht wirklich beantworten. In einem meiner Gedicht sagt der Sprecher:
Nimm nichts von außen an, es führt zu nichts.
Dann wird das eine Weile durchgespielt, und die Konklusion ist:
Nimm aber auch nichts von innen an, das bringt auch nichts.
In diesem Patt zwischen zwei Positionen sehe ich mich oft. Ich kann unmöglich aus der Ablehnung der einen Position in die Zustimmung zur anderen fliehen. Ich möchte aber nicht dazwischen bleiben, ich möchte beide durchspielen. Und dann merke ich, daß es eine Stabilität gibt, allerdings eine prekäre. Das wäre eine etwas philosophische Antwort. Die Lust am Exhibitionismus ist in der modernen Literatur weit verbreitet, aber man kann sie nur bis zu einer gewissen Grenze betreiben. Bei vielen ist es eine große Tarnungsaktion, um vom Eigentlichen abzulenken. Nietzsche macht permanent die Erfahrung, daß er beim Aufdecken nur bis zu einem gewissen Punkt kommt. Dann folgt die Selbstverachtung, weil auch das nur ein schauspielerisches, quasi artistisches Moment ist. Dann versucht er, es durch Anerkennen zu überwinden. Wir kommen wahrscheinlich nicht viel weiter. Hinter allen Masken liegt etwas, das wieder maskenähnlich ist. Es gibt offenbar den Kern nicht. Es gibt keine Generalbeichte, das hat sich gezeigt. Aber wir können manchen durchaus verblüffen. Das ist ein großes Geschäft. Wir Autoren können zunächst uns selber verblüffen, indem wir zu Selbstwahrnehmung kommen, an die wir nie gedacht hätten. Dann ist oft die Lust sehr groß, das herauszustellen. Auch das ist ein Schreibantrieb. Aber wenn man das nach Jahren wieder liest, zeigt sich, es ist gar nicht so radikal gewesen, weil andere viel radikaler waren oder man selbst inzwischen radikaler ist.
Heinrichs: Wir haben zu Anfang schon über die Textform des Essays von Steiner und über die Form Ihrer Arbeiten gesprochen, zum Beispiel über Literatur als ein „Stück Gedankenmusik“. Und die Musikalität, ja die „unbedingte Musikalität“ nennen Sie in Ihrer „Salzburger Rede“ als wichtigste Voraussetzung für dichterisches Schaffen außer der „träumerischen Distanz“ zur Wirklichkeit, dem „geschärften Empfinden für die Entfernungen zwischen Realitäten und Symbolen“ und einer geschärften „Beobachtungsgabe“. Dichterisches Schaffen charakterisieren Sie als ein „höchst spirituelles Handwerk“. Im günstigsten Fall, sagen Sie, kann schon ein einzelner Vers eine kleine Unendlichkeit sein, in der alle die Unvereinbarkeiten der menschlichen Psyche enthalten sind. Darf ich ergänzen: … all die Unvereinbarkeiten auch in dem, was wir Wirklichkeit und Geschichte nennen? An welchen Dichtern haben Sie Ihre Musikalität vor allem geschult?
Grünbein: Ich habe einmal, wahrscheinlich willkürlich, Novalis’ „Hymnen die Nacht“ als mein Ursprungserlebnis benannt. Manchmal lese ich sie wieder und denke, das kann es nicht gewesen sein. Dennoch war es derart fremdartig, daß es mich lange beschäftigt hat. Hölderlin gehört dazu, auch Trakl. Dann entstand eine Sehnsucht nach Klarheit in meinem sensualistischen Gestöber. In dem Moment, wo mich Erkenntnis weitertrieb, kam ich auf die anderen Dichter, die mich bis heute beschäftigen. Rilke, den ich für völlig unterschätzt halte, rein erkenntnistheoretisch hochinteressant. In der englischsprachigen Welt weiß man das inzwischen. Er ist viel einflußreicher dort. Das sind aber Spezialtraditionen. Es kann passieren, daß große Werke plötzlich für ein, zwei Jahrhunderte versinken. Dann hat mich ausländische Poesie angezogen, vor allem die russische, die englische – die metaphysischen Poeten der elisabethanischen Zeit – sowie die russischen Dichter des frühen 20. Jahrhunderts. Bei denen habe ich wieder das Vertrauen in die, wie soll ich sagen, evokativen Kräfte des dichterischen Worts gelernt. Mir voraus ging eine Zeit der absoluten Destruktion, einer analytischen Poesie, die auch die letzten poetischen Partikel zerstörte. Nun ging es darum: Kann man das wieder aufbauen? Gibt es neue Synthesen? Manche kritisieren das. Wenn man streng ist, könnte man sagen: Wir müssen eben auf den Feldern der abstrakten Kunst verdorren oder verdursten. Aber in vielen Kunstgattungen gibt es interessante neue Entwicklungen. Das sieht man an der Malerei wie an der Dichtung, und man sieht es an den Theorien. Das ist kein Verrat an gefundenen Positionen. Die Menschheit muß weiterleben, sie muß auch die neue Erfahrung integrieren. Das klingt sehr defensiv. Ich habe meine Poetik bisher selten aggressiv vorgetragen. Aber ich würde sie bis zum letzten verteidigen.
Heinrichs: Lassen Sie uns unsere Überlegungen zur ursprünglichen Nähe von Wissenschaft, Literatur und Musik noch ein Stück weiter verfolgen und vielleicht auch personalisieren. Für mich stellte immer die von Claude Lévi-Strauss und Michel Leiris, von Victor Segalen und Hubert Fichte verkörperte Ethnopoesie einen besonders überzeugenden Versuch dar, tradierte Grenzen zu überschreiten und nach einer neuen Sprache zu suchen, sich auf die der Sprache eigene Musikalität, auf ihren Klangkörper zu besinnen. In bezug auf den Film haben Regisseure wie Claude Sautet betont, für sie sei der Film in erster Linie ein musikalischer Verlauf. In der gegenwärtigen Philosophie hat sich Peter Sloterdijk am weitesten vom akademischen Ton entfernt und das Philosophieren als Bewegung über die Philosophie als System gestellt.
Grünbein: Ich erinnere mich an einen Radiovormittag, Deutschlandfunk. noch zu DDR-Zeiten, wo die Kritik der zynischen Vernunft als sensationelles philosophisches Werk gefeiert wurde. Von da an hat mich Sloterdijk interessiert. Ich schätze sein Denken, weil ich die Lichtung, auf der wir uns beide bewegen, sehe. Er ist Philosoph, und er läßt die Metapher nicht beiseite. Das hat Blumenberg auf seine Weise erforscht, ja zu erforschen regelrecht gefordert. Die Philosophie schuldet der Literatur eine Metaphorologie, sie hat die Literatur ja beerbt, um nicht zu sagen beraubt. Das ist eine These, die ich immer wieder vortrage. Das fing schon bei den Vorsokratikern an, und nach und nach wird die Philosophie hegemonial. Sie raubt der Poesie die Rede- und Sagemacht, aber partizipiert weiter an ihr. Es ist also ein parasitäres Verhältnis. Erst im 19. Jahrhundert, mit den Nietzsche-Vorboten, haben wir wieder eine Entwicklung, die die Positionen annähert. Was könnte das heißen? Deleuze hat es auf den Punkt gebracht: die Perzepte, die Wahrnehmungskonstruktionen, und die Konzepte, die reinen Ideenkonstruktionen – letztere sind das Geschäft der Philosophie und der Geisteswissenschaften, erstere das der Ästhetik –, nähern sich einander wieder an, kommen wieder in ein faires Gespräch. Denn was wir allzulange, jahrhundertelang erlebt haben, war eine Art philosophischer Imperialismus. Sloterdijk gehört zu denen, die das wissen und theoretisch fruchtbar gemacht haben. Das ist unschätzbar, und die vergleichsweise schwache Rezeption heißt gar nichts. Es sind Pionierwerke, die – das haben wir oft genug gesehen – ein, zwei Generationen brauchen, bis sie ankommen.
Heinrichs: Statt Metaphorologie, das klingt wieder nach Philosophie als System, könnte man metaphorologisch-sphärologisches Denken sagen. Dann behält man stärker die Dynamik, das Werden und das Morphologische im Blick. Sloterdijks Denken ist musikalisch, schon insofern es sich von Grund auf als Prozeß und als Wandlung begreift. Von der Sprache sagt er, sie sei die ekstatische Mitgift des Menschen. Er schließt hier an das euphorische, pathoshaltige Verhältnis zur Sprache bei Nietzsche und Bataille, Heidegger und Cioran an.
Grünbein: In der Schulphilosophie wird nach der Legitimation eines solchen metaphorologischen, metaphernreichen Denkens gefragt und vor allem nach der Legitimation einer musikalischen Textstruktur. So ist das, wenn man zum Gegenstand des Wissenschaftsbetriebs wird. Das geht den bildenden Künstlern nicht anders. Allerdings werden die Sachen verschieden kanalisiert, verschieden destruiert. Wie auch immer, wenn man die drei Bände der Sphären gelesen hat, ergibt sich ein umfassendes Bild, eine metaphorische Grundvorstellung von der Kugelgestalt der Körper, zuletzt der Erde, aber auch des Raums. Das ist fast wie in einer Beethoven-Sinfonie. Könnte so etwas nicht schulbildend werden? Könnte nicht ein Künstler kommen und eine Gemäldeserie dazu entwerfen? Wie wäre die Wirkung? Leider können wir diese Frage nie uns selber stellen.
Heinrichs: Ich schlage abschließend noch einmal den Bogen zu George Steiner. Er exponiert die traurige Hintergrundstrahlung des Denkens. Anstelle der tiefen unaufhörlichen Melancholie alles Lebens haben wir jetzt eine Philosophie angesprochen, die geprägt ist von der Euphorie des Weltaufgangs und er festlichen Tonlage. Die Sprache stiftet dabei Nähe; sie ist eine Art Weltbefreundungsmedium. Auf welcher Seite sehen Sie sich, wenn Sie schreiben?
Grünbein: Ich konzentriere mich auf die Knochen der Kultur, auf das, was übrigbleibt. Ich mag letzte Gedanken. Es kann aber vorkommen, daß der Blick auf euphorisch, die Sprache hymnisch wird, also eine Euphorie den Resten gegenüber.
Sinn und Form, Heft 1, Januar/Februar 2009
Fakten und Vermutungen zum Autor + Archiv + KLG + IMDb + ÖM +
Facebook + DAS&D + Georg-Büchner-Preis 1 & 2 +
Orden Pour le mérite + PIA
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Galerie Foto Gezett +
deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Durs Grünbein–Sternstunde Philosophie vom 14.6.2009.


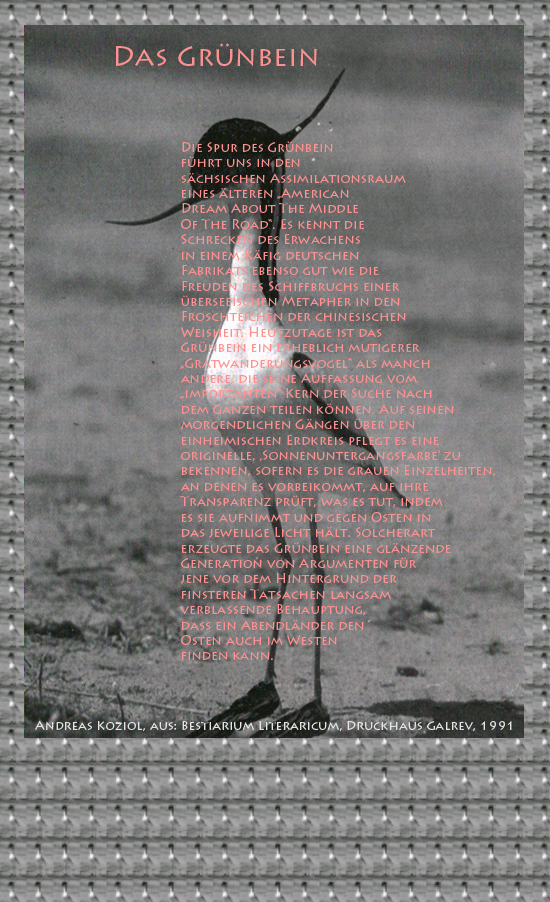
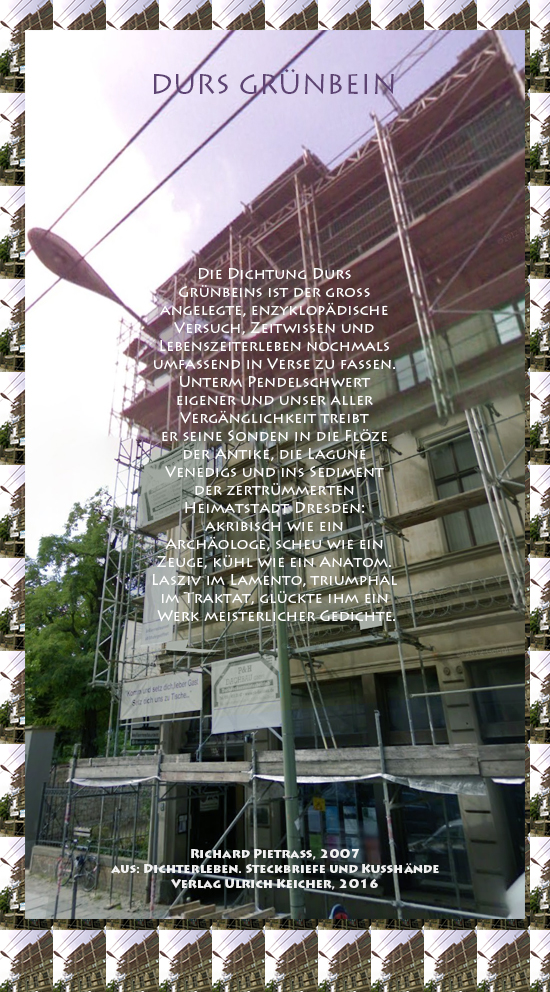












Schreibe einen Kommentar