Durs Grünbein: Warum schriftlos leben
SALZBURGER REDE
Diese Rede handelt von einer einzigen Szene. Sie steuert, wenn Sie etwas Geduld aufbringen, mir zuzuhören, auf einen Moment im Leben des Autors zu, der für Außenstehende vielleicht ganz unscheinbar ist, für mich aber, viele Jahre später erinnert, das, was Sigmund Freud eine Urszene genannt hätte. Doch bevor ich dazu komme, will ich kurz ein paar allgemeine Überlegungen vorausschicken, die erklären, warum dieser Moment mir als ein solches Schlüsselerlebnis erscheinen mußte.
Ob ein Autor sein Publikum kennt, wird oft gefragt. Manchmal taucht die Frage im Anschluß an eine Lesung auf, weit häufiger aber, vermute ich, schleicht sie sich ein, wenn der Leser oder Zuhörer im Stillen mit den Zeilen des Autors beschäftigt ist, sich verstanden fühlt oder mit ihnen hadert. Ich will gleich sagen, daß ich den Verdacht nur allzugut kenne. Mir selbst ist er bei der Lektüre bestimmter Stellen bei einigen Autoren in den Sinn gekommen, seltsamerweise zumeist bei den lyrischen Dichtern und überdurchschnittlich oft auch bei den Philosophen, was in beiden Fällen wohl mit einer gewissen Radikalität der Selbstbesinnung zu tun hatte, mit etwas, das ich vorläufig nur als solitäre Präsenz bezeichnen kann. Ich habe mich oft gefragt, warum dieser Zug in gewissen Gedichten und Gedanken etwas von einer geradezu anthropologischen Allgemeingültigkeit hat.
Nein, ich kenne es nicht, das Publikum. Und wie sollte ich auch bei der Verschiedenheit heutiger Lesegewohnheiten und der Masse an Freizeit für jeden, zu tun oder zu lassen, was immer ihr oder ihm einfällt. Wie heißt es bei Nietzsche so überaus boshaft? „Wer den Leser kennt, der tut nichts mehr für den Leser. Noch ein Jahrhundert Leser – und der Geist selber wird stinken.“ Nun ist dieses Jahrhundert um, und wir haben, zumindest in diesem Punkt, beinahe Gewißheit. Während die Frage nach dem Leser also erledigt scheint, macht ihre Umkehrung einem schon etwas mehr zu schaffen. Und das nicht nur, weil man selber identifikationssüchtig als Leser anfängt, bevor man als Schreiber eines Tages ins Bodenlose stürzt. Zu fragen wäre also, ob man sich selbst denn eigentlich kennt. Nicht, daß jedermann zu solcher selbstquälerischen Frage genötigt wäre, für den Autor aber, so scheint mir, ist sie ganz unvermeidlich. Auch wenn er selbst sie verdrängen mag, früher oder später ist es sein Metier, das in dieser Hinsicht von ihm Rechenschaft verlangt. Denn es ist das Schreiben selbst, das sich erst durch ein paar fundamentale Einsichten überhaupt konstituiert.
Zu diesen Einsichten gehört – erstens: Jeder stirbt für sich allein. Zweitens: Die Welt kommt ganz gut auch ohne dich aus. Und drittens: Da wo man selbst ist, kann kein anderer sein. Mit anderen Worten, man ist, infolge dieses einmaligen Chromosomensatzes, zu einem Körper geworden, physikalisch wie metaphysisch, dessen Stelle kein anderer, auch nicht im bloßen Gedankenspiel, einnehmen kann. Von Doppelgängern soll diesmal abgesehen werden.
Während die ersten beiden Punkte ziemlich entmutigend sind, hält der dritte fast schon so etwas wie Trost bereit. Er ist in diesem banalen, existentiellen Dreisatz der Archimedische Punkt, von dem aus alles andere sich aushebeln läßt, einschließlich der Trostlosigkeit, die andernfalls überwältigend wäre. Man kann das für einen Geburtsfehler halten, aber es ist so, aus irgendeinem Grund haben Dichter eine besonders lebhafte Vorstellung von der Zufälligkeit der eigenen Existenz. Während es ringsum offenbar schon als Verdienst gilt, überhaupt dazusein, kommt den meisten Dichtern ein Leben lang gerade dies als das Allerunwahrscheinlichste vor. Je nach Temperament sind sie darüber verwundert, bestürzt, momentweise überglücklich oder peinlich berührt. Die einen rühmen, was die andern verdammen, es herrscht hierüber in der gesamten Literaturgeschichte alles andere als Einmütigkeit. Und mit jedem neuen Dichterleben wird Salz in die Wunde gestreut.
Für den Nachschub an solchem Salz sorgt das durch und durch Fragwürdige des dichterischen Schaffens. Jeder weiß, daß Versemachen kaum als gesicherte Tätigkeit gelten kann; es ist kein Beruf, allenfalls ein höchst spirituelles Handwerk. Die Betroffenen selbst bestätigen das immer wieder mit ihrem schamvollen Zögern, sobald sie nach ihrem Tun befragt werden. Einer wie Baudelaire hat das Paradoxon poetischer Existenz in neuerer Zeit auf die Spitze getrieben, indem er sich selbst als das Gegenteil eines normalen Bürgers und Erwerbsmenschen darzustellen versuchte. Er tat das bekanntlich mit allem Aufwand an Dandytum, Idiosynkrasie und gespielter Verachtung. Der Preis dafür war entsprechend hoch. Im Laufe seiner Karriere als verseschmiedender Außenseiter kam ihm alles abhanden, was in den Augen des zahlenden Publikums einmal dazugehörte, die Demut, die Glorie, zuletzt sogar der Elan. Seine Berufung erwies sich am Ende als eine unheilbare Krankheit, und für diese, wir wissen es, sind die Psychiater eher zuständig als die Bibliothekare und Philologen.
Dabei trägt Poesie, wenn sie erwachsen wird, alle die obengenannten Widersprüche bereits in sich. Im günstigsten Fall kann schon ein einzelner Vers eine kleine Unendlichkeit sein, in der alle die Unvereinbarkeiten menschlichen Psyche enthalten sind.
Was aber gehört sonst noch zur Grundausstattung des Dichters? Neben dem Bewußtsein von der Zufälligkeit sicherlich so etwas wie träumerische Distanz, ein geschärftes Empfinden für die Entfernungen zwischen Realitäten und Symbolen sowie dafür, daß alles zeitlich ist – das heißt persönlich vergänglich wie historisch absurd. Außerdem Beobachtungsgabe und unbedingte Musikalität, ein Ohr für die Forderungen, die von der Sprache selbst ausgehen. Ich muß leider zugeben, daß all dies Voraussetzungen sind, bei deren Verteilung ich damals nicht sofort laut genug „Hier!“ geschrieen habe. So war mein Zeitgefühl früh schon getrübt. Morgen- und Abendstunden, die Dauer einer Empfindung im Gegensatz zu Pünktlichkeit und terminlicher Disziplin, das alles hat sich mir leider früh verwirrt. Und so ist es geblieben seit dem Kindheitsalter, das mir noch immer als das goldene erscheint, auch deshalb, weil es damals nicht so sehr darauf ankam, sich zu entscheiden. Was musikalische Erziehung betrifft, bin ich einer von den armen Sündern, die nie gelernt haben, ein Instrument zu beherrschen oder auch nur Noten zu lesen. Und mit dem Beobachten ist es nicht mehr allzuweit her, sobald man erst eine gewisse Sehschwäche attestiert bekommt. Goethe hatte ganz recht mit seinem Verdacht gegen die Brillenträger; alles Sonnenhafte verfälschen sie mit ihrer Prothese. Bleibt also nur träumerische Distanz. Davon immerhin habe ich reichlich abbekommen. Abstand zu allem, sogar zum eigenen Knochenbau, ist etwas, woran es mir nie gemangelt hat – eine zweifelhafte Begabung. So viele Umwege, bis man etwas gefunden hat. Leider hatte Nietzsche, dieser unglücklich in Musik und Dichtung Verliebte, nicht ganz unrecht, als er über sich und seinesgleichen das Urteil fällte: „Wir wissen auch zu wenig und sind schlechte Lerner: so müssen wir schon lügen.“ Ich weiß, es klingt unappetitlich, aber als wichtigstes Instrument für den jungen Autor erwies sich die Allergie. Allergie gegen jede Art Propaganda, das Sprechen in falschen Alternativen wie etwa Ost oder West, Sozialismus oder Barbarei, Arbeitsproduktivität versus brotlose Kunst usw. Allergie aber auch gegen die trägen Hoffnungen auf Utopia und die gerechte Aufteilung verbrannter Kuchen, gegen den lebensgefährlichen Politikstil in den Wintertagen des Kalten Krieges; Allergie gegen die dazugehörige Literatur und die verabredete Langeweile, das Gewäsch in den Zeitungen; Allergie gegen bürokratische Ignoranz und anmaßende Interessenvertretung im Namen des Volkes. Auf diese Weise kam eine ganze Liste an Allergien zustande, und die einzige Kur dagegen schien lange Zeit eine instinktive Hygiene, das Sichfortstehlen von allem, was als verordnet und historisch notwendig galt. Es tut mir heut selbst leid um soviel in bloßer Abkehr vergeudete Kraft, aber ich kann sie nicht zurückrufen, und noch weniger kann ich sie korrigieren, die Jahre. Es war ein Lehrgang in der Provinz – raumzeitlich betrachtet −, und die meisten der kleinen Lektionen werden in der globalen Zukunft vermutlich kaum etwas nützen.
Und nun die angekündigte Szene. Für Außenstehende gewiß eher unscheinbar, hat sie für mich selbst, Jahrzehnte später noch immer die Peinlichkeit einer Urszene à la Sigmund Freud. Sie spielt in einer Zeit, die ich am liebsten vergessen würde, weil sie mich mit der Skepsis des doppelt Inhaftierten beladen hat. Daß ich dabei einer unter siebzehn Millionen war, tut nichts zur Sache, es macht sie eher noch schlimmer. Denn geteilte Gefangenschaft ist keineswegs halbe Gefangenschaft, sie ist im Gegenteil deren Multiplikation. Zahlenspiele waren niemals ein Trost hinter Mauern. Es mag ja sein, daß in Rechenkünsten der Vorschein von Freiheit liegt. Das zwanzigste Jahrhundert, ich weiß, hat es damit recht weit gebracht. Da sagt jemand ich, und was er damit bezeichnet, ist eine arithmetische Größe, die im Spiel zweier historischer Kräfte, Supermächte genannt, gegen Null tendiert.
Stellen Sie sich also einen Provinzbahnhof vor, nachts um halb zwölf. Ein Soldat der Volksarmee, Funker bei den Motorisierten Schützen laut Dienstbuch, kehrt nach dem Grundwehrdienst zum erstenmal auf Urlaub in seine Geburtsstadt zurück. Er ist etwa achtzehn Jahre alt. Sein schmächtiger Körper steckt in einer Uniform, die ihn in seinen eigenen Augen zu einem Unberührbaren macht. Nach den Gesetzen seines paranoiden Staates ist er als vereidigter Rekrut zu einer Nummer im Wehrpaß geworden, in seiner Wirklichkeit jedoch, und nur diese zählt, zu einer Geisel im Kriegsfall. Er ist auf den Status eines Leibeigenen reduziert; was immer man ihm befiehlt, muß er ausführen. In diesem Moment, den ich niemals vergessen werde, war in meinem noch frischen Leben das Stadium absoluter Hörigkeit erreicht. Der letzte Rest eines kümmerlichen Selbst hatte den Körper verlassen, und das beste: man war Teil einer Armee, die gegen die eigenen Lebensinteressen in Stellung gegangen war. Wer weiß, vielleicht wollte man ja lieber kaugummikauend auf der anderen Seite des Limes herumspazieren, als Fußgänger in einer der Gassen Salzburgs. Doch nichts da, in jener Dezembernacht, kurz vor Heiligabend im Schneefall, war man endgültig in der innersten Kammer dieses Wahnlabyrinths angelangt. An Dienstverweigerung war nicht zu denken gewesen, sie hätte für den Konfessionslosen Gefängnishaft nach sich gezogen. Aber auch Desertieren war völlig unmöglich, man hätte sich für ein solches Abenteuer zuerst von der Truppe entfernen müssen – in dieser lächerlichen Verkleidung! −, um dann aus dem gesamten Herrschaftsbereich zu entfliehen, sprich durch den Eisernen Vorhang. Man hätte unsichtbar sein müssen für eine solche Aktion. Statt einer Tarnkappe aber trug man die Uniform der Armee eines nervösen, geltungssüchtigen Landes, das seine Bevölkerung mit Argusaugen bewachte.
Ich erzähle das alles nicht, um nachträglich über soviel Verlorenheit zu jammern. Es geht mir nur darum, klarzumachen, wie aussichtslos die Lage war. Spätabends war man vom Bahnsteig langsam zur nächsten Straßenbahnhaltestelle getrottet. Zu dieser Stunde war niemand mehr unterwegs, keiner der kleinen und letzten Menschen, wie Nietzsche sie genannt hätte, vor allem keiner der Proletarier, die nach lateinischer Logik dadurch definiert waren, daß sie anstelle von Eigenschaften vor allem Nachwuchs hatten (proletus hieß kinderhabend). Vorbei war der Feierabend, hinter den Gardinen ringsum ging das Licht aus. Es war ein Weihnachtsabend in einer toten marxistischen Zukunft. Auch die Eltern, bei denen man später wie der Verlorene Sohn aus biblischen Tagen Einlaß suchte, hatten sich schlafen gelegt. In der Straßenbahn fand man sich einigen Nimmermüden und Spätschichtlern gegenüber, doch das Mädchen, das beim Gähnen vor einem den Rücken krümmte, hätte sich niemals nach dem idiotischen Urlauber umgedreht und ihn angelächelt als barmherziger Engel.
Diesen Gewesenen in einem vergangenen Stadtbild heute nicht mit dem Mitleid zu bedenken, wie es so mancher Romanfigur bereitwillig entgegenschlägt, fällt nicht leicht. Jeder kennt sie, die entscheidenden Szenen im Leben der Raskolnikows, Moreaus und grimmigen Maldorors. Sie sind in Prosa verwandelte Doppelgänger ihrer Erfinder, und nur als solche lenken sie die Phantasie auf den jeweiligen Wohnort, das historische Datum und ihre verzweifelte Situation. Der hier spricht, ist ein Anderer, außerhalb jeder fiktiven, fern jener bedrückenden Realität. Nicht nur von Kopf bis Fuß, sondern bis in die letzte Körperzelle verwandelt, steht er heute wie ausgewechselt vor Ihnen. Auch der erwähnte Bahnhof ist längst renoviert, die Stadt, in der die Szene sich abspielte, das ruinierte Dresden, ist nun erwacht aus dem Jahrzehnte währenden Dornröschenschlaf. Bedarf es wirklich der Prosa, um etwas zurückerobern von all der verlorenen Zeit? Sind Gedichte, diese hybriden Überbleibsel der großen Vernichtungsorgien, tatsächlich untauglich geworden zur Aufbewahrung epiphanischer Momente? Sind sie wirklich nur mehr schwierige, kleine unlösbare Rätsel? Zugegeben, es sieht ganz danach aus, als hätten sie nichts als verspätete Selbsterkenntnis zu bieten, cognitio in absentia: ein paralleles Wortuniversum unwillkürlicher Erinnerungen und Einsichten, die meistens zu früh kommen und selten etwas bewirken.
Betrachtet man Zeit und Raum als geschlossenes System, ist das Gedicht der Kassiber, der wie durch ein Wunder aus der universellen Zwangsanstalt herausgeschmuggelt wurde. Haftet ihm nicht etwas Unerlaubtes an, etwas vom anonymen Verkehr zwischen den Einzelzellen der Existenz? Seine Funktion ist die eines Taschenspiegels, der einen über weite Entfernungen hinweg sekundenlang blendet, einen der Nachmieter, der künftigen, planetarischen Insassen, der zufällig das Fenster aufreißt und nachdenklich Ausschau hält. Ich selbst war ein solcher, als ich zu lesen begann. Faßt man es schärfer ins Auge, scheint es mit einemmal seine Splitter zu einem Muster zu ordnen. Und schon ist man hineingezogen in das Kaleidoskop einer Psyche, das sämtliche Lebensmotive in seinen spiegelnden Flächen bündelt. Seht, wie das glitzert und funkelt und in den allergewöhnlichsten Silben erstrahlt.
Dankrede gehalten im April 2000 im Foyer des Festspielhauses Salzburg bei der Entgegennahme des Prmio Nonino.
In den neun Aufsätzen
beziehungsweise Reden dieses Bandes umkreist Durs Grünbein Voraussetzungen, Bedingungen und Folgen des Schreibens. „Im Schreiben versucht sich das Intime zu behaupten“, heißt es etwa, „paradoxerweise, indem es sich öffentlich exponiert. Doch Öffentlichkeit ist, wie sich bald zeigt, nur eine besonders undurchlässige Schutzschicht.“ Grünbein läßt den Leser teilhaben an seinen Denkbewegungen, die Widersprüche nicht verkürzt in eine gewünschte Richtung manipulieren, sondern im Gegenteil entfalten. Historisierung ist eines der Verfahren, die Grünbein konsequent anwendet, egal, ob er nach dem biographischen Herkommen fragt, nach literarischen Traditionsfeldern oder nach ästhetischen Begriffen wie „Weltliteratur“, „Stil“, „Antike“ oder „Zitat“. Wenn er Literatur oder genauer: Dichtung als „Gebilde aus Worten“ in Beziehung setzt zum Tun der Architekten und Stadtplaner, wenn er den „Zusammenstoß von Wort und Musik“ untersucht und den Möglichkeiten und Grenzen der einzelnen Kunstgattungen nachspürt, eröffnet er überraschende und erhellende Sichtweisen nicht nur auf die eigene Arbeit.
Suhrkamp Verlag, Klappentext, 2003
Pausenfüller der Vergänglichkeit
− Lieder, die die Welt braucht: Durs Grünbein macht sich Gesellschaft. −
Drei Fragen hat ein als schwierig empfundener Lyriker nach dem Vortrag seiner Gebilde zu gewärtigen: Kann man denn davon leben? Seit wann schreibt er dergleichen? Warum schreibt er so etwas? Manch einer empfindet diese Fragen als Zumutung einer Erwerbsgesellschaft, die das „Auftrittsrecht“ der Literatur in Frage stellt, den Sinn des allgemeinen Betriebs aber nicht. Auch Durs Grünbein würde die Frager gern einmal mit der Gegenfrage erschrecken: ob sie denn wüßten, daß aus Leuten, die keine Künstler werden, nichts wird.
Aber Grünbein weiß, daß Dichtung schon immer darauf angewiesen war, „daß die Gesellschaft in ihrer Arbeitsteilung gut eingespielt war und ihre Festsänger mitfinanzierte“. Dem entspricht seine gegen eine geschichtliche Tendenz von Platon bis zu den Diktaturen des zwanzigsten Jahrhunderts aufrechterhaltene Hoffnung, daß keine Gesellschaft, die noch irgend an ihre Bestimmung glaubt, es sich leisten könnte, „schwierige Dichtung als solche in Frage zu stellen“.
Im übrigen stellt sich der Dichter die Fragen immer wieder auch selbst. Aber gerade vor ihm, der weiß, daß er sich „nur flüchtig kennt“, weichen je die Antworten zurück. „Hinter jedem Ursprung steckt ein früherer Ursprung.“ Einen Moment in seinem Leben aber hebt Durs Grünbein mit der „Peinlichkeit einer Urszene“ heraus:
Ein Soldat der Volksarmee, Funker bei den Motorisierten Schützen laut Dienstbuch, kehrt nach dem Grundwehrdienst zum ersten mal auf Urlaub in seine Geburtsstadt zurück. Er ist etwa achtzehn Jahre alt. Sein schmächtiger Körper steckt in einer Uniform, die ihn in seinen eigenen Augen zu einem Unberührbaren macht. Nach den Gesetzen seines paranoiden Staates ist er als vereidigter Rekrut zu einer Nummer im Wehrpaß geworden, in seiner Wirklichkeit jedoch, und nur diese zählt, zu einer Geisel im Kriegsfall… In diesem Moment, den ich niemals vergessen werde, war in meinem noch frischen Leben das Stadium absoluter Hörigkeit erreicht.
Ein solches Erlebnis der Beschlagnahmung der Person kann Einsichten zeitigen, die „zur Grundausstattung des Dichters“ gehören:
Erstens: Jeder stirbt für sich allein. Zweitens: Die Welt kommt ganz gut auch ohne dich aus. Und drittens: Da, wo man selbst ist, kann kein anderer sein.
Die dritte Einsicht ist nicht nur für sich tröstlich, von ihr aus läßt auch „alles andere sich aushebeln“. Da verwandelt sich die Erfahrung der Trennung und Isolation ins Glück des Entrinnens und der Subversion.
Gedichte sind in diesem Zusammenhang „Botschaften aus langjähriger Einzelhaft“, Kassiber, die „wie durch ein Wunder aus der universellen Zwangsanstalt herausgeschmuggelt“ werden. Dem Schreiben wie dem Lesen von Gedichten haftet so „etwas Unerlaubtes an“, wie es allemal die reizt, die „geistige Abwechslung“ suchen. Denn ohne Kunst wäre die Welt „ein Ort der Plackerei und Langweile“. Dagegen „glitzert und funkelt“ das Gedicht, obwohl es aus den „allergewöhnlichsten Silben“ besteht.
Ein Gedicht also ist nach wie vor Flaschenpost, die „ein ansprechbares Du“ finden soll, unberechenbar in ihrem Kurs, oder Taschenspiegel, der über Entfernungen hinweg blendet; Zufall, wen das Licht erreicht und fragen läßt. In seinen Aufsätzen stellt Grünbein potentiellen Lesern vorsorglich Gegenfragen. Der Titel ist eine davon, aber ohne Fragezeichen. Es gibt keinen Grund, Gedichte nicht zu lesen, mag die Welt sie brauchen oder nicht.
Mit seinen Fragen macht sich Grünbein Gesellschaft. Er betrachtet das „Panoramagemälde“ der Weltliteratur mit Goethes Augen, zwischen „Antike und X“ zitiert er Geister herbei und merkt auf Zurufe. Er belebt den „verschwundenen Platz“ mit Gestalten; auf seiner Agora wird philosophischen „Oligarchen, die Staat und Gesellschaft für sich beanspruchen“, mit Adorno die Stilfrage gestellt. Als „Komplize der Vergänglichkeit“ bittet dagegen der „Silbenschmied“ alle anderen zur „Pause im Sterben“, zum Tanz auf unüberwachtem Platz. Warum der Einladung nicht folgen.
Friedmar Apel, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 17.7.2003
Südliche Silben
− Ein Dienstbüchlein: Kleine Texte von Durs Grünbein. −
Nichts leichter, als dergleichen gering zu schätzen: Gelegenheitsarbeiten, auf Zuruf nicht immer der Muse entstanden, bislang verstreut, nun plötzlich verdutzt zwischen zwei Deckeln beieinander. Aber was soll diese Geringschätzung? Zum Berufsbild eines erfolgreichen Dichters gehört nun einmal, dass er gelegentlich einen Preis erhält, dass man ihn einlädt zu Jubiläen und in Festspielhäuser oder dass er in eine Akademie gewählt wird. Es kommt drauf an, was einer aus solchen Anlässen macht.
Durs Grünbein stellt an den Beginn seiner Dankesreden, Vorträge und Aufsätze aus den vergangenen Jahren die Selbstvorstellung anlässlich der Zuwahl in die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung. Es ist da vom Trauma der Geburt die Rede, vom Aufwachsen in Sachsen, vom Abschied aus Dresden, dem „Barockwrack an der Elbe“. Ruinen allerorten. Aber man müsste taub sein, wollte man das entscheidende Motiv überhören: Das Davongekommensein, das Glück, der geworden zu sein, der nun schreibt: ein erfolgreicher Dichter. Dieses Einverständnis mit sich selbst bewahrt Grünbein in allen diesen Texten vor dem Kokettieren mit der Maske des poète maudit, des Außenseiters und Schmerzensmanns. An dessen Stelle tritt der bekennende Brillenträger, der seine Gelehrsamkeit ungern verleugnet und sich nicht lange bitten lässt, einen Artikel zum Stichwort „Zitat“ zu verfassen. Die Angstlust, mit der er dieses Wort anfasst, wiegt manche offizielle Selbstauskunft auf. Der Titelessay ist vor allem eins: ein Loblied auf auf die Schrift, das einzige Verfahren,„mit dem Bewusstsein sich photographieren läßt“.
Was ein Platz ist, weiß nur der Süden. Der klassische Süden ist in diesem Dienstbüchlein eines viel gefragten Poeten der Fixpunkt: die lateinische Schriftsprache als selbstgewähltes Trainingslager, das Echo des alten Griechisch, die Villen in Pompeji. Die Todsünde ist nicht die biblische, sondern der platonische Putsch der Philosophie auf Kosten der Poesie. Reflexion kann ich auch, sagt der Dichter. Sehr schön ist eine kleine Reflexion zum Sandburgenbau.
Lmue, Süddeutsche Zeitung, 23.5.2003
Das Wirkliche am Ich
− Durs Grünbein will nicht schriftlos leben. Neuere Reden und Aufsätze. −
Für ein Nachdenken gab es in den letzten Jahren für Durs Grünbein viele Anlässe: die Zuwahl in die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung, die Entgegennahme des Premio Nonino in Salzburg, das Tokyo Summer Festival oder auch ganz einfach nur das Goethe-Jahr. In den Reden und Essays des neuen Bandes Warum schriftlos leben geht es bei unterschiedlichsten Themen unter der Hand stets um die Dichtung und ihren Platz. Und spricht man über Dichtung, muss man von ihrem Urheber und seiner mehr oder weniger fragilen, zu verteidigenden Position sprechen. Nach Lesungen werde er oft von Zuhörern mit den drei typischen Fragen konfrontiert: ob das Dichten einträglich sei und seit wann, aber vor allem, warum er schreibe.
Die Verskunst, antwortet er, sei der Versuch, ein Fensterchen in die eigene schwindende Zeit einzusetzen. Nur „eigensinnigster Ausdruck bietet die minimale Chance, eines Tages anders als nur in sterblicher Hülle wahrgenommen zu werden“. Die Voraussetzungen für diese antibiologische Unsterblichkeit sind denkbar einfach und jedem gegeben, der einem Mindestmaß an Alphabetisierung ausgesetzt war. Grünbein beruft sich auf den Willen, für die klassische griechische Philosophie das von der Vernunft bestimmte handlungsleitende Streben. Erst der Wille zum Geist und zur Schrift mache den Menschen zum Menschen.
Doch der Autor bezieht sich nicht nur hier auf die griechischen und lateinischen Klassiker. Dieser Fernverkehr ist seiner Meinung nach noch immer ein Muss für die moderne Literatur und ihre Schöpfer. Die antike Literatur stehe für das Nichttriviale, „im Lateinischen steckt der Befehl zum aufrechten Gang, das Alphabet zur Charakterbildung“. Zur Verwandlung in den Dichter habe ihm die Begegnung mit den Ausgrabungsstätten von Herculaneum und Pompeji verholfen. In der antiken Tradition entdeckte er eine neue Heimat, die ihm im Gegensatz zu den Erfahrungen in der DDR eine tatsächliche zu werden versprach.
Was das sozialistische Ideal nicht schaffte, vermochte das römisch-griechische: Es grundierte dem Dichter die Schrift- und Denkzüge, verlockte ihn zur Adaption von Gedanken größeren Formates. Letztendlich gibt es aber noch einen weiteren und übergreifenderen Grund, zur Schrift zu kommen. Der unendliche Zufluchtsraum Gehirn, schreibt Grünbein, könne nur schriftlich bereist werden. Hierin ist die Dichtung allen anderen Kunstformen überlegen, denn diese sind, „sobald es um die inneren, traumhaften Zusammenhänge geht, auf das Wort angewiesen. Der Traum, und das stellt sich erst schreibend heraus, ist das Wirkliche am Ich“.
Gegenüber der Musik besitze die Dichtung den Vorteil, dass sie zu intimeren Kontakten fähig sei, ihre Wege von Körper zu Körper zögen weniger raumgreifend. Die Musik sei selbstherrlich und grandios, neige eher zu Höhenflügen, da sie überdeterminiert und ungleich mehr hochgerüstet mit ihren Effekten sei. Einzig die Literatur träte der Zeit nackt gegenüber, durch ihre Armut ist allein sie prädestiniert zu einer besonderen Vertrautheit mit Chronos. Einem Dichter fehlten ganz einfach die Mittel zu jener totalitären Ästhetik, wie sie der „herrschsüchtige Wagner“ vertrete. Auch mit der Architektur verglichen kommt die Kunst der Schrift besser weg. Noch in der kleinesten Gefängniszelle, so Grünbein, verschaffe eine Buchseite das Gefühl imaginärer Freiheit. Die Architektur, ja selbst schon eine beliebige Hauswand könne „einen dagegen zur Geisel, wenn nicht zum Gefangenen des Raumes“ machen.
Es gibt im Grunde, so das dezente Fazit dieses Bandes, keine andere Disziplin oder Äußerungsform des Menschen, der nicht die Dichtung, „im Grunde so alt wie kaum ein anderes Handwerk“, überlegen wäre. Sogar die Philosophie verdanke der Dichtung mehr als sie zugebe. Das vorsokratische Denken wäre nicht, was es ist, ohne den „Vorlauf poetischen Sprechens“. Deshalb seien die wesentlichsten Philosophen des 20. Jahrhunderts erneut der Kunst verfallen, erläutert Grünbein am Beispiel Adornos. Natürlich ahne ein Leser, wenn er den Autor mit obigen drei Fragen zu Leibe rückt, von all der Komplexität wenig:
Wie alle Konsumenten sieht er den Vorgang naturgemäß einseitig, entweder allzusehr vom Aufwand bestimmt, der ihm gewaltig erscheint, oder vom Ergebnis her, das ihm strenggenommen recht dürftig vorkommt.
Cornelia Jentzsch, Frankfurter Rundschau, 13.9.2003
Ein Wort gegen das Nichts und die Gebirge aus Werken
Durs Grünbeins Aufsätzesammlung Warum schriftlos leben fragt, was Schriftsteller antreibt zu sein, wie sie scheinen: gewandt und erfolgreich, selbstbewusst und zielstrebig, extrovertiert und eloquent und alles, wozu es bedarf, dass man Bücher verfasst, verlegt und gelesen wird; um dann in Lesungen mit Fragen traktiert zu werden wie: „Kann man denn davon leben?“ und „Sagen Sie, seit wann schreiben Sie eigentlich schon?“ und „Warum schreiben Sie?“ Was zuletzt dazu führt, dass einen diejenigen bewundern, die gerne so wären, wie sie es scheinen. Aber es treibt sie nach Durs Grünbeins These die unaufhörliche Angst vor dem Nichts, das geschichtslose, aber Geschichten suchende Gesicht, diese heimtückische, alles verzehrende Wiederkehr des immer gleichen Alltäglichen, gegen das sie das kleine Fenster in ihre Biographie schneiden, das man Gedicht oder Prosa nennt, durch das sie noch später, wenn das Nichts alltäglicher Verrichtungen sie mit dem Tode schlägt, immer noch sichtbar sind. Denn diese sind Pausen im Sterben ihres Verfassers, scheinbar dem Nihilismus Entrückte. Denn was bleibt, möchte man sagen, stiften die Bücher – und fast noch, wenn es statthaft wäre, hinzufügen: fiat ars – pereat mundus; obgleich ihre Bedeutung am Blatt klebt wie die Fliege an Musils Fliegenpapier – wenn es ihnen mitunter gleich der Philosophie auch Flügel verleiht.
buechermaxe, amazon.de, 8.10.2006
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Michael Braun: Die Verteidigung der Poesie
Neue Zürcher Zeitung, 26. 6. 2003
Richard David Precht: Honi soit qui mal y pense
Literaturen, Heft 7/8, 2003
Fakten und Vermutungen zum Autor + Archiv + KLG + IMDb + ÖM +
Facebook + DAS&D + Georg-Büchner-Preis 1 & 2 +
Orden Pour le mérite + PIA
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Galerie Foto Gezett +
deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Durs Grünbein–Sternstunde Philosophie vom 14.6.2009.


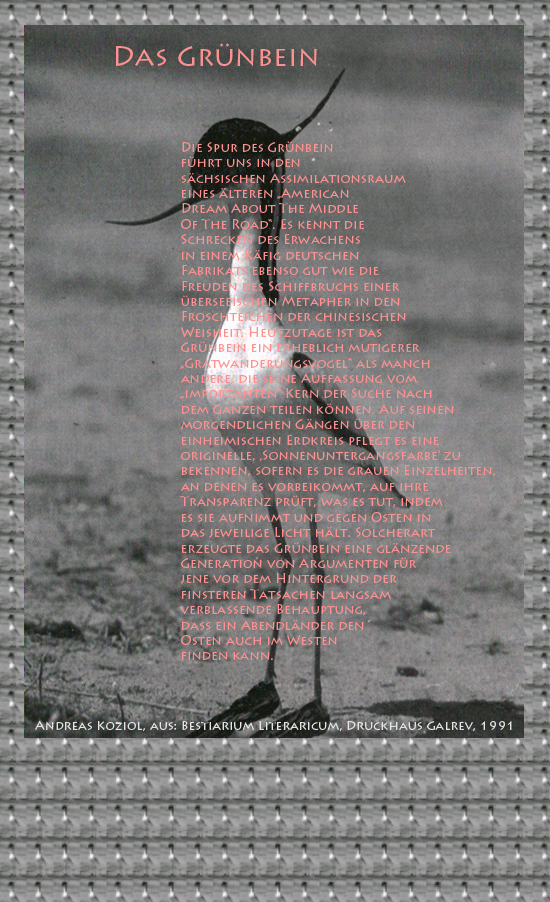
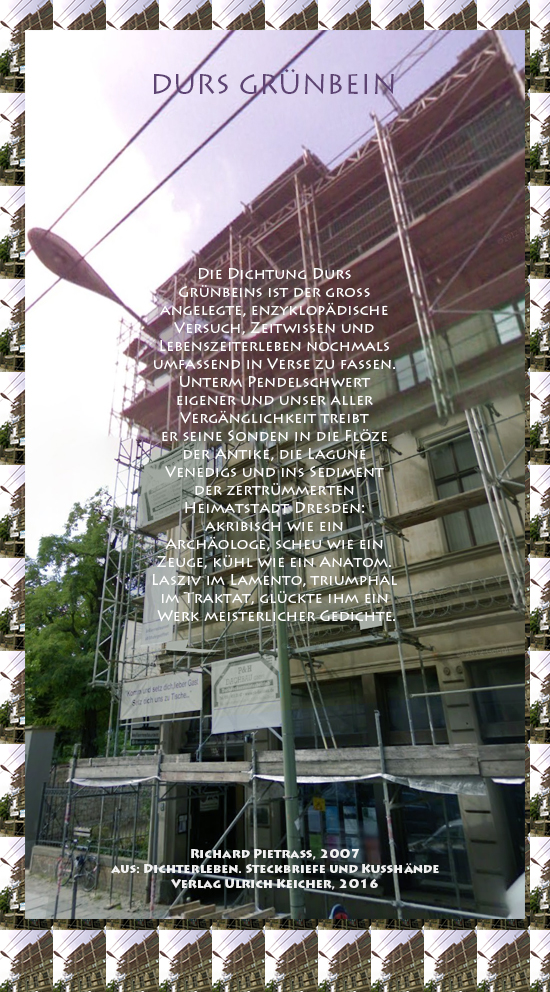












Schreibe einen Kommentar