Elisabeth Borchers: Lichtwelten. Abgedunkelte Räume
ZWEITE VORLESUNG
Anfänge oder Das Geheimnis des Anfangs
(…)
Ort des Geschehens
Bonn, Helmholtzstraße, im Frühjahr 1959. Es war die Zeit der Vorbereitungen zu meiner ersten Reise in die Vereinigten Staaten. Der Anglist Erwin Merbusch hatte sich auf meine Anfrage am Schwarzen Brett der Universität gemeldet. Ich bat um Hilfe im Englischsprachigen, zweimal wöchentlich abends, 5 Mark pro Stunde.
Es war der sechste Abend. Merbusch legte das Lesematerial, Zeitungsartikel, ein Übungsbuch auf den Tisch und redete englisch. Mir fehlte jedes Interesse, jede Neigung zu dieser Auffrischung eines sechsjährigen Schulunterrichts. Die deutschsprachige Literatur war mir näher, wichtiger. Merbusch blätterte in seinem Buch und schlug den Text eines Shantys auf, er ließ mich laut lesen
THE DRUNKEN SAILOR
What shall we do with a drunken sailor?
What shall we do with a drunken sailor?
What shall we do with a drunken sailor?
Early in the morning!
Way, hay and up she rises!
Way, hay and up she rises!
Way, hay and up she rises!
Early in the morning!
und übersetzen. Gleich zu Beginn der erste Fehler: „a drunken sailor“ ist nicht ertrunken, er ist betrunken. Doch nichts ist mir mehr zuwider als Betrunkenheit.
Die Stunde schleppte sich hin, ich war mit meinen Gedanken unterwegs. Merbusch ging, und ich setzte mich an den schmalen Tisch unterhalb des Fensters, der mir als Schreibtisch diente. Der einzige Schmuck: eine Nolde-Kunstkarte mit dem Liebespaar in verwirrend vielen Rotnuancen; ich erinnere mich zudem an einen gelben Fleck, das war inmitten des Rots eine Zitrone in einem Zitronenbaum.
Es hatte wieder zu regnen begonnen, von der Straße herauf Schritte, die eilten und verschwanden. Der Abend war nachtschwarz. Die ersten Zeilen ergaben sich von selbst:
eia wasser regnet schlaf
eia abend schwimmt ins gras
wer zum wasser geht wird schlaf
wer zum abend kommt wird gras
Anders konnte es nicht sein. Ein Gedanke an die Wiesen am Rhein, zu denen ich vom Pressehaus aus in der Mittagspause hinüberging.
weißes wasser grüner schlaf
großer abend kleines gras
es kommt es kommt
ein fremder
Der Fremde war wohl nicht Merbusch; vielmehr der Mensch, der im Regen mit eiligen Schritten am Haus vorübergegangen war. Mir gefiel dieser Auftakt zu etwas, das jetzt kommen sollte – die Matrosenfrage, die keine Korrektur erlaubte:
was sollen wir mit dem ertrunkenen matrosen tun?
wir ziehen ihm die stiefel aus
wir ziehen ihm die weste aus
und legen ihn ins gras
Ich dachte an meine beiden Kinder und sah ihr Erschrecken:
mein kind im fluß ist’s dunkel
mein kind im fluß ist’s naß
Ich verstand, daß das angstmachende Gedicht weitergehen muß:
was sollen wir mit dem ertrunkenen matrosen tun?
wir ziehen ihm das wasser an
wir ziehen ihm den abend an
und tragen ihn zurück
mein kind du mußt nicht weinen
mein kind das ist nur schlaf
Und ein dritter Anlauf:
was sollen wir mit dem ertrunkenen matrosen tun?
wir singen ihm das wasserlied
wir sprechen ihm das grasgebet
dann will er gern zurück
Ich fühlte mich entlastet. Lied und Gebet hatten den Toten besänftigt. Er war bereit, das Wasser als sein Element auch künftighin zu akzeptieren. Auch die Kinder waren in meinen Gedanken beruhigt. Nur der Fremde mußte noch gehen, er war hier nicht mehr zu dulden.
Merbusch, mit seinen Zeitungsartikeln, dem Übungsbuch, dem drunken sailor, mußte jetzt wohl zu Hause sein. Es regnete immer noch und kein Mondstrahl in dieser Schwärze.
es geht es geht
ein fremder
ins große gras den kleinen abend
im weißen schlaf das grüne naß
und geht zum gras und wird ein abend
und kommt zum schlaf und wird ein naß
eia schwimmt ins gras der abend
eia regnet’s wasserschlaf
Der Feuilleton-Chef der FAZ, Schwab-Felisch, druckte dieses Gedicht am 20.7.1960 ab. Die Folge war ein Aufbegehren entrüsteter Leser. Schon einmal seien der Redaktion Proteste auf den Abdruck eines Gedichtes hin widerfahren. Es handelte sich um „Nachhut“ von Günter Eich, mit der Zeile: „Die Kanaldeckel heben sich um einen Spalt.“
Eine Drohung, die einem Gedicht nicht erlaubt werden kann. Damals waren es sieben Briefe. Dieses Mal würden es hundert sein.
NACHHUT
Steh auf, steh auf!
Wir werden nicht angenommen,
die Botschaft kam mit dem Schatten der Sterne.
Es ist Zeit, zu gehen wie die andern.
Sie stellen ihre Straßen und leeren Häuser
unter den Schutz des Mondes. Er hat wenig Macht.
Unsere Worte werden von der Stille aufgezeichnet.
Die Kanaldeckel heben sich um einen Spalt.
Die Wegweiser haben sich gedreht.
Wenn wir uns erinnerten an die Wegmarken der Liebe,
ablesbar auf Wasserspiegeln und im Wehen des Schnees!
Komm, ehe wir blind sind!
Das Feuilleton druckte eine Auswahl der Zuschriften ab, dann einen Erklärungstext, um den ich gebeten worden war. Nun meldeten sich Leser, die sich mir zur Seite stellten. Auch von diesen Briefen wurden einige abgedruckt. Zahlreiche Interpretationen wurden mir geschickt. Dieter Schönbach vertonte das Gedicht, Carla Henius sang es in Prag bei den Jugendmusik-Festspielen.
Am letzten Tag des vergangenen Jahrhunderts – es war der 31.12.1999 – veröffentlichte die FAZ in der Frankfurter Anthologie die Interpretation von Ulrich Greiner zu dem Gedicht „eia wasser regnet schlaf“. So lautet der Beginn:
SCHLAFENSANGST, ERTRINKENSANGST
Dieses Gedicht aus dem Jahr 1960, eines der ersten von Elisabeth Borchers, ist gewissermaßen ihre Blechtrommel, denn kaum einer, der sie später rühmte, hat versäumt, an den Skandal vor Urzeiten zu erinnern. „eia wasser regnet schlaf“ erregte, als es vor rund vierzig Jahren in dieser Zeitung abgedruckt wurde, Aufruhr bei den Lesern. Keiner, schon gar nicht Elisabeth Borchers, hat ihn vorausgesehen oder gewollt. Tapfer wehrte sie sich gegen die Vorwürfe der „Volltrunkenheit“, der „Verdummung“ und der „entarteten Kunst“.
In den letzten Tagen des alten Millenniums erscheint es absurd, daß ein argloses Gedicht solchen Wirbel auslösen konnte. „eia wasser regnet schlaf“ gehört noch immer zu ihren schönsten Gedichten, und keiner, der es heute liest; fühlt sich dadurch verletzt, weder durch die Kleinschreibung noch durch das traumverlorene Spiel mit Wortklängen, Märchenmotiven und Mythenzauber.
Am 18.8.1960 hieß es in der FAZ:
Die Diskussion über das Gedicht „eia wasser regnet schlaf“ reißt nicht ab. Die Zuschriften schwellen an. Die Redaktion hält es für nützlich, Gegnern und Anhängern und nicht zuletzt der Autorin Kenntnis durch eine prozentual repräsentative Auswahl der zahlreichen Zuschriften (weit über 100) Kenntnis voneinander zu geben. Die Veröffentlichung soll unter anderem bewirken, daß die Anhänger erfahren, wer und wie die Gegner sind, und daß die Gegner darüber ins Bild gesetzt werden, daß sie nicht allein das Monopol auf den gesunden Menschenverstand beanspruchen… Wir haben deshalb die Autorin gebeten, sich mit den Briefen der Leser auseinanderzusetzen:
„Erkläret mir, Graf Oerindur, doch diesen Zwiespalt der Natur“, mit dieser Bitte schließt eine der zahlreichen Zu- und Schmähschriften… Auf die einzige sachliche Anfrage, warum die meisten Substantive klein, wenige nur mit Großbuchstaben beginnen, möchte ich zuerst antworten: dies geschah ohne meinen Willen, mein Gedicht kennt keine großen Buchstaben, kennt keine ,Hauptworte‘, alle Worte sind mir gleich viel wert. Zum zweiten möchte ich mit den ,Einwänden‘ und Anklagen derer vertraut machen, die Leidenschaft und Zeit aufwandten, um sich gegen ,pathologische Lyrik‘ zu wehren. Da heißt es zum Beispiel: „… nicht länger darüber im unklaren zu lassen, daß man ertrunkene Matrosen gemeinhin bestattet, wenn sie angeschwemmt werden. Ein solches bedauernswertes Opfer seines Berufs jedoch zu entkleiden, ist nicht nur ungehörig, sondern grenzt an Leichenfledderei; es wieder dem nassen Element zu überliefern, läßt nicht nur schlechte Erziehung und Gefühlskälte vermuten. Ich kann Elisabeth Borchers also nur raten, in der hergebrachten Weise mit dem Toten zu verfahren…“ Ein Verkaufsleiter erklärt mit dem Hinweis auf den „normalen (unterstrichen) Verstand“, „dieses Gedicht, welches nach meiner Auffassung geradezu einen Höhepunkt-Entarteter Kunst: darstellte… Seines Zeichens ein Professor (er war nicht der einzige) fühlte sich zu Nach-Dichtungen animiert: „… Es bleibt im Kern trotz Eia-Ei / Doch nichts als Leichenfledderei.“ Ein Herr aus Bonn: „… ich kann mir aber nicht vorstellen, daß diese Veröffentlichung auch nur ein paar Mütter anregen könnte, ihre Kinder ausgerechnet dann mit einem ertrunkenen Matrosen in Angst zu versetzen, wenn sie schlafen sollen“ … H. R., der allerdings eingesteht: „Die von Ihnen abgedruckten Gedichte bleiben mir meistens unverständlich“, erkundigt sich in bezug auf die Zeile „wir ziehen ihm das wasser an“, ob es sich um eine „Wasserhose“ handle. (Nein.) Außerdem fielen andere markante Formulierungen wie „schizophrenes Gestammel“ oder „volltrunkene oder entartete Dichterin“, ein „Jahrgang 1886“ verweist mich an seinen Nervenarzt, in dessen Wartezimmer besagte Zeitungsausgabe lag, und betont, daß er sich nun nach Lesen meines Gedichtes, wieder „normal“ vorkomme; ein „Jahrgang 1932“ befürchtet, obwohl er „ein moderner, aufgeschlossener Mensch“ sei, daß „wir bewußt verdummt werden?“… und vieles andere mehr.
Zu all dem, mein Gedicht betreffend, läßt sich leider nur sagen: Was erwarten die geneigten Leser eigentlich von einem Gedicht? Ein Gedicht stellt doch keine Information dar im Sinne von Nachrichtenvermittlung. Die findet man in der ganzen übrigen Zeitung. Aber 20 oder 30 Zeilen inmitten der Informationen werden dann und wann ausgespart für das, was Lessing die „vollkommene sinnliche Rede“ nannte. Allein 20 oder 30 Zeilen in einer Hölle von nützlichen Buchstaben, denen es erlaubt ist, der Realität – dem, was wir Realität zu nennen gewohnt sind und was doch nur unser Dahinleben und Daherreden ist – zu entfliehen, ihre eigene unnütze Realität zu finden, und sei es die des Traums, in dem sich alles auf den Kopf stellt und in dem doch alles geborgen ist in einer süßen Surrealität.
Im Falle meines Gedichtes war die Surrealität schon deshalb legitim, weil es sich hier um ein Schlaflied handelt – und Schlaflieder waren seit eh und je und in allen Sprachen ein Sprechen aus dem Traum heraus, um in den Traum hineinzuführen. Am Abend verwischen sich die Konturen, „das gleichgültig Nahe verschwindet, Fernes, das besser und näher scheint, rückt heran“, um mit Ernst Bloch zu reden, am Abend beginnt das Reich der Märchen, die erfundene Träume sind, und warum sollte ich nicht auch ein Märchen erfinden? Ich habe es getan. Wer Märchen erfindet, kann sie nachher nicht erklären oder gar zurücknehmen, sie haben den ,Erfinder‘ selbst mit in ihren Traum genommen. Es ließe sich auch unduldsamer – dafür konkreter – formulieren, dies alles; dann müßte ich mit Paul Celan sagen: „Es gehört zum Wesen des Gedichts, daß es die Mitwisserschaft dessen, der es hervorbringt, nur so lange duldet, als es braucht, um zu entstehen.“ Dann müßte ich – weil ich trotzdem nur allzuviel von der Entstehung und Realität meines Traumes weiß – beginnen, hier die Entwicklung einer Poesie nachzuzeichnen, die immerhin seit über hundert Jahren andere Wege geht als „der gesunde Menschenverstand“, ja diesen geradezu provoziert, und in deren Tradition ich mich aufgehoben weiß. Aber für wen dies? Die einen wissen es ohnehin, die anderen wollen es nicht wissen – wollen nicht wissen, daß die „Inspiration“ nachahmt und nur der kritische Geist neu schafft, wie Oscar Wilde es ausdrückte, daß der Künstler zumindest seit Mallarmé zum „Mann in der blauen Schürze“ wurde, also zum „Mann im Labor“ (Benn), der wie der Wissenschaftler experimentiert, in seinem Fall mit Sprache, dem es um Strukturen geht wie dem Mathematiker und Physiker, um „methodische Sprachspiele“, um es mit Wittgenstein zu formulieren.
Das Spiel mit häufigen Worten ist es auch, das ich in meinem Schlaflied spielte: Worte werden in die verschiedensten Zusammenhänge gestellt und erhalten so die verschiedensten Bedeutungen. Die Relativitätstheorie ist auch für den Schriftsteller eine Realität, die er nicht umgehen kann; vom Wort zu jenem Ding, das es bedeutet, ist ein weiter Weg, und zuletzt werden alle Dinge in Frage gestellt werden, weil die Worte in Frage gestellt werden, zuerst durch ihre Erstarrung zum bloßen Begriff, wie es die ,Umgangssprache‘ mit sich brachte, dann durch die verschiedenen Konstellationen, zu denen ich diese Worte gruppierte. Wie es der neuen Malerei seit gut fünfzig Jahren darum zu tun ist, die Farbe ihrer eigenen Realität zurückzugeben, das heißt, sie nicht dazu verwendet, ihr eine andere Realität – zum Beispiel eine Vase – nachzubilden, geht es der Literatur mindestens auch seit der Jahrhundertwende darum, die Sprache ihrer eigenen Realität zurückzugeben, ungegenständliche Literatur zu schreiben, nicht umsonst Sätze wie „Interpretierbarkeit eines Satzes als Einwand gegen ihn“, wie sie gang und gäbe sind in modernen Texttheorien und wie sie im Grunde schon in den Fragmenten des Novalis angekündigt wurden. Doch wozu dieser Exkurs? Denen, die auf „entartet“ pochten, ist sowieso nichts zu beweisen – und schon gar nicht zu helfen. Anscheinend ist es ihnen entgangen, daß die FAZ von vornherein doch schon die ansprechenderen Gedichte abdruckt, die heute geschrieben werden. Anscheinend lesen sie keine Literaturzeitschriften, hören weder Schönberg und Webern noch Stockhausen oder Nono im Radio, kennen weder Kandinsky noch Pollack oder Mathieu… kennen aber auch nicht jenen Satz Goethes, der besagt, daß die Musik die höchste der Künste sei, weil sie keinen Inhalt hat, der „abgerechnet“ werden muß; also schon Goethes Abneigung gegen den Inhalt, dabei wird keiner behaupten wollen, Goethes Gedichte seien inhaltslos, und – leider muß man hierzulande Beweise immer mit Goethe führen – es wird auch kaum jemand beweisen können, mein Schlaflied sei inhaltslos, aber hier wie dort ist der Inhalt die Form selbst, und das heißt wiederum, das Gedicht hat seine eigene Realität – und wenn es seine eigene Realität nicht erreicht, ist es kein Gedicht, sondern im Höchstfall eine Information irgendwelcher Art –, und Informationen – wie gesagt – finden sich in der ganzen übrigen Zeitung, nur 20 oder 30 Zeilen überläßt man ab und zu den unverbesserlichen Weltverbesserern, den Träumern, die ihre Träume so exakt anzuordnen wissen und denen doch nichts bleibt als die Trauer, daß ihre Träume – und seien sie auch solche von einem ertrunkenen Matrosen, mit dem man die erbarmungslos der Realität ausgelieferten Erwachsenen nochmals in die Surrealität der Kinder zurückführen möchte – trotzdem so aussichtslos allein geträumt wurden, ja wahrhaftig, ein Zwiespalt der Natur, also unerklärbar, ich bitte um Vergebung und ziehe mich zurück.
Es folgt beispielhaft die Zuschrift von Norbert Willerding, Bad Kissingen:
… Die einschmeichelnde, erst beim Sprechen vollends vernehmbar werdende Melodik dieses bezaubernd schönen Gedichtes läßt zwar dem Unheimlichen des beinahe makabren Inhalts der Strophe II doch genügend Entfaltungsmöglichkeit, um Intensität zu schaffen, sorgt aber dafür, daß es nicht zum Schrecknis wird. Die durch die Zeilen scheinende Allegorie des Todes, dargestellt durch die Entkleidung des Leichnams von seinen menschlich-zivilisatorischen Attributen, der die Rückkehr ins Sein der Natur folgt, ist von buddhistischer Sanftheit! Wie hier Kontraste aufeinander abgestimmt werden, damit das Fluidum eines Schlafliedes erhalten bleibe, verrät höchste künstlerische Sensibilität. Daß die Strophe III nicht nur hinsichtlich der Satzfolge ein Spiegelbild der Strophe I darstellt, sondern auch gleichzeitig die in dieser erscheinenden Vorgänge wie im Zuge einer Regression zurückverwandelt – dies ist ein Einfall, den ich fast genial nennen möchte; denn plastischer kann dem Lauschenden die schwebende und wogende Bewegtheit sich gestaltender und sich verflüchtigender Traumbilder kaum nahegebracht werden als durch diesen Kunstgriff im besten Sinne des Wortes.
Jeder Kritiker, der nicht fähig ist, diese leicht ersichtlichen ästhetischen Qualitäten zu erkennen, verliert jedes Mitspracherecht in der Diskussion, zu der dieses Gedicht in unaufdringlicher Weise einlädt. Überhaupt fehlt ihm eine sonst nicht eben seltene Eigenschaft moderner Kunstwerke, nämlich, den Betrachter ratlos zu lassen. Das einschläfernde Geräusch des Regens bietet sich als Stoff eines Schlafliedes zwanglos an. Die assoziative Verknüpfung mit dem Wasser, dem Fluß, dem grünen Gras, dem Ertrunkenen ist ebenfalls nicht gerade gewaltsam. Es gibt nichts Gewaltsames, nichts Schroffes, nichts Provozierendes in diesem stillen, zugleich geheimniskündenden und geheimnisentschleiernden Gedicht! In letzterer Eigenschaft enthält es einen nicht geringen Informationsbeitrag. Beispielsweise wirft es ein Licht auf die geläufige, offenbar aber nicht genügend bedachte und vorzüglich den Psychoanalytiker interessierende Tatsache, daß Kinder nicht nur von Rauschgoldengeln oder Teddybären träumen, sondern daß das Grauen, wenn auch nur am Rande erspäht oder vernommen, sich mit Vorliebe in ihrer Phantasie einnistet und im Einschlaf- und Traumdenken in gespenstiger Flüchtigkeit wiederkehrt. Wer eine Ahnung davon besitzt, wer nicht vergessen hat, wie hartnäckig gerade das Kind ,jenseits des Lustprinzips‘ angstvolle Eindrücke und beunruhigendes Erleben im ,Wiederholungszwang‘ nachvollzieht, wer Nietzsches Ausspruch „Wofür wir Worte haben, darüber sind wir schon hinweg“ in seiner Bedeutung erfaßt, kann nicht umhin, in diesem Gedicht so etwas wie eine Seelenbehandlung am Bett eines Kindes zu erblicken. Ich möchte jedem Kinde von seiten seiner Mutter eine so innige Seelennähe wünschen, wie sie in den schlichten Zeilen der über alles Banausentum erhabenen Verfasserin zum Ausdruck gelangt! Im übrigen pflegen Kinder den Begriff der Leichenschändung nicht zu kennen, Herr Professor (der Jurisprudenz?), wie denn auch die Träume Erwachsener nicht auf Konventionen Rücksicht nehmen!
Verweilen wir noch ein wenig beim Traum! Durch die Traumarbeit werden die verschiedenen Elemente der Traumgedanken, sobald sie unter sich Berührungspunkte bieten, zu neuen Einheiten verdichtet. Am greifbarsten wird die Verdichtungsarbeit, wenn sie Worte und Namen zu ihren Objekten gewählt hat. In ,Wasserschlaf‘, ,Grasgebet‘, ,Wasserlied‘ entdecken wir solche vom Traum hervorgebrachten Neubildungen wieder, was zeigen mag, um wie vieles näher dieses Schlafgedicht der psychischen Realität ist als jedes andere, dem sogenannten normalen Verstande angemessene. An dieser Stelle sei auch noch der markanten Formulierung ,schizophrenes Gestammle‘ gedacht. Der eben nicht liebenswürdige ,Kritiker‘, der sie prägte, ist hier in unvermutete Nähe der Wirklichkeit geraten, freilich ohne es zu wissen und in ganz anderem als dem beabsichtigten Sinne: Traum und Psychose (Schizophrenie) weisen eine Fülle psychologischer Gemeinsamkeiten auf; im Traum werden wir gleichsam alle schizophren. Insbesondere ist hier der eigenartigen, dem philosophischen Denken wie der primitivsten Symbolik gleichermaßen zugrunde liegenden Beziehung zu gedenken, die zwischen bewußter sekundärer Wortvorstellung und der korrespondierenden, oft komplementären, unbewußten primären Sachvorstellung besteht. Diese Beziehung ist gemeint, wenn die Verfasserin sagt, vom Wort zu jenem Ding, das es bedeutet, ist ein weiter Weg.
Noch manches, was der Reflexion wert wäre, steht, nein, schillert und oszilliert zwischen den Zeilen, die für sich aufgeschlossen nennende Leser so schwer zu begreifen sind, daß sie sich verdummt vorkommen! Wenn nach einer Definition von Szczesny ein Gedicht zum Gedicht wird, nicht durch „das Talent seines Autors, ausgefallene Vokabeln, dunkle Gleichnisse und Bruchstücke von Aphorismen rhythmisch aneinander zu reihen, sondern durch seine Fähigkeit, mit Worten etwas einzukreisen, was in den Worten selbst nicht enthalten ist“, dann ist „eia wasser regnet schlaf“ ein vollendetes Gedicht…
Unter dem Titel „Vom Nutzen und Nachteil der Tabus“ schrieb Karl Korn Anmerkungen zu einer Diskussion. Ausschlag gab ein damals berühmt gewordenes Interview mit dem Basler Philosophen Karl Jaspers, in dem dieser sich freimütig zur ,Einheit Deutschlands‘ geäußert hatte. Der Vorgang des Interviews und dessen Resonanz hatte ein überaus diffiziles psychologisches Problem angerührt. Offenbar hatte Jaspers ein Tabu verletzt. Das Tabu hieß: ,Wiedervereinigung‘. Tabu ist, was als unberührbar, unverletzlich, undiskutierbar gültig und verbindlich gilt.
Karl Korn verweist in diesem Zusammenhang auf magnum, die intellektuell und ästhetisch ehrgeizige Zeitschrift, die in Bild und Schrift das Thema ,Tabu‘ behandelte.
Einige Spalten weiter heißt es:
Man verstehe uns nicht so, als wollten wir das Verdienst, das magnum sich erworben hat, schmälern. Was Tabus positiv und negativ bedeuten, dies zu erfahren hat auch diese Zeitung nicht selten Gelegenheit. Man mag die erregten Debatten um das Gedicht „eia wasser regnet schlaf“ beurteilen, wie man will, auch hier war ein Tabu angerührt. Es ist auffällig, mit welcher Gereiztheit auch nach der Selbstdarstellung eine Mehrheit sich gegen den Einbruch des Unterschwelligen, chaotisch Dunklen, Triebhaften, Alogischen, des Märchenschauders, des Motivs der Wasserleiche wehrt…
Karl Korn endet unter anderem mit den Überlegungen:
… Wir Lebenden stehen noch immer mitten zwischen Tradition und Aufklärung. Manche Tabus sind Tradition und werden weiterbestehen, weil die Triebnatur des Menschen eine gewisse Konstanz hat…
Ulrich Greiner endet seine Interpretation am 31.12.1999 mit folgender Überlegung:
… Letzten Endes hat es seine Vorteile, daß wir nun sehr bald im Jahr 2000 leben und nicht mehr in den furchtsamen, furchtbaren fünfziger Jahren. Damals hatte man Angst vor der Blechtrommel und sogar Angst vor einem Gedicht wie diesem. Natürlich sind wir auch heute nicht gegen alle Gespenster gefeit, aber doch gegen manche. Womöglich haben uns die Dichter dabei geholfen.
(…)
Lichtwelten. Abgedunkelte Räume
ist der Titel der Frankfurter Poetikvorlesungen, die Elisabeth Borchers im Sommersemester 2003 gehalten hat. In fünf Schritten, ausgehend vom „Haus der Kindheit“, an das sich die Dichterin erinnert, über die durchaus rhetorische, aber doch ernstgemeinte Frage „Wozu Gedichte?“, über Anmerkungen zum Beruf des Übersetzers bis hin zum Erlebnis der Lektüre von Gedichten von u.a. Nelly Sachs, Else Lasker-Schüler, Hertha Kräftner und Christine Lavant, spricht Elisabeth Borchers über Literatur, literarisches Leben und ihren ganz persönlichen Umgang, ihre Erfahrung mit Büchern. Der Poetin, die zugleich Lektorin war und viele der bedeutendsten Autoren unserer Tage zu ihren Freunden zählt, ist hier ein wunderbar zu lesendes, anregendes Buch gelungen, ein „Nachdenken über Literatur“. Elisabeth Borchers, geboren 1926, lebt in Frankfurt am Main. Für ihre Lyrik erhielt sie u.a. die Roswitha-Gedenkmedaille der Stadt Bad Gandersheim sowie den Friedrich-Hölderlin-Preis. Zuletzt erschien im Suhrkamp Verlag ihr Gedichtband Eine Geschichte auf Erden (2002).
Suhrkamp Verlag, Klappentext, 2003
„Lichtwelten“
– Elisabeth Borchers’ Poetikvorlesungen. –
Die Aufregung lässt sich heute kaum mehr vorstellen. 1960 erschien in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ein Gedicht, das mit diesen Versen begann:
eia wasser regnet schlaf
eia wasser schwimmt ins gras
wer zum wasser geht wird schlaf
wer zum abend kommt wird gras
Es hagelte empörte Leserbriefe, weit über hundert waren es am Ende, und während Wochen wurde in literarisch interessierten Kreisen aufgeregt debattiert. Durfte man so etwas schreiben?
Elisabeth Borchers, von ihr stammt das Gedicht, erwähnt dies in ihren Frankfurter Poetikvorlesungen, die nun unter dem Titel Lichtwelten. Abgedunkelte Räume vorliegen. Das Gedicht und die Aufregung, die es auslöste, sind in die Geschichte der deutschen Literatur nach 1945 eingegangen, und sie stehen am Anfang eines umfangreichen und beeindruckenden Werkes. Elisabeth Borchers, geboren 1926, hat Gedichte geschrieben, Erzählungen, Kinderbücher, Hörspiele, sie hat zahlreiche Anthologien kompiliert und vieles übersetzt, dies alles neben einem grossen Pensum als Lektorin.
In ihren fünf Frankfurter Vorlesungen, die sie im Sommer 2003 gehalten hat, geht es in erster Linie um Gedichte und dabei auch immer wieder um Anfänge. Um ihre Anfänge als Autorin und um das, was allem Schreiben vorausgeht, um Kindheitserinnerungen etwa, um die scharfen und unscharfen Bilder jener Tage. Und um die Scheu, diese endgültig gerinnen zu lassen. Am Beispiel einzelner Gedichte zeigt die Autorin, wie deren „Einzugsgebiete“ aussehen: Was hat alles dazu beigetragen, dass dieses Gedicht entstehen konnte, was ist alles hineingeflossen? Es gibt für das Schreiben von Gedichten, darauf weist Elisabeth Borchers sanft und beharrlich hin, kein theoretisches Kleingeld, keine Faustregeln. Jedes Gedicht ist ein Wagnis. Selbst dann, wenn zuweilen ein Gedicht vor allem darum geschrieben wird, weil darin eine bestimmte Zeile, ein bestimmtes Wort unterkommen soll.
Über literarische Werke ist vor allem dann sehr viel zu erfahren, wenn sie in eine andere Sprache übersetzt werden. Hier greift Borchers auf ihre Erfahrungen als Lektorin zurück und zeigt an konkreten Beispielen, wie riskant die Arbeit des Übersetzens stets bleibt. Dabei bleibt sie vorsichtig und genau, so genau, wie die Arbeit der Übersetzer auch aussehen soll.
Ihren Blick auf die eigene Arbeit beendet Elisabeth Borchers mit einer anrührenden und kundigen Hommage an drei Lyrikerinnen, die ein schweres Los zu tragen hatten und dabei auch schrieben: Christine Lavant, Nelly Sachs und Hertha Kräftner. Freundlicher, unaufdringlicher lassen sich deren Werke kaum vermitteln, als dies hier geschieht, von einer Dichterin unter Dichterinnen.
Martin Zingg, Neue Zürcher Zeitung, 24.7.2004
Fakten und Vermutungen zur Autorin + DAS&D + KLG + Archiv +
Internet Archive + Kalliope
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
deutsche FOTOTHEK
Nachrufe auf Elisabeth Borchers: Park ✝ FAZ ✝ Welt


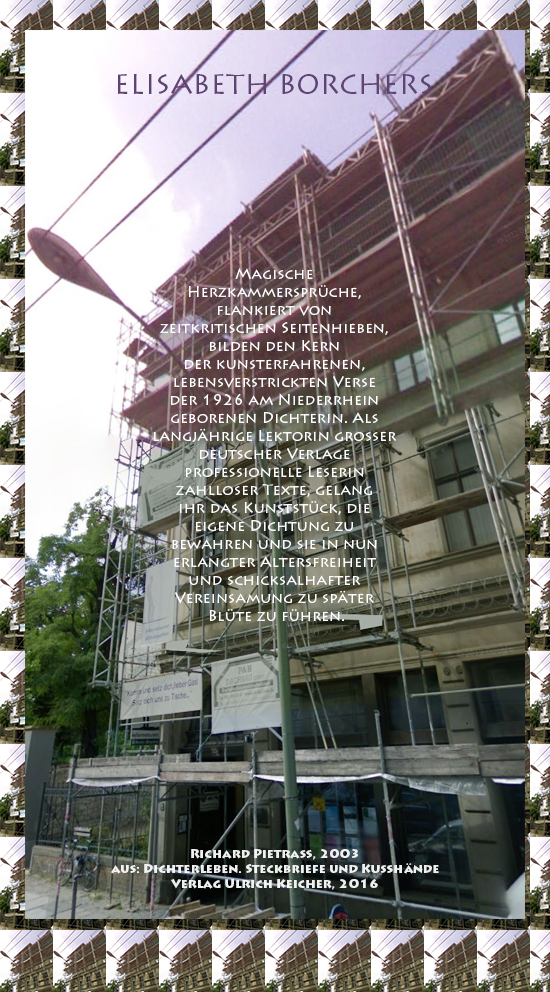












Schreibe einen Kommentar