Elisabeth Borchers: Was ist die Antwort
HEIMAT – EINE LEUCHTSCHRIFT
Eine jener Schriften deren wir bedürfen
Wo denn nun wo
Zwischen Orion und Eos
460 pc im Nebel entfernt und verloren
Hier unten vielleicht
wo die Knochen verwehn
oder ruhn
Zwischen dem einen schon vergessenen Schmerz
und dem zukünftigen
Dem schrillen Ton nach Mitternacht
wenn sich der Traum unterbricht
Heimat ist wo wir waren
oder sein werden ist nicht Krieg
wo der Knopf an der Jacke nicht fehlt
wo die Suppe noch warm ist
Heimat ist ein kurzer Satz
ein langer Satz ein Vers
ein Wort ein Amen
Was wiederholt geschehen ist
Lang, lang vorbei sind die Zeiten, in denen ein märchenhaft-surreales Gedicht einen Sturm in den Leserbrief-Spalten erregen konnte. Das war 1960. „eia wasser regnet schlaf“ begann dieses Gedicht und stammte von Elisabeth Borchers, die damals Mitte dreißig war. Es war eine Provokation – Provokation durch eine fremde Lautlosigkeit. Die Dichterin ist ihr treu geblieben all die Jahre. Nur daß die surrealen Volten nach und nach aus ihren Gedichten verschwanden und anderen, wirklichkeitsnäheren Erfahrungen Platz machten.
„Ein Gedicht ist nicht diktierbar. Es setzt nicht Kenntnisse voraus, sondern Erfahrung“, lautet ein entscheidender Satz in der schönen Selbstinterpretation, die als Zugabe den neuen Gedichtband Was ist die Antwort abschließt. Was aber sind die Erfahrungen dieser vierzig neuen Gedichte? Und gibt es eine Antwort auf die Titelfrage des Buches? Es sind Erfahrungen eines Lebens, das nicht ohne langen und intimen Umgang mit Kunst und Poesie zu denken ist. Elisabeth Borchers verleugnet das nicht in ihren Gedichten, und das ist gut so.
Sie schreibt Verse zum Tag von Wolfgang Koeppens Beerdigung, schreibt über ihre Lektüre des Koreaners Ko Un, über den virtuos reimenden Poeten K., in dem wir unseren hochgeschätzten Karl Krolow wiedererkennen. Sie macht das Gedicht eines anderen Kollegen im Nach-Schreiben zu einem eigenen, was schon der Titel anzeigt: „Am 10. Oktober 1997 las Tadeusz Rózewicz in Schiltigheim das Gedicht ,Alte Frauen‘“. Solche Aneignung ist nicht bloß Hommage, sondern Selbst-Vergewisserung, Selbst-Rettung. Auf der Höhe der Kunst gilt alles gleich, braucht es keinen besonderen Anlaß. Noch eine lustlos absolvierte „Ferienlektüre“ – ein Roman und „ein bißchen Hotelrechnung“ – transzendiert die Situation, und die lesende Poetin liest in alldem „das bald zu schreibende Gedicht“.
Dieses eigene Gedicht, das seinem Text gewissermaßen immer voraus ist, zielt weder auf Weltsynthesen, noch bleibt es im Verhau der Alltagstrivialität hängen. Es kann auf einen Vorrat an Wissen und Erfahrung zurückgreifen und sagen:
Alles kehrt wieder
und ist schon zu Ende.
Das ist Weisheit, nicht Philosophie. Und wenn die Eule der Minerva wieder erscheint, ist das keine bloße Hegel-Reminiszenz, sondern Bild gewordene historische Erfahrung:
Als die Eule
zur Welt geflogen kam
sah sie die Schrecken.
Von diesen Schrecken ist gar nicht besonders oft die Rede. Die Dichterin setzt einen Leser voraus, dem die Andeutung und ein bitteres Etcetera alles sagt:
Wende den Blick ab
von den Feuern zwischen
den Schneehügeln in Bosnien etc.
Das ist Sodom
Wir sind gegen das Schlimmste gefeit.
Sie weiß, daß fünf poetische Zeilen dieses „Schlimmste“ nicht aus der Welt schaffen.
„Ich habe Gedichte gelesen, / die reimten sich wunderbar“, sagt Elisabeth Borchers einmal bewundernd und leise bezweifelnd. Sie selbst verzichtet zumeist auf den Reim. Wo sie ihn dennoch verwendet, ja gelegentlich häuft, pointiert er eigentlich nur das Desperate der Bilanz:
Welche Böen werden kommen
unter vielen auch die frommen
und auch dieses wird genommen.
Umso erstaunlicher aber, daß es in diesen neuen Gedichten eine Bastion gibt, die unbezweifelt vorausgesetzt und angerufen wird. Sie erscheint in der Wiederkehr der Wörter „heilig“ und das „Heilige“. Die Dichterin setzt diesen starken Akzent gleich beim zweiten Gedicht, in einer Evokation der Provence und der Zuwendung zu einer Freundin. „Heiliger Januar“ heißt das Gedicht, das eine Apotheose der Heiligen Sainte-Victoire und der Heiligen Rhône ist und noch den Tod in diese Heiligsprechung hineinnimmt:
Orkus in den wir hinabschauen
Heiliges Hinab.
Diese Apotheose ist nicht bloß religiös zu begreifen. Sie hat durchaus etwas mit der orphischen Preisung der Welt zu tun, mit dem Werk des Dichtens und der Sprache; denn auch die Buchstaben werden dringlich angerufen:
und bitte die Heiligen Buchstaben,
mein Leben zu verlängern
und wie schön ist der dankbare lebensfreudige Zusatz:
Was wiederholt geschehen ist.
Was ist die Antwort lautet der Titel des schmalen und gehaltvollen Bandes. Er wirkt wie hingesagt, und sein emphatisches Understatement ist wie eine eigentümlich trostvolle Bilanz. Wer die Gedichte der Elisabeth Borchers liest, begreift, daß die Verlängerung des Lebens durch Lektüre kein Paradox ist, sondern Erfahrung: „Was wiederholt geschehen ist.“
Harald Hartung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2.7.1998
Zurückgelassene Blicke
– Elisabeth Borchers’ Poetik des Abschiednehmens. –
In Hölderlins „Rheinhymne“ heißt es:
Wie du anfingst, wirst du bleiben,
So viel auch wirket die Not
Und die Zucht, das meiste nämlich
Vermag die Geburt.
Und der Lichtstrahl, der
Dem Neugeborenen begegnet.
Elisabeth Borchers ist an einem Fluß geboren, im Eismonat Februar, unterm Sternbild der Fische, sie hat ihre Kindheit am Rhein verbracht, sie hat ihr Leben lang an Flüssen gewohnt. Und sie lebt auch heute noch in einer Stadt am Strom. Wasser weitet die Städte, ist wie ein zweiter Himmel, das Steinerne und Feste wird in die Mitte genommen vom Flüssigen und Luftigen, bekommt etwas Leichtes und Schwebendes. Und etwas Träumerisches auch.
Ihr Geburtsort ist Homberg am Niederrhein, linkes Ufer, 29 m über dem Meeresspiegel, ehemals Rheinpreußen, gegenüber von Ruhrort gelegen, mit dem es durch eine 626m lange Brücke verbunden ist. Hier ist der Rhein über 600m breit. 1926, in ihrem Geburtsjahr, hatte Homberg 27.000 Einwohner. Die meisten arbeiteten in der Industrie. Die Stadt besaß ein Steinkohlenwerk, eine Eisengießerei, eine Farben-, eine Maschinen- und eine Posamentenfabrik, außerdem Mühlenwerke und Reedereien. Und einen Hafen. Tag für Tag zogen tutende Dampfer mit oft sechs, manchmal sogar noch mehr Lastkähnen im Schlepptau rheinauf- und rheinabwärts. Mitten drin die Fischerboote, die Segeljollen und die weißen Ausflugsschiffe mit ihrem schwarzen Rauchgekräusel über dem Schornstein. Wer, wie Elisabeth Borchers, die ersten zwölf Lebensjahre in einer solchen Wasserstadt, an einem so mächtigen Fluß verbracht hat, dem hat sich dies alles gewiß in die Seele eingraviert. Auch wenn vieles längst vergessen ist. Das Vergessen ist eine Voraussetzung für die Erinnerung. Weil es den Augenblick, der einmal war, wie einem Gefäß verschließt und aufbewahrt. Der Zufall des Lebens läßt uns die Aufbewahrungsstelle nach Jahrzehnten wiederfinden. Was wir Erinnerung nennen, ist das plötzliche Wiedererkennen jener verschollenen Wirklichkeit und das unvermutete Wiederauferstehen unseres damaligen Ichs. Der Mensch ist süchtig nach Vergessen und Erinnern, sagt Elisabeth Borchers.
So wundert es denn auch nicht, daß sie eines Tages am Ufer des Mississippi stand. Was sie dort sah, erzählt ein Gedicht und erzählt es doch nicht.
EINES TAGES
Eines Tages stand ich am Ufer des Mississippi.
(Keine Erzählung.)
Das Hochwasser führte in dem ihm eigenen beschleunigten Fließen
mit sich 1 gedunsene Kuh 1 gedunsenes Schwein
1 gedunsenen Baum 1 gedunsenen Strauch.
Nicht aber den Dampfer mit Rad.
Als ich mich unbeobachtet sah
tauchte ich eine Hand in das Kadaverwasser
meiner Kindheit.
Das ist keine Erzählung.
Das ist der Augenblick.
Vielleicht stand Elisabeth schon als junges Mädchen – die Eltern waren Lehrer, sie deren einziges Kind – in Gedanken an den Ufern des Mississippi und wartete wie jeder Mark-Twain-Leser auf das Einlaufen des Raddampfers. Vielleicht sahen schon Tom Sawyer oder Huck Finn im Hochwasser Kühe treiben und all das andere, was das Gedicht aufzählt. Doch für Mark Twain war der ankommende Dampfer das Wunder, der Dampfer mit dem großen Rad, der nie verblassende Traum aller, die jung sind. Aber im Gedicht von Elisabeth Borchers zeigt sich kein Dampfer, das Ersehnte bleibt aus. Die Verse wurden in den neunziger Jahren geschrieben, nach einer Lesereise durch die USA, und stehen in dem 1998 erschienenen Band Was ist die Antwort. Der Blick auf den Fluß führt zurück in die Kinderjahre. In dem Essay „Das Haus der Kindheit“ notiert sie:
Jeder, der schreibt, kehrt zurück, gibt seinem Herkunftsland einen Namen, bevölkert es mit Menschen und Tieren, mit Landschaften und Jahreszeiten und Zahlen, malt diese Gemälde aus, wiederbelebt sie, verschönt sie, will sich Gutes tun und jenen, die dazu gehörten, obwohl doch der Blick zurück ein klarer, ein erbarmungsloser ist.
Doch das Gedicht hält sich nicht daran: Es verschönt nicht, will nichts Gutes tun. Nur dem Schlußteil des Satzes wird entsprochen: Der Blick zurück ist ohne Erbarmen. „Kadaverwasser der Kindheit“ – eine Metapher, keine Erzählung, doch ein schmerzlicher Augenblick der Aufrichtigkeit, eine aus der Erfahrung der Bitternis kommende Bosheit des Moments, ein Seitenhieb auf dir romantische Lüge der Erinnerung. Aufschlußreich, wie Elisabeth Borchers die Stelle kommentiert:
Wie so oft, damals, im Kindheitsland, habe ich mich verhalten wie die Helden und Heldinnen im Struwwelpeter. Ich reiße die Decke vom Tisch, ich prügele den Hund, daß er mich beißt, ich spiele mit dem Feuer, das nicht zu löschen ist, ich nehme den Sturm zu Hilfe, um von mir fortzufliegen, doch nichts geschah. Darum ist Kindheit nicht erzählbar.
Aber sie in Bildern vergegenwärtigen, das vermag man, und je älter man wird, scheint es, desto besser. Hans-Georg Gadamer, der Philosoph, der 102 Jahre alt wurde, hat gesagt, im Alter wache die Kindheit auf. Genauer noch unterrichtet uns Musil:
Gewöhnlich altern die Erinnerungen zugleich mit den Menschen und die leidenschaftlichsten Vorgänge werden mit der Zeit perspektivisch-komisch, als ob man sie am Ende von neunundneunzig hintereinander geöffneten Türen sähe. Aber manchmal, wenn sie mit sehr starken Gefühlen verknüpft waren, altern einzelne Erinnerungen nicht und halten ganze Schichten des Wesens bei sich fest.
Elisabeth Borchers’ 2002 veröffentlichter Band Eine Geschichte auf Erden enthält mehrere Gedichte über ihre Kindheit, darunter auch eines mit einem gehörigen Schuß Sarkasmus.
DIE REQUISITEN MEINER KINDHEIT
Vater, Mutter
und Ida, die Büglerin
und Sascha, der Hund
mein jährlicher Tannenbaum
mein Engelsflaum.
Gebetet habe ich
daß alles gut werde.
Auch für die Eidechsen im Sommer
daß sie erwachsen werden
und ihren Eltern Freude bereiten
auf der steinernen Treppe
hinauf und immer höher hinauf.
Was außer dem Druck einer ehrgeizigen Erziehung und einer durch die elterliche Übermacht gefesselten Kinderwelt sichtbar wird an Elisabeth Borchers’ Rückschau, das sind glühendes Schönheitsbegehren und ein frühes Gefühl für Vergänglichkeit.
Nicht, daß beides nicht korrespondieren könnte. Das eine, das Bewundern von Schönheit, hat das geschwisterlose Mädchen zuerst in der Welt der Märchen erfahren, das andere, Zeit und Vergänglichkeit, zuerst vor der Standuhr in Großvaters Bibliothekszimmer. Sie schreibt:
Die Schneekönigin war es, die mir erschien und mir zeigte, wie überwältigend Schönheit sein kann, diamantenreich wie Himmelslichter, ein nicht enden wollendes Glitzern vor dem Hintergrund des Sternenraums.
Und von der Standuhr heißt es:
Großvater verriet mir, daß eine Uhr erzählen könne, wenn das Pendel ausschlug und ein zitternder Ton zu hören war. Als sei die Uhr im Begriff, ihre Standfestigkeit zu verlieren. Ich bat ihn, mir zu sagen, was sie denn zu erzählen wisse. Zum Beispiel von der Zeit, sagte er, die Uhr sei die Trägerin der Zeit, und wenn sie sie nicht weitertrage, bleibe die Welt stehn. Wie denn das möglich sei. Nun, sie zähle nicht nur Stunden, auch die Wolken und Sterne über dem Haus, die Dächer der Stadt, die Knöpfe an Großmutters schwarzem, langen Rock, die Federn der Vögel im Garten und das Brennen der Schmerzen im Bein. Die Uhr sei eine große Rechnerin, nur eines verstünde sie nicht: die Ewigkeit auszurechnen, obwohl ihn diese ganz besonders interessiere. Die Ewigkeit sei schließlich der Ort, an dem wir uns alle wiedersehen werden. Ob denn die Ferien schon vorbei seien, fragte ich erschrocken. Und die Uhr setzte zum Schlag an.
Wo immer die Vergänglichkeit auftritt, sagt Elisabeth Borchers, ist sie ein nicht zu tilgende Makel. Doch könnte man nicht ebenso – und mit philosophischen Gründen – sagen, nur was vergänglich ist, ist schön? Alles Schöne ist endlich, radikal endlich. Darum machen schönheitsselige Menschen auch in radikaler Weise die Erfahrung der Vergänglichkeit. Jede Berührung, jedes Leuchten der Helligkeit steht im Zeichen von Abschied und Verlust.
Besonders in ihrem Alterswerk zeigt sich, niemand in der deutschen Gegenwartslyrik ist von dem Gefühl für die allem Schönen anhaftende flüchtige und gefährdete Vollkommenheit so durchdrungen wie Elisabeth Borchers. Daher ihr Impuls, den Dingen immer wieder Glanz zu geben. Ein Gedicht, das ich besonders liebe, zelebriert diese Kunst.
DIE EREIGNISSE EINES EREIGNISLOSEN TAGES AUF LA COLLINA
Die Lautlosigkeit der Ameisen über den heißen Stein
Das Zucken der Eidechse über die Hecke
Die diagonale Spur des Schiffs über den See
Die Verschwiegenheit der Berge
Die Stille der Bäume und lärmenden Vögel
Das Gold der Häuser von Bellagio
Die Ferne des nahen Gewölks
Das tragische Ende des Menschen
Das besetzte Telefon
Die Metastase im Gehirn
Der Sturz der Elster aus der Zeder
Die stillste Stille bevor Baum und Strauch explodieren
Die Leichtigkeit der Rosenblätter zwischen „Winterbild“ und „Zweiter Geburt“
Der Abendhauch
Die Treulosigkeit
Die Frage: Was fang ich nur an
Die vor dem Ertrinken errettete Hummel
Zwei badende Vögel
Das Spiegelbild
Die ermüdeten Augen
Goethe, der Dieb
Die Fledermaus früh um halb vier
Die Fliege, die übers Geländer läuft
Das Aufsteigen des weißen Rauchs
Das Fliegen des weißen Rauchs über den See
Die Müdigkeit der Augen im Abendwind
Die Glockenschläge von jenseits des Sees
Die langsame Uhr, die zu schnell tickt
Das langsame Herz, das zu schnell schlägt
Brechreiz
Das Gespräch mit der erschrockenen Amsel
„Der Augenblick ist das Prinzip der Tätigkeit (jedoch nicht ihre Ursache)“
Mein unaussprechliches Seufzen
Wie das Abendlicht die Felsen krönt
Celans Gedicht nach Paris
Das Jagen des Windes über den See
Das Eindringen der Glocken vom Gebirg herunter
Antonia Sanchez aus Mexiko
Das Zittern der Palmblätter
Das Fehlen des Ginkgo
Der Spatz, der seine Pfütze sucht
Die Winterreise im Sommer
Die schwellenden Fahnen im Abendkleid
Das Ende des dritten Tages
Der baldige Beginn des vierten.
Bei allen kummervollen Ahnungen, was für eine Preisung, welche Fülle von Gegenwart, was für ein Glanz von Gleichzeitigkeit! Und alles in einfachen Worten. Jeder Blick eine visuelle Liebkosung. Doch der Sand des Stundenglases rinnt von Anfang an. Das Gedicht als ein Vorgefühl der Trennung, als eine Geste des Lebewohl. Jeder Vers bald ein zurückgelassener Blick. „Ich lernte Abschied – eine Wissenschaft, ich lernte sie nachts“, heißt es bei Ossip Mandelstam. Das Wehmutsvolle macht die Schönheit aus, der leise Stich, der uns sagt, daß wir das Leben lieben und es doch einmal hergeben müssen.
Abschiednehmen ist nicht nur ein Thema des Alters. Aber im Alter erlangt es einen entschiedenen, endgültigen Charakter. Daß Dinge zu Ende gehen, ereilt die Menschen auf allen Lebensstufen. Schon ein Kind durchlebt Abschiede, zuletzt den von der Kindheit. Und stets ist es ein Abschiednehmen von anderen und von einem selbst.
La Collina ist der Name einer Villa in Cadenabbia am Comer See. Hier hat Adenauer in seiner Zeit als Kanzler viele Jahre den Sommerurlaub verbracht. Das Haus gehört heute der Konrad-Adenauer-Stiftung, und jedes Jahr im Spätsommer trifft sich hier auf Einladung der Stiftung eine Gruppe von Autoren zum mehrtägigen Werkstattgespräch. Auf einem dieser Treffen lernte ich Elisabeth Borchers kennen. Was mir an ihrem stolzen und schweigsamen Wesen als erstes auffiel, war die prüfende Art des Zuhörens und Hinsehens. Von scharfem Urteil und leicht spöttisch gegenüber dem Reden der Menschen, achtsam, hingebungsvoll und dankbar gegen alles, was Natur und Landschaft ist. Das Landschaftliche ist es ja, was diesen Ort so auszeichnet und was uns damals in seiner verschwenderischen Pracht auch unmittelbar umgab. Denn der eigentliche Schatz des Hauses ist der Park und seine Aussicht. Wie tief Elisabeth Borchers mit ihm im Zwiegespräch stand, zeigt das La Collina-Gedicht.
Auch ich habe zwei glückliche Stunden in diesem Park erlebt. Es war an einem sonnigen Septembermorgen kurz vor der Abreise. Die anderen waren schon am Vorabend aufgebrochen. So war ich ganz für mich und ging ohne Absicht und Ziel über die hellen, sich sanft durch das Anwesen schlängelnden Kieswege. Um mich herum blaue und rosa Hortensien, roter und weißer Oleander, blühende Glyzinien, Zedern, Pinien und Kastanien, Feigenbäume und Eiben, Rhododendron und Buchsbaum. Und auf einmal kam mir alles wie ein Wunder vor, die Stille, der Frieden der Natur, die aus den Baumkronen heruntersegelnden Blätter, die huschenden Geckos, die durchs Gebüsch jagenden Amseln, die immergrünen Säulen der Zypressen, der sich an einer alten Zeder emporrankende Efeu, die Krähe, die auf der Pergola balancierte, das Tack-Tack der auf die Steintreppe fallenden Haselnüsse, die Olivenbäume am Hang, ihr seidiges Grün, ihre luftigen Schatten. Die Ausblicke auf den See, die vollkommen ebene Oberfläche, bald spiegelglatt, nur vom Kielwasser der Schiffe gefurcht, bald aufgerauht von einer Windböe. Am Ufer gegenüber die majestätischen Berge, als wären sie vor Urzeiten beiseite getreten, um dem tiefen, dunklen See Durchlauf zu gewähren.
Ich möchte meinen, ich habe das alles mit den Augen von Elisabeth Borchers gesehen. In den Tagen von Cadenabbia sah ich sie oft auf den See blicken. Wenn ich es mir vorstelle, kehre ich in Gedanken zurück an den Anfang, zum Rhein, zu den Flüssen, und dann weiß ich, warum das Wasser in ihren Gedichten beschworen wird. Manchmal frage ich mich, warum sie so oft Meere und Seen besingt und so selten Flüsse. Oder darf man Carl Zuckmayer – aus Nackenheim am Rhein – etwa nicht glauben, der erklärt hat:
An einem Strom geboren zu werden, im Bannkreis eines großen Flusses aufzuwachsen, ist ein besonderes Geschenk?
Vielleicht denkt Elisabeth Borchers dasselbe wie Czesław Miłosz’ Hauptfigur im „Tal der Issa“: daß man nicht darstellen soll, was man liebt. Denn was man liebt, muß ein vollkommenes Geheimnis bleiben.
Oder sind Flußläufe unheimlich, allzu unheimlich? In „eia wasser regnet schlaf“ von 1960, einem Gedicht, das sie mit einem Schlag bekannt gemacht hat, lautet die zweite Strophe:
was sollen wir mit dem ertrunkenen matrosen tun?
wir ziehen ihm die stiefel aus
wir ziehen ihm die weste aus
und legen ihn ins gras
aaaaamein kind im fluß ist’s dunkel
aaaaamein kind im fluß ist’s naß
was sollen wir mit dem ertrunkenen matrosen tun?
aaaaawir ziehen ihm das wasser an
aaaaawir ziehen ihm den abend an
aaaaaund tragen ihn zurück
aaaaamein kind du mußt nicht weinen
aaaaamein kind das ist nur schlaf
was sollen wir mit dem ertrunkenen matrosen tun?
aaaaawir singen ihm das wasserlied
aaaaawir sprechen ihm das grasgebet
aaaaadann will er gern zurück
Flüsse können unheimlich sein. Gedankenströme auch.
Aber vielleicht gibt es noch andere Gründe, Abstand zu halten. Fließendes Wasser bewegt zum Erzählen, wovor das Gedicht sich hüten muß. Und es verleitet zum Warten, zum melancholischen Erleiden von Zeit. Horizontaler Zeit. Verrinnender Zeit. Stromabwärts ins Vergessen, stromaufwärts ins Vorbei. Lethe und Chronos, nicht Kairos. Der Philosoph Gaston Bachelard hat gesagt, Prosa ist dahinströmende, Poesie ist angehaltene Zeit. Ziel der Poesie ist der ewig währende Augenblick. Die Vertikalität.
Elisabeth Borchers ist die Dichterin des vertikalen Augenblicks. Wenn das leuchtende, wenn das düstere Licht hervorbricht und aufglänzt. Ihre Sprache ist undramatisch, sparsam, nüchtern fast, den einfachen Worten vertrauend. Simplex sigillum veris. Das Einfache ist das Siegel des Wahren.
Ich schließe mit dem Gedicht „Wie klein und verständlich sind meine Wörter“ – vielleicht doch einer Liebeserklärung an die potamische Seite der Poesie.
WIE KLEIN UND VERSTÄNDLICH SIND MEINE WÖRTER
sie liegen in den Armen deutscher Flüsse
und Flüßchen
werden dunkel bei Regen und hell
wie Assmannshausen wenn die Sonne darauf scheint.
Und die napoleonischen Pappeln reichen sich die Hände.
Ein Versprechen, das dir gilt.
Sebastian Kleinschmidt, neue deutsche literatur, Heft 550, Juli/August 2003
Fakten und Vermutungen zur Autorin + DAS&D + KLG + Archiv +
Internet Archive + Kalliope
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
deutsche FOTOTHEK
Nachrufe auf Elisabeth Borchers: Park ✝ FAZ ✝ Welt


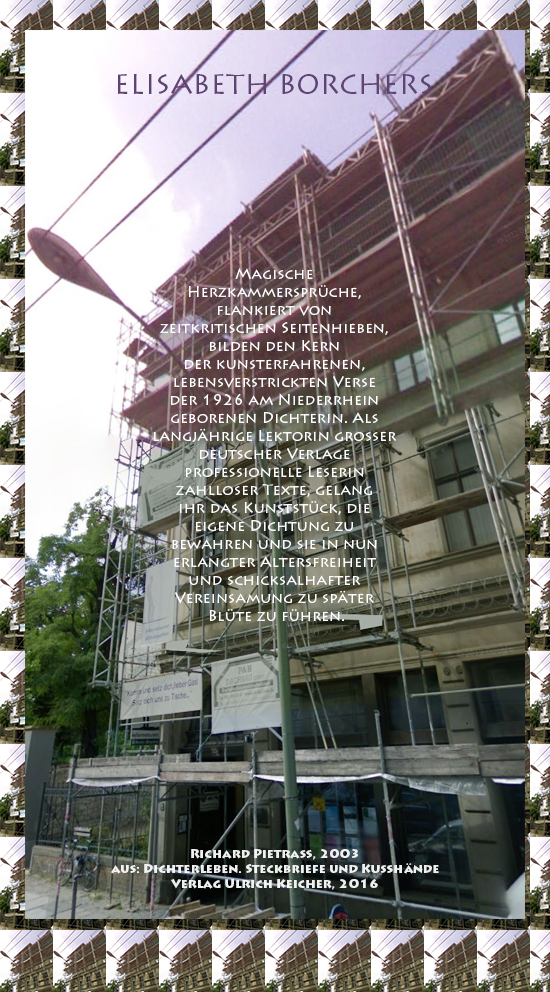












Schreibe einen Kommentar