Ernst Jandl: der künstliche baum
what you can do without vowels
kss
fck
lck
sck
pss
sht
Ernst Jandl war stolz darauf,
als sein Buch der künstliche baum 1970 als Originalausgabe im Taschenbuch erschien – und er wurde Zeuge einer Entwicklung, die ihn noch mehr erfreute: „Band 9 der Sammlung Luchterhand der künstliche baum war binnen weniger Monate mein weitaus erfolgreichstes Buch. Nun stand für nicht wenige fest, ich sei ein konkreter Poet, ein Ruf, der mir schmeichelte, von dem ich mich aber alsbald zu befreien trachtete.“ Über dreißig Jahre nach seinem ersten Erscheinen ist dieses Buch zu beidem geworden: zu einem Klassiker moderner, experimentierfreudiger Poesie und zu einem Klassiker der Poesie überhaupt.
Luchterhand Literaturverlag, Klappentext, 1997
Freud an der Freud mit Ernstens Widerhaken
Im ersten Moment „liest“ man viele von Jandls Gedichten nicht, sondern man schaut sie erst einmal an und ist fasziniert von seiner virtuosen Freud am Spiel mit dem, was sich alles mit der Sprache anstellen lässt: Der titelgebende „künstliche baum“ etwa trägt wortwörtlich Früchte, das „wettrennen“ ist der Wort gewordene „Erster“-Ruf, und witziger als Jandls „séance“ kann man bierernste Spiritistenséancen nicht veräppeln.
Das allein wäre schon mehr als ein Grund, Jandls Gedichte zu lieben, aber sein Spiel mit dem Wort macht immer irgendwo Ernst mit dem Wort: „eine fahne für österreich“ genauso wie der wortgewordene Un-Sinn im „signal“, oder erst das unschuldig-fiese „alphabet einer macht, mit 3 unbekannten“. Jandl nimmt das Wort wörtlich; oft genug lautet die Maxime „Ein Wort — ein Gedicht“. Oder auch „zwei (bzw. drei/vier/…) Wörter — ein Gedicht“: „fliegen“ hebt ab, „immer starrer“ erstarrt buchstäblich, ein konsequentes „ich“ streicht sich aus, und „moral“ hat was Geheimnisvolles an sich, erinnert zugleich an einen Komposthaufen und konterkariert am Ende das gleichseitige Dreieck.
der künstliche baum, erstmals 1970 erschienen, reizt die verborgenen Talente der Sprache aus: „visuelle Gedichte“, die man nur verstehen kann durch genaues Gucken, leiten den Band ein. Aber es kommt noch viel mehr:
„lautgedichte“ muss man sich laut vorstellen, wenn man keinen Jandl im O-Ton (z.B. Eile mit Feile. CD oder him hanflang war das wort: Sprechgedichte) zur Hand hat. Die Mühe lohnt sich, egal ob behelfsweiser Eigenbau oder Rauskramen der CD.
Sodann die „lese- und sprechgedichte“, darunter so Klassiker wie „ottos mops“, oder das etwas andere Sittenbild „aus den 30er jahren“ mit langem Nachhall des Lesers inclusive, oder „familienfoto“… Oder „kinderreim“, dieses Kronjuwel bodenloser Gemeinheit. Oder „fünfter sein“, oder „essen. ein stück mit aufblick“, in denen Jandl banalste Alltagsszene in höchste lyrische Höhen hebt. Oder das „doppelgedicht“, oder das „lied mit begleitung“, die sich so herrlich kreuz und quer lesen lassen und jedesmal Blößen des Alltags aufdecken… Oder das „sonett“, eine geniale Reduktion aufs Wesentliche bar jedes Sinnes. Oder die Entdeckung neuer Sinnzusammenhänge beim Wörtersezieren und beim Ausreizen der Druckerkunst: „(werbetext)“, „hosi“, „voyeur“, „der englische botschafter“. Oder „karwoche. ein turm“, aufgebaut aus sprachgewaltigen Assoziationen.
Oderoderoder. Undundund. Neben den genannten Sparten sind im künstlichen baum auch noch die längeren „lesetext“ („villgratener texte“) und „sprechtext“ („teufelsfalle“) enthalten.
Aber egal wie lang oder kurz: Hier feiern Unsinn und Tiefsinn Hochzeit. Und jedesmal versteckt Jandl in scheinbar bloßer Freud an der Freud mit dem Wortspiel Widerhaken: Jedes Gedicht ein Pfeil, geschossen ins Schwärzeste alles Schwarzen.
weiser111, amazon.de, 6.11.2008
Weiterer Beitrag zu diesem Buch:
Alexandra Pontzen: Poesie und Ernst des Alters
literaturkritik.de, Februar 2002
Gespräch mit Ernst Jandl
Marianne Konzag: Herr Jandl, Sie waren 28 Jahre lang, von 1950 bis 1978, Gymnasiallehrer. Ihr erster Lyrikband Andere Augen erschien 1956. Hat Ihnen der Lehrerberuf so viel Freude gemacht, oder gab es andere Gründe, ihn neben der Schriftstellerei auszuüben?
Ernst Jandl: Auch wenn ich schon sehr früh Schriftsteller werden wollte, so hielt ich es doch für unerläßlich, einen Beruf auszuüben, der mir erlaubte, als Künstler frei zu sein, also nicht mit meiner literarischen Arbeit meinen Lebensunterhalt verdienen zu müssen. Mein Interesse für deutsche Literatur legte den Lehrerberuf nahe. Es gibt viele Schriftsteller, die neben ihrer kreativen Tätigkeit unterrichten. Der Beruf erlaubt gewisse Spielraume, zeitlich zum einen wie auch die Eigenart des Berufs: die Begegnung mit Kindern, die Arbeit mit jungen Leuten. Wenn man Literatur- und Sprachlehrer ist, kann das für die Arbeit mit Sprache, wie sie ein Schriftsteller und vor allem ein Lyriker betreibt, hilfreich sein.
Konzag: Wann begannen Sie zu schreiben, wie war die gesellschaftliche Situation Ihres Landes zu dieser Zeit?
Jandl: Der Entschluß zu schreiben, verbunden mit dem Entschluß, Lehrer zu werden, reicht wirklich schon in meine Kindheit zurück. Meine Mutter begann in den letzten Jahren ihres Lebens – sie war sehr krank damals –, Gedichte und kurze Prosa zu schreiben und auch zu veröffentlichen. Ich war neun oder zehn Jahre alt und Literatur bezauberte mich. Nun, im eigenen Heim mitzuerleben, wie Gedichte entstehen, wie sie im Kreise der Familie vorgelesen, diskutiert werden, das war für mich ein ganz großes Erlebnis. Natürlich verfolgte ich die Sache während meiner ganzen Oberschulzeit und auch in der Zeit meines Studiums an der Universität, stellte aber eine wirklich ernste Beschäftigung damit zurück, um mein Studium möglichst intensiv betreiben zu können, um es auch in einer angemessenen Zeit zu beenden. Das war notwendig. Man muß sich vorstellen, ich begann 1946 Deutsch und Englisch zu studieren, in einer Zeit, da alle Kriegsjahrgänge zurückkehrten, auch in die Universitäten. Und selbst die größten Hörsäle waren übervoll, und sehr viele wollten Lehrer werden. Ich legte die Prüfung bereits nach drei Jahren ab, 1949, ging sofort an die Schule, machte mein Probejahr, beendete zur gleichen Zeit mein Doktorat – also Dissertation und die entsprechenden Prüfungen – und begann erst etwa 1951 intensiv mit dem Schreiben von Gedichten. Die ersten Publikationen in Zeitschriften erfolgten 1952, dann kamen bald Anthologien hinzu und schließlich 1956 der erste eigene Gedichtband: Andere Augen im Bergland Verlag Wien in der Reihe Neue Dichtung aus Österreich. Das Buch enthält Gedichte, von denen ich eine ganze Reihe in einem späteren Gedichtband aufnahm als eigene Abteilung „Andere Augen“. Und einige baue ich noch heute in meine Lesungen ein, verschiedene sind auch in dem Band Augenspiel, Verlag Volk und Welt, Berlin 1981, enthalten. Das Gedicht „Zeichen“ (1953) z.B., ich halte es für ein programmatisches Gedicht, es hat für mich immer noch Gültigkeit. Und die Diskussionen zeigen, das Publikum nimmt es auch heute noch an:
zerbrochen sind die harmonischen krüge,
die teller mit dem griechengesicht,
die vergoldeten köpfe der klassiker –
aber der ton und das wasser drehen sich weiter
in den hütten der töpfer.
Damals wie heute ist dieses Gedicht die Absage an ein klassizistisches Kunstideal, das ich als nicht zeitgemäß empfand. Im Gegensatz dazu schrieb ich Gedichte in der Alltagssprache, Gedichte, die für mich eine bestimmte Verwandtschaft besaßen mit Texten etwa von Jacques Prévert oder Carl Sandburg, auch an Bertolt Brecht erinnerten, dessen Hauspostille mich damals gerade unerhört faszinierte. Ich halte ihn heute noch für den wahrscheinlich größten deutschsprachigen Dichter dieses Jahrhunderts.
Konzag: Eine lange Pause liegt zwischen ihrem Debüt 1956 und den darauffolgenden Bänden. Erst 1964 erschienen lange Gedichte und klare gerührt, konkrete Poesie. Wie ist diese Zeit des Schweigens zu verstehen?
Jandl: Das war kein freiwilliges Schweigen, und auch diese beiden Titel waren schmale Bändchen ohne viel Resonanz. Das erste große Buch nach Andere Augen war 1966 Laut und Luise im Walter Verlag, Olten, Schweiz. Seit 1956 hatte sich bei mir ein radikaler Stilwechsel vollzogen. Ich knüpfte jetzt bei Autoren an, die mir zwar schon lange bekannt gewesen waren, zu denen ich aber bisher kein produktives Verhältnis hatte. Eine versunkene, verschollene, verschüttete Tradition begann ich mit eigenen Mitteln weiterzuführen. Ergebnisse dieser Arbeit sind in Sprechblasen (1968) und Laut und Luise enthalten. Diese Gedichte schockierten die für die Literatur maßgeblichen Leute in Österreich. Sie meinten, an Expressionismus oder Dadaismus, an die Literaturrevolution zu Beginn unseres Jahrhunderts anzuknüpfen sei unmöglich. August Stramm, Hans Arp, Hugo Ball seien überholt, abgetan. Ich aber wußte nicht und wüßte auch heute nicht: überholt durch was? Abgerissene Traditionell sind oftmals gewaltsam abgebrochene Traditionen. Wir wissen, der Nationalsozialismus zerschlug Kunst, zertrümmerte vieles, behinderte neue Entwicklungen. Diese Traditionen waren in Bibliotheken, in Büchern verwahrt. Sie mußten aufgenommen werden, sollte es eine neue Dichtung des 20. Jahrhunderts geben. Und darum bemühte sich in Österreich eine ganze Reihe von Dichtern, etwa die Wiener Gruppe, Hans Carl Artmann, Gerhard Rühm, Konrad Bayer, Friedrich Achleitner, Oswald Wiener sowie Friederike Mayröcker, ich. Wir wollten die wohl wirklichkeitsnahe, aber die Traditionen des 20. Jahrhunderts mißachtende Nachkriegslyrik einen Schritt weiter bringen. Themen, die der Krieg geweckt hatte, konnte man dabei durchaus weiterführen, doch mit anderen Mitteln. Ich möchte zwei Beispiele nennen, zwei Gedichte aus Laut und Luise. Diese Art hatte damals in Österreich keine Chance. Und auch in der Bundesrepublik Deutschland wurden diese Gedichte nur in ganz kleinen Zeitschriften von jungen ambitionierten Leuten veröffentlicht.
FALAMALEIKUM
falamaleikum
falamaleitum
falnamaleutum
fallnamalsooovielleutum
wennabereinmalderkrieglanggenugausist
sindallewiederda
oderfehlteiner ?
Und ein zweites Gedicht, ebenfalls ein Antikriegsgedicht, das von einem deutschen Wort ausgeht, dem die Vokale entzogen sind. Nur das Konsonantische, das Geräuschartige bleibt übrig. Es ist ein „lautmalendes“ Gedicht, mit Mitteln der Stimme wird versucht, Geräusche der Schlacht wiederzugeben, Stimmgeräusche, die den fürchterlichen Widersinn eines Krieges hörbar machen sollen.
SCHTZNGRMM
schtzngrmm
t-t-t-t
t-t-t-t
grrrmmmmm
t-t-t-t
s—–c—–h
tzngrmm
tzngrmm
tzngrmm
grrrmmmmm
schtzn
schtzn
t-t-t-t
t-t-t-t
schtzngrmm
schtzngrmm
tsssssssssssssss
grrt
grrrrrt
grrrrrrrrrt
scht
scht
t-t-t-t-t-t-t -t-t-t
scht
tzngrmm
tzngrmm
t-t-t-t-t-t-t-t-t-t
scht
scht
scht
scht
scht
grrrrrrrrrrrrrrrrrrr
t-tt
Das Wort, das dem Gedicht zugrundeliegt, ist wohl erkennbar: Schützengraben. Es bekommt Dialektfärbung, da das ben von graben verschliffen wird, wie wir es in Österreich tun, zu grmm, hier also Dialekt, ohne daß es ein Dialektgedicht wäre, und nur an einer Stelle klingt ein Wort an, nämlich am Schluß, wo die Lautfolge t-tt deutlich das Wort „tot“ suggeriert.
Konzag: Wir finden in allen Ihren Büchern Gedichte, die sich mit dem Krieg auseinandersetzen. Als der Krieg ausbrach, waren Sie 14 Jahre alt. Erinnern Sie sich noch daran, an Ihre Gefühle und Gedanken?
Jandl: Da war zunächst einmal die Rechnung: Wie alt bin ich, wie lange kann dieser Krieg dauern? Sie wissen, daß die deutsche Führung nach dem Polenfeldzug mit dem Wort „Blitz-Krieg“ prahlte. Es sah nun so aus, als könne man diesen Krieg innerhalb kurzer Zeit beenden. Je länger der Krieg aber dauerte, um so unsicherer wurde ein Heranwachsender meines Jahrgangs, des Jahrgangs 1925, welche Rolle ihm selber in diesem grausamen Spiel zugeteilt war. In den letzten Jahren des Gymnasiums bestand kein Zweifel mehr, daß man in diese Sache hineingezogen würde. Ich hatte das Glück, in einer Schulklasse zu sein, von 1938 bis zum Abitur 1943, die sich nicht zu einer nationalsozialistischen Einstellung verführen ließ. Es war kaum jemand von uns bei der Hitlerjugend, es gab, jedenfalls hier in Wien, verschiedene Auswege. Entweder man hielt sich ganz im Hintergrund, oder man ging zum Deutschen Roten Kreuz. Meine Klassenkameraden waren vom Verlauf des Krieges genauso entsetzt wie ich. Entsetzt von der Herrschaft des Nationalsozialismus und begierig auf die Zeit, die danach kommen würde. Wie sie aussehen würde, das wußte natürlich keiner. Aber gewisse Bilder, Vorstellungen aus den zwanziger Jahren spiegelten uns eine verheißungsvolle Zeit.
Konzag: Einige Worte zur Wiener Gruppe. Sie gehörten ihr nicht direkt an, aber Sie sympathisierten mit ihr?
Jandl: Friederike Mayröcker und ich waren mit H.C. Artmann und Gerhard Rühm befreundet, damals zweifellos die führenden Köpfe der Gruppe. Wir tauschten unsere Arbeiten aus, lasen einander unsere Arbeiten vor und traten so in einen sehr fruchtbaren Wettstreit. Daß Mayröcker und ich nicht zur Wiener Gruppe gehörten, hängt mit der Art der literarischen Produktion zusammen. Die Wiener Gruppe, aus fünf Mitgliedern bestehend, erarbeitete ihre Texte gemeinsam. In verschiedenen Zusammensetzungen stellten Mitglieder der Gruppe Gedichte, Theaterstücke und andere Texte her. Artmann, Bayer und Rühm beispielsweise arbeiten ein Gedicht aus. Diese Zusammenarbeit, belegt in dem ziemlich umfangreichen Band Die Wiener Gruppe, definiert und grenzt die Gruppe ab und beschränkt sie auf diese fünf Autoren. Sie gaben, glaube ich, der österreichischen Gegenwartsliteratur und darüber hinaus der deutschsprachigen Literatur wichtige Impulse.
Konzag: Literaturwissenschaftler und Literaturkritiker rechnen Sie zu dem, was der Einfachheit halber mit experimenteller Poesie bezeichnet wird. Was sagen Sie zu diesem Ruf, Sie seien ein experimenteller oder konkreter Lyriker?
Jandl: Konkrete Lyrik ist eine einengende Etikettierung, obwohl zweifellos bestimmte Gedichte von mir konkrete Poesie sein können. Experimentelle Lyrik – das ist ein sehr dehnbarer Begriff, deshalb verwende ich ihn auch gern. Freunde von mir, etwa Gerhard Rühm, waren immer skeptisch gegenüber diesem Begriff, und ich muß natürlich sagen, ein Gedicht oder ein anderer literarischer Text kann als ein Experimentieren mit Sprache beginnen, aber er muß über diese Phase des Experimentierens hinausgehen. Nur das gelungene Experiment, das ein vollständiges Gebilde ist, kann vom Autor akzeptiert und an das Publikum weitergegeben werden.
Konzag: Umgang mit Sprache ist wichtig für Sie, das fühlt jeder Leser Ihrer Gedichte. Was haben Sie vor mit der Sprache: Revolution, Reform, Revolte?
Jandl: Über das Schreiben von Gedichten hinaus: Schärfung des Sprachbewußtseins, Erweiterung des Sprachhorizonts und eine gewisse – und das wäre schon das höchste Ziel, das ich mir stecken kann – Immunisierung des Lesers gegen Sprachmißbrauch, vor allem auf politischem Gebiet.
Konzag: „Ich schreibe verschiedene Arten von Gedichten, ich will auf viele Wege aufmerksam machen“, haben Sie einmal geäußert. Welche Arten, welche Wege?
Jandl: Zuerst einmal das Gedicht in Alltagssprache, zum Beispiel:
vater komm erzähl vom krieg
vater komm erzähl wiest eingrückt bist
vater komm erzähl wiest gschossen hast
vater komm erzähl wiest verwundt wordn bist
vater komm erzähl wiest gfallen bist
vater komm erzähl vom krieg
Und nun ein Gedicht, in dem die Sprache verändert wird mit einem bestimmten Zweck, eine Szene aus dem Jahr 1938. In diesem Gedicht, könnte man sagen, wird der Sprache so Gewalt angetan, wie dem österreichischen Volk durch den „Anschluß“ an das „Großdeutsche Reich“ und durch den Hitlerkrieg Gewalt angetan wurde. Die Sprache, die ich hier verwende, soll eine Großkundgebung im Frühjahr 1938 im Gedicht wiedererstehen lassen.
WIEN : HELDENPLATZ
der glanze heldenplatz zirka
versaggerte in maschenhaftem männchenmeere
drunter auch frauen die ans maskelknie
zu heften heftig sich versuchten, hoffensdick
und brüllzten wesentlich.
verwegener stirnscheitelunterschwang
nach nöten nördlich, kechelte
mit zu-nummern der aufs bluten feilzer stimme
hinsensend sämmertliche eigenwäscher.
pirsch!
döppelte der gottelbock von Sa – Atz zu Sa – Atz
mit hünig sprenkem stimmstummel.
balzerig würmelte es im männechensee
und den weibern ward so pfingstig ums heil
zumahn : wenn ein knie-ender sie hirschelte.
Konzag: Würden Sie Ihre Gedichte als politische Gedichte bezeichnen?
Jandl: Viele meiner Gedichte sind schon rein äußerlich politische Gedichte. Das Thema weist sie unverstellt als solche aus. In anderen Gedichten benutze, verändere ich Sprache so, daß meines Erachtens eine politische Wirkung entsteht.
Konzag: Sie haben einmal gesagt:
Was ich will, sind Gedichte, die nicht kalt lassen.
Aus welcher Zeit stammt dieses Bekenntnis und in welchem Zusammenhang ist es zu sehen?
Jandl: Dieser Satz, heute für mich so gültig wie damals, stammt aus dem kurzen Text „Selbstporträt 1966“. Ich war von einer Zeitschrift aufgefordert worden, ein ganz kurzes Selbstporträt zu schreiben, und das endete mit dem Satz:
Was ich will, sind Gedichte, die nicht kalt lassen.
Konzag: Wie reagieren Sie – und wie reagieren die Kollegen Ihres Landes – heute bei brennenden politischen Fragen, bei der Frage Krieg – Frieden?
Jandl: Der aktuellen Frage Krieg – Frieden wird man mit Lyrik kaum beikommen können. Gedichte können bestenfalls den Friedenskampf unterstützen. Der Dichter wird selten auf Tagesereignisse mit einem Gedicht antworten. Es gibt andere Möglichkeiten einer politischen Stellungnahme, auch von Schriftstellern, zu brennenden Ereignissen.
Konzag: Ein Dichter, der wie Sie mit der Sprache experimentiert, wird von den Kritikern nicht verschont. Es gibt viel Lob und Anerkennung für Ernst Jandl, es gibt aber auch Ablehnung, Bezeichnungen wie „Sprachpuzzler“, „lyrischer Wortklauber“, „poetischer Ausdrucks-Chemiker“. Wie reagieren Sie auf derartige Angriffe, nehmen Sie sie zur Kenntnis?
Jandl: Dagegen hin ich abgehärtet, das läßt mich kalt.
Konzag: Manchmal wird Ihnen auch vorgeworfen, der Leser müsse sich bei der Lektüre plagen, dem Geheimnis der Form auf die Schliche zu kommen.
Jandl: Ich benutze keine Schliche. Gedichte sind natürlich extreme Formen. Das Formale steht bei mir erst einmal im Vordergrund, wie bei dem Gedicht „Schützengraben“. Erst wenn Sie das Gedicht sprechen, tritt das Formale zurück und Sie haben etwas ganz anderes vor sich. Bei manchen Gedichten hat der Leser Schwierigkeiten, sich dieses Gedicht anzueignen, es verlangt das Sprechen des Textes. Das Medium Schallplatte…
Konzag: … das Sie ja auch nutzen…
Jandl: Natürlich, es gibt eine Reihe von Schallplatten von mir, und ich habe mich seit der Veröffentlichung von Laut und Luise sofort um eine Auswahl für die Platte bemüht. Ich wußte, das braucht der Leser.
Konzag: Für welches Publikum schreiben Sie?
Jandl: Eines meiner Bücher nannte ich Für alle.
Konzag: Mein Schreibtisch ist für alle gedeckt, was heißt für alle?
Jandl: „Mein Schreibtisch ist gedeckt für alle“, richtig. Für alle, die neuen Textgebilden nicht verschlossen gegenüberstehen, die offen sind für Neues, das allerdings von ihnen überprüft werden muß und überprüft werden soll.
Konzag: Eines Ihrer populärsten Gedichte, „ottos mops“, ist in verschiedene Schulbücher aufgenommen worden. Wie kam es dazu, gab es Reaktionen von Kindern?
Jandl: Das Gedicht wurde offenbar von Lehrern empfohlen, die mit ihm bereits Erfahrungen mit den Kindern gemacht hatten. Ich bekam und bekomme noch immer Zuschriften von Schulklassen, in denen mir beschrieben wird, wie sie mit dem Gedicht gearbeitet haben. Wie sie sich dieses Gedicht aneignen. Wie sie die Bauweise erkennen – das Gedicht läßt nämlich nur Wörter zu, in denen als einziger Vokal das o vorkommt. Kein a, kein e, kein i, kein u. Den Briefen beigefügt sind dann auch oft Gedichte der Schüler, die nach ähnlicher Bauweise entstanden, zum Beispiel mit Worten, die nur den Vokal a zulassen: das Gedicht „Hannas Gans“. Oder mit nur dem Vokal u, „Kurts Uhu“. Nur diese Reduktion hat den Erfolg möglich gemacht, das fühlen die Kinder ganz instinktiv, und es macht einfach Spaß, so ein Spiel und sein Ergebnis mitzuerleben.
Konzag: Kinder sollen lernen, mit der Sprache zu spielen?
Jandl: Ja. In Fächern wie Kunsterziehung, Zeichnen und Malen arbeiten die Kinder kreativ, sie arbeiten, singen und spielen kreativ im Musikunterricht. Ausgerechnet in der Literatur soll keine schöpferische Tätigkeit der Kinder, der Schüler möglich sein? Das habe ich nie eingesehen.
Konzag: Ende der siebziger Jahre schrieben Sie das Stück Aus der Fremde. Die Inszenierung erzielte viel Zustimmung. Einen der wichtigsten und aufregendsten Theatertexte dieser Jahre nannte man das Stück, das einen Tag im Leben eines Schriftstellers beschreibt. Hat dieses Lob Sie ermuntert, weiter Texte für das Theater zu verfassen?
Jandl: Ja, aber dieses Stück ist meines Erachtens, so sehe ich das jedenfalls zur Zeit, in einer nicht zu wiederholenden Form geschrieben. Es ist ein poetisches Stück, wenn man so will, in Dreizeilern angelegt. Es gibt keine erste und zweite Person, nur „Er“ und „Sie“. Wenn die Hauptperson von sich spricht, so sagt sie „Er“. Es wird im Konjunktiv geredet. Außerdem ist es eine Sprechoper, jedenfalls von mir so gedacht. Doch muß man hören, was ich mir unter „Sprechoper“ vorstelle, damit man einen Eindruck bekommt von der Künstlichkeit dieser Sprache und damit ihrer Möglichkeit, auf den Zuhörer zu wirken.
Konzag: In Ihrer Biographie ist nachzulesen, daß Ihr lyrischer Proviant zwischen 1938 und 1943, Sie gingen aufs Wiener Gymnasium, aus je drei Gedichten von Stramm, Wilhelm Klemm und Johannes R. Becher bestand. Mich interessiert die Wirkung von Becher auf den Schüler.
Jandl: Es war der junge Becher, der Expressionist, der mich in jener Zeit stark beeindruckte, ein Eindruck, der auch anhielt, als es Johannes R. Becher ebenso wie August Stramm in der offiziellen deutschen Literatur nicht geben durfte. Das waren die Jahre 1938 bis 1945. Ein Gedicht, Bechers „Lied“, beeindruckte mich am meisten, immer wieder habe ich es in jenen Jahren gelesen, mit Freunden diskutiert. Für mich ist es ein Beispiel einer überaus radikalen Sprachbehandlung bei äußerster Schönheit.
LIED
Stern ob Straßenbündel
weht dein Angesicht
Winde krumme münden
Schwarm der Häuser dicht.
Licht-Fontänen sprießen
Sonne tönt hier laut
Rieseln Flöten-Tiere
Mensch kreist hoch im Raum
Ausspann Wiesenhände!
Nacken Gletscher-Berg.
Lippen Hügel-Länder.
Aug so Wald-Traum wirkt…
Das war ein Bild unserer Sehnsucht in der Zeit des Nationalsozialismus und des Krieges, ein Bild für unsere Hoffnung auf eine Zeit des Friedens und der Freude.
Konzag: Einige Namen, Ernst Jandl, sind genannt. Gibt es weitere Ahnväter, Inspiratoren? Durch wen fühlten Sie sich herausgefordert, welchem Dichter oder Schriftsteller wären Sie gern begegnet, wem würden Sie gern begegnen?
Jandl: Gertrude Stein und James Joyce sind Vorbilder. Besonders von Gertrude Stein habe ich viel gelernt, und es gibt im Werk dieser großen und kühnen amerikanischen Dichterin noch vieles, das unentdeckt ist, und vieles, das auch in der Zukunft junge Dichter anregen kann. Weiter Christian Morgenstern mit seinen Galgenliedern, eine sehr frühe, literarische Erfahrung und auch eine wichtige. Die frühe Lektüre einiger Theaterstücke von Johann Nestroy prägte mich wohl auch.
Ich wäre gern Pablo Neruda begegnet, dessen Lyrik für mich zum Bedeutendsten zählt, das in diesem Jahrhundert geschrieben wurde. Und ich wäre überaus gern Bertolt Brecht begegnet.
Konzag: Nach Plänen zu fragen, habe ich kaum Mut, weil ich an Ihr Gedicht denke, „woran ich jetzt arbeite“…
Jandl:
woran ich jetzt arbeite .
daran arbeite ich jetzt
beantworte ich unausgesetzt
die frage eines jeden
ich beantworte unausgesetzt
die frage eines jeden
woran ich jetzt arbeite
daran arbeite ich jetzt
Konzag: Und das gilt heute noch?
Jandl: Ja, das gilt heute noch.
Aus Sinn und Form, Heft4, Juli/August 1985
Bildnisse von Dichtern – Ernst Jandl
Das muß man gesehen haben, wenn ihm die blauen Zornäderchen an der Schläfe anschwellen. Dann stammelt sein Mund, aus seiner Kehle kommt Staub und seine Augen verdrehen sich. Die, die ihn kennen, tun die Finger in die Ohren. Dann schreit er. Niemand schreit so wie er. Wenn wir einmal einen Krieg auszufechten haben werden, spannen wir ihn vor unsern Karren und er schreit uns eine Schneise in die Feinde hinein. Mit dieser Technik haben die Schweizer schon einmal die Österreicher besiegt, bei Sempach. Er spricht ein Englisch wie ein Berserker. Wie er wohl ißt, und was? Er donnert die Gabel, die er mit der Faust hält, in den Rehrücken und säbelt mit einem Tranchiermesser ellenbogenlange Stücke herunter. Er frißt sie rasend schnell. Man meint, jetzt platzt er, aber nein, er lacht plötzlich ganz laut. Wir sehen uns an, dann ihn, und jetzt lachen wir auch. Sein Gesicht glänzt, er sieht jetzt aus wie ein Mond, und wir denken, schade, daß er nicht unser Vater ist oder wenigstens unser Onkel. Dann setzen wir uns zusammen an einen Tisch und spielen eine Partie Schach. Ich ruckle an meinen Bauern herum, er aber kracht gleich mit seinen Türmen übers Brett, und daß er dabei ein paar Rösser verliert, ist ihm wurscht. Sowieso hupfen die so unvorhersehbar. Auch den König mag er eigentlich nicht. Ihm sind die Figuren am liebsten, die wie Kegelkugeln dahinfegen können, Ich schaue auf das Chaos, das er auf dem Brett angerichtet hat und denke, wie er wohl Schnippschnapp spielt, mein Lieblingsspiel, früher, vor jetzt dreiunddreißig Jahren.
Urs Widmer, Manuskripte, Heft 47/48, 1975
Wie man den Jandl trifft. Eine Begegnung mit Ernst Jandl, eine Erinnerung von Wolf Wondratschek.
Ernst Jandl im Gespräch mit Lisa Fritsch: Ein Weniges ein wenig anders machen.
Eine üble Vorstellung. Ernst Jandl über das harte Los des Lyrikers.
Fakten und Vermutungen zum Autor + ÖM + KLG + IMDb + PIA +
Archiv 1, 2 & 3 + Internet Archive + Kalliope +
Georg-Büchner-Preis 1 & 2 + weiteres 1 & 2
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Galerie Foto Gezett +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Ernst Jandl: Der Spiegel ✝ Süddeutsche Zeitung ✝
Die Welt ✝ Die Zeit ✝ der Freitag ✝ Der Standart ✝ Schreibheft ✝
graswurzelrevolution
Weitere Nachrufe:
André Bucher: „ich will nicht sein, so wie ihr mich wollt“
Neue Zürcher Zeitung, 13.6.2000
Martin Halter: Der Lyriker als Popstar
Badische Zeitung, 13.6.2000
Norbert Hummelt: Ein aufregend neuer Ton
Kölner Stadt-Anzeiger, 13.6.2000
Karl Riha: „ich werde hinter keinem her sein“
Frankfurter Rundschau, 13.6.2000
Thomas Steinfeld: Aus dem Vers in den Abgrund gepoltert
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 13.6.2000
Christian Seiler: Avantgarde, direkt in den Volksmund gelegt
Die Weltwoche, 15.6.2000
Klaus Nüchtern: Im Anfang war der Mund
Falter, Wien, 16.6.2000
Bettina Steiner: Him hanfang war das Wort
Die Presse, Wien, 24.6.2000
Jan Kuhlbrodt: Von der Anwesenheit
signaturen-magazin.de
Zum 70. Geburtstag des Autors:
Karl Riha: „als ich anderschdehn mange lanquidsch“
neue deutsche literatur, Heft 502, Juli/August 1995
Zum 90. Geburtstag des Autors:
Zum 20. Todestag des Autors:
Gedanken für den Tag: Cornelius Hell über Ernst Jandl
ORF, 3.6.2020
Markus Fischer: „werch ein illtum!“
Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien, 28.6.2020
Peter Wawerzinek parodiert Ernst Jandl.
Ernst Jandl − Das Öffnen und Schließen des Mundes – Frankfurter Poetikvorlesungen 1984/1985.
Ernst Jandl … entschuldigen sie wenn ich jandle.


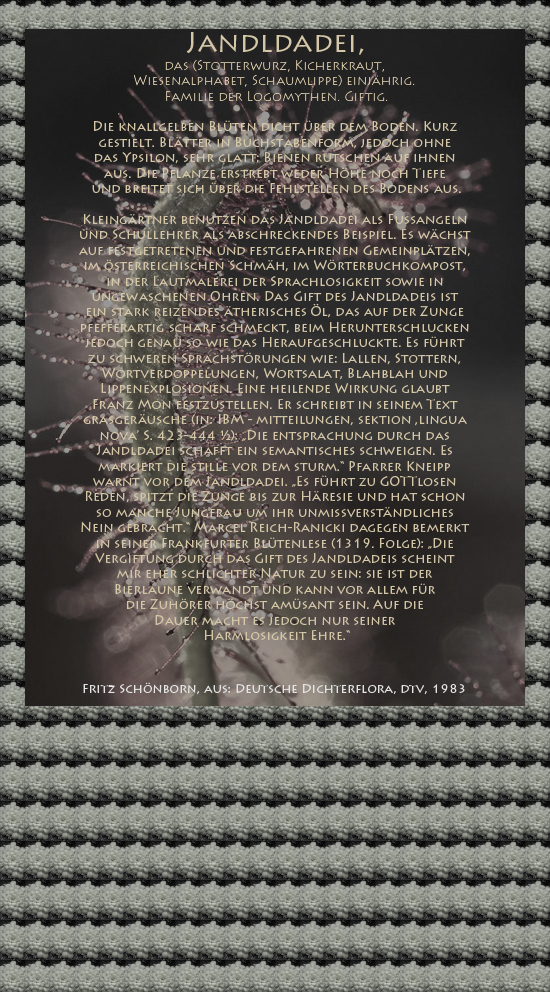












Schreibe einen Kommentar