Ernst Jandl: selbstporträt des schachspielers als trinkende uhr
SCHWEIZER ARMEEMESSER
warum so viele tage, wenn
so wenig ich erinnern kann
von ihnen allen. krachend schlagen
die türen zu, o du gnadenloser
sturm. meine sittiche
flattern schreiend um meinen kopf
und ich perforiere
mit meinem schweizer armeemesser
die blinde haut der vorfahren
die sich über meine zuckende
gestalt will wickeln,
daß meine augen doch
noch bleibe ein loch, um hinaus
aus dem schrecken zu gucken
in die ewige finsternis
An die großen Sprachgesten
vermag Ernst Jandl nicht zu glauben, genausowenig wie an geschlossene Bilder und Formen. Auch in seinen bislang letzten Gedichten, sie sind bis auf das Eingangsgedicht in den Jahren 1980–1983 entstanden, sieht er keinen Grund, von dieser Überzeugung abzuweichen. Und unverändert gilt, was er in der Sprechoper Aus der Fremde formulierte: „Leben und Hirn sollte man nicht kombinieren.“ Die „menschliche Dimension als Maßstab für die Welt (ist) ohne Gültigkeit.“ Dabei ist es nicht verwunderlich, daß ihn ein Thema jetzt stärker beschäftigt als in den früheren Gedichtbänden: das der ablaufenden Zeit.
Luchterhand Verlag, Klappentext, 1986
Böse Spiele
„Spielerisch“ steht auf den Rezensions Etiketts und, unvermeidlich, „experimentell“. Dann folgt der Vergleich mit dem frühen und mittleren Jandl (unter dem Gesichtspunkt: weniger spielerisch, spielerisch experimenteller, oder: jenseits des Experimentellen), der Hinweis auf Nestroy (Wien bleibt Wien), auf Stramm, auf Gertrude Stein. Und irgendwie stimmt das ja auch jedesmal; Jandl selbst hat inzwischen längst alles zugegeben. Und geständige Dichter sind den rezensierenden Germanisten immer noch die liebsten. Haarfein wird da unterschieden zwischen den experimentellen und nicht mehr experimentellen Arbeiten des Schriftstellers, und immer wieder und bis zur Selbstüberredung wiederholt, wie ernst die Jandlschen Spiele zu nehmen seien. Aber was wird hier eigentlich gespielt? Den neuen schmalen Gedichtband noch in der Frischhaltefolie schnell einmal umgedreht, steht da in des Autors eigener säuberlicher oberstudienrätlicher Handschrift folgendes zu lesen:
fang eine liebe amsel ein
nimm eine schere zart und fein
schneid ab der amsel beide bein
amsel darf immer fliegend sein
steigt höher auf und höher
bis ich sie nicht mehr sehe
und fast vor lust vergehe
das müßt ein wahrer vogel sein
dem niemals fiel das landen ein
Das „Spielerische“. Böse Spiele. Max und Moritz Spiele über Ottos Mops, der kotzt, konnte lachen, wer wollte – aber was, wenn das Erbrechen des guten Tieres nun ein erstes Symptom für Magenkrebs wäre? Gibt es etwas Komischeres als Qual, etwas Lustigeres als Verzweiflung? Sadisten sind Leute mit Sinn für Humor.
Ernst Jandls Spiele, das wird in seinem neuen Gedichtband offensichtlich, sind Spiele mit Qual und Tod, Spiele mit der Verzweiflung – Spiele aus Verzweiflung. In ihnen monologisiert die Wut über den „widerlichen lebenszweck“, der Haß auf die Spanne „zeit die die ewigkeit unterbrach“, der Wunsch „lieber gestorben als geboren sein“. Daß diese Verzweiflung keinen eigentlichen Gegenstand, keinen erkennbaren Gegner zu haben scheint, macht sie nur noch gespenstischer. Einen Schachcomputer hat sich der Autor gekauft; in der endlosen Symmetrie der schwarzen und weißen Felder versucht er des anonymen Gegners habhaft zu werden:
17 uhr
hinter ihm
laufe sein schach-computer
mit fünfzehn minuten
computing-time pro zug;
dann ertöne
das dünne stimmchen.
je viertelstunde also
er ans tischchen laufe
zur eingabe
binnen sekunden
seines eigenen zuges,
das glas
mit gin tonic
und dem mühlheimer stadtwappen
zur erinnerung an eine
große stunde
fülle er alle 25 minuten
und nehme daraus
alle 4 bis sieben
minuten
gerade einen schluck.
alle zwölf
bis 14 minuten
entzünde er
eine zigarette.
so errichte er
die background-struktur
für sein heutiges gedicht.
17 uhr 7
Ein selbstzerstörerisches Spiel, erinnernd an die Schachpartien indischer Potentaten, bei denen der Verlierer am Ende Gift zu schlucken hatte. Der Kampf wird zu einem Spiel auf Zeit, und die Geburtstagsgedichte, zum Beispiel für Heißenbüttel und Walter Höllerer, klingen bitter in diesem Kontext. Bitter auch die Erinnerungen an die Familie, Erinnerungen an Worte, deren Bedeutung verloren ging, an Verwandte, die er eigentlich gar nicht gekannt habe, an das Familiensofa:
verstreut zerhackt verbrannt:
kein einrichtungsgegenstand
wird noch bewahrt und verehrt
als von fernher gekommen
über das meer von zeit;
es hat uns alle verschlungen
Wenn beim Leser Assoziationen, Erinnerungen auftauchen, dann nicht an Arp und Schwitters sondern an Cioran, Canetti, Thomas Bernhard. Latent war die Gewißheit um die Krankheit zum Tode schon in den früheren Büchern Jandls vorhanden, nur wurde sie noch überdeckt, versteckt hinter grotesken Masken und Pointen. Spätestens aber in der Sprechoper Aus der Fremde kam sie offen zum Ausdruck, wenn auch selbst hier noch ins Aberwitzige changierend.
Die neuen Gedichte nun haben keine rettende Pointe mehr, sie brechen ab, mehr noch: sie brechen regelrecht in sich zusammen, bleiben mitten im Satz auf der Strecke. Merkwürdig: Ein seltsames Licht fällt von hier aus zurück auf die Lautgedichte und die Texte in Infinitivform. Als Experimente hatte man sie erkannt und klassifiziert, als Spiele lauthals nachgespielt – mit einem Mal scheinen sie verändert. Waren Jandls Spiele tatsächlich, wie von der Kritik nur allzu munter beklatscht, stets neue Ausdrucksmöglichkeiten, Ausflüge in unbekannte Sprachregionen – oder nicht auch manches Mal gefährliche Selbstexperimente, Selbstverstümmelungsversuche gar? Ein Gedicht wie „mit einer kanone“ jedenfalls hat in diesem Band jede experimentelle Unbefangenheit verloren.
mit einer kanone
in meinem mund
die schießt mich herunter
oder rund
je nachdem ob oben
oder eckig ich bin
An einen Expressionismus anderer Art erinnern diese Zeilen, an Trakls „Grodek“, an die Wege, die alle in schwarzer Verwesung münden:
nicht eine einzelne, viele
zerdrückt, es fände
der schlafend sieh rollende
jahrhundertmensch beim erwachen
sie auf dem abends noch weißen
linnen, und schwarz
von sich drängenden, hinab
an sich blickend, die arme
hände, die brust, den bauch
und auch was von beinen und
füßen aus dieser schräge er
sähe, dichtest besetzt, säßen
ihm nicht in undurchdringlichen
kugeln, ihr öffnen erwartend
zu hunderten über den
augen die fliegen
„Ekel“ und „Angst“ bezeichnen in der existenzialistischen Philosophie „Grenzerfahrungen“, in denen sich ein ohnmächtiger, sinnenlos gewordener Mensch noch als selbst erleben kann. In Jandls Gedichten (wie auch in den letzten Arbeiten Brinkmanns oder in Thomas Bernhards Erzählungen) scheint „Verzweiflung“ an diese Stelle getreten zu sein. Deshalb solch monomanisches Behagen an der eigenen Ausweglosigkeit, solch masochistische Lust an der Selbstzerstörung: nur hier, in der Erkenntnis des Schmerzes gibt es noch die Erfahrung von Leben.
Konsequent nähert sich Jandls Sprache den Sprechweisen der Sprachlosen, der Schizophrenen. Nicht mehr der Gedankenkonzentration dient die Sprache, sondern der Denkzersetzung, nicht mehr der Ich-Bewahrung, sondern der Ich-Spaltung. Das trennt Jandlhimmel (oder besser: höllen ) weit von all den wackeren Identitätspfadfindern, deren lyrische Produktion die Regale der Buchläden verstopft. Nein, hier spricht kein Selbst-Liebhaber sondern ein Selbst-Hasser, und selbst konzediert, daß Haß nur die allerunmöglichste Form der unmöglichsten menschlichen Tätigkeit, des Liebens, ist, so spürt der Leser doch bereits soviel Resignation in dieser Leidenschaft, daß der Tod die große Partie schon gewonnen zu haben scheint:
wenn vor sich hin
er ein wort stelle
und sei es auch
das gewöhnlichste
wort von allen
wie rasch habe
er es umgedreht
fliegend vermehrend
sein potential
an asche
Auch ich hatte Ernst Jandl als einen lustigen Vogel kennengelernt, als einen Taschenspieler, Sprachakrobaten, einen genialen Alchimisten auf der Suche nach der reinen Wortsubstanz. Ich hatte ihn als grotesk komischen Melancholiker in Erinnerung, der tagsüber Mützen bearbeitet und abends in Konjunktivform zu Bett geht. Diese Gedichte aber gehören zum Bittersten, Schwärzesten, das ich seit langem gelesen habe. Es ist nicht mehr die Sprache, mit der Ernst Jandl jongliert es ist die Verzweiflung selbst. Ich hatte mich auf dieses Buch gefreut; auf das nächste freue ich mich nicht mehr, ich fürchte es.
![]() Benedikt Erenz, Die Zeit, 14.10.1983
Benedikt Erenz, Die Zeit, 14.10.1983
Gedichte gegen den Schritt der Zeit
Im Zentrum von Ernst Jandls neuer Gedichtsammlung stehen zwei genau datierte „selbstporträts“ eines trinkfreudigen, etwas liederlichen Poeten. Sein Partner und Hausgenosse ist der Schach-Computer, dessen dünnes Stimmchen – Homunkulus im Karomuster – zum nächsten Zug mahnt. Seine Stimulantia sind Alkohol und Zigaretten. In beiden Texten ist, alles andere als euphorisch, von der mühseligen Herstellung von Gedichten die Rede. Von Zug zu Zug, von Schluck zu Schluck, sagt Jandl, errichte er „die backgroundstruktur / für sein heutiges gedicht. / 17 Uhr 7“.
Das Schachspiel ist ein Bild für die Möglichkeiten der konkreten Poesie, über die der Lautjongleur artistisch verfügt: die Bastardisierung von Wörtern, Silben-Kapriolen erzeugen Sprachwitz, Mutterwitz. Dennoch dominieren Trauer, Resignation, Verzweiflung den neuen Band. Das Sprachmaterial glänzt nicht mehr, und sich mit dem „Chess Champion Super System III“ zu messen, ist auch nicht gerade ein erfüllender Lebenszweck. Hat der spottgleißende Autor sich selber matt gesetzt?
Im „kommentar“ heißt es, daß ihm sein Leben viel zu sehr „als dreck erscheine“, und das Selbstporträt vom 18. Juli schließt mit dem Zynismus: „ (er wäre ein genie / gewesen, hätte er / sich selbst ver- / hüten können.)“ Die Klammer nimmt der Aussage wenig von ihrer Säure. In den elf Dreizeilern „morgen erinnern“ finden wir die poetologische Introduktion, die Gedichte hätten sich zu verändern begonnen. Auch hier ist vom Tod die Rede, der Autor tröstet sich lediglich damit, daß er sich – den Kerl – bestimmt nicht daliegen sehen müsse.
In dieser Bitternis ist das Todesgedenken eine neue Dimension in Ernst Jandls Gedichten. Das Sprachspiel wird zum Schachspiel gegen sich selbst, gegen die Zeit („je viertelstunde also / er ans tischchen laufe“) und damit gegen den Tod. Das Ende der Schmach ist abzusehen, die abgelebten Jahre haben nur die Ewigkeit unterbrochen, die Unendlichkeit vor und nach der Existenz.
Im Beerdigungsgedicht will er den Hinterbliebenen nicht zum Leichenzug folgen: „ich gab euch, was ich hatte – mehr ist nicht da.“ Es bleibt das Wort „zügenglöckchen“ für Totengeläute, das ihm sein Vater überliefert hat. Es gehört zu den Spieldosen-Wörtern, die, wenn man sie umdreht, fliegend ihr „potential / an asche“ vermehren. Zu diesem Umkreis zählen auch die Widmungs- und Geburtstagsgedichte, die allesamt in einem In-memoriam-Ton gehalten sind, weil Altersschwellen in besonderem Maße an das Danach erinnern. Und das heißt bei Jandl: an das Nichts, das uns schrill verhöhnt. Nur eine Hoffnung bleibt: „gegen den schritt der uhr“, sagt er zu Helmut Heißenbüttel, bist du immun, weil dein Werk Bestand hat.
In diesem memento mori äußert sich ein barockes Lebensgefühl, das durchaus zu den formalen Errungenschaften der konkreten Poesie paßt. Zwar gibt es im neuen Band keine skripturale Graphik, keine Piktogramme mehr. Aber das Permutationsgedicht „my own song“, das Vexierbild „dieses gedicht ist ungedruckt…“, die infantilisierte Alltagssprache und die Gegenüberstellung von englischer und deutscher Version erinnern an Jandls These, daß der sprachliche Fehler zum Kunstmittel gemacht werden müsse angesichts der Fehlerhaftigkeit des menschlichen Lebens. Und der Tod ist ja der existentielle Kunstfehler schlechthin. Was leistet die Übersetzung? In Laut und Luise hat Jandl die Fremd-Sprache noch verulkt: „nach brasilien / wulld ich laik du go.“ Hier genügt die bloße Konfrontation der deutschen mit der englischen Version, um auf die in der Linguistik so genannte „Beliebigkeit“ der Zeichen hinzuweisen. Konkrete Poesie will ja ursprünglich nichts anderen sein als sprachbildhafte Oberfläche, inszenierte Typographie. Auch hier wieder die Parallele zum Schachspiel: man verschiebt ein Wort, ein Laut, und schon ist die semantische Konstellation eine ganz andere. Zum Beispiel: „allah-heiligen“. Der Sprachspieler als „trinkende uhr“ registriert das „präzise vergehen“ seiner Jahre. Das heißt im doppelten Sinn: das Ablaufen der Zeit und ihr Verbrechen am Menschen. Wenn sich die Erlebnisse auf Schokolade, Whisky und Schach-Computer reduzieren, manifestiert sich im Wunsch, nach dem Strick zu greifen, eine massive Altersdepression. Dagegen ist Poesie, der „widerliche lebenszweck“, ein dürftiges Heilmittel, selbst wenn man mit der Sprache, wie Jandl in einem Interview sagt, alles anfangen kann, was man will. Er präzisiert auch: „was die sprache mit sich anfangen läßt.“
Tatsächlich ist Literatur immer ein Kompromiß zwischen dem, was der Schriftsteller will, und seinem handwerklichen Können. Der neue Gedichtband Jandls ist formal nicht so verspielt wie die tagebuchartige Sammlung der gelbe hund von 1980, dafür menschlich und thematisch reicher, gerade indem er den Leser die Brüchigkeit aller „versuche über die ewigkeit“ deutlicher spüren läßt als bisher.
Hermann Burger, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 8.10.1983
Ich will ich sein
Als einzigem Autor unter den experimentellen Lyrikern ist es Ernst Jandl gelungen, seine Gedichte populär zu machen. Seine Spracharbeit war nie eine bloß intellektuelle, sondern stets sinnlich und lustvoll. Er bahnte im wuchernden Umfeld der Leseliteratur dem Hörgedicht den Weg. Jandl bürstet Redensarten gegen den Strich. Er zeigt das Mißverhältnis der von den Leuten gebrauchten Worte zur Wirklichkeit. Das berühmte Hölderlin-Wort „Was aber bleibet, stiften die Dichter“ darf man abwandeln: Was Sprache versteckt, aufdeckt es Jandl. In seiner Wortkomik steckte immer schon Trauer, in diesem Band wird sie abgründig. Den Dürstenden stillt nicht mehr der Quell. Der Fliegende verläßt verstümmelt den Boden. Der Versemacher umkreist sein Porträt, indem er es auszulöschen beginnt. Er entzieht den Mitmenschen sein „Bildnis“:
ich will nicht sein wie ihr seid
so wie ihr mich wollt
ich will nicht sein wie ihr sein wollt
so wie ihr mich wollt
…
ich will ich sein
nicht wie ihr mich wollt will ich sein
ich will sein.
Setzte Jandl in seinen früheren Gedichtbänden das sprachliche Schmerzmesser vorab gegen die Ansprüche, die Lüge, den Schein der Bürger, so richtet er das Schmerzmesser in den neuen Gedichten unerbittlich gegen das eigene Ich. Er stilisiert sich als einen von Pfeilen durchbohrten unheiligen Sankt Sebastian. Die Altersflecken auf den Händen redet er als Wundmale Christi an, auf die er spuckt. Da fragt einer, was bleibt in der Veränderung zum Tode. Was bleibt vom Gedichteschreiben, „wenn kein Wort mehr glänzt“? Was bleibt, wenn er Schach spielen muß „mit dem Schach-Computer“? Jandl destruiert den Sonnenschein zu „Sonnenschwein“. Er sieht am Baum nur noch den Ast zum Aufhängen. Er widerruft die Heilkraft der Kunst: „ich habe auch geglaubt / die kunst ist gut.“ – Mir scheinen das alles Schmerzensschreie zu sein. Der Mann am Kreuz, – nicht der einsame Schachspieler vor einem Computer – Totenkopf, ist in Wirklichkeit der innere Bezugspunkt dieser Schmerz-Gedichte: der Todesgalgen als ungewollter „Aufstieg“, der Stein als Rückstieg zur Erde.
ausruhen und vergessen sein
am besten unter einem stein
den niemand hebt, kein kind
das schaut ob würmer und asseln sind
…
oder selbst wurm oder assel sein
…
oder vielleicht dieses kind sein
oder selbst vielleicht dieser stein
Während Wondratschek den vital aggressiven, selbstgenüßlich erotischen Schmerz zeigt, buchstabiert Jandl den Schmerz des armen, alternden Mannes. Er erinnert sich freundschaftlich seiner Mitschreiber, aber er ist in die Todesregion geraten, in der Individualität und Dualität in Frage gestellt sind. Die Erinnerung an die Freunde ist gleichsam ein Andenken zurück. Die Gegenwart der vorausgegangenen Dichter ist das Andenken nach vorn. Einer der kunstlosen „Dreizeiler“ heißt:
wasser für celan
feuer für bachmann
erde fühl ich mich an
Paul Celan ist ins Wasser gegangen; Ingeborg Bachmann im Feuer gestorben. Der Sprecher fühlt die Erde. In dieser Richtung scheint mir das bitter ironische Gedicht „das schöne bild“ zu gehen. Die Erde spart das Bild des Menschen, die Orte sparen die Spur des Menschen aus. Eine unerhörte Auslöschung des „schönen Bildes“ geschieht. „So wird meine Seele gesund“, heißt ironisch-grotesk die letzte Zeile. Ist die Auslöschung Nichtung oder Verwandlung? – Das bleibt die Frage.
Im anderen, nicht weniger grotesken Bild „der wahre vogel“ wird eine Amsel vorgestellt, der die Beine abgeschnitten werden, so daß sie nur noch fliegen kann und immer fliegen muß:
steigt höher auf und höher
bis ich sie nicht mehr sehe
und fast vor Lust vergehe
das müßt ein wahrer vogel sein
dem niemals fiel das landen ein.
Ich lese im Prozeß dieser Jandlschen Loslösung nicht nur die Verstümmelung, die Durchbohrung, die Aufhängung, sondern auch Chiffren des Absoluten. Aber nicht der mehr ästhetische Schmerz, das wahre Sterben schreibt sie.
Paul Konrad Kurz, Bayerischer Rundfunk, 24.11.1983
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Jörg Drews: Unerhörte Redeweisen für Schmerz und Verzweiflung
Süddeutsche Zeitung, 29./30.10.1983
Gerhard Sauder: Die peinigenden Jahre
Saarbrücker Zeitung, 27.12.1983
Ernst Nef: Potential aus Asche
Neue Zürcher Zeitung, 16.1.1984
Heinz F. Schafroth: Ernst Jandl: Beiläufig heulendes Elend
Basler Zeitung, 20.7.1984
Wendelin Schmidt-Dengler: Ernst Jandl: Selbstporträt des Schachspielers als trinkende Uhr
Literatur und Kritik, Heft 185/186, 1984
Hansjörg Schertenleib: Die Trauer des Scherzboldes
Bücherpick, Heft 4, 1983
Kurt Kahl: Jandls Widmungen
Kurier, 6.8.1983
Achim Barth: Der Schachspieler als trinkende Uhr
Münchner Merkur, 29.8.1983
h.sch.: Ernst Jandl, Selbstporträt des Schachspielers als trinkende Uhr
Falter, 20.9.1983
Anonym: Ich gab euch, was ich hatte
Stuttgarter Nachrichten, 11.10.1983
Alexander Hildebrand: Zerbrochen die Illusionen. Zwei Altmeister und zwei junge promovierte Damen
Wiesbadener Kurier, 13.10.1983
Klaus Stadtmüller: Rückblick aus Trauer
Hannoversche Allgemeine Zeitung, 15.10.1983
Anonym: Ernst Jandl: Selbstporträt des Schachspielers als trinkende Uhr
Boulevard, 10.1983
Jürgen Schiewe: „nicht wie ihr mich wollt“. Lust-voller Umgang mit Wörtern
Nürnberger Zeitung, 23.11.1983
Jörg Drews: Zum Lesen in Raten
Luzerner Nachrichten, 15.12.1983
Reinhold Tauber: Lied der Einsamkeit
Oberösterreichische Nachrichten (OÖN), 9.1.1984
Martin Kraft: Bekenntnisse eines abstinenten Schnapsbrenners
Der Landbote, 28.1.1984
H. St.: Gebündelte Ohnmacht
Salzburger Nachrichten, 4.2.1984
Volker Hage: Kassandras Warnruf, der Chinese des Schmerzes, Männer-Einsamkeit. Zur deutschen Literatur 1983 – ein Jahresrückblick
Börsenblatt des Deutschen Buchhandels, Heft 21, 13.3.1984
alb: Letale Endspiele der Sprache
Der Bund, 17.3.1984
Heinz Weder: Subtile Gefühle
Bücherpick, Heft 1, 1984
Hannelore Schlaffer: Von Augenblick zu Augenblick. Sechs Gedicht-Publikationen zwischen Tradition und Moderne
Stuttgarter Zeitung, 1.9.1984
Anonym: Ich trete ab, Freunde, ich trete ab
Westdeutsche Zeitung, 22.4.1986
dotz: Taschenbuch
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 26.9.1986
Norbert Hummelt: Merk dir, du heißt ernst jandl. Eine Vermißtenanzeige
Schreibheft, zeitschrift für literatur, Heft 55, 2000
Gespräch mit Ernst Jandl
– Spätestens seit dem Erscheinen des Gedichtbandes Laut und Luise (1966) ist der Name Ernst Jandl ein Begriff in der modernen Lyrik. Mit diesem Namen verbinden sich moderne Textverfahren, die mit der konkreten Poesie engstens verwandt sind und darüber hinausgehen: Sprechgedichte, visuelle und Lautgedichte, Dialekt- und Fremdsprachenverarbeitungen, Montagen, Phon-, Silben-, optische und Sprachstückverschiebungen und -reduktionen. Doch will und soll Ernst Jandl nicht als bloßer Sprachmanipulator und -artist gelten. Er ist ständig bemüht, seinem Engagement in bezug auf Wirklichkeitserfahrung in und durch Sprache adäquat Ausdruck zu verleihen. – Das nachfolgende Gespräch führte Cegienas de Groot am 14. März 1983 in Amsterdam. –
Cegienas de Groot: An vielen Stellen kann man lesen, Sie seien der Begründer oder der Mitbegründer der Grazer Autorenversammlung. Andererseits jedoch heißt es, daß es nach oder im Zusammenhang mit Ihrer Rede im Forum Stadtpark Graz, anläßlich des Zurücktretens des österreichischen PEN-Club-Präsidenten wegen der Nobel-Preisverleihung an Heinrich Böll, zur Gründung der Grazer Autorenversammlung gekommen sei. Wollen Sie bitte unseren Lesern in dieser Angelegenheit etwas mehr Klarheit verschaffen und vielleicht zugleich einen Eindruck davon vermitteln, was die Leser sich unter Forum Stadtpark und Grazer Autorenversammlung vorzustellen haben?
Ernst Jandl: Das Forum Stadtpark und die Grazer Autorenversammlung sind zwei völlig getrennte und völlig verschiedene Dinge.
Erstens einmal ist das Forum Stadtpark wesentlich älter als die Grazer Autorenversammlung und hat seinen Namen daher, daß diese Vereinigung zu einem Zeitpunkt (1960) gegründet wurde, als ein Gebäude, ein pavillonartiges Gebäude, im Grazer Stadtpark leer stand und abgerissen werden sollte. Einige Schriftsteller und bildende Künstler taten sich zusammen und unternahmen alles, um den Abbruch dieses Gebäudes zu verhindern und es für verschiedene künstlerische Aktivitäten zur Verfügung zu bekommen. Das ist gelungen. Es wurde der Verein Forum Stadtpark gegründet, und es ist dieses Gebäude heute, wie vor zwanzig Jahren etwa, in Betrieb. Es werden dort Ausstellungen organisiert, es werden Lesungen, Filmvorführungen, Diskussionen aller Art veranstaltet. Es gab, zumindest früher, im Keller des Forums Stadtpark überdies Veranstaltungen wie Jazz-Konzerte und Jam-Sessions und einen immer nicht nur angenehmen, sondern auch inspirierenden Kontakt zwischen den Mitgliedern und ihren Freunden und Gästen bis spät in die Nacht oder früh in den Morgen hinein. Zentrale Figur ist heute wie am Anfang Alfred Kolleritsch, der vor wenigen Tagen mit dem Würdigungspreis, einem Staatspreis, dem zweithöchsten Preis in Österreich, für sein literarisches Werk ausgezeichnet wurde. Sicherlich auch für die außerordentliche Ausstrahlung, die dieser Mann im deutschen Sprachraum und darüber hinaus hatte und hat, wobei er als Medium der Ausstrahlung nicht nur seine Person, sondern auch die Zeitschrift manuskripte hat, die jetzt auch gut 20 Jahre alt und – das kann man wohl sagen – seit vielen Jahren die interessanteste und anregendste Literaturzeitschrift im deutschen Sprachraum ist. Sie hat sicherlich in der Literatur in Österreich und darüber hinaus vieles verändert.
Die Grazer Autorenversammlung wurde vor 10 Jahren (1973) gegründet. Anstoß für die Gründung war eine Erklärung, die ich abgefaßt hatte und anläßlich einer Lesung in Graz vor dem Fernsehen, das hier einen Teil der Lesung aufnehmen wollte, verlas. Diese Erklärung kannte, außer Friederike Mayröcker, mit der zusammen ich nach Graz fuhr und die an der Lesung ebenfalls teilnahm, niemand. Auch die Leute vom Fernsehen natürlich nicht; ich machte sie nur darauf aufmerksam, es würde am Anfang, vor der Lesung, eine interessante Erklärung kommen und sie sollten es nicht versäumen, diese Erklärung aufzunehmen. Ich hatte in dieser Erklärung den Rücktritt des österreichischen PEN-Präsidenten Alexander Lernet-Holenia, der aus Protest gegen die Nobelpreisverleihung an Heinrich Böll erfolgte – einen Autor, der für Lernet-Holenia viel zu weit links stand –, zum Anlaß genommen, um einiges von dem, was wir seit langer Zeit am österreichischen PEN kritisierten und als sehr unangenehm erfuhren, hier bei dieser Gelegenheit vor aller Öffentlichkeit zu äußern.
Das war erstens die Tatsache, daß die für die österreichische Gegenwartsliteratur im Jahre 1973 relevanten österreichischen Autoren nahezu alle außerhalb des PEN standen und keinerlei Aussicht war, daß nun diese 20 oder 25 oder 30 Autoren, die tatsächlich die österreichische Gegenwartsliteratur der damaligen Jahre – und heute ist das vielleicht nicht viel anders – repräsentierten, in den PEN aufgenommen worden wären. Und zum zweiten zählte diese Schriftstellerorganisation fast nur lokale Größen zu ihren Mitgliedern, die man keineswegs als für die österreichische Literatur repräsentativ bezeichnen konnte, jedenfalls nicht für eine Literatur, die über die Grenzen Österreichs hinauswirken wollte – und ich glaube, das muß jede österreichische Literatur, so wie jede deutschsprachige. Auch der Schweizer Autor – ich denke in erster Linie an den deutschschreibenden Schweizer Autor – muß über die Grenzen der Schweiz hinaus wirksam werden, sonst bleibt er eine lokale Größe.
Im PEN, dem österreichischen PEN, sahen wir fast nur lokale Größen, die aber zu unserer Erbitterung seit Jahr und Tag die Schlüsselstellungen, die es für Literatur in einem Land geben kann, in Österreich besetzt hatten. Das ist in erster Linie natürlich der Rundfunk, der österreichische Rundfunk: Alles, was dort mit Literatur zu tun hatte, war fest in den Händen dieser Vertreter einer sozusagen provinziellen österreichischen Literatur. Ich kann nicht sagen, daß sich bis heute alles grundlegend geändert hat, was etwa den Rundfunk betrifft, aber es hat sich einiges geändert und es ist einiges besser geworden – das nur so nebenbei. Das waren also die Hauptmotive, warum ich diesen Text, diese Deklaration, verfaßt hatte und weshalb eine Anzahl Autoren in Graz sofort bereit waren, diese Deklaration zu unterzeichnen. Dadurch war also Graz zum Ausgangspunkt geworden. Es folgte ein weiterer Schritt, man wollte ja etwas tun. Nach Holenia wurde Friedrich Torberg neuer Präsident des PEN. Und Torberg erklärte öffentlich – das stand dann in allen Zeitungen –, er werde nun die jungen und neuen Autoren in den PEN hineinholen, und er lud eine Anzahl von Autoren ein. Jetzt standen wir vor der Frage, ob wir uns vom PEN, so wie er damals aussah, vereinnahmen lassen sollten. Denn wir würden darin natürlich nur eine verhältnismäßig kleine Minderheit bilden. Und es kam dann zu einem Gespräch mit Kolleritsch in Wien und, als Folge dieses Gesprächs, zu einer Einladung an ungefähr 30 Autoren nach Graz, in das Forum Stadtpark, um dort die Situation zu diskutieren und zu entscheiden, was wir nun eigentlich unternehmen wollten. Wir trafen uns in Graz und beschlossen, daß wir an den internationalen PEN ein Ansuchen stellen würden: ein Ansuchen um Anerkennung als zweites, autonomes österreichisches PEN-Zentrum. Das brachte natürlich den österreichischen PEN-Club in höchste Verwirrung. Im Vorstand des österreichischen PEN wurde der Entschluß gefaßt, dieser Sache unbedingt zu begegnen und dieses Unterfangen unmöglich zu machen. Es gab einzelne PEN-Zentren, die an dieser Grazer Autorenversamlung, an dieser verhältnismäßig kleinen Gruppe von Autoren, großes Interesse hatten, wie z.B. der schwedische PEN, und unbedingt wünschten, daß diese Autoren einen Platz im Rahmen des internationalen PEN finden sollten. Bei dem nächsten – also auf diese Ereignisse folgenden – internationalen PEN-Kongreß wurden zwei Autoren der Grazer Autorenversammlung nach Schweden eingeladen, nach Stockholm, um dort die Sache der Grazer zu vertreten. Die Entscheidung wurde aufgeschoben. Ich hatte aus privaten Gründen keine Möglichkeit, an der Stockholmer Sitzung teilzunehmen. Beim nächsten internationalen PEN-Kongreß in Ochrid in Jugoslawien war ich dabei, mit Klaus Hoffer (Klaus Hoffer hatte bereits dem Kongreß in Stockholm beigewohnt). Wir trugen in Ochrid unser Anliegen vor. Die Gegenseite, vertreten durch den inzwischen verstorbenen Peter von Tramin, trug ihrerseits ihren Standpunkt vor. Es kam schließlich zur Abstimmung, obwohl manches anwesende PEN-Zentrum, wie z.B. der schwedische PEN, es offenbar lieber gesehen hätte, wenn man die Sache weiter vertagt hätte – und das wäre vielleicht, nachträglich gesehen, auch ganz klug gewesen. Die anwesenden Delegierten der nationalen PEN-Organisationen stimmten zwar in Mehrheit für uns, d.h. dafür, daß wir ein eigenes, autonomes zweites österreichisches PEN-Zentrum errichten sollten, aber eine ganze Reihe von nicht-anwesenden nationalen PEN-Organisationen hatte zu erkennen gegeben, für den Standpunkt des österreichischen PEN zu sein, und zwar durch briefliche Abgabe ihrer Entscheidung. Damit hatten wir nicht gerechnet, aber es wurde auf diese Weise – die Briefstimmen galten als gleichberechtigt – unser Ansuchen abgelehnt, mit Mehrheit abgelehnt. Es ist dazu noch zu bemerken, daß diese nationalen Zentren natürlich nur vom österreichischen PEN aus informiert worden waren und die andere Seite nicht in ihrer Argumentation zur Kenntnis hatten nehmen können.
Darauf ging bei uns die Diskussion weiter und führte alsbald dazu, daß wir uns als eigener Verein konstituierten. Wir beschlossen, mit Mehrheit, als österreichische Schriftstellerorganisation unabhängig vom PEN und neben dem PEN weiter zu existieren und zu versuchen, innerhalb Österreichs unseren Standpunkt zu vertreten und der neuen Literatur, den neuen Autoren, möglichst günstige Chancen auch in Österreich zu erkämpfen. Der Anspruch, ein unabhängiges zweites PEN-Zentrum zu gründen, wurde bald nach der Niederlage in Ochrid fallengelassen. Und heute existieren die beiden Vereinigungen, also der PEN und die Grazer Autorenversammlung, nebeneinander. Es gibt zwischen ihnen viele Kontakte, z.B. in der Interessengemeinschaft österreichischer Autoren, dem Dachverband der Schriftsteller in Österreich, dem beide Organisationen angehören. Es gibt auch einen Sozialfonds, an dem Vertreter des PEN und der Grazer Autorenversammlung mitarbeiten. Ich würde sagen, daß die Kampfsituation, die es einmal gegeben hat, inzwischen einer viel nüchterneren Situation gewichen ist. Aber es ist noch immer eine stillschweigende Regel, daß ein Autor, wenn er zur Grazer Autorenversammlung will, nicht Mitglied des österreichischen PEN sein soll.
Groot: Und umgekehrt?
Jandl: Darüber kann ich nichts sagen. Ich glaube, daß man umgekehrt anders vorgehen würde, da man ja noch immer interessiert wäre, unseren Verein irgendwie aufzusaugen. Aber jedenfalls, die Schärfe ist der Sache genommen, würde ich sagen. Es hat z.B. vor einem Jahr einen großen Schriftstellerkongreß gegeben – es war die erste wirklich öffentliche Demonstration der Schriftsteller in ihrem Kampf um bessere Lebensbedingungen, vor allem Sozialversicherung, Pensionsversicherung und ähnliches. Da standen die Mitglieder des PEN und der Grazer Autorenversammlung Seite an Seite und haben diese Sache durchgefochten und in diesem Kongreß zusammengearbeitet. Und vor kurzem war bei einer Schriftstellerdemonstration, einem Zug durch die Innenstadt, genau dasselbe zu beobachten. PEN und Grazer Autorenversammlung gehen in Angelegenheiten, die das Anliegen sämtlicher Schriftsteller sein müssen, ob nun progressiv oder weniger progressiv, Seite an Seite.
Groot: 1952–1953 waren Sie an der East Barnet Grammar School in England tätig, Sie hatten ja Germanistik und Anglistik studiert – inwieweit hat nun etwa die angelsächsische nonsense-poetry bei Ihnen so etwas wie einen Blick für Sprachspiele oder ähnliche Sprachhandhabungen ausgelöst, wie sie dann die Konkrete Poesie später pflegte? Oder meinen Sie, daß die Konkrete Poesie in ihrer Entstehung kaum auf angelsächsische Einflüsse zurückgeht?
Jandl: Es gibt schon Einflüsse von englischer und amerikanischer Literatur.
Groot: Aber als Auslösen würden Sie das nicht bezeichnen?
Jandl: Sicherlich hat Gertrude Stein einiges ausgelöst.
Groot: Ihr Name wird in diesem Zusammenhang auch oft genannt.
Jandl: Ihr Name wird zurecht oft genannt, z.B. von einem Autor wie Heißenbüttel, der sehr früh schon auf die Wichtigkeit von Gertrude Stein für eine neue Literatur aufmerksam machte. Und ich kannte Gertrude Stein auch schon verhältnismäßig lange. Ich begann mich so um 1949 etwas genauer mit Gertrude Stein zu beschäftigen, Ich las nicht viel von ihr, sondern eher eine bescheidene, kleine Menge ihrer Arbeiten, die aber durch ihre Radikalität eine äußerst starke Wirkung auf mich hatten. Dann könnte man z.B. Cummings erwähnen, der sicherlich in seinen Gedichten ebenfalls zu den großen Neuerern der Poesie gehörte. Und selbstverständlich kannte ich auch Gedichte von Gerald Manley Hopkins, der ja auch auf dem Gebiet des Wortspiels, des ernsten Wortspiels, wie es Erich Fried zu nennen pflegt und ganz zurecht, Großes geleistet hat. Schließlich könnte man Erich Fried nennen, den ich 1952 während meines England-Aufenthaltes kennengelernt hatte und der damals gerade in einer Phase war, in der er dieses ernste Wortspiel mit großer Intensität betrieb. Ihm war es offenbar gelungen, verschiedene Merkmale englischer Dichtung, die man eigentlich auf die englische Dichtung, der Sprache wegen, beschränkt glaubte, ins Deutsche herüberzuholen, z.B. die sogenannten Ablautreime.
Groot: In dem 1982 von Wendelin Schmidt-Dengler herausgegebenen Materialienbuch über Sie zitieren Sie pädagogische Kulturzeitschriften und andere Texte aus dem Zeitraum 1957 bis 1960, die Ihre Texte als schlecht für die Jugend, ja eventuell sogar als Abfallprodukte abtun. Dieses Zitieren Ihrerseits ist eindeutig ein Protest. Wie würden Sie dies kommentieren?
Jandl: Ja, das geschah alles – Anlaß dafür war die Mainummer 1957 der Zeitschrift Neue Wege, einer Zeitschrift, die eigentlich nur in die Schulen kam, in die Hände der Lehrer und in die Hände der Schüler, vor allem in die allgemeinbildenden höheren Schulen, wie es jetzt heißt, also in Gymnasien und Realgymnasien. Öffentlich wurde sie kaum verkauft, in den Buchhandlungen überhaupt nicht. Sie war gebunden an das Theater der Jugend, eine Organisation, die bald nach dem Krieg errichtet wurde, um Schülern und ihren Lehrern die Möglichkeit zu verschaffen, zu billigen Preisen Theateraufführungen in Wien zu sehen. Eine Organisation, die sich dann sehr ausweitete, weil äußerst viel Interesse seitens der Schüler und der Lehrer daran bestand. Sie gab auch die Zeitschrift Neue Wege heraus, die Zeitschrift des Theaters der Jugend, die ihre eigene Literaturredaktion hatte, wo junge Autoren ihre Gedichte, ihre Texte, ihre Prosa veröffentlichen konnten. Zu einem Zeitpunkt, als der Leiter des Theaters der Jugend schwer erkrankt im Spital lag, gab der Literaturredakteur, mit dem ich gut befreundet war, Friedrich Polakovics – der sich auch einen Namen durch die Herausgabe des Buches med ana schwoazzn dintn von Artmann machte – , ohne Kontrolle von oben die Mainummer 1957 heraus; er öffnete die Zeitschrift zum ersten Mal literarischen Experimenten, und zwar ziemlich massiv. Daraufhin erfolgte dann die heftige, ablehnende Reaktion der Gewerkschaft der Lehrer, der katholischen Lehrerorganisation usw. Dabei wären die Schüler zum Teil zu haben, zu interessieren gewesen. Wir hielten um dieselbe Zeit, im Anschluß an diese Veröffentlichung, da und dort Lesungen. Es kamen da ganze Schulklassen, geschlossen, natürlich ohne Lehrer, um sich das anzuhören, und die jungen Leute reagierten wirklich mit Begeisterung.
Auf Ihre Frage zurückkommend: In diesem Materialienbuch ist auch ein Zitat aus der Weltbühne, Ost-Berlin, enthalten, das zu einem viel späteren Zeitpunkt erschienen ist und gezeigt hat, daß dort ein gewisser Widerstand gegen neue Poesie aufkommen konnte, ein Widerstand, der sich inzwischen wieder gelegt hat. So wurde 1981 eine Gedichtauswahl von mir in Berlin (DDR) veröffentlicht, und ich hatte dort zwei Lesungen, die in meiner Erinnerung zu den schönsten Lesungen gehören, die ich je hatte, mit einem begeisterten Publikum.
Groot: Wie war Ihr Verhältnis zur Wiener Gruppe (1952–1964)? Sie gehörten nicht dazu, obgleich Sie natürlich sehr verwandte Texte schrieben und sich auch z.B. mit H.C. Artmann gut standen. Und er schreibt ja noch immer über Sie.
Jandl: Ja, es gab von Ende 1956 an und bis in das Jahr 1958 hinein einen engen Kontakt zwischen Friederike Mayröcker und mir auf der einen Seite und Artmann und Rühm auf der anderen. Wir kamen sehr oft zusammen, jeder interessierte sich sehr für die Arbeit des anderen, es war wirklich eine großartige Atmosphäre unter uns Schreibenden. Und natürlich gerieten wir einander auch immer wieder in die Haare, vor allem Rühm und ich. Und wenn Rühm und ich zu streiten begannen, da war Artmann derjenige, der den Streit schlichtete und uns sagte:
Um Gottes Willen, wenn wir jetzt streiten, wo wir sowieso von allen isoliert werden und alle gegen uns sind, was soll dann geschehen?
Artmann brachte immer wieder die Versöhnung zustande. Aber zur Wiener Gruppe gehörten weder ich noch Friederike Mayröcker. Die Wiener Gruppe, die diesen Namen nicht selber erfunden hat, sondern der er von außen, von journalistischer Seite, gegeben wurde, wird einfach definiert und abgegrenzt durch Gemeinschaftsarbeiten. Es gab 5 Leute, die Jahre hindurch diese Gemeinschaftsarbeiten mit großer Freude, großer Intensität und großem Elan betrieben, und dabei immer wieder neue Entdeckungen machten. Und diese fünf – Artmann, Achleitner, Bayer, Rühm und Oswald Wiener – sind die Wiener Gruppe. Und wer nicht mitmachte aus diesem oder jenem Grund, sei es, daß er nicht hineingezogen wurde, sei es daß er selber eine Scheu hatte, da irgendwie einmal für sich den Anfang zu machen und mitzumachen, der ist wohl oder übel nicht in der Wiener Gruppe drin, auch wenn er mit den anderen gleichzeitig ähnliche Dinge machte .
Groot: Es heißt wohl, daß es der Wiener Gruppe primär um Experimente mit sprachmateriellen Grenzüberschreitungen ging, während im Gegensatz dazu oder darüber hinaus bei Ihnen so etwas wie assoziative Aussagekerne, also nicht bloße Sprachexperimente, eine Rolle spielten. Wie stehen Sie dazu?
Jandl: Ich will der Wiener Gruppe nicht Unrecht tun… Die Autoren der Wiener Gruppe haben, jeder auf seine Weise, Stellung bezogen zur außerliterarischen Realität wie auch zur Literatur, besonders jener, die sie als Vorläufer der neuen Literatur anerkannten, nehmen wir August Stramm, nehmen wir die Dadaisten, nehmen wir Kurt Schwitters. Bei Artmann müßte man unbedingt das Barock hinzunehmen, die Barockdichtung, die auch von Rühm und vor allem von Konrad Bayer aufgesogen wurde. Also Schreibverfahren, die man für die eigene Arbeit dann brauchen konnte, wenn man sie einmal wirklich in sich verarbeitet hatte. Es gab bei Rühm immer wieder Experimente, die den Anschein völliger Abstraktheit hatten, d.h. Loslösung der Sprache, weitestgehende Loslösung der Sprache von allen Bindungen an Außersprachliches.
Und bei mir herrschte die Vorliebe, oder das Interesse, vor, Bekanntes mit Unbekanntem zu verbinden und möglichst Verbindungen zur außersprachlichen Welt sichtbar werden zu lassen.
Groot: In seinem Beitrag zum Materialienbuch meint Helmut Heißenbüttel, Sie seien seit Laut und Luise als Komiker mißverstanden worden. Was meinen Sie dazu?
Jandl: Es ist nicht zu leugnen, daß eine Reihe Texte, die ich geschrieben habe, eben Humor oder Ironie oder was auch immer besitzen und die Zuhörer lachen machen, und ich sehe darin keineswegs einen Nachteil. Allerdings ist es, oder wäre es, eine sehr einseitige Betrachtung, wenn man mich nun einfach als Komiker mit literarischen oder lyrischen, poetischen Mitteln klassifizieren oder abqualifizieren wollte.
Groot: In diesem Zusammenhang folgendes: Sie geben in Dingfest (1973) den Gedichten ein Datum bei. Karl Riha deutet im Materialienbuch das so, als ginge es Ihnen darum, die Durchgängigkeit Ihres lyrischen Schaffens zu dokumentieren.
Jandl: Ja, Dingfest war wohl das erste Buch, wo ich Daten geliefert habe. Und zwar war die Absicht bei Dingfest zu zeigen, daß ich neben den Gedichten, wie sie sich in Laut und Luise finden, auch Gedichte anderer Art geschrieben habe. Daß ich also zu keinem Zeitpunkt einfach als Verfasser konkreter oder experimenteller Poesie hätte gelten können, sondern daß das Feld, das Ich bearbeite, oder der Weg, den Ich ging, immer etwas breiter war. Und die sozusagen experimentellere Seite und die andere haben sich zum Teil gegenseitig bedingt und beeinflußt. Als Gegenbeispiel könnte man Eugen Gomringer nehmen: als konkreten Dichter, als Autor, der von dem, was er geschrieben hat, nur konkrete Gedichte oder solche, die man irgendwie als konkrete Gedichte bezeichnen könnte, gesammelt und herausgegeben hat. Manchmal sieht man, daß ein solcher Künstler – und ich halte Gomringer für einen ganz bedeutenden Künstler – einen Punkt erreicht, wo es aussieht, als ob es nicht weiter gehe. Ich habe einmal in einer Schweizer Zeitung einen kleinen Zyklus von ihm gelesen, den er dann nicht in sein Buch Worte sind Schatten (1969), also in seine gesammelten Konstellationen, aufgenommen hat; mit diesem Zyklus tat er einmal einen Schritt weg von der konkreten Poesie im klassischen Sinne. Er hat sich dann sehr wohl überlegt, ob er das wirklich zu seinem Werk hinzufügen soll oder ob er dieses nicht in der Reinheit, in der es jetzt dasteht, belassen soll.
Also, Purist in diesem Sinne war ich nie, und das sage ich, ohne daß ich den Puristen Gomringer etwa deswegen nicht schätzen und hochachten würde. Ich verstehe durchaus, daß der Purismus eine ganz großartige und wichtige Sache für einen Künstler sein kann, sogar eine entscheidende Sache für einen bestimmten Künstler. Ein anderer wieder lebt als Künstler davon, daß er eben nicht Purist ist; das ist also mehr mein Fall.
Groot: Franz Mon spricht im Hinblick auf Ihre Sprechoper Aus der Fremde davon, daß – ich zitiere –: „Sichäußern und gar das schreibende nahezu unmöglich (geworden)“ (Materialienbuch) sei. Wie stehen Sie zu dieser Äußerung?
Jandl: Ich würde erst einmal sagen, daß ich in dem, was ich geschrieben habe, mich eigentlich immer geäußert habe, daß ich das immer als ein „Sich-Äußern“ empfunden oder gesehen habe.
Ich meine, mir würde es eher unmöglich erscheinen, mich nicht zu äußern. Oder sagen wir, mich nicht zu äußern und trotzdem mit Sprache etwas zu tun. Ich glaube, es ist mir jedenfalls kaum möglich, mit Sprache etwas anzufangen, ohne mich zu äußern.
Groot: Auf welche Weise ist für sie der Sprache ein Realitätsbezug inhärent?
Jandl: Sie bringt jeweils Realitätsbezüge mit sich und ist dabei immer „Sprache an sich“. Damit hat sich ja die Konkrete Poesie, auch theoretisch, immer wieder beschäftigt. Die Sprache ist selbst eine Realität und eine Realität unter anderen. Ich kann mit Sprache nicht alles tun. Ich kann zwar mit Sprache mich äußern, mich verständigen. Ich kann mit Sprache an anderen Menschen das oder jenes bewirken. An Tieren kann ich schon weniger mit Sprache bewirken, obwohl man weiß, daß man bei dressierten Tieren mit Sprache noch das eine oder andere bewirken kann. Bei Dingen ist es aus: Da kann ich mit Sprache überhaupt nichts bewirken.
Die Sprache hat ihre Grenzen der Wirksamkeit. Ich kann einen Revolver nicht durch Sprache ersetzen und dann mich oder meinen Gegner ,killen‘ mit Sprache.
Groot: Zuweilen ist im Hinblick auf die Problematisierung der Sprache die Rede vom ,Sprachspiel als letzte Möglichkeit‘ oder vom Schreiben als ,Überlebenstrick‘. Wie stehen Sie dazu?
Jandl: Ich bin ganz dagegen, muß ich sagen. Ich finde überhaupt diese Versuche, eine Sache dann so in ein ideologisches Eck abzudrängen, alle unrichtig.
Groot: Für Sie ist das Experimentieren etwa der Konkreten Poesie kein Symptom, kein Ausdruck einer Unzulänglichkeit der Sprache?
Jandl: Von mir aus gesehen wäre das ganz unzutreffend, denn die Sprache, wie sie im Alltag verwendet wird, ist ein sehr brauchbares Instrument, mit dem auch sehr viel Mißbrauch getrieben werden kann. Die Sprache, die Verwendung der Sprache, im Kunstwerk ist eine andere Sache, ist eine andere Art von Verwendung der Sprache, wenn auch nicht eine völlig andere Art. Aber in dem Moment, wo ein Autor die Forderung an sich stellt, nicht zweimal dasselbe zu machen oder nicht etwas zu machen, was ein anderer schon gemacht hat, da stößt er an Grenzen seiner eigenen Möglichkeit, mit Sprache künstlerisch zu verfahren. Und das kann ihn in furchtbare Klemmen bringen und in furchtbare Krisen. Wenn er Glück hat oder wenn er beharrlich genug ist, wird er aus seiner schwierigen Lage, aus seiner Klemme wieder herausfinden, indem er für sich neue Möglichkeiten zur Sprachverwendung entdeckt. Wobei diese neuen Möglichkeiten natürlich nicht immer radikal neue Möglichkeiten sein können. Es sind immer wieder Veränderungen von Nuancen, Und alles, was sich für den Hersteller oder für den Betrachter an Poesie abspielt, spielt sich gegen den Hintergrund einer Normalsprache ab, die in unserem Alltag funktioniert, die ihre festen Regeln und Normen hat und sie braucht, um für unsere Verständigung funktionieren zu können. Das geht dann weiter in die Sprache der Theorie, der Wissenschaft usw., die ja auch sich nicht völlig von den Normen der Alltagssprache getrennt hat, im Gegenteil: Sie versucht möglichst dicht an der Alltagssprache zu bleiben und schwer ausdrückbare, schwer sagbare Dinge doch noch faßlich zu sagen, wenn auch vielleicht nur für einen kleinen Kreis von Experten faßlich zu sagen. Und der Autor, so wie ich es sehe, sieht sich immer wieder gezwungen, wie auch der Autor von Lyrik, mit Sprache etwas zu tun, was er noch nicht genau auf diese Weise getan hat, was womöglich auch kein anderer genau auf diese Weise getan hat. Und die Grenzen sind da nicht die Grenzen der Sprache, sondern seine eigenen Grenzen, seine Grenzen als Künstler, die er ausdehnen muß, durchbrechen muß oder was auch immer.
Groot: In diesem Zusammenhang: Die „heruntergekommene“ Sprache, wie in „Tagenglas“, und die verkindlichte Sprache, wie in den Gedichten „an die Kindheit“ (in Der gelbe Hund) sind die als Zeichen einer Suche nach immer neuen Möglichkeiten zu verstehen?
Jandl: Ich würde sagen, daß diese Sprache, die „heruntergekommene“ Sprache, als eine Ergebnis dieser Suche nach einer neuartigen Verwendung von Sprache zu sehen ist, als ein Versuch, mit Sprache etwas Neues zu machen. Der Versuch geht nicht in einem neutralen Bereich vor sich – womit ich meine: Der Autor ist in eine Situation geraten – und er muß praktisch immer in eine Situation geraten, um etwas Neues machen zu können, ja um überhaupt schreiben zu können –, er ist in eine Situation geraten, die ihm diese Sprache zu diesem Zeitpunkt, und sei es eine Woche lang oder einen Monat oder ein Jahr oder zwei, möglich macht. Und daß er vorher nicht mit dieser Sprache gearbeitet hat, ist nicht nur darauf zurückzuführen, daß er bei seinem Herumexperimentieren mit Sprache zufällig nicht fünf Jahre früher darauf gestoßen ist, sondern auch darauf, daß er selber als Person fünf Jahre früher in einer anderen Situation war.
Was die „verkindlichte“ Sprache betrifft: Daß diese sich immer wieder mit der Thematik des Alltags trifft, ist kein Zufall. Und daß die „heruntergekommene“ Sprache sich immer wieder mit der Thematik des Nicht-mehr-schreiben-Könnens, im Sinnen von Keinen-Satz-mehr-bilden-Können trifft, ist auch kein Zufall.
Groot: Liegt das daran, daß Sie sich sagten, da bin ich sozusagen am Ende, ich brauche andere Möglichkeiten, ich stoße da an eine Grenze?
Jandl: So habe ich mir das ungefähr vorgestellt, weil ich ja auch über diese Sachen manchmal nachdenke… Ich würde sagen, es ist die Fähigkeit des Konstruktiven zurückgegangen. In Laut und Luise und in sprechblasen oder im künstlichen baum kann man zuweilen entdecken: das sind wirklich neue Konstruktionen. Da wird konstruiert, und so entstand etwas ganz Konturiertes, Einmaliges, Nicht-Wiederholbares – und das ist zweifellos zurückgetreten.
Groot: Es macht den Eindruck, als schöpften Sie in den älteren Gedichten aus dem vollen.
Jandl: Ja, es war jedenfalls die Möglichkeit, immer wieder neue Dinge zu konstruieren. Während die „heruntergekommene“ Sprache eine zwar nicht konsequent durchgearbeitete Nebensprache oder Parallelsprache zur Normalsprache war, aber es war eine Sprache, mit der sich dann Gedicht um Gedicht um Gedicht machen ließ, während beispielsweise dieser „schtzngrmm“ nur einmal gemacht werden konnte und man daraus für kein weiteres Gedicht einen Nutzen hätte ziehen können.
Groot: Bedeuten in diesem Zusammenhang die Hörspiele und die Sprechoper Aus der Fremde für Sie ein weiteres abtastendes Experimentieren? Fand sich dort eine alternative, adäquate Möglichkeit der Sprachformung?
Jandl: Das Hörspiel ist eine Sache gewesen, die bewußt angepeilt wurde. Das gilt für das Theaterstück genauso. Dem Theaterstück ging ein viele Jahre früher – etwa zehn Jahre früher – unternommener Versuch voran, eine kleine Szenenfolge zu machen. Das war dann eine Kollage aus vorhandenem Material mit einzelnen neueren oder neu dazugeschriebenen Passagen. Das war eine Auftragsarbeit. Und Aus der Fremde war auch eine Auftragsarbeit: Einige Leute erhielten den Auftrag, ein Theaterstück für den Steirischen Herbst zu schreiben. Man hatte drei Jahre Zeit, diesen Auftrag zu erfüllen. Und ich war während der ersten zweieinhalb Jahre dieser Periode oft daran, die Sache aufzugeben. Erst im letzten Halbjahr dieser Frist entstand das Stück. Natürlich hat dabei die Vorstellung des Theaters mitgewirkt, aber gleichzeitig war es eine Vorstellung – sagen wir – eines Stückes gegen das Theater.
Groot: Ihre Gedichte scheinen mir zusehends persönlicher oder ,ich-expressiver‘ zu werden. Ich meine, in früheren Gedichten bleibt das Ich mehr im Hintergund als in späteren. Würden Sie mir zustimmen?
Jandl: Das stimmt. Man könnte sagen, daß der Autor unter Umständen dazu kommt, daß er sich letzten Endes selbst als Material verwendet und schaut, was er da herausbringt.
Groot: Auf der anderen Seite scheint der Ton skeptischer oder resignierender…
Jandl: Man kann sicher nicht von Skepsis sprechen. Resignation und Skepsis sind ja nicht unbedingt dasselbe. Und inwieweit Resignation darin ist, könnte ich praktisch nur sagen, wenn ich mir nun Gedicht um Gedicht ansehen würde. Skepsis ist es sicherlich nicht, das ist klar. Resignation – das würde ich in meiner Vorstellung eigentlich mehr mit einem Aufgebenwollen verbinden. Und so liegt es nicht, daß man das Schreiben aufgeben möchte. Die Resignation kann bis zum Selbstmord oder bis an die Grenze des Selbstmordes gespannt werden, ohne daß diese Resignation das Schreiben aufhören läßt. Ich könnte mir also einen Autor vorstellen, der bis zuletzt schreibt und sich dann eine Kugel in den Kopf schießt oder ein Schlafmittel nimmt. Nehmen sie etwa Jean Améry; das war ja nicht ein Mann, der Jahre lang resigniert geschwiegen hätte und sich dann plötzlich umgebracht. Sondern eigentlich hat er bis zuletzt gearbeitet. Er hat sich aber trotzdem als Person ständig diesem Punkt genähert, als Person und nicht unbedingt als Schreibender. Der Schreibende ist also offenbar ein Teil dieser doch etwas komplexeren Person. Keiner ist nur ein Schreibender, auch wenn er es vielleicht gerne wäre. Die Resignation könnte man sehr weit treiben, ohne deswegen aufzuhören zu schreiben.
Groot: Der deutschsprachigen Schweizer Literatur sagt man nach, sie sei, abgesehn von der ausgesprochen lokalen Literatur, weitgehend in die bundesrepublikanische Literatur integriert. Gilt das, soweit Sie das beurteilen können, auch für die österreichische Literatur?
Jandl: Ich kann für die Schweizer nicht reden. Ich kann mir nicht ganz vorstellen, daß die Schweizer Literatur, die deutschsprachige Schweizer Literatur auch der Gegenwart nun völlig in die bundesrepublikanische integriert sein sollte. Der Begriff der Bundesrepublik ist ja ein ausgesprochen politischer und noch dazu ein sehr junger Begriff, und ich kann mir auch nicht vorstellen, daß die von Österreichern geschriebene Literatur völlig in die bundesrepublikanische integriert sein könnte, es sei denn in der Weise, daß die Bücher dort erscheinen – die Bundesrepublik hat immer noch die größten und potentesten Verlage – und daß dort auch das Leserpotential am größten ist. Und auch wenn die Wiener Gruppe oder meine Arbeiten oder Friederike Mayröckers Arbeiten zu einem bestimmten Zeitpunkt von wesentlich mehr Leuten, einem wesentlich größeren Prozentsatz von Lesern in der Bundesrepublik gelesen wurden, so würde ich das noch nicht als eine Integrierung dieser Dichtung in die der Bundesrepublik ansehen. Genauso, wie ich umgekehrt nicht sagen kann, irgendwelche bundesrepublikanische Autoren seien in die österreichische Literatur integriert.
Groot: Auffallend ist aber, daß Schweizer Autoren oft in deutschen Verlagen erscheinen. Und das gilt für die österreichische Literatur viel weniger.
Jandl: Für die österreichische Literatur sind die Möglichkeiten, in österreichischen Verlagen zu publizieren, auch begrenzt. Der einzige von den größeren Verlagen, der wirklich konsequent neue österreichische Literatur veröffentlicht, wäre eigentlich der Residenz-Verlag. Aber ich sehe darin jedenfalls keinerlei Problem. Die Grenzen sind offen, mit Ausnahme der DDR, in der andere Voraussetzungen herrschen, da ja dort immer wieder ganz massiv, in einer bestimmten ,Bandbreite‘, versucht wird, auf die Literatur Einfluß auszuüben. Andererseits entsteht in der DDR eben durch diese immer wieder auftretende Spannung zwischen Autor und Ganzem – eine Spannung, die wir nicht haben – wichtige und für den ganzen deutschen Sprachraum relevante Literatur.
Ich würde eher dazu tendieren zu sagen, es gibt eine österreichische Literatur, es gibt eine schweizerdeutsche Literatur, es gibt eine Literatur der Bundesrepublik und eine Literatur der DDR. Ich würde nicht von vier Nationalliteraturen sprechen. Daß eine Sprache sich auf so verschiedene Länder erstreckt, ist eigentlich etwas sehr Positives. Wenn ich von österreichischer Literatur spreche, so ist es eben die Literatur, die von Österreichern geschrieben wurde. Ich schreibe in deutscher Sprache, bin ein Österreicher, ich bin ein deutschsprachiger Autor und kümmere mich im übrigen um Nation überhaupt nicht, zumindest nicht im Zusammenhang mit Literatur.
Groot: Ich danke Ihnen sehr für dieses Interview.
Deutsche Bücher, Heft 1, 1984
BREGENZ ODER JANDL UND WIR
Zweihundert
saßen im Foyer
(des Theaters am Kornmarkt)
als Jandl
las
Zurück blieben
zwanzig
für uns
Aber wenn die
Zwanzig
uns aufgenommen haben
in ihr Ohr
in ihr Herz
ist es mehr
als das Amusement
oder die Verwirrung
der Zweihundert
Lilly Ronchetti
ERNST JANDL
Wuff
wuff klufft
kluff kluff
umma ruff
Hörrrrrnnnnnstuuff
Wuff ruff
Umma um
Kupp kummt
klufft
Ummawuff rufft
Nixxxxxtata
Wuff ruff
Kupp um
Umma um
Wuff buff
Nanananununu
Peter Wawerzinek
Wie man den Jandl trifft. Eine Begegnung mit Ernst Jandl, eine Erinnerung von Wolf Wondratschek.
Ernst Jandl im Gespräch mit Lisa Fritsch: Ein Weniges ein wenig anders machen.
Eine üble Vorstellung. Ernst Jandl über das harte Los des Lyrikers.
Fakten und Vermutungen zum Autor + ÖM + KLG + IMDb + PIA +
Archiv 1, 2 & 3 + Internet Archive + Kalliope +
Georg-Büchner-Preis 1 & 2 + weiteres 1 & 2
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Galerie Foto Gezett +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Ernst Jandl: Der Spiegel ✝ Süddeutsche Zeitung ✝
Die Welt ✝ Die Zeit ✝ der Freitag ✝ Der Standart ✝ Schreibheft ✝
graswurzelrevolution
Weitere Nachrufe:
André Bucher: „ich will nicht sein, so wie ihr mich wollt“
Neue Zürcher Zeitung, 13.6.2000
Martin Halter: Der Lyriker als Popstar
Badische Zeitung, 13.6.2000
Norbert Hummelt: Ein aufregend neuer Ton
Kölner Stadt-Anzeiger, 13.6.2000
Karl Riha: „ich werde hinter keinem her sein“
Frankfurter Rundschau, 13.6.2000
Thomas Steinfeld: Aus dem Vers in den Abgrund gepoltert
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 13.6.2000
Christian Seiler: Avantgarde, direkt in den Volksmund gelegt
Die Weltwoche, 15.6.2000
Klaus Nüchtern: Im Anfang war der Mund
Falter, Wien, 16.6.2000
Bettina Steiner: Him hanfang war das Wort
Die Presse, Wien, 24.6.2000
Jan Kuhlbrodt: Von der Anwesenheit
signaturen-magazin.de
Zum 70. Geburtstag des Autors:
Karl Riha: „als ich anderschdehn mange lanquidsch“
neue deutsche literatur, Heft 502, Juli/August 1995
Zum 90. Geburtstag des Autors:
Zum 20. Todestag des Autors:
Gedanken für den Tag: Cornelius Hell über Ernst Jandl
ORF, 3.6.2020
Markus Fischer: „werch ein illtum!“
Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien, 28.6.2020
Peter Wawerzinek parodiert Ernst Jandl.
Ernst Jandl – Das Öffnen und Schließen des Mundes – Frankfurter Poetikvorlesungen 1984/1985.
Ernst Jandl … entschuldigen sie wenn ich jandle.


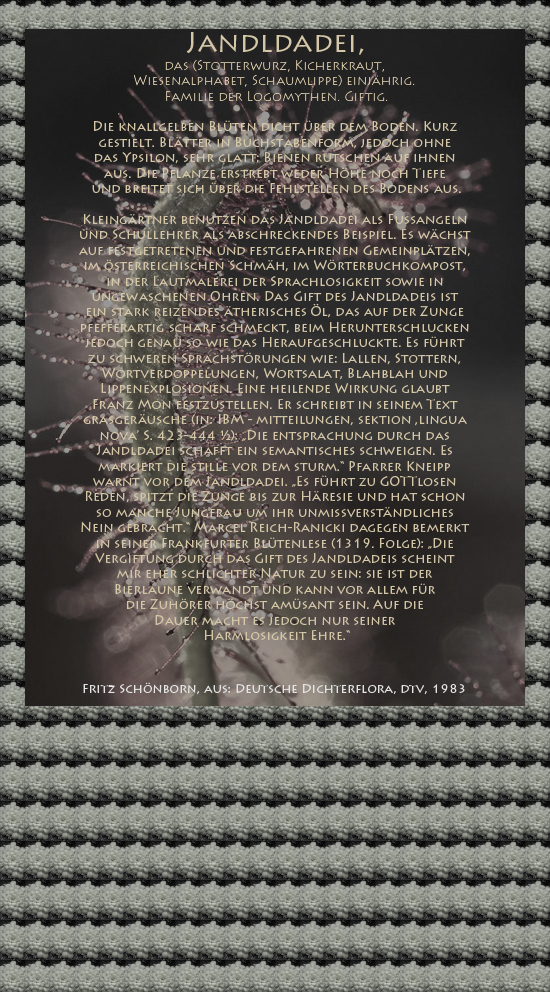












Schreibe einen Kommentar