Briefwechsel (mit Hermann Wallmann)
Lieber H. W., »… ach, wenn man wüßte«, so heißt es irgendwo bei der Achmatowa, »auf was für Mist Gedichte wachsen …«
Der Satz … oder ist’s ein Seufzer? … kann, denke ich, verallgemeinert werden, nämlich jeder Text, nicht nur der lyrische, auch Erzähltes, Dramatisches erwächst aus kompostiertem Grund.
Wie denn anders.
Literatur entsteht aus Literatur; Literatur besteht … wie oft ist es schon gesagt worden, wie oft muß es noch gesagt werden … aus Wörtern, und nicht aus Ideen, auch nicht aus Erfahrungen. Und … aber Wörter sind in aller Mund; in aller Mund werden sie um- und umgewendet und verdreht, in unsäglichen Kopulationen vermählen sie sich zu immer wieder neuen Lautgebilden und Bedeutungsbündeln. War’s nicht Mandelstam, der das Wort mit einem Stamm … nein, mit einem gotischen Pfeiler verglichen hat, von dem aus in zahllosen Verzweigungen das Gewölbe sich aufbaut. Nur ist es … naturgemäß … so, daß der alltägliche, der automatisierte, also besinnungslose und erinnerungslose Wortgebrauch jeweils bloß die oberste, die jeweils jüngste, eben die aktuellste Bedeutungsschicht … die noch dampfende letzte Ablagerung auf dem gigantischen Misthaufen der Sprache … berücksichtigt. Vergessen wir dabei, und nur die Poesie erinnert gelegentlich daran, daß die Sprache ein Erinnerungsdepot darstellt, dessen Reichtum und Reichweite alles umfaßt, was wir überhaupt denken, sagen, schreiben können. So verstanden ist jeder Text und ist auch jedes Wort ein Zitat, und als solches … auch diese Metapher stammt von Mandelstam … wird’s zur »Zikade«, durchwirkt es als lebendiger Klang in stetig wechselnden Modulationen alles je Geschriebne. Das Wort, das Zitat, das literarische Werk existiert noch bevor es … im Text, als Text … lesbar (gemacht) wird; jeder Text ist, als ein virtueller, vorgegeben … der Autor schafft ihn nicht, er ruft ihn wach und hält ihn fest in der Schrift. Schriftstellerei. Und also ist der, der die Schrift stellt, nicht zu verwechseln mit dem, der spricht; der sich ausspricht durch den Text. Denn Subjekt des Texts … und auch dessen einzige tragikomische Heldin … ist die Sprache.
Wer schreibt, muß gelesen, muß gelernt haben, was vor ihm da war. Der Schriftsteller ist der Konservative par excellence, der Nachfahrende, der Nachtragende, festzumachen nur an den Texten, aus denen sein Text … als Misch- und als Miststück gewissermaßen … entstanden ist. »Zitierte Autoren und unzählige Anspielungen« … das sind, nach Michel Foucault, »die Personen«, die den Text aufsagen, »den Text, den sie anderswo, in andern Büchern, auf andern Bühnen anders gesprochen haben, der aber nun hier gespielt wird«; und wenn Foucault, mit Bezugnahme auf Deleuze, das Buch als ein »wundersames Theater« bezeichnet, »in dem die stets wieder neuen Differenzen, die wir sind, die wir machen, zwischen denen wir herumirren, gespielt werden«, so ist damit nicht zuletzt auch unser Buch charakterisiert … »Erinnerung, sprich«; das Buch, mit dem Vladimir Nabokov weniger sich selbst als vielmehr dem ganzen familiären und literarischen »Mist«, aus dem er, als Autor, hervorgegangen ist, ein filigranes Denkmal gesetzt hat. [Vladimir Nabokov, Erinnerung, sprich (Wiedersehen mit einer Autobiographie). Deutsch von Dieter E. Zimmer. Rowohlt Verlag, Reinbek 1991.] Und so ist es denn auch kein Zufall, daß am Anfang dieses Buchs nicht nur der frühkindliche Spracherwerb noch einmal, im Nachvollzug, vergegenwärtigt wird, sondern auch … in geradezu alttestamentarischer Ausführlichkeit … die Genealogie einer weitverzweigten Sippe, als deren letzter Sprößling … und in deren uraltem Namen … Nabokov das ererbte Wort ergriffen hat. Laß uns also, davon ausgehend, korrespondieren!
F. P. I.
Lieber F. P. I., nein, ein »filigranes Denkmal« ist Nabokovs Erinnerungsbuch nicht, zumindest dann nicht, wenn unter Denkmal der marmorne Antipode jeglicher Form von »performance« verstanden wird. Die »verwickelte Textgeschichte«, über die Dieter E. Zimmer in seinem Nachwort berichtet, ist weniger eine Geschichte der Veränderungen und Erweiterungen als eine Geschichte des Wieder-Sehens, des Wieder-Hörens: Nabokov hat gewußt, was er tat, als er seiner letzten »Fassung« (was ja auch den »Rahmen« etwa von Brillengläsern meint!) den Untertitel »An Autobiography Revisited« gegeben hat. Die Sprache der Erinnerung ist, du hast es gesagt, die Erinnerung der Sprache, der, so setze ich fort, der Autor Auge und Ohr »leiht«. In einem Brief vom 14.12.1948 an seinen Lektor John Fischer bezeichnet Nabokov sein Buch als eine »Recherche über die Elemente, die zusammenkamen, meine Persönlichkeit als Schriftsteller zu formen«, und er bedauert die ökonomisch bedingte »ruckhafte Entwicklung des Thomas«: »Der Fluß des mir vorschwebenden Buches wäre geräumiger und getragener, als es die scharfen kleinen Stücke, die für den Zeitschriftenabdruck herausgeschnitten wurden, nahelegen könnten.« Auf dem Weg von »Conclusive Evidence – A Memoir« (New York, 1951), einem Titel, der Nabokovs (kontrafaktische) Souveränität über die Vergangenheit ausdrückt, über das bittend sensible »Speak, Memory – A Memoir« (London, 1951), das in seinem Untertitel freilich noch Gewißheiten »wachen« läßt, bis zu »Erinnerung, sprich. Wiedersehen mit einer Autobiographie« (1967) scheint Nabokov sich dessen inne geworden zu sein, was Du über die Virtualität der Texte ausgeführt hast. (Oder vielmehr: Er hat es immer unmißverständlicher angezeigt.)
In seinem Vorwort zur Ausgabe letzter Hand hat Nabokov deinen Gedanken, der Schriftsteller sei der »Nachfahrende, der Nachtragende« par excellence, mit dem die Struktur betreffenden Bild des auszufüllenden Kreuzworträtsels »vorweggenommen«, nachdem er in seinem Brief mit dem ihm vorschwebenden Fluß ein Bild für das Ganze gegeben hatte: »Obwohl ich diese Kapitel in der erratischen Reihenfolge niederschrieb, die sich in den (…) Daten der Erstveröffentlichung widerspiegelt, hatten sie in meinem Geist schon vorher hübsch in numerierte Lücken gepaßt, die der jetzigen Kapitelfolge entsprachen. Diese Ordnung war 1936 bei der Legung des Grundsteins etabliert worden, der in seiner versteckten Höhlung bereits verschiedene Landkarten, Fahrpläne, eine Sammlung von Streichholzschachteln, eine Scherbe rubinroten Glases und wie mir jetzt klar wird auch die Aussicht von meinem Balkon auf den Genfer See enthielt, auf seine Wellen und Lichtschneisen, heute zur Teestunde von Wasserhühnern und Haubenenten schwarz getüpfelt.« (Herrlich, wie »durchsichtig« das »Ding« aus dem Jahr 1936 als Nabokov, staatenlos, in Berlin lebte für den Genfer See des Jahres 1966 ist: Und wie Lichtschneisen den gleichen materialen Status bekommen wie Landkarten und Glasscherben! Und daß dieses »Wie mir jetzt klar wird« keinen intellektuellen, sondern einen physikalischen Prozeß meint: Nabokov ist Nabokov ist Nabokov.
Die vor uns liegende Ausgabe indes trägt, gemessen an der Vitalität der Entstehungsgeschichte, alle Züge einer Petrifizierung. Und dennoch möchte ich sie nicht missen. Ihr Apparat, der neben dem editorischen Nachwort einen Anhang mit Briefzitaten, einen weiteren mit abweichenden Textstellen der russischen Fassung, einen dritten mit Passagen aus der französischen Urfassung des 5. Kapitels (Mademoiselle O) enthält und einen vierten mit Photographien aus dem Jahr 1990, die dokumentieren, was von Nabokovs Kinderstätten »geblieben« ist dieser Apparat stellt für mich tatsächlich einen Apparat dar, eine Maschine, die es mir ermöglicht, die ursprüngliche Bewegtheit, das ursprünglich Organische, den »Mist«, wie die Achmatowa sagt, die »Zikade«, wie Mandelstam sagt, zu rekonstruieren, d.h. wiederzubeleben. Alles gegen den positivistischen Biographismus! Aber was mich dann doch elektrisiert hat, ist das von Zimmer beigebrachte Photo von Walentina (Ljussa) Schulgin, der »Tamara« der Memoiren, der »Maschenka« des ersten Romans: Läßt sich an diesen, will ich mal sagen: Aggregatzuständen einer Figur studieren, wie Nabokovs »Schrift-Stellen« funktioniert? Was meinst du?
H. W.
Lieber H. W., ich hatte in meinem ersten Brief, versuchsweise, so etwas wie ein argumentatives Trampolin entworfen, von dem aus verschiedene Volten und Absprünge möglich sein sollten; nun muß ich wohl, einen nach dem andern, jene Punkte ansteuern, bei denen du gelandet bist. Da ist zum ersten das »filigrane Denkmal« … mein Vergleich mit Nabokovs Text; du kannst offenbar nichts anfangen damit. Mir gefällt das Bild, es überlagert sich mit der Vorstellung eines locker geschichteten Misthaufens, aus dem die würzigsten Düfte und Dämpfe steigen, eines »Denkmals« also, das ohne Sockel auskommt, das keinerlei darstellerische, keine repräsentative Funktion hat, das eben eher einem Texthaufen gleicht, der vom Leser verzettelt werden muß, damit seine Energien sich ausleben, sich in dieser oder jener Lesart konkretisieren können. Und gerade weil Nabokovs Erinnerungsbuch so »filigran« angelegt ist, so viele Leerstellen offenläßt und entsprechend viele Durchblicke freigibt, ermöglicht es auch eine Vielzahl von Lektüren, deren vordergründigste … die autobiographische … mich eigentlich am wenigsten interessiert. Nabokovs »Denkmal« sollte für den Leser ein Imperativ sein … Denk mal! Und sieh mal einer an, was aus einem Leben werden kann, wenn es, geschrieben, im Buch steht: »Alles ist, wie es sein sollte, nichts wird sich je ändern, niemand wird jemals sterben.« Von daher gewinnt die Gattungsbezeichnung »Autobiographie«, die Nabokov im Untertitel zu seinem Erinnerungsbuch verwendet, eine neue semantische Dimension … die Autobiographie steht hier nicht mehr nur für ein rekapituliertes Leben, vielmehr ist sie identisch mit dem, was der Autor … selbst … sich als sein Leben erschaffen, erschrieben hat. Die Autobiographie, so verstanden, ist eher ein Lebensentwurf als ein Lebensfazit, und die Erinnerung, von der bei Nabokov und in bezug auf Nabokov so oft die Rede ist, erweist sich als eine spezifische Art literarischer Erfindung; der Autor, schreibend auf der Suche nach sich selbst, findet zu seiner Identität, indem er sie … mithin sich … erfindet. Schon immer wollte Nabokov seinen Namen in goldenen Lettern irgendwo an gut sichtbarer Stelle eingraviert sehen; ein Wunsch, der durchaus dem Grandiositätsbedürfnis eines Autors entspricht, dessen Werk als eine einzige, über Tausende von Seiten sich hinziehende Grabinschrift angelegt ist, die ihn überdauern, zugleich ihn am Leben erhalten sollte.
Erinnerung, ich wiederhole es, wird bei Nabokov als Erfindung praktiziert, und von daher kann ich deine Faszination angesichts der »echten« Tamara, der »wahren« Maschenka, wie sie nun im vorliegenden Band anhand einer bislang unbekannten »historischen« Photographie vorgeführt wird, nicht teilen, bleibt doch das Bilddokument weit hinter Nabokovs literarischem Portrait zurück, sowohl was dessen Aura, wie auch was dessen Authentizität betrifft; »wahr« ist nicht, was damals war, wahr ist einzig das, was in der Erinnerung noch heute gegenwärtig ist, auch wenn es sich im Lauf der Zeit durch seine permanente Neuerfindung weitgehend verwandelt, sich verselbständigt hat. Nabokov selbst spricht ja von den »sorgsam gereinigten Linsen der Zeit«, die das Vergangene in immer wieder anderm Licht erscheinen lassen, wenn es … jedesmal: jetzt! … jäh aufblitzt beim Schreiben, beim Lesen des Texts. Und was jenes photographisch »festgehaltene «Mädchen betrifft, so mag ich sie lieber als ein Wesen aus Wörtern und Lettern denn als wirklichkeitsgetreues Konterfei; nicht sie, die »wirkliche« Walentina Schulgin, sondern all jene nymphenhaften Tamaras etc., die aus Nabokovs Erinnerungen hochtauchen, sind doch die Puppen, aus denen schon bald sein schönster Schmetterling, Lolita, entstehen wird.
Natürlich kannst du nun einwenden, Nabokov selbst habe die Photodokumentation in seine Autobiographie aufgenommen, um gewisse Reminiszenzen zu präzisieren und zu dokumentieren. Stimmt. Künstlerisch wars gleichwohl ein Fehlgriff; und außerdem steht es in Widerspruch zur oftmals wiederholten Feststellung des Autors, wonach generell »in der Fiktionalisierung ein kräftigeres Extrakt persönlicher Realität enthalten« sei als in jeder noch so skrupellosen Dokumentation, und nie habe er glauben mögen, »daß eine schmissige Imitation imstande sein sollte, mit der schlichten Wahrheit zu wetteifern.«
Nur die Erfindung, nicht die Erinnerung und auch nicht das zeitgeschichtliche Dokument wird der »Wahrheit« gerecht. Selbst Mademoiselle O, die von allen Figuren in Nabokovs Autobiographie die höchste Lebensechtheit mitgekriegt zu haben scheint, ist letztlich nichts anderes … niemand anderes … als ein Wortwesen, verdichtet, reduziert auf den Buchstaben oder die Ziffer O … eine triviale Marquise von O, vielleicht auch einfach eine Null? »Ich glaubte«, so schreibt Nabokov in der französischen Fassung des Texts, »es würde mich erleichtern, von ihr zu sprechen, und nun, da es getan ist, wird mir seltsam zumute, so als hätte ich sie in allen Stücken erfunden, ganz wie die anderen Personen meiner Bücher. Hat sie wirklich gelebt? Nein, wenn ich jetzt recht darüber nachdenke sie hat nie gelebt …« Doch sie lebt weiter im Text; erst heute wieder bin ich ihr begegnet. Jede Lesart ist wohl auch eine Lebensart.
F. P. I.
Lieber F. P. I., vielleicht sind ja hinkende Vergleiche die letzten Reservate eines Enthusiasmus, den Ludwig Marcuse einmal als bengalische Beleuchtung der Seele definiert hat. Vladimir Nabokov hat Biographien erfunden, klar, und er hat seine Autobiographie erfunden, präziser, weil im besten Sinne dubioser: fingiert. Aber du sprichst selbst von einer »spezifischen Art literarischer Erfindung« und eben das Spezifische ist es, was mich interessiert. Reich-Ranicki hat von erfundenen Wahrheiten gesprochen. (Bei) Nabokov geht es nicht einmal um erfundene Wirklichkeiten, sondern, lediglich, um Wirklichkeiten qua Erfindung da gebe ich dir in allem recht. Aber mir liegt an dem Unverwechselbaren! Daß nur die Fiktion Vergegenwärtigungskraft und -herrlichkeit besitzt, das trifft, mit Verlaub, bei Luise Rinser genauso zu. Liegt Nabokovs Exorbitanz lediglich darin, daß er »besser« erfindet, oder gar nur darin, daß er besser »schreibt«? Was sind das für spezifische Transformationen (wenn ich von der zauberischen ersten, die den Augen-Blick einer Frau aus Fleisch und Blut auf die photographische Platte »gebannt« hat, sogar noch absehe): die eine Transformation von Ljussa Schulgin in die »fiktive« Maschenka (um der Diskretion willen oder aus methodologischem Kalkül), die (qualitativ) andere Transformation jener Ljussa oder dieser Maschenka in die »autobiographische« Tamara und dann die (potenziert) dritte Transformation dieser einen (oder des Duos oder des Trios) in die Ultima Lolita …
Dein Reklamieren der als Erfindung praktizierten Erinnerung scheint mir die Komplexität der Nabokovschen Materialbehandlung zu reduzieren auf eine juristifizierbare Vorbemerkung nach dem Muster der »rein zufälligen« Ähnlichkeit zwischen dem Romanhelden und einem Roß nebst Reiter. Im Mademoiselle O-Kapitel muß es Nabokov (oder, um auf deinen Schreibheft-Aufsatz anzuspielen:) Nabokovs Autor bedauern, »daß jeder mir teure Bestandteil meiner Vergangenheit, mit dem ich die Figuren ausgestattet habe, in der künstlichen Welt, der er sich so unvermittelt ausgesetzt fand, unweigerlich verkümmerte. Obwohl er in meinem Geist fortlebte, hatte er seine persönliche Wärme, seinen retrospektiven Charme eingebüßt, und fortan war er meinem Roman enger zugehörig als meinem früheren Selbst, wo er dennoch einst vor der Zudringlichkeit des Künstlers so sicher schien.« Aber im Tamara-Kapitel dann – 13 Jahre später entstanden, jetzt aber nur mehr 215 Seiten von der zitierten Stelle entfernt und von der 1966er Ausgabe gleichsam syn-chronisiert – findet sich ein ganz anderes Bedauern: »Glücklich der Romancier, dem es gelingt, einen echten Liebesbrief aus seiner Jugend in einem Roman aufzubewahren, wo er wie eine saubere Kugel in schlaffem Fleisch eingebettet liegt und zwischen fiktiven Existenzen völlig sicher ist.« Was denn nun? Oder ist Vladimir Nabokov ein Gott, der die kontrafaktisch »aufgehende« Sonne genauso beleidigen darf wie die Erfindung des Kopernikus?
Lieber F., gestatte mir, daß ich demonstrativ noch einmal zu dem Mademoiselle O-Kapitel zurückkehre, in dessen letztem Abschnitt Nabokov das Geheimnis seiner Kunst so apotheotisch verschweigt. Während eines nächtlichen Uferspaziergangs am Genfer See sei er eines alten Schwans ansichtig geworden, der sich vergeblich bemühte, in ein vertäutes Boot hineinzuklettern: »Das schwere, ohnmächtige Flappen seiner Flügel, das schlüpfrige Geräusch, das sie an dem schwankenden und plätschernden Boot machten, der klebrige Glanz der dunklen Wogen, wo der Lichtschein sie traf – all dem schien für einen Augenblick jene seltsame Bedeutung eigen, die in Träumen bisweilen einem Finger zukommt, der an stumme Lippen gedrückt wird und dann auf etwas hinweist, das der Träumer nicht mehr zu erkennen vermag, ehe er aus seinem Schlaf hochfährt.« Und dann bringt Nabokov diese naturalistische Allegorie in eine Beziehung zu seiner Mademoiselle, ausgerechnet nachdem er sich gefragt hat, ob er sie wirklich »aus der Dichtung« (!) »gerettet« (!) habe. Er fürchtet, ihm sei etwas entgangen, das jenem Schwan verwandt ist, »dessen Qual künstlerischer Wahrheit so viel näher kam als die bleichen Arme einer niedersinkenden Tänzerin.«
H. W.
Lieber H. W., man möchte im Gespräch über Nabokov immer nur … nicht wahr? … zitieren; wir zitieren, wenn wir zitieren, aus Liebe, du tust es reichlich, und manches von dir angeführte Zitat kommt mir, im Kontext deiner Überlegungen, »wie neu« vor, jedenfalls ganz anders, als ich es grade eben noch in Erinnerung hatte. Es gibt bei Nabokov … und generell bei starken Autoren … keine vorgefaßte und ein für allemal festgelegte »Wahrheit«, mithin kann es auch keine, das heißt nicht bloß eine verbindliche Leseart geben. Viel eher wird es doch so sein, daß die Gesamtheit der Lesearten, die ein Autor … ein Text ermöglicht, identisch ist mit dem, was als dessen künstlerische »Wahrheit« gelten kann, eine Wahrheit, die weder zu beweisen noch zu widerlegen ist, eine veränderliche, stetig sich wandelnde und sich erneuernde Wahrheit, welche nicht mehr Sache des Autors sein kann, sondern vom Leser … dem einzigen beweglichen, auch austauschbaren Element im triadischen System von Textproduzent-Text-Textrezipient … individuell verantwortet wird, indem er auf den Text, so oder anders, Antwort gibt. Und diese … unsre Antwort ist denn auch die »Wahrheit« des Texts.
Was wir zu Nabokovs Erinnerungen sagen können, ist letztlich nichts anderes als das, was durch sie, als Text, sich ausspricht, indem wir, lesend, darauf antworten.
Folglich kommt es, lieber H. W., auch gar nicht darauf an, ob Nabokov besser schreibt als Ljussja Rinser; die Qualität des Texts ist weit weniger durch den Autor als durch jenen kollektiven Leser bestimmt, der ihm kraft seiner Lektüre zum Überleben verhilft. Frau Rinser mag eine gute, eine schlechte Autorin sein. Tatsache ist, daß sie heute zu den Erfolgreichen gehört, und hierzulande wird sie wohl weit mehr gelesen als Nabokov; Tatsache aber gewiß auch, daß sie schon morgen, im Unterschied zu Nabokov, vergessen sein wird, weil ihre Texte immer bloß eine Leseart zulassen, nämlich jene, die der auktorialen »Aussage« entspricht.
Luise R. legt den Leser auf ihre Wahrheit fest, wohingegen Nabokov ihm die Wahrheitsfindung oder Wahrheitsbildung überläßt. Nabokovs Texte funktionieren auch dann richtig, wenn sie falsch gelesen werden, sie sind gegen Mißverständnisse nicht nur resistent, sie fordern sie geradezu heraus und gewinnen dadurch zusätzlich an Bedeutung. Beispiel »Lolita«. Man kann das Buch als philosophischen Roman, als Kriminalroman, als Liebesroman, als Reiseroman, als Pornoroman lesen, und in jeder Leseart … auch in der von Nabokov nicht beabsichtigten, womöglich sogar explizit abgelehnten … stimmt der Text.
Nabokovs Buchwerke könnte … sollte man vielleicht mit großen Orgeln vergleichen, auf denen ein und derselbe Text je nach Registrierung auf immer wieder neue Weise durchgespielt, interpretiert werden kann. Die interpretative Variationsbreite bildet das Sinnpotential des Texts, und dieses Sinnpotential wird umso reicher, je weniger der Autor den Leser durch vorgegebene außerliterarische Fakten, die objektiv verifizierbar sind, auf eine bestimmte Lektüre festlegt. Eine solche Festlegung bewirkt Nabokov in seinem Erinnerungsbuch dadurch, daß er den Text durch die Beigabe einer umfänglichen Bilddokumentation, vor allem durch Photos aus dem Familienalbum, »realistisch« … eben auf die dokumentarisch belegbare Wirklichkeit hin … perspektiviert und somit eine einfältige Leseart geradezu erzwingt. Ich empfinde dies, wie bereits in meinem zweiten Brief ausgeführt, in künstlerischer Hinsicht als fragwürdig, und ich kann deshalb, nach wie vor, auch deinem Lieblingsbildchen, dem nachträglich von Herausgeberseite beigebrachten Photoportrait »jener Ljussja«, keinen Reiz und schon gar keine Faszination abgewinnen.
Nabokovs Erinnerungsbuch, darin sind wir uns doch wohl einig, ist mehr als ein Buch der Erinnerung; es ist auch ein Buch über die Erinnerung und deren Funktion als Generator künstlerischer Kreativität, und es ist, auf jeweils andern Registern, zu lesen als ein Buch über Rußland und Europa, über Tradition und Revolution, über Liebe und Entsagung, über Literatur und Leben, über Heimat und Exil. Das sind große, oft behandelte, allgemein bekannte Themenbereiche; doch bei Nabokov liest sich alles wie zum erstenmal. Die bleibende Frische seiner Texte ist dadurch garantiert, daß er sich, worüber auch immer er schreibt, ganz von seiner subjektiven Wahrnehmung leiten läßt … wissend, daß Wahrnehmungen nicht falsifizierbar und in der Regel sehr viel länger haltbar sind als noch so »ewige« Wahrheiten. Nie werden Nabokovs Bücher verjährt sein; die Zeit kann ihnen nichts anhaben, da sie weder in Abhängigkeit von der Zeit noch in Übereinstimmung mit ihr geschrieben wurden. Schreibend widersetzt sich Nabokov der Zeit als Geschichte; er widersetzt sich der Vergänglichkeit ebenso wie der Utopie einer machbaren lichten Zukunft. »Ich gestehe, ich glaube nicht an die Zeit«, stellt er in seinem Erinnerungsbuch fest. »Und am meisten«, so fügt er bei, »genieße ich die Zeitlosigkeit, wenn ich … unter seltenen Schmetterlingen und ihren Futterpflanzen stehe. Das ist Ekstase, und hinter der Ekstase ist etwas anderes, schwer Erklärbares. Es ist wie ein kurzes Vakuum, in das alles strömt, was ich liebe. Ein Gefühl der Einheit mit Sonne und Stein. Ein Schauer der Dankbarkeit …«
F. P. I.
aus: Felix Philipp Ingold: Freie Hand
Ein Vademecum durch kritische, poetische und private Wälder


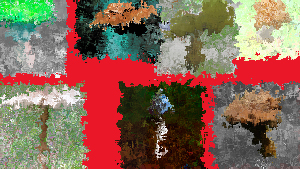






Schreibe einen Kommentar