Lektüre
Wer liest, schafft sich im Akt des Lesens seine eigene Zeit, eine Art Zwischenzeit, für die es keine Agenda, keinen Kalender gibt. Die Zeit des Lesens ist eine Zeit der Weltabgewandtheit, zugleich die Zeit intensivster Hiesigkeit; man ist, wenn man liest, weitab vom lebensweltlichen Getriebe und doch ganz bei der Sache der Dichtung; also soll der Leser, wie schon Petrarca in seinem Brief an Francesco Nelli … im Sommer 1352 … es gefordert hat, »die Last der Geschäfte und die Sorge um seine Privatangelegenheiten von sich werfen und seinen Sinn auf das richten, was er vor Augen hat«.
Was man, lesend, vor Augen hat, ist nichts anderes als der buchstäbliche Text, ist das, was geschrieben, gedruckt dasteht … hier auf dem Blatt, hier auf der Buchseite … Wörter, Wörter, lauter Wörter, die vernommen werden wollen als ein Sagen und ein Gesagtes zugleich, letztlich als etwas Sagenhaftes, das seinen eigenen Wirklichkeitsstatus hat; etwas, das die äußere Wirklichkeit nicht bloß wiederholt, indem es sie, wie auch immer, darstellt, etwas Sagenhaftes vielmehr, worin Wirkliches gewissermaßen in der Möglichkeitsform … als ein Werdendes … sich darbietet. Aus dieser Möglichkeit, aus solchem Werden kann der Leser, falls er den Verstehensschritt ins Offene wagt, einen Sinn gewinnen … seinen Sinn, der mehr wäre als das, was der Autor von sich aus jeweils zu sagen vermöchte.
Wenn dem Leser … so fährt Petrarca in seinem Schreiben fort … »diese Bedingung nicht paßt«, solle er von seinen »unnützen Schriften fernbleiben«. Und abschließend betont er: »Ich will nicht, daß er sich zugleich mit Geschäften befaßt und sich mit mir abgibt, ich will nicht, daß er völlig ohne Mühe in sich aufnimmt, was ich nicht ohne Mühe geschrieben habe.«
aus: Felix Philipp Ingold: Freie Hand
Ein Vademecum durch kritische, poetische und private Wälder


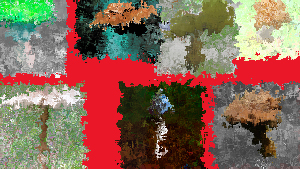






Schreibe einen Kommentar