Weihnachten
Nach langer Krankheit ist heute G. P. gestorben … Schriftsteller, bekennender Atheist, ständig auf Reisen, auserwählt von vielen Frauen, zu haben nie; er war acht Jahre jünger als ich, ein Freund, wir sahen uns selten. G. P. gehörte zu den Menschen, dem Nähe … für mich, zu mir … bestimmt war durch ihre Abwesenheit. Jedesmal, wenn wir uns trafen … und wir trafen uns, immer aus Zufall, vielleicht zwei-, dreimal jährlich … war’s ein Fest, es war das, was sich gehörte, es war das, was uns gehörte. Nie mußten wir einander berichten oder erklären, was inzwischen gewesen, geschehen, was aus uns geworden war; das Gespräch brauchte gar nicht erst in Gang gebracht zu werden, es ging einfach weiter. Und es ging auf die gleiche Weise weiter auch dann, als er schon krank war; als er nicht mehr reisen, kaum noch essen, kaum noch atmen konnte; als er wußte, daß die Krankheit, er hatte Krebs, ihn erledigen, innert ein paar Monaten ihn aushöhlen, aushungern würde. Dreimal hatte man ihn operiert, der Kehlkopf, die Stimmbänder, zuletzt auch die Zunge wurden entfernt, am Hals klaffte ein ständig blutendes Loch, drin stak eine Kanüle, durch die sein Atem, nichts mehr als Durchzug, pfiff; pfiff. Nur einmal hatte ich ihn in dieser Zeit getroffen, kurz zuvor war er, nach der zweiten Operation, aus der Klinik entlassen worden, mußte aber in Zürich bleiben, mehrmals wöchentlich wurde er bestrahlt. G. P. lebte mit einer sehr jungen Frau, Studentin der Theologie, beim Römerhof in einer Anderthalbzimmerwohnung, sprechen konnte er nicht mehr, er versuchte sich mit Grimassen, mit fuchtelnden Armbewegungen verständlich zu machen, wirkte wie ein Ertrinkender; manchmal, wenn er ruhiger wurde, schrieb oder zeichnete er, was zu sagen war, auf eine kleine Magische Tafel, um es dann mit einer knirschenden Ritsch-ratsch-Bewegung sofort wieder zu löschen.
Überwindung von Schwierigkeiten durch Häufung derselben. Ich glaube, das war damals der erste Satz, den G. P. mit seinem stumpfen Griffel auf das Täfelchen schrieb, worauf er mir dieses wie einen Handspiegel nah vor’s Gesicht hielt; er lachte.
Ach, sagte seine Freundin; zum Beispiel gestern sei es so gewesen, daß in der Straßenbahn, mit der sie und G. zur Klinik unterwegs waren, bei einer Fahrkartenkontrolle ein Afrikaner von einem Beamten rassistisch verunglimpft und körperlich bedroht worden sei, weil er kein Ticket vorweisen konnte, ein Vorgang, über den G. sich derart aufgeregt habe, daß er laut zu protestieren begann, dabei aber, wohl ohne sich dessen bewußt zu sein, nur ein hilfloses Schnauben von sich gab.
Jetzt hat G. P. ausgeschnaubt. Die meisten jener knappen Sätze, die er bei unserm letzten, durch seine Stummheit behinderten Gespräch für mich auf der Magischen Tafel notierte und die er auch gleich wieder zum Verschwinden brachte, habe ich vergessen; doch einer ist mir im Gedächtnis geblieben: Als ich noch reden konnte, liebte ich das Schweigen. Und auch dieser: Bin eher vom Leben geheilt als vom Tod. Und immer noch einer fällt mir nun ein. Die Sprache des Schweigens kennt jeder, aber keiner wagt sie zu brauchen, weil keiner sie gelernt hat. Und zuletzt: Ich bewohne nur noch meinen Schatten, er ist mein Reisemobil.
Oder vielleicht wollte G. P. sagen … mein Reiseziel; dann wäre er seit heute bei sich. Was für ein Ende. Welches Erwachen.
aus: Felix Philipp Ingold: Freie Hand
Ein Vademecum durch kritische, poetische und private Wälder


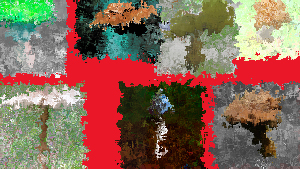






Schreibe einen Kommentar