François Villon: Baladn
GRABSCHRIFT:
in dieser etage hier schläft und rastet einer,
ein armer kleiner student, der amor in den pfeil lief –
françois villon hieß er.
vollkommen darnieder war er, kein streifchen erde
aaaaagehörte ihm,
aber trotzdem verschenkte er alles, wie jedermann
aaaaaweiß:
den tisch, das bett und sogar das brot samt dem körbchen.
ich bitte euch alle, die ihr verliebt seid,
betet für ihn wie folgt:
gebet:
herr, gib ihm die ewige ruhe
und das ewige licht dazu!
sei teller war immer leer,
seine speise ungefähr
nicht größer wie eine grille,
nicht ein stielchen petersilie
sah er in seinem leben,
es ist klar, daß er deswegen
wie ein rettich war,
ein abgeschälter – nicht ein haar
auf dem kopf, kein bart, keine brauen –
ein gelächter für die frauen.
herr, gib ihm die ewige ruhe!
ins exil wurde er gejagt
mit arschtritten, mehr als zu viel,
und er protestierte..
wen aber kümmerte das?
herr, gib ihm die ewige ruhe!
GROBSCHRIFT:
in dera etasch doda schloft und rost ana,
a r oama glana schdudent dea wos in AMOR in pfäu grend is –
françois villon hod a kassn..
bedind woa r a, kaa schdraffal eadn hod eam kead,
owa drozzdem hod a r olas faschengt (wia r a jeda was):
en disch, es bet und s brod sogoa mezzaumt n keawal!
i bit eich ole, wos s faliabt seit s,
bet s fia r eam wia foigt:
gebet:
herr, gib eam d eweche rua
und s eweche liacht dazua!
sei döla woa r ima leea,
sei essn ungefeea
ned gressa r oes a grüü,
kaa schdammal bedasüü
hod ea sei lem ned xeng,
gaunz gloa, das ea dessweng
oes wia r a radi woa –
a gschöda –. ned a hoa
aum kopf, kaa boad, kaa braun –
a glachta fia de fraun..
herr, gib eam d eweche rua!
gjaugt haum s eam ins exüü
med oaschdrit, mea r oes z füü –
und ea hod brotestiad..
wem hot des scho scheniad?
herr, gib eam d eweche rua!
Proteus mit der Chrysantheme
Wer es in romantischem Schwarm für einen richtigen Dichter nicht lassen kann, auch jedes Buch und Büchlein seines Lieblings in die Hand bekommen zu wollen, und es nicht nur mit Hand und Auge, Hirn und Herz erfassen, sondern sogar Äußerungen darüber zu Papier bringen will, der muß sich alleweil sputen. Denn bei H.C. Artmann holt nun in den letzten Jahren ein Buch das andere, und ein Verlag um den anderen holt Artmann – das ist wie am Schluß von Faust I: Der Satan schreit „Her zu miiir“, aber seinem Opfer ist das Himmelreich doch sicher. Nach vielen kleinen Vorhöllen wie den Verlagen Otto Müller, R. Piper, Wilhelm Frick, H.F. Kulterer, Walter, Rainer, Collispress, Residenz, Hartmann, U. Ramseger, Rowohlt und (für Schallplatten, gesprochen von Qualtinger) Preiser-Records scheint Artmann sich jetzt, endgültig, Suhrkamp-Insel als Quartier gewählt zu haben.
Für die Insel hat er schon seit 1963 die eine und andere Übersetzung aus etlichen Sprachen gearbeitet, sein neuestes Buch ist nun auch ein Insel-Büchlein mit Villon Baladn. In Wiener Mundart (und deutscher Übersetzung links daneben, wo sonst das Original steht). Es sind auch „Erläuterungen“ beigegeben, die uns unter anderem einführen in die „wiener geheimsprache, deren system in der umstellung von silben besteht, sowie einer vorsetzung von o und einer e-endung. Zum Beispiel goling (galgen) ling-go, o ling (o)e.“ Was würde also „oarisbe“ (Villon: Parouart) heißen? Es heißt: Paris. Einen Ausdruck wie das untertreibende „heimadschein“ erläutert der Dichter feinsinnig so: Es ist „das messer, mit dem man jemanden seiner letzten bestimmung zuführt“.
An kleinen Freuden dieser Art ist das Insel-Buch Nr. 883 reich, an der großen Freude allerdings, Villon einmal besser, knapper, zutreffender übersetzt zu lesen, mangelt es denn doch. Allerlei Textstellen scheinen mir nutzlos ungenau beziehungsweise unvollständig übersetzt, gewissermaßen eingewienert oder poliert auf den Tonfall eines ennuyierten Strizzi. Es kann aber vielleicht gar nicht anders als ein bißchen herzig und lasziv, gruslig und heimelig zugleich geraten, wenn sich – wie Friedrich Polakovics sagte – die Wiener Vorstadt und der nichtbretonische Surrealismus paaren zum herausspringenden Dichter Artmann. Die wienerischen Baladn-Texte nach Villon sind daher eher als Appendix zu Artmanns Dialektgedichten der fünfziger Jahre anzusehen, zu med ana schwoazzn dintn, das 1958 erschien und Artmann berühmt machte, und zu hosn rosn baa, gemeinsam produziert mit Achleitner und Rühm – gedruckt 1959. Darum vermißt man etwas unerfreut, daß in der Villon-Auswahl so gar keine Bemerkung über die Absichten dieser Auswahl, über die Gründe für Textreduzierungen und vor allem über die Entstehung und Geschichte dieser Einwienerungen beigefügt ist.
Denn man erinnert sich, daß in med ana schwoazzn dintn die Angabe steht, die „Übertragung der balladen des françois villon in den wiener dialekt“ befinde sich „in vorbereitung“. Chotjewitz bemerkt in seinem Nachwort zur von ihm und Gerald Bisinger herausgegebenen „Festschrift“ für Artmann, Der Landgraf zu Camprodòn, seit Beginn der sechziger Jahre habe er ein halbes Dutzend Bücher übersetzt, unter anderem Villons Balladen, und tatsächlich ist ja auch 1964 eine Schallplatte mit diesen Übersetzungen, „gesprochen von qualtinger mit jazz von fatty george“, bei Preiser-Records in Wien erschienen. Möglicherweise sind die Texte noch überarbeitet und die Anmerkungen zusätzlich angemerkt worden: Aber das hätte man gern schon aus Insels Hand gewußt, insonderheit da es sich doch vor allem um eine Dichtung aus dem Wiener Gemüte, also um ein Primärwerk, und weniger um eine Übersetzung handelt. Vielleicht aber soll das Bändchen auch einen unauffällig eingerichteten Einführungskurs ins Wienerische für Reichsdeutsche bieten? Das Vokabelverzeichnis zur schwoazzn dintn hatte sein Dichter durch aparte Satzstellung so begründet:
Nachstehendes Wörterbuch ist vornehmlich jenen Wienern gewidmet, die, durch ein widriges Geschick ihrer Muttersprache entfremdet, anders des nötigen Verständnisses entbehren müßten.
Dem liebenswert polyglotten Artmann genügt aber seine Vielsprachigkeit nicht. Hatte er einst mit vergleichenden Sprachstudien angefangen, so ist später dem spielenden Dichter die Synthese beschieden gewesen: Der reichen Sprachspiel- und Geheimsudeleitradition der Gauner und Schreiber einen würdigen Beitrag anfügend, hat er viel Fremdklingendes zu Papier gebracht. Beispiele dafür druckte des öfteren die Wiener Zeitschrift Eröffnungen, seit Jahren ein wichtiges Auffangbecken für des Dichters dezentrierte Emanationen und eine unentbehrliche Ergänzung der Buchveröffentlichungen – so etwa 1966 (Nr. 18, 6. Jg.) die Arbeit „liebe kinder, laßt nur kein blut daneben rinnen!“ aus den „lappländischen texten“: „časka tuona häppo, mo kadsa kaskosid!, wirf mir wenigstens die finger zurück, du höllenhure!“ ruft die Mutter der mit den abgehackten Fingern im Schlitten davonfahrenden Tochter nach. Ob die den Lappen in den Mund gelegten Worte nun echt lappisch oder läppisch sind, habe ich nicht nachgeprüft. Poetisch betrachtet, ist das gleichgültig – oder auch nicht, wenn man recht überlegt. Denn für den Fall, daß das fremdsprachige Einsprengsel original ist, kann man immerhin anfangen, den so angestrebten Realismuseffekt vielleicht als Pop-Mittel zu interpretieren oder das Pop-Mittel als Realismus-Charge, und man könnte das Originale nicht bloß als das Originelle und das sprachliche Literatur-Varieté als eine Art „literature vérite“ ausklabüstern.
Gar türkisch, ohne es zu sein, sieht nun der Titel tök ph’rong süleng aus, der biblio- und graphophil in dreiklassiger Ausführung bei der Richard P. Hartmann Bibliothek, München, erschienen ist: der zu kleinen Grüppchen unter den Buchstaben des Alphabets sortierte Abenteuertext wurde, so heißt es, im Auftrag der Hartmann-Galerie geschrieben. Er scheint mir das geschickte und erfreuende Werbemittel eines Bilderverkäufers zu sein, der über den phantastischen Art-Mann seine Männer von der Ars phatastica ins Blickfeld der Press-Öffentlichkeit zu rücken versucht. Das mir vorliegende Exemplar der Volks- oder Sonderausgabe Dritter Klasse enthält 27 großformatige Abdrucke nach Lithographien und Radierungen; es sollte auch zwei Radierungen enthalten, die es aber nicht enthält. Die über zwanzig bildenden Künstler haben die abenteuerlichen Motive einer lykanthropologischen, das heißt werwölfischen oder wolfmenschlichen Forschungsexpedition in den Himalaja zu teils schier illustratorischen (Kurt Regscheck) und teils sehenswert ausschweifenden (Gisela Breitling) Bilderzeugnissen verarbeitet.
Mortimer Grizzleywold de Vere ist der Held der den Hinweisen eines „interessanten khanchuli-manuscripts des 18. jahrhunderrs“ folgt, einem deutschen Professor manches verdankt, die Fabel mit hinterasiatischem Kolonialflair der besseren alten Zeiten füllt und bricht, gebrochen khanchulisch redet und gänzlich die vielen geschlungenen Knoten wie angefangene Fäden fallen läßt – das alles auf eine parodistische Weise, die Artmann mit den Lesefrüchten seiner frühen Kinder- und mittleren Mannesjahre ironisch-romantisch bis sentimentalisch-sentimental aufgepäppelt oder auch aus ihnen zusammengebraten hat.
Artmann als der nimmersatte Proteus, der eklektizistisch alles sein kann, nichts eindeutig, aber eindeutig immer Proteus mit der Chrysantheme im Knopfloch – er hat auch auf seine Träume, aufs publikumsbewußte Traumbuch und Lottospiel, auf seine Anregungen aus – so schreibt der Verlag – Gaspard de la Nuit, Barocklyrik, García Lorca, Ghelderode, Commedia dell’arte, Comic strips, Trivialromanen und Dada, Volkslied und Märchen zurückgegriffen und „90 Träume“ zur Grünverschlossenen Botschaft zusammengestellt. Wunderschöne Kurzwaren der Poesie und langhergeholtes Zeug stehen da Seite um Seite nebeneinander, jeweils illustriert von dem Jugendstilverwerter Ernst Fuchs (82 Zeichnungen, 8 Radierungen). Während der Dichter seinen dreizehnten Traum selbst als einen „einfachen“ charakterisiert – denn: „Dreizehn beine auf einmal zu besitzen ist ein einfacher traum. Erhebe dich nimm deinen Schirm, spanne ihn dreizehn mal auf.“ –, lautet doch der einundzwanzigste unwiderruflich so:
Begegnet dir ein bärtiger chinese und bäte dich um messer und gabel, er hatte sein besteck zu hause in peking gelassen, und verwandelte sich dieser gelbe mann unmerklich in eine telefonwählscheibe, dann säume nicht, sondern wähle die zahlen zwo und eins, die glückbringende einundzwanzig.
Oswald Wiener hat, scheint mir, sehr treffend charakterisiert wenn er schreibt, Artmanns „poetische akte“ seien „riten eines zweifellosen monisten, poetisierungen oder besser mythisierungen eines selten schwankenden lebensgefühls“.
Wie bei allen seinen Büchern, so gilt auch für seinen Suhrkamp-Einstand Fleiß und Industrie: Mit Fleiß und einer frühindustriellen Behendigkeit, wie sie in alten Manufakturen Brauch gewesen sein mag, erstellt Artmann Text um Text. Seine Gestehungskosten sind gering, denn er erzeugt den Charme aus der wohlfeilen Inkongruenz von altbackenen Vorlieben und alltagsbackenen Realitäten – das nimmt man gern für Poesie. Brüsseler Spitze am Minimädchen, die Antiquität zwischen Knoll International und Miller Collection, Berufe mit dem exotischen Reiz eines aussterbenden „Bienenvaters“, eines „Bürstenbinders“, eines „Erzeugers von Tarockkarten“ naivisierend dargestellt angesichts der futuristisch behauchten Berufe von Programmierern und Elektronikbedienern oder auch der Entfremdungsopfer einer modernen Arbeitswelt – welcher Kunstgewerbefreund liebte das nicht?
Doch ist das immer nur eine Art Gratispoesie, die uns hier freundlich umfängt – ihre charmanten Stileigenheiten ergeben sich beiläufig aus dem adaptierten Tonfall älterer Fibeln, belehrender und moralischer Schriften, beflissener Konversationslexika und betulicher Taschenbüchelchen für die Jugend und erwachsene Weiblichkeit der vorletzten Jahrhundertwende – einem Tonfall also, einem Stil- und Denkgestus, der aus Österreich, dem Mutterland der Restauration, bis heute nicht gewichen ist.
Natürlich hat Artmann, obwohl wirklicher und geheimer Landgraf von Camprodòn, hierzu ein ironisches Verhältnis: bisweilen flippert er ein keckmodernes, ein kritisch funktioniertes Sätzchen in seine psalmen- und episodenhaft, jedenfalls achtfach gegliederten, prosagedichtigen Berufsporträts und kann darauf rechnen, daß der poetische Kalauereffekt dieser Privatliteratur schöne Schmunzelfunken aus den Leserlefzen schlägt. Hier wird geganghofert, aber kulinarisch mit Pfiff und Zwinkern, versteht sich. Was wäre auch heiterer als das wissende Spiel mit der Anspielung auf eine heile Welt, von der wir ja sicher sind, daß es sie heute nicht mehr gibt. Ironisch und sentimentalisch zugleich läßt unser Dichter sich auf die alte Fiktion ein, daß es sie früher einmal gegeben habe.
Wenngleich sich so das Kunsturteil über Fleiß und Industrie dahin summiert, daß dem Artmann die Poesie dieser Prosa gratis und franko aus den Zeilen läuft, indem er hauptsächlich die Klischees eines altspätzischen, meierlich-biederen Weltempfindens kompiliert – möchte man doch bekennen, daß der Meister der Dichtkunst selbst im Rahmen dieser bescheideneren Handwerksprobe mit der einen oder anderen Intarsie unwiderstehlich animierend wirkt.
Uwe Herms, Stuttgarter Zeitung, 20.4.1968
„gedichta r aus baris“ und
„Der abenteuerliche Buscon Teutsch“
– H.C. Artmann als Übersetzer Villons und Quevedos. –
I
Der französische Aufklärer Montesquieu hat in seinen Persischen Briefen den Verächtern von Übersetzern und Übersetzungen ein Bonmot in den Mund gelegt, mit dem man die Vermittler zwischen den Sprachen zu demütiger Selbsteinschätzung auffordern zu dürfen glaubte: „Seit zwanzig Jahren“, behauptet einer, „mache ich Übersetzungen“. „Wie mein Herr, antwortet der Geometer, seit zwanzig Jahren denken Sie schon nicht mehr?“1
Wie unrecht der arrogante Geometer hat, beweisen am besten die ausschließlich enttäuschenden Erfahrungen, die in unserem Jahrhundert mit der Computerübersetzung gemacht wurden. Auch die kompliziertesten Apparate sind einem halbwegs begabten Übersetzer so deutlich unterlegen, daß Anlaß genug besteht, vorteilhafter als Montesquieus Geometer von den intellektuellen Leistungen zu denken, die beim Transport eines Textes von einer Sprache in eine andere im Spiel sind. Es liegt in der Natur natürlicher Sprachen, daß das Übersetzen keine mechanische Tätigkeit sein kann; es ist, mit einem Modewort gesagt, ein höchst kreativer Prozeß. Dies gilt für alle Arten von Übersetzung, selbst für fachsprachliche, in besonderem Maß aber für die literarische.
Auf einem anderen Blatt steht die unbestreitbare Tatsache, daß nicht alle – vor allem nicht alle literarischen – Übersetzungen ihrer Gattung Ehre machen. Es gibt schlechterdings mißlungene Übersetzungen, und es gibt solche, die die einen für einen großen Wurf, andere wieder für höchst kritisierbar halten.
Seit Übersetzen und Übersetzungskritik akademisches Interesse für sich beanspruchen, werden Qualitätskriterien und differenzierte Beurteilungsmaßstäbe erarbeitet. Die traditionelle Scheidung in „treue“ und „untreue“ Übersetzung wurde schon dadurch hinfällig, daß natürlich keine Einigung darüber zu erzielen ist, woran man eine treue Übersetzung erkennen soll. Es hat sich heute das Bewußtsein durchgesetzt, daß jeder Übersetzer mit einer Wertskala als Orientierungshilfe operiert: dem einen ist die Wahrung der formalen Gestaltung des Originals, dem anderen die mühelose Lesbarkeit der Übersetzung, einem dritten die inhaltliche Seite der Vorlage wichtiger als anderes.
Daher sind bei der Analyse einer Übersetzung zunächst die Kriterien zu beschreiben, an die sich der Übersetzer gehalten hat, erst dann kann man darüber diskutieren, ob die „Hierarchisierung“ der zu erhaltenden Werte sinnvoll war oder nicht.
Nun hat man, auch von berühmten und berufenen Leuten, zu hören bekommen, der Übersetzer sei ein unterwürfiger Charakter. Wie aber, wenn ein Dichter einen anderen übersetzt, wenn zwei starke, „kreative“ Naturen aufeinandertreffen? Man kennt glückliche Ergebnisse solcher Begegnungen: Shakespeare und Schlegel, Goethe und Nerval, Baudelaire und Stefan George; viel häufiger aber entstehen problematische Produkte, die sich nur aus Pietät und dank dem Vollständigkeitsbedürfnis der Herausgeber Eingang in die Schlußbände der Gesammelten Werke zu verschaffen pflegen. Die Frage also, ob der Schriftsteller ein prädestinierter, privilegierter Übersetzer von literarischen Kunstwerken ist, kann nicht mit einem eindeutigen Ja oder Nein beantwortet werden.
Gelingt aber einem Schriftsteller, der sich in der eigenen Sprachgemeinschaft schon einen Namen erworben hat, eine Übersetzung, die den Beifall des Lesepublikums und womöglich auch noch denjenigen der Kritiker findet, so wird man sie großzügig mit dem Attribut „kongenial“ auszeichnen. Bei näherem Hinsehen stehen die meisten „kongenialen“ Übersetzungen jedoch in mehr oder weniger deutlicher Nähe zur Nachdichtung, einem Produkt also, bei dem sich der Übersetzer über die Dienerrolle hinweggesetzt hat; diese Grundhaltung erwartet man geradezu von einem, der sich schon selbst als Literaturproduzent ausweisen kann, man tadelt sie nicht selten, wenn es sich um einen „namenlosen“ Übersetzer handelt.
Ein renommierter Praktiker der Lyrik-Übersetzung, Karl Dedecius, hat einmal den Vorschlag gemacht, die zuverlässige, aber künstlerische Ü b e r s e t z u n g im engeren Sinn abzuheben von der Ü b e r t r a g u n g, die zugleich künstlerisch und zuverlässig sein soll, während die N a c h d i c h t u n g zwar künstlerisch, aber unzuverlässig wäre.2 Natürlich besitzen alle drei Verfahren, je nach Zweck und Publikum, ihren Wert. Die höchsten Anforderungen stellt nach dieser Einteilung die Übertragung, weil sie zwei von jeher für unvereinbar gehaltene Ansprüche zu versöhnen bemüht ist (Übersetzungen, sagen die Franzosen, sind wie die Frauen: wenn sie schön sind, sind sie nicht treu, und wenn sie treu sind, sind sie nicht schön). Nach der Einteilung von Dedecius wären also die „kongenialen“ Leistungen, wenn dieser Begriff überhaupt etwas Sinnvolles meint, vornehmlich unter den Übertragungen zu suchen, weil diese in der Zielsprache weder den Kunstwerkcharakter opfern noch der Aussage des Originals Gewalt antun.
H.C. Artmann ist einer, dem man, wenn er sich als Übersetzer versucht, weitgehende Zugeständnisse an seine Intuition und Kreativität konzediert. Im Anschluß etwa an ein kleines Referat über verschiedene Übersetzungen Villons ins Deutsche, in dem die Tendenzen der deutschen Fassungen gegenübergestellt wurden,3 hielt ein hochqualifizierter Zuhörer entgegen, die Version Artmanns sei wohl nur schwer mit anderen zu vergleichen, da es sich dabei um eine freie Nachdichtung handle. Dieser beharrlich eingebrachte Vorwand, der mir schon durch die Argumentation in dem erwähnten Referat entkräftet schien, veranlaßt mich unter anderem, ein zweites Mal und an anderen Texten zu zeigen, daß Artmann als höchst sorgfältiger Übersetzer von Villon-Texten betrachtet zu werden verdient und daß die verunsicherten Reaktionen der Philologen mit anderen Motiven zusammenhängen.
Nicht überall ist Artmann als Übersetzer mit derselben Genauigkeit zu Werke gegangen wie bei Villon. Aus der Sicht des Philologen müssen zum Beispiel gegen seine deutsche Fassung des Buscon einige Bedenken angemeldet werden, wovon in Kapitel III die Rede sein soll.
II
Die Villon-Übersetzung
Die romanistische Forschung versucht bisweilen, das griffige Villon-Bild, welches in Frankreich ebenso geläufig ist wie im deutschsprachigen Raum, mit akademischem Ernst zu korrigieren: erfolglos, wie man erkennen muß, denn die Attraktivität des Klischees läßt sich nicht leicht ersetzen durch eine Handvoll wenig aussagekräftiger, aber dafür gesicherter Fakten. Selbst in einschlägigen Handbüchern, die als seriös gelten, ,ist der alte Trugschluß der Villon-Rezeption keineswegs ausgeräumt, der dadurch zustandekommt, daß man aus den Ich-Gedichten eine (historisch nicht zu belegende) Biographie konstruiert, um dann zu behaupten, das Erleben Villons habe in seiner poetischen Produktion reichen Niederschlag gefunden. Holt man sich dann noch aus dem ohnehin schmalen Gesamtwerk Villons (etwa 3.000 Verse) die „interessanten“ Texte heraus (und verschweigt, daß ein großer Teil seiner Dichtung für uns nicht mehr entschlüsselbar ist), bekommt die traditionelle Vorstellung vom volksnahen, saufgewaltigen, sexhungrigen, kriminellen, anarchistischen Läster- und Lasterpoeten die Nahrung, die sie braucht, um sich gegen alle Vorbehalte der Forschung zu behaupten.
Zweifellos begünstigen ideengeschichtliche Parallelen des 15. Jahrhunderts mit unserer Zeit4 die Begeisterung für Villon. Kein Wunder also, daß viele heutige Schriftsteller und Liedermacher sich auf ihn berufen (z.B. Wolf Biermann, der ihn seinen „großen Bruder“ nennt)5 und daß viele sich angeregt fühlen, ihn zu übersetzen.
So auch H.C. Artmann. Zur besseren Erläuterung seiner Verfahrensweise in der Übersetzung ist es wohl zweckmäßig, ein zusammenhängendes französisches Textstück als Ausgangspunkt zu nehmen. Die berühmte Ballade „Les Contredits de Franc Gontier“ erscheint deswegen als besonders geeignet, weil wir von ihr auch eine für Interpretationszwecke angefertigte, also inhaltlich sehr genaue Prosaübersetzung zur Hand nehmen können, um sie Artmanns Fassung gegenüberzustellen.6
BALLADE
Sur mol duvet assiz, ung gras chanoine,
Lez ung brasier, en chambre bien natee,
A son costé gisant dame Sidoine,
Blanche, tendre, polye et attintee,
Boire ypocras a jour et a nuytee,
Rire, jouer, mignonner et baisier,
Et nud a nud pour mieulx des corps s’aisier,
Les vy tous deux par ung trau de mortaise.
Lors je congneuz que, pour dueil appaisier,
Il n’est tresor que de vivre a son aise.
Se Franc Gontier et sa compaigne Elayne
Eussent ceste doulce vie hantee,
D’oignons, cyvotz, qui causent forte alaine,
N’acontassent une bise tostee.
Tout leur maton ne toute leur potee
Ne prise ung ail, je le dy sans noisier.
S’ilz se vantent couchier soubz le rosier,
Lequel vault mieulx? Lit costoyé de cheze?
Qu’en dictes vous? Faut il ad ce muser?
Il n’est tresor que de vivre a son aise.
De groz pain bis vivent, d’orge et d’avoyne,
Et boyvent eaue tout au long de l’annee;
Tous les oyseaux de cy en Babiloyne
A tel escot une seulle journee
Ne me tendroient, non une matinee.
Or s’esbate, de par Dieu, Franc Gontier,
Helayne o luy, soubz le bel esglantier;
Se bien leur est, cause n’ay qu’il me poise,
Mais quoy que soit du laboureux mestier,
Il n’est tresor que de vivre a son aise.
Prince, jugiez, pour tost nous accorder!
Quant est de moy, mais qu’a nulz ne desplaise,
Petit enffant j’ay oÿ recorder:
Il n’est tresor que de vivre a son aise.
DIE ERWIDERUNGEN AUF FRANC GONTIER
Auf weichem Daunenbette sitzend, ein fetter Domherr / bei einem Kohlenbecken, in reich ausgekleidetem Zimmer, / an seiner Seite liegend Frau Sidoine, / weiß, zart, glatt und hübsch zurechtgemacht, / bei Tag, und Nacht Würzwein trinken, / lachen, spielen, schäkern, küssen, / und nackt an nackt, um sich an ihren Leibern besser zu ergötzen, / so sah ich die beiden durch ein Zapfenloch; / da begriff ich, daß, um Kummer zu lindern, / es kein höheres Gut gibt als behaglich [oder auch: im Wohlstand] zu leben.
Wenn Franc Gontier und seine Gefährtin Helene / dieses süße Leben kennengelernt hätten, / würden sie für Zwiebeln und Schalotten, die starken Atem verursachen, / keine Scheibe geröstetes Schwarzbrot geben. / All ihre Dickmilch, all ihren Gemüseeintopf / schätze ich keinen Knoblauch wert, ich sage das, ohne Streit zu suchen. / Wenn sie sich preisen, unter dem Rosenstrauch zu liegen, / was ist besser: Ein Bett mit einem Stuhl daneben? / Was sagt Ihr dazu? Muß man sich dabei aufhalten? / Es gibt kein höheres Gut als behaglich zu leben.
Sie leben von grobem Schwarzbrot aus Gerste, Hafer / und trinken das ganze Jahr lang Wasser. / Alle Vögel von hier bis Babylon / würden mich nicht einen einzigen Tag, / nicht einen Vormittag bei solcher Kost halten. / Nun möge sich in Gottes Namen Franc Gontier, / Helene mit ihm unter dem schönen Heckenrosenstrauch vergnügen: / Wenn es ihnen behagt, habe ich keinen Grund, deshalb bedrückt zu sein. / Aber, wie es mit der mühevollen [Land]arbeit auch bestellt sei: / Es gibt kein höheres Gut als behaglich zu leben.
Fürst urteilt, um uns alle zu einigen! / Was mich betrifft, aber das möge niemand mißfallen, / so hörte ich schon als kleines Kind immer wieder sagen: / Es gibt kein höheres Gut als behaglich zu leben.
ENTGEGNUNG AUNAN FRANC GONTIER:
auf an wachn daunanboista
sizt a blada pfoff und bazt se.
in kamin brend gmiadlech s feia
und de zimawend rundum
san med seidn ausschdaffiad.
nem eam liegt de sidonii:
weis und zoat, a glote haud,
riachad wia r a rosa pfiasech ..
so hob i de zwaa daschaud
duach an schboed fon eanan fenzta!
dog und nocht haum s weamut drunkn,
glocht und gschmusd haum s,
gschbüd und bleld
– nokat, dass as bessa gschbian –.
do is mia r a liacht aufgaunga.
head s jezt zua, wos ii eich sog:
gliklech bisd nua r auf da wöd,
schwimst en recht an hauffm göd!
waun aa jezt da franc gontier
und sei freindin, de helaine,
auf a fridlex laundlem schdengan,
zwifö kifön, schnidlauch, gnofö,
fon den wos s a faune griang,
sog i drozzdem (one z schdenkan),
das ma r eana saure müle,
d zwifösupm und dea gnofö
ned besondas eigee ded!
woitn s extra noo dazön,
das ma hinta d rosnschdaudna
bessa schloft oes wia r auf boista,
miast e lochn – secht s: i frog eich,
soi ma soo sei zeid fadandln?
gliklech bisd nua r auf da wöd,
schwimst en recht an hauffm göd!
lost s as lem fon drokna brod,
howan hawan wia de ressa,
wossa schledan s gaunze joa!
ole fegl untan himö
fon baris bis babilon
kentn mi kan dog ned hoedn
bei dea kost, wos de zwaa kochn
(nedamoe a anzex nochtmoe!) ..
und waun si da franc gontier
daun mid seina liam helaine
unta d heknresaln hiihaud,
wia r i me desshoeb ned aufreng,
mia r is s wuascht und se san zfridn;
mi kent s jednfoes ned lokn,
und drum sog i eich nua r ans:
gliklech bisd nua r auf da wöd,
schwimst en recht an hauffm göd!
jeztn, herr, jezt uatäuns söwa,
kum ma r auf an grinan zweig
(kana soi ma desshoeb bes sei):
owa scho oes glana bua
how e nii wos aundas song kead,
und i sog eich s nochamoe:
gliklech bisd nua r auf da wöd,
schwimst en recht an hauffm göd!
Was sofort ins Auge springt: Artmann bedient sich der Wiener Mundart. Damit ist die Zielgruppe von vornherein wesentlich kleiner, als wenn er eine hochdeutsche Fassung angeboten hätte. Da die Übersetzung zudem in einem Verlag der BRD erschienen ist, verwundert es nicht, daß das kleine Büchlein nach dem 4. Tausend nicht mehr aufgelegt wurde. Eine erheblich größere Verbreitung erzielt dagegen die Schallplatte, auf der Helmut Qualtinger eine Auswahl aus der Übersetzung Artmanns vorträgt.
Halten wir zunächst fest, daß vom Original aus gesehen kein triftiger Grund vorliegt, sich für eine andere als die überregionale Umgangs- bzw. Standardsprache zu entscheiden. Das Französisch, das in Paris im 15. Jahrhundert gesprochen und geschrieben wird, darf ohne weiteres als Grundlage der französischen Literatursprache gelten, die dialektalen Unterschiede, wie wir sie aus dem Schrifttum des Hochmittelalters kennen, sind in der Sprache der Literatur schon weitgehend eingeebnet, und Paris wird bereits als unumstrittene Metropole des kulturellen Lebens angesehen, der Sprache der Hauptstadt wird „Modellcharakter“ zuerkannt.
Es erübrigt sich fast zu ergänzen, daß die Option für die Mundart natürlich in keinem Zusammenhang steht mit einer Untersuchung des Instituts für Werbepsychologie und Markterkundung in Frankfurt/Main, die einige Jahre vor dem Erscheinen der Baladn das Wienerische als den im deutschen Sprachraum beliebtesten Dialekt ermittelte. Basis dieser Erhebung war ja eher das Schnitzler-österreichisch, die Sprache der Wiener, wie man sie aus populären Filmen (z.B. jenem über die Kaiserin Sissy etc.) kennt, nicht das Breitenseerische.
Artmann, der die Literaturfähigkeit des Vorstadtdialekts mit seiner schwoazzn dintn so augenfällig unter Beweis gestellt hatte, ging Ende der Sechzigerjahre, nachdem auch im Rahmen des Literaturbetriebs zunehmendes Interesse für diese unsentimentale und kitschigen, verniedlichenden Tönen abholde Form der Dialektdichtung zu registrieren war, daran, der Mundart eine neue Domäne zu erschließen, die ganz besonders geeignet war, mystifizierende Vorstellungen von den Entstehungsbedingungen der Mundartdichtung (Schollengebundenheit etc.) abzubauen.
Freilich, ganz hilflos steht der Leser nicht vor dem auch in seiner Graphie ziemlich unorthodoxen Text. Eine Rückübersetzung ins Hochdeutsche hilft ihm – scheinbar. Der Anfang der „balade fia de blade magoo“ („Ballade de la grosse Margot“) etwa liest sich folgendermaßen:
glaubt s i bin da lezte dreg,
wäul e auf mei glane schdee?
glaubt s, i bin a r oasch med uan,
wäul e ia r en schane moch?
In der hochdeutschen Version lautet das so:
glaubt ihr etwa, ich sei der letzte dreck,
weil ich auf meine kleine versessen bin?
glaubt ihr, ich sei ein arsch mit ohren,
weil ich für sie den lakaien spiele?
Wer, um nur diesen einen Ausdruck herauszugreifen, aus seiner Dialekterfahrung nicht spontan versteht, was ein „oasch med uan“ ist, wird sich auch unter einem „Arsch mit Ohren“ schwerlich etwas Richtiges vorstellen können.
Die „Rückübertragung“ verdeckt wahrscheinlich Artmanns eigentliche Leistung eher, als daß sie „jedem daran Interessierten die Überprüfung der Werktreue“ ermöglicht, wie auf dem Plattencover versprochen wird. Denn die Vorstellung von der Funktion der Rückübersetzung beruht auf einer nicht ganz richtigen Einschätzung des Verhältnisses von Dialekt und Hochsprache.
An dem oben zitierten Beispiel sieht man deutlich, daß dem Deutschen (im Gegensatz zum Französischen) eine transregionale Vulgärsprache fehlt; die soziologischen Unterschiede in der Sprache sind an die geographischen gekoppelt. Im Deutschen kann ein vulgärer Ausdruck normalerweise nicht einfach in ein phonetisch hochdeutsches Kleid schlüpfen, um allgemein verstanden zu werden.
Dieser Mangel ist e i n Grund dafür, warum es schwer ist, Villon befriedigend ins Hochdeutsche zu übersetzen. Vielleicht sollte an dieser Stelle auch gleich die verbreitete Meinung relativiert werden, Villon sei unvergleichlich ausfällig und obszön. Man braucht ihn aber nur neben seine – heute kaum mehr gelesenen Zeitgenossen zu stellen, um zu sehen, daß diese Beurteilung schief ist.7
Hingegen haben die Standardsprachen im Zuge ihrer „Veredelung“ umfangreiche Tabuzonen aufgebaut, was viele Übersetzer veranlaßt, sich an freizügigeren Stellen in schlüpfrige Anspielungen zu flüchten. Artmann verfügt in seinem Dialekt jedoch zumeist über die derben aber direkten Ausdrücke, die ihn des Rückzugs in Zweideutigkeit und Verschwommenheit entheben.
Läge das Rezept für eine gelungene Villon-Übersetzung aber nur darin, die Vulgarität zu bewältigen, wäre Artmann vermutlich nicht der erste, dem die Idee kam, sich des Dialekts zu bedienen. Die oben angeführte Ballade diene als Demonstrationsobjekt dafür, daß es Artmann gelungen ist, die verschiedensten Arten von Übersetzungsproblemen überzeugend zu bewältigen.
Am besten beschreibt man die Qualitäten einer Übersetzung, indem man sie mit anderen vergleicht. Dies sei nun anhand einzelner Aspekte versucht.
– Das Original erfüllt, wie das bei einem Text des Spätmittelalters nicht weiter verwunderlich ist, hohe formale Ansprüche. Vieles davon beachtet Artmann, nur auf das augen(bzw. ohren)fällig Ornamentale, den Reim, wird verzichtet. Von ihm macht er nur in den Kleinformen („fiazäula“, „rundoo“) und in jenen Balladen Gebrauch, wo er der eigenen Phantasie, ohne den semantischen Gehalt des Originals zu beeinträchtigen, freieren Lauf lassen darf (etwa in der „balade fon de glanechkeiten“, einer rhetorischen Kunstausübung Vilions, an der inhaltlich nur der Refrain interessiert). Dagegen hält sich Artmann ziemlich streng an die Baugesetze dieser Gedichtform, die neben dem anspruchsvollen Reimschema drei Strophen von gleicher Länge, einen Envoi (Geleit), halb so lang wie die Strophen, und einen Refrain fordert.
Umgekehrt verfahren die meisten anderen Übersetzer. Keiner gibt den Reim preis, dafür nehmen fast alle in Kauf, daß die Strophen unterschiedlich lang, Symmetrien geopfert, Teile der Aussage verändert werden, wenn sie syntaktische Verbiegungen und Verkünstelungen vermeiden wollen; abgesehen davon, daß die Reimwörter nicht selten einiges Unbehagen beim Leser erzeugen, der die Absicht merkt und verstimmt zu werden droht.
– Um dem Original auch inhaltlich gerecht zu werden, macht Artmann aus einem Villon-Vers zwei eigene, kürzere. Dadurch gewinnt er den Raum, den er braucht, um unangenehme Verkrümmungen im Satzbau zu vermeiden. Der Effekt des Dialekts wäre ja schwer beeinträchtigt, sein Einsatz künstlerisch unglaubwürdig, wenn dann der Umgangssprache fremde Konstruktionen auftauchten, die an altertümelnde oder hochliterarische Lyrik erinnern.
Bisweilen scheint es, als müsse Artmann einen Vers auffüllen. Aber bei näherem Hinsehen leuchten einem die Verdeutlichungen durchaus ein. Mancher Ausdruck, bei Villon noch kräftig und treffend, ist einem Abnützungsprozeß unterlegen; sparsam frischt Artmann mit Vergleichen auf,
z.B.
iachad wia r a rosa pfiasech (für attintee), anderes rechtfertigt sich durch kaum merkliche Einbeziehung des „soziokulturellen“ Hintergrundes,
Z.B. Sur mal duvet assiz = sizt a blada pfoff und bazt se. Dieser Tupfen Farbe im einleitenden Genrebild bringt die Perspektive des Sprechers gut zur Geltung: Sessel und Bett waren für Leute wie Villon Luxusgegenstände.
Im allgemeinen aber bleiben selbst zurückhaltende Ergänzungen die Ausnahme. Artmann nimmt die inhaltliche Seite so ernst wie kaum ein anderer Übersetzer. Nur in einem Punkt gesteht er sich freie Hand zu, nämlich in der Auswahl der Texte, denen er sich widmet. Denn genau genommen ist Villon für den Leser des 20. Jahrhunderts ein schwer zugänglicher Dichter. Viele Anspielungen, die das zeitgenössische Publikum ohne Zweifel verstand und goutierte, vermögen auch die scharfsinnigsten Philologen und Historiker nicht mehr zu entschlüsseln. Das „Große Testament“, ein Werk, in das die meisten der bekannten Balladen (als Vermächtnisse) eingebaut sind, ist voll von Namen, mit denen heute nichts mehr assoziiert werden kann. Wenn ein Übersetzer daher das Gesamtwerk übersetzen und sich exakt an die Vorlage halten will, muß er oft Dinge übersetzen, deren Witz er gar nicht mehr versteht.
Daher wählt Artmann aus – Texte, mit denen man noch etwas „anfangen“ kann, die auch heute noch mitreißend oder doch vergnüglich sind. Das heißt aber nicht, daß die ausgesuchten Gedichte ganz ohne Hintergrundinformation umfassend deutet werden könnten, sondern nur daß man ihnen auch ohne dieses Spezialwissen etwas abgewinnen kann. Artmann stellt sich nie vor den Text, um etwa zu fragen: wer verbindet heute noch etwas mit den Namen „Franc Gontier“ oder „Sidoine“?
An dieser Stelle sollte zum deutlicheren Kontrast die Fassung des unbestreitbar bekanntesten Villon-Verdeutschers eingefügt werden:8
Paul Zech:
DIE BALLADE VOM ANGENEHMEN LEBEN AUF DIESER WELT
Er hat ein Bett und hat auch Feuer im Kamin,
es reitet hin und her auf seinen Knien
die reizende Marie. Von wegen jener Glut
sind beide unbedeckt; wozu auch nicht?!
Der süße Wein, der Hetzhund, jagt ihr Blut
zum letzten Schwung. Sie tuns bei Licht,
denn in der Finsternis ist manches unbequem.
Nur der, der lebt, lebt angenehm.
Auch der Villon hat sich noch nie ein Bein
hinkniend ausgerenkt, ein frommer Christ zu sein,
viel weniger noch um einen Bissen Brot
mit Bettel sich beschmutzt; ich danke sehr!
Es kommt die schwarze Pest und Hungersnot
auch zu dem frommen Mann und säuft ihn leer.
Ich frage nicht, woher, wohin die Winde wehn.
Ich habe und wer hat, lebt angenehm.
Da lieg ich, wie ich bin, im hohen Gras
und denk nicht anderes als das,
daß von dem Baum nicht weit der Apfel fällt.
Und in dem Apfel wohnen schon die Würmer drin,
damit er nicht zu lange sich am Stengel hält,
und dabei kommt der Spruch mir in den Sinn:
Mensch, wenn was kommt, frag nicht wofür, für wen,
du hast, und wer was hat, lebt angenehm.
Es geht auf dieser grauen Elendswelt
wohl gar nichts ohne Sorgen um das Geld
und von dem Brot allein wird niemand satt im Darm.
Doch wenn man Wildpret hat und sich mit Wein
den Schlauch anfüllt und hinterdrein noch ein
vergnügtes Weibchen hält im Arm,
für den kann diese Welt zugrunde gehn,
er hat und also lebt er angenehm.
Bleiben wir gleich bei den Eigennamen. Schon mit dem Titel der Ballade deutet Villon an, daß er sich auf ein Gedicht eines älteren Dichterkollegen bezieht, dessen Thema das Lob des Landlebens war. Zech geht nicht darauf ein, während Artmann am Personal der Ballade nichts ändert. Wir lernen Gontiers „freindin, de helaine“ kennen; auch das andere Paar, der „gras chanoine“ und „dame Sidoine“, erscheint bei Artmann als „blada pfoff“ und „sidonii“; Zech nennt sie, blaß und einfallslos, „Er“ und „Marie“ (- warum Marie?). Wieder ist freilich der sozialgeschichtlich und literarisch versierte Leser im Vorteil, der weiß, daß der mit einer Pfründe ausgestattete Kleriker zur Zeit Villons als Prototyp des gehobenen Lebensstandards galt; Sidonie war bekannt als mit allen körperlichen Vorzügen versehene Hauptfigur eines vielgelesenen Liebesromans. Aus der Konstellation der Figuren ergibt sich nun von selbst die Aussage der Strophe I als These und jene der Strophen II/III als Gegenthese.
Von Artmann wird nicht einmal der „Prince“ des Envoi vergessen. Die Anrede war poetologische Vorschrift und entsprang der Konvention, den Urteilsspruch (Synthese) dem hochadeligen Vorsitzenden der Dichterakademien zu übertragen.
Diese klar erkennbare Gedankenführung, deren Nachvollzug wohl die Mindestanforderung an jede Verdeutschung – auch wenn sie sich als Nachdichtung präsentiert – darstellt, erweist sich bei Zech als hoffnungslos verdunkelt. Ich überlasse es dem interessierten Leser, weitere Abweichungen Zechs von der Vorlage zusammenzustellen und ihre Problematik zu ermessen und wende mich einem kleinen Sonderproblem zu: der Übersetzung des Refrains.
Die formale Vorschrift, daß jede Strophe der Ballade mit einem den Inhalt der Dichtung thematisierenden Refrain zu enden habe, scheint prinzipiell keine sonderliche Hürde darzustellen. Anders jedoch im vorliegenden Fall, wo durch Brechts Bearbeitung der berühmten Ammerschen Übersetzung im Deutschen bereits eine „klassische“, „gültige“ Formulierung für „Il n’est tresor que de vivre a son aise“ vorliegt, nämlich:
Nur wer im Wohlstand lebt, lebt angenehm.
Zech läßt sich offenbar in gewisser Weise inspirieren von dieser Formel und schreibt:
R I: Nur der, der lebt, lebt angenehm
R II: Ich habe und wer hat, lebt angenehm
Schwerer als der Umstand, daß Zech den Refrain jeweils variiert, wiegt die Tatsache, daß die logische Unsinnigkeit der Aussage von R I zunächst die Stoßrichtung des Texts vernebelt, und in R II schließlich exakt das Gegenteil von dem gesagt wird, was im Original steht, womit Zech die Grundidee des Textes vollkommen zertrümmert: der Sprecher (warum erlaubt sich Zech eigentlich, Villon namentlich in das Gedicht einzuführen?) beklagt sich ja eben, daß er n i c h t mit den voyeurhaft erblickten Annehmlichkeiten und Reichtümern des „chanoine“ gesegnet ist.
Wieder zeigt sich Artmann als zuverlässiger Übersetzer. Dem Baugesetz der Ballade ist treu entsprochen: „gliklech bisd nua r auf da wöd, schwimst en recht an hauffm göd!“ heißt es viermal. In den Sog des geflügelten Worts aber kommt Artmann in der Dialektfassung gar nicht, er braucht es weder zu übernehmen oder zu adaptieren noch sich ihm ausdrücklich zu entziehen. Neuerlich ein Vorteil, den ihm die Entscheidung für die Mundart in die Hände gespielt hat.
Es ist wiederholt behauptet worden, Gedichte seien grundsätzlich unübersetzbar. Eine so apodiktische Formulierung hört man vor allem von Leuten, die eine große Hochachtung vor der eigenen Nationalliteratur haben. Hinter dieser Meinung scheint jedoch eher ein psychologischer als empirisch zu belegender Faktor zu stehen: die muttersprachliche Dichtung wird als ein Universum verteidigt, an dem sich ein Fremdsprachiger nicht zu vergreifen habe. Denn umgekehrt kann man von Vertretern solcher Anschauung regelmäßig erfahren, daß es durchaus beachtliche Übersetzungen von Werken der Weltliteratur i n i h r e Sprache gebe. Also, um ein authentisches Beispiel zu bringen: Rilke auf spanisch, wurde mir gesagt, das sei ein ganz großer Wurf, eine übersetzerische Meisterleistung; aber Antonio Machado oder García Lorca auf deutsch sei ein Greuel, ein Verrat, fast ein Verbrechen.
Umsichtigere stufen ab. Man weiß, daß Dichtung, die mit Sprache spielt, im strengen Sinn nicht übersetzbar ist. Auch Villon spielt gern mit Wörtern, spielt gern an (nicht immer wissen wir worauf). Die Übersetzungswissenschaft rät in solchen Fällen zur Kompensation. Das ist ein reichlich theoretischer, abstrakter Rat, der dem Übersetzer konkret meist wenig hilft. An einem kleinen Textbeispiel sei daher gezeigt, wie Artmann dort verfährt, wo sich eine wörtliche Übersetzung nicht empfiehlt.
Strophe II und III behandeln den Topos vom unbeschwerten Leben auf dem Land. Wie Villon läßt Artmann Franc Gontier sich von saurer Milch und Zwiebeln, Brot und Wasser ernähren. Die hinterhältigen Wortspiele Villons, die das Französische seiner Zeit erlaubt (z.B. „Tout leur maton… Ne prise ung ail“),9 umgeht Artmann, indem er den Knoblauch in die Reihe der wenig achtbaren Nahrungsmittel aufnimmt; er stellt diesen mit den Zwiebeln zusammen und läßt sie „a faune“ verursachen – in der Rückübersetzung heißt das, nach Art der Zahnpastareklame, „starken mundgeruch“. Im Vergleich mit einer wortgetreuen Übersetzung ermißt man, wie geschickt Artmanns Kunstgriff war:
Üs. Küchler:
Für Zwiebeln, Lauch, die aus dem Munde riechen,
Nicht einen Zwieback möchten sie wohl geben
All ihre saure Milch und all den Brei daneben
Schätz keinen Knoblauch ich, sags ohne Streit10
Wenn man peinlich genau sein will: Artmanns Fassung ist nicht ganz „fehlerlos“. Der Vers „Mais quoy que soit du laboureux mestier“ hat sich nicht in die Übersetzung hinübergerettet – aber selbst der strenge Philologe wird darin keine Verfälschung Villons erblicken, während eine solche unbestreitbar bei der Nachdichtung Zechs vorliegt.
Kommen wir zurück auf die Einteilung von Karl Dedecius. Von allen Verdeutschungen verdient diejenige Artmanns sicherlich am ehesten, unter die Übertragungen eingereiht zu werden, ist sie doch so zuverlässig wie kaum eine andere, und doch künstlerisch autonom, d.h. man braucht nicht den französischen Originaltext daneben, um die „eigentlichen“ Qualitäten Villons beurteilen zu können.
Es wäre unergiebig, darüber zu diskutieren, ob Artmann auch in der Hochsprache einen so authentischen Villon hätte schaffen können. Es war jedoch zu zeigen, daß es nicht der Dialekt an sich war, der das Gelingen der Übertragung garantierte, und daß das Klischee von der „unverbrauchten und kraftvollen Mundart“ nur eine mangelhafte Erklärung wäre. Vielmehr nützt Artmann den Freiraum, den ihm der Dialekt läßt, äußerst geschickt aus, wie in einigen Punkten gezeigt wurde.
Und eines sollte man wohl auch nicht vergessen: nur wenige l e s e n die Artmann-Übersetzung, aber viele h ö r e n sie dank der Platte. Wird hier nicht auch eine Parallele in der Rezeptionssituation sichtbar? Bei Villon wird es doch auch so gewesen sein: seine Gedichte waren viel mehr zum Vortragen und Anhören gedacht als zum einsamen Lesen in der Stube. Heute, wo die stille Lektüre, auch von Gedichten, der Regelfall ist, könnte die Artmannsche Fassung Anstoß sein zu einem kollektiven Literaturerlebnis; das wäre nicht der geringste ihrer Vorzüge.
(…)
Wolfgang Pöckl, aus Josef Donnenberg (Hrsg.): Pose, Possen und Poesie. Zum Werk Hans Carl Artmanns, Akademischer Verlag Hans-Dieter Heinz, 1981
François Villon (1910/1913)
Astronomen vermögen die Wiederkehr eines Kometen nach Ablauf einer großen Zeitspanne genau vorauszusagen. Für diejenigen, die Villon kennen, stellt das Auftauchen Verlaines ein ebensolches astronomisches Wunder dar. Die Schwingungen dieser beiden Stimmen sind sich verblüffend ähnlich. Außer der Klangfarbe und der Biographie jedoch verbindet diese Dichter eine beinah gleiche Mission in der Literatur ihrer Zeit. Beiden war es beschieden, in einer Epoche gekünstelter Treibhausdichtung aufzutreten, und ähnlich wie Verlaine die serres chaudes des Symbolismus durchschlug, warf Villon der mächtigen Rhetorischen Schule, die man mit vollem Recht als den Symbolismus des 15. Jahrhunderts auffassen darf, seine Herausforderung entgegen. Der berühmte Roman de la Rose hatte zum ersten Male die undurchdringlichen Schutzwände errichtet und jene fortwährend sich verdichtende Gewächshausatmosphäre geschaffen, die dem Atmen der vom Roman entworfenen Allegorien unentbehrlich war. Liebe, Gefahr, Haß, Hinterlist – das sind keine toten Abstraktionen. Sie sind keineswegs körperlos. Die mittelalterliche Dichtung verleiht diesen Geistern gleichsam einen Astralleib und ist zärtlich für die künstliche Luft besorgt, die zur Aufrechterhaltung ihres zerbrechlichen Seins so notwendig ist. Der Garten, in welchem diese eigenartigen Personen leben, wird von einer hohen Mauer umgrenzt. Wie der Anfang des Rosenromans berichtet, war der Verliebte auf der vergeblichen Suche nach dem verborgenen Eingang lange um diese Schutzmauer herumgestreift.
Dichtung und Leben sind im 15. Jahrhundert zwei selbständige, miteinander verfeindete Dimensionen. Es ist kaum anzunehmen, daß Maître Alain Chartier einer eigentlichen Verfolgung ausgesetzt war und persönliche Unannehmlichkeiten erdulden mußte, nachdem er die damalige öffentliche Meinung gegen sich aufgebracht hatte – durch ein allzu hartes Urteil über die Mitleidlose Dame, die er nach einer glänzenden Gerichtsverhandlung, unter Beachtung aller Feinheiten der mittelalterlichen Prozeßführung, im Brunnen der Tränen ertränkte. Die Dichtung des 15. Jahrhunderts war autonom: sie hatte in der damaligen Kultur die Stellung eines Staates im Staate. Erinnern wir uns an den Liebeshof von Charles VI.: verschiedene Dienste schließen 700 Menschen zusammen, von der höchsten Herrschaft bis hin zum Kleinbürger und den untersten Clercs. Die Nichtbeachtung der Standesunterschiede erklärt sich durch den ausschließlich literarischen Charakter dieser Einrichtung. Die Hypnose der Literatur war derart stark, daß die Mitglieder solcher Vereinigungen sich mit grünen Kränzen schmückten – dem Symbol des Verliebtseins – und so durch die Straßen zogen, getragen vom Wunsche, den literarischen Traum in die Wirklichkeit hinein zu verlängern.
François Montcorbier (des Loges) wurde 1431 in Paris geboren, in der Zeit der englischen Besatzung. Zu der Armut, die seine Wiege umgab, kam die Not des ganzen Volkes und insbesondere die Not der Hauptstadt. Man könnte nun erwarten, daß die Literatur jener Zeit erfüllt gewesen sei von patriotischem Pathos und von Rachedurst für die erniedrigte Würde der Nation. Indessen finden wir weder bei Villon noch bei seinen Zeitgenossen solche Gefühle. Das von den Ausländern gefangengesetzte Frankreich zeigte sich als echte Frau. Wie eine Frau in Gefangenschaft verwandte es die Hauptaufmerksamkeit auf die Kleinigkeiten seiner Kultur- und Alltags-Toilette und musterte die Sieger mit Neugier. Die höhere Gesellschaft, darin ihren Dichtern folgend, enteilte wie vordem durch den Traum in die vierte Dimension der Gärten der Liebe und der Gärten der Freude, für das Volk hingegen entzündeten sich am Abend die Lichter der Tavernen, und an Festtagen wurden Farcen und Mysterienspiele aufgeführt.
Die weiblich-passive Epoche prägte tief das Schicksal und den Charakter Villons. Zeit seines ungesitteten Lebens bewahrte er die unerschütterliche Überzeugung, daß irgend jemand sich um ihn kümmern, über seine Angelegenheiten Bescheid wissen und ihm aus schwierigen Situationen heraushelfen müsse. Noch als erwachsener Mensch ruft er, vom Bischof von Orléans in Meungsur-Loire in den Kerker geworfen, jammernd seine Freunde an:
Le laisserez-vous là, le pauvre Villon?…
Die soziale Karriere des François Montcorbier begann damit, daß ihn Guillaume Villon in seine Obhut nahm, der angesehene Domherr der Klosterkirche Saint-Benoîtle-Bestourné. Nach Villons eigenem Bekenntnis war der alte Domherr für ihn „mehr als eine Mutter“ gewesen. Im Jahre 1449 erlangt er den Grad eines Baccalaureus, 1452 den eines Lizentiaten und Maître.
O Herr, wenn ich in den Tagen meiner unbesonnenen Jugend gelernt und guten Sitten mich geweiht hätte – ein Haus hätte ich bekommen und ein weiches Bett. Aber was soll man dazu sagen! Aus der Schule weggelaufen bin ich wie ein verschlagener Junge: wenn ich diese Worte schreibe, blutet mein Herz.
So seltsam dies auch erscheinen mag, Maître François Villon hatte für eine gewisse Zeit ein paar Zöglinge und unterwies diese, so gut er konnte, in Schulweisheit. Bei seiner Ehrlichkeit sich selber gegenüber erkannte er jedoch, daß es ihm nicht anstand, den Titel eines Maître zu tragen, und so zog er es vor, sich in den Balladen den „armen kleinen Scholaren“ zu nennen. Das Lernen gestaltete sich für Villon aber auch besonders schwierig, da ausgerechnet auf die Jahre seines Studiums die Studentenunruhen von 1451–1453 fielen. Die Menschen des Mittelalters liebten es, sich als Kinder der Stadt, der Kirche, der Universität zu begreifen… Doch die „Kinder der Universität“ fanden ausschließlich an losen Streichen Geschmack. Es wurde eine heldenhafte Jagd auf die populärsten Aushängeschilder des Pariser Marktes veranstaltet. Der Hirsch hatte die Ziege und den Bären zu trauen, und als Geschenk für die Jungvermählten war der Papagei vorgesehen. Die Studenten stahlen auch einen Grenzstein aus den Besitzungen der Mademoiselle de Bruyères, stellten ihn auf den Berg der heiligen Genevieve, tauften ihn la vesse und machten den Stein nachdem sie ihn bereits einmal der Gewalt der Obrigkeit entrissen hatten, mit eisernen Faßbändern am Orte fest. Auf den runden Stein stellten sie einen anderen, einen länglichen, den Pet au Diable, und machten beide in den Nächten zum Gegenstand ihrer Verehrung, bestreuten sie mit Blumen und tanzten um sie herum zu den Klängen von Flöten und Tamburinen. Die erbosten Fleischer und die beleidigte Dame unternahmen die entsprechenden Schritte. Der Gerichtsvorsteher von Paris erklärte darauf den Studenten den Krieg. Zwei verschiedene Gerichtsbarkeiten prallten aufeinander – und die unverschämten Polizeibeamten hatten auf den Knien, mit angezündeten Kerzen in Händen, beim Rektor der Universität um Verzeihung zu bitten. Villon, der zweifellos im Mittelpunkt dieser Ereignisse stand, hielt sie fest im uns nicht erhaltenen Roman Le Pet au Diable.
Villon war Pariser. Er liebte die Stadt und das Nichtstun. Für die Natur hegte er keinerlei Zärtlichkeit und verspottete sie sogar. Schon im 15. Jahrhundert war Paris jenes Meer, in dem man schwimmen konnte, ohne je Überdruß zu empfinden, und das restliche Weltall vergaß. Doch wie leicht stößt man auf eines der zahllosen Riffe einer untätigen Existenz! Villon wird zum Mörder. Die Passivität seines Schicksals ist bemerkenswert. Es ist, als ob es nur darauf gewartet hätte, von einem Zufall befruchtet zu werden, gleichgültig, ob von einem guten oder einem schlechten. In einer unsinnigen Straßenrauferei erschlägt Villon an einem 5. Juni den Geistlichen Sermoise mit einem schweren Stein. Zum Galgen verurteilt, reicht er seine Appellation ein, wird begnadigt und in die Verbannung geschickt. Die Landstreicherei zerrüttete vollends seine Moralität, indem sie ihn mit der Verbrecherbande la Coquille in Berührung brachte, deren Mitglied er wird. Bei seiner Rückkehr nach Paris beteiligt er sich an einem großen Diebstahl im Collège de Navarre und flüchtet unverzüglich nach Angers – einer unglücklichen Liebe wegen, wie er beteuert, in Wirklichkeit jedoch zur Vorbereitung eines Raubes an seinem reichen Onkel. Vom Pariser Horizont verschwindend, veröffentlicht Villon sein Petit Testament. Darauf folgen Jahre ziellosen Umherstreifens, mit Zwischenhalten an Feudalhöfen und in Gefängnissen. Am 2. Oktober 1461 von Louis XI. amnestiert, verspürt Villon eine tiefe schöpferische Bewegung, seine Gedanken und Empfindungen nehmen ungewöhnlich scharfe Umrisse an, und er schafft das Grand Testament – sein Denkmal für alle Zeiten. Im November des Jahres 1463 war François Villon Augenzeuge eines Streites und Mordes an der Rue Saint-Jacques. Hier enden unsere Kenntnisse über sein Leben, und seine dunkle Biographie bricht jäh ab.
Grausam war das 15. Jahrhundert den Einzelschicksalen gegenüber. Viele ordentliche und besonnene Leute verwandelte es in Hiobsgestalten, die vom Grunde ihrer übelriechenden Verliese aufmurrten und Gott der Ungerechtigkeit bezichtigten. Es wurde eine besondere Art der Gefängnisdichtung geschaffen, die von biblischer Bitterkeit und Rauhheit durchdrungen war, soweit diese der höflichen romanischen Seele überhaupt zugänglich ist. Doch aus dem Chor der Gefangenen dringt scharf die Stimme Villons hervor. Seine Auflehnung gleicht eher einem Prozeß denn einer Revolte. Er verstand es, in einer Person den Kläger und den Angeklagten zu vereinen. Die Beziehung Villons zu sich selber überschreitet nie bestimmte Grenzen der Intimität. Er ist für sich selber nicht zartfühlender, aufmerksamer und fürsorglicher als ein guter Advokat seinem Klienten gegenüber. Selbstmitleid ist ein parasitisches Gefühl, das Seele und Organismus zersetzt. Jenes trockene juristische Mitleid jedoch, das Villon sich schenkt, ist für ihn die Quelle seiner Munterkeit und der unerschütterlichen Überzeugung von der Rechtlichkeit seines „Prozesses“. Der vollkommen sittenlose, „amoralische“ Mensch lebt, als echter Nachfahre der Römer, völlig in einer vom Recht bestimmten Welt und kann sich keinerlei Verhältnisse außerhalb von Gerichtsbarkeit und Norm vorstellen. Der lyrische Dichter ist seiner Natur nach ein zweigeschlechtliches Wesen, fähig zu unzähligen Aufspaltungen im Namen eines inneren Dialoges. Bei keinem ist dieser „lyrische Hermaphroditismus“ so lebhaft zum Ausdruck gekommen wie bei Villon. Welch eine vielfältige Auswahl bezaubernder Duette: der Betrübte und der Tröstende, die Mutter und das Kind, der Richter und der Angeklagte, der Besitzende und der Bettler…
Besitztum lockte Villon zeit seines Lebens wie eine musikalische Sirene und ließ ihn zum Dieb werden… und zum Dichter. Als kläglicher Landstreicher macht er sich die ihm unzugänglichen Güter mit Hilfe einer schneidenden Ironie zu seinem Eigentum.
Die modernen französischen Symbolisten sind in die Dinge verliebt, als seien sie deren Besitzer. Vielleicht ist selbst die „Seele der Dinge“ nichts anderes als das Gefühl des Besitzers, durchgeistigt und veredelt im Laboratorium der aufeinanderfolgenden Generationen. Villon hatte den Abgrund zwischen Subjekt und Objekt bestens erkannt, verstand ihn jedoch als Unmöglichkeit des Besitzes. Der Mond und andere neutrale „Gegenstände“ sind unwiederbringlich aus seinem dichterischen Haushalt verbannt. Dafür lebt er sofort auf, wenn die Rede auf gebratene Enten an Sauce oder die ewige Glückseligkeit fällt, die zu erlangen er nie endgültig die Hoffnung verliert.
Villon malt ein bezauberndes intérieur im holländischen Stil, wobei er durch ein Schlüsselloch späht.
Villons Sympathien für die Hefe der Gesellschaft, für alles Verdächtige und Verbrecherische, sind in keiner Weise Dämonismus. Die finstere Kumpanei, mit welcher er sich so rasch und so eng verband, fesselte seine weibliche Natur durch ihr großes Temperament, durch ihren mächtigen Lebensrhythmus, den er in den anderen Gesellschaftsschichten nicht finden konnte. Man muß schon hören, mit welcher Lust Villon in der „Ballade à la grosse Margot“ vom Beruf des Zuhälters erzählt, der ihm offensichtlich nicht fremd war:
Wenn Kunden kommen, greife ich einen Krug und laufe, den Wein zu holen.
Weder der blutleer gewordene Feudalismus noch das neu in Erscheinung getretene Bürgertum mit seinem Hang zu flämischer Schwere und Behäbigkeit vermochten jenem gewaltigen dynamischen Vermögen einen Ausweg anzubieten, das wie durch ein Wunder im Pariser Clerc versammelt und konzentriert war. Dürr und finster, brauenlos, mager wie eine Chimäre, mit einem Kopf, der seiner eigenen Aussage gemäß an eine geschälte und geröstete Nuß erinnerte, den Degen in der halbweiblichen Kleidung des Studenten verbergend – so lebte Villon in Paris wie das Eichhörnchen im Rad und kannte keine ruhige Minute. Er liebte in sich das raubgierige, gemagerte Tierchen, und sein abgewetztes Fell war ihm teuer: „Nicht wahr, Garnier, ich habe gut daran getan zu appellieren“, schreibt er an den Staatsanwalt, kaum ist er dem Galgen entronnen, „nicht jedes Tier verstünde es, sich so herauszuwinden.“ Wäre Villon in der Lage gewesen, sein dichterisches Credo formulieren zu müssen, hätte er zweifellos in der Art Verlaines ausgerufen:
Du mouvement avant toute chose!
Als mächtiger Visionär träumt er das eigene Erhängtwerden am Vorabend der vermeintlichen Hinrichtung. Seltsam jedoch – mit unbegreiflicher Erbitterung und rhythmischem Schwung stellt er in seiner Ballade dar, wie der Wind die Körper der Unglücklichen in eine Schaukelbewegung versetzt, einmal hierhin, einmal dorthin, nach seinem Gutdünken… Selbst dem Tode noch verleiht er dynamische Eigenschaften, und sogar hier bringt er es zuwege, seine Liebe zu Rhythmus und Bewegung kundzutun… Ich meine, es sei nicht der Dämonismus, sondern die Dynamik des Verbrechens gewesen, die Villon gefesselt hat. Wäre es möglich, daß ein reziprokes Verhältnis zwischen der sittlichen und der dynamischen Entwicklung eines Geistes bestünde? In jedem Falle sind die beiden Testamente Villons, das große wie das kleine – dieses Fest herrlicher Rhythmen, wie es die französische Dichtung bis dahin nicht gekannt hatte – unheilbar amoralisch. Dieser klägliche Landstreicher schreibt zweimal sein Vermächtnis, verteilt nach rechts und nach links seine angebliche Habe und behauptet als Dichter ironisch seine Herrschaft über alle Dinge, die er zu besitzen wünscht. Auch wenn sich das Seelenleben Villons bei all seiner Originalität nicht durch eine besondere Tiefe auszeichnete – seine gelebten Beziehungen, ein verworrener Knäuel von Bekanntschaften, Verbindungen, Abrechnungen, stellten ein Gebilde von genialer Komplexität dar. Dieser Mensch hat es fertiggebracht, eine wirkliche, vitale Beziehung mit einer ungeheuren Anzahl von Personen verschiedensten Ranges einzugehen, auf allen Stufen der gesellschaftlichen Hierarchie – vom Dieb bis zum Bischof, von der Kneipenwirtin bis zum Prinzen. Mit welchem Genuß erzählt er ihre tiefsten Geheimnisse! Wie genau und treffsicher er ist! Die Testaments Villons sind schon deshalb fesselnd, weil er in ihnen eine Menge genauer Kenntnisse vermittelt. Dem Leser kommt es vor, als könne er sich ihrer bedienen, und so fühlt er sich als Zeitgenosse des Dichters. Der gegenwärtige Augenblick vermag den Druck der Jahrhunderte auszuhalten, seine Unversehrtheit zu bewahren und das gleiche „Jetzt“ zu bleiben. Man muß es nur verstehen, ihn aus dem Erdboden der Zeit herauszuheben, ohne seine Wurzeln zu beschädigen – ansonsten wird er verwelken. Villon hat es geschafft. Die Glocke der Sorbonne, die seine Arbeit am Petit Testament unterbrach, erklingt bis heute.
Wie die Troubadours-Prinzen hat Villon „in seinem Latein“ gesungen: irgendwann, noch als Scholar, hatte er von Alkibiades gehört – und in der Folge schließt sich die unbekannte Archipiade der grandiosen Prozession der Damen der vergangnen Zeiten an.
Das Mittelalter klammerte sich hartnäckig an seine Kinder und trat sie nicht freiwillig an die Renaissance ab. Das Blut des authentischen Mittelalters floß in den Adern Villons. Ihm ist er verpflichtet mit seiner Ganzheit, seinem Temperament, seiner geistigen Eigenart. Die Physiologie der Gotik – denn eine solche gab es tatsächlich, und das Mittelalter war eben eine physiologisch-geniale Epoche – vertrat bei Villon die Weltanschauung und entschädigte ihn im Überfluß für den fehlenden Traditionsbezug zur Vergangenheit. Mehr noch – sie sicherte ihm einen Ehrenplatz in der Zukunft, da die französische Dichtung des 19. Jahrhunderts ihre Kraft aus derselben nationalen Schatzkammer der Gotik schöpfen wird. Nun wird man sagen: was hat denn die herrliche Rhythmik der Testaments, die einmal launisch ist wie ein Stehaufmännchen, dann wieder gemessen wie eine kirchliche Kantilene, mit der Kunst der gotischen Baumeister gemeinsam? Aber ist denn die Gotik nicht der Triumph der Dynamik? Und noch eine Frage: was ist beweglicher, was fließender – eine gotische Kathedrale oder ein weicher Wellengang des Ozeans? Wodurch, wenn nicht durch das Gefühl für Architektonik, erklärt sich das wundervolle Gleichgewicht jener Strophe, in der Villon seine Seele über die Gottesmutter – Chambre de la divinité – und die neun Himmelslegionen der Dreifaltigkeit anvertraut? Dies ist kein blutarmer Flug auf den Wachsflügelchen der Unsterblichkeit, sondern ein architektonisch begründetes Aufsteigen gemäß den Schichten der Kathedrale. Wer als erster in der Architektur das bewegliche Gleichgewicht der Massen verkündete und das Kreuzgewölbe schuf – der hat genial das psychologische Wesen des Feudalismus formuliert. Der Mensch des Mittelalters fühlte sich im Weltgebäude ebenso unentbehrlich und gebunden wie ein beliebiger Stein im gotischen Bau, der mit Würde den Druck der Nachbarn aushält und als unumgänglicher Einsatz in das allgemeine Spiel der Kräfte eingeht. Dienen bedeutete nicht nur ein Tätigsein für das allgemeine Wohl. Unbewußt betrachtete der mittelalterliche Mensch allein schon die ungeschminkte Tatsache seiner Existenz als einen Dienst, als eine Art Heldentat. Villon, das letzte Kind, Epigone der feudalen Weltauffassung, erwies sich als unempfänglich für deren ethische Seite, für die solidarische Bürgschaft. Das Beständige, Sittliche der Gotik war ihm vollkommen fremd. Dafür stand er ihrer Dynamik nicht gleichgültig gegenüber und erhob sie auf die Ebene des Amoralismus. Zweimal erhielt Villon Begnadigungsschreiben – Lettres de rémission – von Königen: von Charles VII. und Louis XI. Er war fest davon überzeugt, einen solchen Brief dereinst auch von Gott zu erhalten, mit der Vergebung all seiner Sünden. Vielleicht verlängerte er ganz im Sinne seiner trockenen und rationalen Mystik die Stufenleiter der feudalen Gerichtsbarkeiten bis ins Unendliche, und in seinem Geiste gärte verworren die wilde, doch zutiefst feudalistische Auffassung, daß es einen Gott über Gott gebe…
„Ich weiß ja gut, daß ich kein Engelssohn bin, gekrönt mit einem Diadem von Sternen oder andern Himmelskörpern“, sagte von sich selber der arme Pariser Schüler, der für ein gutes Abendbrot zu vielem fähig war.
Solche Verneinungen kommen einer bejahenden Zuversicht gleich.
Ossip Mandelstam
(aus dem Russischen von Ralph Dutli in Ralph Dutli: Ossip Mandelstam: „Als riefe man mich bei meinem Namen“. Dialog mit Frankreich – Ein Essay über Dichtung und Kultur, Fischer Taschenbuch Verlag, 1990)
Lebenslange Freundschaft François Villon
Die Gefängnispoesie des Vagabunden Villon
François Villon (1431–1463?) ist der französische Dichter, zu dem sich Mandelstam während seines ganzen Lebens rückhaltlos bekannt hat, den er immer als Vertrauten und Gefährten ansprach, selbst da noch, wo der Leser eine leise Ironie im Text zu vernehmen glaubt. Ob der mittelalterliche Poet und Vagabund als Mitstreiter gegen den russischen Symbolismus oder als Verbündeter gegen den Stalinschen Terror von Mandelstam adoptiert wird – Villon ist immer und unbedingt Freund. Wie fast im ganzen postumen Schicksal des französischen Poeten ist Villon auch in Mandelstams Lektüre als Dichter Existenzfigur – sein Leben und sein Werk sind kaum je voneinander geschieden. 11 Mandelstam hat in dieser zwiespältigen Existenzfigur des Ausgestoßenseins und der Freiheitsliebe den Spiegel seines eigenen Weges gesehen, wie denn auch beim russischen Dichter, und besonders in den dreißiger Jahren, Existenz und Schaffen unablösbar miteinander verhaftet sind.
Die Freundschaft zum französischen Dichter ist anhand von Texten aus allen Schaffensjahrzehnten Mandelstams zu belegen, mit Zeugnissen der zehner, der zwanziger und der dreißiger Jahre. Das erste Zeugnis stammt aus dem Jahre 1913 und stellt einen der ersten Versuche Mandelstams in essayistischer Prosa dar, das letzte wurde im Jahre 1937 geschaffen, findet sich in einem der letzten Gedichte überhaupt.
Betrachtet sei zunächst ein Dokument aus der „Mitte“, eine Reiseskizze der ersten Hälfte der zwanziger Jahre: „Die Rückkehr“, ein Text, der wohl die Vorstudie oder einen Entwurf zur 1923 veröffentlichten Skizze „Die Menschewiken in Georgien“ darstellt. In der „Rückkehr“ gibt es eine Passage über Gefängnisse. Daß der Name François Villons dort auftaucht, kann kein Zufall sein: die wenigen Daten aus dem Leben Villons, die man kennt, sind zumeist mit Aufenthalten hinter Gittern verknüpft. 1455, drei Jahre nach seinem Magisterexamen an der Sorbonne, ist er in ein Handgemenge verwickelt, bei dem der Priester Philippe Sermoise ums Leben kommt. 1462 sitzt er wegen des 1456 begangenen Einbruchs im Collège de Navarre in Haft, 1463 wegen einer von ihm angezettelten Schlägerei. Er wird zum Tod durch den Strang verurteilt, auf Grund einer Appellation jedoch zu einer zehnjährigen Verbannung aus Paris begnadigt.12
Auch ein Detail aus der Biographie Mandelstams ist zum Verständnis der „Rückkehr“ unerläßlich: der Dichter war während der russischen Bürgerkriegswirren im Sommer 1920 zweimal verhaftet worden, zuerst auf der Krim von den Truppen des „weißen“ Barons Wrangel, als angeblich bolschewistischer Spion, sodann in der georgischen Stadt Batumi von den Menschewiken, die Mandelstam als einen Doppelagenten festnahmen, der für Wrangel und für die Bolschewiken gearbeitet hätte.13 Das Mißtrauen bestimmte die Atmosphäre am Schwarzen Meer, und Gefängnisaufenthalte wurden fast zur Gewohnheit – von da her rührt die Ironie des Mandelstamschen Gefängnisporträts:
Ach ihr Gefängnisse, Gefängnisse! Ihr Verliese mit Eichentüren, klirrenden Schlössern, wo der Gefangene eine Spinne füttert und dressiert und zur Fensternische hinaufklettert, um Luft und Licht zu trinken in der kleinen verstärkten Luke; ihr romantischen Gefängnisse des Silvio Pellico , die ihr den Lesebüchern teuer seid, mit Verkleidungen, mit dem Dolch im Brote, mit der Tochter des Kerkermeisters; ihr liebenswerten dekadent-feudalen Gefängnisse VILLONS, MEINES FREUNDES UND LIEBLINGS – Gefängnisse, Gefängnisse, alle seid ihr auf mich eingeströmt, als die donnernde Türe zugeschlagen wurde und ich das folgende Bild sah: in der leeren, schmutzigen Zelle kroch ein junger Türke über den Steinboden und putzte konzentriert alle Ritzen und Winkel mit einer Zahnbürste (III, S. 23f.). (Hervorhebung: RD).
Durch die Nachbarschaft zu den romantischen Gefängnissen Silvio Pellicos (Prigioni, 1832) werden die Gefängnisse Villons selber romantisiert, ja beinah zum Idyll stilisiert. Der immer nur durch Glücksfälle und unverhoffte Begnadigungen dem Strang entschlüpfte François Villon hätte sich gegen eine solche Sicht seiner Kerkertage verwahrt. Im Sommer 1461 etwa hatte er in den Gefängnissen des Bischofs von Orleans, Thibault d’Aussigny, die Folter gekostet, und wäre er nicht zum Anlaß der Thronbesteigung Louis’ XI. amnestiert worden, hätte er nicht einmal mehr Zeit gehabt, sein Hauptwerk, das „Große Testament“, zu verfassen. Für Kerker wie Bischof findet er denn in der Eröffnung des „Testaments“ keinerlei milde Worte:
Peu m’a d’une petite miche
Et de froide eaue tout ung esté;
Large ou estroit, moult me fut chiche:
Tel luy soit Dieu qu’il m’a este!14
Im Sommer saß ich in der Zelle
Bei Wasser und bei trocken Brot:
Karg oder larg – es war die Hölle –
Gott zahl ihm heim, was er mir bot!
(Übertragung: Carl Fischer)15
Bei aller launigen Verzeichnung – zwischen Ironie und Idyll – ist Mandelstams Reiseskizze von 1923 für unsere Belange höchst bedeutsam. Durch die unmißverständlichen Titel „Freund und Liebling“ weist das zitierte Fragment auf das Bekenntnisgedicht von 1937 voraus, das Adjektiv lieb/liebenswert ist ein Hinweis auf Mandelstams dauerhafte Neigung für das französische Mittelalter, und die Tendenz zur Romantisierung erinnert an den biographischen Teil des frühen Villon-Essays, den der zweiundzwanzigjährige Mandelstam 1913, im Manifestjahr des Akmeismus veröffentlicht hatte.
François Villon – Der erste Akmeist
Nadeschda Mandelstam hat in ihren Memoiren die außerordentliche Wichtigkeit der frühen Essays betont, in denen Mandelstam bereits seine Grundgedanken formuliert habe – und diese Grundgedanken seien bis zum Schluß unwiderrufen geblieben. Dem Villon-Essay komme darüber hinaus eine besondere Bedeutung zu: in ihm mischten sich Selbstbekenntnisse Mandelstams unter die Aussagen über Villon, und ein Gefühl der Verwandtschaft deute sich an.16
Begonnen wurde der Text über Villon vermutlich noch 1910 in Heidelberg, wo Mandelstam während zweier Semester bei Fritz Neumann altfranzösische Sprache und Literatur studierte.17 1913, im Manifestjahr des Akmeismus, steht der Essay im vierten Heft der Zeitschrift Apollon, begleitet von einigen Ausschnitten aus Villons „Testament“ in einer Übertragung Nikolaj Gumilevs. Weit davon entfernt, sich von diesem jugendlichen Versuch loszusagen, läßt Mandelstam den Villon-Text seine 1928 in Buchform erscheinende Essaysammlung Über Poesie beschließen. Dort ist als Entstehungsdatum das Jahr 1910 angegeben.
Der Villon-Essay ist eine reizvolle Mischung von Angelesenem und Gedanken von bemerkenswerter Originalität (der vollständige Text – in deutscher Erstübertragung – ist dem vorliegenden Essay als POSTSCRIPTUM beigefügt). Er widerspiegelt zunächst einmal die französische Villon-Kritik der Jahrhundertwende – etwa gleich zu Beginn des Textes, mit dem Vergleich von Verlaine und Villon:
Astronomen vermögen die Wiederkehr eines Kometen nach Ablauf einer großen Zeitspanne genau vorauszusagen. Für diejenigen, die Villon kennen, stellt das Auftauchen Verlaines ein ebensolches astronomisches Wunder dar. Die Schwingungen dieser beiden Stimmen sind sich verblüffend ähnlich. Außer der Klangfarbe und der Biographie jedoch verbindet diese Dichter eine beinah gleiche Mission in der Literatur ihrer Zeit (II, S. 301).
In Heidelberg muß Mandelstam das 1901 erschienene Buch François Villon von Gaston Paris gelesen haben. Den Vergleich von Villon und Verlaine nämlich, dem auch Paul Valéry noch 1937 huldigt,18 hatte Gaston Paris in Mode gebracht:
Verlaine war ein moderner Villon, der, wie der ältere, das Laster kannte, Elend und Gefängnis, der in wechselhafter Liebe Margot und die Jungfrau Maria liebte und es verstand, wie der ältere, inmitten seines „Schmutzes“ eine Blüte von seltener Poesie zu bewahren.19
Hinzugefügt sei jedoch, daß Paul Verlaine selber den Vergleich gesucht hatte, selbst wenn er ihn kokettierend verleugnete:
J’idolâtre François Villon,
Mais être lui, comment donc faire?
C’est un roi du sacré vallon.
J’idolâtre François Villon
Et c’est mon maître en Apollon.
Mais l’homme, c’est une autre affaire!
J’idolâtre François Villon,
Mais être lui, comment donc faire? (…)
(1893?)20
Mandelstam steht auch in Gaston Paris’ Schuld, wenn er zu Beginn seines Textes auf zwei Werke der mittelalterlichen französischen Literatur Bezug nimmt, auf den Roman de la Rose (1237–1280) und Alain Chartiers Belle Dame sans mercy (1424). Der französische Kritiker hatte Villon in die mittelalterliche Literaturtradition gestellt und ihn als Erben des Rosenromans und Alain Chartiers charakterisiert.21
Einen beträchtlichen Teil des Essays nimmt die romaneske Lebensbeschreibung ein. Dieses Vergnügen an der mysteriösen und aufregenden Villon-Biographie spiegelt durchaus auch die Interessen der damaligen Forschung, welche durch die Archivfunde von Auguste Lognon (in dessen Ausgabe von 1892 Mandelstam seinen Villon gelesen haben muß) und Marcel Schwob, der ebenfalls 1892 in einem Essay die bisherigen Ergebnisse der Villon-Exegeten einem breiteren Publikum zugänglich machte, neuen Auftrieb erhalten hatte.22 Aus diesen Quellen hat Mandelstam sein Wissen bezogen – etwa über die Pariser Studentenunruhen von 1451–1453, in die Villon verwickelt sein mußte und in deren Verlauf Wirtshausschilder und Grenzsteine gestohlen wurden, worauf der Hügel der Pariser Stadtheiligen Sainte-Genevieve, im Quartier Latin gelegen, Zeuge seltsamer heidnischer Rituale und gröbster Studentenspäße wurde; über Villons ersten Konflikt mit dem Gesetz, als bei einem Handgemenge der Geistliche Sermoise ums Leben kommt; über den großen Einbruch im Collège de Navarre, die Gefängnisaufenthalte und die Jahre der Irrfahrten.23
Doch Mandelstams Essay ist nicht ein Sammelsurium von Angelesenem – seine Handschrift ist bereits unverkennbar, und es zeigt sich hier schon jenes kunstvolle Ineinandergreifen von Epochen- und Personenporträt (amalgamiert mit literaturkritischer Reflexion), jene „Verkürzung der Distanz zwischen Figur und kulturellem Hintergrund“,24 welche bereits die Technik von Das Rauschen der Zeit (1925) ankündigt. Im Erzählton liegt eine eigenwillige Familiarität, die da und dort gar komplizenhaft erscheint. Die Sympathie Mandelstams für den spätmittelalterlichen Poeten ist nicht abzuleugnen. Mandelstam erzählt jedoch nicht um des Erzählens willen, sondern eignet sich die Wege des französischen Vagabunden so zwanglos-unbefangen an, um ihn zum Kronzeugen der neuen literarischen Gruppierung zu machen, die in Petersburg um 1912 im Entstehen begriffen war.
Im Villon-Essay kommt schon früh eine anti-symbolistische Position zum Ausdruck. Wenn sie 1910 in Heidelberg noch nicht im Text lag, ist sie 1911 oder 1912, als Mandelstam sich in der den Akmeismus vorbereitenden Dichtergilde um Nikolaj Gumilev bewegte, hinzugekommen. Mandelstams Interessen waren eine wichtige Anregung für Nikolaj Gumilev, der 1913 in seinem Manifest „Das Erbe des Symbolismus und der Akmeismus“ bezüglich der Stammväter der neuen Strömung festhält:
In Kreisen, die dem Akmeismus nahestehen, werden am häufigsten die Namen Shakespeare, Rabelais, Villon und Théophile Gautier ausgesprochen. Die Wahl dieser Namen ist nicht willkürlich. Jeder von ihnen ist ein Grundstein für das Gebäude des Akmeismus, eine hohe Konzentration dieses oder jenes seiner Elemente. Shakespeare hat uns die Innenwelt des Menschen gezeigt, Rabelais – den Körper und seine Freuden, eine kluge Leiblichkeit. Villon hat uns vom Leben gekündet, das nicht im geringsten an sich zweifelt, auch wenn es alles kennt, sowohl Gott als auch das Laster, sowohl den Tod wie auch die Unsterblichkeit; Théophile Gautier fand in der Kunst für dieses Leben die würdige Kleidung makelloser Formen. Diese vier Momente in sich zu vereinigen, ist der Traum, der nun jene Menschen untereinander verbindet, die sich so kühn die Akmeisten nennen.25
Von allem Anfang an gibt Mandelstam in seinem Essay zu verstehen, daß er in Villon einen Mitstreiter gegen den Symbolismus sehen will, auch wenn dem Franzosen dadurch eine literarhistorisch schwer zu vertretende Rolle erwächst (Villon wäre der Überwinder der Rhétoriqueurs, eines literarischen Stils, der erst nach ihm, zwischen 1470 und 1520, seine Blüte erlebte):26
Beiden war es beschieden, in einer Epoche gekünstelter Treibhausdichtung aufzutreten, und ähnlich wie Verlaine die SERRES CHAUDES (Treibhäuser; RD) des Symbolismus durchschlug, warf Villon der mächtigen Rhetorischen Schule, die man mit vollem Recht als den Symbolismus des 15. Jahrhunderts auffassen darf, seine Herausforderung entgegen. (II, S. 301)
Villon wird in Mandelstams Essay durch seine Themenwahl zum Akmeisten vor der Zeit: seine Ablehnung des Mondes, die Mandelstam ihm zuschreibt, stünde für die Überwindung eines veralteten, entrückten, jenseitigen Themas, seine Bevorzugung von „gebratenen Enten“ (II, S. 306) wiese ihn als Jünger einer diesseits bezogenen (lies: akmeistischen) Thematik aus. Erinnert sei an die Tatsache, daß das erste wirklich akmeistische Gedicht Mandelstams (aus dem Jahre 1912), in dem sein Dichterkollege Nikolaj Gumilev den Wendepunkt zwischen Symbolismus und Akmeismus sah,27 mit der Verneinung des Mondes anhebt und eine Bejahung des „Hier und jetzt“ darstellt:
Нет, не луна, а светлый циферблат
Сияет мне, и чем я виноват,
Что слабых звезд я осязаю млечность?
И Батюшкова мне противна спесь:
„Который час?“ его спросили здесь,
А он ответил любопытным: „вечность“.
(I, S. 18)
Nein, nicht den Mond – ein Zifferblatt
seh ich dort leuchten. Was kann ich dafür,
daß ich die Sterne milchig seh und matt?
Wie dünkelhaft war Batjuschkows Bescheid!
„Wie spät ist es?“ so fragten sie ihn hier,
und die es wissen wollten, hörten: „Ewigkeit“.
(Übertragung: Paul Celan)28
Ein weiterer implizit akmeistischer Zug Villons liegt in dessen Erkenntnis des „Abgrundes zwischen Subjekt und Objekt“ (II, S. 305). Im Manifest von Gumilev ist dies eines der wichtigsten Argumente in der Abgrenzung des Akmeismus vom Symbolismus: bei den Symbolisten hatten sich die Grenzen zwischen Subjekt und Objekt verwischt, alles war durch geheimnisvolle Entsprechungen (die correspondances aus dem gleichnamigen Sonett Baudelaires) miteinander verbunden.
Mandelstams Essay ist auch da für den Akmeismus charakteristisch, wo er nicht direkt von Villon handelt. Im Abschnitt über die Hiobsgestalten des politisch sehr bewegten 15. Jahrhunderts (die Zeit der englischen Besatzung und anschließender innenpolitischer Wirren) und über deren Gefängnisdichtung fällt das Stichwort von der höflichen romanischen Seele (II, S. 305). Wie etwa zur selben Zeit bei den anglo-amerikanischen Imaginisten um Ezra Pound („The Spirit of Romance“, 1910) herrschte unter den Akmeisten ein Kult des romanischen Geistes. Das bereits erwähnte Manifest des Klarismus (S. 108) von Michail Kuzmin („Über die herrliche Klarheit“, 1910) ist eine Hymne auf die „apollinische Betrachtung der Kunst“, die den romanischen Völkern eigne. Und auch Gumilev feiert 1913 in seinem Manifest, wo drei von den vier Stammvätern des Akmeismus Franzosen sind, den romanischen Geist – in Abgrenzung vom „germanischen“ des russischen Symbolismus:
Der romanische Geist liebt zu sehr das Element des Lichtes, das die Gegenstände heraustrennt, die Umrißlinie deutlich sich abzeichnen läßt; jenes symbolistische Zerfließen aller Bilder und Dinge, die Unbeständigkeit ihres Angesichts, hatte nur im nebligen Dunkel der germanischen Wälder entstehen können. (…) Die neue Strömung, von der ich oben gesprochen habe, gibt dem romanischen Geist entschieden den Vorzug vor dem germanischen.29
An einer Stelle jedoch scheint sich ein tiefer Widerspruch zwischen der Gestalt Villons und der akmeistischen Doktrin zu ergeben. Wiederholt weist Mandelstam auf die Amoralität Villons hin. 1922, im Essay „Über die Natur des Wortes“, in seinem Rückblick auf die Anfänge des Akmeismus, hebt Mandelstam hingegen die moralische Wiedergeburt hervor, die sich mit der Ablösung vom Symbolismus vollzogen habe. In diesem Essay versteht Mandelstam den lebensbejahenden Akmeismus als Auflehnung gegen den vom Symbolisten Valerij Brjusov gepredigten Dämonismus und Nihilismus (II, S. 258). Der Widerspruch läßt sich in drei Richtungen lösen. Nachdem Mandelstam in Abwandlung eines Verlaine-Verses die Villonsche „Poetik des Dynamischen“ („Du mouvement avant toute chose“ (II, S. 306)) skizziert hat, spricht er die Vermutung aus, Villon sei nicht vom Dämonismus, sondern von der Dynamik des Verbrechens fasziniert gewesen; die finstere Gesellschaft, mit der er sich verband, hätte ihn durch großes Temperament, durch einen mächtigen Lebensrhythmus gefesselt. Der Kult der Bewegung, der Dynamik hat hier für Mandelstam den Vorrang vor einer epochenabhängigen Moralität.
Eine weitere Auflösung des Widerspruchs ergibt sich durch Beizug des ebenfalls 1913 in Apollon veröffentlichten Essays „Über den Gesprächspartner“ (vgl. S. 40f.). Mandelstam trifft dort eine Unterscheidung zwischen Dichtung und Literatur. Der Literat halte sich an das Grundgesetz, daß Belehrung der Nerv der Literatur sei. Der Dichter jedoch spreche nicht von einer moralisch höheren Warte aus zu seinen Zeitgenossen, sondern sei nur mit dem providentiellen Gesprächspartner, seinem künftigen Leser verbunden. Villon, in dessen Versen der providentielle Gesprächspartner Mandelstam einen lebendigen Reiz findet, habe weit unter dem durchschnittlichen geistigen und sittlichen Niveau der Kultur des 15. Jahrhunderts gestanden (II, S. 237f.). Die endgültige Auflösung des Widerspruchs jedoch wird Mandelstam im Villon-Gedicht von 1937 leisten, wie wir noch sehen werden – durch eine politisch bedingte radikale Umwertung der Begriffe von Moral und Unmoral.
Nicht die ganze Themenfülle des Villon-Essays kann hier diskutiert werden – auch wenn etwa Mandelstams Überlegungen zur Autonomie der Kunst, zur Zeit- und Kunstphilosophie des Dichters (zu den Wurzeln des Augenblicks, die der Künstler unversehrt aus dem Erdboden der Zeit heben müsse) oder zur Gespaltenheit des Lyrikers im Namen eines inneren Dialoges, zu seinem lyrischen Hermaphroditismus („Welch eine vielfaltige Auswahl bezaubernder Duette: der Betrübte und der Tröstende, die Mutter und das Kind, der Richter und der Angeklagte, der Besitzende und der Bettler …“ (II, S. 305)) besonders lohnend erschienen.
Zwei Dinge in diesem Text über den mächtigen Visionär Villon (II, S. 307) seien hier jedoch herausgegriffen, da sie bei Mandelstam eng mit der französischen Kultur verknüpft sind. Da ist zunächst die Faszination der Welt des Mittelalters – eine der Konstanten des Mandelstamschen Werkes. Der Villon-Essay ist geprägt vom Bestreben des Dichters, sich in das Weltgefühl des mittelalterlichen Menschen zu versetzen. Bezeichnend etwa die Aussage, die Menschen des Mittelalters hätten sich als „Kinder der Stadt, der Kirche, der Universität“ begriffen (II, S. 303). Bedeutet wird hier ein kindliches Aufgehobensein der Menschen in einer für sie bis in die Ständeordnung gottgewollten, intakten und ganzheitlichen Welt diesseits der modernen Zerrissenheit. Villon liebt er denn nicht seiner vielgepriesenen Modernität wegen, sondern als Verkörperung des Mittelalters, das er im Essay eine „physiologisch-geniale Epoche“ nennt, es damit als körperlich-organisches, unteilbar kluges Ganzes verstehend:
Das Mittelalter klammerte sich hartnäckig an seine Kinder und trat sie nicht freiwillig an die Renaissance ab. Das Blut des authentischen Mittelalters floß in den Adern Villons. Ihm ist er verpflichtet mit seiner Ganzheit, seinem Temperament, seiner geistigen Eigenart. (II, S. 308)
Eng mit der Faszination des Mittelalters verknüpft ist bei Mandelstam der Kult der gotischen Architektur. Frische und Originalität kennzeichnen hier seine Gedanken. Jahre bevor der französische Kritiker Jean-Marc Bernard in Villons „Testament“ eine „literarische Kathedrale“ entdeckte (1918),30 hatte der russische Dichter die Physiologie der Gotik in Villons Versen aufgespürt und den Poeten in die Nähe der Kathedralenerbauer gerückt.
Nun wird man sagen: was hat denn die herrliche Rhythmik der TESTAMENTS, die einmal launisch ist wie ein Stehaufmännchen, dann wieder gemessen wie eine kirchliche Kantilene, mit der Kunst der gotischen Baumeister gemeinsam? Aber ist denn die Gotik nicht der Triumph der Dynamik? (…) Wodurch, wenn nicht durch das Gefühl für Architektonik, erklärt sich das wundervolle Gleichgewicht jener Strophe, in der Villon seine Seele über die Gottesmutter – CHAMBRE DE LA DIVINITÉ – und die neun Himmelslegionen der Dreifaltigkeit anvertraut (Achtzeiler LXXXV des Testament; RD)?. Dies ist kein blutarmer Flug auf den Wachsflügelchen der Unsterblichkeit, sondern ein architektonisch begründetes Aufsteigen gemäß den Schichten der gotischen Kathedrale. (II, S. 308)
Gewiß hatte Villon die Kunstwerke der Kathedralenerbauer in der Ile-de-France zeitlebens vor Augen, gewiß waren deren Schöpfungen gegenwärtig. Die kühne Assoziation eines Dichters des 15. Jahrhunderts mit den Größen des Kathedralenbaus (zweite Hälfte des 12. Jahrhunderts/13. Jahrhundert) zeigt jedoch, daß sich Mandelstams Mittelalter-Leidenschaft eher in den Bereichen des Mythos aufhält als in denjenigen der Historie. All jene Züge des ausgehenden Mittelalters, welche Niedergang bedeuten – es ist die Epoche des Aberglaubens, der Teufels- und Hexenangst, der Tode auf dem Scheiterhaufen, des Bewußtseins einer Endzeit, des Totentanzes31 – sind aus diesem Mythos verbannt. François Villon erscheint beim russischen Dichter als direkter Erbe jener gewaltigen, ungebrochenen Schaffenskraft, die zum Kathedralenbau notwendig. war, und in dieser gotischen Kathedrale vermögen sich für ihn noch immer unverändert Weltgefühl, Ständeordnung und Ethik des mittelalterlichen Menschen – mit ihren ineinandergreifenden Prinzipien des notwendigen Dienstes am Ganzen bei intakter Würde des Einzelnen – zu versinnbildlichen.
Der Mensch des Mittelalters fühlte sich im Weltgebäude ebenso unentbehrlich und gebunden wie ein beliebiger Stein im gotischen Bau, der mit Würde den Druck der Nachbarn aushält und als unumgänglicher Einsatz in das allgemeine Spiel der Kräfte eingeht. (II, S. 308)
Beide herausgegriffenen und bei Mandelstam in enger Verbindung stehenden Themen – Faszination des Mittelalters, Kult der gotischen Architektur – bedürfen hier je eines kleinen Exkurses, eines Ausblickes auf ihr weiteres Schicksal in Mandelstams Werk.
Ralph Dutli, aus Ralph Dutli: Ossip Mandelstam: „Als riefe man mich bei meinem Namen“. Dialog mit Frankreich – Ein Essay über Dichtung und Kultur, Fischer Taschenbuch Verlag, 1990
FRANÇOIS VILLON 1456
he du schöne
du mädchen mit dem regenbogen
über dem kopf
komm her
wärm deine nassen
nackten füße
in den taschen
meines löchrigen rocks
doch paß auf vielleicht
bleibt dir an der sohle klebe
mein letzter sou
dann mädchen
schlepp ich dich zu jean diesem vieh
und zwölf männer werdens mit dir treiben
oder dreizehn
denn du bist ein nettes ding
und sicher nicht abergläubisch
Rolf Bossert
VILLON
Du, die Landschaft Touraine
durchstreifend: Steingrund
großer Städte immer
unter den Schritten, du
kommst nicht zurück.
Mond
hinter dir, schräg,
die langen Schatten voraus
vom Getürm und den Bäumen.
Einer geht da, pfeifend.
Den umhängt mit flüchtigen
kleinen Wolken – Chitongeweb –
der Diebsgott, ein griechischer, heißt’s.
Kahlkopf, schwenk den Hut!
Dein Bild auf den mördrischen Spiegeln
aller Weiher! Im windigen Nord
weit das Fischernest:
unter der Mauer, im schiefen
Dach, in den Nebeln,
wirst du schlafen, die Männer
kommen morgens vom Fang, das Getränk
steht an den Herd gerückt,
da springt in den Pfannen der lautlose
Martyr, er glänzt vom ÖL,
der Meerfisch. – „Da werd ich schlafen.“
Johannes Bobrowski
BALLADE AUF DEN DICHTER FRANÇOIS VILLON32
1
Mein großer Bruder Franz Villon
Wohnt bei mir mit auf Zimmer
Wenn Leute bei mir schnüffeln gehen
Versteckt Villon sich immer
Dann drückt er sich in’ Kleiderschrank
Mit einer Flasche Wein
Und wartet bis die Luft rein ist
Die Luft ist nie ganz rein
Er stinkt, der Dichter, blumensüß
Muß er gerochen haben
Bevor sie ihn vor Jahr und Tag
Wie’n Hund begraben haben
Wenn mal ein guter Freund da ist
Vielleicht drei schöne Fraun
Dann steigt er aus dem Kleiderschrank
Und trinkt bis morgengraun
Und singt vielleicht auch mal ein Lied
Balladen und Geschichten
Vergißt er seinen Text, soufflier
Ich ihm aus Brechts Gedichten
2
Mein großer Bruder Franz Villon
War oftmals in den Fängen
Der Kirche und der Polizei
Die wollten ihn aufhängen
Und er erzählt, er lacht und weint
Die dicke Margot dann
Bringt jedesmal zum Fluchen
Den alten alten Mann
Ich wüßte gern was die ihm tat
Doch will ich nicht drauf drängen
Ist auch schon lange her
Er hat mit seinen Bittgesängen
Mit seinen Bittgesängen hat
Villon sich oft verdrückt
Aus Schuldturm und aus Kerkerhaft
Das ist ihm gut geglückt.
Mit seinen Bittgesängen zog
Er sich oft aus der Schlinge
Er wollt nicht, daß sein Hinterteil
Ihm schwer am Halse hinge
3
Die Eitelkeit der höchsten Herrn
Konnt meilenweit er riechen
Verewigt hat er manchen Arsch
In den er mußte kriechen
Doch scheißfrech war François Villon
Mein großer Zimmergast
Hat er nur freie Luft und roten
Wein geschluckt, gepraßt
Dann sang er unverschämt und schön
Wie Vögel frei im Wald
Beim Lieben und beim Klauengehn
Nun sitzt er da und lallt
Der Wodkaschnaps aus Adlershof
Der drückt ihm aufs Gehirn
Mühselig liest er das ,ND‘
(Das Deutsch tut ihn verwirrn)
Zwar hat man ihn als Kind gelehrt
Das hohe Schul-Latein
Als Mann jedoch ließ er sich mehr
Mit niederm Volke ein
4
Besucht mich abends mal Marie
Dann geht Villon solang
Spazieren auf der Mauer und
Macht dort die Posten bang
Die Kugeln gehen durch ihn durch
Doch aus den Löchern fließt
Bei Franz Villon nicht Blut heraus
Nur Rotwein sich ergießt
Dann spielt er auf dem Stacheldraht
Aus Jux die große Harfe
Die Grenzer schießen Rhythmus zu
Verschieden nach Bedarfe
Erst wenn Marie mich gegen früh
Fast ausgetrunken hat
Und steht Marie ganz leise auf
Zur Arbeit in die Stadt
Dann kommt Villon und hustet wild
Drei Pfund Patronenblei
Und flucht und spuckt und ist doch voll
Verständnis für uns zwei
5
Natürlich kam die Sache raus
Es läßt sich nichts verbergen
In unserm Land ist Ordnung groß
Wie bei den sieben Zwergen
Es schlugen gegen meine Tür
Am Morgen früh um 3
Drei Herren aus dem großen Heer
Der Volkespolizei
„Herr Biermann“ – sagten sie zu mir –
„Sie sind uns wohl bekannt
Als treuer Sohn der DDR
Es ruft das Vaterland
Gestehen Sie uns ohne Scheu
Wohnt nicht seit einem Jahr
Bei Ihnen ein gewisser
Franz Fillonk mit rotem Haar?
Ein Hetzer, der uns Nacht für Nacht
In provokanter Weise
Die Grenzsoldaten bange macht“
– ich antwortete leise:
6
„Jawohl, er hat mich fast verhetzt
Mit seinen frechen Liedern
Doch sag ich Ihnen im Vertraun:
Der Schuft tut mich anwidern!
Hätt ich in diesen Tagen nicht
Kurellas Schrift gelesen
Von Kafka und der Fledermaus
Ich wär verlorn gewesen
Er sitzt im Schrank, der Hund
Ein Glück daß Sie ihn endlich holn
Ich lief mir seine Frechheit längst
Ab von den Kindersohln
Ich bin ein frommer Kirchensohn
Ein Lämmerschwänzchen bin ich
Ein stiller Bürger. Blumen nur
In Liedern sanft besing ich.“
Die Herren von der Polizei
Erbrachen dann den Schrank
Sie fanden nur Erbrochenes
Das mählich niedersank
Wolf Biermann
FRANÇOIS VILLON
Solang die Erde sich noch dreht,
aaasolang noch Licht sie füllt,
gib, Herr, doch jedem, was ihm fehlt:
aaadem Weisen einen Kopf,
dem Ängstlichen den Hengst,
aaadem Glücklichen gib Geld…
Und denke auch an mich.
Solang die Erde sich noch dreht,
aaa– Herr, Deine Macht!
Mach, daß sich die Macht
aaader Machtbesessnen nicht bemächtigt:
dem Großmütigen gib genügend Atemweite,
aaasei es auch bloß bis zu der Tagesneige,
räume Kain die Reue ein –
aaaund denke auch an mich.
Ich weiß, was alles Du vermagst,
aaain Deine Weisheit setze ich Vertrauen –
wie der gefallene Soldat
aaaans Weiterleben drüben glaubt
und wie ein jedes Ohr an Deinen
aaaleisen Lippen hängt,
vertrauen auch wir selber Dir,
aaanicht wissend, was wir tun!
Gott, o Herr, Grünauge mein!
aaaSolang die Erde sich noch dreht,
– und das kommt ihr selbst seltsam vor –,
aaasolang sie Zeit genug und Feuer hat,
gib jedem, Du, davon ein bißchen.
aaaUnd denke auch an mich.
Bulat Okudschawa
Deutsch von Felix Philipp Ingold
Fakten und Vermutungen zum Autor + Internet Archive + Kalliope
Fakten und Vermutungen zum Übersetzer + Reportage +
Gesellschaft + Facebook + Archiv + Sammlung Knupfer +
Internet Archive 1 & 2 + Kalliope + IMDb + KLG + ÖM +
Bibliographie + Interview 1 & 2 + Georg-Büchner-Preis 1 & 2
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Brigitte Friedrich Autorenfotos +
deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Ausschnitte aus dem Dokumentarfilm Die Jagd nach H.C. Artmann von Bernhard Koch, gedreht 1995.
H.C. Artmann 1980 in dem berühmten HUMANIC Werbespot „Papierene Stiefel“.


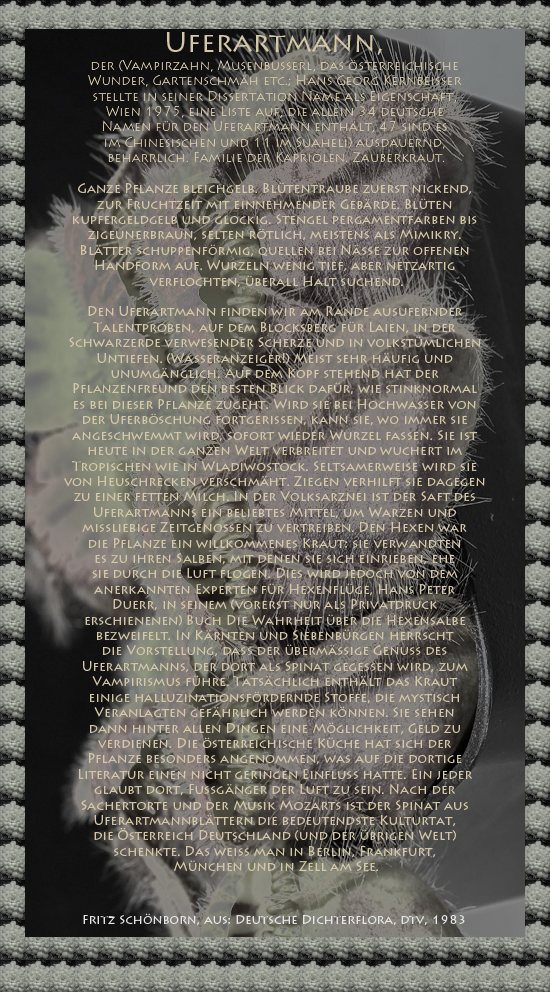












Schreibe einen Kommentar