František Hrubín: Romanze für ein Flügelhorn
MEIN GESANG
Von Zweifeln und von Traurigkeiten voll
sei mein Gesang, sein Jubel oder Klagen,
von Art der Wellen, die wie toll
dem Künftigen zujagen.
Und stets erfüllt vom Menschen her,
Haft mag ihm nur das Herz bescheren;
trotz Angst und Wunden töne er
niemals im Menschenleeren!
Nachwort
Eines seiner Gedichte in dem Band Bis zum Ende der Liebe von 1961 hat František Hrubín mit den Versen abgeschlossen:
… jede Sekunde
fürs Leben,
jede Sekunde
wider den Tod.
Der damals einundfünfzigjährige Hrubín hatte damit ein Bekenntnis formuliert, das gleichsam als Erkenntnis seines Lebens und Wirkens spätestens seit den frühen vierziger Jahren für sein Werk galt: das Bekenntnis zur Kraft des eindringlichen poetischen Wortes, das in den Zeitgenossen das Wissen um die einmalige Chance und Verpflichtung des individuellen Lebens wecken hilft und ihnen so die Verantwortung gegenüber der Gesellschaft bewußt macht. Bei aller Dynamik, die wie jedes bedeutende Werk auch das von František Hrubín auszeichnet, erfassen diese Verse eine der wesentlichen Konstanten seines Werkes, das er als Dramatiker, Prosaist, Kinderbuchautor, Essayist und vor allem als Dichter in fast vier Jahrzehnten geschaffen hat. Dieses Wirken, das in die entscheidende Umbruchsepoche der neuesten tschechischen Geschichte fällt, wodurch der ideelle Reifegrad und die persönliche Erfahrungswelt des Dichters Hrubín geprägt wurden, spiegelt sich natürlich in unterschiedlichsten poetischen Ausdrucksformen wider.
Sie reichen von der sorglosen Trunkenheit glückhaft empfundener Jugendliebe bis zum schmerzhaften Erkennen des nahen Alters, der Gewißheit, daß „jemand an die Tür geklopft hat“, wie er 1968 schrieb, den Tod gleichsam körperlich spürend. Aber da ist auch das Bangen um das Schicksal seiner tschechischen Heimat „in den verzweifeltsten Nächten“ des Jahres 1942, da dem Dichter die „Namen Wolga und Don“ die einzige Hoffnung sind. Und da ist die überschäumende Freude über die Befreiung in den blühenden Maitagen 1945 durch die Söhne des Landes Lenins, die die unmenschliche Schwere eines Sechstels der Erde tragen“, und der Preisgesang auf seine Heimat in ihrem neuen Geborgensein. Aber es fehlt auch nicht die Mahnung, den schwer errungenen Frieden zu schützen, der Aufruf an das Gewissen der Völker, nach der Ungeheuerlichkeit jenes 6. August 1945 in Dichtungen wie „Hiroshima“ oder „Die Verwandlung“ poetisch gestaltet.
Hrubín, einer der subjektivsten Dichter der tschechischen Poesie, der in der Intensität seines Erlebens und Schaffens stets „bis ans Ende gehen“ will und es auch vermag, ist zugleich ein Dichter von außerordentlicher gesellschaftlicher Kraft. Selbst privateste Motive wie die Liebe zwischen Mann und Frau oder Vater und Sohn, die Erinnerungen an die Kindheit und Jugend, das Bangen vor dem Alter oder das Empfinden der Schönheit der Natur weiß er auf die Gesellschaft zu beziehen, Oft hymnisch oder pathetisch-preisend, besonders in den größeren zyklischen Dichtungen voller Dramatik und Dynamik, ist er bestrebt, die Spannweite seiner Kunst groß zu halten und seine Dichtung von der geheimsten Regung des Herzens und den zartesten Nuancen einer Stimmung bis ins Sternenhaft-Kosmische der Majestät des Alls zu heben.
Von seinem ersten Gedichtband, Aus der Ferne gesungen (1933), an bis zu seiner letzten Arbeit, der allegorischen Weihnachtsballade „Das Krippenspiel von Lešany“ (1970), hat Hrubín einen intensiven Dialog mit der Zeit geführt. Als František Hrubín, geboren am 17.9.1910 in Prag, im Herbst 1933 als Student an der Philosophischen Fakultät der Prager Karls-Universität, seinen ersten Gedichtband, Aus der Ferne gesungen, veröffentlichte, war diese Lyrik noch – um ein mehrfach von ihm selbst verwendetes Bild zu gebrauchen – ein „Aufblitzen“. Mit melodischem Wohlklang waren in diesen Versen Betrachtungen über die Natur, das Wandern der Sterne oder das Mädchen in der Nacht eingefangen, in einem Schwebezustand zwischen Ekstase und Wehmut, und zwar einer elegisch-traklhaften Wehmut. Hier wie in den folgenden Gedichtbänden Die von Armut Schöne (1954) und Erde nach den Mittagen (1937) war sein thematisches Feld zwischen Liebe und Tod abgesteckt, war er auf der Suche nach Werten, die die Beständigkeit des Daseins allgemein ausdrücken sollten. Er hing einer Welt der Harmonie in franziskanischer Demut an, die so gar nicht der Realität jener Zeit entsprechen wollte. Hrubín zählte in den Jahren vor dem Münchner Diktat zu den Dichtern, die auf metaphysische Werte bauten und weit entfernt waren von der kämpferischen, weltverändernden Position eines Jiří Wolker, Josef Hora oder S.K. Neumann, die schon ein Jahrzehnt vor Hrubíns Debüt in der proletarischen Poesie bedeutende weltliterarische Leistungen erreicht hatten. Auch die eruptive Kraft eines Vítězslav Nezval oder Konstantin Biebl, die in der zweiten Hälfte der zwanziger Jahre im Zeichen des Poetismus eine phantasievolle, lebenszugewandte „avantgardistische“ Literatur schufen und sich dann in den dreißiger Jahren für ein reichliches halbes Jahrzehnt das Experiment des französischen Surrealismus zu eigen machten, war in seinen Versen nicht enthalten.
Die ausgehenden dreißiger Jahre mit dem verhängisvollen Münchner Diktat und dem faschistischen „Protektorat“ zwangen aber jeden tschechischen Kunstschaffenden zur unmittelbaren Parteinahme. František Halas oder Vladimír Holan, die kurz vor Hrubín in die tschechische Poesie eingetreten waren, hatten in Gedichtsammlungen von zündender Eindringlichkeit gegen dieses Diktat protestiert. Der proletarische Vilém Závada, um fünf Jahre älter als Hrubín, hatte ebenfalls Gedichte des Zornes und der Zuversicht geschrieben. So verbündeten sich in der Zeit der Gefahr Dichter wie Neumann, Nezval, Seifert, Hora oder Biebl, um trotz unterschiedlicher Ausgangspositionen und Grundhaltungen den Widerstandswillen eines bedrohten und stolzen Volkes zu artikulieren. Auch Hrubín fand zu ihnen. Gedichte wie „Spanisches Land“ oder „Barbarischer Gesang“ aus der Sammlung von 1937 signalisierten diesen Umbruch. In Versen von der „verbrannten Liebe“ oder vom Aufruf gegen Kleinmut und Angst deuteten sich nun jene Motive und Themen an, die in den schweren Kriegsjahren seine Poesie bestimmen sollten.
Unter den Bedingungen des faschistischen „Protektorats“ konnte ein tschechischer Dichter allerdings jene gesellschaftliche Konkretheit, wie sie uns in den genannten Gedichten Hrubíns entgegentritt und auch für ihn bis dahin die Ausnahme war, nicht wiederholen. Soweit sich ein Schriftsteller legal zu äußern vermochte, war es wohlverstandene Demonstration und Trotz genug, wenn er von der nationalen kämpferischen Tradition sprach, die tschechische Sprache und Kultur pries und sein tapferes Volk. Jubiläen wie die des genialen Sängers der tschechischen Romantik Karel Hynek Mácha oder der aufrechten Demokratin und großen realistischen Gestalterin Božena Nĕmcová wurden so zum klug genutzten Anlaß, Protest und Widerstandswillen zu bekunden.
Für Hrubíns Dichtung jener Jahre „des stinkenden Schlamms“ – wie sein Freund František Halas diese Zeit umschrieb – gewann die poetisch formulierte Verbundenheit mit der Heimat gleichsam existentielle Bedeutung. Das schöne mittelböhmische Land am Zusammenfluß von Sázava und Moldau bei Lešany, dem Geburtsort seiner Mutter, wird ihm Wahrzeichen und Sinnbild der Zuflucht und der Ruhe.
In Lešany hatte Hrubín acht Jahre seiner Kindheit, und zwar von 1914 bis 1922, verbracht. Vor allem durch die Kinderbücher, die Hrubín seit 1943 schrieb und die ihn in den fünfziger Jahren zu einem der angesehensten und beliebtesten tschechischen Kinderbuchautoren werden ließen, und durch seine Lyrik wurde dieses Land, das während des Krieges von der SS zum Übungsgebiet erklärt wurde und von Tschechen deshalb nicht betreten werden durfte, zum Symbol der Heimstatt, der Sicherheit und Geborgenheit. Hier sah er die Gemeinschaft jener, die sich auch unter der faschistischen Okkupation echte Menschlichkeit zu bewahren wußten und sich bemühten, sie tagtäglich zu leben. So ist die Hoffnung auf eine bessere Zeit, etwa in dem ideell bedeutsamen Gedicht „Gesang der Gräber und des Lichts“ aus der Sammlung Die Erde Schicksalsgöttin von 1941, symbolträchtig artikuliert durch das große Aufbäumen und Keimen der Erde trotz Winter und Tod:
Ich weiß, was tief im Dunkel drängt,
wo Erde mit der Wildheit eines Schwarms
von Wespen König Tod anhängt.
Was Hrubín in Gedichten dieser Art – und die endgültige Fassung seiner Lyrik der Kriegsjahre erschien 1947 unter eben diesem bezeichnenden Titel Gesang der Gräber und des Lichts – nur anzudeuten vermochte, das schrieb er dann in jenen Werken direkt und deutlich nieder, die er erst nach der Befreiung 1945 veröffentlichen konnte.
In seinem Stalingrad-Poem hat Hrubín ein bedeutendes Werk der Hoffnung und der Zuversicht geschaffen. In Stalingrad, so schrieb er Ende 1942, kämpften und starben die sowjetischen Verteidiger nicht nur für ihre Heimat, sondern für alle „Armen“ der Welt:
… Dort stirbt man reihenweise hin.
Da wir die Waffen niederlegten,
erwarten wir sie von den Brüdern…
aaaaaaaaaaaaaaaaaaa… das Volk
hat seine Hand aus Stahl
zur Stalingrader Faust geballt,
schöpft Atem aus dem Duft der Erde,
stirbt für die Armen dieser Welt!
Dieses Kurzpoem erschien als Triptychon zusammen mit den Dichtungen „Brot mit Stahl“ und „Der Prager Mai“ im Jahre 1945. In dieser poetisch und politisch bedeutenden Dokumentation vom Fühlen und Denken des tschechischen Volkes in den „sechs schreienden Jahren“, wie Hrubín die Zeit des „Protektorats“ nannte, spiegelt sich der Umschlag vom geballten Zorn zur mitreißenden Freude über die endliche Befreiung durch die Rote Armee wider.
Auf dem Hintergrund des historischen Geschehens, das er zunehmend als großen gesellschaftlichen Prozeß versteht, verständigt sich Hrubín in dem Poem „Hiobsnacht“ von 1945 in einer Auseinandersetzung mit sich selbst über die Funktion der Kunst. Die neu gewonnene Sicht auf und Einsicht in die gesellschaftlichen Zusammenhänge hat zur Folge, daß der Dichter jetzt den Kampf zwischen der „alten Welt“ mit ihren „schwarzen Dämonen“ und der neuen Welt, „geboren durch Lenin und die Revolution“, als prinzipiellen Kampf um die Entwicklung der Menschheit und die Humanität betrachtet. Im „Osten tragen die schönen Menschen die unmenschliche Schwere eines Sechstels der Erde… Ihr schrecklich unschuldiger Blick wirft das Feuer hinter die Feste der alten Welt, bis der Bau der ganzen Erde erschüttert wird“, schreibt Hrubín und knüpft, sicher unbewußt, an die Revolutionsdichtung der frühen zwanziger Jahre an. Und diese neue Welt, für Hrubín seit seinem Stalingrad-Poem eine wesentliche Metapher, ist das Unterpfand, daß auch „das böhmische Land, diese… abgetretene Opanke, in den Hohlweg des Himmels geworfen“, aus seiner jahrhundertealten Not herausfinden wird. Denn dieses neue Land, das da „blutig auferstanden ist“, erkennt überall seine Kinder, „die Erniedrigten, Beleidigten, Geschlagenen“.
Die Hoffnung, die Hrubín in Versen dieser Art artikuliert, ist verkörpert in den Taten jener Menschen, die an der Wolga und in der Steppe, das Vermächtnis des Großen Oktober erfüllend, ihr Land und damit zugleich die Humanität der Welt verteidigten.
Vom bloßen „Aufblitzen“ kann längst nicht mehr die Rede sein. Für Hrubín ist inzwischen „die Erfahrung zur Idee“ geworden. Er ist jetzt fähig, die gesellschaftlichen Prozesse in ihrem Zusammenhang zu erfassen. Das befähigt ihn aber auch, die Position des Dichters in der Gesellschaft eindeutig zu bestimmen. Der symbolhafte Dichter Hiob, der von seiner Warte der Einsamkeit aus „die alte Welt“ pries, ist für die „neue Welt“ unbrauchbar. Hier ist der Dichter ein aktiver Teil der Gesellschaft und Teilhaber bei der Gestaltung der neuen Gemeinschaft, die anzustreben ist. Poesie muß also aus dem Vorwärtsbewegen der Gesellschaft erwachsen. Das wiederum bedeutet Parteinahme, leidenschaftliches Eintreten für die progressiven Ideen und die Verwirklichung der neuen Humanität, der Hrubín mit seiner Poesie voranhelfen will.
Die Auseinandersetzung mit dem Faschismus bleibt dabei für ihn auch in den folgenden Jahren eine verpflichtende Thematik. In der Sammlung Der Fluß Unvergessen von 1946 und im Band Unermeßliches schönes Leben von 1947 finden sich Gedichte von entlarvender Kraft, wie das exemplarische „Hunde-Nocturne“:
Finstre, gottverlaßne Nacht,
in mir winseln tote Hunde,
die der Tod gefügig macht…
… Zieht der Mond auf, heulen sie,
heult in mir, zermalmt vom Elend,
Menschlichkeit auf wie ein Vieh…
Die Befreiung, für die tschechische Poesie ab 1945 einer der ideellen Ausgangspunkte, wird für Hrubín – wie für S.K Neumann oder Jaroslav Seifert, Vítězslav Nezval, Vladimír Holan oder Vilém Závada – ein anderes wichtiges Inspirationsfeld. Fast schon klassisch zu nennen ist das mitreißende Gedicht vom „Flügelhorn beim Dorffest“:
Aus Dielenbrettern stampften eure Füße
in Gräbern längst erfrorne Schritte,
und greise, antlitzlose Weiber
berückten mit dem Mond da, Fenster –
ich trug die Tollheit in die Stille,
nun freut euch, bis im Morgenblauen
der Hahn schreit und Vernunft befiehlt…
Mahnung und Hoffnung sind die beiden Pole, zwischen denen sich Hrubíns Dichtung in der zweiten Hälfte der vierziger Jahre entfaltet. In dem Gedichtband Unermeßliches schönes Leben erweist er sich als Dichter einer echten Volkstümlichkeit: Die Freude über die Befreiung und das Gefühl der Verbundenheit mit dem Lande Lenins, die Liebe – wie ehedem und bis an sein Lebensende eine entscheidende Inspirationsquelle und die Vorbedingung, daß diese Erde menschlich und bewohnbar bleibt. Und immer wieder beschwört er in Kindheitserinnerungen die Majestät der Natur herauf, benutzt er das Motiv von den „spähenden Knaben am Wehr“. Und schließlich die Begegnung mit der Dichtung Verlaines mitten in den Bombennächten, die ihm Hoffnung auf den Frieden gibt.
Eine neue Weltbezogenheit erhält sein Werk mit dem Poem „Hiroshima“ (1948). „Noch immer fällt das“, heißt es in einem der beschwörenden Gedichte dieses Zyklus gegen die schreckliche Potenzierung der zerstörenden Energie, gegen die Hrubín – Oppenheimer zitierend – „das einfache Sehnen zu leben“ stellt, „das sich im Menschen kosmisch erhebt“.
Wie Nezval in seiner Dichtung „Ich singe den Frieden“ greift er damit eins der damals aktuellsten politischen Themen auf und stellt den unmittelbaren Bezug des furchtbaren Geschehens im Fernen Osten zu seiner tschechoslowakischen Heimat her.
Danach sammelt Hrubín gleichsam Kraft zu neuer schöpferischer Arbeit. Er, der schon lange in Prag heimisch geworden ist, entdeckt für sich jetzt Südböhmen, das Land der grüblerischen Versonnenheit, das der impressionistische Dichter Antonín Sova um die Jahrhundertwende in die tschechische Literatur eingebracht hat. Er bleibt dabei in der Art, wie er der Natur dieses Gebietes begegnet, sich selber treu. Wie in seiner Jugenddichtung sind es häufig die Wasserläufe, die Wehre und großen Fischteiche, die ihn faszinieren, aber auch die eigenwilligen Menschen um den Flecken Chlum.
Das Heimatgefühl findet in der tschechischen Poesie der fünfziger Jahre, wie etwa Josef Kainars Poem „Der tschechische Traum“ von 1953 zeigt, einen besonders nachhaltigen Niederschlag. Hrubín schreibt über das südböhmische Land Verse voll beglückender Harmonie. In Kindergedichten, die in ihrer melodisch-rhythmischen Schmiegsamkeit zu den schönsten Beispielen der tschechischen Lyrik gehören, sowie in zahlreichen Bänden, die seine neugewonnene Souveränität und Vielseitigkeit belegen, hat er diesem Gefühl Ausdruck verliehen. Dazu gehören seine bekenntnishaften Gedichtbände Mein Gesang (1956) und Bis zum Ende der Liebe (1961), sein philosophisches Poem „Die Verwandlung“ (1957) und seine „Romanze für ein Flügelhorn“ (1962), in der er sich freudvoll-wehmütig an die erste Liebe erinnert. Hierzu zählen aber auch – und das ist neu für den Dichter Hrubín – seine lyrischen Dramen Augustsonntag (1958) oder Kristallklare Nacht (1961), auf tschechischen Bühnen seinerzeit vielgespielte Theaterstücke, in denen der Autor der Echtheit menschlicher Beziehungen und Empfindungen nachspürt. Und nicht zuletzt sind hier seine Prosawerke zu nennen: der Zyklus Am Tisch (1958), Kindheitserinnerungen voll lyrischer Sensibilität, und die sprachlich meisterhafte Erzählung „Die goldene Renette“ (1964).
Diese neue schöpferische Energie hat, wie schon die bloße Aufzählung andeutet, viele Seiten. Alle diese Werke, so differenziert ihr jeweiliges Sujet auch sein mag, sind jedoch vom Bewußtsein einer großen Mitverantwortung für das Geschehen dieser Zeit getragen. Vom Kosmos bis zum lyrischen Ich hat Hrubín dabei „zum Lob des Lebens“ den ganzen Bereich poetischer Kommunikation ausgeschritten. Lob des Lebens heißt bei Hrubín, die einmalige Chance auszuloten, die dem Menschen mit dem Leben gegeben ist, eine Chance, die er als Subjekt in der Gemeinschaft unter den konkreten gesellschaftlichen Bedingungen seiner Zeit zu verwirklichen hat. Das heißt aber auch, die Grenzen dieses Lebens anzuerkennen, die durch den Tod vorbestimmt sind, und desto konsequenter ein realitätsbezogenes und die Realität immer menschlicher gestaltendes Dasein zu bewirken. Die Einsicht in den dialektischen Zusammenhang der Dinge, in das Werden und Vergehen ist die Voraussetzung für Hrubín, eine ungemein wirklichkeitsfördernde, ja wirklichkeitsbesessene Dichtung zu schreiben, die darauf aus ist, den Dingen auf den Grund zu gehen – „bis zum Ende des Lebens“, „bis zum Ende der Poesie“, wie er es nennt.
Das „natürliche Leben“ als ein sinnvolles, erfülltes Leben des Menschen zu gestalten, das ist es, was Hrubín immer wieder auszudrücken versucht. Was diesem „natürlichen Leben“ entgegensteht, an gesellschaftlichen Hindernissen wie an subjektiven Unzulänglichkeiten des einzelnen, greift er schonungslos an; was das „kristallklare Leben“ erstrebenswert macht, wird er nicht müde zu preisen. Echte Gefühle, aufrichtige menschliche Beziehungen, das sind ihm dafür entscheidende Gradmesser. Nicht zuletzt deshalb kehrt Hrubín so oft zur Kindheit zurück und zur Jugend, weil er in ihnen jene Echtheit der Empfindungen, jene radikale Ehrlichkeit und Kompromißlosigkeit sieht.
Das auszusprechen, hat Hrubín viele künstlerische Lösungen gefunden. In seinem Poem „Die Verwandlung“ greift er die alte Ikaros-Sage auf und funktioniert sie um. Das ewige menschliche Streben nach neuen Horizonten befragt er jetzt, „sieben Jahre nach Hiroshima“, auf Zweck und Ziel. Das Kompositionsprinzip – die Verbindung des Flugs von Dädalus und seinem Sohn mit der Stimmung eines heißen Prager Julisonntags am Moldauufer – ermöglicht ihm eine aktualisierende Eindringlichkeit:
… wie auch ich in ihnen,
mit ihnen mich gewaltig sehne, nach
dem unverstellten Leben, der
Natürlichkeit des Todes und
Natürlichkeit des Lebens…
nach unverstellten Menschen.
Dieses Sehnen nach dem „natürlichen Leben“, das die echte menschliche Gemeinschaft vorausbedingt, und das Wissen, daß sich „auf unseren Gefühlen und Gedanken noch kein dunkles Fell angesetzt hat“, ist auch das Grundmotiv der „Romanze für ein Flügelhorn“, einer nachdenklich gestimmten Dichtung über das Leben, die Liebe und den Tod. Die erste große Liebe ist hier das Gleichnis einer beglückenden Begegnung zwischen zwei jungen Menschen, die selbst von der Tragik des frühen Sterbens nicht zerstört werden kann und von Hrubín als Geschenk und Verpflichtung zugleich angesehen wird:
Liebe und Leben
werden mir immer eins sein…
und immer bleib ich ihr offen, sperrangelweit, ihr,
die das Leben auf meinen Traum pfropft…
Angesichts des unaufhaltsam vorrückenden Alters setzt Hrubín die „Liebe zum Leben“ immer häufiger in Beziehung zur Landschaft. In einem Gedicht, das diesen Titel trägt, hat er dafür programmatische Verse gefunden, deren Bildhafrigkcit aus der südböhmischen Landschaft erwächst. Er weiß:
… einmal verlasse ich euch, himmelblaue Spiegel,
euch, Flüsse, Seen und sanftgewölbte Hügel.
euch, Nächte des August, drin die Geliebten auferstehen,
euch, Linden, summend, Wiesen, prachtvoll im Vergehen
der Königskerzen…
Aber er weiß auch, und das gibt ihm Zuversicht:
… Flügelhörner schütten zwischen Tanz und Trauer
in Mädchenträume prickelnd unbekannte Schauer
im hohen Gras…,
zwei werden sein, die Sonnen gegen Monde tauschen…,
die Ufer werden, eingedenk auch meiner Zärtlichkeiten,
des Flusses Vibrationen in die Erlenkronen leiten,
und Träumer werden aus dem Sternebeben
des Weltalls neuen Traum sich weben.
Hrubíns Optimismus ist also der einer menschheitsgeschichtlich begriffenen Gewißheit, daß die Humanität zunehmend an Kraft gewinnt. Deshalb bejaht er den Kreislauf der Natur in der Dialektik von Werden und Vergehen, an dessen Ende für den einzelnen, nicht aber für die Gesamtheit, Alter und Tod stehen. In dem Gedicht „Augustmittag“ aus dem Band Bis zum Ende der Liebe gibt es dafür eine eindringlich-einfache Metapher, die die Dramatik und zugleich die Lösung dieses Konflikts festhält:
Verweile, Leben, mich
und alles will ich dir hingeben…
Dank, Leben, daß du nicht verweiltest!
Aus einem werden tausend Augenblicke neu geboren.
Verhieltest du jetzt, ich ginge tot und ungelebt verloren.
Voraussetzung dafür ist: daß der Dichter sich eins weiß mit den Menschen seines Landes, seiner Welt, daß er sich als Teil dieser Gemeinschaft fühlt, die in ihrem Tätigsein füreinander die Bedingungen dieser neuen Gemeinschaft ständig erneuert und erweitert.
In den späten sechziger Jahren hat Hrubín nur noch wenige Werke vollendet. Sein Prosaband Liebe (1967) gehört dazu, auch seine Nachdichtungen französischer Lyrik, der er sich zeitlebens verbunden fühlte. In diese Zeit fallen auch seine Gedichte des Bandes Der Glanz des erloschenen Sterns, in denen er des großen tschechischen Dichters und Freundes František Halas gedenkt, der schmale Band Der schwarze Morgenstern (1968) sowie die moderne Weihnachtsballade „Das Krippenspiel von Lešany“ (1970).
Gemeinsam ist diesen Werken, daß sie auf der Erinnerung beruhen und – als ahne Hrubín den nahen Tod – voll beziehungsreicher Ambivalenz sind zum Thema Leben und Sterben. Im Schwarzen Morgenstern, Erinnerungen an seine Kindheit und seine Mutter, verwendet Hrubín ein symbolhaftes Bild, das zum Gleichnis seines eigenen Lebens werden sollte: „Die Nacht hat jemand an die Tür geklopft“, lautet ein Gedicht. Es ist die tote Mutter, die auf der Schwelle steht und Einlaß begehrt – als Mahnung und Gewissen. „Einmal werde ich öffnen, für immer sperrangelweit“, schließt František Hrubín und nimmt so vorweg, was drei Jahre später bittere Wirklichkeit werden sollte: seinen Tod am 1. März 1971 in České Budějovice.
Geblieben ist ein Werk von künstlerischer Dichte, ein Zeugnis hoher Kultur, das den Weg des tschechischen Volkes in einer entscheidenden historischen Epoche des Umbruchs begleitet hat und mehr und mehr zum Bestand der progressiven Weltkultur gehört.
Manfred Jähnichen, Nachwort, Juni 1977
Romanze für František Hrubín
Jede wahrhaft dichterische Existenz ist radikal: scheinbar maßlos im Durchleben und durchmessenden Benennen aller vorgefundenen Dinge und Verhältnisse. Maßlos genau, maßlos direkt, maßlos anspruchsvoll, maßlos wahrhaftig – gemessen an der für viele alltäglich gewordenen Ungenauigkeit, bloßen Vermitteltheit, Anspruchslosigkeit ihres eigenen, als „nicht allzu ernst zu nehmend“ empfundenen Lebens. Gegen die selbst- und damit weltzerstörende Unbedachtheit solcher Lethargie läßt Dichtung ihr Kraut schießen. Ein Kraut, das die Trägen mobilisiert, die Hitzköpfe kühlt, die Trunkenen ernüchtert, die Nüchternen berauscht, die Resignierenden mit Hoffnung erfüllt und den blind Hoffenden die Augen öffnet. Derlei wüßte ich vermutlich mit weniger Bestimmtheit zu sagen, hätte es František Hrubín nicht gegeben und durch ihn und mit ihm die Radikalität eines dichterischen Werkes, das hier erstmals in einer größeren repräsentativen Auswahl auch den Leser in der DDR einlädt, sich seiner sinnlich und gedanklich zu versichern. Von Belang gibt Welt nicht wieder, sondern ist Welt, Äußerung eines konkret benennbaren, in seiner Individualität kenntlich gewordenen Menschenbruders. Sein Kenntlichwerden im scharfsichtigen, scharf fühlenden Wort ermuntert den, der ihm begegnet, zu gleicher Aufrichtigkeit und führt ihn zur stärkenden Entdeckung des Eigenen im vermeintlich Fremden.
František Hrubíns Poeme und Gedichte sprechen, wo immer sie sich auch durch Äußeres veranlaßt zeigen, mit der inneren Stimme des im einzelnen Betroffenen.
Und Hrubíns Biographie, geklammert durch die Daten 17. September 1910 und 1. März 1971, geprägt durch mittelbares und unmittelbares Erlebnis zweier Weltkriege und das seit Hiroshima gebrannte Bewußtsein von der greifbar nahen Gefahr eines atomaren Weltbrandes, verzeichnet nur wenige Jahre, die die gefährliche Illusion eines Nicht-von-allem-Betroffenseins hätten nähren können. Und dennoch – oder vielleicht gerade deshalb – wurde Hrubín das kreatürlich Natürliche seiner böhmischen Heimat zum bestimmenden Motiv seiner Dichtung. Die für Hrubíns Verse charakteristische Melodiosität und sanfte Verhaltenheit scheinen ideale Entsprechungen zu den betörenden milden Reizen seiner heimatlichen Landschaft zu sein. Und die bis an ihren Rand und bis an den Rand des Todes immer wieder neu erfahrene und neu artikulierte Liebe erweist sich in ihrer Sinnlichkeit und in ihrer Transparenz als die bewegende Triebkraft seines unbestechlichen Nachdenkens, Nach-Sinnens über die Möglichkeit, eine vielfach bedrohte Welt doch noch zu retten
Seine unmittelbare Welt in ihrer Häßlichkeit und Schönheit gleichermaßen intensiv ins Gedicht gebracht und sie dabei als unsere Welt kenntlich und erkennbar gemacht zu haben ist für mich das wesentlichste Verdienst František Hrubíns, der schon tot ist und noch lebt: in der menschlichen Wärme seiner radikal eigenen dichterischen Botschaft.
Jürgen Rennert, Verlag Volk und Welt, Begleitzettel, 1978
Mein Hrubín
– Ein Prager Vortrag gehalten am 21.9.1978 im Prager Kultur- und Informationszentrum der DDR. –
Durch abschminkende Selbst-Erfahrung weniger denn je geneigt, mich gar in Sachen Literatur und Dichtung theoretisch für kompetent zu halten, nehme ich Ihre liebenswürdige Herausforderung, hier und heute über František Hrubín zu sprechen, dennoch an. Und ich selbst bestaune vielleicht am meisten den Mut, der mich dies hier beginnen läßt. Möglicherweise ist es der Mut der Verzweiflung angesichts einer existentiellen Krise, der wir – wenn es gut geht – die Katharsis verdanken und – wenn es schlecht geht – die Katastrophe. Wenn ich hier wage, derart unverdeckt von meinem Mut und meiner Verzweiflung zu sprechen, dann lediglich deshalb, weil es mir mehr als je zuvor ernst ist, ernst mit mir und meinem Leben, das nahe daran war zu zerspringen, wie eine batavische Träne oder Seifenblase. Denn das habe ich in den letzten Monaten und Wochen schmerzhaft im persönlichen Konflikt erfahren: wieviel mir noch fehlt, um der zu werden, der ich möglicherweise bin. Ob ich hingegen der werden will, der ich vor mir und vor anderen zu sein scheine, ist mir zur Zeit uninteressant und mehr als zweifelhaft.
Im Versuch, meine private Misere im Kern zu benennen, fiel und fällt mir Hrubín ein, Zeilen seines Hiroshima-Poems, das den seltenen Vorzug aller einzig legitimen politischen Dichtung hat: die Existenz der Menschheit an der Existenz des einzelnen Menschen zu definieren. Und so ist im Plural der Schlußstrophen dieses Poems die singuläre Erfahrung unüberhörbar, wenn es heißt:
Doch in uns ist die Sehnsucht – die verschwommnen
Konturen dieser Welt zu härten
ist in uns doch die Sehnsucht – aufzuhalten
den fast nicht aufhaltbaren Fall,
dem Abrutsch und dem Einsturz unsrer Wesen
zu wehren, alle die zu stützen, denen
die Erde unter ihren Füßen
derart entgleitet, daß sie mit den Köpfen
am Steinhang der Vergangenheit aufschlagen…
Dies also sind die Zeilen, die mir – ehe ich sie soeben zitierte – vor allem von mir und meinem ureigensten Verlangen zu sprechen schienen; jenem Verlangen, die verschwommenen Konturen meines Ichs zu härten, dem Abrutsch und dem Einsturz meines Wesens zu wehren. Jedoch das Bewußtsein von Ihrer Anwesenheit, Ihrem Zuhören, meine Damen und Herren, versperrt mir die absolute Identifikation, verleitet mich zur Rücksichtnahme auf Ihr Verständnis und Ihr Verstehen, lenkt mich ab und in anderer Weise auf mich zurück. Denn es weckt in mir auch die fatale Erinnerung, daß ich selbst vor Jahresfrist kaum wußte, was ich da nachdichtete, kaum übersah, worauf ich mich da eingelassen hatte, kaum spürte, wie sehr mich traf, was unbestreitbar auf anderes und mehr als mich gerichtet war.
Gestützt auf Ludvík Kunderas beispielhaft präzise Interlinear-Übersetzungen, ein unzulängliches Glossar bei der Hand und die mir mirakulös erscheinenden Originaltexte vor Augen, erstrebte ich nicht mehr und nicht weniger als eine semantisch genaue und adäquat melodisierte und strukturierte deutsche Verdichtung. Handwerksarbeit also, die ich mit Ehrgeiz zu erledigen trachtete, auf geringstem Plateau und unter den „ungünstigen Umständen“, wie Franz Fühmann es einmal nannte, buchstabierenden Übersetzens aus einer bis dato kaum eingesehenen Sprache. Ich war mir meiner mangelhaften praktischen Voraussetzungen durchaus bewußt. Und dennoch hatte ich paradoxerweise nicht lange gezögert, die gebotene Chance wahrzunehmen und ungelenke Hand an Hrubíns biegsame und geschmeidige Verse zu legen.
Ich wußte damals wirklich nicht, was mich trieb, mich an Hrubíns Gedichten zu versuchen, ich vermutete: hasardierende Eitelkeit. Heute – nach Hrubín und auf dem spärlich erleuchteten Weg zu mir selbst – wage ich es genauer zu wissen und mißverständlicher zu sagen: Es war die Hybris eines Menschen, der sich im letzten Grunde seines Wesens – wider alle andere Selbstaussage – primär als Künstler versteht. Eine Hybris, zu der ich mich heute ungeniert bekenne, an der ich nicht länger fürchte, was mich bis vor kurzem noch schreckte und traumatisierte, was ich für mich nicht gelten lassen wollte: ihre Zweischneidigkeit und Zwiespältigkeit. Ich willige ein in allen Glanz und alles Elend, welche sie mir, wenn ich noch zu leben haben werde, bescheren wird. Denn ich bin ein Dichter und ein Künstler, ein naher Bruder František Hrubíns und Georg Heyms, Paul Verlaines und Jaroslav Seiferts, Fernando Pessoas und Alexander Twardowskis, Jean Cocteaus und Alexander Blocks. Ich wünschte, Sie überhörten nicht die Bescheidenheit, die mit im Spiel ist, wenn ich dies hier bekenne.
Heute, in meinem sechsunddreißigsten Jahr, will mir scheinen, als hätte ich fünfunddreißig Jahre lang nichts anderes versucht, als vor mir selbst davonzulaufen. Vor mir selbst, das meint: vor meinen tatsächlichen Wünschen, meinen handfesten Begierden, meinen elementaren Ansprüchen, meinen verdrängten Ängsten, vor meinem Dunkel und vor meiner Helle. Faktisch elternlos, also unbeheimt und ungeborgen aufgewachsen, zwischen zwei Staaten eines schizoiden Landes, im religiösen Pietismus traditionell deutscher Spielart dressiert, lernte ich als erstes Zwang und Gewalt, unter denen ich kindheitslang litt, zu verinnerlichen und schließlich zu sublimieren, Einigen pubertären Rebellionsversuchen mit unbefriedigendem, weil nicht befreiendem Ausgang folgte meine Einübung in die Spielart intellektueller Regression, verbrämt als überpersönliche, gesellschaftliche Progressivität. Das alles vollzog sich immer im angstgeschärften und durch die Angst zugleich zensierten Blick auf das Außen der Um-Stände, der äußeren Gegebenheiten. Dem Fatalismus dieses Lebensgefühls entsprach die Irrationalität meines Widerstandes. Was ich dabei produzierte, hatte – wenn es gelang – etwas von der rührenden Schönheit eines Singens im Dunklen, spiegelte die kunstvolle Verlogenheit eines aufrichtigen Illusionisten oder illusionär aufrichtigen Menschens. In den wort- und trostlosen Augenblicken meines Lebens, Augenblicken, in denen das Wirkliche einbrach, beschlich mich das Gefühl katastrophaler Verheerung und Versehrtheit. Seine Bewältigung schien mir unmöglich, im Akt seiner Verdrängung sah ich den einzigen Ausweg. Selbst da noch, wo ich mich auf einen Text einließ, der wie kein anderer ebenjenes Gefühl für mich artikulierte: František Hrubíns „Hunde-Nocturne“. 1942, im schlimmen Jahr des Attentats auf Heydrich, im Lidice-Jahr entstanden, spricht es unter der massenhaften, massierten physischen und psychischen Bedrängung durch Menschen meines Volkes und eben auch meiner fragwürdigen Provenienz von der seelischen Realität des einzelnen. Und zwar derart genau und gültig, daß es einem Nachfahren dieser mörderischen, im Brennen, Sengen und Verdrängen geübten Generation noch die Augen zu öffnen vermag: vor allem über sich selbst und über das verheerende Ausmaß seiner eigenen Verdrängungen:
Finstre, gottverlaßne Nacht,
in mir winseln tote Hunde,
die der Tod gefügig macht –
finstre, gottverlaßne Nacht!
Winselnd sehn sie nichts als Gitter,
stückweis fällt uns Leben ab,
Hundeleben, hündisch, bitter –
winselnd sehn sie nichts als Gitter.
Zieht der Mond auf, heulen sie,
heult in mir, zermalmt vom Elend,
Menschlichkeit auf wie ein Vieh –
zieht der Mond auf, heulen sie.
Keiner stickt das Heuln der Städte,
du stickst nicht den Säuglingsschrei,
drosselt ihn des Dämons Kette –
keiner stickt das Heuln der Städte.
Finster heuln sie tief am Grunde,
in uns winseln angstverschreckt
stets gepeitschte Leben, Hunde –
finster heuln sie tief am Grunde.
Unterm Stahlsturm eingeschreint,
nehmen wir mit Brot und Wasser
ihre Asche, die noch weint –
unterm Stahlsturm eingeschreint.
Dieses Gedicht, dessen Entstehungsdatum mit meiner Zeugung wie zufällig zusammenfällt, ist heute für mich unentbehrlich. Es lenkt meine Aufmerksamkeit auch auf den dunklen Punkt meiner pränatalen Existenz, einen Punkt, an dem jede Psychotherapie zu beginnen hat, falls sie sich nicht selbst um den Erfolg bringen will.
Keiner stickt das Heuln der Städte,
du stickst nicht den Säuglingsschrei,
drosselt ihn des Dämons Kette…
Ausgetragen und geboren wurde ich in der sirenendurchheulten, mehr und mehr von pfeifenden Bomben-Abwürfen heimgesuchten, sich panisch in Bunkern und Kellern verkriechenden Stadt Berlin. Meine frühesten Erinnerungen beschwören das schreckliche, jaulende Heulen der Alarmsirenen, das Verlöschen von Lichtern, die Verdunkelung, das Verdichten von Luft, Atemnot und die hektische Vertikalbewegung sich beschleunigenden Treppaufs und Treppabs. Weit davon entfernt, aus solchem Früh-Erleben lineare Schlüsse auf späteres Ver-Sagen zu ziehen, erlaube ich mir dennoch den Hinweis, daß das eine mit dem anderen ursächlich und unabdingbar zu tun hat. Auch wenn es im Moment scheinbar nichts erklärt und nichts entschuldigt…
Als ich die Nachdichtungs-Arbeit für die nun vorliegende Hrubín-Auswahl begann, war ich vierunddreißig Jahre alt. Zwei Gedichtbände und ein Band vermischter Prosa von mir lagen vor und spiegelten in einem damals für mich ausreichenden Maße mein Bemühen um Weltaneignung und Weltbewältigung. Die Position, die ich zwischen den Stühlen stehend gefunden zu haben meinte, bediente sich zu ihrer Verteidigung relativ erfolgreich christlicher, humanistischer und marxistischer Argumente. Zu stehen vermochte ich also, aber nicht, mich zu setzen. Worauf auch hätte ich mich setzen sollen? Denn ich anerkannte nicht mein Gesäß. Ich verleugnete meinen Unterleib. Wie ich meine Geliebten nicht nur vor der Öffentlichkeit und vor meiner Frau, sondern auch vor mir selbst zu verleugnen und zu verheimlichen suchte. Nicht bloße Prüderie, nicht simple Frömmelei, nicht der Respekt vor Konventionen ließen mich so verfahren, sondern eine Ur-Angst vor der Einsicht in die ganze, auch in mir existierende widersprüchliche Realität menschlichen Daseins. Ohne bis jetzt im einzelnen ermessen zu können, aus wie vielen Quellen sich diese mich mehr und mehr neurotisierende Angst speiste, weiß ich doch zumindest um eine dieser Quellen. Und da zeigt sich, daß das Wort Quelle nicht hinlangt. Was in mich einfloß, strömte – wie mir scheint – schon Jahrhunderte unterirdisch durch „deutsche Art“ und „deutsches Wesen“, hat als Strömung schon mehr verursacht als die Frustrierung eines einzelnen Gemüts. Es ist die historisch gewiß erklärbare, dadurch aber nicht akzeptabler werdende Verstiegenheit und Verlogenheit einer die eigenen nationalen Realitäten und Realien verdrängenden, verleugnenden Weltbetrachtung und Weltempfindung. Einem Volk, das – nur zum Beispiel – über Jahrhunderte hinweg seine wesentliche Erhebung in den Bauernkriegen von 1525 nicht in einer einzigen kulturellen Leistung unverdrängt zu erinnern wußte, obgleich sie stattgefunden hat und mit den denkbar blutigsten und abscheulichsten Konsequenzen geahndet wurde, einem Volk wie diesem hilft auch sein Goethe nicht. Ein Volk, das seinen Thomas Müntzer mit seinem Martin Luther, seinen Marx mit seinem Nietzsche austreibt, seinen Kafka mit seinem Brecht, ist über das Stadium des Exorzismus noch kaum hinaus. Bei einem Volk, wo soviel Teufel und Gegenteufel beschworen und ausgetrieben werden, kann es nicht wundernehmen, wenn sich Dämonisches schließlich auch in seinen Menschen manifestiert. Ich hoffe, Sie wissen, meine Damen und Herren, daß ich nach wie vor nur von mir spreche und historische Reminiszenzen allein bemühe, um mich selbst, nicht aber die Historie, zu erklären.
Ich höre Hrubín und bin dankbar für seine Erinnerungshilfe. „Einmal an der Sázava“ ist ein Gedicht überschrieben, das an den Fluß seiner heimatlichen Landschaft erinnert und deren Leiden unter der Okkupation. Viele ihrer Bewohner wurden deportiert und ermordet. Ihre Häuser wurden von der deutschen SS, die dort ihre Schießplätze errichtete, besetzt oder geschleift:
Flüssin der Kindheit, meiner Jugend!
Die sich an meine dünnen Waden hielt,
als watend sie zur Sonne stieg.
Nachts trank sie rücklings überm Wehr
die Mondin in unendlich langen Zügen.
Dann kamen sie hierher:
Verpflanzten Espen in die Menschen.
Verkehrten Felder, und die lagen disteloben,
Bis an die Gräber ließen sie die Häuser.
Veratmeten den Wald…
Und kamen zu der Flüssin: Ringelnatterfluß,
wasch den Geruch der Leichen von uns ab!
Da sirrte menetekelnd die Libelle,
und Fische-Pfeile schossen aus dem Köcher
des seichten goldnen Sands.
Allein was ihr gehört, wäscht sich die Flüssin
mit grüner Hand – den Staub des Lands!
Von unterwegs, entwendet zwischen Feldern.
Und alarmierend dröhnt aus ihr,
die hilflos liegt, im Landstrich unter allen Gräbern
allein der Felsenblöcke steingewordne Salve.
Derlei in deutscher Zunge zu sagen und zu hören ist schmerzlich wie eh und je und kann nur um den Preis der Nichtverdrängung hilfreich sein. Denn hörbar wird im genau artikulierten Schmerz eines tschechischen Dichters, was aus melancholischem deutschem Heimat-Gesang so nicht herauftönt: die ungebrochene Sinnlichkeit, die Fähigkeit zu unmittelbarer sinnlicher Wahrnehmung und Anverwandlung gegebener Landschaft.
Lassen Sie mich unter Berufung auf Brecht, meine Damen und Herren, diese Ihnen vielleicht fast schon „typisch deutsch“ erscheinende These stützen. Doch es geht mir wirklich nicht um eine unangemessene Demonstration deutschen Selbsthasses, wenngleich derlei gerechterweise wohl auch akzeptiert werden müßte und sollte. Bei Brecht heißt es im Arbeitsjournal in der Eintragung unter dem 12. August 1938:
wir deutschen haben einen materialismus ohne sinnlichkeit, der ,geist‘ denkt bei uns immer über den geist nach. die körper und die gegenstände bleiben geistlos. in den deutschen liedern über den wein ist die rede von lauter geistigen wirkungen, selbst in den ordinärsten liedern. der geruch der weinfässer kommt nicht vor. die welt schmeckt uns nicht. in die liebe haben wir etwas gemütliches hineingebracht, der geschlechtsgenuß hat für uns etwas banales. wenn wir von geschmack reden, meinen wir ebenfalls etwas rein geistiges, die zunge ist da längst aus dem spiel, es ist so etwas wie gefühl für harmonisieren. beachtet auch diese zusammensetzung ,rein geistig‘. der geist verunreinigt sich gleich bei uns, wenn er materie anfaßt, mehr oder weniger ist materie für uns deutsche dreck. in unserer literatur ist überall dieses mißtrauen gegen die lebendigkeit des körperlichen zu spüren. unsere helden pflegen der geselligkeit, aber essen nicht; unsere frauen haben gefühle, aber keinen hintern, dafür reden unsere greise, als hätten sie noch alle zähne.
Dieses Zitat kann, will und soll nichts beweisen. Von Wichtigkeit ist es möglicherweise nur für mich, indem es neben vielen Behauptungen auch einer Befindlichkeit und einer Empfindung Ausdruck verleiht, die der meinen ziemlich genau entsprach, als ich fast vierzig Jahre später mit František Hrubín konfrontiert wurde und in dieser Konfrontation auf das stieß, was meiner latenten Krise schließlich zum Ausbruch verhalf.
Im Blick auf meine Altersgenossen und gleichaltrigen Kollegen spüre ich sehr wohl die Verspätung, mit der ich mich auf den Weg zu mir selbst machte. Es bleibt Außenstehenden unbenommen, dies hier als eine individuelle Krankengeschichte zu lesen und mich als Ausnahme zu betrachten, als Ausnahme, deren Krankhaftigkeit nur die Gesundheit der Regel und des ihr übergeordneten Reglements bestätigt. Dennoch stehe ich nicht an, meine Biographie und die sie steuernden Impulse auch als kulturell, soziologisch, national und historisch verursacht anzuerkennen und anzunehmen. Was daraus für mich folgen wird, bleibt abzuwarten.
Immer wieder auf der Suche nach den für mich entscheidenden katalytischen Elementen in František Hrubíns Dichtung, erinnere ich jene Texte, die nahezu über alles verfügen, was Brecht in seiner Journal-Notiz über den deutschen Materialismus ohne Sinnlichkeit vermißte: Hrubíns Liebesgedichte. In ihnen sind Gerüche und Formen, Farben und Genüsse aufgehoben und unkastriert, geschlechtlich unversehrt, präsent. Das „Geistige an sich“ ist nirgends auffindbar. Das Geistige existiert nur – analog zur Wirklichkeit – in seiner Bindung an das Stoffliche, sinnlich Erfahrbare. Die Liebe hat etwas Atemberaubendes, die erogenen Zonen unmittelbar Erregendes; der Geschlechstgenuß, Erektion, Ejakulation und Orgasmus werden im Worte nicht verdrängt, sondern mit Hilfe des Wortes zu Wort und wörtlicher Entsprechung gebracht. Die Materie ist kostbar, gerade da, wo sie nichts kostet und verfügbar ist wie Sand, der zwischen den Schenkeln sich Umarmender reibt, sich ihrem Haar verhaftet, oder wie Lehm, der Hrubín zum Sinnbild aller Erfahrung wird. Im Gedicht „Frühlingsabend“ endet er:
Erinnrungsnimmersatt,
auch was da kommt, erinner ich bereits,
und wie beim Regenwurm geht von Geburt
bis Tod durch mich hindurch der Lehm.
(„Wie scheußlich!“ und „Pfui!“ wären vermutlich die einzigen Vokabeln gewesen, die meine Mutter, so sie noch lebte, zur Artikulation und gleichzeitigen Verdrängung ihrer Empfindungen beim Hören dieser Zeilen zur Verfügung gehabt hätte. „Mehr oder weniger“, heißt es bei Brecht, „ist Materie für uns Deutsche Dreck.“ Meine Mutter, Jahrgang 1920, ist seit siebzehn Jahren tot, und ich lebe, wie ich hoffe, weiter in einer größeren Weite, als ihr vergönnt gewesen ist.)
Hrubíns Helden sind keine Helden, sondern Männer und pflegen mehr der Liebe als der großsprecherischen Geselligkeit. Hrubíns Frauen haben nicht nur Gefühle, sondern auch Schöße und Schenkel und Brüste und Anmut. Lassen Sie mich zum Exempel zwei Gedichte zitieren, deren Sinnlichkeit in meiner Nachdichtung hoffentlich nicht allzuviel Schaden genommen hat. Das erste Gedicht stammt aus dem Jahre 1933 und eröffnet den Reigen der in der deutschen Auswahl versammelten Texte. Es heißt „Liebeslied“:
Aus dem Gewölk der Brüste fällt ein Schnee,
wie er vorzeiten fiel, ins Tal der Hände,
die Dunkles schon bedrängt,
der Südwind meines Nachdrucks weckt dich jäh,
erregt den Leib, dein Haus, an dessen Wände
Lust nichts als Geigen hängt.
Die starke Wölbung dieser lichten Leidenschaft
verlockt die Schönheit, alle Strenge,
darin sie lebte, abzutun,
wenn Nacht, die dunkle Spange, aus der Haft
ihr Haar erlöst, um für des Fallens Länge
im Nacken eines Lieds zu ruhn.
Das zweite Gedicht trägt den Titel „Vollmond“:
Dürstend betrinken sich meine Hände,
der Liebsten gefügig zu sein –
lasse, Nacht, sorglos ihr Haar ohne Ende
süßer verströmen als Wein.
Ermattete Finger der Lichter durchwinden
Blumen am Rande deines Schoßes –
Am Ende der Wiese strahlt im Entschwinden
der Mondrücken auf als ein Bloßes.
Beim Nachdichten dieser Texte, über deren Kunstwert ich momentan nicht anders als subjektiv und euphorisch zu befinden weiß, geschah mir zwangsweise, was ich im Leben und beim Verfassen eigener Texte immer noch mit Erfolg ins Unterbewußte abzudrängen verstanden hatte: die nackte Konfrontation mit meiner eigenen Männlichkeit. Weder Geist noch Kopf boten mir länger Asyl. In meiner Sprache mußte da über meine Lippen und mit meiner Zunge etwas geschmeckt, gesagt und nachgesprochen werden, was in anderer Sprache und aus anderer Erfahrung gültig vorformuliert worden war, authentisch männlich und authentisch existentiell. Kein Wort aber vermag eine Empfindung oder Erfahrung zu treffen, wenn es nicht zuvor aus ähnlicher Empfindung und Erfahrung hervorgegangen ist. Und mit vor mir selbst verschwiegenen Worten, die ich nach und nach, Zeile für Zeile ans Tageslicht holte, näherte ich mich auch den Verdrängungen, meinen verheimlichten, verschwiegenen sexuellen Erfahrungen, die ich wohl im ganzen gehabt hatte, aber nicht im ganzen anzunehmen in der Lage gewesen war. Sie hatten nicht zu sein, weil sie nicht sein durften. Ihre Anerkennung vor mir selbst hätte meine „geistige Position“, mein religiös geprägtes, bürgerliches Selbst- und Eheverständnis über den Haufen geworfen. Aber Hrubín war – wie ich heute sehe – unerbittlich wie ein Psychoanalytiker. Fast jeder seiner Texte störte mich im Tiefsten, Dunkelsten auf, verlangte von mir zumindest die emotionale und sprachliche Bewältigung des verdrängt in mir Existierenden. Und wahrscheinlich hätte ich mich rechtzeitig gegen diesen Angriff auf mein Unter- und Unbewußtes gewehrt, wenn ich damals auch nur ansatzweise erkannt hätte, welch großer Stellenwert dem Unter- und Unbewußten im psychischen und physischen Organismus jedes einzelnen Menschen zukommt. Denn noch während der mich oft rätselhaft erschöpfenden Arbeit an Hrubíns Gedichten hielt ich das gesamte Unterfangen mehr für ein Spiel, äußerst kunstvoll wie vieles, was ich bis dahin mit allem kindlichen Ernst – also ohne den entscheidenden Einsatz meiner geschlechtlichen Existenz – gespielt und gelebt hatte. Gestatten Sie mir bitte an dieser Stelle den Einschub eines Textes, in dem Hrubín über diese von mir erst heute einsehbare Problematik Erhellendes mitzuteilen hat. Der Text heißt „Syrinx“ und erschien erstmals 1961 in dem Band Bis zum Ende der Liebe:
Ich singe die kleine Verwandlung.
Dem Tod zu entkommen, wandelt sich alles und immer,
wird rostiger Herbst zum Winter, Winter zum Frühling.
So dauert Welt allein durch Verwandlung.
Verzeih mir, Ovid!
Abend ist es
und später Oktober.
Aus der Wolke ragen die Hörner des Mondes,
aus dem Manne die Hörner des Knaben.
Beide, Mann und Knabe, ein Leib, der einhergeht.
Beiden gemeinsam ein und dasselbe Herz;
Der Mann verspürt es schrecklich umklammert,
spürt schmerzlich des Knaben Sehnsucht gegen
des Herzens Wände anbranden.
Beide, Mann und Knabe, gehen einher.
Beiden gemeinsam ein und dasselbe Herz.
Der Knabe bejubelt die Geräumigkeit des Herzens,
das sich ausdehnt bis ans Ende der Luft,
den dauernden Zuschlag des dreißig Jahre
unentwegt fallenden Hammers, Mühsal des Mannes,
vernimmt er nur als ein samtenes Pochen
aus unendlicher Ferne.
Dennoch: Spränge dem Manne das Herz, der Knabe
stürzte augenblicks tot auf die Erde.
Beide, Mann und Knabe, gehen einher.
Neben ihnen schreitet schweigsam ein Mädchen
in der Anmut und Gemessenheit langsamen Tanzes.
Aber dem Manne will scheinen, es flieht ihn,
als befände es sich auf phantastischer Flucht
und wie bereits in der Zukunft
(lediglich lispelnde Laute)
wie in der Zukunft bereits
(nichts als Erinnern),
Da schreckt der Mann den Knaben auf, und beider Herz
rhythmisiert irrsinnig schlagend die imaginäre
Treibjagd.
Der Taumel ist mehr als das leichte Kreiseln
fallender Blätter,
viel mehr als das tödliche Zucken des Windes,
mehr als das Drehen des schwarzen Rades auf Kampa:
in der Mitte des wirbelnden Taumels alternieren
das Lockern
und Festziehn
des Bolzens am Herzen.
Da weiß am trüben Fluß der herbstlichen
Karmeliterstraße das Mädchen nicht weiter,
Lichtblasen steigen auf und kreisen vor ihm.
Schon des Mädchens in seinen Armen gewiß, beschwert
statt seiner das Wogen der Stadt den Brustkorb
des Mannes.
Derart, Liebe,
werden wir uns auf immer berühren!
In Stadt verwandelten sich Abertausende von Mädchen,
und abertausend Mädchen wandeln und verwandeln sich in sie.
An des Pazifiks milchigem Ufer liegt in besternten Nächten
Prag, eine goldne Syrinx, erwartend
den starken Atem des jungen Geschlechts.
Spät ist der Abend
und Monat Oktober.
Hinter Wolken verbirgt seine Hörner der Mond,
nicht verbirgt seine Hörner der Knabe.
Denn ginge der Knabe im Manne zugrunde, es bliebe
kein Gran von der Liebe,
kein Gran Poesie.
Als ich die Arbeit an der Hrubín-Auswahl abschloß und jenen Text aus dem „Schwarzen Morgenstern“ vor Augen hatte, der Hrubíns eigene Existenz wie kein anderes seiner mir bekannten Gedichte auf die Tiefe aller menschlichen und männlichen Existenz zurückführt, das Gedicht „Die Nacht hat jemand an die Tür geklopft“, da ahnte ich zumindest schon, was seine Faszination für mich ausmachte. František Hrubín war mir jemand geworden, den ich annehmen konnte in seiner vermeintlichen Andersartigkeit. Seine seelische Klarheit und Lauterkeit schien mir hinreichend erklärt durch seine Zugehörigkeit zur tschechischen Nation, die auf mehrfach überzeugende Weise ihrem Sitz im Herzen Europas und der europäischen Kultur gerecht geworden ist. Daß meine Ahnungen jedoch weiter reichten als meine Erklärungen, spiegelt mir ein Text, den ich damals schrieb und der nun als „Romanze für František Hrubín“ der deutschen Auswahl seiner Gedichte beigelegt wurde:
Jede wahrhaft dichterische Existenz ist radikal: scheinbar maßlos im Durchleben und durchmessenden Benennen aller vorgefundenen Dinge und Verhältnisse. Maßlos genau, maßlos direkt, maßlos anspruchsvoll, maßlos wahrhaftig – gemessen an der für viele alltäglich gewordenen Ungenauigkeit, bloßen Vermitteltheit, Anspruchslosigkeit ihres eigenen, als ,nicht allzu ernst zu nehmend‘ empfundenen Lebens. Gegen die selbst- und damit weltzerstörende Unbedachtheit solcher Lethargie läßt Dichtung ihr Kraut schießen. Ein Kraut, das die Trägen mobilisiert, die Hitzköpfe kühlt, die Trunkenen ernüchtert, die Nüchternen berauscht, die Resignierenden mit Hoffnung erfüllt und den blind Hoffenden die Augen öffnet. Derlei wüßte ich vermutlich mit weniger Bestimmtheit zu sagen, hätte es František Hrubín nicht gegeben und durch ihn und mit ihm die Radikalität seines dichterischen Werkes… Dichtung von Belang gibt Welt nicht wieder, sondern ist Welt, Äußerung eines konkret benennbaren, in seiner Individualität kenntlich gewordenen Menschenbruders. Sein Kenntlichwerden im scharfsichtigen, scharf fühlenden Wort ermuntert den, der ihm begegnet, zu gleicher Aufrichtigkeit und führt ihn zur stärkenden Entdeckung des Eigenen im vermeintlich Fremden. Františeks Hrubíns Poeme und Gedichte sprachen, wo immer sie sich auch durch Äußeres veranlaßt zeigen, mit der inneren Stimme des im einzelnen Betroffenen.
Und Hrubíns Biographie, geklammert durch die Daten 17. September 1910 und 1. März 1971, geprägt durch mittelbares und unmittelbares Erlebnis zweier Weltkriege und das seit Hiroshima gebrannte Bewußtsein von der greifbar nahen Gefahr eines atomaren Weltbrandes, verzeichnet nur wenige Jahre, die die gefährliche Illusion eines Nicht-von-allem-Betroffenseins hätten nähren können. Und dennoch – oder vielleicht gerade deshalb – wurde Hrubín das kreatürlich Natürliche seiner böhmischen Heimat zum bestimmenden Motiv seiner Dichtung. Die für Hrubíns Verse charakteristische Melodiosität und sanfte Verhaltenheit scheinen ideale Entsprechungen zu den betörend milden Reizen seiner heimatlichen Landschaft zu sein. Und die bis an ihren Rand und bis an den Rand des Todes immer wieder neu erfahrene und neu artikulierte Liebe erweist sich in ihrer Sinnlichkeit und in ihrer Transparenz als die bewegende Triebkraft seines unbestechlichen Nachdenkens, Nach-Sinnens über die Möglichkeit, eine vielfach bedrohte Welt doch noch zu retten. Seine unmittelbare Welt in ihrer Häßlichkeit und Schönheit gleichermaßen intensiv ins Gedicht gebracht und sie dabei als unsere Welt kenntlich und erkennbar gemacht zu haben ist für mich das Wesentliche Verdienst František Hrubíns, der schon tot ist und noch lebt: in der menschlichen Wärme seiner radikal eigenen dichterischen Botschaft.
Wenn ich diesen Text hier abschließend zitiere, dann mehr aus Gründen notwendiger Selbst-Dokumentation als denen der Höflichkeit. Denn nach wie vor verspüre ich den Mut der Verzweiflung. Daß ich ihn nicht länger leugne und verschweige, bin ich geneigt, erst einmal für einen Vorzug zu halten. Und diese Haltung verdanke ich, wie ich mich zu zeigen bemühte, auch der Begegnung mit František Hrubín und ihrem Nachhall.
Ihre Anwesenheit, meine Damen und Herren, hat mich herausgefordert, so wahrhaftig wie möglich über etwas zu sprechen, was wirklich verlohnt und was im öffentlichen Gespräch über Poesie häufig genug unbeachtet und unartikuliert bleibt: die wörtlich zu nehmende existentielle Bedeutung manchen Gedichts und manchen Dichters für den einzelnen Leser.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Jürgen Rennert, Sinn und Form, Heft 1, 1979
Fakten und Vermutungen zum Autor + Kalliope
Zum 70. Geburtstag des Übersetzers:
Roland Lampe: Ein streitbarer Anwalt der Literatur
Märkische Oderzeitung, 13.3.2013
Fakten und Vermutungen zum Übersetzer
Porträtgalerie: deutsche FOTOTHEK


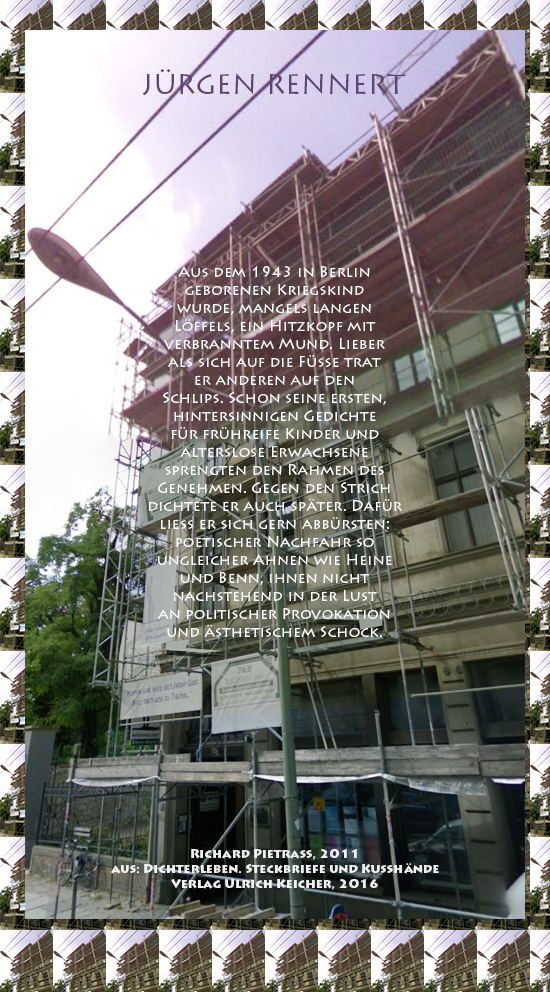












Schreibe einen Kommentar