Friederike Mayröcker: Scardanelli
HÖLDERLINTURM, AM NECKAR, IM MAI
Diese Prise Hölderlin
im hellroten Hölderlinzimmer
im Korridor stehend
fällt mein Blick auf die roten Blumen im Glas
gesäumt von abgefallenen
Blütenblättern
nichts sonst
das Zimmer leer nur die Vase die Blumen
zwei alte Stühle −
ich öffne ein Fenster
im Garten sagst du die Bäume
sind noch die gleichen wie damals
aber man hört einen Ton Musik es
glänzt die bläuliche Silberwelle
Für Valerie Lawitschka
6.6.89
Die Spur führt nach Tübingen,
in eine Turmstube oberhalb des Neckars. Dort sitzt einer und schreibt. Hölderlin nennt er sich indes nicht mehr. Seine Gedichte unterzeichnet er „Mit Unterthänigkeit / Scardanelli“.
Seine Stube verläßt er nur selten, und doch begegnet ihm Friederike Mayröcker auf ihren Streifzügen durch magische Kopf- und Sprachlandschaften auf Schritt und Tritt: Mal stößt sie auf ihn, „wo junge Blättchen wo verborgene Veilchen schwärmten“, mal zeigt er sich als „1 schöner / Wanderer mit Alpenhut und einer Blume in seiner / Hand“.
Zwischen Januar und September 2008 entstanden 40 Gedichte, in denen Friederike Mayröcker dem hymnischen Ton und den freien Rhythmen Friedrich Hölderlins folgt. Meist reicht ein einzelnes Wort, manchmal ein Teil einer Verszeile, um die Sehnsucht zu beflügeln: „ich möchte / leben Hand in Hand mit Scardanelli“.
Suhrkamp Verlag, Ankündigung, 2009
Berlin und Wien am Neckar
− Diese wunderbaren nächtlichen Geschöpfe: In ihren neuen Gedichten tritt Friederike Mayröcker in ein intimes Zwiegespräch mit Friedrich Hölderlin und beschwört zugleich idyllische Momente mit Ernst Jandl. ¬
Ein harmloser Zeitvertreib ist das Dichten für Friederike Mayröcker nie gewesen. Ihr Vertrauen in die schöpferische Kraft der Sprache und ihre Unbekümmertheit gegenüber allen literarischen Moden haben im Lauf der Jahrzehnte ein vielseitiges Werk hervorgebracht. Bei aller verspielten Sprachlust, der Freude an kühnen Bildern und manchen Verstößen gegen die Grammatik hat sie nie die großen Themen aller Kunst – Liebe, Vergänglichkeit, Tod – gescheut. Vielleicht ist es gerade dieser existentielle Ernst, der Friederike Mayröcker nun den Dialog mit Friedrich Hölderlin suchen lässt.
Scheu vor dem berühmten Kollegen kennt Mayröcker nicht. Gleich das erste Gedicht ihrer neuen Sammlung setzt, fast wie ein Kochrezept, mit einer „Prise Hölderlin“ ein, und wenig später bekennt sie: „ich möchte / leben Hand in Hand mit Scardanelli“. „Scardanelli“, zugleich der Titel des Buchs, ist jener rätselhafte Name, mit dem Hölderlin viele seiner späten Gedichte unterzeichnete. Zu dieser Zeit lebte der kranke Dichter bereits im Tübinger Turmzimmer, das ihm für mehr als drei Jahrzehnte zur eng umgrenzten Heimat werden sollte. Keine einfache Lebensgemeinschaft zwischen den Jahrhunderten also ist hier zu erwarten.
Vergnügen an der Landschaft
Mit dem schwäbischen Turmbewohner teilt Friederike Mayröcker in diesen vierzig neuen Gedichten zunächst das Vergnügen an der Landschaft am Neckar, dessen „bläuliche Silberwelle“, so hatte Hölderlin ihn beschrieben, nun auch durch ihre Verse fließt. Mayröcker weiß aber auch von den Gefährdungen alles Schreibens: „die Bilder in meinem Kopf rasen wie irrwitzige“. Von solchem Irrwitz ist es möglicherweise nicht weit zu jener „Umnachtung“, als die man Hölderlins Geisteskrankheit gern umschrieben hat. So hebt denn auch eins von Mayröckers Gedichten mit dem Wunsch nach Beistand an:
sei du bei mir in meiner Sprache Tollheit.
Von „Tollheit“ kann hier allerdings keine Rede sein. Im Gegenteil: Friederike Mayröcker, die seit ihrem fünfzehnten Lebensjahr, also seit nunmehr siebzig Jahren, Gedichte schreibt, hat sich erstaunliche sprachliche Präzision wie Originalität bewahrt. Im steten, mitunter erfrischend unkonventionellen Dialog mit Hölderlins Dichtung entstehen vielschichtige Texte, die oft an Vexierbilder erinnern. Denn obwohl es Mayröcker ihren Lesern auf den ersten Blick leicht zu machen scheint und die vermeintlichen Hölderlin-Zitate graphisch hervorhebt, ist ihr niemals zu trauen. Längst nicht alle Entlehnungen von Hölderlin werden nämlich markiert, und oft genug entpuppt sich ein scheinbar wortgetreues Zitat als virtuose Montage, in der Fremdes und Eigenes miteinander verschmelzen. „Im Grunewald / ‚oft ich weinend und blöde‘ (Hölderlin)“ lautet zum Beispiel die verwirrende Titelzeile eines Naturgedichts, das der Berliner Literaturwissenschaftlerin Heidrun Loeper gewidmet ist.
Klingende Wortgeschichte
Nun kannte sich Hölderlin zwar in der schwäbischen Topographie und an den Küsten des antiken Griechenlands bestens aus; die Hauptstadt des fernen Preußens aber blieb ihm, dem Sänger „heiliger Wälder“, mitsamt dem profanen Grunewald fremd. Tatsächlich stammt der Hölderlin zugeschriebene Halbvers nicht von ihm, vielmehr fügt Mayröcker hier Vokabeln, die er gern gebraucht hat, neu zusammen, um ein Bild ihrer eigenen melancholischen Menschenscheu mit dem Gruß an die deutsche Freundin zu verbinden. Überdies bringt hier die Wortgeschichte die Sprache auf ungewohnte Weise zum Klingen: Das in heutigen Ohren abwertend klingende „blöde“ bedeutete für Hölderlin und seine Zeitgenossen nichts anderes als „schüchtern“.
Oft variiert Mayröcker auch ein und denselben Hölderlin-Vers. Besonders angetan haben es ihr seine Naturbeschreibungen und sein Blick für das Kleine, Unscheinbare. „Wo die verborgenen Veilchen sprossen“, heißt es in einem seiner Tübinger Turmgedichte, und Mayröcker lässt nun an vielen Stellen des Buches diese Veilchen in immer neuen Zusammenhängen „sprieszen“ und „schwärmen“.
Geborgenheit in der Erinnerung
Stärker noch als bei Hölderlin, gelegentlich aber in seiner Sprache, ist die Natur für Friederike Mayröcker vor allem Erinnerungsraum an glückliche vergangene Tage, und wie schon in ihren vorangehenden Büchern ist dabei auch hier das Andenken an ihren im Jahr 2000 verstorbenen Lebenspartner Ernst Jandl allgegenwärtig. Die Schilderung einer Wanderung „auf dem Cobenzl“ mündet in die Beschwörung der lebensrettenden Nähe des Freundes: „ach es drängte mich deine / Hand zu ergreifen um dem Bedürfnis nicht nachgeben zu / müssen mich in den Abgrund zu stürzen (dem blüthenlosen)“. Momente des ungetrübten Einklangs mit „EJ“ beschwört Mayröcker in einer der wenigen Idyllen der Sammlung:
er lädt mich zum Essen es war schon Frühling wir waren
uns eins ich spürte die Fülle seines Geistes er trank
1 Glas Rotwein und mehr ich blickte ihn lange an faszte
nach seiner Hand die Zeit verging noch nicht so rasch wie
heute er wuzste Bescheid ich war geborgen.
Diese Geborgenheit aber hat mit dem Tod des Gefährten aufgehört, und oft findet Mayröcker Trost in dem Gedanken an ihre eigene Vergänglichkeit. Besonders anrührend ihr Epitaph auf sich selbst:
Besuch mich
nicht an meinem Grab es hilft mir nicht ich bin schon
tot. Ich bin so traurig jetzt und habe Angst vor dem
Verlassen dieser Welt die ich so sehr geliebt mit ihren Blüthen
Büschen Bäumen Monden mit ihren wunderbaren nächtlichen
Geschöpfen. Mein Leben war zu kurz für meinen Lebenstraum.
Ein Lebenstraum in Sprache
Noch aber verfügt Friederike Mayröcker über die Kraft, diesen Lebenstraum, der ein Traum in Sprache und aus Sprache ist, fortzuführen. Im freundschaftlichen Zwiegespräch überblendet sie die eigenen Erfahrungen mit denen ihres Vorgängers, was der Natur in ihrer Variation auf Hölderlins Ode „Chiron“ geradezu magische Züge verleiht:
Verzaubert ist mir die Welt
und fiebrig in meinem Schädel Nachtviolen Fuchsien Weiden Pinien
und Reseden lauschend im Garten (ich) Krokus und Haferkorn auch,
kirschenessend in tiefer Nacht, auch, ich auch den weich’ Kräutern,
Hölderlin.
Auf der poetischen Landkarte der Friederike Mayröcker grenzt ihre Heimat Wien unmittelbar an die schwäbischen Neckarufer.
Sabine Doering, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 7.5.2009
Eine Prise Hölderlin
− „Ich habe niemals Hölderlin geheißen, sondern Scardanelli“, hatte der 1843 gestorbene Lyriker einst behauptet. In ihrem gleichnamigen Gedichtband erinnert die Österreicherin Friederike Mayröcker durch dezente Anspielungen an Friedrich Hölderlin. Aber auch Ernst Jandl wird vor dem Vergessen bewahrt. −
1806 wird der deutsche Dichter Friedrich Hölderlin (1770–1843) in die Universitätsklinik in Tübingen eingeliefert. Die Diagnose lautet „Wahnsinn“. Drei Wochen später wird er einer Pflegefamilie anvertraut, denn er gilt als unheilbar krank und die Ärzte rechnen mit seinem baldigen Tod. Doch Hölderlin lebt und schreibt noch 36 Jahre. Als dem alternden Dichter seine Gedichte aus früher Zeit vorgelegt werden, bestätigt er zwar die Autorschaft, meint aber der Name sei gefälscht:
„Ich habe niemals Hölderlin geheißen, sondern Scardanelli!“
Seitdem ist der Name mit Hölderlins Werk untrennbar verbunden. Nun nennt die österreichische Schriftstellerin Friederike Mayröcker ihre Gedichtsammlung „Scardanelli“. Der Buchtitel ist Programm und der Name verweist auf Hölderlins zweite Lebenshälfte. In 40 Gedichten, die im Jahr 2008 entstanden sind, begegnet die Grande Dame der Literatur dem Meister der Sprache, der die Wucht des Wortes auszukosten wusste.
Im Eröffnungsgedicht „Hölderlinturm, am Neckar, um Mai“ befindet sich das lyrische Ich im noch heute bestehenden Stadtturm, in dem Hölderlin einst schrieb. Im „hellroten Hölderlinzimmer“ registrieren die Augen anfangs lediglich eine „Prise Hölderlin“. Bis sich der Blick in einigen „Blütenblättern“ verfängt und ein Vers aus seinem Gedicht „Der Neckar“ erinnert wird:
„Es glänzt die bläuliche Silberwelle“
Ton kommt zum Bild und der museale Ort scheint plötzlich belebt.
Mayröcker stimmt mit dieser Szenerie auf das Thema des Gedichtbandes ein. Und sie verrät bereits im darauffolgenden Gedicht, in welchem Zustand die Begegnungen stattfinden:
„erschrecke zuweilen dass der zu dem ich spreche nicht da ist“.
Für das Verständnis der Gedichte ist das eine wesentliche Information, denn in der Einsamkeit des/der Sprechenden verläuft der geheimnisvolle Meridian, der beide Künstler verbindet und der als zentraler Gedanke die Texte durchzieht. Zugleich aber spricht der Vers von „knallharter Mnemotechnik“ und „Gedächtniskunst“. Denn neben Hölderlin gilt es auch den Hand- und Herzgefährten Ernst Jandl vor dem Vergessen zu bewahren, der 2000 verstarb.
So stößt das lyrische Ich beim Erinnern immer wieder auf Leerstellen (den Verlust von Freunden, den Tod der Mutter) und verfällt in einen inneren Dialog, der auch der Selbstvergewisserung dient. Aus der Not zunehmender Kommunikationsabstinenz, unverschuldet und unwiederbringlich wie einst bei Hölderlin, entstehen Gedichte, die in großer Anzahl Freunden und Bekannten gewidmet sind. Schreiben als Leidenschaft und letzter Halt in der Welt: „Ein anderes Geländer haben wir nicht“, zitiert sie den jung verstorbenen Lyriker Thomas Kling.
Mitunter sind es nur einzelne Worte aus „Scardanellis“ Werk, mit deren Hilfe der ewige Kampf gegen das Vergessen in Gang gehalten wird. Ein Kampf, der über die eigene Existenz hinaus führt. Etwa im Gedicht „ich auch den weich‘ Kräutern, Höld.“
„Vergiszmeinnicht in meinem Schädel die Einsam-
keit tobt die Verzweiflung in meinem Schädel die Angst tobt der Schrecken“.
In Mayröckers Scardanelli begegnen wir einer „bangen Seele“, die ihre Angst vor dem Verlassen dieser Welt schonungslos bekennt und uns dabei kostbare Gedichte beschert, die Mut machen, zu verweilen.
Carola Wiemers, Deutschlandradio, 29.4.2009
Friederike Mayröcker: Scardanelli
Wenn Dichten heißt, einer Stimme zu lauschen, die größer ist als das Ich – dem Murmeln der Menschheit – dann sind die vierzig Gedichte im jüngsten Band von Friederike Mayröcker ein wunderbarer Lauschangriff. Ein Hören nach Innen, in zweifacher Hinsicht.
Einerseits auf das unverwechselbar Mayröckersche, geöffnete und nicht mehr geschlossene Klammern – nicht nur qua Zeichensetzung; dem Leser wird eine verrückende Privatheit gewährt. Andererseits auf den titelgebenden Scardanelli. Wer ist Scardanelli? Mayröckers erfundener Gesprächspartner? Ein abwesender, verflossener Geliebter, Begleiter auf Spaziergängen? Eigentlich tut es kaum zur Sache, wer oder was Scardanelli ist. Vielleicht ein Käfer? Ein Vogel, eine Raupe, eine Blindschleiche unter Blechgieszkanne? Ein Teil des Getiers, das die Gärten und Waldlichtungen bewohnt, die in diesen Gedichten besucht werden? Fraglos ein gelungener Titel. Wer weiter fragt und liest, wird entdecken, dass sich eine Person dahinter verbirgt, ein Dichterkollege: Friedrich Hölderlin (1770-1843), mit dem die Grande Dame der zeitgenössischen deutschsprachigen Dichtung mehr als der Vorname verbindet.
Der ironischerweise unter anderem mit dem Gedicht „Die Hälfte des Lebens“ („Mit wilden Birnen hänget / Und voll mit wilden Rosen / Das Land in den See,…“) berühmt gewordene Hölderin verbrachte seine zweite Lebenshälfte in mehr oder weniger großer geistiger Umnachtung in einem Turmzimmer am Neckar. Aus der psychiatrischen Anstalt war er als unheilbarer Fall entlassen worden. Noch 36 Jahre lebte Hölderlin, der nun Scardanelli genannt zu werden wünschte, oder Buonarotti oder Killalusimeno, bei der Schreinerfamilie Zimmer, der das Turmzimmer gehörte. In diesem Zimmer der Familie Zimmer beginnt Friederike Mayröckers erstes Gedicht mit einer Prise Hölderlin.
Ihre Wahlverwandtschaft mit Scardanelli kann man – so man sich durch dieses Buch zum Hölderlinlesen verführen lässt – auch in früheren Werken erkennen. Gärten als Zufluchtsorte an den Strömen der heiligen Urwelt (Hölderlin) sind den zwei Dichtern gemein. „So sage, wie erwartet die Freundin dich / In jenen Gärten, da nach entsetzlicher / Und dunkler Zeit wir uns gefunden?, sagt Hölderlin. im Garten sagst du die Bäume / sind noch die gleichen wie damals“, sagt Mayröcker.
Anfänge und Enden im herkömmlichen Sinn gibt es in den hier versammelten Gedichten nicht. Naturgemäß müssen die gedruckten Texte irgendwo beginnen und irgendwo ein Ende haben. Doch, wie immer bei Mayröcker, deutet schon die Schreibweise, Klein- oder Großbuchstaben, wie es kommt, an, dass noch etwas davor oder danach sein könnte. Wer das liest, fängt Teile eines intimen Gespräches auf. Die scheinbare Bruchstückhaftigkeit erhöht die Intensität.
Scardanelli ist wie das Sitzen in einem halbwilden Garten. Theoretisch weiß man, alles ist angelegt, menschengemacht. Lässt man sich aber nieder, so wirkt nichts aufgesetzt, alles ganz natürlich, als gäbe es gar keine andere Möglichkeit. Die Kunst der Wortgärtnerin! Gärten sind ein Ausschnitt aus der Welt, ihr Dekolleté. Eben durch die Begrenzung und das Wissen, dass es außerhalb weiter geht, sieht man genauer. Betrachtet den Garten, seine Utensilien, Vögel, Sessel, Rosen, und entdeckt ihn doch jedes Mal neu, sobald man sich um die eigene Achse dreht. „Zwar gehn die Treppen unter den Reben hoch / Herunter, wo der Obstbaum blühend darüber steht / Und Duft an wilden Hecken weilet, / Wo die verborgenen Veilchen sprossen“; (Hölderlin). Hölderlins Veilchen werden gepflückt:
auch verweilten diese Schaafe, und jetzt nach so vielen Jahren
Tränenjahren mitten im Winter Blättchen sprieszend („wo
die verborgenen Veilchen sprossen“) unter halb hochgezogenen
Blenden mein Bibelchen mein Flügelhorn ich habe dich doch
überall geheiratet und zu Kränzchen verflochten: Fenster wo junge Blättchen wo verborgene Veilchen schwärmten.
Das Besondere, Seltene an Scardanelli geht weit über die geheimnisvolle Gabe hinaus, die das Buch für Literaturwissenschaftler darstellt. Mit entwaffnendem Freimut verrät Mayröcker, was wir alle wissen wollen. Eine Ahnung davon, was es heißt, alt zu sein. Schon in „Lebenslauf“, einem Gedicht aus dem Jahr zweitausenddrei (aus: Gesammelte Werke, Suhrkamp 2004), wendete sich das Ich an zwei nie geborene Kinder, „und ich würde mir alt vorkommen neben / ihnen und sie um Himmelswillen / um Rat fragen den sie mir vielleicht“. Hölderlin schreibt in einem titelgleichen Gedicht, „Denn nie, sterblichen Meistern gleich, / Habt ihr Himmlischen, ihr Alleserhaltenden, / Dass ich wüsste, mit Vorsicht / Mich des ebenen Pfads geführt“.
Das alternde Ich aus Scardanelli ist innerlich voll stürmischer Energie. Jung und überquellend wie die oftmals besuchten Bad Ischler Quellen, erinnert es sich an Kindheitsreisen, Frühlinge, Herbste, Küsse, und die Tiere: Käfer und Köter, wie Herzblut. Es betrachtet sich im Spiegel, mit Entsetzen und Verwunderung. Das Innere will mit dem Äußeren ganz und gar nicht mehr übereinstimmen. Und wer wird sich an einen erinnern, wenn man dann nicht mehr ist? An das Eisschlecken vor dem Fotogeschäft? An die Sommerküsse?
Das achtzehnte Gedicht trägt den Titel, „Bedenken von der Liebe“, und da heißt es, „an dir erkannt, was mich verwirrte ALS ICH SPRACH ZU DIR WIE NAH / DER TOD MIR und dasz ich Jahr für Jahr mir Aufschub erflehe und / wie du darauf mich umarmtest. Damals in Bad Ischl, Zichorie und / Waldgehölz, wie sie sich krallten mit zärtlichen Füszen : klammer- / ten am schwankenden Epheu unter dem Gasthof Fenster: SPATZEN / Mei- / sen Stieglitze im gleiszenden Morgenlicht, damals…“
Wenn die Angst vor dem Tod so schön ist.
Andrea Grill. literaturhaus.at, 30.4.2009
Kein Imbiss, sondern ein Gedichtband
gegen die Schnelllebigkeit. Ein Aufbegehren gegen den Wahn von Tempo und schnell verbrauchendem Konsum. Ein im besten Sinne langsames Buch. Der Gedichtband „Scardanelli“ von Friederike Mayröcker lässt einen innehalten.
Die Trägerin des Büchner Preises ist längst zur Sprachikone geworden, mit dichten und dichtesten Eindrücken in ihren Zeilen und auch dazwischen. Lange Jahre im produktiven Einklang und Widerstreit mit ihrem Lebenspartner Ernst Jandl hat sie eine poetische Intensität erreicht, die für sich steht und die in stiller Größe mit der Sprache behutsam, forschend und dennoch ihre Territorien erweiternd umgeht.
In diesem Gedichtband misst sie sich mit einer romantischen Ikone: Friedrich Hölderlin, der von seiner wahnsinnigen Zeit zum Wahnsinnigen erklärt wurde und in seinem Turmzimmer über dem Neckar als „Scardanelli“ unvergängliche Verse schuf. Sie trifft ihn, in langen Spaziergängen und durchschriebenen Nächten. Sie begegnet ihm mit Respekt, ohne sich zu scheuen, aus seinen Versen heraus in völlig neues Land zu gehen. Mayröcker nimmt Hölderlins Steine des Anstoßes, um sich in ein Terrain hinein zu wagen, in dem formale Konventionen, intime Bilder und sprachliche Rätsel gleichberechtigt zueinander finden. Es sind Zeilen des Alters, der Reife, des Überblicks. Aber immer wieder auch brennende Sehnsüchte und Erinnerungen, die da in nicht leicht fassbare, aber umso tiefer wirkende Gedichtbilder gefasst werden.
Als Themen tauchen Natur, Landschaftsbilder – echte und erdachte −, sowie Gedanken an „EJ“ und Blicke in eine blasser werdende Vergangenheit auf. Aber auch Trauer, Elegien, oftmals unterbrochen von hymnischen Bildern der Freude. Vieles bleibt rätselhaft, fragmentarisch, mehr fragend als beschreibend. Vieles ist nur in Stimmung, in Hingabe an Rhythmus und Klang erlesbar, der schnelle Zugang zu ihren Gedichten bleibt verwehrt, was aber durchaus als großes Kompliment verstanden werden soll.
Eine bemerkenswerte Antithese zu Popliteratur und Textverschleiß auf Frankfurter oder anderen Buchgroßmessen. Dieser Gedichtband braucht Zeit und Muße. Beides Faktoren, die als unmodern und oftmals auch unnötig gelten. Wer sich aber die Zeit nimmt, in diesen Zeilen Stunden zu verbringen, sich einzuhören, einzulesen, einzulassen, der wird belohnt mit einer Sprache und mit Bildern, die tief berühren. Dieses Buch ist ein poetisches Genussmahl. Kein schneller Imbiss, kein „Coffee-to-go“. Entschleunigung in schönster Form.
Tristan Jorde, kulturwoche.at
Teil III meiner Notizen zur Mayröcker Lektüre
Scardanelli
Scardanelli oder auch Buonarotti oder Rosetti, so nannte sich Hölderlin in seinen letzten Lebensjahren, wenn er im Turmstübchen des Tübinger Tischlers Ernst Zimmer Besuch empfing. 37 Jahre, die Hälfte seines Lebens verbrachte er in diesem Turmstübchen, das ihm sein Bewunderer Zimmer nach seinem letzten Wahnsinnsschub zur Verfügung gestellt hatte. Scardanelli, so signierte er auch seine spätesten Gedichte. Oft auch mit der Wendung „mit Unterthänigkeit“ und einem Phantasiedatum versehen.
Was an den Wahnsinnsgedichten Hölderlins sofort auffällt ist ihre gefällige Form. Sie wirken gar nicht „wahnsinnig“, sondern eher seltsam unbeholfen, wie die ersten lyrischen Gehversuche eines pubertierenden Gymnasiasten. Ein simples Bauschema aus 5 bzw. 6-hebigen iambischen Versen mit einem gefälligen Reimschema. Kein Vergleich zum sprachlichen und metrischen Reichtum der Gedichte aus der Zeit vor dem Wahnsinn.
Scardanelli, das ist die ausgebrannte Ruine, die von Hölderlin übriggeblieben ist. Im Gegensatz zur populären Vorstellung zeigt sich der Wahnsinn nicht (nur) in expressiven Sprachbildern, in bizarren Formulierungen, in ungewöhnlichen Rhythmen, sondern (auch) in einem Verdämmern, Verglühen, Vergehen.
Nachtgesänge
Kurz vor seinem Verlöschen schreibt er noch Gedichte, die zu den großartigsten, vielleicht auch rätselhaftesten der deutschen Dichtkunst zählen, die „vaterländischen Gesänge“ und die „Nachtgesänge“. In einem dieser Nachtgesänge, in der „Hälfte des Lebens“ scheint er seine eigene zweite Lebenshälfte als Scardanelli vorwegzunehmen:
Mit gelben Birnen hänget
Und voll mit wilden Rosen
Das Land in den See,
Ihr holden Schwäne,
Und trunken von Küssen
Tunkt ihr das Haupt
Ins heilignüchterne Wasser.
Weh mir, wo nehm’ ich, wenn
Es Winter ist, die Blumen, und wo
Den Sonnenschein,
Und Schatten der Erde?
Die Mauern stehn
Sprachlos und kalt, im Winde
Klirren die Fahnen
Die „Nachtgesänge“ sind erst spät gerühmt worden, ursprünglich sind sie gar nicht gut aufgenommen worden. „Nichts erregt mehr Unwillen, als Nonsens mit Prätension gepaart“, hieß es in einer zeitgenössischen Rezension.
Stefan Zweig hat in seiner bemerkenswerten biographischen Studie zu Hölderlin, Nietzsche und Kleist die These vertreten, dass der Wahnsinn hier gewissermaßen als Brandbeschleuniger wirkt. Das Genie verbrennt sich selbst in einem letzten manischen-visionären Feuerwerk der Poesie. An der äußersten Grenze ihrer Existenz, kurz vor dem geistigen Verfall (Hölderlin, Nietzsche) oder der Selbstvernichtung (Kleist) schaffen sie Ungeheuerliches, Großartiges: Nietzsche verglüht zum Klang seiner Dionysos-Dithyramben, Hölderlin verdämmert in der Rhythmik seiner Nachtgesänge, Kleist zelebriert seine Selbstauslöschung in der dunklen Messe seiner Todesbriefe. Dieser Weg in den Abgrund, in die letzte Götterdämmerung ist der rote Faden, den Zweig in seinen Psychogrammen nachzeichnet. Und zurück bleibt nichts als kalte Asche.
eine Prise Hölderlin
„diese Prise Hölderlin“. Mit diesen Worten beginnt das erste Gedicht im Scardanelli Band. Und es schließt mit den Worten „sehnsüchtige Bäche uns blühten, Höld.“ des letzten Gedichtes. Dazwischen 38 weitere Gedichte, die um Hölderlin/Scardanelli kreisen. Formal weisen Mayröckers Scardanelli Gedichte nicht die geringste Ähnlichkeit mit den „echten“ Scardanelli Gedichten auf. Keine gefällige Metrik, schon gar keine gefälligen Reime.
Und auch was das lyrische Ich betrifft, könnten die Unterschiede nicht größer sein. Die Scardanelli Gedichte sind „ichlose Gedichte“ (Oelmann 1996, 203) Kein lyrisches Ich erhebt in ihnen mehr die Stimme, exklamiert, fragt, beschwört, beklagt. Sondern ein ichloses Subjekt, das sich Scardanelli nennt, verfasst auf Zuruf Gedichte, vornehmlich über die Jahreszeiten, so wie er sie aus seinem Turmfenster wahrnimmt. „Fenstergedichte“ nennt Oelmann diese Gedichte über eine Welt, die auf einen trüben Blick aus einem Turmfenster zusammengeschrumpft ist.
Mayröckers Scardanelli Gedichte hingegen sind vielfach Reflexionen eines lyrischen Ichs. Mitnichten Wahnsinnsgedichte also, eher Reflexionen über den Wahnsinn, mehr noch über das Altern, das Verdämmern, den drohenden Sprachverlust.
1 Krümel Leben zwischen den Fingern zerrieben, gehe vorgebeugt wisch mir das linke Auge : kleiner geworden, all dies : die verknoteten Morgen das schwindende Augenlicht, der grüne Staub in den Adern das kontinuierliche Alter : du kannst zusehen : dieser Schritt in die Ewigkeit (…)
(„Elegie auf Jorie Graham“).
Wahnsinn, Tod und Sprachverlust
Und doch heißt es da auch einmal:
ich möchte Leben Hand in Hand mit Scardanelli
(„Velázquez diese Schaafe“)
Warum mit der Ruine, die einmal Hölderlin war und nicht mit Hölderlin? Klingt hier ein versöhnlicher Ton an, ein Sich-Abfinden mit der Endlichkeit, mit dem Sprachverlust, mit der Hinfälligkeit des Alters? Eher nicht. Weder die Dichterin Friederike Mayröcker, noch das lyrische Ich in ihren Scardanelli Gedichten kann sich mit dem Tod abfinden. Die Dichterin sagt:
Der Tod ist mein Feind. Ich kann die Tatsache des Todes überhaupt nicht akzeptieren. (…) Der Tod ist ekelhaft. Er ist ein Eklat, ein Skandalon, eine Frivolität, eine Schmach, eine Verdammung und Herabsetzung des Lebens. (Mayröcker 2004)
Und das lyrische Ich spricht ganz ähnlich:
und doch, welche Lust zu leben (…) folgsam und ängstlich jederzeit bettelnd um weitere Tage
Oder auch:
Ich bin so traurig jetzt und habe Angst vor dem Verlassen dieser Welt die sich so sehr geliebt mit ihren Blüthen Büschen Bäumen Monden mit ihren wunderbaren nächtlichen Geschöpfen.
Manche dieser Gedichte wecken in mir jene „Lust am Text“, die sich bei der Lektüre der „Abschiede“ nicht und nicht einstellen wollte. Vielleicht ist mir der Wahnsinn näher als die Liebe?
Gerald Hutterer, hutterer.blog.de, 6.3.2010
Mayröcker besucht Hölderlin
− Heuer ist ein Band erschienen, der die Hölderlin-Gedichte Friederike Mayröckers bündelt; insgesamt 40 Stück. Scardanelli-Versatzstücke und ein Scardanelli-Tonfall, gespiegelt auch in metrischen Anklängen, sind darin zu finden. −
Ich möchte leben Hand in Hand mit Scardanelli
Wem wohl würde man eine solche Gedichtzeile abnehmen, wenn nicht Friederike Mayröcker, bei der sich Sätze wie dieser mit einer über fünf Jahrzehnte gelebten dichterischen Existenz zu füllen vermögen. Der Name Scardanelli ist ein starker Bezugspunkt, denn hinter ihm steht eine poetische Ungeheuerlichkeit.
Erste Berührung
Ganze 36 Lebensjahre verbrachte Friedrich Hölderlin, verfangen in seinem Wahn, in seinem Turmzimmer in Tübingen. Die Gedichte, die er in jener Zeit schrieb, unterfertigte er mit dem Fantasienamen, oft begleitet von Demutsformeln: Mit „Unterthänigkeit: Scardanelli“. Friederike Mayröcker hat den Hölderlinturm, ein Dichter-Gefängnis mit romantischem Blick über den Neckar, schon vor Jahren erstmals besucht und sich von dem Ort bezaubern, aber wohl auch erschrecken lassen. Aus dem Jahr 1989 datiert ein Gedicht, das von einer ersten Berührung zeugt. Nicht von dem ungeheuerlichen Gesamt-Schicksal des fernen und doch zugleich nahen Dichter-Freundes ist darin die Rede, sondern von einer „Prise Hölderlin“, die sich über den Text streut. Ein Text, der die Aussicht aus dem Fenster des „Hölderlinzimmers“ im Blick hat, hinaus in den Ufergarten. Die Bäume da unten, so vernimmt sich eine dritte Stimme, „sind noch die gleichen wie damals.“
Zahlreiche Zitate
Bei Suhrkamp ist nun ein Band erschienen, der unter dem Titel „Scardanelli“ die Hölderlin-Gedichte der Autorin bündelt; insgesamt 40 Stück, beginnend mit dem erwähnten bis hin zu einer längeren Serie, die Mayröcker im Vorjahr schrieb. Auch hier ist es oft nur eine „Prise Hölderlin“, ein einzelnes Wort etwa aus einem seiner Gedichte, das sich in das poetische Universum der Autorin fügt oder an dem sich die dichterische Phantasie neu entzündet. „Diese Schaafe“ beispielsweise, geschrieben mit zwei a und bei Mayröcker kursiv gesetzt, weiden an mehreren Stellen im Text, und auch längere Hölderlin-Zitate, die manchmal, scheinbar schlampig, nur noch mit der Abkürzung „Höld.“ bezeichnet werden, sind in ihm präsent. Oft auch im Titel der Gedichte wie zum Beispiel das Hölderlin-Zitat „oft ich weinend und blöde“, das sich in einen verwirrenden langen Titel eines Mayröckerschen Naturgedichtes fügt. Im 19. Jahrhundert übrigens war mit dem Wort „blöde“ noch nicht eine Blödsinnigkeit in unserem heutigen Sinn gemeint, sondern es hatte das Wort die schlichte Bedeutung „schüchtern“.
Eingepasst in die Zeit
Die Unterthänigkeit (vor der Gnade des eigenen Schreibens) und die Schüchternheit, die gerade auch in den Zusammenhängen des heutigen Literaturbetriebes als eine Blödheit gelesen werden kann, verbinden das Mayröckersche Schreiben nicht erst in diesem neuen Gedichtband mit dem Hölderlinschen Sprachuniversum. Scardanelli scheint hier nun aber tatsächlich auferstanden zu sein, zu einer neuen demutsvollen und dabei doch ungeheuer kraftvollen Art, mit den Gegenständen der Welt umzugehen. „mit Scardanelli“ nennt sich folgerichtig eines der Mayröckerschen Gedichte, und in einem anderen wird angezeigt, dass es sich hier um die „Scardanelli-Version“ eines Textes handelt. Scardanelli-Versatzstücke und ein Scardanelli-Tonfall, gespiegelt auch in metrischen Anklängen, sind in den Mayröckerschen Gedichten zu finden, wobei diese aber nicht altertümlich wirken, sondern ganz eingepasst in ihre Zeit. So steht, was man vielleicht nicht vermuten wollte, in einem der Gedichte „1 Jimi Hendrix an einer Straszenkreuzung“, ich nehme an in Wien, und es lagern sich bekannten Wiener Orten wie dem Cobenzl oder dem Pötzleinsdorfer Schlosspark Hölderlinblicke auf den Neckar, aber auch Erinnerungsblicke der Autorin aus Florenz oder aus Venedig an.
Neue Kraft
Die einzelnen Gedichte des Bandes sind auch Bilanzen eines künstlerischen Lebens. Aber sie schließen, obgleich der Gedanke an den Tod drängt, an diesem Leben nichts ab. Ganz im Gegenteil: Die Wahrnehmungsfähigkeit der Autorin, die ver-rückte Phantasie ihrer Bildwelten, das anarche Element ihrer Beschreibungen und auch die Zuneigung zu den Menschen, die sie umgeben, gewinnen in „Scardanelli“ neue Kraft. „Ich möchte leben / Hand in Hand mit Scardanelli“, schreibt Mayröcker und zeigt, indem sie die Zeile weiterspinnt, wie das geht: „das Lamm in meinem Bett / die Schäbigkeit meiner Zwischenzeit ekstatisch ahnungslos (ent- / flammt) wie damals als Vater mich fotografierte in meinem / weiszen Kleid und 1 Strähne Haar (hatte den Kopf gedreht) / ins Auge wehte –“
Und so weiter, und so fort: Man möchte mit dem Lesen nicht aufhören.
Klaus Kastberger, oe1.orf.at, 18.12.2009
Lebenshunger und Todesfurcht
− Friederike Mayröckers neuester Gedichtband Scardanelli. −
Das poetische Ich, das sich in diesen Gedichten so vielfältig auf Friedrich Hölderlin bezieht, begreift den Dichter des „Hyperion“ als Scardanelli mit der „Schönheit des Wahns im Herzen“. Diese Beziehung gleicht weniger einer intellektuell sich auseinandersetzenden, als vielmehr einem emphatisch vorgetragenen zärtlichen Einverständnis, in dem beide, das poetische Ich und „Höld.“, eine Position der Bedürftigkeit, der Fragilität und Verletzlichkeit einnehmen. Neben der zunehmenden Todesnähe artikuliert sich ein immenser Lebenshunger, von der daraus resultierenden, manchmal kaum auszuhaltenden Spannung sprechen die Gedichte des jüngsten Lyrikbands von Friederike Mayröcker.
Am Anfang stehen dort zwei Gedichte, eines von 1989 und eines von 2004, die frühere Beschäftigungen mit Hölderlin widerspiegeln, während alle folgenden chronologisch geordnete Gedichte von 2008 sind (manchmal erfahren wir sogar die Uhrzeit der Entstehung, warum das wichtig ist, sei dahingestellt). Das erste Gedicht ist unschwer als Erlebnisgedicht zu begreifen und wohl nach einem Besuch des Hölderlinturms entstanden. In wohltuender Klarheit gibt es die Perspektive vor, die die folgenden Gedichte einnehmen. Der Blick fällt auf verwelkende Blumen im Hölderlinzimmer, nicht mehr ganz frische Spuren des Erinnerns an seinen schon lange abwesenden Bewohner und dann auf zwei Stühle, deren bloße Existenz zu dem Dialog einlädt, der hier entfaltet wird. Das zweite bezieht sich nicht auf Hölderlin, sondern spricht von einem magischen Ort in Wien, dem Bürgercafé: Unschwer ist zu lesen, dass es sich auf den seit seinem Tod im Jahre 2000 von Mayröcker so schmerzlich vermissten Lebensgefährten Ernst Jandl beziehen könnte: „erschrecke zuweilen dasz der zu dem ich / spreche nicht da ist“. Damit sind zwei der Koordinaten genannt, zwischen denen sich der gesamte Band bewegt: „Die Prise Hölderlin“, in der in einem Anderen aufscheint, was hier geleistet werden soll: eine Mnemotechnik, die einerseits an diese großen Dichter des Totenreichs erinnert und andererseits ihre eigenen engen Grenzen ausstellt: Sichtbar wird das dort, wo Szondis Celanlektüre anzitiert („die Schnittblumen messerscharf in der Wiese, diese knallharte Mnemotechnik“), und damit die akute Bedrohtheit durch den Tod ins Bild gesetzt wird.
In diese Koordinaten schreiben sich Gedichte hinein, die einen Naturdiskurs entfalten, den man in zeitgenössischen Gedichten ebenso so selten findet, wie man ihn dennoch ebenso häufig bei Mayröcker lesen kann. Die botanisch kenntnisreich sich entfaltende Pracht überwuchert (fast) alles Andere und bereitet den natürlichen Rahmen für eine Lebensfeier, die einerseits ungebrochen, andererseits umso zerbrechlicher erscheint, je mehr sie vom Verfall künden muss. Die Bilder vom Natürlichen sind nicht immer solche des Blühens, sondern oftmals herabwehende Blätter, die sich gelöst haben vom Gesamtorganismus, um ihrer Bestimmung zu folgen, zugrunde zugehen. Es sind zugleich Bilder für die Poetik der Gedichte. Die einzelnen Gedichte lösen sich von der Grammatik, vom Satz, der kohärenten Rede und ihren Kontexten und betonen umso farbiger und greller die Details. Das Bild der Natur, das so entsteht, hat ein langes Leben aufgesogen, um es in letzter Konzentration und Fülle zu reflektieren. In diesen Gärten bewegt sich ein Ich, das sich in großer Schonungslosigkeit als lebenshungriges und dennoch versehrtes zeigt. Bedroht ist es nicht nur von dem nahenden Tod, sondern von der lebendigen Natur selbst („der Waldesschatten (damals) zerrte mir / das Herz aus dem Leib“). Der in so vielen Blütenträumen erscheinende Raum ist, so gesehen, ambivalent und auch das Ich ist janusköpfig: Es ist ein die Lasten des Alters beklagendes und die Trostbedürftigkeit des Kindes zelebrierendes. Auch die Anrufung der Hölderlinfigur erfüllt zwei gegensätzliche Funktionen: Einerseits soll er der Schützende sein, andererseits und auch ungleich häufiger ist er die ähnlich zerbrechliche Bruderfigur. Der Dialog, der so entsteht, fächert sich immer dort noch weiter auf, wo die Autorin (Dichter-)Freunden Gedichte widmet (Elfriede Haider, Pia-Elisabeth Leuschner, Franz-Josef Czernin, Julian Schutting und anderen), direkten Bezug nimmt auf ein anderes Gedicht („Falten und Fallen“ von Durs Grünbein) oder auch Dichterfiguren in ihren Gedichten auftreten lässt. Zweimal ist es etwa Thomas Kling (von Ernst Jandl muss hier nicht mehr die Rede sein), der auftaucht und man versteht sofort warum, wenn man die Verse zitiert, in denen das geschieht: „und scheu der Vogel der Nacht trauert / wie einst Thomas Kling auf der geborstenen Säule mit ausgebreiteten / Flügeln ehe er starb dieser rauhe und zärtliche Held“ und noch einmal in den folgenden für den gesamten Gedichtband programmatischen Versen: „Wir halten uns an / die Schrift weil 1 anderes Geländer haben wir nicht, Thomas / Kling.“. Der früh verstorbene Dichter erhält hier ebenso ein Denkmal, wie er auch zum Bundesgenossen ausgerufen wird. Das Ich lehnt sich mit ihm zusammen als Schreibende gegen den Tod auf, und ebenso wie er wird es diesen Kampf wohl verlieren, aber dennoch bietet die Schrift zunächst einen Halt, so zerbrechlich er sich auch schlussendlich erweisen mag.
Der Naturpreisung an die Seite gegeben sind Verweise auf Lesefrüchte, die kein obsoletes Bildungsgut sind, sondern die Gedichte mit Erfahrungen sättigen, die den eigenen des poetischen Ich einen zusätzlichen Resonanzraum schaffen. Besonders reizvoll ist das dort, wo nicht nur die Wortkunst, sondern auch die bildende Kunst oder die Musik mit einbezogen werden: Man weiß um die Qualität der Tränen, wenn auf John Dowland angespielt wird.
Das Ich, das in diesen und aus diesen Gedichten spricht, ist ebenso klug wie neugierig, ein reisendes zudem und, wie man nicht müde werden kann, es zu betonen, verletzlich und mutig genug, es deutlich zu zeigen. Gerade diese letzte Eigenschaft berührt als Plädoyer für das Fragile, Ersterbende und Strauchelnde sehr. Umhergehen kann man in Seelengärten en miniature, in denen ein schwankendes Ich umso leidenschaftlicher seine Liebe bekennt und zugleich seine eigene Todesverhaftetheit anerkennen muss. Man merkt es den Gärten voller Blumennamen nicht an, dass sie selbst die Perspektive eines Paul Celan noch zu radikalisieren vermögen. Das wird beispielsweise dort deutlich, wo „die Maulbeerbäume verbluteten“. Während es in Celans Anfangsgedicht aus „Atemwende“ („Du darfst mich getrost mit Schnee bewirten“) vom Maulbeerbaum heißt: „Schrie sein jüngstes Blatt“, sterben die Maulbeerbäume bei Mayröcker ganz.
All das ist mit einer manchmal sentimentalen Signatur versehen, immer aber mit der Subtilität derjenigen, die eine Sprache für die vielfältigen geistreichen Vernetzungen und emotionalen Verstrickungen gefunden hat. Die aber ist durchaus besonders zu nennen und leicht zu lesen ist dieser Gedichtband bis auf die beiden ersten Gedichte überhaupt nicht. Wie in vielen früheren Gedichten wird auch hier eine eigenwillige Grammatik entfaltet und die Rede fragmentarisch und kryptisch abgebrochen. Das mag deiktisch ein Verstummen zeigen, ja auszustellen, dabei wird dieses Verfahren immer zugleich reflektiert. Prekär und das heißt bedrohlich wird das dort, wo das poetische Ich sich seiner Sprache nicht mehr versichern kann: „Dann hört plötzlich alles auf […]; dann geht mir die Sprache verloren“. Hier wird deutlich, wie viel für das Ich auf dem Spiel steht: Alles. Gerade das ist das Mutige und Unhintergehbare an diesen Gedichten: Sie wagen es, die große Verletzlichkeit und Bedürftigkeit eines alternden und zugleich kindlichen Ich zu zeigen, ja zu zelebrieren unter Zuhilfenahme eines preziosen Diskurses, der die Naturemphase der Romantiker radikal überbietet, indem die Natur in jäher Schnitttechnik dargeboten wird. Die Zeit hat sich ihrer bemächtigt und wie Szondi für Celan gezeigt hat, ist auch hier die augenblicklich eintreten könnende Todesnähe jene Spannung, die dem gesamten Gedichtband zugrundeliegt. Wie das poetische Ich sich dieser unüberwindlichen Herausforderung stellt, in barocker Fülle das Leben besingt und den Tod umso mehr fürchtet, lohnt die Lektüre der, typografisch gesehen, wild wuchernden Gedichte.
Iris Hermann, literaturkritik.de, 11.11.2009
„Sei du bei mir in meiner Sprache Tollheit“
− Scardanelli – Friederike Mayröckers Gedichte im Zeichen Hölderlins. −
Dichter sein, das ist Profession und Imperativ zugleich. Ganz nahe ist Friederike Mayröcker ihrem „Herzgefährten“ Ernst Jandl im Leben und nach dessen Tod geblieben. Dass es jetzt Hölderlin sein soll – „Hand in Hand“ sogar –, erscheint angesichts der Folgen für die Poesie als geradezu zärtliche Untreue.
„Mit Unterthänigkeit / Scardanelli“ hat Friedrich Hölderlin in den Jahren nach 1806 seine Gedichte gezeichnet. Blatt um Blatt wurde vom Tübinger Turmbewohner mit seltsamen Zeilen gefüllt, die zwischen Hellsichtigkeit und Umnachtung schwanken. In ihrem fünfundachtzigsten Jahr und dem neuen Gedichtband „Scardanelli“ nimmt sich Friederike Mayröcker die Freiheit, mit der Poesie zu machen, was diese mit ihr macht.
„Sei du bei mir in meiner Sprache Tollheit“, ruft die Dichterin aus und schafft sich ihren Hölderlin noch einmal neu. Unter seinem wirklichen Namen, als „Scardanelli“ oder unter der Abkürzung „Höld.“ steht der deutsche Poet in den Versen. Die „bläuliche Silberwelle“ des Neckars windet sich durch Gedichte, wo nicht nur „die verborgenen Veilchen“ spriessen, sondern auch ein ganzer Wald schönster Apokryphen. Zusammengeträumt sind Hölderlins „Schaafe“, deren „Schäfer ich war“, zusammengeträumt sind auch manche Zitate, die penible Philologen in die Irre führen werden.
Inklinationen der Einsamkeit
Wenn der hymnische Ton des Dichters durch Mayröckers eigensinnige Sprache weht, dann bekommt das Gesagte eine Dringlichkeit, die man nicht ohne Grund autobiografisch lesen wird.
„Scardanelli“ ist eine Hymne auf das Glück und zugleich eine Erinnerung an die Trauer. Dass zwischen beiden der Abschied liegt, macht der schmale Band auf schmerzhafte und zugleich poetischste Weise bewusst. Nicht wenige Gedichte beschwören gemeinsam mit Ernst Jandl erlebte Zeiten. „Inkliniere zu Einsamkeit“, notiert Mayröcker, und schon meint man die Brüchigkeit dieser (Selbst-)Gespräche zu spüren. Fragmentarisch wie bei Hölderlin bleiben manche Zeilen, wenn sie plötzlich in einem Niemandsland der Grammatik enden. Klammern werden geöffnet, um sich nicht mehr zu schliessen, Sätze mit einem schlichten „usw.“ abgebrochen.
Das eigene Alter, „die Schäbigkeit meiner Zwischenzeit“, wird von Mayröcker mit schonungsloser Deutlichkeit und dennoch auch mit Empathie beschrieben. Hat man denn zu wählen? Man sieht die Dichterin am Fenster ihrer Wohnung stehen und wie sinnlos auf die Strasse schauen, man sieht sie über die Dinge stolpern, die sich in der Wohnung angesammelt haben, und man sieht sie auf Reisen. Nach Venedig führt der Weg, nach Altaussee und immer wieder in die Kindheit. Still steht die Zeit der Deinzendorfer Sommer, in denen die Mädchenfüsse ihren Abdruck im Staub der Strasse hinterlassen.
Makulatur eines Lebens
Es bleiben Bilder von der Mutter, die der Tochter „3 Kreuzchen : Knospen“ auf die Stirn pflanzt. Ist die Kindheit, um mit Hölderlin zu sprechen, nicht die Zeit, da man „unsterblich“ ist, weil man vom Tod nichts weiss? Durch die Jahre reisen Mayröckers neue Gedichte, sortieren die Freuden und alles das, was Makulatur eines Lebens bleiben wird. „Scardanelli“ ist eine ergreifende Bilanz, die das Ende mit trotzigen Diminutiven verhöhnt, es „Tyrannchen“ nennt, und doch vor Epitaphen nicht mehr zurückschreckt. „Mein Leben war zu kurz für meinen Lebenstraum“, steht in einem der letzten Gedichte. „Leg mir nur 1 Blume auf das frische Grab nicht / Kranz nicht Tannenhändchen Palmenhaupt“, heisst es da. „Besuch mich / nicht an meinem Grab es hilft mir nicht ich bin schon / tot.“
Das Seufzen der Dichter umspannt die Jahrhunderte. „Ach! Das Leben ist kurz, sehr kurz. Wir leben nur Augenblicke und sehn den Tod umher“, schreibt Hölderlin in einer Vorstufe des „Hyperion“, aber in dieser Formel vergänglicher Schönheit ist nicht nur Bedauern. Die Ekstasen der Freude sind niemals lang, es sind Momente, in denen sich der Aether schützend über Menschen wie diese zu wölben scheint: Beide, Hölderlin und Mayröcker, sind Ekstatiker des Lebens und damit auch des Todes. Dass ihr Werk ästhetisch ins Offene strebt, aber ähnlichen philosophischen Überzeugungen verpflichtet ist, macht „Scardanelli“ zum grossen poetischen Abenteuer.
Wandellose Schönheit
Wenn Hölderlin die „wandellose Schönheit“ der Natur besingt, dann ist das ein Programm, das Mayröckers Lyrik mit triumphaler Leichtigkeit in die Gegenwart hinüberrettet. In der Natur, „dieser Welt die ich so sehr geliebt mit ihren Blüthen / Büschen Bäumen Monden mit ihren wunderbaren nächtlichen Geschöpfen“, wird der Mensch eins mit sich, weil er Teil des Ganzen ist. So wie Hölderlin mit dem Bild der Natur die „seelige Selbstvergessenheit“ feiert, betreibt Friederike Mayröcker ihre emphatischen Aufschreibungen. In den Gedichten wird die Welt sich wiederholender Verwandlungen erlebbar. Die Stimme von Maria Callas und die Musik von John Dowland gehören nicht weniger zu diesem Inventar als „Primel Himmelschlüssel Krokus“ oder „die Wimper / 1 reiner Brunnen pochend 1 Regengusz die Thränen die lachrymae“.
Mit „Hölderlinturm, am Neckar, im Mai“ beginnt der Gedichtband. Es sind Verse, die schon im Jahr 1989 entstanden sind, bei einer Reise nach Tübingen. In der Stube des Dichters nur eine Vase mit Blumen, „zwei alte Stühle – / ich öffne ein Fenster / im Garten sagst du die Bäume / sind noch die gleichen wie damals“. Wie weit ist es zu Hölderlin, der Friederike Mayröcker ganz nah ist? Ist es die Wegstrecke zwischen Schweigen und Schreiben, zwischen Leben und Tod? „Ich möchte / leben Hand in Hand mit Scardanelli.“
Paul Jandl, Neue Zürcher Zeitung, 26.5.2009
Der Wahnsinn, kirschenessend
− Alles, nur nicht glatt gedichtet: Mayröckers Hölderlin-Zyklus. −
„Besuch mich nicht an meinem Grab es hilft mir nicht ich bin schon tot.“ Zwei Mal bin ich der Mayröcker begegnet. Das erste Mal in Bad Ischl, nicht lange nachdem Ernst Jandl, ihr geliebter Partner, gestorben war, der auch in dem Band Scardanelli Spuren der Sehnsucht und Trauer hinterlassen hat: „Fröhlich waren wir eine stille Fröhlichkeit ach ahnungslos war ich.“ Und Jahre später im Wiener Café Tirolerhof. Beide Male hätte ich mir gewünscht, sie kennenzulernen; und beide Male war ich froh, sie nicht behelligt zu haben. So blieb das intime Sprachbild der mir fremden Dichterin unangetastet.
Mayröckers dunkle Haare und Stirnfransen, aus denen auf so vielen Fotos Mayröckers käferdunkle, seendunkle Augen hervorblicken: Dazu passen die „Blüthen“, die aus dem Hölderlindeutsch in ihren neuen Gedichtband eingeweht sind. Das Buch ist voller Blumen und Gewächse, „Fuchsien Weiden Pinien und Reseden lauschend im Garten (ich) Krokus und Haferkorn auch“. Ja, es ist bei der Mayröcker ein zauberisch umschlossenes „ich“, voller Andränge, Tränen, hymnischer Verkleinerungsformen, die immer nur eines wollen: die Welt reinen Herzens zu lieben, trotz allem „usw.“. Es ist kein Ich, das sich gegen die Welt setzt, obwohl es sich niemals ins Welteinverständige hinein- und das Leben glatt dichtet.
So wie Mayröckers Gräser hätten Walt Whitmans Grass Leaves sein sollen, denke ich, Scardanelli lesend. Denn nicht der Lebensjasager und Naturenthusiast öffnet uns zur wahren Poesie hin, sondern das reine Herz. Aber dieses ist, im dunklen Tal, zwischen den Widrigkeiten, Banalitäten und Schrecken des Alltags, in der Globusmaschine des alternden Gehirns, einzig als verstricktes vorfindbar. Es ist nie ganz. Blut sickert aus der Lunge. Der Wahnsinn lauert, „kirschenessend in tiefer Nacht“.
Glänzt mit Formuliermarotten
Ich habe diese Spannung, die Mayröckers Poesie durchzieht, lange Zeit nicht recht verstanden. Mir gingen die Ticks auf die Nerven, die orthografischen und grammatischen und alle anderen auch. Sie schreibt „1“ statt „einer / eine / eines“, aber nicht immer. Sie schreibt immer „sz“ statt „ß“. Sie demonstriert Eile oder Überdruss, indem sie an das Ende einer Zeile ein „usw.“ setzt. Beistriche findet der Leser bloß ausnahmsweise, noch ein Relikt aus der Zeit der alten Avantgarde.
So rackert sie sich ab, und zwischen ihrem höchsteigenen Gestrüpp aus Ticks und Formuliermarotten glänzt sie umso reicher, „voll der Gnaden“, sie liebt solche Bilder, wenn sie sehr, sehr kindlich klingen. Dabei schützt sie ihre Unschuld, indem sie sich verkompliziert, gegensinnig Worthäufchen aufschichtet:
haben 1 Quartett von Penderecki gehört (,flow my tears‘ John Dowland wenn aus den Schnäbeln und Wolken hellere Welle sich herabgegossen, Höld., auf der Fuszmatte vor der Wohnungstür 1 gelbe vergessene Blume.
Wo ist die zweite Klammer geblieben? Und Hölderlin im Wahnsinn, der mit Scardanelli unterzeichnete – er wird wie Massenware abgekürzt; und doch ist er der Same, aus dem das Ganze, der Zyklus der 52 Gedichte, emporwächst.
Nein, ich werde die Mayröcker nicht besuchen. Ich werde ihr als Leser begegnen, ab und zu in einem wundersamen Zeilendickicht, in dem sie sich unsterblich verheddert und blüht.
Peter Strasser, Die Presse, 9.5.2009
Traumwald deutscher Griechen
− In dem schmalen Gedichtband Scardanelli ruft Friederike Mayröcker Hölderlin zum Zeugen des Alterns auf. −
Friederike Mayröckers (84) dichterisches Werk wuchert seit gut fünf Jahrzehnten allseitig aus: Die Flügel der Ausdruckskraft weithin ausspannend, verwebt die Wienerin alogische Traumnotate zu berückenden Bilderfolgen. Über viele Schaffensjahre hinweg waren Mayröckers Gedichte Gelegenheitsprodukte im besten Sinn des Wortes. Das Ingenium der Autorin schien auf Epiphanien angewiesen. Ihre spinnwebfeinen Texte waren Sammlungen von Sprachoffenbarungen: Sanfte „Verrückungen“ des Alltagssinns schufen semantische Bedeutungshöfe von blendender Strahlkraft und hoher Suggestivität.
Oft gerieten Mayröckers Poeme über dem Gleißen ihrer wie unvermittelt aneinandergereihten Wortbrocken in ein somnambules Traumtanzen. Kindheitslandschaften bergen bis zum heutigen Tag das zitierbare Material, das Mayröcker zu immer neuen fragilen Gebilden zusammenschließt.
Mayröckers poetisches Prinzip ist daher ein waghalsiger Chemismus: Die Flüchtigkeit des Augenblicks wird von dem sich behutsam vorantastenden Gedicht im berühmten mehrfachen Wortsinn aufgehoben. Neben der „Narzisse“ kommt dann zum Beispiel die „Nachtigall“ zu stehen, weil in Mayröckers Naturkosmos Verwandtschaftsverhältnisse am ehesten auf Assonanzen und Lautähnlichkeiten gründen – nicht etwa auf zugrunde gelegten Eigenschaften.
Und doch besitzt der neue, schmale Gedichtband „Scardanelli“ ein Verstörungspotenzial, das man nicht bloß der „Autonomie“ sprachlichen Handelns zuschreiben kann. Natürlich steht Mayröcker zur „Wiener Gruppe“ in einem lockeren Verwandtschaftsverhältnis, vielleicht als betörende Kusine: Sie hat die Verfahrensweisen der experimentellen Literatur auf völlig eigenständige Weise aufgesaugt und das Erbe der europäischen Moderne absorbiert.
„Scardanelli“ aber will von allen diesen Reizen nichts mehr wissen: In Mayröckers Lebensmitschrift greift ein neuer, wehmütiger Ton, der den Skandal des Todes – und die mit der Bürde des hohen Alters einhergehenden Verlustanzeigen – so zusammenfasst, dass ein Versagen des Pneumas immerzu hörbar bleibt.
„Pneuma“ – der feurige Lufthauch – rührt an das innerste Geheimnis der Dichtung: Nur wer Silben und Strophen beseelt zu sprechen vermag, versteht es auch, in weiten, prosodischen Bögen zu dichten. Mayröcker, durch den Tod ihres Lebensmenschen und Dichterkollegen Ernst Jandl zuinnerst betroffen, hat sich in ihrem neuen Band einen kollabierten Dichter zum Ansprechpartner erwählt. Friedrich Hölderlin, der vielleicht rätselhafteste aller Lyriker, saß als verwirrter Schlackengreis in einem Tübinger Turm fest, um nur noch sporadisch seltsam artige, sprachgebändigte Gedichte für den bereitgestellten Wäschekorb zu produzieren.
Hölderlin (1770–1843) ist das dichterische Opfer des deutschen Idealismus par excellence. Er trägt das Kreuz des (an sich selbst) scheiternden Dichters, und er gilt zugleich als Zeuge einer unmöglich gewordenen Verbindung mit der als entzaubert erlebten Welt. Hinter seinem rätselhaften Bündnis mit den alten Göttern Griechenlands lauern bereits die Vorboten einer schon damals unlebbar gewordenen Welt: Es ist die heraufziehende Industriegesellschaft, die alte Harmonievorstellungen durch schnöde Zweck-Mittel-Relationen ersetzt.
Mayröcker sucht in 40 Gedichten, die unablässig auf einem schmalen Bildervorrat beharren, die Begegnung mit dem Moment der Verzauberung. „Scardanelli“ – so pflegte Hölderlin seine späten Früchte voller „Unterthänigkeit“ zu unterzeichnen – soll den poetischen Proviant herausrücken, mit dem wir uns in kalten Zeiten bevorraten: „… entgegen kam uns 1 schöner / Wanderer mit Alpenhut und einer Blume in seiner / Hand…“, heißt es einmal. Hölderlins „Schaafe“ (sic!) sind es, die eine Einübung in die Haltung der Duldsamkeit ermöglichen: Denn skandalös sind Tod, Siechtum und die altersbedingte Einschränkung der Wahrnehmung.
Mayröcker inszeniert die Begegnung mit Scardanelli, der letzten Verlarvung Hölderlins, als Gipfelkonferenz mit einem Wahl-, einem Lebensabschnittsverwandten. Es fällt nicht schwer, in der Wachrufung eines fernen Dichters die zärtliche Bezugnahme auf Jandl – er starb 2000 – mitzuhören.
Der stille Schrecken von Mayröckers gewohnt bezirzenden Landschaftsbeschwörungen liegt daher auch in der realen Abwesenheit aller derjenigen, die ihre poetische Arbeit kollegial bezeugen könnten. Am Schluss bleibt der Dichter, bleibt die Dichterin unrettbar verloren: „weiszt du noch, sage ich zu mir am Morgen jeden Morgen an welchem / ich vor Seligkeit und Angst die Tränen vergiesze, weiszt du noch, / die Bilder in meinem Kopf rasen wir irrwitzige“ – hier bricht der Vers ab, hier stürzt die Poesie ins Ungewisse hinunter. Besser vermag Scheitern nicht zu gelingen.
Ronald Pohl, Der Standart, 18./19.4.2009
Ein anderes Geländer haben wir nicht
− Mein Leben im Robinienflor: Friederike Mayröcker schaut vom Hölderlinturm in den Neckar, verbündet sich mit allerhand Dichtern und schafft den Sprung über ihren eigenen Schatten. −
„Mit Unterthänigkeit Scardanelli“ signierte Friedrich Hölderlin, seit 1806 psychisch krank, jene eigentümlichen Gedichte, die er gegen Ende seines Lebens im Wahnsinn verfasste. Dass unser Umgang mit der Dichtung sich oft unmerklich in einen Umgang mit den Dichtern verwandeln möchte, ist nicht so tadelnswert, wie eine strenge Fraktion der Literaturwissenschaft behauptet. „Scardanelli“ im Munde Friedrich Hölderlins und aus seiner Feder ist ein poetisches Produkt, eben das Wort, in welchem der Dichter sich selber überlebte. „Scardanelli“ als Titel des neusten Gedichtbändchens von Friederike Mayröcker ist nun vollends eine poetische Chiffre, die von dem darunter verborgenen und sich selber fremd gewordenen Friedrich Hölderlin abstrahiert und ihrer Stimme einen verfremdeten und doch ganz eigenen Klang gibt.
Dass auch der Name „Hölderlin“ eine poetische Aura besitzt, konstatiert sie beinahe ironisch im ersten Vers des Bändchens, der den Eindruck eines Besuchs in Tübingen wiedergibt: „eine Prise Hölderlin“. Jedesmal wenn der Name in den Gedichten auftaucht – sogar abgekürzt als „Höld.“, enthält er eben als poetische Chiffre eine „Prise Hölderlin“. „Scardanelli“ und „Hölderlin“ üben einen Zauber aus, haben die Kraft eines poetischen Klischees, ja Fetisch-Charakter.
Ein ganz kurzes Gedicht heißt zwar „mit Scardanelli“, aber es zeichnet mit kräftigen Strichen Friederike Mayröckers eigenes poetisches Grundthema seit dem Tod des „Freundes“ Ernst Jandl: „ich denke an die Nachmittage umschlungenen / Mitternächte, vor vielen Jahren diese Rosenkugeln die / Schaafe auf der dunklen Himmels Weide“. Dass hier in Bildern eine Liebe aufersteht, die der Tod zerbrochen und geheiligt hat, ist für das lyrische Ich als Erlebnis dargestellt, für Leserinnen und Leser spontan verständlich. Doch spricht dieses Ich nicht nur aus eigener Inspiration, sondern lässt Gelesenes einfließen und signalisiert es bei der Niederschrift sogar durch Kursivdruck und die altertümliche Rechtschreibung „Schaafe“. Das Ich (und die Autorin) schreibt also nicht allein, sondern „mit Scardanelli“, obwohl das Gedicht, aus dem diese „Schaafe“ grüßen, ganz am Anfang von Friedrich Hölderlins langer Leidenszeit verfasst worden ist, als er sich noch gar nicht Scardanelli nannte:
Da, auf den Wiesen auch
Verweilen diese Schaafe.
Die poetischen Fragmente, die Friederike Mayröcker aus Hölderlin-Scardanelli heraushebt, gehorchen demselben Prinzip: Es sind Chiffren für eine hölderlinische Poetizität im Dienste ihrer eigenen, oder umgekehrt: Das lyrische Ich lässt sich von Hölderlin-Scardanelli die Feder führen. Jenes Gedicht, das mit „eine Prise Hölderlin“ beginnt, datiert am 6.6.89 nach einem Besuch im „Hölderlinturm, am Neckar, im Mai“, funktioniert wie ein Prolog der kleinen Sammlung und endet mit einem Zitat aus Hölderlins Gedicht „Der Neckar“:
es
glänzt die bläuliche Silberwelle
Mit diesen Worten schlüpft die Besucherin sozusagen in den Blick des Dichters (obwohl er noch lange nicht in dieses Turmzimmer verbannt war, als er so den Neckar bedichtete).
Dem Prolog folgt ein poetisches Tagebuch von neununddreißig genau datierten Gedichten, die (bis auf das zweite) alle von Januar bis September 2008 entstanden sind. Sie enthalten zwar immer wieder solche Bruchstücke, aber selten bringen sie deren eigene poetische Aussage mit wie dort im Prolog. Im Gegenteil scheint sich die Dichterin zu bemühen, die zitierten Fragmente noch weiter zu fragmentieren. Am Anfang des Gedichts vom 31.5. steht wie Kauderwelsch:
die mir geblieben sind die blühend holden Gestirne zu oft mich dessen’ Höld.
Das befremdliche „dessen“ gehörte bei Hölderlin zu dem hier unterdrückten Verb „mahnen“, und die Stelle hieß in „Mein Eigentum“ (1799):
… doch wie Rosen, vergänglich war
Das fromme Leben, ach! und es mahnen noch,
Die blühend mir geblieben sind, die
Holden Gestirne zu oft mich dessen.
Die brüchige Syntax irritiert zwar, aber sie überlässt auch das gesamte poetische Feld den Bildern. Dieses lyrische Ich will nicht aussagen, sondern evozieren.
Die dichterische Phantasie greift auch zu anderen Gewährsleuten: Durs Grünbein, John Updike, Elke Erb. Andere bleiben anonym; wenn man sucht, findet man manchmal die Quelle, wie bei dem „viel war mir teuer“ vom 1.5. und auch schon, versteckter, am 5.4. Es erinnert an den unglücklichen jüdischen Wiener Dichter Theodor Kramer, der, nach langem Londoner Exil nach Wien zurückgekehrt, 1958 starb und der in Lenauscher Manier gedichtet hatte:
Nichts bleibt – und viel war mir teuer –
nichts, nun die Zeit mir verrinnt,
nichts als das sinkende Feuer
und in den Bäumen der Wind.
Hier kann man im Vergleich spontan erkennen, wo Friederike Mayröckers dichterische Potenz steckt. Wenn sie an das Vergangene denkt, bleibt ihr nicht „nichts“ wie dem traurigen Theodor Kramer, dessen Klage sie doch so gut nachfühlen kann, sondern eine mit großer Anstrengung zur Sprache gebrachte lebendige Erinnerung.
Das Wunder der Dichtung ist bei Friederike Mayröcker eine extreme Form von Sublimierung, ja Absolutsetzung des Lebens, bei der es der Dichterin selber und auch den Leserinnen und Lesern zu schwindeln beginnt. Es gibt darum wohl immer wieder Momente in den Gedichten, wo der Zauber unterbrochen scheint und eine persönliche Stimme ironisch oder ernüchtert zu sagen versucht: Ich geb’s auf! Am 29.5. fällt ein emphatischer Aufschwung abrupt in einen Alltag zurück mit „endlich die 1. Kirschen im Körbchen“, und in einem Epitaph auf sich selbst heißt es ganz und gar ungeschützt:
Ich bin so traurig jetzt und habe Angst vor dem
Verlassen dieser Welt…
Diese Realität wird nicht mystifiziert, aber sie macht um so deutlicher, dass die Poesie ein Lebenselixier ist:
Wir halten uns an die Schrift weil 1 anderes Geländer haben wir nicht, Thomas Kling.
Dass es wirklich Schrift ist, macht Friederike Mayröcker seit jeher mit kleinen manieristischen Zeichen deutlich, mit ihrem „sz“, mit ihren Ziffern für den unbestimmten Artikel, aber auch mit ihren Verszeilen, die jetzt oft die Tatsache unterstreichen, dass diese Sprache gedruckt ist. In der dünnen Luft der geglückten Evokation sucht die Dichterin wie aus Furcht vor dem Absturz nach einer Rückbindung. Darum datiert sie ihre Gedichte so penibel genau im Ablauf der Tage, manchmal sogar bis auf die Stunde genau, zum Beispiel am 4. März 2008, „5 Uhr früh“; darum wohl widmet sie die meisten Gedichte lebenden Personen und verankert sie so in der anderen, der nichtpoetischen Wirklichkeit.
Das Niemandsland zwischen Dichter und Gedicht hat Friederike Mayröcker ihren Lesern zur Erkundung freigegeben. Obwohl sie sich dabei stilistisch und thematisch treu geblieben ist, hat sie sich „mit Scardanelli“ weit überboten.
Hans-Herbert Räkel, Süddeutsche Zeitung, 13.10.2009
Weiterer Beitrag zu diesem Buch:
Nico Bleutge: Honigreiche Vogelstimmen
Stuttgarter Zeitung, 19.6.2009
Laudatio für Friederike Mayröcker
– Zum Hermann Lenz Preis 2009. –
Bevor ich Stunde um Stunde las, da in der Nacht im letzten Sommer, im Zimmerchen vom Ischl-Wirt, immer von vom und neu und anders begeistert, bis es dämmerte, bis es hell wurde hinter dem Gebirg, waren wir drei, du mit der Edith und mir, durchs Abendstädtchen in der versunkenen Zeit herumgestrichen, hatten die Alten mit den Jungen vor den Haustüren sitzen sehn, hatten im Dreiton „Oh wie wohl ist mir am Abend“ gesungen und einander an den Händen gehalten. Du warst müde und zart, die Zeit stand uns offen, es zog, der Mond über der Traun hinter der Burg auf dem Berg war ein Muezzin, der seine Eulen rief. „Gebt Obacht“, sagtest du, während Edith und ich am Ufer unsere Nachtwürste aßen, „die Traun ist ein wildes Wasser, sie strömt und strudelt, reißt.“ – „du mein Blutkörperchen du mein armes wildes Blutkörperchen daß die Strömung daß die riesigen Blutmassen der wegströmenden Seele: so reißend: so hinreißend sind“, schreibst du im Requiem für Ernst Jandl.
Das einmal, das immer wieder einmal und nur jetzt und nur hier und nur von ihr und dir und mir Wahrgenommene, das Gedicht, es erhebt seinen Anspruch als Ort. Dort, in ihrer, deiner oder meiner allereigensten Enge setzt uns der Strudel frei in ihren, deinen oder meinen Kreis, in dem wir freiwillig drehn, um uns selbst zu begegnen im „befremdeten Ich“, im Entwurf unserer selbst.
Geheime Worte schreiben sich herbei. Der Vers flammt auf: denn „es geht um das Leben“, schreibst du, „es geht um das Schreiben als Leben, es geht um die Schreibexistenz, […] die Seele auf dem Papier“. Es geht „um die Frage der verstörten Wahrheit“, schreibst du, es geht darum, ihr auf der Spur zu bleiben, sie anders zu bestimmen als jene, die sie in Handlungsbau einfangen wollen. Es geht darum, sich selbst und die Wahrheit diesem Zweckmäßigkeitsverfahren – „Zweckmäßigkeitsverfahren“, schreibst du – zu entziehen, sie aus den Netzen der Selbsttäuschung herauszuretten und an Land zu schiffen, d.h. in den Text, wo sie zwar immer noch gefährdet, aber aufgehoben ist, die Wahrheit, aufgehoben im Zweifel und Selbstzweifel, rings umgeben von diesem „gefährlich schreiende[n] Zustand“, schreibst du, gefährlich schreienden Zustand der äußeren Welt.
Es gibt wohl Schulen, Traditionen, die solchen Ausdruck lehren, die aber nicht bekannt sein müssen, um der Wahrheitsspur zu folgen, die du in deinen Texten legst, ihr zu folgen ins „Zentrum des Schreibens und Schreiens“, schreibst du. Im Zentrum des Schreibens und Schreiens aber steht dir E. J.
Ehjeh asher Ehjeh, „ich werde sein, der ich bin“, heißt es in der Zunz-Übersetzung der Bibel, und in der Luther-Übersetzung heißt es: „Ich werde sein, der ich sein werde.“ Ehjeh ist ein Gottesname. Ehjeh bedeutet von eh und je zugleich das Grenzenlose und das Nichts, das Nichts und die Unendlichkeit als eins von eh und je.
Als du vor vier Jahren am Berliner Ensemble zum ersten Mal aus Und ich schüttelte einen Liebling gelesen hast, hast du dort, wo die Initialen E. J. stehen, Ehjeh gelesen. Und als ich dich fragte, wußtest du wohl, daß du statt E. J. Ehjeh gelesen hattest, aber du wußtest nicht, was uns Ehjeh heißt, und was Ehjeh dir heißt, wer weiß das schon.
Edith machte Fotos von der Traun. Die Traun war schwarz. Du wolltest heim. Wir streichelten uns wie junge Mädchen. Dann zogst du dich zurück und gabst mir ein Bündel Gedichte mit auf den Weg in die Nacht, ein Bündel, was Scardanelli heißen sollte.
In der zweiten Lebenshälfte, die er im Tübinger Turm verbringt, bestreitet Hölderlin seinen bürgerlichen Namen. „Ich, mein Herr, bin nicht mehr von demselben Namen“, bescheidet er den Besucher Wilhelm Waiblinger und nennt sich statt dessen Killalusimeno, Buonarotti und Scardanelli.
Es existiert da eine linguistische Theorie, der zufolge in dem Namen Scardanelli die Buchstaben des Namens Hölderlin enthalten seien, letzterer also eine Permutation darstelle. Das Spielbild paßt aber nicht in seinen einfachen schweren Rahmen, worin jedoch das Örtchen Scardanal, oberhalb der Rheinschlucht gelegen, wie von der Natur seinen Platz zu haben scheint. Scardanal, zu Hölderlins Lebenszeit ein Hundertseelenfleck vielleicht, gerade dort, wo der Rhein im Quellgebiet die Richtung ändert, wo er von der Südrichtung in die Nordrichtung überfließt, wo er umschlägt, umbricht, plötzlich, wie die Handlung des klassischen Dramas, seine Peripetie. Der Fluß, der auf seinem Weg gen Süden an den Felswänden der Rheinschlucht entlangtobt, sammelt bei Scardanal seine Wasser und läßt sie dort auch wieder los als breiten Strom gen Norden.
In seinem Buch Hölderlin als Hirnforscher schreibt der Neurophysiologe Detlef B. Linke:
Hölderlins Identität läßt sich mit Hilfe seiner Rhythmustheorie darstellen. […] Er [Hölderlin hat also] nicht beliebig mit seinem Namen permutiert, sondern, ganz der Theorie der Vorstellungsentstehung durch Rhythmenumbruch entsprechend, seine Identität an der Stelle des Zusammenpralls von Flußkraft und Felswand mit der nachfolgenden Umlenkung des Rhythmus markiert. […] Gemäß der Theorie der Peripathie Hölderlins entsteht an dieser Stelle [an der Stelle des Umbruchs, des Umschwenks], die entscheidende Vorstellung. […] Hölderlin als Scardanelli ist derjenige, der sich im Chaos des Umbruchs einzurichten versucht.
Und dann? Spricht er weder aus, noch verheimlicht er, gibt Winke, Zeichen, wie sie von alters her die Sprache der Götter sind – oder? Und um es nicht weiter der Zerstörung durch Wirklichkeit auszusetzen, diesem gefährlich schreienden Zustand, zieht sich sein Wesen auf sich selbst zurück – oder? Wie heißt es im Phaidros:
Es gibt zwei Arten von Wahnsinn, deren eine aus menschlichen Krankheiten entspringt, deren andere aus göttlicher Entfernung von den gewohnten Sitten.
Eine der wenigen Besucherinnen in der Tübinger Turm-Abgeschiedenheit war Bettine Brentano, und tief beeindruckt durch Hölderlins Scardanelli meinte sie, die Sprache bilde alles Denken, denn sie sei größer als der Menschengeist, der sei ein Sklave nur der Sprache, und solange die Sprache ihn nicht alleinig hervorriefe, sei der Geist im Menschen noch nicht vollkommen. Die Gesetze des Geistes aber seien metrisch, das fühle sich in der Sprache, und nur der Geist sei Poesie, der das Geheimnis eines ihm eingeborenen Rhythmus in sich trage, und nur mit diesem Rhythmus könne er lebendig und sichtbar werden, denn dieser sei seine Seele.
Es gibt Spuren, deutliche Hölderlin-Hinterlassenschaften im Scardanelli-Zyklus. Die Trennung, der Abschied sind Thema wie von je. Aber Trennung und Abschied sind ohne ihr Gegenteil nicht denkbar, sie sind nur die Hälfte des Lebens. Die andere Hälfte ist dem irdischen Glück verschrieben, das nur die Zweisamkeit und das Schreiben, nur das Schreiben in Zweisamkeit kennt:
ich möchte
leben Hand in Hand mit Scardanelli
Lebensglückfetzen treiben durch die Gedichte dort und prallen auf Tod- und Vergänglichkeitstrümmer. Eine sanfte Annäherung gibt es nicht. Die Zäsur bleibt, und wie bei Hölderlin bleibt sie ungemildert:
Ich bin so traurig jetzt und habe Angst vor dem
Verlassen dieser Welt die ich so sehr geliebt mit ihren Blüthen
Büschen Bäumen Monden mit ihren wunderbaren nächtlichen
Geschöpfen. Mein Leben war zu kurz für meinen Lebenstraum
Die Zäsur gilt als kühnstes Moment der Tragödie, als „die Art, wie in der Mitte sich die Zeit wendet“, heißt es in Hölderlins Anmerkungen zu Antigonae.
Darum. Und auch weil du, Friederike, für S. U. deinen Magischen Blättern eingeschrieben hast:
Im Rückblick auf die vergangenen zwölf Jahre als Autorin in Ihrem Verlag verbinden sich in mir Gefühle großer Beglückung mit solchen eines großen Dankes an Sie in der Hoffnung, es möge alles noch lange dauern, das Schreiben und das Publizieren, das Leben, das Ihre und das meine.
Und auch weil sich mir im Rückblick auf die vergangenen sechs Jahre Gefühle großer Beglückung mit solchen eines großen Dankes an dich in der Hoffnung verbinden, es möge alles noch lange dauern, das Schreiben, das Leben, das deine.
Weil also hier die Liebe waltet, und die Zäsur wie die Hirnforscher-Peripetie nach der Lobrede Regel verlangen, hier bitteschön:
Liebste Hanne Lenz, edler Spender, weise Jury, verehrtes Publikum.
Die beste Laudatio auf Friederike Mayröcker wäre eine, die das Licht der Aufmerksamkeit auf den Spiegel der Verse richtet und uns so erlaubt, uns vorzustellen, wie sich das anfühlen könnte, wenn man Friederike Mayröcker wäre. Diese Verse, die Erfahrungen und Ideen zu Bildern machen, und diese Erfahrungen und Ideen dann auf eine Weise feiern, die nichts mit Party und alles mit zugleich ernster wie spielerischer Festlichkeit zu tun hat, sind auch eine Feier der Autorin selbst, nach dem Gesetz, das Karl Kraus meinte, als er sagte, Selbstbespiegelung sei erlaubt, wenn das Selbst schön sei, werde aber zur Pflicht, wenn der Spiegel gut sei. Wir lesen also, um nicht zu vergessen, daß ein Fest auch etwas Schmerzliches sein kann, nämlich der Durchbruch des Ewiglichen ins davon nicht nur geheiligte, sondern auch verletzte Diesseits. Verse, wie diese von 1985:
eine Erlösung, eine Offenbarung jetzt diese
Stimme wieder zu hören Vogelstimme jetzt dieses
Gezwitscher etwas wie Paradies blühten
auf ich vergösse die
Tränen
Das letzte Wort, Tränen, ist eine ganze Zeile, es steht allein, weil Schmerz, auch ein menschheitlicher, immer heißt: Man steht allein. Aber das Alleinstehen dieses Verses sieht man erst, weil da noch ein Gedicht steht. Nur wer Gemeinschaft kennt, nur wer Liebe kennt, kennt Einsamkeit. Das ist kein Widerspruch. Das führt zwei Seiten einer Sache, die niemals Sache wird, immer im Prozeß bleibt, in der Erkenntnis der Schönheit des Flüchtigen zusammen, von dem wir auch nur wissen, daß es flüchtig ist, weil wir in uns etwas haben, das nicht flüchtig ist.
Damit dieses Wunder gelingen kann, muß das Gedicht die Stelle des Ewigen annehmen, so daß wir, die wir die Stelle des Flüchtigen einnehmen, an das in uns lebendige Ewige erinnert werden, bis wir das Gedicht weglegen, weil es sich beim Lesen mit unserer eigenen Flüchtigkeit aufgesogen hat, weil es eine Erfahrung geworden ist, seinen Ideenkern an uns abgegeben hat. Wir sind nicht gut, die Gedichte sind es, das macht uns besser. Was uns die Dichterin, wie die Schulaufgabensprache es nennt, „damit sagen“ will, ist längst nicht so wichtig für die Wahrheit der Dichtung wie das, was wir darauf antworten können. Je nachdem, in welcher Verfassung uns das Gedicht, die aufgeschriebene Vogelstimme, die versifizierte Hoffnung, Enttäuschung, der metrisch formalisierte Verlust, das melodische Geschenk antreffen, müssen wir eine andere Art Arbeit auf uns nehmen, um in die Wechselbeziehung mit der Sprache eintreten zu können, die das Wesen des Gedichts ist. Sind wir gelangweilt, verwirrt, sind wir, was bei Menschen ja vorkommt, einfach böse, wenn wir lesen, was in der Brust zieht oder die Haut kühlt, führt das dazu, daß man, wenn im Radio das falsche Lied läuft, sich selbst zwischen die Rippen fassen will und festhalten, was da drin durcheinanderkommt und sich entzündet hat. Je nach dem Flüchtigen also schaffen wir das Innehalten mal besser, mal schlechter – wir wollen dazu nicht nur angehalten, ermahnt, erzogen werden, sondern auch verführt, und Friederike Mayröcker tut das, verführt uns:
Zehr ich dich nicht auf?
trink ich dich nicht aus?
Brünnlein liebes
– nur für den harmlosesten Verstand spricht hier die Dichterin; passiert etwas viel Unheimlicheres, das Gedicht spricht, es wundert sich über seine eigene Stärke: „von wo wirst du gespeist? / woher nimmst du die Kraft / deines Strahls?“, es weiß, daß es nicht naturgeboren ist, sondern Produkt der Zivilisation, Station einer langen Lerngeschichte des Menschengeschlechts, urban und pastoral zugleich: „über die halbe Stadt / saug ich dich an / wie einen Mund“, und dann, wenn es all dies gezeigt hat, vergißt es alles wieder, wirft es von sich, läßt Wissen einfach Wissen sein und spürt, sieht und ahnt nur noch: „und du bist da: / Tropfen an meinem Fenster / Wange voll Wärme und Wind“, ein Gedanke, aus dem wieder wird, was der Geist am Anfang der Welterklärung, in der frühesten Theologie. immer war: Ein Anhauch.
Den möchte man sich merken können, für die Zeiten, in denen man gelangweilt ist, verwirrt oder böse, weil man von Gedichten doch mitbekommen zu haben meint, daß sie sich auswendig lernen lassen. Aber es geht nicht; es gibt Gedichte, die nur inwendig zu lernen sind – oder wer möchte sich vorstellen, daß das leiernd, automatisch, abgesichert über die Lippen zu bringen ist, was Friederike Mayröcker seit ihrem großen Verlust darüber geschrieben hat:
entwurzelt bin ich
schrecklich gottverloren, die Wolke mit
Rosenmund, eisklumpenförmig mein Herz was
um Himmelswillen ist mir geschehen
einsam
die Wedel der Palme die ich mir wünsche auf
meinem Grab usw.
Das „usw.“ ist lapidar, lakonisch, wahr – und weist die Philister vor die Tür, die von Kunst, in der es um Tod und Verlust geht, eine Bestätigung der Spießerlehre erhoffen, Leiden sei etwas besonders Edles; Schwermut, Zweifel seien an sich kunstnäher als Freude, Glück, Hoffnung. Eine Horrorphantasie, an der nur stimmt, daß Sehnsucht und Kummer und Unerfülltes zwar Quelle von Kunst sein können, an der aber Lüge ist, daß verschwiegen wird, welche anderen Quellen Kunst hat. Glückliche Menschen machen auch schöne Sachen, vielleicht sogar die schönsten; und das Traurige wirkt nur, wenn es von Leuten besungen wird, die sein Gegenteil kennen. Dichtung, wie Friederike Mayröcker sie ihr ganzes Dichterinnenleben hindurch geschaffen und gelebt hat, steigert, überhöht, verbessert, durchdringt das sonstige Menschsein, sie ersetzt es aber nicht. Kunst als Ausgleichshandlung, das verbitten sich Verse wie diese, die doch dem Verlust so nahe sind, ihn so direkt aussprechen: „würde alles tun für dich wenn / du nur lebtest! / als erstes würden wir zur Albertina, / ins Museumscafé dann zum FELDHASEN, 1 Blick / in dein Auge würde mir sagen ob du müde / bist der ob es noch weitergeht. Weinen / würden wir trotzdem oft, weil / der Abschied noch vor uns läge –“ Dichtung, Kunst als Steigerung, als Fest der sonstigen Erfahrung, das heißt nicht, daß Zäsuren, Pausen, Nichtleben im Sinne von Kontemplation, auch Einsamkeit, nicht notwendig sind. Stumpfsinn, der immer zur Remmidemmi will und nie still weinen und leiden, ist fast noch schlimmer als asketischer Stumpfsinn. Denken und Träumen ist das, was passiert, wenn man nicht handeln kann oder will. Ich kann grade nicht, will nicht. Aber das ist die lebendige Schönheit, die Anlaß all meiner Handlungen wäre, wenn ich welche unternehmen könnte, die lebendige Schönheit, die ich niemals aufgeben werde. Auch nach der sehr eindeutigen und endgültigen Trennung, von der jene Verse handeln, ist klar, wie Sprache etwas nur klarmachen kann: Nicht Versemachen aus dem Bild der Schönheit, das langsam blasser wird, sondern: Bereitbleiben für den Kuß, für die Berührung, für das Gelebte, die Umarmung.
Selbstbespiegelung, können wir den Satz von Karl Kraus ergänzen, ist auch dann noch zwingend für das Schöne selbst und den guten Spiegel, wenn der Spiegel vor Schärfe schier zerbrechen will. Die Spannung, unter der so ein Spiegel dann steht, ist die Sehnsucht der Lesenden, die Welt möge wirklich so tief sein, wie sie uns bei Friederike Mayröcker erscheint.
Glaub es nur, sagen ihre Gedichte. Sie ist so tief.
Ulla Berkéwicz, manuskripte, Heft 185, Oktober 2009
gegen die Decke des Zeltes dürstend
− Rede anläßlich der Verleihung des Friedrich-Hölderlin-Preises, Bad Homburg v.d.H, 7. Juni 1993. −
meine Damen und Herren, hochverehrtes Auditorium, liebe Freunde −
glaub es, Theuerster! ich hatte gerungen bis zur tödlichen Ermattung, um das höhere Leben in Glauben und im Schauen vest zu halten, ja! ich hatte unter Leiden gerungen, die nach allem zu schließen, überwältigender sind als alles andre, was der Mensch mit eherner Kraft auszuhalten imstande ist.
(Hölderlin an seinen Halbbruder Karl Gok, 2. Märzhälfte 1801, Hauptwil)
Sekundenschlaf, Schleppen von Träumen : Andrang von Bildern : Wort Tang im Schwemmland des Traumes, nicht nachvollziehbar wenn nicht augenblicklich festgehalten, hinweggetragen vom leichten Wind als zartes flimmerndes Sommergewölk am Meer, sanfte Verfärbungen über dem Wasser am Horizont : Luftspiegelungen von Landschaft, wundersame Gebilde Tag oder Nacht (Köpfe oder Stürze der Tränen und Träume), wogende Kontinente. Durch ein Vorüberstreifen : durch solches Luftgestöber : der kleine Kamm fällt von der Kante des Wandschranks, so war ich ein Überdruß, so war ich ein Ärgernis für meine Menschenumgebung, Magnolienfalle, so nämlich wie ich umgehe mit den Zufälligkeiten des Lebens, sage ich, könnte man den Schluß ziehen, die Zufälle : die Enigmas des Schreibens geschähen mir in ebenderselben Weise, ich finde im Zufall, im Random Erlebnis ein graues Jäckchen mit grüner Borte zum Beispiel, vor drei Jahrzehnten gefertigt : Mutters Handarbeitskünste, etc., enorme Kleider.
Und ich, gegen die Decke des Zeltes dürstend, mit Blicken dürstend als ob da eine Botschaft, ebenso an den Wänden, und mit zurückgeklapptem Kopf als würde sich da eine Schrift nämlich etwas mir Ablesbares : etwas für mich zu Schreibendes, Abzuschreibendes, etwas mir Einzusagendes, Eingesagtes, Eingeflüstertes : also ein Zeichen an Wand und Decke zeigen – Fußpunkt der Phantasie.
Hölderlin eben : der war seit Jugendtagen die leuchtende Schrift an der Wand am Himmel im Buch, und abermals diese weiblichen silbernen Schnüre : KANÜLEN im Wachen im Schlafen – tatsächlich scheint es etwas wie Parallelität, nein ein System kommunizierender Gefäße zwischen seinen, Hölderlins, Schreibbildern und meinen eigenen zu geben, dies sei in aller Bescheidenheit vorgebracht.
Nicht von ungefähr wähle ich das Bild der kommunizierenden Gefäße, bindet es mich doch gleichzeitig an jene Schreibtradition der ich mich ähnlich verpflichtet fühle wie jener Hölderlins, der nämlich des Surrealismus.
Eine Prise Benn, eine Prise Brecht, eine Prise St. John Perse, Salvador Dalis geheimnisvolle Lebensberichte, Jean Paul, Freud, Francis Ponge, viel Breton, Michaux, Duras, einiges von Roland Barthes, Jacques Derrida, Botho Strauß, und immer wieder, und abermals, Samuel Beckett, den unvergleichlichen Meister der Moderne. −
Für den 18. Mai 1989 lud mich Prof. Paul Hoffmann, der von mir hochverehrte, zu einer Lesung nach Tübingen in den Hölderlin Turm ein, an diesem für mich so beglückenden sommerlichen strahlenden Tag, die Studenten in weißen Kleidern so schien es mir, an das weiße Mäuerchen gelehnt, darunter der Neckar, wartend auf den Beginn meiner Lesung, überhaupt dieser weiße weißleuchtende Tag, die Äste der Weiden tief hängend ins Wasser flüchtige Schatten, der Turm, der Garten, die Stille. Ich fühlte mich glücklich da, geborgen, ich wollte wiederkommen. Damals, im Hölderlin Turm ich wußte es nicht ich ahnte es nicht, heute, vier Jahre danach, darf ich diesen mich ehrenden weil Hölderlins Angedenken geweihten Preis entgegennehmen, dafür bedanke ich mich bei der Stadt, bei den Damen und Herren der Jury, und, indem ich Pierre Bertaux zitiere: IM NAMEN HÖLDERLINS! −
Mancher von uns jetzt Lebenden mag wohl zuzeiten wünschen, sich in einen solchen HÖLDERUNTURM flüchten zu können, um für eine kurze Zeit geschont und verschont zu sein angesichts des Grauens der gegenwärtigen Weltereignisse, die wir, wenngleich nicht am eigenen Leib, so doch in anderer Weise erleiden.
Nach Pierre Bertaux, dem großen Hölderlin Forscher, war Hölderlin mit dem Einzug in den Turm an einem Punkt innerhalb seines Lebens und Schreibens angelangt, der mit dem Wunsch, sich von der Welt zurückzuziehen, zusammentrifft. Er, Hölderlin, habe erkannt, schreibt Pierre Bertaux, daß die Welt sein Schreiben nicht mehr verstehen konnte oder wollte, daß also die Kommunikations- und Vermittlungsbasis zum Verstandenwerden nicht mehr gegeben war.
Das Angenehme dieser Welt..
Das Angenehme dieser Welt hab ich genossen,
Die Jugendstunden sind, wie lang! wie lang! verflossen,
April und Mai und Julius sind ferne,
Ich bin nichts mehr, ich lebe nicht mehr gerne!
Nun, wie konnte es überhaupt zu diesem REFLEX EINER GEISTESVERWANDTSCHAFT kommen, in dieser unserer Zeit, vermutlich ist verantwortlich dafür etwas wie ein sympathetisches System von Gefühls- und Gedankenkanälen oder KANÜLEN, womit wir wiederum in die Nähe der kommunizierenden Röhren gelangen. Die eher elegische Anschauung von Natur, die Hinwendung : Hinneigung : leidenschaftliche Hingabe an die anderen Künste, was an der Wende zum dritten Jahrtausend einer moralischen, geistigen, seelischen Ausschließlichkeit, vielleicht Exzentrizität bedarf. Oder wollen wir es lieber egozentrische, ja, autistische Lebensbeherrschung nennen? eine Lebenshaltung jedenfalls, die von der Öffentlichkeit, der literarischen inbegriffen, nicht sonderlich bedankt sein kann und bedankt sein will – da sind die leuchtenden Palmen, da ist die ganze Vision, da ist das krasse Faszinosum des bildnerischen Werks eines Francis Bacon zum Beispiel. An vorderster Front seit den Fünfzigerjahren, Tag für Tag um diese meine geliebte deutsche Sprache bemüht, im Wachen und Träumen, also Rausch und Askese in einem, Lebensbedürfnislosigkeit gepaart mit höchsten Ansprüchen der eigenen Schreibarbeit gegenüber, harte Übung in Selbstkritik, unermüdliches Suchen, Versuchen, Vergleichen, Verkosten, Nachahmen, Lauschen – da sind doch diese zauberhaften Echos von überall her, Echos von Welt, Schmerzensschreie und Jubelstimmen in meinem Kopf, aufgeladen mit assoziativer Elektrizität, das Furioso also neben der Berechnung, das LUNATISCHE neben der Präzision.
Ich frage mich wie soll ich mich den Dingen den Umständen den Geschehnissen gegenüber verhalten, ich habe alles immer an der Oberfläche getan, was ich tat was ich dachte, war immer an der Oberfläche gedacht, war immer an der Oberfläche getan, so drüberhin alles so drüberhin, nicht wahr, keine Versenkung keine geduldige Zuwendung kein Aufgehen in einer Sache, einem Menschen, einem Ritual – überhaupt Ritual: ich habe immer gleichzeitig ganz anarchisch und ganz nach den allgemeinen Gesetzen der Menschen gelebt : ungesellig, verschlossen, uneingeübt in jeglichen Umgang mit meiner mich umgebenden Menschenwelt, flüchte ich mich in Alltagsphrasen, Jasagen, Notlügen, gespielte Höflichkeiten.
Ich sah ich sehe nicht ein, wie die Zusammenhänge verlaufen : es war wohl einiges unter der sichtbaren Oberfläche passiert. Jeder Zwischenruf : Appell, Anruf, Zimmergast, kam mir ungelegen, ich saß nur da und blickte ins graublaue Himmelsgestöber ohne erkennen zu können, ob es Flocken oder winzige Vögel waren, eigentlich Himmelsgewässer. Ich starrte ins violette Blutwasser einer mir unzugänglichen Welt Perspektive, zusammengesetzt aus Ratlosigkeit, Hilflosigkeit, Geringschätzung meiner selbst und Verlangen nach Stille. Ich wollte ich wünschte die Ausschaltung von Personen in meiner Nähe, aber ich wünschte eine Gesamtsicht von Welt, ohne Personen, denn diese verstellten mir nur den PROSPEKT, ich wollte ich wünschte eine Gesamtheit: ein PANORAMABILD von Welt sehen, begreifen, umfangen, mich ihm beigesellen, ich wollte hören, lesen, lernen, erschließen, ohne mich zu verlieren. So lebte ich dahin, atmete ahnungsvoll.
Beim Aufwachen ist die Natur da, und blattlos.
Meine gekrümmte Haltung vor der Maschine ich sitze vor meiner Maschine so tief daß die Knie beinahe den Boden berühren, ja ich knie vor meiner Maschine, der platonische Text vielleicht das einzige was ich anbete. Meine Schreibarbeit kommt durch mich zustande : meine Schreibarbeit kommt durch mich, aber nicht von mir – ich knie vor meiner Maschine ich knie vor meiner Schreibarbeit es ist so ein Tränenstrom, der mich davon schwemmt – Reißzwecken und Wäscheklammern halten mein Leben mein Schreiben zusammen, wer kann das verstehen.
Den Horizont im Visier, so saß ich, die Hautfetzen grünlich wehend vor meinem Fenster, die Stoffserviette als Schreibblatt, den unauflösbaren immerwährenden Rebus im Hirn.. nämlich des schnell welkenden Vogels im Baum, die hinterrücks Sterne.
Ich darf meine Dankrede mit einem meiner Lieblingsgedichte von Hölderlin beenden:
Hälfte des Lebens
Mit gelben Birnen hänget
Und voll mit wilden Rosen
Das Land in den See,
Ihr holden Schwäne,
Und trunken von Küssen
Tunkt ihr das Haupt
Ins heilignüchterne Wasser.
Weh mir, wo nehm ich, wenn
Es Winter ist, die Blumen, und wo
Den Sonnenschein,
Und Schatten der Erde?
Die Mauern stehn
Sprachlos und kalt, im Winde
Klirren die Fahnen.
Friederike Mayröcker, Friedrich Hölderlin-Preis. Reden zur Preisverleihung am 7. Juni 1993, Magistrat der Stadt Bad Homburg v.d.H. & Stiftung Cläre Jansen
Die Kunst, mit anderen Augen zu sehen
Friederike Mayröcker und Bodo Hell
− Friederike Mayröcker und Bodo Hell sprechen über das Werk der Dichterin, den Stellenwert der Poesie, über ihre Freundschaft – und die gemeinsamen Erinnerungen an Ernst Jandl. −
Wiener Zeitung: Frau Mayröcker, in Ihrem neuesten Lyrikband, Scardanelli, finden sich auffallend viele persönliche Widmungen. Drei der Gedichte sind beispielsweise Bodo Hell zugedacht. Wissen Sie schon im Voraus, dass Sie ein Gedicht einem bestimmten Menschen widmen möchten, oder ergibt sich das erst im Prozess des Schreibens?
Friederike Mayröcker: Das ist unterschiedlich. Aber meistens weiß ich es schon im Vorhinein.
Bodo Hell: Das Schöne ist, dass man sich einerseits wahnsinnig freut, wenn man ein Gedicht liest, das einem zugedacht wurde. Andererseits hat man oft das Gefühl, Friederike entwirft eine andere Person, an die man sich annähern könnte, bzw. eine Situation, die man halluziniert haben könnte.
Mayröcker: Halluzination spielt natürlich eine große Rolle. Der Zustand während des Schreibens ist an und für sich ein ganz außerordentlicher.
Wiener Zeitung: In einem früheren Interview meinten Sie, dass Ihre Texte nicht autobiografisch, sondern authentisch seien.
Mayröcker: Das ist ein zweischneidiges Schwert. In irgendeiner Form ist natürlich immer ein bisschen Autobiografie vorhanden, die man allerdings nicht gleich merkt, weil sie oft verhüllt wird.
Hell: Viele derer, denen du Gedichte gewidmet hast, erkennen sich in deinen Zuschreibungen bisweilen nicht wieder. Und genau das finde ich das Spannende. Es sind keinesfalls Übertragungen im realen Sinn, sondern die Wahrnehmung ist immer in einer Weise verschoben. Manchmal habe ich fast den Eindruck, du gibst den Personen in deinem Werk Namenshülsen. Ich bin gar nicht sicher, ob diese Gedichte wirklich uns gewidmet sind.
Mayröcker: Doch, es hat schon immer etwas mit diesen ganz speziellen Menschen zu tun. Ich würde sagen, es ist eine Mischung aus Fantasie und Wirklichkeit.
Hell: Meiner Leseerfahrung nach erfährt man über ein Gedicht nicht mehr, wenn man darüber informiert ist, welche Konstellationen – autobiografischer oder biografischer Natur – gerade bei dir ablaufen. Eine Art Schlüssellochliteratur wird man in deinem Werk nicht finden.
Mayröcker: Das würde ich auch nie wollen. Ich könnte übrigens auch nie Memoiren schreiben.
Hell: Die Menschen, die in deinem Werk vorkommen – ich nenne sie jetzt einmal Substitutionsfiguren –, ermöglichen es, dass jeder, der es liest, sich selbst angesprochen fühlt. Diese verschiedenen Grade der Nähe zu den Realpersonen, dieses abschattierte System von Figuren und Namenskürzeln sind meiner Meinung nach ein genialer Zug, den Leser bei der Stange zu halten.
Wiener Zeitung: Was war für Sie aber nun konkret dafür ausschlaggebend, diese drei Gedichte in „Scardanelli“ Bodo Hell zu widmen?
Mayröcker: Da müsste ich erst nachschauen – ich kann keines meiner Gedichte auswendig.
Hell: Ich denke, das hängt damit zusammen, dass man deine Gedichte jedes Mal neu liest. Deine Texte sperren sich gegen das Auswendiglernen. Obwohl sie aus dem Gedanken- und Assoziationszusammenhang kommen, beinhalten sie überraschenden Wendungen und Sprünge, die sich dem Memorieren widersetzen. Gleichzeitig jedoch hätte man sie gerne parat. Was deshalb der Fall ist, weil du Bilder entwirfst, die man als Leser nicht vergisst.
Wiener Zeitung: Denken Sie da an ein konkretes Beispiel?
Hell: Zum Beispiel an den Text mit den Schwalben, die mit aufgesperrten Schnäbeln so tief fliegen, dass ihre roten Zungen zum Vorschein kommen. Seither warte ich immer darauf, dass ich das irgendwo sehe.
Mayröcker: Ja, diese Szene ist eine Kindheitserinnerung aus Deinzendorf, die mich bis heute fasziniert. Nach dem Regen flogen die Schwalben tatsächlich auf Augenhöhe.
Hell: Vielleicht noch ein Wort zu den mir gewidmeten Gedichten. Friederike schenkte mir vor einiger Zeit zwei Rosenkugeln; eine rote und eine grüne. Diese Rosenkugeln sind nun in meinem Garten im Kamptal, von dem im Gedicht „oh Phantasus, mit Konrade, zerbrochenen Blüthen“ die Rede ist. Friederike war noch nie vor Ort, um sie zu sehen. Ich habe den Eindruck, dass dieses Bild der Rosenkugeln umso mächtiger ist, je weniger du sie gesehen hast.
Mayröcker: Rosenkugeln sind auch eine ganz starke Erinnerung an Deinzendorf. Wir hatten zwar keine, aber in den Nachbarsgärten waren welche. Das hat mich ungemein beeindruckt.
Hell: Weil man sich darin spiegelt?
Mayröcker: Man spiegelt sich – und sie leuchten, sie haben diesen ganz eigenartigen Glanz.
Wiener Zeitung: Dieses Gedicht ist also auch eine Mischung aus Fantasie und Wirklichkeit?
Mayröcker: Ja, die Rosenkugeln und die Beschreibung von Bodo Hells Gestik der Hände sind Wirklichkeit, alles andere ist bislang leider nur in der Fantasie möglich gewesen.
Hell: In diesem Zusammenhang gibt es noch eine Parallele mit der Alm, wo du und Ernst Jandl mich immer besuchen wolltet. Es hat sich leider nie ergeben, aber immer war der Gedanke da, mit dem Hubschrauber hinauf und über die Alm hinweg zu fliegen. Ähnlich wie in diesem Gedicht: Man hat das Gefühl, du warst schon in diesem Garten, ohne dass du je dort gewesen bist.
Wiener Zeitung: Wie lange reicht Ihre Freundschaft mittlerweile zurück?
Mayröcker: Bis ins Jahr 1975.
Wiener Zeitung: Kennen Sie einander über die Literatur?
Hell: Ja, wenn ich das sagen darf: Friederike hat immer schon mehr gewagt, als wir sogar als Junge gewagt hätten. Auf verschiedenen Ebenen. Auch was die Lebensform zu zweit betrifft. Du und Ernst Jandl – das war vergleichbar mit Simone de Beauvoir und Jean Paul Sartre. Nicht was den Grad der Öffentlichkeit der Personen betrifft, sondern als vorbildliches Paar.
Mayröcker: Vorbildlich würde ich gar nicht sagen.
Hell: Jedenfalls war es eine Gestaltung der Lebensform, die damals eine große Ausnahme darstellte. Beide arbeiten intensiv, sind schriftstellerisch tätig, und gleichzeitig dieses gegenseitige Einräumen von Freiheit. Aber speziell zu deiner Literatur: Für mich ist immer so überraschend, dass jedes deiner neuen Bücher tatsächlich etwas Neues bringt. Nicht nur bezogen auf den Inhalt, sondern wie du Formen wagst. Das neueste Manuskript, an dem du gerade arbeitest und von dem ich bereits einige Seiten lesen durfte, besteht beispielsweise aus Fußnoten zu einem Buch, das in Wirklichkeit nicht geschrieben ist. So etwas muss einem erst einmal einfallen! Wie gesagt: Eine Kühnheit, die immer wieder überrascht.
Wiener Zeitung: Sie selbst bezeichnen „je ein umwölkter gipfel“ als Schlüsselwerk.
Mayröcker: Es ist deshalb ein wichtiges Buch, weil ich mich mit diesem Werk vom puren experimentellen Arbeiten abgewandt habe. Ich dachte mir, ich muss jetzt etwas anderes machen. Vorab wusste ich nur den Titel des Buches, den ich übrigens aus der „Zeit“ gestohlen habe. Damals war gerade der Amerika-Russland-Gipfel und die „Zeit“ titelte mit der Überschrift: „Ein umwölkter Gipfel“. Ich fügte nur das „je“ hinzu und entwarf zwei sprechende Personen. Später in „Heiligenanstalt“ bin ich allerdings wieder zum Experimentellen zurückgekehrt.
Hell: Weil du „Heiligenanstalt“, also deine Musikerbiografien, ansprichst: Für mich ist faszinierend, wie du diese Biografien aus den Texten, die du über diese Musiker gelesen hast, in einer Weise herausziehst, dass zum Schluss eine Art innere Biografie übrig bleibt. Sowohl bei Chopin, Bruckner, Schumann oder Schubert hast du für jede dieser biografischen Annäherungen eine eigene literarische Form gefunden. Die Schubertgeschichte besteht beispielsweise nur aus Zettelchen. Das finde ich großartig, weil du auf diese Weise meiner Ansicht nach ein besseres Bild einer Annäherung an ein mögliches Leben erzeugst, als wenn man „klassische“ Biografien liest. Biografien erwecken oft den Eindruck, als wäre alles erklärbar. Du lässt vieles offen.
Mayröcker: Ich habe zwei Schubert-Biografien geschrieben. Zu jener in „Heiligenanstalt“ hat mich Otto Breicha verführt. Er brachte mir einen großen Stoß Bücher und Schallplatten, wobei ich generell sagen muss, dass mich Otto Breicha für vieles geöffnet und mir vieles nahe gebracht hat. Nicht nur was Musik betrifft, vor allem auch in Sachen Bildender Kunst. Er war ja Kunsthistoriker und viele Jahre Direktor des Salzburger Rupertinums.
Hell: Zudem brachte er die Zeitschrift „protokolle“ heraus, wo er die wildesten Dinge veröffentlichte. Zu mir sagte er immer: „Schreiben Sie mir wieder was Schönes!“
Mayröcker: Das sagte er zu mir auch, ebenso wie: „Du bist mein Maskottchen. Wenn kein Text von dir drinnen ist, dann stimmt das Heft nicht.“
Wiener Zeitung: Weil Sie zuvor die Bildende Kunst angesprochen haben: Steht sie als Inspirationsquelle noch über der Musik?
Mayröcker: Auf jeden Fall. Speziell Maria Lassnig gefällt mir ausgesprochen gut. Mit ihren Body-Awareness-Bildern ist sie eine Art Vorbild für mich.
Hell: Was selten gesagt wird und was dich vielleicht mit Lassnig verbindet, ist das Interesse für Körperfunktionen.
Mayröcker: Ja, die interessieren mich sehr.
Hell: Du verstehst es mit der größten Feinheit, mit delikatester Wörtlichkeit die unglaublichsten Dinge zu beschreiben. Ganz gleich, ob es sich um sperrige Themen wie Inkontinenz oder Fäkalien handelt – bei dir erwecken diese Texte keinen technischen oder medizinischen Eindruck, sondern alles ist so fein, fast liebevoll.
Mayröcker: „Wäsche, selig gemacht“ heißt dieser Text…
Hell: Eine weitere Parallele zu Maria Lassnig ist natürlich deine Tier-Morphologie – wenn du sozusagen in Tiergestalten auftauchst. Mich hat deine Aussage beeindruckt, dass es vorkommen kann, dass du auf der Straße einen Hund siehst und daraufhin die Welt mit seinen Augen wahrnehmen kannst. Eine ähnliche Situation hast du einmal beschrieben, als du plötzlich mit den Augen deines Vaters sehen konntest.
Mayröcker: Das habe ich wirklich erlebt. Ich hatte mich so in meinen Vater hineinversetzt, dass ich plötzlich das Gefühl hatte, ich schaue jetzt genau mit den Augen meines Vaters. Das ist nicht oft vorgekommen. Aber mit dem Hund war das damals genauso.
Hell: Das ist vielleicht eine Brücke zu den zuvor angesprochenen Substitutionsfiguren und Namen: Du gibst auf ganz spezielle Weise Anleitungen zur Wahrnehmungstechnik. Das geht ganz schleichend vor sich. Auch wenn sich die angesprochenen Personen mitunter in den Texten nicht wiederfinden, ist ihnen gleichzeitig eine Lebensmöglichkeit gegeben. Nicht nur in der Wahrnehmung beispielsweise durch ein Hunde- oder Insektenauge, sondern die Literatur macht etwas mit dem Leben, das gar nicht über die Person geht. Du ermöglichst deinen Lesern Wahrnehmungsbereiche, die man ansonsten bestenfalls nur erahnt.
Wiener Zeitung: Sind diese von Bodo Hell angesprochenen subtilen Zwischentöne der Grund, weshalb Sie Ihre Texte immer selber lesen?
Mayröcker: Ich lese meine Texte deshalb immer selbst, weil die meisten Schauspieler nur sich selbst sprechen. Ich halte das nicht aus.
Hell: Man will ihnen keineswegs eine böse Absicht unterstellen, aber wenn Schauspieler mit Texten arbeiten, hat man sehr oft das Gefühl, als müssten sie sich diese Texte aneignen. Sie können nicht auf den Text horchen, nicht abwarten, was er macht.
Mayröcker: Der einzige Schauspieler, der dies mit meinen Texten konnte, war Ulrich Wildgruber. Wie er mein Hörspiel „Dein Wort ist meines Fußes Leuchte oder Lied der Trennung“ sprach, war sehr beeindruckend.
Hell: Wildgruber las den Text, als würde er ihm in der Sekunde eingegeben. Und zwar im rasenden Tempo – dann stoppte er, ganz so, als horchte er, was er soeben gesagt hatte.
Mayröcker: Das war faszinierend.
Wiener Zeitung: Wenn man Ihre Prosa-Werke liest, fragt man sich oft, wie Sie letztlich zu einem Ende finden können?
Mayröcker: Wenn man keine Kraft mehr hat, ist es aus.
Wiener Zeitung: Kommt Ihnen dann nicht der Gedanke an eine Fortsetzung?
Mayröcker: Fortsetzungen habe ich nie gemacht. Wenn ein Buch aus ist, ist es aus. Dann war ich, wie gesagt, mit meiner Kraft am Ende. Danach folgt meistens eine Phase mit Gedichten.
Wiener Zeitung: Im Anschluss an die Buchpräsentation von „Scardanelli“ sprachen Sie über Ihre intensive Hinwendung zum Leben, und dabei fiel der Satz „Ich hasse den Tod“.
Mayröcker: Ja, den hasse ich. Ich sehe nicht ein, dass ich abtreten muss, weil ich noch einiges vorhabe. Canetti war ja auch gegen den Tod. Ich finde es ein Abschneiden eines Fadens, der am liebsten noch sehr lange weiter ginge. Dieser Faden wird einfach abgeschnitten, und man geht in ein unbekanntes Terrain. Das finde ich schlimm.
Wiener Zeitung: Ihr literarisches Schaffen reicht nun bereits mehr als 60 Jahre zurück. In welche Richtung hat sich Ihrem Empfinden nach in dieser Zeit der Stellenwert von Dichtung verändert?
Mayröcker: Ich denke schon, dass das Interesse steigt. Vor allem bei jüngeren Menschen. Aber auch bei älteren Frauen. Das merke ich oft bei meinen Lesungen – dort sind sehr viele weibliche Hörer und Leser.
Hell: Du hast eine sehr große Fangemeinde. Zudem habe ich den Eindruck, dass du hier Menschen gewonnen hast – und zwar nicht im Sinne von für dich gewonnen, sondern der Text hat das vollbracht.
Wiener Zeitung: Wie ist das zu verstehen?
Hell: Es geht über eine bestimmte Textgestalt, die einen im Herzen trifft. Das ist sehr verführerisch.
Christine Dobretsberger, Wiener Zeitung, 20.6.2009
CHERUB
Für Friederike Mayröcker zum 90. Geburtstag
1924–2014
Wilderin in
den Gängen
der Grammatik
ich folge dir
Knarrende Dielen
ausgetretene Stiegen
Luft dick dass die Ohren dröhnen
Witterung aufnehmend
und schon greifst du in den Raum
mit den unverbrauchten Wortstämmen
Ich traue mich
nicht deine
Spinnenbeinfinger
zu streicheln
die Worte ergreifen
als seien sie
eine Beute
Jägerin, selbst
auf der Hut
vor der Zerstörung
der Zeit
Deine stockigen
Glieder zerfallen
ein Schattenspiel
wenn das Licht
schwindet
Deine gläserne Sprache
zersplittert mein Herz
Du fällst meinen
Wortstamm
Ich bin sprachlos
Deine Zunge spaltet
mein Trommelfell
Ich blute aus
in deiner Kraft
Was übrig
bleibt
düngt eines Tages das
Ruhebeet der Worte
Du signierst mein Buch
entwirrst dein Gerippe
erhebst dich und
der Schatten
Ernst Jandls folgt
Ich gehe zum Kleistgrab
am Wannsee
und du fährst nach Wien
II.
Berlin lässt nicht locker der
Potsdamer Platz ruft dich
Sie sind wieder hineingewachsen
deine Gebeine in die
ausgelatschten Schuhe
eures gemeinsamen Lebens
So bereift
bist du reisefertig
Die Wunden im Sand
schließen sich Auf
deinem Herzen trampeln
Touristen Noch immer
Ernst Jandl am Lesetisch und du
sagst es war am Küchenfenster
beim letzten Mal
Es ist schwer
einen Mann auszukehren
Auch die Berliner Stadtreinigung
hat keinen Container
für Gedichte
zwischen Hochhäusern Der
Verkehr für einen Abend beruhigt
Ein kollektives lauschen
deiner staubigen Stimme
Knarrende Dielen beim
Abgang – Der Abendstern
ist dem Cherub gewichen
Jenny Schon
Theo Breuer: „Wie eine Lumpensammlerin“ – Vermerk zu Friederike Mayröckers Werk nach 2000
poetenladen.de, 20.12.2014
Hans Ulrich Obrist spricht über die von ihm kuratierte Ausstellung von Friederike Mayröcker Schutzgeister vom 5.9.2020–10.10.2020 in der Galerie nächst St. Stephan
Friederike Mayröcker übersetzen – eine vielstimmige Hommage mit Donna Stonecipher (Englisch), Jean-René Lassalle (Französisch), Julia Kaminskaja (Russisch) und Tanja Petrič (Slowenisch) sowie mit Übersetzer:innen aus dem internationalen JUNIVERS-Kollektiv: Ali Abdollahi (Persisch), Ton Naaijkens (Niederländisch), Douglas Pompeu (brasilianisches Portugiesisch), Abdulkadir Musa (Kurdisch) und Valentina di Rosa (Italienisch) und Bernard Banoun – im Gespräch mit Marcel Beyer am 6.11.2021 im Literaturhaus Halle.
räume für notizen: Friederike Mayröcker: Frieda Paris erliest ein Langgedicht in Stücken und am Stück, Juliana Kaminskajas Film das Zimmer leer wird gezeigt. Die Moderation übernimmt Günter Vallaster am 29.1.2024 in der Alten Schmiede, Wien
Fest mit WeggefährtInnen zu Ehren von Friederike Mayröcker Mitte Juni 2018 in Wien
Sandra Hoffmann über Friederike Mayröcker bei Fempire präsentiert von Rasha Khayat
Im Juni 1997 trafen sich in der Literaturwerkstatt Berlin zwei der bedeutendsten Autorinnen der deutschsprachigen Gegenwartslyrik: Friederike Mayröcker und Elke Erb.
Protokoll einer Audienz. Otto Brusatti trifft Mayröcker: Ein Kontinent namens F. M.
Zum 70. Geburtstag der Autorin:
Daniela Riess-Beger: „ein Kopf, zwei Jerusalemtische, ein Traum“
Katalog Lebensveranstaltung : Erfindungen Findungen einer Sprache Friederike Mayröcker, 1994
Ernst Jandl: Rede an Friederike Mayröcker
Ernst Jandl: lechts und rinks, gedichte, statements, perppermints, Luchterhand Verlag, 1995
Zum 75. Geburtstag der Autorin:
Bettina Steiner: Chaos und Form, Magie und Kalkül
Die Presse, 20.12.1999
Oskar Pastior: Rede, eine Überschrift. Wie Bauknecht etwa.
Neue Literatur. Zeitschrift für Querverbindungen, Heft 2, 1995
Johann Holzner: Sprachgewissen unserer Kultur
Die Furche, 16.12.1999
Zum 80. Geburtstag der Autorin:
Nico Bleutge: Das manische Zungenmaterial
Stuttgarter Zeitung, 18.12.2004
Klaus Kastberger: Bettlerin des Wortes
Die Presse, 18.12.2004
Ronald Pohl: Priesterin der entzündeten Sprache
Der Standard, 18./19.12.2004
Michael Braun: Die Engel der Schrift
Der Tagesspiegel, 20.12.2004.
Auch in: Basler Zeitung, 20.12.2004
Gunnar Decker: Nur für Nervenmenschen
Neues Deutschland, 20.12.2004
Jörg Drews: In Böen wechselt mein Sinn
Süddeutsche Zeitung, 20.12.2004
Sabine Rohlf: Anleitungen zu poetischem Verhalten
Berliner Zeitung, 20.12.2004
Michael Lentz: Die Lebenszeilenfinderin
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 20.12.2004
Wendelin Schmidt-Dengler: Friederike Mayröcker
Zum 85. Geburtstag der Autorin:
Elfriede Jelinek, und andere: Wer ist Friederike Mayröcker?
Die Presse, 12.12.2009
Gunnar Decker: Vom Anfang
Neues Deutschland, 19./20.12.2009
Sabine Rohlf: Von der Lust des Worte-Erkennens
Emma, 1.11.2009
Zum 90. Geburtstag der Autorin:
Herbert Fuchs: Sprachmagie
literaturkritik.de, Dezember 2014
Andrea Marggraf: Die Wiener Sprachkünstlerin wird 90
deutschlandradiokultur.de, 12.12.2014
Klaus Kastberger: Ich lebe ich schreibe
Die Presse, 12.12.2014
Maria Renhardt: Manische Hinwendung zur Literatur
Die Furche, 18.12.2014
Barbara Mader: Die Welt bleibt ein Rätsel
Kurier, 16.12.2014
Sebastian Fasthuber: „Ich habe noch viel vor“
falter, Heft 51, 2014
Marcel Beyer: Friederike Mayröcker zum 90. Geburtstag am 20. Dezember 2014
logbuch-suhrkamp.de, 19.1.2.2014
Maja-Maria Becker: schwarz die Quelle, schwarz das Meer
fixpoetry.com, 19.12.2014
Sabine Rohlf: In meinem hohen donnernden Alter
Berliner Zeitung, 19.12.2014
Tobias Lehmkuhl: Lachend über Tränen reden
Süddeutsche Zeitung, 20.12.2014
Arno Widmann: Es kreuzten Hirsche unsern Weg
Frankfurter Rundschau, 19.12.2014
Nico Bleutge: Die schöne Wirrnis dieser Welt
Der Tagesspiegel, 20.12.2014
Elfriede Czurda: Glückwünsche für Friederike Mayröcker
Manuskripte, Heft 206, Dezember 2014
Kurt Neumann: Capitaine Fritzi
Manuskripte, Heft 206, Dezember 2014
Elke Laznia: Friederike Mayröcker
Manuskripte, Heft 206, Dezember 2014
Hans Eichhorn: Benennen und anstiften
Manuskripte, Heft 206, Dezember 2014
Barbara Maria Kloos: Stadt, die auf Eisschollen glimmt
Manuskripte, Heft 206, Dezember 2014
Oswald Egger: Für Friederike Mayröcker zum 90. Geburtstag
Manuskripte, Heft 206, Dezember 2014
Péter Esterházy: Für sie
Manuskripte, Heft 206, Dezember 2014
Wilder, nicht milder. Friederike Mayröcker im Porträt
Zum 93. Geburtstag der Autorin:
Einsame Poetin, elegische Träumerin, ewige Kinderseele
Die Presse, 4.12.2017
Zum 95. Geburtstag der Autorin:
Claudia Schülke: Wenn Verse das Zimmer überwuchern
Badische Zeitung, 19.12.0219
Christiana Puschak: Utopischer Wohnsitz: Sprache
junge Welt, 20.12.2019
Marie Luise Knott: Es lichtet! Für Friederike Mayröcker
perlentaucher.de, 20.12.2019
Herbert Fuchs: „Nur nicht enden möge diese Seligkeit dieses Lebens“
literaturkritik.de, Dezember 2019
Claudia Schülke: Der Kopf ist voll: Alles muss raus!
neues deutschland, 20.12.2019
Mayröcker: „Ich versteh’ gar nicht, wie man so alt werden kann!
Der Standart, 20.12.2019
Zum 96. Geburtstag der Autorin:
Fakten und Vermutungen zur Autorin und Interview 1, 2, 3 & 4 +
Archiv 1, 2 & 3 + Internet Archive + KLG + IMDb + ÖM + Kalliope +
DAS&D + Georg-Büchner-Preis 1 & 2
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Galerie Foto Gezett +
Dirk Skiba Autorenporträts + Autorenarchiv Susanne Schleyer +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + Keystone-SDA +
deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Friederike Mayröcker: Standart ✝︎ NZZ 1 + 2 ✝︎ SRF ✝︎
FAZ 1 + 2 ✝︎ Tagesspiegel ✝︎ FAZ ✝︎ Welt 1 + 2 ✝︎ SZ ✝︎ BR24 ✝︎ WZ ✝︎
Presse ✝︎ FR ✝︎ Spiegel ✝︎ Stuttgarter ✝︎ Zeit 1 + 2 + 3 ✝︎ Tagesanzeiger ✝︎
dctp ✝︎ Kleine Zeitung ✝︎ Kurier ✝︎ Salzburger ✝︎ literaturkritik.de 1 + 2 ✝︎
junge Welt ✝︎ ORF 1 + 2 ✝︎ Bayern 2 1 + 2 ✝︎ der Freitag ✝︎ Die Furche ✝︎
literaturhaus ✝︎ WOZ ✝︎ NÖN ✝︎ BaZ 1 + 2 ✝︎ Poesiegalerie ✝︎
Friederike Mayröcker – Trailer zum Dokumentarfilm Das Schreiben und das Schweigen.


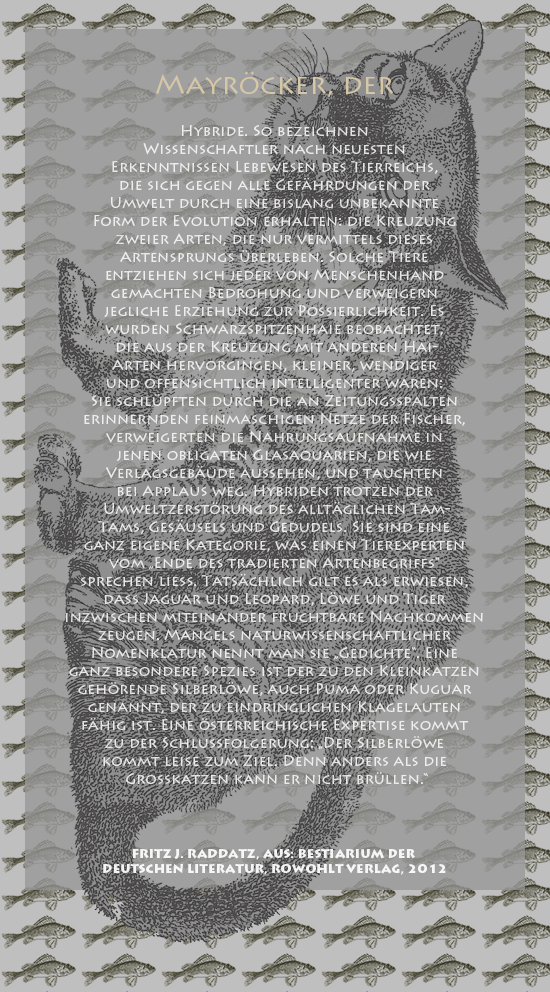












Schreibe einen Kommentar