Friederike Mayröcker: Benachbarte Metalle
OVAL DER SONNE
ach im Aprilgefunkel die
taubengrauen Schneisen der
Luft ich bin
keine Ameise sondern im
Lerchenkleid sondern feldgrün und blau
sondern das unzertrennliche
Freundespaar – Herzrose Blumenstern
Dioskurenknospe in seiner Brust oder wie man so
sagt dunkel aus einem Tulpen-
schosz, Raptus im tiefen
Mais, Halbschneiderei, die
Dichter tun nur so als wären sie
tot, Ton
aus der Ferne
Hendrik Jackson „Mutiert“ in der Reihe des Deutschen Literaturfonds Hundert Autoren präsentieren ihre Arbeit im Internet unter Verwendung der Gedichte „Praterbesuch“ sowie „schwarz wie die Farbe der Anarchie“ von Friedericke Mayröcker.
(S. Stiefelhoff schreibt bei lyrikkritik.de über dieses Video)
Benachbarte Metalle
Friederike Mayröckers Gedichte sind Evokationen. Mit Evokation war das Hervorrufen, das Herausrufen von fremden Göttern aus einer belagerten Stadt gemeint, um sie zur Übersiedlung nach dem frühen Rom zu bewegen. Diese Evokation geschah durch das carmen – durch das Gedicht.
„Es ist eine Art Parallelprozeß, ich exzerpiere etwas, ich höre dann in meinem Kopf etwas Ähnliches, etwas Anklingendes, also ich werde sozusagen vom Akustischen her befruchtet, wenn ich lese“, sagt Mayröcker in einem Interview. Marcel Duchamp sprach einmal von „Benachbarten Metallen“, als ihm nicht mehr einfiel (einfallen wollte), welche Werkstoffe er zu einer bestimmten Arbeit verwandt hatte. Auch bei den vielen hundert Mayröckergedichten ist es das Ähnliche, das Unterschiedene, ist das Scheidbare verschmolzen. Ihr Gedicht ist aus Benachbarten Metallen gemacht. Gerade ihr Band Winterglück, der die Gedichte der frühen bis mittleren achtziger Jahre enthält, ist Schwermetall und scheint eine besonders lange Zerfallszeit zu haben, weswegen ich bei meiner Anordnung besonderen Wert auf diese Benachbarten Metalle gelegt habe.
Mayröcker schreibt seit den vierziger Jahren Gedichte. Eine Frau, Dichterin, die sich die Sprache genommen hat, die ihren Rufen – Sounds – und vielgestaltigen Rhythmen folgt. Das heißt, die Dichterin transformiert Welt in Schrift – Überführung von Bewegung in Bewegung: ihr Gedicht, vielgestaltigst, ist Trans-Formation; Eigenheit in erneuten und erneuten Entbabylonisierungs-Versuchen.
Mayröckers Gedicht ist, immer und zunächst, metropolitane Mitschrift. Auch wenn sie landschaftliche Parallelprozesse thematisiert, ist es der den schnellen Schnitt gewohnte Städterinnenblick, das stadtgeschulte, also mit dem Sinn für unausgesetzte Frequenzüberlagerung ausgestattete Ohr, das ihr Gedicht vortreibt, es hören und sehen macht; nie hat ihr der Weichzeichner der Innerlichkeit zur Verfügung gestanden – nicht der unwesentlichste Grund für das Interesse an Mayröckers Dichtung! Immer ist ihr Gedicht der Metropolen-Unruhe geschuldet. Ja, sie schreibt, seit Jahrzehnten, am Babylonische(n) Gedicht, wie sie schon in den 60er Jahren titelt. Schon zur selben Zeit heißt es bei ihr, programmatisch und refrainhaft wiederholt: „so eine stadt spricht doch!..“. Und, ebenso programmatisch wie selbstbewußt, liest man in ihrem berühmten frühen Zyklus Tod durch Musen den Vers: „und schon sind wir mitten drin in der suspekten abstraktion“ – der Illusion eines gesellschaftspolitischen Nutzens von Dichtung ist Mayröcker zu keiner Zeit aufgesessen. Ihr war das Gedicht seit jeher „ein apparatus“ (Babylonisches Gedicht), Welterkenntnis-Maschine der Vor-Leibnizzeit, wie sie nur in der vanitassüchtigen, deutlich aus dem Barock sich speisenden Stadt Wien entstehen kann. Mayröckergedicht heißt Bilderreichtum, vielmehr: Bildkatarakt, bedeutet unausgesetztes Ton-Ereignis. Mayröckers Dichtung zu lesen ist – unvermutet – eben aber auch dies: „leichte Kommunikation“ (Text mit Giotto). Überwältigend durch Schönheit und Sprachkraft ist Friederike Mayröckers komplexem Werk nicht sehr viel an die Seite zu stellen, das in der zweiten Jahrhunderthälfte hervorgegangen ist aus der deutschen Sprache.
Thomas Kling, Nachwort, 16.9.1998
Benachbarte Metalle
enthält eine Auswahl von Friederike Mayröckers Gedichten aus über dreißig Jahren, besorgt und mit einem Nachwort versehen von Thomas Kling.
In die nichtchronologische Anordnung ist schwerpunktmäßig Lyrik aus ihren Gedichtbüchern aufgenommen, beginnend mit dem fulminanten Zyklus „Tod durch Musen“, der ihrem ersten Gedichtbuch 1966 den Namen gab. Ein Schwergewicht der Benachbarten Metalle liegt bei den Gedichten der achtziger Jahre aus Winterglück, dem vielleicht wichtigsten Gedichtband der Grande Dame der deutschen Gegenwartsdichtung.
Suhrkamp Verlag, Klappentext, 1998
Beitrag zu diesem Buch:
Jonis Hartmann: Klings Blick auf Mayröckers Werk
fixpoetry.com, 20.9.2016
„Ich bin erst mit Mitte 70 ein wirklicher Mensch geworden“
− Seit ihr Mann Ernst Jandl gestorben ist, lebt die Schriftstellerin Friederike Mayröcker fast nur noch in der Welt ihrer Texte. Ein Gespräch über das Weitermachen. −
Friederike Mayröcker zählt zu den bedeutendsten Schriftstellerinnen unserer Zeit. Von 1954 bis 2000 hat sie mit dem berühmten Schriftsteller Ernst Jandl zusammengelebt, ihrem „Hand- und Herzgefährten“. Sie ist 87 Jahre alt und hat ihr ganzes Leben in Wien verbracht. Ihre beiden letzten Bücher heißen Von den Umarmungen und Ich sitze nur grausam da.
Friederike Mayröcker wartet im Hotel Imperial in Wien. Ende August, es ist heiß, trotzdem sitzt sie nicht wie die anderen auf der Terrasse, sondern drinnen im Café, ganz still und ins Abseits gekauert, mehr Wesen als Mensch. Wie immer ist sie bis auf die weißen Romika-Schuhe ganz in Schwarz gekleidet, selbst die Augen hat sie dick mit Kajal eingerahmt. „Grüß Gott“, sagt sie leise, schaut auf und lächelt. Ein Blick in diese 87 Jahre alten Augen genügt, und man weiß: Das hier wird kein Interview, sondern eine – sie wird es am Ende selbst so nennen – seelische Sitzung.
Tobias Haberl: Es gibt einen Dokumentarfilm über Sie mit dem Titel Das Schreiben und das Schweigen. Sie reden nicht gern, stimmt’s?
Friederike Mayröcker: Ja, ich fühle mich nur am Leben, wenn ich schreibe. Seit ich 15 bin, explodiert es jeden Tag in mir. Mein Kopf ist so voll, und alles muss raus, ich kann nicht anders.
Haberl: Sie könnten auch mit einer guten Freundin sprechen.
Mayröcker: Schon, aber ich spreche auch nicht so gut. Meine Mutter war eine stille Person, mein Vater auch. „Kind, wie geht’s dir, erzähl doch mal“, das war bei uns nicht üblich. Also habe ich auch wenig gesprochen, eigentlich fast gar nichts. In der Schule war ich scheu, nur ganz selten habe ich mich getraut, den Finger zu heben.
Haberl: Was stört Sie am Sprechen?
Mayröcker: Dass ich nicht genug Zeit zum Überlegen habe. Zu Hause am Schreibtisch würde ich die Dinge ganz anders formulieren. Außerdem stimmt das doch alles gar nicht, was man den ganzen Tag so spricht.
Haberl: Warum haben Sie sich dann auf dieses Gespräch eingelassen?
Mayröcker: Weil die Journalisten, die zu mir kommen, oft ganz nett sind. Und manchmal gelingt es ihnen sogar, die Dinge, die ich sage, so anzuordnen, dass sie stimmen.
Haberl: Sie werden im Dezember 88 Jahre alt. Fällt Ihnen das Leben schwerer als noch vor zehn Jahren?
Mayröcker: Ja, mit 77 war ich noch ziemlich frisch. Im Moment habe ich eine Arthrose an den Füßen. Ich kann nicht mehr rasch gehen. Dicke Bücher schaffe ich auch nicht mehr. Ich bin langsam geworden. Gott sei Dank nicht beim Denken und Schreiben. Ich arbeite jeden Morgen, bis ich spüre, dass ich aufhören muss, weil der Blutdruck auf 200 ist.
Haberl: „Körperruine“, „Monster im Spiegel“ – kommt alles in Ihren Texten vor.
Mayröcker: So nehme ich mich nun mal wahr und es gefällt mir nicht. Trotzdem bin ich nur äußerlich das alte Weib, das durch die Straßen humpelt, innerlich bin ich immer noch das 17-jährige Mädchen, das in Deinzendorf barfuß über die Wiese läuft. Ich glaube, ich habe eine Kinderseele. Kann man das so sagen?
Haberl: Stört Sie das Altwerden?
Mayröcker: Ja, man sieht es mir nicht an, aber ich bin furchtbar eitel. Wenn ich vor zwanzig Jahren einen Preis bekommen habe, bin ich sofort in die Stadt und habe mir was Hübsches gekauft. Ich war verrückt nach Mode. Aber heute? Eine fast 100jährige, die sich Mode kauft, das wäre obszön. Glauben Sie mir, Älterwerden ist furchtbar. Männer haben es nicht so schwer. Denken Sie mal an Samuel Beckett. Würden Sie den auch fragen, wie alt er ist und ob er ein Problem damit hat? Eher nicht.
Haberl: Warum nicht?
Mayröcker: Weil alte Männer, vor allem Künstler, mehr Würde haben als wir Frauen. Haben Sie Becketts Gesicht vor Augen? Was hat dieser Mann für eine Würde besessen.
Haberl: Er hatte das Glück, gut zu altern.
Mayröcker: Und welche Künstlerin ist gut gealtert? Mir fällt keine ein. Und ich selbst schaffe es auch nicht. Sie wissen, dass ich 50 Jahre mit dem Schriftsteller Ernst Jandl zusammengelebt habe? Er war in den letzten Jahren sehr von Alter und Krankheit gezeichnet, aber es war ihm egal, er hat sogar Scherze darüber gemacht. „Schau mal, wie ich ausschaue“, hat er immer gesagt.
Haberl: Ein paar Jahre nach seinem Tod im Jahr 2000 sagten Sie: „Die Lücke schließt sich nicht.“ Hat sie sich inzwischen geschlossen?
Mayröcker: Sagen wir so, das Gefühl ist milder geworden. Kurz nach seinem Tod war ich davon überzeugt, nie mehr schreiben zu können, so ausgeleert war ich. Heute ist er punktuell sogar bei mir. Er kommt, wann er will, oft für eine halbe Stunde, dann ist er ganz da, so dass ich ihn spüren kann. Wissen Sie, kurz bevor er gestorben ist, habe ich ein paar ganz gute Gedichte geschrieben und hatte keine Ahnung, dass er zwei Tage später nicht mehr da sein würde. Was für eine Gefühllosigkeit, oder? Das kann man nur Gefühllosigkeit nennen. Ich war so innig mit ihm und habe nicht gespürt, dass es seine letzten Tage sind.
Haberl: Kommt es vor, dass Sie ihn um Hilfe bitten?
Mayröcker: Ja, wenn ich was nicht finde, eine Tasse oder Schere, dann sage ich: „Ernst, wenn du noch irgendwo bist, mach, dass ich dieses Ding finde.“ Ich kann mich noch gut an einen Sommerabend erinnern, wenige Wochen nach seinem Tod. Ich war zu Hause und hatte alle Fenster offen, als eine riesige Libelle zum Fenster hereingeflogen kam. Sie flog durch den Raum, versteckte sich in einer Ecke und blieb da, bis sie zu einer Mumie geworden und vertrocknet ist. Damals habe ich geglaubt, dass er das ist.
Haberl: Vermissen Sie ihn?
Mayröcker: Natürlich, ich habe eine riesige Sehnsucht nach Liebe, ich verliebe mich auch ständig. Als Ernst noch gelebt hat, hat er das aufgefangen. Heute kommt die Liebe ganz plötzlich, meistens über die Augen, über den Blick. Ich verliebe mich in Menschen und Tiere, ganz egal ob sie mich widerlieben. Das macht mir nichts aus. Ich will ja gar nichts von denen.
Haberl: Kommt es vor, dass Sie mit 87 Jahren Dinge auf einmal ganz anders sehen als Ihr ganzes Leben zuvor?
Mayröcker: Ich glaube, dass ich heute mehr vom Leben und den Menschen verstehe. Ich bin erst mit Mitte 70 ein wirklicher Mensch geworden. Vorher war ich egoistisch, ohne Mitgefühl für meine Mitmenschen, vor allem für meine Mutter, die ich heiß geliebt habe. Trotzdem, wenn ich bei ihr war und sie mich gebeten hat, noch ein bisserl zu bleiben, bin ich nach Hause, um zu schreiben. Kurz vor ihrem Tod hat sie gesagt: „Weißt du, Friederike, eigentlich habe ich nur für dich gelebt.“
Haberl: Haben Sie deswegen ein schlechtes Gewissen?
Mayröcker: Ja, weil ich gemerkt habe, dass es die Wahrheit ist. Trotzdem konnte ich meinen Schreibdrang nicht abstellen. Oft musste ich einen Absatz unbedingt zu Ende bringen, dabei hätte sie sich so gefreut. Dreißig Minuten hätten gereicht. Nur ein bisserl sitzen bleiben. Ich habe es nicht geschafft.
Haberl: Sie waren besessen vom Schreiben.
Mayröcker: Ich bin es immer noch, aber früher war ich egoistisch, und je weiter ich zurückdenke, desto rücksichtsloser sehe ich mich. Heute habe ich keine Familie mehr. Alle sind gestorben.
Haberl: Fühlen Sie sich einsam?
Mayröcker: In manchen Stunden ja, vor allem am Wochenende, wenn die Geschäfte geschlossen haben und keine Post kommt. Dann kann es arg sein. Ich kriege so gern Post. An solchen Tagen werde ich mir meiner Einsamkeit bewusst. Dann schreibe ich Briefe oder gehe spazieren. Manchmal versuche ich, jemanden anzurufen.
Haberl: Warum versuchen?
Mayröcker: Weil ich gehemmt bin. Eigentlich will ich niemanden belasten. Kann doch niemand was dafür, dass es mir elend geht. Wissen Sie, manchmal bin ich eine Raunzerin. Dann jammere ich, wie alt ich bin und dass es sicher bald aus sein wird. Ich werde dann von einer Sentimentalität überfallen, dass ich mich sofort hinsetzen und schreiben muss, um dieses Gefühl wegzudrücken.
Haberl: Sind Sie traurig, dass Sie keine Kinder haben?
Mayröcker: Natürlich wäre es schön, jetzt einen Sohn oder eine Tochter zu haben, aber ich bereue nichts, weil ich sonst mein Schreiben bereuen müsste, und das tue ich nicht, weil ich ohne Schreiben nicht leben kann, aber warten Sie, ich glaube, ich muss mich messen, es ist wieder so weit.
Es dauert eine Weile, bis sie ihr Blutdruckmessgerät gefunden hat, so viel Zeug hat sie dabei: eine Handtasche, eine Plastiktüte, einen kleinen Rucksack, außerdem einen Schirm, einen großen Notizblock und ihr letztes Buch – „weil ich schon nicht mehr weiß, was drinsteht.“ Dann hat sie es. Schnallt sich die Manschette um, misst, wartet: 160 zu 90. „Das geht noch“, sagt sie. „Ich versuche noch 30 Minuten, ja?“
Haberl: In Ihrem Buch Brütt oder die seufzenden Gärten heißt es: „Ich habe alles verloren, vertan, versäumt…“
Mayröcker: Natürlich hat man alles versäumt.
Haberl: Was zum Beispiel?
Mayröcker: Ich habe mich immer versteckt. Wenn ich an andere Autoren denke, die mischen sich ein in gesellschaftliche und politische Fragen. Ich interessiere mich nicht so für die Außenwelt.
Haberl: Lesen Sie auch nicht Zeitung?
Mayröcker: Manchmal Die Zeit, wenn ich im Kaffeehaus bin, aber nur das Feuilleton.
Haberl: Krieg in Syrien, Euro-Krise, das kriegen Sie alles gar nicht mit?
Mayröcker: Ich nehme es wahr, lese die Überschriften, die ersten Zeilen, aber ich bleibe nicht dabei. Natürlich denke ich mir, wie entsetzlich das alles ist, aber im Grunde geht es mich nichts an. Da ist schon noch ein großes Stück Egoismus in mir. Dafür gehen mir Einzelschicksale umso näher.
Haberl: Zum Beispiel?
Mayröcker: Gesichter auf der Straße. Ich schaue sie an und versuche zu ahnen, was in den Menschen vorgeht. Oft spürt man schon am Gang, wie es einem Menschen geht. Bei mir im Haus lebt eine Frau, die nenne ich die kleine heilige Frau. Sie kommt aus dem Kosovo, ist eine ganz stille Person und haust in einer winzigen Wohnung. Wenn wir uns begegnen, umarmt sie mich immer. Der stecke ich ab und an ein wenig Geld zu, vor allem im Winter, wenn sie heizen muss. Ich konnte ja selbst nie vom Schreiben leben, kann es heute noch nicht.
Haberl: Aber Sie zählen zu den ganz großen Autoren des 20. und 21. Jahrhunderts, 2004 wurden Sie als Favoritin für den Literatur-Nobelpreis gehandelt.
Mayröcker: Aber meine Bücher hatten immer kleine Auflagen. Ein paar Tausend pro Buch vielleicht. Genau weiß ich es nicht. Die großen Herren bei Suhrkamp nehmen mich nicht so wahr, der Enzensberger kennt mich, glaube ich, gar nicht. Und gelebt habe ich vor allem von den Preisgeldern. Ich habe viele Preise bekommen.
Haberl: Ist es nicht kränkend, wenn man als hochgelobte Schriftstellerin seinen Lebensunterhalt nicht mit dem Schreiben bestreiten kann?
Mayröcker: Ich habe es immer hingenommen. Viele andere Autoren können vom Schreiben leben, auch mittelmäßige. Die Leute sagen, mein Werk sei schwierig, ich frage mich, was sie meinen, ich verstehe jeden Satz.
Haberl: Es ist schon so, dass Ihre Prosa große Konzentration erfordert. Sie erschließt sich nicht auf Anhieb, sabotiert die Erwartungen des Lesers.
Mayröcker: Das ist mir gar nicht bewusst, aber ich ahne, was Sie meinen. Und es ist ja nicht so, dass ich nicht verstanden werden möchte. Es gibt sogar Momente, in denen ich darüber nachdenke, was wohl die Leser zu einem bestimmten Satz sagen werden. Trotzdem würde ich ihn nie deswegen ändern. Er kann nur so lauten, wie er da steht. Mir geht es immer nur um die Sprache. Um ihre Funktionsweise, vor allem ihre Schönheit. Handlung, Botschaft, interessiert mich alles nicht.
Haberl: Ihr letztes Buch trägt den Titel Ich sitze nur grausam da. Wie kommt man auf so was?
Mayröcker: Es ist lächerlich, aber dieser Titel kam mir in den Sinn, als ich aus der Toilette gekommen bin. Auf einmal sehe ich diese Wörter vor mir, höre ihren Klang und weiß, das ist der Titel. Das muss gar keinen Sinn ergeben.
Haberl: Aber dann verkommt die Sprache doch zu einem sinnlosen Spiel.
Mayröcker: Sie ist kein Spiel, sondern bitterer Ernst. Es geht um die Wahrheit. Um die Wahrheit der Sprache. Und wehe, ich mache einen Fehltritt und weiche von ihr ab, das ist furchtbar. Zum Glück passiert es mir kaum noch.
Haberl: Was kann so einen Fehltritt auslösen?
Mayröcker: Wenn ich einen guten Schriftsteller intensiv lese, denke ich oft, der kann mehr als ich, und versuche, seinen Stil zu kopieren. Bei Derrida geht es mir oft so.
Haberl: Auch bei Ernst Jandl?
Mayröcker: Nein. Ernst hat ja vor allem Gedichte geschrieben. Er hat mir oft vorgelesen, was er geschrieben hat, und gesagt: „So, jetzt musst du kritisieren. Ist es gut? Soll ich was ändern?“ Mir hat fast immer gefallen, was er geschrieben hat, aber er hat mir nicht geglaubt und meinte, dass ich ihn nur trösten will.
Haberl: Was war das Faszinierende an ihm?
Mayröcker: Er war intellektuell, konnte aber trotzdem seine Gefühle ganz offen zeigen. Ich mochte immer gescheite Männer. Wenn wir Gäste hatten, hat fast immer nur er gesprochen, und ich konnte mich zurückziehen.
Haberl: Sie haben 23 Jahre als Englischlehrerin gearbeitet, sich aber mit 45 vom Dienst befreien lassen. Warum?
Mayröcker: Weil ich den Kindern nicht sagen wollte, was sie zu schreiben und denken haben. Ich glaube, dass mich einige von ihnen ganz gern hatten, aber den Beruf mochte ich nie. Am schlimmsten fand ich, dass ich vormittags arbeiten musste. Das ist meine beste Zeit, da will ich schreiben und musste doch jeden Tag mit der Tram nach Simmering rausfahren. Ich saß in dieser Bahn und hatte nur einen Gedanken: was ich in diesem Moment alles schreiben könnte.
Haberl: Wie sieht ein normaler Dienstag im Leben von Friederike Mayröcker aus?
Mayröcker: Es gibt verschiedene Varianten: Manchmal bin ich schon um fünf Uhr wach. Dann fange ich an, im Bett mit der Hand zu schreiben. Nach einer Stunde bin ich so kaputt, dass ich noch mal schlafen muss, bevor ich weiterarbeite. Manchmal habe ich beim Aufwachen Magenschmerzen und so hohen Blutdruck, dass ich nicht arbeiten kann. Dann weiß ich, der Tag ist verloren.
Haberl: Warum so früh?
Mayröcker: Meine Zeit ist der Vormittag, da ist der Traum der Nacht noch in mir. Ich träume in Wörtern und Sätzen, dann wache ich auf und muss alles aufschreiben. Damit nichts verloren geht, liegen Stift und Zettel neben mir auf dem Nachtkasterl, das sind riesige Zeichenblätter, die nehme ich quer und schmiere drauflos.
Haberl: Klingt wie ein Rausch.
Mayröcker: Das kann man schon so sagen. Ich bin beim Schreiben total von der Außenwelt abgeriegelt, fast high, als ob ich mich in tiefes Wasser begebe.
Haberl: Sind Sie glücklich, wenn Sie schreiben?
Mayröcker: Überglücklich. Schreiben ist reflektiertes Leben.
Haberl: Wie lange arbeiten Sie pro Tag?
Mayröcker: Drei bis vier Stunden, aber nur am Vormittag. Ins Bad gehe ich erst, wenn ich fertig bin, also gegen Mittag. Wenn mich jemand um halb zwölf anruft und denkt, ich bin gewaschen und angezogen, dann ist er falsch beraten. Erst wird geschrieben.
Haberl: Gibt es kein Frühstück?
Mayröcker: Das läuft nebenher. Ein Tee, ein Bröckerl Kuchen. Ich schreibe, während ich esse. Bei mir läuft auch immer die gleiche Musik, Bach, Satie, John Dowland, mehr CDs habe ich nicht. Am Nachmittag suche ich mir dann was zu essen, und weil ich nicht kochen kann, gehe ich in ein Beisl. Mit dem Taxi hin, zu Fuß zurück, damit ich ein bisserl Bewegung habe.
Haberl: Sie haben mal gesagt: „Ich komme beim Schreiben so nah an die Wirklichkeit heran, dass es mir den Atem verschlägt.“
Mayröcker: Wenn ich schreibe, kommt mir das, was ich beschreiben will, so nahe, als ob es mir gegenübersitzt. Oft heule ich beim Schreiben, weil ich mich so gut in alles hineinversetzen kann. Menschen, Tiere, ganz egal, mit allem, was mir nahe ist, kann ich mich völlig identifizieren. Ich bin dann dieses Ding. So viel Empathie kann auch belasten. Ich kann nicht sagen, dass es mir Freude macht, aber es befriedigt mich. Wenn ich durch die Straßen gehe, schauen mich alle Hunde an. Und jeder dieser Hunde ist mein Hund, ja eigentlich bin ich es selbst, der da traurig aus dem Fell rausschaut. Ich kann sehen, wenn Hunde weinen, egal ob Mensch, Tier oder Ding, alles spricht zu mir.
Haberl: Auch die Natur?
Mayröcker: Ja. Gestern habe ich einen riesigen Baum im Volksgarten gesehen, der war so majestätisch und überwältigend, dass ich fast heulen musste. Ich habe drüber nachgedacht, was zwischen diesen Zweigen alles lebt: die Vögel, die Käfer. Ich habe den Baum eine halbe Stunde angeschaut. Weil dieser Baum – der bin ich ja auch.
Haberl: Was würde passieren, wenn Sie eines Tages nicht mehr schreiben können?
Mayröcker: Ich würde depressiv werden. Ich bete jeden Tag, dass ich weiterschreiben kann. Ich arbeite seit Monaten an einem Buch, das ich einfach nicht abschließen kann. Es ist fertig, glaube ich, aber ich traue mich nicht. Ich bin außer Stande, mir vorzustellen, was danach kommt.
Haberl: Wovor haben Sie Angst? Vor dem Tod. Weil Sie nicht mehr da sind oder nicht mehr schreiben können?
Mayröcker: Beides. Wir wissen nicht, was nach dem Leben geschieht, aber wahrscheinlich kann man nicht das machen, was man gerne macht.
Haberl: Woran hängen Sie?
Mayröcker: An der Natur. Sie ist etwas, in das ich mich hineinsteigern kann, weil sie so uneitel ist. Bäume und Tiere sind so uneitel.
Haberl: Außer dem Pfau.
Mayröcker: Der ist auch uneitel. Es liegt in seiner Natur, ein Rad zu schlagen. Wirklich, ich bin verliebt in die Natur, vor allem in die Abfolge der Jahreszeiten. Immer wieder kommt ein Frühling, und noch ein Frühling, und noch ein Frühling und noch ein Sommer und noch ein Herbst. Ich lebe so gern. Der Abschied wird mir schwerfallen.
Süddeutsche Zeitung Magazin, 14.9.2012
Hans Ulrich Obrist spricht über die von ihm kuratierte Ausstellung von Friederike Mayröcker Schutzgeister vom 5.9.2020–10.10.2020 in der Galerie nächst St. Stephan
Friederike Mayröcker übersetzen – eine vielstimmige Hommage mit Donna Stonecipher (Englisch), Jean-René Lassalle (Französisch), Julia Kaminskaja (Russisch) und Tanja Petrič (Slowenisch) sowie mit Übersetzer:innen aus dem internationalen JUNIVERS-Kollektiv: Ali Abdollahi (Persisch), Ton Naaijkens (Niederländisch), Douglas Pompeu (brasilianisches Portugiesisch), Abdulkadir Musa (Kurdisch) und Valentina di Rosa (Italienisch) und Bernard Banoun – im Gespräch mit Marcel Beyer am 6.11.2021 im Literaturhaus Halle.
räume für notizen: Friederike Mayröcker: Frieda Paris erliest ein Langgedicht in Stücken und am Stück, Juliana Kaminskajas Film das Zimmer leer wird gezeigt. Die Moderation übernimmt Günter Vallaster am 29.1.2024 in der Alten Schmiede, Wien
Fest mit WeggefährtInnen zu Ehren von Friederike Mayröcker Mitte Juni 2018 in Wien
Sandra Hoffmann über Friederike Mayröcker bei Fempire präsentiert von Rasha Khayat
Im Juni 1997 trafen sich in der Literaturwerkstatt Berlin zwei der bedeutendsten Autorinnen der deutschsprachigen Gegenwartslyrik: Friederike Mayröcker und Elke Erb.
Protokoll einer Audienz. Otto Brusatti trifft Mayröcker: Ein Kontinent namens F. M.
Zum 70. Geburtstag der Autorin:
Daniela Riess-Beger: „ein Kopf, zwei Jerusalemtische, ein Traum“
Katalog Lebensveranstaltung : Erfindungen Findungen einer Sprache Friederike Mayröcker, 1994
Ernst Jandl: Rede an Friederike Mayröcker
Ernst Jandl: lechts und rinks, gedichte, statements, perppermints, Luchterhand Verlag, 1995
Zum 75. Geburtstag der Autorin:
Bettina Steiner: Chaos und Form, Magie und Kalkül
Die Presse, 20.12.1999
Oskar Pastior: Rede, eine Überschrift. Wie Bauknecht etwa.
Neue Literatur. Zeitschrift für Querverbindungen, Heft 2, 1995
Oskar Pastior: Rede, eine Überschrift. Wie Bauknecht etwa.
Neue Literatur. Zeitschrift für Querverbindungen, Heft 2, 1995
Johann Holzner: Sprachgewissen unserer Kultur
Die Furche, 16.12.1999
Zum 80. Geburtstag der Autorin:
Nico Bleutge: Das manische Zungenmaterial
Stuttgarter Zeitung, 18.12.2004
Klaus Kastberger: Bettlerin des Wortes
Die Presse, 18.12.2004
Ronald Pohl: Priesterin der entzündeten Sprache
Der Standard, 18./19.12.2004
Michael Braun: Die Engel der Schrift
Der Tagesspiegel, 20.12.2004.
Auch in: Basler Zeitung, 20.12.2004
Gunnar Decker: Nur für Nervenmenschen
Neues Deutschland, 20.12.2004
Jörg Drews: In Böen wechselt mein Sinn
Süddeutsche Zeitung, 20.12.2004
Sabine Rohlf: Anleitungen zu poetischem Verhalten
Berliner Zeitung, 20.12.2004
Michael Lentz: Die Lebenszeilenfinderin
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 20.12.2004
Wendelin Schmidt-Dengler: Friederike Mayröcker
Zum 85. Geburtstag der Autorin:
Elfriede Jelinek, und andere: Wer ist Friederike Mayröcker?
Die Presse, 12.12.2009
Gunnar Decker: Vom Anfang
Neues Deutschland, 19./20.12.2009
Sabine Rohlf: Von der Lust des Worte-Erkennens
Emma, 1.11.2009
Zum 90. Geburtstag der Autorin:
Herbert Fuchs: Sprachmagie
literaturkritik.de, Dezember 2014
Andrea Marggraf: Die Wiener Sprachkünstlerin wird 90
deutschlandradiokultur.de, 12.12.2014
Klaus Kastberger: Ich lebe ich schreibe
Die Presse, 12.12.2014
Maria Renhardt: Manische Hinwendung zur Literatur
Die Furche, 18.12.2014
Barbara Mader: Die Welt bleibt ein Rätsel
Kurier, 16.12.2014
Sebastian Fasthuber: „Ich habe noch viel vor“
falter, Heft 51, 2014
Marcel Beyer: Friederike Mayröcker zum 90. Geburtstag am 20. Dezember 2014
logbuch-suhrkamp.de, 19.1.2.2014
Maja-Maria Becker: schwarz die Quelle, schwarz das Meer
fixpoetry.com, 19.12.2014
Sabine Rohlf: In meinem hohen donnernden Alter
Berliner Zeitung, 19.12.2014
Tobias Lehmkuhl: Lachend über Tränen reden
Süddeutsche Zeitung, 20.12.2014
Arno Widmann: Es kreuzten Hirsche unsern Weg
Frankfurter Rundschau, 19.12.2014
Nico Bleutge: Die schöne Wirrnis dieser Welt
Der Tagesspiegel, 20.12.2014
Elfriede Czurda: Glückwünsche für Friederike Mayröcker
Manuskripte, Heft 206, Dezember 2014
Kurt Neumann: Capitaine Fritzi
Manuskripte, Heft 206, Dezember 2014
Elke Laznia: Friederike Mayröcker
Manuskripte, Heft 206, Dezember 2014
Hans Eichhorn: Benennen und anstiften
Manuskripte, Heft 206, Dezember 2014
Barbara Maria Kloos: Stadt, die auf Eisschollen glimmt
Manuskripte, Heft 206, Dezember 2014
Oswald Egger: Für Friederike Mayröcker zum 90. Geburtstag
Manuskripte, Heft 206, Dezember 2014
Péter Esterházy: Für sie
Manuskripte, Heft 206, Dezember 2014
Wilder, nicht milder. Friederike Mayröcker im Porträt
Zum 93. Geburtstag der Autorin:
Einsame Poetin, elegische Träumerin, ewige Kinderseele
Die Presse, 4.12.2017
Zum 95. Geburtstag der Autorin:
Claudia Schülke: Wenn Verse das Zimmer überwuchern
Badische Zeitung, 19.12.0219
Christiana Puschak: Utopischer Wohnsitz: Sprache
junge Welt, 20.12.2019
Marie Luise Knott: Es lichtet! Für Friederike Mayröcker
perlentaucher.de, 20.12.2019
Herbert Fuchs: „Nur nicht enden möge diese Seligkeit dieses Lebens“
literaturkritik.de, Dezember 2019
Claudia Schülke: Der Kopf ist voll: Alles muss raus!
neues deutschland, 20.12.2019
Mayröcker: „Ich versteh’ gar nicht, wie man so alt werden kann!
Der Standart, 20.12.2019
Zum 96. Geburtstag der Autorin:
Fakten und Vermutungen zur Autorin und Interview 1, 2, 3 & 4 +
Archiv 1, 2 & 3 + Internet Archive + KLG + IMDb + ÖM + Kalliope +
DAS&D + Georg-Büchner-Preis 1 & 2
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Galerie Foto Gezett +
Dirk Skiba Autorenporträts + Autorenarchiv Susanne Schleyer +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + Keystone-SDA +
deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Friederike Mayröcker: Standart ✝︎ NZZ 1 + 2 ✝︎ SRF ✝︎
FAZ 1 + 2 ✝︎ Tagesspiegel ✝︎ FAZ ✝︎ Welt 1 + 2 ✝︎ SZ ✝︎ BR24 ✝︎ WZ ✝︎
Presse ✝︎ FR ✝︎ Spiegel ✝︎ Stuttgarter ✝︎ Zeit 1 + 2 + 3 ✝︎ Tagesanzeiger ✝︎
dctp ✝︎ Kleine Zeitung ✝︎ Kurier ✝︎ Salzburger ✝︎ literaturkritik.de 1 + 2 ✝︎
junge Welt ✝︎ ORF 1 + 2 ✝︎ Bayern 2 1 + 2 ✝︎ der Freitag ✝︎ Die Furche ✝︎
literaturhaus ✝︎ WOZ ✝︎ NÖN ✝︎ BaZ 1 + 2 ✝︎ Poesiegalerie ✝︎
Friederike Mayröcker – Trailer zum Dokumentarfilm Das Schreiben und das Schweigen.
Fakten und Vermutungen zum Herausgeber + Hommage +
Symposion + DAS&D + Dissertation + KLG + IMDb + PIA +
Internet Archive + Kalliope
Porträtgalerie: Autorenarchiv Susanne Schleyer + Keystone-SDA +
Galerie Foto Gezett + Brigitte Friedrich Autorenfotos +
deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Thomas Kling: FAZ ✝ Der Freitag ✝ Perlentaucher ✝
NZZ ✝ Die Welt ✝ FR ✝ KSTA ✝ einseitig ✝ text fuer text ✝
Der Tagesspiegel ✝ Berliner Zeitung ✝ Neue Rundschau
Weitere Nachrufe:
Julia Schröder: gedicht ist nun einmal: schädelmagie
Stuttgarter Zeitung, 4.4.2005
Thomas Steinfeld: Das Ohr bis an den Rand gefüllt
Süddeutsche Zeitung, 4.4.2005
Jürgen Verdofsky: Unablenkbar
Tages-Anzeiger, 4.4.2005
Norbert Hummelt: Erinnerung an Thomas Kling
Castrum Peregrini, Heft 268–269, 2005
Thomas Kling liest „ratinger hof, zettbeh (3)“.


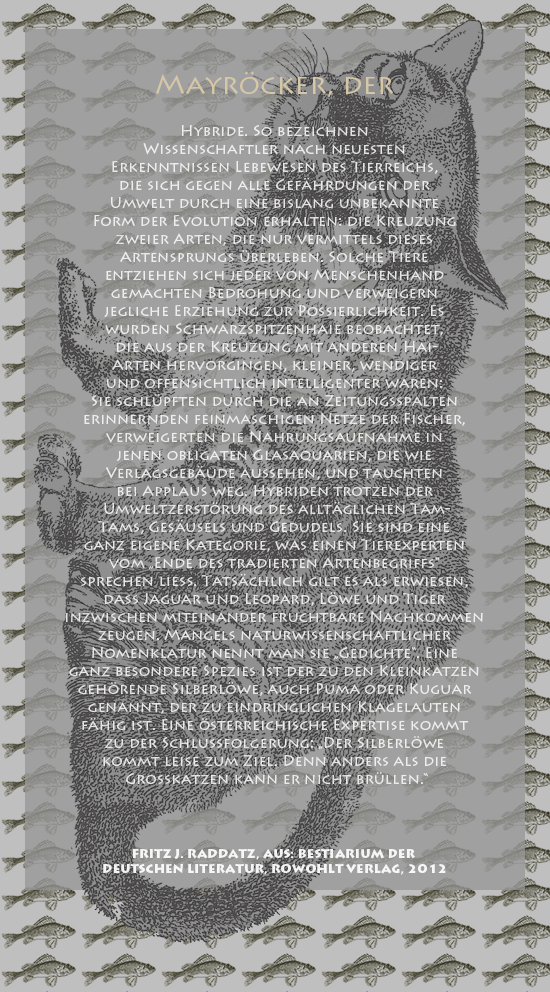
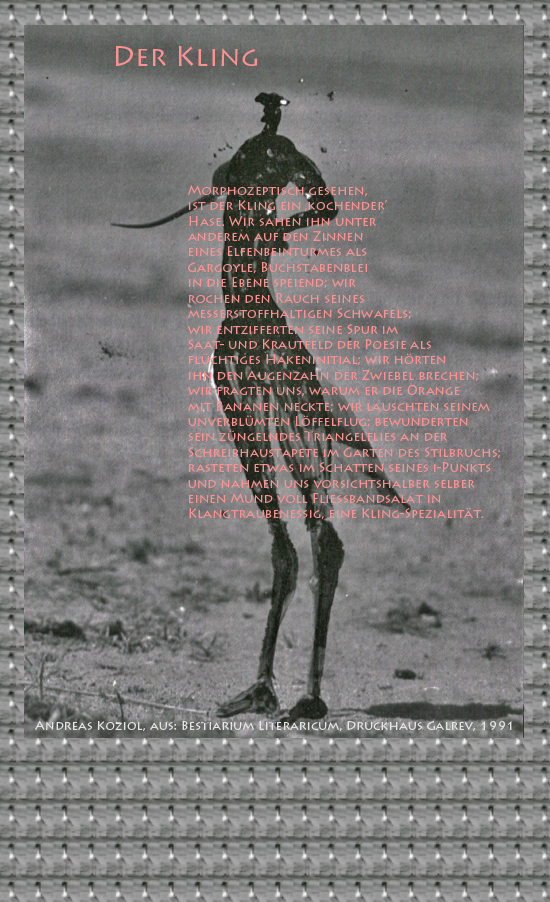












Selbstvorstellung
Anläßlich der Aufnahme in die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung
Durchschaubild Welt, Versuch einer Selbstbeschreibung
Die kleine Ansprache, die ich jetzt vor Ihnen halten darf, erbittet, trotz oder wegen ihrem eher ungewöhnlichen Ton Ihre Aufmerksamkeit – eigentlich sind es bloß hastige Andeutungen, Annäherungen an etwas, das ich selber kaum auszunehmen imstande bin -:
weil doch mein Leben sich so mächtig in diesen jüngsten fünfzehn Jahren zugespitzt hat nämlich auf diese Bleistiftspitze des Schreibens hin, kann ich wenig von meinen Anfängen berichten, außer daß ich, vom Vater geboren, in der Muttersprache gediehen, immer schon Schreckling gewesen bin, daß mir alles zum Schreckenswort, zum Schreckensgedanken geworden ist, und, weil der Schrecken so riesenhaft war, folgte kaum je eine Tat, und, wenn sie folgte, war sie tatsächlich nichts als eine Geste des Schreckens. Ich vollbrachte immer alles zum eigenen Schrecken, ängstigte mich noch im nachhinein. Doch die Natur hilft, wie die Kunst, Lineamente, Federstriche zu zaubern; Wahrheitssehnsucht und artistische Ver-Rücktheit meine Schreibantriebe von Anfang an. Also bin ich immer schon den Eingebungen meines Auges gefolgt und habe alles sogleich an die Wand meines Zimmers mit Bleistift gekritzelt, wie beim Vokabellernen das lernbeflissene Kind, wofür es mit sanfter Rüge bedacht wurde. Ich war weniger ein Schrei- als ein Schreib-Balg – der Beginn meines Schreibens plötzlich und stürmisch – schon in der Schule schrieb ich Aufsätze für mein Leben gern, wurde deswegen gelobt und zum Beispiel erhoben, worüber ich meist Scham empfand, aber ich wußte schon damals nicht woher ich es hatte, wollte es auch nicht wissen, ererbt wohl kaum. Ohne sonderliche Bemühungen um „die oft unsichtbaren Faden wodurch freiwillige Gedanken in einem Dichterkopfe zusammenhangen“ (Wieland).
Auch stand es immer nur mäßig gut um meinen Verstand, von Intelligenz gar nicht zu reden, das Gedächtnis schon im zarten Alter zerstückt und ruinenhaft, Wissen und Wohlverhalten hielten sich nie die Waage. (Während die Straßenbahn in die Station einfährt, fällt mir plötzlich, nach vierundfünfzig Jahren, der Anfang der ersten Lektion in meinem Französischbuch aus der Volksschule ein, die ich als siebenjähriges Kind auswendig lernte. Während ich aussteige, spreche ich aus dem Gedächtnis nach: Madeleine est une petite fille, elle est a la fenêtre, elle regarde la rue… hier endet der memorierte Film-)
1924, mein Geburtsjahr. Kafka stirbt, das Erste Manifest des Surrealismus wird veröffentlicht. Ich, unwissendes Subjekt, in eine wetterleuchtende Zeit gestellt, mit Liebe umhegt. Da standen die Großeltern von Mutterseite noch da, da standen sie Wache, bald verliert sich das Bild, auch die Geborgenheit, alles divergierte ja mehr und mehr, allgemein und persönlich, 1934 steht die Familie vor ihren eigenen Trümmern. Ich komme aus den Ruinen.
Meine Kometenschaft, ich meine Verwandtenschaft, regelte immer mein Geistesleben, meine Erinnerungen – gestochen scharf, eingepflanzt von Kindesbeinen an – was wurde mir alles eingepflanzt!, vor allem Redlichkeit, und die Lüge zu meiden!, auf das Schreibritual bin ich von selber verfallen (inwieweit dieses mit Redlichkeit und Lüge verflochten sei, und ob Schreiben gleich Fälschen sei, wage ich nicht zu beurteilen). Ich war ein gottgeweihtes Kind, die gegensprossigen Oblaten zergingen mir wie nichts auf der Zunge, ich stand ja inmitten von Monets Seerosen in Giverny in meinen Kindertagen, habe Perlen darin klingeln gehört und wie sie von Stufe zu Stufe tropften, da weinte ich viel.
Ich suchte die Unschuld in der Landschaft zurückzugewinnen, im Moosgrund die Menschenschatten, die mir während meines langen Lebens begegnet sind, deren Spuren ich aber größtenteils verloren habe, durch irgend Fehlgriff und -wort, oft mit größter Behutsamkeit bemühte ich mich, das Amüsement der anderen nicht zu zerstören, flüchtete in die Dunkelheit. Ich habe an der Unsterblichkeit zeitweise gezweifelt, bin immer noch unsicher.
Ich habe Nachsicht gelernt, ich habe Nachsicht geübt, bis zur Selbstverleugnung. Mit zunehmendem Alter eine unverächtliche Haltung allen Menschen, aller Kreatur, auch den Dingen gegenüber erworben, was mir auch schon zum Vorwurf gemacht worden ist der Kritiklosigkeit, weil es als indifferente Haltung der Welt gegenüber ausgelegt werden kann, aber ich erkenne zuweilen die Palette, ich entdecke das Wechselspiel der Farben, ich entdecke so viele Facetten, nämlich die Vielfalt der Dimensionen.
In den Kriegsjahren fuhr schon der Dichthammer auf mich nieder, dieses früheste Panorama, die Kriegsjahre, welche mich gleichermaßen beschädigt wie verschont hatten, habe ich wie hinter einer gläsernen Wand verbracht, ich schrieb im Verborgenen. Die solcherart mißlichen Lebensumstände: das war meiner Schreibarbeit günstig, oder wie Goethe sagt: „sollen die Menschen nicht denken und dichten, müßt ihr ihnen ein lustig Leben errichten“.
Aber ich wollte nie mit Schreiben meinen Unterhalt verdienen, darum verdingte ich mich – weniger einer Familientradition folgend als in die Fußstapfen des Vaterberufs tretend – zwei und ein halbes Jahrzehnt als Lehrperson, gegen mein eigentliches Trachten. Ja, wenn ich es jetzt bedenke, so arbeitete ich, indem ich in diesen ungeliebten Beruf gedrängt worden war, gegen mich selbst, gegen mein Wunschbild: das war einzwängend, das war verdunkelnd, das führte zu innerer Spaltung, zu Widersprüchlichkeiten, das machte mich abtrünnig, das preßte die Poesie in den wenigen freien Stunden aus mir heraus, ich war ein gleichgültiger widerwilliger Schulhalter, der möglichst schlau immer den kürzesten Weg einschlug und meist auch während der Unterrichtszeit herumkritzelte, was meine Lernknaben und -mädchen teils kommentarlos hinnahmen, teils höhnisch quittierten. So blieb ich allzu lange ein bloßer Schreibergeselle, Schreibergehilfe, Zögling der Poesie, und meine frischesten Jahre gingen darauf.
Schreibhaft wie leibhaft, als ich endlich im Jahre 1969 den Abschied nehmen konnte, wollte ich mich nur noch der Literatur widme, mit Leib und Seele nur das, nur noch schreiben!: mit einem Tintenfaß am Gürtel, wie Heinrich von Beringen es beschreibt, meine Schreibtasche stets bei mir tragend, würde ich nun jeden Tag herumlaufen, auch Notizbuch und Stift, und während beides der zitternden Hand entgleitet, zu Boden fällt, auf der Straße und die Umstehenden zum Staunen, zum mitleidigen Lächeln veranlaßt, würde ich über die Frage nachsinnen, ist die Schreibkunst eine Vernunftkunst, ist die Schreibkunst eine Empfindungskunst, ist die Schreibkunst eine Erfindungskunst, oder alles zusammen nicht, oder halbfremd, oder über Feld.
Vielleicht war es mir schon früh an die Stirn geschrieben: ein Feuermal, das im Laufe der Jahre, Jahrzehnte ausbleichte, ein Afrikakontinent, ein dunkler Fleck an der Stirn, mit dunklem Fransenhaar verhängt, und um der Irrbahn nicht zu entraten.
Eine alte Schreibkommode mit einem Aufsatz, also Sekretär, wie das gute Stück genannt wurde, alles vieldeutig in meiner Kindheit, ein Bösendorfer Konzertflügel, an dessen Taille geschmiegt ich mein ersten Schreibversuche unternahm, anstatt darauf, wie meine gütigen Eltern es gerne gesehen hätten, Diabelli-Etüden zu spielen, dieses Mobiliar, dieses würdige Inventar hat mich bis heute begleitet, verfolgt. Jedenfalls was den Flügel betrifft. Die prahlenden Notenhefte, die jetzt mit Schriftkürzeln gefüllt sind, die ich, sobald einige Tage verstrichen sind, kaum mehr entziffern kann, oder am Schreibgerät kauernd, vor meiner Schreib-Maschine, meine Schreibhand in der Mehrzahl, mit zehn Fingern sogar.
Ohne die Stadt, in der ich geboren wurde, sind die wechselnden Zustandsbilder meines Wesens nicht erkennbar. Und doch habe ich mich dieser geschichtsüberladenen Stadt nicht wirklich genähert, ich meine ihrer ihr anhaftenden Historie. Ich habe mich tatsächlich der Geschichte dieser Stadt zeitlebens verweigert, vermutlich weil ich historische und persönliche Zusammenhänge bestreite, vermutlich weil ich nach anderen, tiefergreifenden Verknüpfungen Ausschau halten will, von denen ich nur im Augenblick noch nicht weiß.
Wien ist eine Schreibstadt. Hier kann man verrückt werden. Hier kann man verrückt sein. Wien ist für viele Dichter zur Schreibstadt geworden, viele verrückte Dichter kommen aus Wien. Verrücktheit, verrückte Sicht ist eine der Voraussetzungen für Schreiben.
Und obwohl ich von dieser Stadt geprägt worden bin, gibt es darüber noch die Ortlosigkeit, den utopischen Wohnsitz: die Deutschsprachigkeit: meine deutschsprachige Poesie. In keiner anderen Sprache – auch wenn ich sie, wie das Englische, leidlich beherrsche – könnte ich mich entfalten, könnte ich schreibend mich verwirklichen.
So ist mein Schreibgebrauch von speziellerer Art als mein Sprechgebrauch. Überhaupt wünsche ich mir für meine mir noch verbleibende Lebenszeit, sie mit schreiben, lesen, schauen und schweigen verbringen zu können: der Omnipotenz des Ekels, der Leere, der Verzweiflung, der Angst zu entgehen. Also nicht so sehr schreiben als brüten. Zu lesen zu fleiß. Damit ich endlich imstande bin, die Titel jener Bücher im Gedächtnis zu behalten, mit welchen ich mich gerade beschäftige, um nicht zu wiederholten Malen in die unangenehme Situation zu geraten, auf die Frage, was ich gerade lese, keine Antwort zu wissen. Nämlich das Brüten ist eine Kunst frei von Gewicht – daß ich nicht von meinem Gesicht verliere, wenn ich mich Über die spiegelnde Eisfläche beuge!, wenn es fällt, wenn es hinfällt, wenn es niederfällt vor dem heiligen Geist, an welchen ich immer schon glaube, ja wie die Augen, die jetzt vor dem Hirtenfeuer gaukeln in meinem Zimmer.
Wie ein Garten geflochten mit Blumen ihr Angesicht: so warte ich, so stelle ich mir immer die Eingebung vor, aber sie kommt selten, erscheint mir so selten. Ich falle sogleich aufs Knie, Amaryllis an ihrem Scheitel, die Sonne fällt. Meine Sonne fällt: meine Eingebung fällt vor mich hin und fällt in mich ein, und ich sitze als Greis in schwalbenähnlicher Gestalt auf der Bettkante frierend in Fieberglut – ob Vers oder Prosa, darauf kommt es nicht an. Es kommt nur darauf an, wie sie angezogen sind, ich meine die Worte: die mir meine Eingebung eingibt, welche Art Knochenwerk sich da herausbilden will, darauf kommt es an, in Böen wechselt mein Sinn. Meine Erleibung ist meine Erleidung bis ich nicht mehr weiter kann: der Berg ist sehr steil, auch das kleine Stoßgebet hilft nicht weiter, Herzwiderstand kalbt. Vielleicht ist Dichten wirklich ein Übermut, wie Goethe zu bedenken gibt. Also ein unausgesetztes Rezipieren, ein unausgesetztes Registrieren der schaubaren, hörbaren Welt.
Immer wieder stellt sich mir die Frage, warum es heute als fragwürdig, ja anachronistisch gilt, von Eingebung, von Ingenium zu sprechen, man spricht lieber davon, daß es jedermann gegeben ist, einen Text herzustellen. Ich melde meine Bedenken an.
Eine weitere Frage: warum fühle ich mich geneigt, das Gedicht, den Prosatext, den Bühnendialog, die mich zum Schmunzeln bringen, die in mir das zwerchfellerschütternde Lachen erzeugen, nicht eingliedern zu wollen in meine schöne Literatur, in die von mir bevorzugte Literaturart, warum drängt es mich, solche Texte außerhalb des magischen Kreises zu sehen, sie auszuweisen, abzustellen, beiseitezurücken. Eine Entsprechung scheint mir bei Roland Barthes zu finden: er schreibt in seinem Buch Die helle Kammer: „Humor mag ich weder in der Musik noch in der Photographie“.
Ich habe keine Zeit zu verlieren, ich geize mit jeder Stunde, alles möchte ich gleichzeitig tun, ein Buch schreiben an einem einzigen Tag. Ein Quell der Erfahrungen, Grenzüberschreitungen ist mir das Schreiben geworden. Ein Lehrmeister ist mir das Schreiben, das Schreiben ernährt mich im Geiste, durch mein Schreiben erfahre ich über mich selbst, über die Natur und die Welt und die Menschen. Und die Wildheit wird immer umfänglicher, immer kalkulierter. Was die Intuition an Wahnwitz und Ungestüm wagt, wird vom Verstand gleichzeitig oder im nachhinein bedachtvoll, präzise und streng in wahrheitstreue Form gebracht, fixiert und versiegelt. So wird Ekstase zu einer Disziplin. Trotzdem hat es seine Richtigkeit, wenn ich sage: ich reagiere fast nur vom Gefühl her. – (Wie doppelwertig hört sich eine solche Äußerung an: wird sie von einem schreibenden Mann, wird sie von einer schreibenden Frau, wie eben, vorgebracht: wie verändern sich auf der Stelle Qualität und Glaubwürdigkeit der Behauptung!)
Die neue Literatur, die experimentelle Poesie, der Dadaismus, der Surrealismus damals: sie waren und sind es noch: Angriffe auf die Grundhaltungen, auf die Vorstellungen des sogenannten guten Geschmacks unserer zivilisierten Gesellschaft. Sie enthüllen eine neue rätselhafte Sprachwelt, was Verwirrung stiftet, Staunen erregt, den Stachel vorantreibt.
Beckett und Brecht, Roland Barthes und Breton, Max Ernst und Jean Paul, Hölderlin, Arno Schmidt, Michaux, Claude Simon und Duras – schon umkreisen, umschweben sie mich in meinem Zimmer, meine Genien, meine Blutsbrüder. Und ich spüre, wie sie mir winken, ihre Geheimnisse zuflüstern, mir, diesem Schwächling, diesem Schweiger, diesem Wetterdichter mit Wandertasche und Distelkopf, diesem VogeIbekümmerer, diesem Fremdling der Welt, mir, dieser fragwürdigen Marginalexistenz. –
Von jungen Vögeln heißt es in einem alten Sprachgebrauch: Sie dichten, wenn sie anfangen zu singen, wenn sie ihre Stimme mit leisem Gesang versuchen.
Friederike Mayröcker 1985, aus: Michael Assmann (Hrsg.): Wie sie sich selber sehen. Antrittsreden der Mitglieder vor dem Kollegium der Deutschen Akademie, Wallstein Verlag, 1999.