Friederike Mayröcker: Mein Arbeitstirol
GEBIRGE IM KRANKENHAUS
für Ernst Jandl
in den Augen das Blau
aber es regnet so viel
und die Speise schling ich hinunter
dieses Blau in den Augen
aber es regnet so viel
allein in der Kammer
so allein in der Kammer so getrent von der Liebe
so allein in der Welt : kein Geschmack an der Stille
aber der Phlox in den Gärten
weht in der Nacht
Inhalt
Friederike Mayröcker hat für diesen Band neue Gedichte aus den letzten Jahren zusammengestellt. So entsteht eine Art lyrisches Tagebuch, ein Bilder-Buch der Dichterin mit dem „euphorischen Auge“. Oft sind es kleinste Anlässe, Anemonen auf einer Wiese, Schnee vor dem Fenster, das Gedicht (oder Bild) eines Kollegen, die in Friederike Mayröcker ein Sprechen provozieren, in dem sie ins Grenzenlose ausschreitet, sich die Welt verwandelt in die eigenen Worte und die eigenen Findungen in die Welt, „beim Gedichteschreiben ganz eingesponnen in das Heilige in das Wohlwollende, Sprengfreude in mir“.
Suhrkamp Verlag, Ankündigung
Ein herzzerreissend poetisches Larifari
Seit einem halben Jahrhundert knüpft Friederike Mayröcker an einem magischen Sprachteppich, an dem jede neue Masche ebenso kunstvoll wie zufällig aussieht. Wer dieser Autorin vorwirft, sie gehe zu willkürlich um mit ihrem Garn, sollte sich nach den Gründen für die Sogwirkung fragen, die seit Jahrzehnten von ihren Texten ausgeht. Zwar zieht sie nicht gerade die Massen an, aber doch eine ansehnliche Schar von hellhörig Lesenden. Ihren ersten Prosaband nannte sie mit listigem Understatement Larifari (1956), ihre letzte Gedichtsammlung hiess sibyllinisch Notizen auf einem Kamel (1996). Das neueste Buch trägt den schönen und wohl unerklärlichen Titel Mein Arbeitstirol, enthält Lyrik aus den letzten Jahren und überrascht nur angesichts des Alters der Autorin, denn ihre grandiosen Gedankensprünge und Wortschöpfungen sind zappelfrisch wie eh und je.
Kunst der Assoziation
Vor zwanzig Jahren, als Friederike Mayröcker noch gar nicht so alt war, schrieb sie in der halluzinatorischen Prosa des Bandes Reise durch die Nacht von ihrer Vermutung oder Hoffnung, „dass die Assoziationskraft mit zunehmendem Alter eher zu- als abnimmt“. Jetzt, mit bald 80 Jahren, hat sie das wieder einmal bestätigt. Denn eines der Wunder von Mayröckers Poesie liegt in der Kunst der Assoziation, durch die sie der Sprache Verblüffendes entlockt, was den Leser zwar verstören, aber ihm seinerseits auf assoziative Sprünge helfen kann. Ein weiteres Mirakel ist ihr beharrlich weltabgewandtes Wandeln in einem privaten Zettelhain, jetzt genauso wie schon in den Jahrzehnten der allgemeinen ideologischen Schaustellerei. Doch bei aller Freiheit von Ideologie ist in ihren Gedichten erstaunlich viel von der Wirklichkeit die Rede, vom häuslichen Alltag in ihrem „Elendsquartier“, vom Hier und Jetzt der körperlichen Hinfälligkeit, freilich nie vom letzten Schrei der Weltgeschichte.
Auch Mayröckers neueste Gedichte haben eine ganz eigene intime Verbindung mit der Welt. In ihren versponnenen Kopfspielen holt sich die Autorin allerlei Kunstsparten und Dichterkollegen in ihre legendäre Wiener Wohnung, eine papierene Schreibhöhle von rigorosem Chaos (in einer Sondernummer der Zeitschrift Wespennest 1999 bestens dokumentiert). Der Dadaismus und Beckett sind oft bei ihr zu Gast, noch häufiger Hölderlin und der Surrealismus. Aber auch mit jungen Poeten hält sie zitierend Zwiesprache, mit Thomas Kling, Franz Josef Czernin, Raoul Schrott, als „grüne Lichtburschen“ sind vielleicht auch sie gemeint. Auf diese Weise ist auch ihre Dichtung welthaltig, Raum und Zeit haben eine präzise Rolle (die Entstehung der einzelnen Gedichte zwischen 1996 und 2001 ist genau datiert). Malerei und Literatur aus allen Weltgegenden sind ständig präsent. Und immer wieder bringt sie die eigene Intimität ins Spiel der Worte. Doch keine Spur von den sogenannten grossen Ereignissen, kein Hauch von Politik aus diesen aufgeregten österreichischen Jahren, nicht einmal ein direkter Hinweis auf den Büchner-Preis, den Friederike Mayröcker im Oktober 2001 spät, aber doch bekommen hat.
In fabelhafter Distanz geht auch der September 2001 in ihr vorbei: Am 8. schreibt sie das Gedicht „Luftseele undsoweiter“, das mit einem „Mund“ und einem „Mond“ beginnt und mit „Päonien“ endet. Zehn Tage später, eine Woche nach den Attentaten in Amerika, schreibt sie „Aspekte der Malerei“, ein Gedicht von herrlich trostloser Hinterhofromantik:
und jeden Tag der Blumenstrauss
im Milchglasfenster vis-à-vis
ich ahne Tulpenrot in altem Blechgeschirr…
Vom selben Tag ist aber auch ein Gedicht ohne Titel, das anfangs so harmlos spricht über „diese weisslichen Büsche vom Fenster aus“, dann von der Freude „beim Gedichteschreiben“, schliesslich noch einmal von einem „Päonienfenster“, dann jedoch brüsk und kursiv endet: „… die / Welt zusammengebrochen.“ Um welche oder um wessen Welt es sich handelt, wird nicht gesagt. Solche Zurückhaltung ist in jedem Fall bewundernswert, besonders aber in jener Zeit kurz nach dem 11. September, als die schreibende Welt sich in eine Erklärungshysterie hineinsteigerte und alle Meinungsdämme brachen. Der wie üblich überraschende Abschluss dieses Gedichts zeigt abermals, dass Friederike Mayröckers Mitteilungsbedürfnis nicht von dieser Welt ist.
Ein ganz gravierend irdisches Ereignis ist jedoch deutlich in der Chronologie der Entstehung dieser Gedichte ersichtlich, allerdings durch eine Leerstelle: Nach dem Tod von Ernst Jandl im Juni 2000 ist eine Lücke von vier Monaten, jene Trauer- und Schreckenszeit, in der das separat veröffentlichte Requiem für Ernst Jandl (2001) entstand. Mayröcker und Jandl waren im Leben ein Paar und in der Kunst siamesische Zwillinge. Ihre Werke wären ohne den Zwilling nicht so geworden, wie sie sind. Er sagte, er wäre ohne sie verdammt gewesen „zum Kinderwagenschieben“ und zu einer mittelmässigen Existenz. Sie nannte ihn schon in früheren Texten ihren „Vorsager“ und ihren „Ohrenbeichtvater“. Sie hat ihn in alle ihre Bücher einbezogen. Hier aber, in dem neuen Band Mein Arbeitstirol, geht eine Schwellenlinie durch den Textkorpus, etwa in der Mitte des Buches. Sie teilt diese Gedichte in diesseits und jenseits von Jandls Tod.
Ewige Finsternis
Als Jandl im Sterben liegt, Anfang Juni 2000, schreibt Mayröcker: „ach ich KLEBE an diesem / Leben an diesem LEBENDGEDICHT“. Dann folgt die besagte Lücke von vier Monaten. Danach geistert „ER“ noch deutlicher als früher durch ihre Verse, entstehen noch mehr Gedichte in seinem Angedenken, wie diese private Erinnerung an ein Weltereignis:
SONNENFINSTERNIS ’99 / BAD ISCHL
für Ernst Jandl
erst wieder in 700 Jahren sagt ER
1 Jahrhundert Ereignis sagt ER
solltest du nicht versäumen sagt ER
auf dem Balkon ER setzt die Spezialbrille auf
verkrieche mich mit dem Hündchen in der Schreibtischnische
die Vögel verstummen –
1 Jahr danach SEINE ewige Finsternis
Nach dem grossen Verlust sind die Gedichte noch häufiger ausdrücklich ihm gewidmet, wie zur Demonstration, dass auch der Tod seine Grenzen hat. Die Widmungen waren immer schon ein eigentümlicher Aspekt in Mayröckers Lyrik. Sie dienen der Autorin zur Hervorhebung des Intimen, gleichzeitig aber auch zur Verbindung des lyrischen Subjekts mit der Aussenwelt, die mehr und mehr zu verschwimmen droht. So kam es im Lauf der Jahre zu einer wahren Widmungswut, die das Rätsel mancher Texte noch verschärfte, denn kaum jemand weiss, wer „Sara Barni“ ist. Es sollte den Leser nichts angehen, doch steht es auch für ihn da. Und so mag er rätseln, wer denn dieser „Hans Haider“ ist und was es auf sich hat mit dem „Univ. Prof. Herbert Zeman“. Solche Intimisierung kann rasch an befremdliche Kumpanei grenzen, so wie es auch nur ein kleiner Schritt ist vom poetisch Wunderbaren zum Wunderlichen. Aber im Fall von Ernst Jandl ist es um diese Zueignungen anders bestellt, weil er mit den Texten in jeder Hinsicht was zu tun hat. Manche Mayröcker-Gedichte hat er derart mit seiner erdbodenhaften Strenge beeinflusst, dass es auch ohne Widmung sichtbar ist:
WENN ICH VOR IHM GESTORBEN WÄRE
an zu weinen fing
der Mann Fink / an zu weinen
es wäre im Frühjahr gewesen während
alle Bäume jauchzten (Fink Amsel Fink)
er hätte geweint in seinem schönsten Kleide
an meinem Grabe und wäre mir nach
weil in die Tiefe zog es ihn
Um die letzten Dinge geht es in den besten Gedichten dieser Sammlung, um die Frage „wirst auferstehen je? werden / einander wiedersehen wir?“ Leider kennt sie seine Antwort. Ernst Jandl und Friederike Mayröcker haben die Rollen des mythischen Paars vertauscht: Orpheus ist vorausgegangen, hat nie an eine Wiederkehr, nicht im Geringsten ans Jenseits geglaubt. Eurydike weiss das, will es aber nicht glauben in ihrem herzzerreissenden Gesang.
Franz Haas, Neue Zürcher Zeitung, 26.6.2003
Zauber der Alltäglichkeit
Es ist ein zauberhaftes Buch der Mayröcker, beinahe überirdisch. Themen des Alltags, oft beinahe banale Dinge nimmt sie auf und verwandelt sie in Kunstwerke, mit wunderbaren Wortschöpfungen und verklärt durch Liebe und Weisheit. Die Gedichte sind chronologisch sortiert, so daß der Bruch nach dem Tode ihres großen Freundes Ernst Jandl deutlich wird. Es ist ein Bruch, der das Thema Abschied noch stärker betont. Mayröckers Kreativität und ihr sensibler Umgang mit der Sprache haben nicht gelitten. Lassen Sie sich anrühren vom „sterbenden Azaleenbäumchen in der Küche“, und vom vorerst letzten Gedicht für Ernst Jandl: „die Küsse auf dem Campingtisch“. Es lohnt.
Johannes Wöstemeyer, amazon.de, 17.7.2003
Filigrane Wortwebereien
Worte, so hintereinandergereiht, dass sie abhängig von der Verfassung des Lesers stark unterschiedliche Wirkungen erzielen, das ist Mayröckers Arbeitstirol. Da sind feinste Webearbeiten aus zarten Worten, die bei einem missgünstigen Blick, einer momentanen Aversion zur Bedeutungslosigkeit zerfallen können. Mit Reimen, mit Gedichten hat die Lyrik Mayröckers wenig zu tun, melodoisch ist sie dennoch, man muss nur genau hinhören. Die Gedichte sind neben Ernst Jandl verschiedenen Personen zugedacht, von denen ich einige im Verdacht habe, der Phantasie der Autorin entsprungen zu sein, sie sind ein Teil des Wortteppichs, auf dem sich der Leser räkeln kann. Mein Prädikat: ganz besonders wertvoll.
Till Seidler, amazon.de, 1.11.2003
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Dieter M. Gräf: Diese Fähigkeit, unerschöpflich neu wahrzunehmen
Basler Zeitung, 14. 3. 2003
Samuel Moser: Gnadenlose Wörtlichkeit
Der Standard, 3. 5. 2003
Franz Haas: Ein herzzerreissend poetisches Larifari
Neue Zürcher Zeitung, 26. 6. 2003
Nico Bleutge: Die kleinen Intervalle zwischen unseren Zungen
Süddeutsche Zeitung, 30.6.2003
Nico Bleutge: Bouquet aus Sprachen
Stuttgarter Zeitung, 8. 8. 2003
Rolf-Bernhard Essig: Ausgespuckte Tage
Die Zeit, 10. 7. 2003
Ulrich Weinzierl: Es scherbt der Knochen spinnenkraus
Die Welt, 26. 7. 2003
Michael Opitz: Das Staunen, das Vermissen
Neues Deutschland, 1. 8. 2003
Andreas Kohm: Die Welt in Sprache verwandeln
Mannheimer Morgen, 11. 8. 2003
Martin Reiterer: Friederike Mayröcker: „Mein Arbeitstirol“
Wespennest, Heft 132, 2003
Harald Hartung: Wie süß sind verständliche Worte
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 26. 11. 2003
Bildnisse von Dichtern – Friederike Mayröcker
Sie ist nie am blauen Nil gewesen, nie in hängenden Gärten spazierengegangen, jedenfalls hat man keine Spuren von ihr gefunden. Allerdings hinterläßt sie auch keine Spuren. In Paris aber war sie, das wissen wir. Sie war Platzanweiserin in einem Kino, mein Großvater, der damals einen Zylinder trug, hat sie gesehen. Sie trug ein kurzes, wippendes Röckchen und knickste, falls wir die krakelige Schrift meines Großvaters richtig entziffern. Sie sah sich das Programm durch den Spalt des Vorhangs an. Manchmal stieß sie kleine Schreckensschreie aus. Am besten gefiel ihr, daß der Klavierspieler so schön spielte. Sie sang dann leise mit. Mein Großvater kniff sie einmal in die Wange und sagte Charmant, très charmant, aber dann wurde doch nichts daraus. Später, als wir dann selber ins Kino durften, haben wir sie in einem Film gesehen, sie ritt zusammen mit Rodolfo Valentino auf einem Elefanten durch Indien und stürzte in eine mit Bambusstäben getarnte Falle. Der Film ist inzwischen unauffindbar. Sie wurde auf dem Sklavenmarkt verkauft. Man weiß nicht, was aus ihr geworden ist. Wir haben Hunderte von Stummfilmen angesehen und Tausende von Asienforschern befragt. Manche erinnern sich dunkel an ihre Stimme. Es gibt eine alte Platte von ihr. Man muß sie ganz laut abspielen, dann hört man ein fernes Zwitschern darauf. Es ist unendlich süß, ein großes Sehnen packt einen. Schnüffelnd steht man auf und gibt seinen trockenen Topfpflanzen Wasser. Auf der Plattenhülle sieht man sie, auf einem Foto, in weißen Kleidern in einer Hängematte liegend. Sie ist ganz jung, sie trinkt einen glühenden Kaffee und schaut in die Kamera. Jünglinge, die sonst nur Bilder von Sportlern sammeln, starren minutenlang auf das Bild, stumm. Wie die unbekannte Frau auf dem Bild machen sie mit der Hand eine Muschel und halten sie ans Ohr. Sie hören, durch eine ferne Brandung hindurch, einen Gesang, den sie aus einem sehr viel früheren Leben kennen, einem, in dem sie auf Mammuts sitzend durch Lianen ritten.
Urs Widmer, manuskripte, Heft 47/48, 1975
Wie man den Mainstream sabotiert
– Eine kurze Betrachtung zum langen Werk der Friederike Mayröcker. –
Vielleicht sollte ich damit beginnen zu beschreiben, wo ich meine Betrachtungen zu einer der überzeugtesten Verteidigerinnen des Glaubens an die Sprache unter den zeitgenössischen österreichischen Schriftstellerinnen und Schriftstellern verfasse. Der Ort heißt Gargellen, es ist ein alpines Dörfchen, im malerischen Montafon gelegen, der bergigen Landschaft am westlichen Rand von Mayröckers Land. Man würde nicht erwarten, sie hier anzutreffen, denn Mayröcker ist ein durch und durch urbaner Mensch, tief verwurzelt in Wien, selbst wenn sie mit dem Ursprung ihres Schreibens pastorale Erinnerungen verbindet. So saß sie als Sechsjährige einmal an einem Brunnen im niederösterreichischen Dorf Deinzendorf und spielte auf ihrer Harmonika; Mayröcker assoziiert diese ein wenig melancholische Szene, diese „Ur-Idylle“, wie sie es nennt, mit genau jener Stimmung, die seitdem ihr Schreiben beeinflusst.
Nein, das winterliche Gargellen wäre ganz und gar nicht Mayröckers Ort, mit seinen Brigaden von teuer ausgerüsteten Schifahrern, die einander wie Kühe beim Almauf- und -abtrieb folgen, ihre Montafoner Kartenschlüssel und elektronischen Tickets um den Hals tragend wie Symbole tonloser Kuhglocken, während sie auf dem Weg zur hyper-modernen Seilbahnstation sind, die die Schifahrer hinauf in den Tiefschnee-fun park und zu den Abfahrten auf einer alpinen Hochebene bringt, die den passenden Namen Schafsberg trägt.
Oder sind wir hier doch schon am Beginn eines Mayröckerschen Satzes angelangt, der durch seine reichhaltige Textur genau jenes tiefe Eingebundensein der Autorin in seine Umwelt zeigt? Mayröcker würde jedenfalls, wäre sie hier in Gargellen, über diese höchst absurde Form der Massenbewegung aus der Perspektive der Einzelgängerin schreiben, vielleicht einer Gehbehinderten, einer begeisterten Nicht-Schifahrerin, einer auf irgendeine bestimmte Art Verletzten oder einer Person, die mitten unter diesen Sportfanatikern mitspaziert, allerdings als Außenseiterin in langem schwarzem Mantel mit einem langen schwarzen Schal und einem schwarzen Umhängetäschchen, die französische Baskenmütze nicht zu vergessen.
Die zuvor angesprochene Machart der Texte Mayröckers erinnern die Leser an Stücke eines dichten Textilgewebes mit intrikaten Mustern, aber ohne eine Stickerei, die es einfasste; sie selbst verweist auf den Umstand, dass ihre Mutter handgeknüpfte Teppiche hergestellt habe. Während man diese Texte liest, ist man sich ihrer Stofflichkeit, ja materiellen Textur bewusst. Mayröckers Worte und Sätze wollen von den Augen und Händen der Leser berührt werden. Diese Autorin respektiert die Realität der Worte, ihre Präsenz und ihr Verlangen danach entweder autonom oder abwesend zu sein; sie illustriert den Prozess linguistischer Formationen und glaubt daran, dass Worte eine Eigendynamik entwickeln können. Anders als Ernst Jandl, mit dem sie den größten Teil ihres Lebens verbrachte, ist Mayröcker nie bereit gewesen die Verständlichkeit der Wörter zu opfern. Sie weigerte sich ein Wort aufzulösen und seine Klänge zu isolieren, wie es etwa in Jandls sogenannter ,Konkreter Poesie‘ der Fall war.
Immer wieder hat Mayröcker betont, dass sie nie versucht war die Grenzen der Sprache zu überschreiten; sie akzeptiert die Beschränkungen der Sprache, reizt aber jede noch so kleine Möglichkeit aus, die dieses Ausdrucksmedium ihr bietet. Ihre Originalität und ihre meisterhafte Verwendung des (indirekten) Zitats sind oft kommentiert worden. In ihren Texten finden wir zum Beispiel Baudelaire in der Mundhöhle; und mit Flaubert führt sie Notizen auf einem Kamel durch, aber nicht auf einer Reise durch Ägypten, sondern während einer Meditation über die Stadtwüste Wien.
Mayröcker verdankt der Romantik ebenso viel wie dem Surrealismus und dem Erbe der Wiener Gruppe mit ihrem Ethos und Pathos der ständigen, innerlichen Revolution. Sie scheint den Glauben an eine ihr mögliche Sabotage des Mainstream und eine Kreation der perfekten Verbindung von innersten Gefühlen und poetischem Ausdruck zu brauchen. Mayröcker hat erklärt, dass die sinnliche Wahrnehmung die Grundlage ihres Schreibens darstelle. Sie beschreibt sich selbst als einen „Augen- und Ohrenmenschen“, mit anderen Worten, als jemanden, die gänzlich von visuellen Bildern und auraler Wahrnehmung abhängig ist.
Gesprächshalber hat Mayröcker eingeräumt, in ihren Arbeiten jüngeren Datums versucht gewesen zu sein, „Mainstream zu machen“, aber ergänzt, dass dieses Ansinnen „immer wieder sabotiert“ werde „durch ganz winzige experimentelle Punkte und Einschübe“. Mayröcker verdeutlicht, dass es sich bei diesem Umgang mit Mainstream und dessen Sabotage für sie um ein prinzipielles poetologisches Phänomen handelt:
Es ist auch beim Gedichteschreiben nicht anders. Wenn ich anfange, an einem Gedicht zu arbeiten, dann erscheint mir das wie eine ganz gerade Linie. Und dann werden aber Punkte hingepfeffert. Ich begebe mich auf Abwege des Umbruchs und des Umschwungs. Das macht dann den Reiz des Gedichtes aus, das anfänglich als sehr verständlich erscheint. Wenn man es aber dann genauer anschaut, dann ist es in Wahrheit ganz anders.
Es scheint nicht verfehlt, diesen sabotierenden Ansatz als Merkmal im Schreiben der österreichischen Post-Avantgarde zu bezeichnen. Adam Kirsch etwa spricht vom „extravaganten Akt der Sabotage und Selbstsabotage“ in den Texten Thomas Bernhards. Verwandtes trifft für Peter Turrini zu. Im Sabotieren unterläuft der Text bestimmte Verstehenserwartungen, legt sich quer zum bloßen Textkonsum, versinnbildlicht etwa in Ilse Aichingers Erzählung „Der Querbalken“, über die Wolfgang Hildesheimer befand, dass in ihr die Frage Protagonistin sei. Und das scheint das Kriterium für sabotierendes Schreiben zu sein, nämlich die Ermächtigung der Frage, scheinbar konterkariert durch die von Mayröcker paradox behauptete „Askese der [sprachlichen] Maszlosigkeit“. Mayröcker sabotiert alle an die Literatur herangetragenen sinnstiftenden Erwartungen durch ein Verfahren, welches den Text immer wieder von neuem anfangen lässt. Beatrice von Matt spricht von Mayröckers vibrierenden Sprachkörpern, die aus „Wörtern mit glühenden Rändern“ bestehen.
„Es gibt einen Wunsch, zu erzählen, gleichzeitig aber auch den Wunsch, das Erzählen zu sabotieren. Ich bin keine Autofahrerin, aber wenn ich eine wäre, dann würde ich schlecht Auto fahren. Ich würde abwechselnd ganz rasch fahren und dann wieder ganz langsam, gab Mayröcker in besagtem Interview, ihrem poetologisch aufschlussreichsten, zu Protokoll. Beschleunigung und Entschleunigung als Mittel der Sabotage – in die Sprachzeichen Mayröckers umgesetzt schärft das den Blick auf den ,Sinn‘ ihrer Verwendung der Majuskel. Sie bremst das lesende Auge, zwingt zur Konzentration, bringt Wortmuster hervor und läßt das sprachliche Umfeld nur umso diffuser erscheinen. Diese Texte prägt eine mehr oder weniger diskrete „Hinterlist“ (Konstanze Fliedl).
Sucht man dagegen nach Spuren utopischen Denkens in diesen Texten, was in der heutigen Zeit für Intellektuelle und Künstler geradezu rufschädigend ist, so würde ich Mayröckers ungebrochenes Vertrauen in die Kraft der Sprache sowie in der beunruhigenden Qualität innerer Rebellion nennen, etwa gegenüber der Arroganz staatlicher Autorität, aber auch gegenüber der großen Leere, die das (post-)moderne Individuum prägt.
Man kann Mayröckers Texten ihre Suggestivkraft schwerlich absprechen; sie absorbieren einen, sind fast magisch zu nennen. Deswegen könnte auch der Titel Magische Blätter, der entfernt an Schumanns musikalische Sammlung Bunte Blätter erinnert, nicht passender sein. Nur schwer kann man sich dem sinnlichen Einfluss dieser Texte entziehen. Sie fesseln die Leser und lässt sie wünschen, den Texten wieder und immer wieder aufs Neue begegnen zu können. So erging es auch mir, als ich zum ersten Mal Mayröckers Prosasammlung Das Herzzerreißende der Dinge, veröffentlicht 1985, las. Diese Texte waren im Protest gegen die Erkenntnis geschrieben worden, dass der Mensch in der modernen Zeit zunehmend überflüssig geworden sei. Die Autorin dieser Texte weiß genau, dass ihre Schreibtisch-Anstrengungen vergeblich sind, doch ist es gerade dieser Sinn für das Vergebliche, der sie antreibt und dazu inspiriert, dagegen mit Goya, Dali und Canetti als ihren virtuellen Mitstreitern anzugehen. In diesen Texten beschreibt sie Wien als einen Ort, der sowohl von einem Ansturm der Melodien, der „Wahnsinns Musik“, wie Mayröcker es nennt, als auch von hartnäckigem Durchzug tyrannisiert wird. Doch dann ist da das Wort „Capriccio“, das sie fasziniert; sie spricht darüber im Zusammenhang mit ihrem „unermüdlichen Dialog mit Sprache“, der sie dazu bringt alle anderen Formen künstlerischen Ausdrucks, wie Musik und die Bildende Kunst, auszuschöpfen, um sie, wie alles andere auch, in poetische Narrative umzuwandeln. Das heißt nichts weniger, als dass ein Musikstück oder ein Bild für Mayröcker allein der Erschließung ihres verbalen Potentials wegen existieren.
Mayröckers lebenslange Liebesgeschichte mit der Sprache hat es ihr ermöglicht, einige der berührendsten Liebesgedichte der neueren deutschsprachigen Literatur zu schreiben. Ein Beispiel ist das Gedicht „Wie und warum ich dich liebe“, das Ernst Jandl zu dessen siebzigstem Geburtstag gewidmet ist:
wenn du es bist bin ich nicht sicher ob ich es bin
was dich bedroht ist bedrohlich für mich
der Spiegel in den ich blicke an jedem Abend
hält mir gleichzeitig entgegen dein Bildnis und meines
das Geheimnis im Dunkel deines Herzens ist nicht
um von irgendjemandem gelüftet zu werden
es zieht mich an am gründlichsten und am tiefsten
und ist vermutlich das Motiv meiner unbeirrbaren Liebe
Mayröckers Texte sind letztendlich ebenfalls solche Spiegel, auch mehrfach gebrochene. Wenn wir sie lesen, erkennen wir uns selbst und das ewig wechselnde Bild unserer vielsagendsten Leidenschaft, der Sprache.
Rüdiger Görner; aus Rüdiger Görner: Sprachrausch und Sprachverlust, Sonderzahl Verlag, 2011
„Ich will ganz nah an das fast
nicht mehr Mögliche heran.“
Es ist ein besonderer Augenblick, als ich im Dezember 2004, kurz vor Friederike Mayröckers 80. Geburtstag, in der Zentagasse in Wien auf die Klingel drücke. Jeder, der schon einmal von der großen Wiener Dichterin gehört hat, weiß um die sagenumwobene Schreibhöhle in der Zentagasse, in der sie seit den vierziger Jahren wie Hieronymus im Gehäuse lebt. Jetzt werde ich diese Zettelwelt endlich kennenlernen, in die sich Friederike Mayröcker eingesponnen hat, um darin ihre unvergleichlichen, in freien poetischen Assoziationsströmen dahinfließenden Prosabücher zu schreiben. Ohne diese Zettelberge, aus denen sie immer wieder neue Anregungen für ihr Schreiben herauszupft, kann sie nicht arbeiten und wohl auch nicht leben. Die Zettel enthalten Notizen, Geträumtes, Gesehenes, aber auch Exzerpiertes, Zeilen ihrer „Blutsbrüder“ Beckett und Brecht, Max Ernst und Jean Paul, Friedrich Hölderlin und Arno Schmidt, Claude Simon und Marguerite Duras, Roland Barthes und André Breton, André Michaux und Jacques Derrida.
Ihre ursprüngliche Zweizimmerwohnung ist im Lauf der Jahre derartig verzettelt, dass sie darin nicht mehr wohnen kann. Deswegen ist Friederike Mayröcker nach dem Tod ihres Lebensgefährten Ernst Jandl in dessen Dachwohnung im selben Haus gezogen (die beiden waren eines der glücklichsten Liebespaare der Literaturgeschichte, haben aber wie Claude und Réa Simon, Philippe und Ré Soupault, Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir nie in einer gemeinsamen Wohnung gelebt). Auch hier ist die Verzettelung schon weit vorangeschritten.
Wir bahnen uns einen Weg durch die Papierstapel der ehemaligen Jandl-Wohnung zu einem winzigen freigeräumten Platz an einem der ebenfalls mit Papieren übersäten Tische. Hier hat die Autorin auf einer ausgebreiteten Serviette ein Glas Wasser und etwas Obst bereitgestellt. Das Schreibzimmer befindet sich im Nebenraum und enthält außer den Papierstapeln nur einen Campingtisch mit der Hermes Baby. An diesem Campingtisch entsteht beinahe Jahr für Jahr ein neues Buch.
Wie immer ist die große Mayröcker ganz in Schwarz, schwarze Hose, schwarze Jacke, schwarze Haare. Inmitten ihres weißen Zettelgebirges ist sie eine theatralische Erscheinung, deren Heftigkeit jedoch durch die Sanftmut und Freundlichkeit gemildert wird, mit der sie ihre Besucherin empfängt. Wir unterhalten uns mehrere Stunden, unterbrochen von einer Mittagspause. Das Gespräch strenge sie an, klagt sie. Sie lebe in großer Einsamkeit, könne nur selten Menschen sehen, denn nach Gesprächen wie diesem sei der Schreibfluss manchmal noch für Tage wie ausgelöscht. Es koste sie viel Zeit, um wieder in den magischen Schreibzustand, in das „Hirnfieber“ des Schreibens zurückzufinden.
Auch nach diesem Besuch gab es einen nachträglichen Gruß: Vier Jahre später hat Friederike Mayröcker mir ihr Buch Paloma gewidmet.
Iris Radisch: Über das Alter spricht man wie über einen großen Verlust, Lebensverlust, Lebensrestzeitverlust, Verlust der Lebenskräfte. Was heißt Alter für Sie?
Friederike Mayröcker: Ich kann nicht sagen, dass sich etwas verändert hat. Ich fühle mich nicht alt. Und manchmal geht es sogar so weit, dass ich wieder bloßfüßig in Deinzendorf herumlaufe als Kind. Und das ist nicht die übliche Erinnerung der Erinnerung des alten Menschen, sondern die Kindheit. Es ist das Gefühl, ich fange erst an. Manchmal denke ich, mein Leben beginnt überhaupt erst.
Radisch: Heißt das, es gibt das Kind, einen Kern in einem selbst, der sich nicht verändert?
Mayröcker: Das ist richtig.
Radisch: Gleichzeitig müssen doch die vielen Jahresringe, die man ansetzt, eine Veränderung bewirken. Was haben die Jahre mit Ihnen gemacht?
Mayröcker: Die Jahre sind einfach vergangen. Und man weiß eben nicht, wie. Ein Jahr vergeht so rasch. Dieses Jahr ist vorüber, dann ist das nächste Jahr vorüber. Und man denkt sich dann: Wie lange wird es noch gehen? Aber ich denke nicht viel an die Vergangenheit. Ich denke an eine Mischung von Gegenwart und Zukunft. Ich habe noch sehr viel vor.
Radisch: Wenn Sie im Kern das ewige Kind sind, gibt es dann überhaupt Lebensepochen?
Mayröcker: Da muss ich mich anstrengen, um Lebensepochen herauszufinden. Eine Epoche ist die, seit Ernst Jandl tot ist. Das ist eine Epoche, die mir sehr viel Traurigkeit gebracht hat und noch immer bringt. Das ist eine neue Art des Gefühls von Verlassenheit und eigentlich von Im-Stich-gelassen-Sein, was vielleicht hart klingt. Ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich ihn auffordere: Komm und hilf.
Radisch: Und kommt er?
Mayröcker: Nein, nicht immer.
Radisch: Gibt es so etwas wie eine Restkommunikation über den Tod hinaus?
Mayröcker: Ja, vielleicht gibt es etwas wie eine Restkommunikation, am ehesten beim Schreiben. Wenn ich Dinge suche, und ich suche ja fast den halben Tag, dann sage ich: Wenn du wirklich irgendwo bist, dann muss ich das jetzt mit deiner Hilfe finden. Und manchmal finde ich es dann auch.
Radisch: Sie leben beinahe Ihr ganzes Leben schon in einem Zettelgehäuse, in einem Zettelberg hier in der Zentagasse, den Sie sich selbst gebaut und nur selten verlassen haben. War das Leben im Zettelgehäuse ein Versuch, das Leben anzuhalten wie in einem endlosen Augenblick?
Mayröcker: Ein endloser Augenblick, das stimmt. Das ist die Beschreibung meines Lebens. Ein endloser Augenblick.
Radisch: Und Ihr Papiergehäuse, dieses Papierkunstwerk, das Sie um sich geschaffen haben, welchen Sinn erfüllt es dabei?
Mayröcker: Das hat sich ergeben durch die Art des Schreibens. Hier, in Ernst Jandls alter Wohnung, in die ich nach seinem Tod gezogen bin, habe ich Inseln der Ordnung. Unten, in der alten Wohnung, gab es das nicht. Es gibt einen Korb, in dem sind Zettel für neue Gedichte. In diesem Korb suche ich herum und finde vielleicht einen Anfang für ein Gedicht. Sonst ist in meinem Schreibkammerl alles sehr verstreut. Da kommt es darauf an, dass ich wie bei einem Lotteriespiel Zettel herausziehe, die mir vielleicht etwas sagen. Das sind vielleicht Traumfetzen. Ich träume in der Nacht immer in Sätzen und in Wörtern. Ich wache dann mitten in der Nacht auf und mache Notizen, weil ich mich am Morgen an nichts mehr erinnern kann.
Radisch: Die Zettel sind eine Wundertüte? Sie wissen selbst nicht, was da überall draufsteht?
Mayröcker: Nein, ich weiß es nicht, manchmal habe ich die Zettel auch schon verwendet.
Radisch: Befürchten Sie nicht, unter diesen ständig wachsenden Papierbergen selbst zu verschwinden?
Mayröcker: Nein, dazu sind sie mir zu vertraut, auch wenn ich nicht weiß, was in diesen Haufen ist.
Radisch: Alles wäre viel übersichtlicher, wenn Sie Hefte oder Ordner verwendet hätten.
Mayröcker: Nein, es mussten fliegende Blätter sein.
Radisch: Wann hat dieser Rückzug in das Zettelgehäuse begonnen?
Mayröcker: Als ich jung war und in der Schule unterrichtet habe, hat es schon angefangen. Vormittags war ich in der Schule, mittags habe ich bei meinen Eltern gegessen, dann bin ich hierher in die Zentagasse in meine alte Wohnung gekommen, habe sofort angefangen zu arbeiten, schon in den Freistunden und in der Straßenbahn habe ich ja ununterbrochen geschrieben. Abends musste ich mich auf den nächsten Schultag vorbereiten. Sonst gab es gar nichts. An der Wiener Gruppe konnte ich nicht teilnehmen. Das hat sich ja alles nachts abgespielt. Dann, nach meiner Frühpensionierung 1969, war der Rückzug total.
Radisch: Ein Leben wie eine mittelalterliche Nonne in ihrer Klosterzelle. Haben Sie sich vor der Welt draußen geekelt? Der Weltekel ist ja unter österreichischen Künstlern sehr verbreitet.
Mayröcker: Nein, ich habe mich nie vor der Welt geekelt. Das Draußen habe ich immer in meine Gedichte aufgenommen, besonders in den letzten Jahren sind meine Gedichte sehr welthaltig. Ich gehe auch viel raus. Ich habe das Gefühl, ich atme die ganze Welt ein. Und sie ist dann in mir drin. Mir ist sehr wichtig, mit großen Augen zu schauen, was die Welt mir bringt. Ansonsten bin ich furchtbar scheu und habe die Kommunikation mit den Menschen schon fast verloren. Ich fürchte mich, wenn ich mich nach außen stülpen muss, ja, es ist wirklich ein Nach-außen-Stülpen.
Radisch: Hatten Sie eigentlich immer dieselbe Frisur? Alle Fotos zeigen Sie mit diesen kohlrabenschwarzen Haaren, die Sie wie ein Schleier bedecken.
Mayröcker: Die Frisur hatte ich schon als Kind. Ich fühle mich geborgen unter dieser Frisur.
Radisch: Gab es nie eine Zeit, in der Sie auch daran gedacht haben, ein herkömmliches Frauenleben zu führen, mit Familie und Kindern?
Mayröcker: Es war von Anfang an klar, dass ich das nicht will. Schon als Mädchen habe ich das gewusst. Als junge Frau war ich schon sehr empfänglich für alle erotischen Dinge, ich habe mich tausendmal verliebt. Es war alles da. Aber mit dem Beginn des richtigen Schreibens, das heißt mit dem Erscheinen von Tod durch Musen, wollten Ernst und ich aufs Ganze gehen.
Radisch: Für uns Normalmenschen sind die Wonnen des gewöhnlichen Lebens auch ein Schutz vor einer Lebensradikalität, die schwer zu ertragen ist.
Mayröcker: Wir haben ein paar Wochen lang versucht, das kleine Glück zu leben. Hier unten, in meiner winzigen Wohnung. Das war so fürchterlich für den Ernst. Da hat er sich ein Untermietzimmer genommen. Wir hatten für uns selbst einfach keinen Platz. Das war nicht auszuhalten. Trotz großer Liebe war das nicht auszuhalten.
Radisch: Dann haben Sie über vierzig Jahre getrennt gelebt. Eine Liebe zwischen zwei Einsiedlern.
Mayröcker: Wenn er jetzt noch da wäre, würde ich gerne in einer großen gemeinsamen Wohnung mit ihm leben. Das wäre vielleicht schön. Nur hätten wir dann den Abschied noch vor uns.
Radisch: Also doch ein wenig Reue?
Mayröcker: Nein, es war gut, dass ich es so gemacht habe. Vielleicht war ja der Hauptgrund, dass wir so lange zusammengeblieben sind, dass jeder woanders gelebt hat. In den Sommern, die wir gemeinsam auf dem Land verbracht haben, war ich so sehr mit den Gedanken bei ihm, dass ich nicht schreiben wollte. Momentweise denke ich, dass ich vielleicht etwas im Leben verpasst habe. Ich habe auch das Gefühl, zu wenig für Ernst da gewesen zu sein. Ich bin ja immer erst am Abend zu ihm gekommen. Aber ich war ja auch nicht praktischer als er. Ich kann nicht kochen. Ich stelle mich manchmal an wie ein Wickelkind.
Radisch: Ernst Jandl und Sie sind vielleicht die einzige geglückte Dichterliebe der Literaturgeschichte, denkt man an die Tragödie zwischen Frisch und Bachmann und die eher lieblose Groteske zwischen Sartre und Beauvoir.
Mayröcker: Ernst Jandl war so ein offener Mensch. Er konnte mir die ärgsten Grobheiten sagen, und ich war glücklich darüber, weil ich wusste, das kommt von innen. Er hat mich nie angelogen. Er hat alles gesagt, was in ihm vorgegangen ist. Und trotzdem war er für mich ein großes Geheimnis. Das hat mich so an ihm fasziniert. Mit ihm konnte mir nie eine Sekunde langweilig werden. Wir haben alles ausgetauscht. Ernst hat mir alles sofort vorgelesen und hat mich aufgefordert zu kritisieren. Aber ich konnte nicht kritisieren, die Sachen waren alle so gut.
Radisch: Was Sie im Schreiben versucht haben, die radikale Transzendierung des Lebensvordergrunds, macht Ihnen so wunderbar beinahe niemand nach. Wann und wie hat sich dieses „Denkflattern“, die „Schädelfreude“, das „Gehirnwunder“, wie Sie es nennen, in Ihren Texten eingestellt?
Mayröcker: In den frühen sechziger Jahren hatte ich das Gefühl, ich kann so nicht mehr weiterschreiben wie in den Fünfzigern. Ich habe der Alltagssprache zunächst vertraut und mich ganz auf das Emotionale verlassen. Aber das war mir plötzlich zuwider. Ich hatte das Gefühl, ich will zu viel, und das geht alles nicht in die alten Muster hinein. Es war ein Protest in mir, ein Protest gegen meine eigene Sprache. Ich habe dann zum ersten Mal die Montagetechniken versucht, und das hat mir einen ungeheuren Sprung nach vorne ermöglicht. Im Rückblick muss ich sagen, das waren krude Montagen, ich habe buchstäblich alles montiert. Straßenaufschriften, Gespräche, Briefe, Bücher. Das war der Anfang der experimentellen Literatur. Mir konnte nichts experimentell genug sein. Ernst hat zur selben Zeit mit den Lautgedichten begonnen.
Radisch: Sie haben gegen Ihre eigene Sprache revoltiert, gegen die Sprache, in die Sie als Kind in Kriegszeiten hineingewachsen sind?
Mayröcker: Ich habe als Kind in einer ungeheuren Phantasiewelt gelebt. Unten waren die Russen mit ihrer Gulaschkanone, und ich habe oben Klimt studiert. Ich habe mich überhaupt nicht darum geschert, wer unten in der Straße erschossen wird. Ich verstehe das heute nicht mehr.
Radisch: Die Außenwelt war Ihnen gleichgültig?
Mayröcker: Damals war mir die Außenwelt gleichgültig, jetzt ist sie mir ganz wichtig.
Radisch: Auf dem Weg, den Sie damals eingeschlagen haben, liegt sehr viel Unbekanntes, auch Unbegreifliches. Konventionen gibt es ja unter anderem deshalb, weil sie Schutz bieten vor der Unbegreiflichkeit des Lebens, seiner tiefen Unverständlichkeit. Die unendlichen Räume, die sich auftun, sobald man die Stellagen unserer Alltagswirklichkeit entfernt, haben schon Pascal erschaudern lassen. Kennen Sie diese Angst?
Mayröcker: Ich habe sie manchmal, dann auch wieder nicht. Aber meine Wut ist immer größer als die Angst. Meine Schreibwut. Ich habe keine Angst vor der Leere, auch nicht vor dem weißen Blatt Papier, weil ich ja rundherum meine Sachen habe. Im Augenblick bin ich zum Beispiel abhängig und angeregt von Maria Callas, ich spiele immer dieselben Stücke. Als ich Brütt geschrieben habe, war es eine bestimmte Bach-Kantate. Die Musik hilft mir sehr. Sie reißt mir das Herz auf. Jeden Tag aufs Neue, ich kann es gar nicht begreifen.
Radisch: Wo sind Sie, wenn Sie schreiben?
Mayröcker: Es ist ein total anderer Zustand, es ist fast, wie wenn ich eine Droge nehmen würde. Ich trinke aber weder Alkohol, noch rauche ich. Es ist ein magischer Zustand. Ich rede nicht gerne darüber. Ich empfinde es beinahe als Verrat, darüber zu sprechen. Es ist auch für mich ein Geheimnis. Und wenn ich zu viel darüber spreche, kann ich nicht mehr schreiben. Das Geheimnis verflüchtigt sich. Man sollte nicht darüber nachdenken. Es kommt, oder es kommt nicht. Und meistens kommt es.
Radisch: Und wenn es nicht kommt?
Mayröcker: Wenn ich ein, zwei Tage nicht schreiben kann, bin ich verzweifelt und fürchte, es ist aus. Dann, durch irgendetwas, einen Brief, häufig durch Lektüre, komme ich wieder hinein. Jacques Derrida hat mich sehr angeregt mit seinen literarischen Texten. Beckett hat mich sehr geprägt. Roland Barthes hat es mir angetan. Claude Simon, Marguerite Duras und Georges Bataille, besonders sein Roman Das Blau des Himmels. Das schreibe ich mir alles heraus. Wo ich nichts exzerpieren kann, lese ich auch nichts. Wie eine Lumpensammlerin notiere ich Sätze und Wörter, die ich oft auch völlig überarbeite.
Radisch: Sind es denn Sie, ist es Ihr Ich, das da schreibt?
Mayröcker: Das Ich ist beteiligt, wenn ich die Reinschrift mache aus der ersten, zweiten oder dritten Version. Die erste Version ist ganz intuitiv, die zweite auch noch, ab der dritten, vierten kommt die eiserne Faust, die Ratio, dann wird alles Emotionale, das übergeschwappt ist, niedergeboxt.
Radisch: Haben Sie manchmal das Gefühl, dass Ihnen etwas eingesagt wird? Julien Green zum Beispiel war davon überzeugt, ihm seien seine Bücher diktiert worden.
Mayröcker: Manchmal hatte ich das Gefühl. Manchmal dachte ich auch, der Ernst sagt mir etwas ein. Aber davon bin ich wieder abgekommen. Manchmal sage ich, es ist der Heilige Geist, der mich treibt.
Radisch: Eine göttliche Kraft?
Mayröcker: Es ist ein Geist, und ein Geist ist natürlich göttlich.
Radisch: Das hieße, dass das Schreiben eine andere Art des Gottesdienstes ist?
Mayröcker: Vielleicht ja. Es ist eine hohe Konzentration auf etwas Spirituelles. Eine Art Sehnsucht. Man möchte es näher heranziehen. In jedem Fall ist das Schreiben eine Anstrengung und eine Loslösung von der äußeren Welt. Dennoch, mit automatischem Schreiben, wie die Surrealisten es versucht haben, hat das nichts zu tun. Ich habe ja immer meine Zettel um mich herum. Sonst hätte ich nur das Gefühl des Highseins, ohne Fleisch zu haben.
Radisch: Und woher beziehen Sie dieses Fleisch?
Mayröcker: Es sind Verbaleinfälle von der Straße, Verlesungen, Verhörungen, Stenogramme, die ich nicht mehr lesen kann und verändere, Traumreste, Gelesenes, die Malerei, ich stülpe mir Bilder in den Kopf. Ich schreibe sehr gerne über Bilder für Museumskataloge, wozu ich viel zu selten Gelegenheit habe. Ich bin immer auf Materialsuche. Wenn mich etwas anspringt, ist es immer eine große Beglückung.
Radisch: Mir fällt es schwer, den Eigencharakter jedes Ihrer Bücher zu erkennen. Ich habe viel mehr den Eindruck, Ihr ganzes Prosawerk wäre ein zusammenhängendes poetisches Tagebuch Ihrer Existenz.
Mayröcker: Für mich ist jedes Buch abgeschlossen. Aber sobald es abgeschlossen ist, habe ich auch schon eine furchtbare Sehnsucht danach, weiterzuschreiben. Ich habe Heimweh nach dem Buch. Irgendwo habe ich einmal geschrieben: „Ich sehne mich nach meinen ungeschriebenen Werken.“
Radisch: Warum erklären Sie Ihre Bücher dennoch irgendwann für abgeschlossen?
Mayröcker: Einfach, weil ich nicht mehr kann. Ich muss unterbrechen. Man kann meine Bücher als ein einziges Buch lesen, obwohl sie sich auch voneinander unterscheiden. Das neue Buch, das ich gerade beendet habe, hat keine Verwandtschaft mehr mit den vorhergehenden. Es ist entstanden, weil ich zufällig das Buch von Gertrude Stein über Pablo Picasso gelesen habe, und das hat mich so gefesselt, dass ich alles drei-, vier-, fünfmal von ihr gelesen habe. Gertrude Stein ist mein neuer Stern. Mein neues Buch heißt und ich schüttelte einen Liebling und kommt ganz von woanders her.
Radisch: Kann man sagen, dass Ihre Bücher immer radikaler wurden, vielleicht bis zu diesem letzten, ganz anderen Buch?
Mayröcker: Der Höhepunkt war Brütt, mein zuletzt erschienenes Prosabuch. Da hatte ich eine völlige Rücksichtslosigkeit gegen mich und die literarische Welt. So etwas werde ich nicht noch einmal schreiben können. Ich möchte es gerne noch einmal vor meinem Abschied. Ein Buch schreiben, das das letzte Ganze gibt! Einmal noch so ein Buch, das überhaupt auf nichts Rücksicht nimmt!
Radisch: Worauf haben Sie denn sonst Rücksicht genommen?
Mayröcker: Das kann man vielleicht so ausdrücken: Schönheit ist Wahrheit. Das war meine erste Vorstellung. So habe ich geschrieben. Jetzt, im Alter, habe ich den Satz umgedreht: Wahrheit ist Schönheit. Ich will ganz nah an das fast nicht mehr Mögliche heran, das ist dann Schönheit. Ich weiß nicht, ob ich das noch einmal schaffe. Im Grunde ist doch immer alles ein Geschenk.
Radisch: Heißt das, es gibt wahre und weniger wahre Literatur, authentische und weniger authentische?
Mayröcker: Ja, so ist es. Indem man die Sprache des Dichters begreift, öffnet sich auch das Authentische. Wenn man sich verschließt, erfährt man das nicht. Meine Bücher sind authentisch, weil sie ein lebendiger Kosmos sind.
Radisch: Ihre Wiener Kollegin, die Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek, macht Furore mit der Behauptung, es gebe auf der Welt nichts Authentisches mehr. Deswegen müsse sie beim Schreiben auch immer kotzen.
Mayröcker: Elfriede Jelinek hat einen anderen Lebensweg, eine andere Familie. Sie ist mir ein Rätsel. Sie schreibt ja sehr gut, ich lese ihre Sachen gerne, sie hat einen guten Zugang zur Sprache. Aber es ist nicht wahr, dass die Sprache kaputt ist. Die Sprache ist nicht kaputt, die ist ganz lebendig.
Radisch: Viele junge Autoren und Essayisten halten dagegen, die Sprache sei kaputt, weil wir keine echten Erfahrungen mehr machen können. Wir leben nur ein Schein-Leben und machen Schein-Erfahrungen, die uns nicht berühren. Es sei völlig unmöglich, heute noch authentische Erfahrungen zu machen.
Mayröcker: Warum soll es nicht möglich sein, Erfahrungen zu machen? Ich mache doch tagtäglich Erfahrungen. Die Welt ist so reich, und ich bin so ungeheuer neugierig auf die Welt. Da bin ich vielleicht anders als die, von denen Sie sprechen. Ich möchte so gerne noch ein bisschen leben, weil ich hinter manche Dinge noch kommen will. Man muss die kleinen Dinge anschauen. Wie einer schaut, warum er den Hut in der Hand hält. Wenn ich durch die Straßen gehe, begegnen mir immer wieder Menschen, mit denen ich so ein Mitgefühl empfinde, dass ich auf sie zugehen und ihnen helfen möchte. Dieses Verschämte, dieses Sichbloßstellen vor der Welt! Das berührt mich so, dass ich auf der Straße heulen könnte.
Radisch: Könnten Sie denn helfen?
Mayröcker: Ich weiß nicht. Es sind so viele Menschen herausgetreten aus der Möglichkeit, überhaupt an etwas anderes als an die Realität zu glauben. Es sind so viele Menschen verarmt.
Radisch: Sie haben Ihr Leben in Wien verbracht. In Wien gab es im vorigen Jahrhundert eine weibliche Sprachmacht, Aichinger, Bachmann, Jelinek, Mayröcker, wie nie zuvor in der deutschsprachigen Literatur. Verdankt sich das noch der alten Habsburger Kulturhauptstadt? Ich finde, dass es in der deutschsprachigen Literatur bis heute ein Habsburger-Deutsch und ein Preußisch-Deutsch gibt.
Mayröcker: Ich habe mich nie für Austriazismen interessiert. Dennoch kann ich nur in Wien schreiben, nirgends sonst. Nicht mal in einem anderen Wiener Bezirk. Könnte ich die Zeit noch einmal vierzig, fünfzig Jahre zurückschrauben, würde ich es vielleicht wagen, in den achten Bezirk zu ziehen. Aber das ist schon alles. Ich muss hier ausharren.
Radisch: Wien hat eine ausgeprägte Leidenskultur.
Mayröcker: Ich bin zwar oft melancholisch, aber ich bin gerne da. Ich freue mich jeden Morgen, dass ich wieder aufwache.
Radisch: Hans Arp hat einmal geschrieben: „Einstmals war der Sinn des Lebens, sich auf den Tod vorzubereiten.“ Haben Sie sich vorbereitet?
Mayröcker: Ich hasse den Tod. Ich weiß, dass ich knapp vor diesem Tor stehe. Mit achtzig muss man immer damit rechnen. Das ist eine so furchtbare Vorstellung. Ich kann es mit nichts vergleichen, eine strangulierende Vorstellung. Bald wird man nicht mehr alles erfahren können, was man gerne noch erfahren möchte. Wohin kommt das alles, was man gedacht hat? Was man empfunden und gemacht hat? Und auch der Gedanke, dass die Welt weitergeht. Wenn ich tot bin, geht die Welt genauso weiter wie an den Tagen, wo ich noch lebte. Das ist eine Unbegreiflichkeit. Eine Benachteiligung! Man möchte doch erfahren, wie es weitergeht. Und man wird abgeschnitten davon und weiß nicht, ob es weitergeht, wie es weitergeht. Es ist einfach aus.
Radisch: Einfach aus?
Mayröcker: Nach dem Tod von Ernst Jandl habe ich ein Medium befragt. Dieses Medium hat gesagt, Ernst Jandl sei gut aufgehoben. Aber dann bin ich skeptisch geworden, als er in dem Gespräch mit dem Medium angeblich Friederike zu mir gesagt haben soll. Er hat nie Friederike zu mir gesagt. Das Medium wollte mich nur trösten. Die Wahrheit ist: Er ist weg, ganz weg. Und wir haben uns nicht einmal verabschieden können, es ging alles zu schnell. Ich hoffe, dass ich nicht von einem Augenblick zum anderen sterbe. Ich möchte mich auf das Sterben vorbereiten. Mit meinen liebsten Menschen sprechen. Aber ob einem das vergönnt ist, weiß man nicht. Man müsste wenigstens zweihundert Jahre alt werden. Manche Pflanzen werden so alt.
Radisch: Nach zweihundert Jahren hätte sich das Leben erfüllt?
Mayröcker: Ja. Man braucht so viel Zeit. Ich würde das Leben aufteilen. In einem Leben würde ich nur lesen, in einem nur schreiben und in einem nur reisen. Dann brauchte ich noch eines, um mehrere Sprachen zu erlernen. Vielleicht wird man das in ein paar hundert Jahren können, vielleicht werden die Menschen sogar unsterblich. Das würde ich mir wünschen. Man könnte sich alles so schön einteilen.
Radisch: Gibt es etwas, das sich in Ihrem Leben noch nicht erfüllt hat?
Mayröcker: Es hat sich eigentlich alles erfüllt.
Aus Iris Radisch: Die letzten Dinge. Lebensendgespräche, Rowohlt Verlag, 2015
DANK AN FRIEDERIKE MAYRÖCKER
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaamit
einer Schlange in einen Sack gesperrt sein,
spanischer
Heimatling!
heimatling / heimattling
heimattling mattgeliebt matter-
horn, die stierhörner
so im nebel
so im nebel
aussichtlos
die nordwand
José F.A. Oliver
Theo Breuer: „Wie eine Lumpensammlerin“ – Vermerk zu Friederike Mayröckers Werk nach 2000
poetenladen.de, 20.12.2014
Hans Ulrich Obrist spricht über die von ihm kuratierte Ausstellung von Friederike Mayröcker Schutzgeister vom 5.9.2020–10.10.2020 in der Galerie nächst St. Stephan
Friederike Mayröcker übersetzen – eine vielstimmige Hommage mit Donna Stonecipher (Englisch), Jean-René Lassalle (Französisch), Julia Kaminskaja (Russisch) und Tanja Petrič (Slowenisch) sowie mit Übersetzer:innen aus dem internationalen JUNIVERS-Kollektiv: Ali Abdollahi (Persisch), Ton Naaijkens (Niederländisch), Douglas Pompeu (brasilianisches Portugiesisch), Abdulkadir Musa (Kurdisch) und Valentina di Rosa (Italienisch) und Bernard Banoun – im Gespräch mit Marcel Beyer am 6.11.2021 im Literaturhaus Halle.
räume für notizen: Friederike Mayröcker: Frieda Paris erliest ein Langgedicht in Stücken und am Stück, Juliana Kaminskajas Film das Zimmer leer wird gezeigt. Die Moderation übernimmt Günter Vallaster am 29.1.2024 in der Alten Schmiede, Wien
Fest mit WeggefährtInnen zu Ehren von Friederike Mayröcker Mitte Juni 2018 in Wien
Sandra Hoffmann über Friederike Mayröcker bei Fempire präsentiert von Rasha Khayat
Im Juni 1997 trafen sich in der Literaturwerkstatt Berlin zwei der bedeutendsten Autorinnen der deutschsprachigen Gegenwartslyrik: Friederike Mayröcker und Elke Erb.
Protokoll einer Audienz. Otto Brusatti trifft Mayröcker: Ein Kontinent namens F. M.
Zum 70. Geburtstag der Autorin:
Daniela Riess-Beger: „ein Kopf, zwei Jerusalemtische, ein Traum“
Katalog Lebensveranstaltung : Erfindungen Findungen einer Sprache Friederike Mayröcker, 1994
Ernst Jandl: Rede an Friederike Mayröcker
Ernst Jandl: lechts und rinks, gedichte, statements, perppermints, Luchterhand Verlag, 1995
Zum 75. Geburtstag der Autorin:
Bettina Steiner: Chaos und Form, Magie und Kalkül
Die Presse, 20.12.1999
Oskar Pastior: Rede, eine Überschrift. Wie Bauknecht etwa.
Neue Literatur. Zeitschrift für Querverbindungen, Heft 2, 1995
Johann Holzner: Sprachgewissen unserer Kultur
Die Furche, 16.12.1999
Zum 80. Geburtstag der Autorin:
Nico Bleutge: Das manische Zungenmaterial
Stuttgarter Zeitung, 18.12.2004
Klaus Kastberger: Bettlerin des Wortes
Die Presse, 18.12.2004
Ronald Pohl: Priesterin der entzündeten Sprache
Der Standard, 18./19.12.2004
Michael Braun: Die Engel der Schrift
Der Tagesspiegel, 20.12.2004.
Auch in: Basler Zeitung, 20.12.2004
Gunnar Decker: Nur für Nervenmenschen
Neues Deutschland, 20.12.2004
Jörg Drews: In Böen wechselt mein Sinn
Süddeutsche Zeitung, 20.12.2004
Sabine Rohlf: Anleitungen zu poetischem Verhalten
Berliner Zeitung, 20.12.2004
Michael Lentz: Die Lebenszeilenfinderin
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 20.12.2004
Wendelin Schmidt-Dengler: Friederike Mayröcker
Zum 85. Geburtstag der Autorin:
Elfriede Jelinek, und andere: Wer ist Friederike Mayröcker?
Die Presse, 12.12.2009
Gunnar Decker: Vom Anfang
Neues Deutschland, 19./20.12.2009
Sabine Rohlf: Von der Lust des Worte-Erkennens
Emma, 1.11.2009
Zum 90. Geburtstag der Autorin:
Herbert Fuchs: Sprachmagie
literaturkritik.de, Dezember 2014
Andrea Marggraf: Die Wiener Sprachkünstlerin wird 90
deutschlandradiokultur.de, 12.12.2014
Klaus Kastberger: Ich lebe ich schreibe
Die Presse, 12.12.2014
Maria Renhardt: Manische Hinwendung zur Literatur
Die Furche, 18.12.2014
Barbara Mader: Die Welt bleibt ein Rätsel
Kurier, 16.12.2014
Sebastian Fasthuber: „Ich habe noch viel vor“
falter, Heft 51, 2014
Marcel Beyer: Friederike Mayröcker zum 90. Geburtstag am 20. Dezember 2014
logbuch-suhrkamp.de, 19.1.2.2014
Maja-Maria Becker: schwarz die Quelle, schwarz das Meer
fixpoetry.com, 19.12.2014
Sabine Rohlf: In meinem hohen donnernden Alter
Berliner Zeitung, 19.12.2014
Tobias Lehmkuhl: Lachend über Tränen reden
Süddeutsche Zeitung, 20.12.2014
Arno Widmann: Es kreuzten Hirsche unsern Weg
Frankfurter Rundschau, 19.12.2014
Nico Bleutge: Die schöne Wirrnis dieser Welt
Der Tagesspiegel, 20.12.2014
Elfriede Czurda: Glückwünsche für Friederike Mayröcker
Manuskripte, Heft 206, Dezember 2014
Kurt Neumann: Capitaine Fritzi
Manuskripte, Heft 206, Dezember 2014
Elke Laznia: Friederike Mayröcker
Manuskripte, Heft 206, Dezember 2014
Hans Eichhorn: Benennen und anstiften
Manuskripte, Heft 206, Dezember 2014
Barbara Maria Kloos: Stadt, die auf Eisschollen glimmt
Manuskripte, Heft 206, Dezember 2014
Oswald Egger: Für Friederike Mayröcker zum 90. Geburtstag
Manuskripte, Heft 206, Dezember 2014
Péter Esterházy: Für sie
Manuskripte, Heft 206, Dezember 2014
Wilder, nicht milder. Friederike Mayröcker im Porträt
Zum 93. Geburtstag der Autorin:
Einsame Poetin, elegische Träumerin, ewige Kinderseele
Die Presse, 4.12.2017
Zum 95. Geburtstag der Autorin:
Claudia Schülke: Wenn Verse das Zimmer überwuchern
Badische Zeitung, 19.12.0219
Christiana Puschak: Utopischer Wohnsitz: Sprache
junge Welt, 20.12.2019
Marie Luise Knott: Es lichtet! Für Friederike Mayröcker
perlentaucher.de, 20.12.2019
Herbert Fuchs: „Nur nicht enden möge diese Seligkeit dieses Lebens“
literaturkritik.de, Dezember 2019
Claudia Schülke: Der Kopf ist voll: Alles muss raus!
neues deutschland, 20.12.2019
Mayröcker: „Ich versteh’ gar nicht, wie man so alt werden kann!
Der Standart, 20.12.2019
Zum 96. Geburtstag der Autorin:
Fakten und Vermutungen zur Autorin und Interview 1, 2, 3 & 4 +
Archiv 1, 2 & 3 + Internet Archive + KLG + IMDb + ÖM + Kalliope +
DAS&D + Georg-Büchner-Preis 1 & 2
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Galerie Foto Gezett +
Dirk Skiba Autorenporträts + Autorenarchiv Susanne Schleyer +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + Keystone-SDA +
deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Friederike Mayröcker: Standart ✝︎ NZZ 1 + 2 ✝︎ SRF ✝︎
FAZ 1 + 2 ✝︎ Tagesspiegel ✝︎ FAZ ✝︎ Welt 1 + 2 ✝︎ SZ ✝︎ BR24 ✝︎ WZ ✝︎
Presse ✝︎ FR ✝︎ Spiegel ✝︎ Stuttgarter ✝︎ Zeit 1 + 2 + 3 ✝︎ Tagesanzeiger ✝︎
dctp ✝︎ Kleine Zeitung ✝︎ Kurier ✝︎ Salzburger ✝︎ literaturkritik.de 1 + 2 ✝︎
junge Welt ✝︎ ORF 1 + 2 ✝︎ Bayern 2 1 + 2 ✝︎ der Freitag ✝︎ Die Furche ✝︎
literaturhaus ✝︎ WOZ ✝︎ NÖN ✝︎ BaZ 1 + 2 ✝︎ Poesiegalerie ✝︎
Friederike Mayröcker – Trailer zum Dokumentarfilm Das Schreiben und das Schweigen.


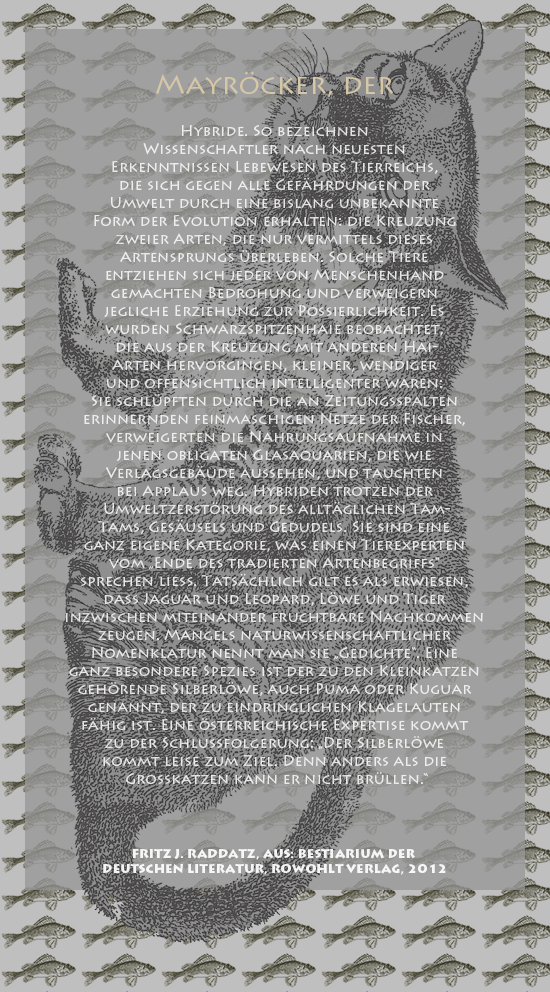












Schreibe einen Kommentar