Friederike Mayröcker: VERITAS
ZWEIMAL DEIN GESICHT AUF EINEM SOFA
ja es ist Zephir, ein
Himmelsgeviert, zweimal dein
Gesicht auf einem Sofa, ja es ist
so ein tauber Tag, die Schatten und
schrägen Sterne wechseln im
zornigen Rasen : Windräder
aus Pappe, ein
Artefakt
Nachwort
Diese Auswahl ist begrenzt auf die Gedichte und die kurzen Prosa-Stücke Friederike Mayröckers. Den Hintergrund bilden vor allem ihre großen Prosa-Unternehmen: Es erschien mir ungehörig, aus solchen Geweben Teile herauszuschneiden. Die Biobibliographie verzeichnet diese Prosa-Titel und ihre Entstehungsdaten. Liest man diese Angaben vereint mit denen im Inhaltsverzeichnis, ergibt sich ein zumindest zeitlich-quantitatives Abbild der hier nicht repräsentierten Texträume. Zur Repräsentanz der ausgewählten Texte meine ich, daß wohl auch mir (nicht nur andern) mehrere andere Wege durch das Werk möglich gewesen wären – auf die ich blicke mit Bedauern und Neugierde, ja Eifersucht…, einer ähnlichen Mischung, wie sie den Gedanken füllt, man könnte auch einen anderen Lebensweg gegangen sein. – Die Nicht-Auswahl einer nicht unbeträchtlichen Zahl von Gedichten indessen gehorchte einer gewissen Scheu vor Veröffentlichung, denn ich empfand bei ihnen, sie sollten auf den Seiten ihres eigenen Buches verbleiben, weil sie dessen weißes Papier und inneres weises Wissen porträtieren, wie es ihm zu Gesicht steht und mir nicht erlaubt, sie von dort abzulösen und außerhalb ihres Wuchses und Blicks/Anblicks peripher irgendwo aufzublättern. −
Bei der Anordnung habe ich mich an das chronologische Prinzip gehalten, weil es bedeutungsfrei ist und die Autonomie der Autorschaft nicht entstellt, sondern den offenen Raum bewahrt, der ihr zukommt. Ebenso habe ich auch beim Auswählen selbst nicht den Vorwitz sekundärer Interessen wie etwa die Absicht einer entwicklungsgeschichtlichen Darstellung der Autorschaft herrschen lassen oder gar eine biografische Programm-Musik zugelassen. Mit dieser Treue gegen die Wahrnehmung meines Lebens hoffe ich, eine ungestörte Begegnung mit den Texten zu fördern. Vermittelnde, moderierende Zutaten wären (auch noch hier, im Nachwort) wie ein Reden neben den Texten, die aber Stille brauchen, weil sie ja, wie ich es selbst beim Lesen erfahren habe, auf eine dichte, phalanxartige Masse von Reden in den Lesenden treffen; und sie werden gelesen nur, indem sie in diesen Widerpart eindringen.
Sie dringen nur ein, während sie eindringlich gelesen werden. Gewiß gibt es Lesende, die diese Texte widerstandslos aufnehmen, ich gehörte nicht zu ihnen und ich erfuhr, wie die Freude des Lesens aus der (von den Dichtungen hervorgerufenen) eigenen Aktivität der Aufnahme erwächst. Ich las mit allem Widerstand, den ich aufzubringen vermochte, oder richtiger: den der Text in mir mobilisierte, – mit einem starken Begehren, „alles zu verstehen“, und zwar vermutlich doch in der überkommenen Art zu lesen. An Stellen, die über meine Aufnahmebereitschaft hinauslangten, setzte ich Fragezeichen. Es konnte mich verwundern, wieso?, weil ich ja nicht sagen konnte, ich hätte alles andere verstanden. Der Reihe der Fragezeichen entsprach am anderen Ufer eine Reihe angemerkter Begeisterungen. Offenbar hatte ich diese Stellen ,verstanden‘, wiewohl ein wenig abseits von dem, was ich vordem als verstanden haben bezeichnet hätte. Ich gewahrte, daß ich mit diesen Zeichen ein Rezeptionsporträt markierte, ein Porträt von mir selbst, das neu war. Die Texte bildeten also eine andere, nämlich ihre Leserin aus mir, eine, die es vorher nicht gegeben hatte, und dies schon beim ersten Lesen. Oft waren zudem dessen Begriffsstutzigkeit, Blindheit schon beim zweiten Blick auf eine Stelle verschwunden.
Gewiß hängt die Aufnahmefähigkeit von der jeweiligen Gerichtetheit und Gestimmtheit ab, und vermutlich verbinden sich die Momente der Aufgeschlossenheit allmählich zu einer Wachheit weiterer Begegnungen. So konnte z.B. die Folge
[…] Tinten-
kalk, Schulterblatt Eiswand; lichtfeste
Knirschung, Kirschhang […]
vor zwei Jahren nicht so ungehindert durch mich hindurchgehen – indem sich eben jedes Signal unverzüglich erfüllt – wie nun. Und ich meine auch, in der Freude darüber/Freude daran, daß diese aktivierende und aktive, ebenso widerständige wie anlockende Lektüre ein Lesenkönnen schlechthin (auch anderer Texte) entschlackt, nämlich mich dahin bringt, daß ich so lesen kann, wie ich es wünsche, nicht nur so, wie die gewohnte strapaziöse Unleserlichkeit (abträgliche Schein-und-Teil-Leserlichkeit) des Kontextes Gesellschaft meine Lesefähigkeit mindert (formt, nach ihrem leidenden Bilde: Krusten backend, ungar haltend). Muß ich hinzufügen, daß die Lektüre Unverbindlichkeit nicht duldet? Gegen den eigenen Text so wenig wie gegen den Kontext Gesellschaft!
Natürlich habe ich nun den ersten Widerstand nicht mehr ungebrochen zur Verfügung. Das Lesen lebt mit dem Schreiben. Nach einem Beginn, der für mich mit seiner Entschlossenheit und der sogleich aufgebrochenen Fülle seiner Orientierungen unermeßlich (,ein Wunder!‘) war und bleibt, sehe ich, erlebe ich konsequente Verwandlung/Erweiterung, neu entschlossenes Unternehmen. Ich hoffe, meine Auswahl gibt, was diese Worte wiedergeben sollen, und gibt auch, was diese und andere Worte nicht sagen können. Statt des Versuchs einer beschreibenden Wiedergabe, einer objektivierenden Einordnung gar, statt den Interessen einer begrifflichen Thematik zu folgen (Interessen, die ich nicht leugne), will ich hier einige der Antwortreden anschließen (die Friederike Mayröcker insofern gehören, als sie sie hervorgerufen hat) und mit deren Mitteilung das Nachwort beenden.
Elke Erb, Nachwort, 1.3.1993
Lesebegegnung
„Jetzt möchte ich durch einen Dschungel“, dachte ich im Dezember 1990, und alsbald fragte mich Torsten Ahrend vom ReclamVerlag, ob ich eine Auswahl aus dem Werk Friederike Mayröckers herausgeben möchte. Im Januar 91 besuchte ich sie, sie schenkte mir eine Tasche voll ihrer Bücher, und ich blieb von da an in deren Gesellschaft.
Das Wort Dschungel war freilich ein Behelfswort, aber es taugte. Gemeint war ohnehin gewiß ein geistiger Dschungel, besser: ein dem gewohnten Durchdringen dschungelgleich ungewohnt widerstehendes Gedränge. Zur Kräftigung. Auch ohne den Wechsel der Gesellschafts-„Ordnung“ hätte ein solcher Wechsel für mich kommen müssen, meiner persönlichen Prognose nach. Aus der letzten Arbeitsphase in den achtziger Jahren ergab sich, die nächste müsse den politischen Formen und Formeln gelten.
Wie – unter den vorigen politischen Bedingungen – hätte das angehen, gehen können? – Es hätte sich gefunden. Unter den gewechselten Bedingungen fehlte die den vorigen immanent gewesene Konsequenz, und die Aufnahme vernachlässigter alter wie neuer Konditionen begann ohne Vorwitz…
Die Gesellschaft der Texte Friederike Mayröckers kam anstelle des „Dschungels“. Sie war als Sprache Existenz (nicht Erklärung oder Verweisung), und sie war insgesamt Existenz „von drüben“. Es fügte sich so, wie ich es in dem vorigen Soziotop erarbeitet hatte: Ich verhalte mich (aus meinem Stand an gemeinsamer Erfahrung – in der Proportion anderthalb zu sieben – heraustretend und) diese Gesellschaft durchwandernd, in allen möglichen Arten des Aufnehmens, ohne zu hierarchisieren, und jede gilt absolut in jeder einzelnen Reaktion.
Hier fand sich, als Widerstand beim Lesen, ein stupider („dem Alten“ eingewohnter) Rationalismus neben einem Entzücken, das die Hemmungen dieses Verstandes nicht zu kennen schien, und eine Ratlosigkeit, die sich unerwartet als erwünscht kennenlernte (wenn nämlich eine folgende Passage nicht ratlos ließ). Hier sah ich mir zu, wie ich in Sorge kam, von Klagen in dem durchwanderten Text verführt, und in Sorge kam der allgemeinsten Art, nämlich in jene Fürsorge, mit der unterbewußt jeder Mensch die Unternehmung eines jeden andern begleitet!! Hier ergab es sich, wie der begegnende Text ein anderes Ich der Erinnerung aus mir herausrüttelte (Rastersiebe), eben weil ich ihn nicht annektierte.
Ich nahm mir die Freiheit zu Text-Echos, auch aller möglichen Art, zumindest des Anlasses, ohne daß also eine Art hätte der Vormund der anderen sein dürfen. Zu nichts Drittem verpflichtet möge sich, hoffe ich, also auch das geneigte Lesen fühlen. Es hat mir gefallen, daß es während der beiden zurückliegenden Jahre in meinem Leben Alltag war, Friederike Mayröcker zu lesen. Es gefällt mir, daß die Sammlung meiner neuen Gedichte Reaktionen auf Literatur und auf Un-Literatur nebeneinander mitteilt und gleichstellt.
Um jedoch diese Gleichheit zu schützen davor, daß aus der augenfälligen Häufigkeit der Nennung der Autorin ein Legenden-Pathos selbstherrlich in die Augen springt, halte ich es für angebracht, mit diesen meinen Vorbemerkungen einem solchen Effekt im Wege zu stehn. Auch möchte ich mir mit ihrer Hilfe einen Freiraum für einige Text-Gänge oder -Bildungen ausdrücklich einräumen, die nicht die selbständige Abschlüssigkeit der anderen erreichten, sondern nur im Kontakt mit ihren Zusammenhängen, also verhalten, erscheinen können. Es handelt sich bei ihnen um die ersten Reaktionen auf die Texte von Friederike Mayröcker. Als ich sie ihr im Sommer 91 zuzusenden begann, begleitete ich sie mit Kommentaren. Nachträglich habe ich dem Komplex dieser schriftlich reflektierten Lesebegegnung im einzelnen, Gehalte erschließend, nachgefragt und einigen Kontext ergänzt.
Jan. 93
11.7.91
Liebe Friederike!
[…] Als wir im Januar nach Salzburg fuhren, kamen wir nachts an. Am Fluß entlangfahrend, suchten wir die Unterkunft. Die Häuser am Ufer hatten wohl kein Licht, so strömte der Fluß wie allein.
Im Zimmer las ich in DAS HERZZERREISZENDE DER DINGE und hatte auf einmal diese Vorzeitvision. Es war, als liefe der Fluß draußen vor meinem Kopf, in der Ebene unten hinter der Wand. Es ließ sich nicht abweisen, setzte mir zu, ich entschloß mich standzuhalten. Denn es war einer Unterrichtsstunde gleich, einer Taufe – für das Leben in dem gewechselten Raum, das ich nicht kenne.
Einige Motive – gefiedert, gefedert – verschwistert – Blitz/knistern/Zündschnur – Ragen – bewegen mich auch in anderen Gedichten seit Januar, – bis sie wohl haben, was sie wollen. Das SIE im Titel fliegt austauschlich. […]
(Bemerkung zu dem F. M. übersandten Gedicht SIE UND DER FLUSS.)
26.7.
Liebe Friederike,
nachdem Du solange nichts von mir hörtest, will ich nun, was in Worten inzwischen sich eingerichtet hat, Dir zusenden, nach und nach – –
Aber wie kann ich das tun, ohne Dich zu stören?
Denn dieser Schatz Deiner Bücher hier
– das kannst Du wohl selbst so nicht fassen,
weil sie ja Dir nicht alle auf einmal –,
sondern mit gelber Zeit verquirlt –
aaaaaich meine jene Zeit, die,
aaaaawährend wir sie gestaltig zubringen,
aaaaaarbeitend, meinend, empfangend, verhoffend
aaaaasie gestaltenreich lösen –
aaaaa(eigentlich ist es der Garten, der näht, denke ich nun,
aaaaaaber weil er auch rahmt. Hast du
aaaaavernähtes Maisfeld gesagt?)
– mit gelber Zeit verquirlt, mit jener,
die, während wir sie gestaltig zubringen,
dennoch überständig bleibt – oder wird –
Blütenflor (?), Aushauch, Überwurf (?) –
verquirlt mit jener üppigen, gelben, im Übergehen,
ausgelassen, und darunter
kommt doch jedes einzelne Buch seines Weges (ei! wie sie.
– und das, ohne sich zu drehn oder sonst der Geometrie
aufzukreuzen – ei, wie sie
stets zugleich dahin gehen, wo sie herkommen,
mag sich der Zeithimmel noch so dehnen und einziehn,
sie haben anderes im Sinn –)
Aber nun hier: alle auf einmal vor mir –
so kannst du die eigenen ja nicht kennen…
SIE IN MEINEM HAUS ist im April geschrieben, von einem Antritts-Besuch bei Deinen Gartenschatten1 her, die nachwirkten.
Ich sehnte mich nach dem Land – die gesamte aus-dem-Winter-Prozession nur vom Zugfenster aus. Reisen zu Lesungen. Herzkerbend: schon Ginster! schon Mohn! – als schrien sie noch seit dem Frühjahr davor!
Du warfst mehrmals den Zauberzirkel. So sah ich Dich aus meinem Haus blicken, gleichen Garten.
Das Haus ist sehr arm, sehr mauerlich – unten die Fensterhöhlen tief wie mein Arm lang ist. Sehr stubig ist es, und nachdem wir Deinen Spiegel darin gehalten hatten, sank meine Sehnsucht in das Bauwerk, so kam im Juni das Gedicht BAUSINN.
Anfang August
Notiz vom 17.7.
Noch habe ich kein einziges Kapitel oder gar Buch
als Figur im Ganzen gesehen, als Komposition vor Augen
gehalten…
aber einzelne Abschnitte, Kleinfolgen doch
halten mich an, mich umzudrehen, rufen mich zurück,
lösen lauter Bewunderung aus, ein Aufblicken,
Gewahren: Gestöber, von Gottweißwo, vom Gelenk
aaaaaaaaaain die Schultern aufsteigend,
das sich Bewunderung nennt.
Ausdruck, Ausdruck: die Pinnwand –
aaaaaaaaaaaaaaaein Erlebnis-Relief.
Ausdruck im Glanz,
das Sehen verblendend,
der Horde Kontroll-Bilanz,
unwillkürlich, beständig,
der Geltungen, Münzen im Dunst,
flüchtiges Sichten (durch Blenden),
dennoch im eigenen dunklen
Bildgrund flüchtig-präzis (ins Schwarze: Treffer!),
im Dunkel beschwingt (und dankbar,
begeistert), all so überschlägt
die Horde im Nu, der Spürsinn,
vermutlich unfehlbar.
Bewunderung: frei!
wieder, ins Freie!
(Schimmer im blassen
sich bildenden Dunst).
Überlaufausgleich, reell das
Tier, Reh springt hinweg
über das Steigen: nirgendshin fort,
springt, weil es springt
und nicht stirbt (weicht), so daß
immer die Treue
Bewunderung bewahrt,
wurzelecht deinesgleichen gilt,
unseresgleichen gilt
Zoll gleich Gewinn
(springt heraus,
nicht ins Aus).
Nachsatz: Gott heilt Wunden,
aaaaaaaaaWunder heilen Gott.
Anlaß dieser Notiz
(über die unwillkürliche Teilnahme aller an allem)
Ich schlage STILLEBEN auf, um wegen der Antwort vom 14.5., die ich Dir jetzt senden will, die Seite 36 aufzusuchen, gerate auf Seite 39 und lese:
das Verhäßlichte, sage ich,
ist davon das Gemüt so zerschlagen?
und vorher hatte ich Dein Schwarzfärben, Dein
Übertreiben – in das verstoßene, gestoßene Kind,
aaaaaaaaaaa– ins Ungehörige: Brotkruste im Bett usw.,
aaaaaaaaaaa– in die katastrophale Behelligung
aaaaaaaaaaaaaim Kerker der Nachbarschaft (Mietshaus)
aaaaaaaaaaaaaund das Toben darwider…
begriffen, eingesehn (mit den Augen ) –
aaaaaMAGISCHE BLÄTTER III:
aaaaaAM GRAM EINES ENGELS
aaaaaWIRD SICH UNSERE POESIE ENTZÜNDEN (GOGOL):
aaaaaDie Sünde ist, auf durchaus flüchtige Weise
aaaaadurchkreuzen wir unser Überleben, sage ich,
aaaaadie Sünde ist, auf durchaus flüchtige Weise
aaaaaführen wir Gespräche mit jedermann,
aaaaadie Sünde ist, auf durchaus flüchtige Weise
aaaaaversuchen wir, uns gegen unreine Töne
aaaaazu verschließen, gegen das Strichgewitter,
aaaaaden Ausstoß gröblicher Rede.
Und noch gedacht daran (dann aber fallenlassen),
daß das Thema den Namen „das Häßliche“ trage.
Und nun suche ich diesem Winkelzug des Erhaschens
nach im Kopf, krame, taste nach ihm,
lese (im STILLEBEN) weiter:
Die schrecklichsten Vergreisungstendenzen haben uns erfaßt, sage ich, katzbuckelnd mein Leib vor der Maschine, auf ganz niedrigem Stuhl, wie vor Klaviatur […].
– ich halte an, folge dem Bild (es mir vorstellend)
– und finde es überaus schön:
„Das ist, wirklich, außerordentlich schön!“
– ich will es notieren, aber da –
im Abschnitt vor diesem Satz – das angesammelte:
„zerschlagen“, „totale Zertrümmerung“,
„dieses mein total zertrümmertes und perforiertes Leben“
bringt mir (Sorge zu tragen!) in Erinnerung
die versäumte Dimension: das Ganze erkennen –
und ich beginne die Notiz vom 17.7. mit einem friedlichen
(nicht „schuldbewußten“) Nennen des Schuldiggebliebenen.
aaaaaDie gesamte Folge S. 39:
aaaaazartwüchsig, mit zertropftem Schädel: das Verhäßlichte, sage ich, ist davon das Gemüt so zerschlagen? Totale Zertrümmerung, mir ist der Körper auseinandergefallen, mein Gemüt war verschwunden. Das ist eine künstliche Melancholie, durch mich selber hervorgerufen, nützlich für Schreibarbeit, durch viele künstliche Tränen ausgezeichnet. Nämlich ich habe das Glück, ein ganz schwacher Mensch zu sein, usw. Dieses mein total zertrümmertes und perforiertes Leben ist eine der Voraussetzungen für meine Schreibarbeit. Plötzlich lerne ich wieder sehen! – sehen! genau hinsehen! auf keinen Fall irgendwelche Klischees zulassen! Jedes Wort, jeder Satz muß Gewicht haben. Die schrecklichsten Vergreisungstendenzen haben uns erfaßt, sage ich, katzbuckelnd mein Leib vor der Maschine, auf ganz niedrigem Stuhl, wie vor Klaviatur […]
Nun zu S. 36 (zurück?) und zu dem 14.5.:
aaaaaOhnehin kann man mit einem Menschen nur partiell kommunizieren, immer bleibt ein Rest ungesagt. Man kann immer nur mit einem dieses, mit einem anderen jenes sprechen, einem dieses, einem anderen jenes anvertrauen, nie einem Alles!
Antwort:
Aber ein Rudel, Pferderudel, prescht vorüber,
erblickst du, zur Seite Getretene,
hinter der schützenden Hecke,
Galopp, der dann war
auf dem Weg für immer
spanisch
in das Vorüber
gerundet.
Briefdatum 15.8. (Notiz vom 10.7.)
SIE UND DER BAUM
Exakt einen Monat nach Weihnachten roch es auf dem leeren Kirchenvorplatz, dort wo vor Weihnachten die Christbäume angeboten worden waren, plötzlich wieder nach Nadelwald […]
Das Herzzerreissende der Dinge, S. 14
Der aufweisende Satz gab mir ein
(es ist leicht mal Dezember),
eine Tanne (Fichte) für sie selbst (selbst sie)
irgendwohin (irrend jedoch)
in ihre Wohnung zu stellen.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaWüste „Weihnachts“-Idee…
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaWüste „Weihnachts“-Idee…
Was war die Idee?
Ei! –: Sieh, da ist
aaaaaaaaaaein Ding und ist doch eine Tanne!
Zauber. (Fichte Dich nicht,
aaaaaaaaTänzelnde, – ruhig,
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaruhig Blut!)
Und ich?
Weiß ich weiter?
Etwa Lametta?
aaaaaaaaaaDer Baum hält stand.
aaaaaaaaaaSein ergebenes Spitzauslaufen.
aaaaaaaaaaUnantastbares Abgesägtsein.
aaaaaaaaaaDie in den ehemals-Wuchs
aaaaaaaaaaverwendeten
aaaaaaaaaaZirkelstürze der Zweige am Stamm
aaaaaaaaaatarnen imaginär
aaaaaaaaaaeinen Alten-Rock über,
aaaaaaaaaaTuch des Verlöschens.
aaaaaaaaaaGroßmutter-Großmut. – Verhüllte
aaaaaaaaaaAltersgeneigtheit.
Ich büße Dich ein vor dem Baum!
Und doch nur Deinetwegen,
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaamein Beistand!
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaZweitblick!
der Einfall des Dramas!
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaVergessenes Rückgrat,
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaGespielin,
Schutzengel hinter mir
aaaaaaaaaaaaavor der unverträglichen Spitze,
aaaaaaaaaaaaavor der ungeborenen Spitze:
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaBor.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaMutabor.
Milchschwester, stunde,
Du meine schwarze Wolke, getreue,
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaeinzige Gewähr unterwegs!
Sie brennen so nicht.
Sie brennen nicht, nadeln
unter dem Griff,
auf Schritt und Tritt
bleiche Nadelmonde,
kleine Jenseitssicheln,
störrisch nun, gekippt, getragen,
zu Tage getragen, Wasser
ist ein Verbrennungsprodukt.
20.9. / Notizen vom 23.8.
Nach FAST EIN FRÜHLING DES MARKUS M.
zu Beginn von HEILIGENANSTALT:
Wie ich das Buch in die Hand nehme, beim Aufblättern
(wo war ich, wo werde ich wieder sein gleich?!),
beim inneren Aufblicken
erscheint mir die Lesebegegnung geschwind
amphitheatralisch, als ein Panorama,
aaawohl: blitzend, blendend, funkelnd,
aaawohl: frisch wie unberührt, belebend,
aaawohl: ungewohnt/unbewohnt,
aaawohl: winterähnlich,
wohl doch winterähnlich.
Auch spricht, wie der Bach hinter dem Haus,
aaaaaaaaaaaaden ich diesen Sommer kaum höre,
eine Sorge in dem Geschriebenen selbst –
unentwegt, recht gehört, wohlgemerkt
(von vielerorts außen zur Mitte hin trüge die Sorge,
gestaltet, gekleidet und abgebildet, mit einer Sprechblase vor):
Ob es wohl doch Winter sei?
Ist aber wo von Funkeln und Blitzen die Rede
(Gold, Heimspitzen, Schneid) – widerstrebe ich.
Nicht gutheißen kann ich das blinkende Auf-Begehren.
Wie bei der Droste damals: Nein der Miene.
Ist es der Elstern-Strich?
Vor meinem langsamen Westfalen-Blick?
Ein unseriöser (leichtes Spiel ist kein Spiel)
Griff, ein rascher, überrascher, überraschender?
Ein – schneller als du folgen kannst –
Erfolg, ja, nämlich: unversehens
(auf deiner überraschten Seite: nur Versehen!)
Schon nicht mehr im Gesichtskreis,
schon im Unvertrauten, nicht mehr recht Geheuren,
schon im Ungewissen, und gewarnt der Fuß,
der Schritt unwirklich kühl ins Mondscheinsilber…
Scharf dennoch unterscheidet,
pflugschar-(Flügel in den Lehm!)-scharf und -stur
das eingefleischte Weizenblonde-Blauäugige-Stämmige
in meinem Sinn – das so Behäbige blitzend! –:
Wie Tag und Nacht – Einheimsen und Stehlen.
Nein? Immerhin wird eingeheimst?
Unverkennbar?
Eingeheimst wird hinter/nach dem Stehlen unverkennbarer
als gestohlen (anderen etwas weggenommen) wird?
Freilich. Aber dann:
Wo denn ist das Heim?
Aha!
…
Blitze an sich sind langsam,
nur das Blitzen an ihnen ist schnell.
Aha!
Da ich mich erinnere
an das Blitzen und Funkeln der Droste
(mitunter im GEISTLICHEN JAHR:
aaaaaaaaaaGeschmeide, Königsprunk, Elsternstaat,
aaaaaaaaaaHellebarden, Gottesheer, Heroldgeschmetter),
als ich eintauche
in diese mir damals (ihretwegen!) – und ja immer noch –
peinliche, mich nötigende Aura, die blendet und betört,
fällt mir zum Trost ein: „blitzgescheit“.
Doch kaum notiere ich: „blitzgescheit“,
steht grauenerregend genaht
das „blitzsaubere Mädel“ da
(„Mama, Mama, ich will in den Brunnen“,
ruft himmlisch ein Herzblatt-Stimmchen,
„die blitzsaubere Windsbraut macht mir Angst!“).
Niemand spricht noch von „blitzgescheit“.
Und es ist doch das einzige wirklich
geheure und ohne weiteres sichtbare Blitzen
in Gesichtern, über Gesichter hin,
und „führt“ nicht und „lockt“ nicht, ist
ein Herzschlag von außen, ein Ankommen augenblicklich
endlich einmal…
Ach. Und rascher als blitzgescheit
aaaaabin ich begriffsstutzig eben,
aaaaawenn ich gelesenes Funkeln
aaaaabeifällig aufnehmen soll.
Aber „Blitzgescheit pickt die Henne das Korn“,
wirft das Thema jetzt selbständig ein,
aaaaa„blitzgescheit in der Ordnung der Dinge!“
und – nun doch wieder! – spüre ich
eine feine, geheime, so stille, sachte
(wie dämmerlicht sickernd)
Freude am Winter,
innige Sympathie für
Kristall an Kristall an… – und Einerlei,
denn so picken ja Hennen den Weizen.
Sollte es dämmern?
Sollte ich mich erhellen?
PS. (Du legst, weil du abwaschen willst,
aaaden Ring von Manfred ins offene Küchenfenster.
aaaDu siehst wieder hin: Er ist weg!)
Was kann wohl die Elster bewegen,
von der in ihr gipfelnden
aaaaaaaa(während der ihr bemessenen Frist
aaaaaaaain ihr schlußpünktlichen)
Natur her
auf Auffälliges solcherart (Glänzen, Funkeln) hin
so auffällig (berühmt, bezüngt) sie bewegen
zu dem raschen Entschluß-Husch?
Ihr eigenes Schwarz-Weiß?
Enthielte eine so schnellkräftige Bereitschaft
zur Übertreibung, Ausstechsucht, Manie??
Elke Erb, aus Elke Erb: Unschuld, du Licht meiner Augen, Steidl Verlag, 1994
Weiterer Beitrag zu diesem Buch:
Klemens Renoldner: Die Rätsel der Nähe
Die Presse, 23./24. 4. 1994
Friederike Mayröcker zum 70. Geburtstag
Ansprache im Literaturhaus Wien am 19. November 1994
Sehr liebe, verehrte Friederike Mayröcker,
ich komme als Bote vom Tübinger Hölderlinturm und bringe zur Eröffnung der Ausstellung liebe- und verehrungsvolle Grüße der Menschen – überwiegend junger Menschen −, die in seinen Mauern an zwei Abenden Ihnen lauschen durften: wir alle geeint im lebendigen Erinnern einer einzigartigen Dichterstimme, im sanften Zauber ihres verhaltenen Molltons; sie war dem großen toten Dichter, der in jenen Räumen die winterliche, lange Hälfte seines Lebens geweilt hatte, der Welt entrückt, uns gegenwärtig in der Aura, seines Schweigens, geheimnisvoll schwesterlich verbunden.
Ich rufe das Tübinger Ambiente zurück, des Tags Ihrer ersten Lesung im Hölderlinturm, am 18. Mai 1989, mit Ihren eigenen schönen Worten (aus Ihrer Rede anläßlich der Verleihung des Friedrich-Hölderlin-Preises der Stadt Bad Homburg im vorigen Jahr): „An diesem für mich so beglückenden sommerlichen strahlenden Tag“, sagten Sie, „die Studenten in weißen Kleidern so schien es mir, an das weiße Mäuerchen gelehnt, darunter der Neckar, wartend auf den Beginn meiner Lesung, überhaupt dieser weiße, weißleuchtende Tag, die Äste der Weiden tiefhängend ins Wasser, flüchtige Schatten, der Turm, der Garten, die Stille“.
Bei der gemeinsamen Lektüre zeitgenössischer Lyrik, die wir in unserem Tübinger Turm-Seminar pflegen, fanden wir immer wieder bestätigt, daß dieser Modus der Gedichtrezeption anregend und hilfreich ist. Denn es verhält sich keineswegs so, daß dadurch der individuelle Zugang zum Gedicht unterbunden wäre. Das Gegenteil ist unsere Erfahrung: die gemeinsame Rezeption aktiviert die individuelle, in die sie ja wieder einmündet.
Das gemeinsame Gespräch anhand des Texts fördert die Reflexion, worin das unmittelbare, subjektive Gedicht-Erlebnis sich objektiviert und intensiviert. Und vom Leser moderner Lyrik ist Reflexion gefordert, die der spontanen Rezeption rückverbunden bleiben muß: Diese ist Motor und Matrix der Reflexion und wird wiederum durch die Reflexion angereichert und verwandelt. Die „Anstrengung des Begriffs“ entspannt sich wieder in erneuter persönlicher Hingabe an das Gedicht, im erneuten persönlichen Gespräch mit dem Gedicht. Nachdem wir ausführlich über das Gedicht nachgedacht haben, lesen wir es wieder laut – und es spricht zu uns: dasselbe und ganz neu.
Doch bei Friederike Mayröcker war es noch etwas Besonderes. Denn unsere Leseerfahrung mit ihren poetischen Texten war in besonderem Maße spannend und ertragreich. Wir waren vor ihrer öffentlichen Lesung im Mai mit ihrer Lyrik befaßt gewesen. Ihre Poesie hatte uns zusammengeführt und verbunden, ihr Werk hatte schon zu uns gesprochen, bevor die Dichterin persönlich uns gegenüber saß und zu uns las und wir nachher in unserer Runde miteinander sprachen. Der Schwerpunkt unserer Seminararbeit lag auf dem Lyrikband Tod durch Musen der eine Produktion von 20 Jahren umspannt und dessen Erstausgabe schon beinahe 30 Jahre zurückreicht. Lange Gedichte in ihrer eigenwilligen, vielfältig nuancierenden Typographie (Querstriche, Klammern, Wechsel der Drucktypen, expressive Satzzeichen), die Sätze graphisch aufgesplittert und syntaktisch verbunden; Wechsel sehr kurzer und überlanger Zeilen, Zeilensprung, Isolierung und Profilierung des einzelnen Wortes in der Spannung von Rhythmus und Satz.
Damals glaubte ich, eine Affinität zu Gerard Manley Hopkins zu erkennen in der Geballtheit ganz neuer mächtiger nominaler Komposita, die den Versfluß schweren und stauen, und in der großräumigen, weiterdrängenden Rhythmik der Langzeilen. Jetzt begegne ich Hopkins in dem jüngsten Buch poetischer Prosa von Friederike Mayröcker, mit dem Titel Lection zitiert aus seiner Poetik, in der wunderbaren Übersetzung von Peter Waterhouses, Hopkins als ganz persönliche, ins Unterbewußte hineinwirkende poetische Suggestion. Wie doch zusammenfindet, was zusammen gehört!
Nach diesem „aside“ zurück zum Tod durch Musen: Zitate eingeblendet; ein verwirrendes Gemenge von vielfältigstern Erfahrungsstoff in abruptem Wechsel. Ohne das Gerüst einer Fabel finden die Wörter zueinander in unerwarteten Verbindungen und Verwandlungen. Es ist in eins: ein rhythmisch musikalisches Aufladen der Wortkörper und ein Musizieren der Konnotationen. Die Satzzeichen fungieren als Tonzeichen, die zum lauten Lesen herausfordern – mit dem gebotenen Wechsel des „Tons“.
Es war ein Abenteuer im vollen Wortsinn, worauf wir uns bei der geistigen Aneignung dieser Gedichte eingelassen hatten, zu regster Mittätigkeit gefordert. So tauchten wir ein in eine deutsche Sprachwelt ganz eigener Art, faszinierend und verwirrend: ein Kaleidoskop irisierender Wörter.
Weit Auseinanderliegendes war zusammengerückt, rieb sich aneinander, schichtete sich übereinander oder verschmolz.
Alles in turbulentem Fluß. Die Sätze, Satz-Fragmente, Wörter, aufgeladen mit Bedeutung in der ganzen Fülle disparater Bilder und vielfältiger Assoziationen.
Doch das Ganze erschien vorerst ohne kohärenten Sinn. Dann plötzlich die Erkenntnis vom inneren Zusammenhang, zu dem sich der spontane Eindruck subtiler phonischer und semantischer Assoziationen verfestigte.
Ein Netz von Entsprechungen war offensichtlich. Die Fülle der Wörter ordnete sich zu einheitlichen Wortfeldern. Das verwirrende Gemenge „schießt zusammen“, auch als Rezeptionserfahrung. („Es schießt zusammen“, so resümiert Friederike Mayröcker die Genese ihrer Texte). Es schießt zusammen, folgend der inneren Dynamik der Wörter, gebunden durch die Innenspannung ihres assoziativen Bezugs. Doch die überquellende Sprachenergie gehorcht einem subtilen Kunstverstand, gebändigt durch einen strengen Formsinn.
Friederike Mayröckers Dichtung, und das gilt für ihren Vers wie für ihre artverwandte poetische Prosa, hat die Konsistenz des Traums. Doch dies ist etwas qualitativ Verschiedenes von einem Traum-Protokoll. Daß der Versuch einer einfachen Niederschrift der uns im Schlaf geschenkten Träume es nicht schafft, bringt Friederike Mayröcker eindrucksvoll ins Wort. In einer knappen Selbstdarstellung in dem 1967 im Berliner Literarischen Colloquium von Walter Höllerer herausgegebenen Band Ein Gedicht und sein Autor sagt sie: Es gelinge nicht „diesen verästelten, komplizierten Traumkörper nachzuziehen“, man wird bald „enttäuscht ablassen, weil es unbefriedigend ist, Vages zu fixieren. Die wenigen Knotenpunkte des Traums konnte man ja reproduzieren, aber das Eigentliche, […] das Faszinierende, die Farbe konnte man nicht wiederherstellen; es ist nicht wiederzugeben, es war da als Traum, man hatte es sozusagen als Traum produziert, und das war schon das beste, was man tun konnte“.
Daß Sprache traumhaft wirke, bedarf der Sprache der Poesie. Valérys Unterscheidung von Poesie und Traum, Baudelaires Wort von der täglichen Arbeit als Schwester der Inspiration, gilt auch und gerade für die sich dem Unbewußten neu öffnende, von ihm neu befruchtete und gelockerte Dichtung des Surrealismus. Darauf, daß sie den Aggregatzustand des Traums durch die Kraft der Poesie neu erschaffen, beruht der Zauber der Verse und der poetischen Prosa Friederike Mayröckers.
Intendiert ist das Ineinandergreifen von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, das ganze Gemenge der sich überlagernden Schichten in seiner Totalität werden zu lassen. Das geschieht im Rückgriff der Erinnerung auf die unerschöpflichen Ressourcen der „Dunkelkammer der Kindheit“. Die Abgeschlossenheit ihrer Kindheit, erwägt Friederike Mayröcker in Ein Gedicht und sein Autor, habe vielleicht dazu beigetragen, daß sie zur Dichterin wurde, die „Kindheit eine […] Art Dunkelkammer, in der alles schon vorausentwickelt wurde“. Gisela Lindemann kommentiert: „In dieser Dunkelkammer sammelten sich vor allem verdeckte Erlebnisse an: eine ganze Welt von Unausgesprochenheiten, Andeutungen, behütenden Verschweigungen […]. Partikel davon tauchen immer wieder auf in Friederike Mayröckers Gedichten, und zwar unbeschönigt und unverfälscht, scheinbar ungeordnet wie in bösen Träumen, denen mit den anerzogenen Kategorien, womit wir unseren Alltag zu regeln pflegen, nicht beizukommen ist.“
Spurensuche – „in einem minutiösen Aufspüren der schier unerschöpflich aufrührerischen Potenzen der Kindlichkeit: das Unterbelichtete, Unbegriffene, die Verletzungen, das Aufbegehren, das Grausame, unbeschönigt und unverfälscht […] und über sie hinaus in eine nicht näher zu definierende Offenheit“.
Die Gesamtheit ihres Bewußtseins von der Welt in Sprache zu fassen, ist die Intention von Friederike Mayröckers dichterischem Schreiben: In Ein Gedicht und sein Autor beschließt sie ihre Selbstdarstellung: „Das ,freie‘ oder ,totale‘ Gedicht, das ich anstrebe […] ist meiner Vorstellung nach ein Gedicht, das einen Ausschnitt aus der Gesamtheit meines Bewußtseins von der Welt bringt. ,Welt‘ verstanden als etwas Vielschichtiges, Dichtes, Bruchstückhaftes, Unauflösbares“.
„Annnäherungen an etwas, an das ich nicht näher herangehen konnte, […] dessen ich nicht bewußter werden konnte, und damit auch für mich eine neue Situation, nicht nur für den Leser. Eine Situation, die durch ihren unbeendeten Reiz zu neuer Produktion drängt“ (1967).
Die sich dem Zugriff fertiger Begriffe verweigernde Welt motiviert das kreative Potential ihrer Sprache zu weiterdrängender Produktivität in einem Weiterschreiben aus immer neuem Ansatz, in immer neuer Annäherung an ein Uneinholbares. Dieser Prozeß in der Erkundung der vielschichtigen, geheimnisvollen Wirklichkeit ist Sprachgewinn, Terraingewinn. Beim Literarischen Colloquium Berlin im Winter 1966/67 erläutert Friederike Mayröker: „Ich schalte […] auf Erinnerungspunkte irgendwelcher Vergangenheit, [und] bringe dadurch, wenn es gelingt, etwas ganz intensiv in die Mitte meines Bewußtseins, wo es lebendig dasteht, zu sehen, zu hören, zu riechen, zu betasten, in einer Eigenbeweglichkeit, die es aus dem Zustand des Eingebettetseins in einen Erinnerungsablauf befreit. Es steht für sich da, an einer Stelle, die ihm gehört, statisch, und zugleich in einem Strahlenkranz von Assoziationsmöglichkeiten. Diesem zum Auseinanderfließen strebenden Ding wird von mir eine eiserne Form aufgesetzt.“
Der Begriff des Sprachexperiments deckt dieses Schreiben nicht ab. Das Etikett greift zu kurz wie jede andere Etikettierung gegenüber der singulären Erscheinung. Tiefgründig ist die Motivation, vielschichtig, wie ihr Gegenstand, ist die Substanz der dichterischen Texte Friederike Mayröckers. Ihrer Inkommensurabilität entspricht kein einsichtiges Strickmuster. Die Spur eigenen Erlebens zieht sich durch ihr ganzes Werk, artistisch transformiert im Prozeß ihres poetischen Fortschritts, von literarischen Einflüssen befruchtet und geschult, vom kreativen Impuls der Sprache vorangetrieben und überlagert, verfremdet, verdunkelt, irisierend, bis dann wieder der unmittelbare biographische Zusammenhang sich deutlich abzeichnet.
Gisela Lindemann beendet ihren schönen Beitrag zu Friederike Mayröcker mit dem Fazit: „Es gehört zur Inkommensurabilität all dieser Texte, zu ihrer Hinwendung nämlich auf bislang noch nicht sprachgewordenes, in der Zukunft angesiedeltes Bewußtsein, das die Welt in ihrer ganzen Widersprüchlichkeit wird aufnehmen müssen (zum Beispiel auch in der Unvergleichlichkeit weiblicher und männlicher Gefühle, einem Hauptgrund solcher Widersprüchlichkeit, um den die meisten Texte von Friederike Mayröcker kreisen), daß der poetische Stoff, aus dem sie gemacht sind, in allen literarischen Formen derselbe ist: im Gedicht und im Roman, im Prosatext und in der Biographie und sogar in jeder Art von theoretischer Selbstaussage.“ Der Fluchtpunkt solcher Texte bleibt immer die Unendlichkeit der Widersprüche; daher ihre prinzipielle Offenheit, die „durch ihren unbeendeten Reiz zu weiterer Produktion drängt“.
„Hinwendung auf bislang noch nicht sprachgewordenes, in der Zukunft angesiedeltes Bewußtsein“ – das ist das Stichwort, das mich an meinen Anfang zurückführt, zu Hölderlin, als ich der Lesung Friederike Mayröckers im Tübinger Hölderlinturm gedachte. Denn für die Hinwendung des dichterischen Sprechens auf ein in der realen Gegenwart abwesendes Bewußtsein, das in der Hochspannung der Innenwelt des Dichters lebendigst gegenwärtig war, im gewaltigen schöpferischen Griff in die Sprache über die Grenzen ihrer Syntax und Semantik hinaus, im Blick auf die ersehnte Realisierung in einer gemeinsamen humanen Zukunft, dafür ist Hölderlin das größte und tragisch großartige Beispiel. Darüber, was Friedrich Hölderlin für Friederike Mayröcker bedeutete und bedeutet, äußerte sie sich in der schon eingangs zitierten Rede: „Hölderlin eben: der war seit Jugendtagen die leuchtende Schrift an der Wand am Himmel im Buch“. Und weiter:
[…] tatsächlich scheint es etwas wie Parallelität, nein ein System kommunizierender Gefäße zwischen seinen, Hölderlins Schreibbildern, und meinen eigenen zu geben, dies sei in aller Bescheidenheit vorgebracht.
Sicher weist Friederike Mayröckers Schreiben keinen inhaltlichen und formalen Bezug zu „Hölderlins Schreibbildern“ auf, es lassen sich kaum Einflüsse und Anklänge aufzeigen. Das Bild von den „kommunizierenden Gefäßen“ verweist sowohl auf die Eigenständigkeit ihrer dichterischen Existenz und Schreibweise als auch auf eine Gemeinsamkeit fundamentaler Natur. Im selben Atem, wie Friederike Mayröcker von Hölderlins „leuchtender Schrift“, Zeichen und Botschaft an der Himmelswand spricht in der Vertikale des Aufblicks, bezeugt sie auch die konstitutive Horizontale des vegetativ Schöpferischen in der Genese ihres Schreibens, seines spezifisch weiblichen Ingeniums: „Und abermals diese weiblichen silbernen Schnüre: KANÜLEN im Wachen und Schlafen“, bekennt Friederike Mayröcker und statuiert weiter:
Nicht von ungefähr wähle ich das Bild der kommunizierenden Gefäße, bindet es doch gleichzeitig an jene Schreibtradition, der ich mich ähnlich verpflichtet fühle wie jener Hölderlins, der nämlich des Surrealismus.
Im Blick auf dieses Junktim beruht Friederike Mayröckers Affinität zu Hölderlin (unabhängig von Inhalt und Form seines Dichtens) auf der Faszination durch die Quellkraft seiner Sprache, Sprache in ihrer sinnlich-seelischen Totalität, Sprache als Wagnis, die aus sich ein „bislang noch nicht sprachgwordenes“ erschafft, eine Welt. Und ihre Affinität beruht auf ihrer starken Zuneigung zu dem in seiner Zeit vereinsamten, an seiner Zeit zerbrochenen großen Dichter, ihr entrückt in seinem Turm. Sie schloß ihren Vortrag mit der Lesung von Hölderlins Gedicht „Hälfte des Lebens“.
Gestatten Sie, daß ich mit einem Gedicht Friederike Mayröckers schließe, das sie im Gedenken ihres Besuchs in Tübingen geschrieben hat. Es ist ein kurzes Gedicht, überschrieben „Hölderlinturm, am Neckar, im Mai“, gewidmet der verdienstvollen Geschäftsführerin der Hölderlin-Gesellschaft Frau Valérie Lawitschka; es steht in dem jüngsten Gedichtband Das besessene Alter. Anläßlich von Friederike Mayröckers zweiter Lesung im Turm war unsere Seminarvorbereitung vor allem auf diese Gedichte ausgerichtet. Auch in der Kurzform (häufig mit Widmungen versehen und erkennbarem lebensgeschichtlichem Zusammenhang) war die Totalität des Bewußtseins zur Sprache gebracht.
In „Hölderlinturm am Neckar, im Mai“ ist auf knappstem Raum die Vielschichtigkeit eines Erlebnisses in sicheren Strichen gefaßt. Das Realsubstrat ist das Oval von Hölderlins leerem Zimmer im oberen Geschoß, die Fenster blicken auf den unmittelbar angrenzenden Neckar mit den Uferweiden, keine Möbel, auf der Wand gegenüber die vier späten Jahreszeitengedichte, gezeichnet „Scardanelli“. Auf dem Fußboden nur eine Vase mit roten Pfingstrosen, abgefallene Blätter davor. Die Bewegung des Gedichts folgt der Erinnerungsspur: vor dem Betreten des Zimmers das „lyrische Ich“, „die roten Blumen im Glas“, „gesäumt von abgefallenen Blütenblättern“, dann im Zimmer das Öffnen eines Fensters; die Stimme eines „Du“ bringt die Dimension der Vergangenheit in die Gegenwart und das Bewußtsein von Kontinuität:
im Garten sagst du die Bäume
sind noch die gleichen wie damals
In dem Bruchstück eines Dialogs schwingt neben den Worten Verschwiegenes mit im Bezug auf den Bewohner von einst. Dann, jenseits aller Worte, das Erklingen innerlich gehörter Musik, wie in dem abschließenden fortklingenden Hölderlinvers, den der Blick auf den Neckar assoziiert, der die Anwesenheit des Abwesenden manifest macht:
HÖLDERLINTURM, AM NECKAR, IM MAI
diese Prise Hölderlin
im hellroten Hölderlinzimmer /
im Korridor stehend
fällt mein Blick auf die roten Blumen im Glas
gesäumt von abgefallenen
Blütenblättern
nichts sonst /
das Zimmer leer nur die Vase die Blumen
zwei alte Stühle −
ich öffne ein Fenster
im Garten sagst du die Bäume
sind noch die gleichen wie damals
aber man hört einen Ton Musik es
glänzt die bläuliche Silberwelle
Paul Hoffmann, in Paul Hoffmann: Das erneute Gedicht, Suhrkamp Verlag, 2001
Scherben eines großartigen Frauenzimmers
– Friederike Mayröckers Nachrichten aus dem Bleistiftgebiet. –
Friederike Mayröckers Werk gilt als Fall für Spezialisten, ihre lyrische und erzählerische Poesie als Verschlußsache, die Autorin als Vertreterin einer Sprachkunst, die ihren Mitteilungscharakter aufs Spiel setzt. In Zeiten, wo das Schreiben breite Wirkungen vor allem mit autobiographischer Literatur erzielt, wo die Autobiographie mit ihrer täuschenden Nähe zur autobiographischen Person Kontaktbedürfnisse der Leser zu befriedigen scheint, ist der vermeintlich hermetische Fall Friederike Mayröcker ein groteskes Mißverständnis, denn Friederike Mayröcker schreibt seit rund vier Jahrzehnten ein Buch des Lebens. Allerdings ist ihr Werk von der vermeintlich nackten Authentizität konventioneller Lebenserzählungen weit entfernt.
Ihre Autobiographie ist Kunstpraxis. Das Leben, aus dem berichtet wird, besteht aus dem Alltag einer Wiener Schriftstellerin zwischen häuslichem Dasein und Reisen, zwischen Freundschaften, Krankenbesuchen, Erinnerungen, Lektüreerfahrungen, Stimmungsdramen, Naturerlebnissen, städtischem Leben. Aber zum Sozialstoff dieser Biographie zählt, neben den inneren und äußeren Ereignissen des Daseins, die Sprache. Die Sprache ist die erste Gesellschaft des poetischen Ich und das Schreiben ein Lebensvorgang, der die Ehe mit ihr schildert. Darum gehören zu den spannungsvollen Erlebnissen der Mayröcker-Lektüre die inneren Machtverhältnisse des Textes, der mehrsprachig ist, die Zänkereien, vor allem aber die Bündnisse zwischen Sprache und Sprechen, zwischen anonymen Idiomen und der Innenstimme der Autorin.
Auf dem Spiel stehen bei dieser Art lebensgeschichtlichen Schreibens keine Wahrheiten der biographischen Aussage. Nicht die Fiktion, die das Erzählen einer Geschichte unweigerlich erzeugt, tastet Authentizität erzählten Lebens an. Auf dem Spiel steht, im äußersten Fall, das Schreiben selbst. Es vollzieht sich auf einer breiten Tonskala zwischen chorischen Formen, wenn das poetische Ich passiv den Fahrbahnen der vorhandenen Sprache folgt, und den herrlichen solistischen Einsätzen, die souverän, bei vollkommener Beherrschung auch der komischen Mittel, ihr Mitteilungsrepertoire zwischen reinem „Gedankenleben“ und nackter „Nervenschrift“ entfaltet, zwischen gefaßten und vegetativen „Löschblatt“-Zuständen des Bewußtseins, zwischen umarbeitender Imagination und gerader Wahrnehmung. In einem ganz unheroischen Sinn geht es im Bleistiftgebiet Friederike Mayröckers um Sein oder Nichtsein. So dringt ihre lyrische und erzählerische Poesie ohne pseudospontanes Gestammel oder erhabenes Großvokabular bis zu Grenzzonen des Schweigens vor. Die Ränder werden bebildert oder im konkreten Verfahren beredt gemacht.
Friederike Mayröcker, 1924 geboren, ist neben Ingeborg Bachmann die zweite große Frauenfigur der modernen österreichischen Literatur. Das Leben der gebürtigen und lebenslänglichen Wienerin besteht, seit sie sich 1969 als Hauptschullehrerin vom Dienst freistellen ließ, aus einer Folge von Buchpublikationen, Vortrags- und Lesereisen, künstlerischen Mitgliedschaften, öffentlichen Ehrungen und der inzwischen fast vierzigjährigen Lebensgemeinschaft mit dem Schriftsteller Ernst Jandl. Leben und Schreiben sind in ihrem Falle geradezu austauschbar. Der „Biographielosigkeit“ ihres Lebensprogramms steht eine überaus dynamische und in ihren ästhetischen Entwicklungen kühne Schreibgeschichte gegenüber.
Sie hat Ende der vierziger Jahre mit konventionellen Liebes- und Naturgedichten und religiöser Lyrik begonnen. Daneben entstand stark auobiographisch gefärbte Kurzprosa. Die Phase des literarischen Experiments beginnt in den fünfziger Jahren im Dialog mit der Wiener Gruppe um Oswald Wiener, Konrad Bayer, H.C. Artmann und Gerhard Rühm. Die Wiener Gruppe ging aus der politischen Auseinandersetzung junger Nachwuchsschriftsteller mit dem Konservativismus des geistigen Wien in der ersten Nachkriegszeit hervor. Unter dem Einfluß der Sprach- und Erkenntnisphilosophie Ludwig Wittgensteins und Fritz Mauthners definiert der Theoretiker der Gruppe, Oswald Wiener, die Literatur als methodische Arbeit und Auseinandersetzung mit dem begrenzten, den individuellen Ausdruck einschränkenden Zeichensystem Sprache. Im Rückgriff auf die historischen Avantgarden des Dadaismus, Expressionismus, Surrealismus und Konstruktivismus entstehen Dialektgedichte, Ideogramme, Antiromane, Lautgedichte, automatische und Sehtexte – eine Konkrete Literatur, deren Autoren sich höchst nüchtern als collagierende, montierende, konstruierende Kunsttechniker verstehen. Friederike Mayröcker schreibt in dieser Zeit Kinderbücher, Langgedichte, Prosa, auch eine Reihe von Hörspielen, vier davon in Zusammenarbeit mit Ernst Jandl. Die humoristische Sprachspielerin und Wortmaterialistin Mayröcker, die mit Comic-strip-Formen, dem Tonbandprotokoll, mit Science-fiction, mit Spiegeltexten, der Oper, Fibeltafeln, Wortketten, Psalmregistern, dem Logbuch experimentiert, holt sich ihr Sprachmaterial aus Wörterbüchern, aus Fibeln, dem Dialekt, dem Geheimdienst, dem Jazz, der Bibel, Südtiroler Regionaldialekten, der Kirchensprache.
1971/72 entsteht die Erzählung „je ein umwölkter gipfel“. Damit beginnt eine Auseinandersetzung mit inhaltlichen Formen des Erzählens. Prosaarbeiten wie „meine träume ein flügelkleid“, vor allem aber, in demselben Jahr 1974 erschienen, „augen wie schaljapin bevor er starb“ verbinden Formen des Sprachexperiments mit dem erzählerischen Bericht.
Die Hinwendung, zu prozessualen Formen des Schreibens verhilft einer Subjektivität zum Ausdruck, die dem Zweifel an der Vorstellung vom einheitlichen, identischen, selbstbestimmten menschlichen Subjekt entspringt. Die Texte, die alle Anfang der siebziger Jahre entstehen, integrieren surreale Techniken des Traums, konkrete Formen des Ausdrucks, die zerbrochene Sprache vorreflexiver Zustände des Bewußtseins bis hin zu mimetischen Verfahren. Auf dem Höhepunkt dieser Entwicklung, in den 1980 erschienenen Abschieden, erreicht sie ein vollkommenes Gleichgewicht zwischen methodischer Arbeit und vitalen Schreibimpulsen, zwischen rhetorischer Organisation und freien Erlebnisformen des Poetischen, zwischen lyrischen und erzählerischen, symbolischen und konkreten, rationalen und expressiven Ausdrucksformen. Die Abschiede, eine breite, mythologisch grundierte Erzählreflexion über das Motiv Abschied als Lebensmuster, schließen eine literarische Entwicklung ab und legen den Grundstein für die Gedicht- und Prosabände der folgenden Jahre bis hin zu ihrem eben erschienenen Gedichtband Das besessene Alter.
… auf das Haltlose und Disziplinierteste des Schreibens seien ihre Anliegen damals ausgerichtet gewesen, nämlich am haltlosesten und diszipliniertesten seien die Vorstellungen ihres Schreibens in dieser Phase gewesen, so als hätten sich ihr in einer hinreißenden Besessenheit, in einer schweren und verzweifelten Erhitzung die hauchartigen Einschübe zwischen den Wörtern als rasende Küsse zu erkennen gegeben – in befremdender Weise sich ihr jedoch plötzlich wieder entzogen – Aufwallungen der Zunge / als Taschist ein Opiumesser.
Diese Selbstinterpretation in Die Abschiede kombiniert zwei Sprachen: eine gesteuerte inhaltliche Aussage, die an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrigläßt, und eine sinnliche, pinselnde, deskriptive Bildersprache, deren Gegenstand die naturhaft orale Rausch- und Triebtätigkeit des Sprachorgans ist. Der Text verknüpft seinen Kommentarteil assoziativ mit dem Bild einer abschiednehmenden Figur, die „haltlos winkt“. Nicht die inhaltliche Mitteilung, sondern das rohe Sprachmaterial stiftet den Zusammenhang der Prosaeinheit. Die fiktive Erzählerin ist nicht die unumschränkte Herrin des Textes. Die Sprache ist ihre Miterzählerin.
In seiner formalen Verfassung ist das Buch eine Kündigungsschrift. Die linear geordnete, hierarchisch strukturierte Geschichte, das Erzählen als Form der Ereignisorganisation, wird aufgegeben. Unausgesprochen steckt in der narrativen Verweigerung der Protest gegen die Grenzen traditioneller Ordnungen, Logiken und Sinnkonstruktionen. Der Verzicht auf die traditionellen Requisiten des Erzählens und die Erneuerung seiner Architekturen hat die Autorin später als Erzählen „zwischen den Diskursen“ bezeichnet.
Der Einfluß des Surrealismus und des Dadaismus auf ihr Schreiben ist evident. Friederike Mayröcker hat selbst auf diese Tatsache hingewiesen. Mit den beiden Stilrichtungen benennt sie ästhetische Oppositionen der klassischen Moderne. Der Dadaismus verkörpert die rationalistische, einer Ästhetik des Machens verpflichtete Moderne. Der Surrealismus dagegen entdeckte unter dem Einfluß der Psychoanalyse das Unbewußte als schöpferisches Potential. In der Technik der „écriture automatique“, im automatischen, vom identischen Ich nicht gesteuerten Schreiben, soll nach den Vorstellungen der surrealistischen Literaturtheorie diese Dunkelzone des Ich ans Licht geholt werden.
Ein Denkmal setzt Friederike Mayröcker dem Surrealismus in einer Fülle von Zitaten und Anspielungen, darunter einer kleinen literarischen Ahnenreihe in Das Herzzerreißende der Dinge:
ich kann mich verständigen, ich kann mich nicht verständigen, ich bin einmal dort, ich bin einmal mit ihm, ich bin einmal ohne ihn, ich gehe mit Goya um, ich gehe mit Dalí um, ich kann mich mit Goya verständigen, ich kann mich mit Dalí verständigen, mit Derrida sofort, undsofort…
Die Ahnentafel stellt nebeneinander den Surrealisten Salvatore Dalí und den französischen Poststrukturalisten Jacques Derrida, den sie schon in der ein Jahr zuvor erschienenen Reise durch die Nacht zitierend einführt hatte. Damit zeigt sie auf die gewisse Verwandtschaft zwischen dem Vertreter der surrealen, psychische Zustände abbildenden Malerei und dem Theoretiker des Dekonstruktivismus, der den Begriff der „psychischen Schrift“ geprägt hat. Zu Derridas Lehrgebäude gehört ein Verständnis der Begriffe Text und Schrift, die deren vermeintlich einfache Mitteilungseigenschaften radikal in Frage stellt. Danach ist die Schrift ein Schauplatz des Verdrängten und Apokryphen. Die Lektüre dient der psychoanalytischen Rekonstruktion unbewußt und unwillentlich in den Text eingekerbter affektiver Mitteilungen.
Friederike Mayröckers Texte sind seit den Abschieden Aufzeichnungen aus einem Schreibleben, zu dessen Voraussetzungen die Gewißheit und Zulassung einer nicht durchgesteuerten „Nervenschrift“ gehört. Ihr Co-Produzent ist die Sprache. Das Schreibleben, aus dem sie berichtet, handelt zuallererst vom launischen Zusammenleben mit ihr. Berichtet wird von den ichschwachen Zuständen reiner Gefolgschaft auf den Fahrbahnen der Sprache und den solistischen Sprachauftritten eines selbstgewissen, textbestimmenden Ich.
Die Ahnengalerie in Das Herzzerreißende der Dinge, ist Teil des ersten Kapitels, das „Amok in die Blumen“ überschrieben ist. Das Nebeneinander panischen Außersichseins und anorganischer Natur ist Teil einer Zustandsbeschreibung, die als „Hölle“ bezeichnet wird. Die „Selbstaufgabe“, „Seelenverlorenheit“ und „Leere“, von der dort die Rede ist, rückt in unmittelbare Nachbarschaft zum entstehungsgeschichtlichen Ort des Textes, zum „Anfang“ der Erzählung, der an den Übergang zwischen Tag und Nacht plaziert wird, zwischen Wachen und Schlafen, zwischen Geistesgegenwart und Traum. Der Text entwickelt an dieser Stelle beispielhaft für das ganze Buch eine Bildlichkeit, die ihr Zeichenmaterial verschiebt – in der Sprache der Semiotik: ihre Signifikanten. So entfaltet sich ein breiter Bedeutungsfächer, von „Beginn der Erzählung“, „Herkunft des Textes“, „Leere“, „Abwesenheit“, „Sprachlosigkeit“, „Vergessen“, „Leblosigkeit“, „Finsternis“ bis zu „Nacht“ und „Tod“…
Auf der entgegengesetzten Seite des Textes liegt jenes „Lusthaus“ der Kunst, an das sich Bilder künstlerischer Gemeinschaft und Verständigung knüpfen, Nähe, Inspiration, Glück und ein schwereloses Frühlingsleben mitten im Winter. Am Ende taucht der mythologische Kunstvogel Phönix auf. Die Wirklichkeit hat sich inzwischen längst in eine Wirklichkeit aus Sprache verwandelt.
Das Textbegehren, das zu ihm hinführt, wird in Mein Herz mein Zimmer mein Name immer wieder als die Erfüllung von Wünschen beschrieben, die in den Grenzen des Körpers, mit den fünf Sinnen, nicht befriedigt werden können. Die schöpferischen Vorgänge bei der Enthüllung von Kunst sind Verlängerungen, ja der eigentliche Höhepunkt erotischen Erlebens. In einer Schlüsselszene des Buchs wird in einer Lautverschiebung von „Ohrenzeug“ zu „Oberzeug“ die Wahrnehmung der empirischen Wirklichkeit stufenweise ersetzt durch eine Liebesszene, dann durch den Akt poetischer Imagination.
Die Korrespondenz mit neueren Subjekt- und Texttheorien, namentlich der des Franzosen Jacques Lacan, stellt die Autorin mit Zitaten explizit her. Damit legt sie Spuren zu einer Theorie, die Bewußtsein an Zeichenstiftung bindet. Das Subjekt wird bei Lacan nicht mehr als eine mit sich selbst identische und weltbildende Bewußtseinsinstanz gedacht, sondern es artikuliert sich im Zirkel einer Reflexion, die der imaginären Einheitsbildung des Ich dient. Die Geschlechtsidentität ist dann nicht mehr kausal an das Geschlecht gebunden, folglich auch nicht determiniert wie dieses. Der Identitätsbegriff löst sich von dem des Geschlechts. Es gibt keine festgelegte weibliche oder männliche Identität. Namentlich Derrida sieht im Weiblichen ein Potential, die festgelegte Geschlechteropposition aufzulösen und das geltende System männlicher Identitätsbestimmungen abzusetzen.
Das lebensgeschichtliche, nichtbiographische Schreiben Friederike Mayröckers ist eine poetische Einlösung solcher Vorstellungen. Ihre poetische Biobibliographie besteht aus Aufzeichnungen eines vielgestaltigen, beweglichen Ich, das sich in einem nie abgeschlossenen Prozeß des Schreibens selbst erzeugt. In der Sprache vollziehen sich zwischen Ohnmachts- und Allmachtszuständen der Sprechenden, zwischen gefaßten und vegetativen Bewußtseinslagen, zwischen Sein und Nichtsein Selbstvorwürfe jenseits von Geschlechtszuschreibungen, Bildnisse einer lebendigen Kunst, die ein Treffpunkt von Sprachen ist, eigener und fremder, ein Werk, das den Titel „Leben“ tragen könnte.
Sibylle Cramer, neue deutsche literatur, Heft 496, Juli/August 1994
LATEINISCHES GEDICHT
für friederike mayröcker
aaaaai
unterhalb
der zur linken liegt
so tief hinab
an einen punkt unterhalb
tiefer als
emporrücken
nachstehend
aaaaaii
erregen
angreifen
stammeln
sehr jung
unruhig
bedrohlich
höllendunkel
hineinstopfen
aaaaaiii
der unterste teil
an der wurzel
heineinbringen
gezückt
zu hoch
zu tief
ins grab tragen
liegeordnung
aaaaaiv
der niedrigste
der geringste
der schlechteste
styx
aufsieden
aus der tiefe der brust
der tiefe des herzens
renovare dolorem
aaaaav
bis zur rechten
bis zur linken
bis zum auge
tief hinab
baum
ohne früchte
galgen
so tief hinab
aaaaavi
hydra
inferno
opferwein
dem unglücksvogel
stürzen
ohne zustande gebracht zu haben
ohne zu beenden
silberbarren
aaaaavii
die wurzeln der hörner
sinkt ganz unter
brach einen streit vom zaun
sinkt ganz unter
das verlegene stammeln der scham
sinkt ganz unter
aufs pferd setzen
pluto
Ernst Jandl
Hans Ulrich Obrist spricht über die von ihm kuratierte Ausstellung von Friederike Mayröcker Schutzgeister vom 5.9.2020–10.10.2020 in der Galerie nächst St. Stephan
Friederike Mayröcker übersetzen – eine vielstimmige Hommage mit Donna Stonecipher (Englisch), Jean-René Lassalle (Französisch), Julia Kaminskaja (Russisch) und Tanja Petrič (Slowenisch) sowie mit Übersetzer:innen aus dem internationalen JUNIVERS-Kollektiv: Ali Abdollahi (Persisch), Ton Naaijkens (Niederländisch), Douglas Pompeu (brasilianisches Portugiesisch), Abdulkadir Musa (Kurdisch) und Valentina di Rosa (Italienisch) und Bernard Banoun – im Gespräch mit Marcel Beyer am 6.11.2021 im Literaturhaus Halle.
räume für notizen: Friederike Mayröcker: Frieda Paris erliest ein Langgedicht in Stücken und am Stück, Juliana Kaminskajas Film das Zimmer leer wird gezeigt. Die Moderation übernimmt Günter Vallaster am 29.1.2024 in der Alten Schmiede, Wien
Fest mit WeggefährtInnen zu Ehren von Friederike Mayröcker Mitte Juni 2018 in Wien
Sandra Hoffmann über Friederike Mayröcker bei Fempire präsentiert von Rasha Khayat
Im Juni 1997 trafen sich in der Literaturwerkstatt Berlin zwei der bedeutendsten Autorinnen der deutschsprachigen Gegenwartslyrik: Friederike Mayröcker und Elke Erb.
Protokoll einer Audienz. Otto Brusatti trifft Mayröcker: Ein Kontinent namens F. M.
Zum 70. Geburtstag der Autorin:
Daniela Riess-Beger: „ein Kopf, zwei Jerusalemtische, ein Traum“
Katalog Lebensveranstaltung : Erfindungen Findungen einer Sprache Friederike Mayröcker, 1994
Ernst Jandl: Rede an Friederike Mayröcker
Ernst Jandl: lechts und rinks, gedichte, statements, perppermints, Luchterhand Verlag, 1995
Zum 75. Geburtstag der Autorin:
Bettina Steiner: Chaos und Form, Magie und Kalkül
Die Presse, 20.12.1999
Oskar Pastior: Rede, eine Überschrift. Wie Bauknecht etwa.
Neue Literatur. Zeitschrift für Querverbindungen, Heft 2, 1995
Johann Holzner: Sprachgewissen unserer Kultur
Die Furche, 16.12.1999
Zum 80. Geburtstag der Autorin:
Nico Bleutge: Das manische Zungenmaterial
Stuttgarter Zeitung, 18.12.2004
Klaus Kastberger: Bettlerin des Wortes
Die Presse, 18.12.2004
Ronald Pohl: Priesterin der entzündeten Sprache
Der Standard, 18./19.12.2004
Michael Braun: Die Engel der Schrift
Der Tagesspiegel, 20.12.2004.
Auch in: Basler Zeitung, 20.12.2004
Gunnar Decker: Nur für Nervenmenschen
Neues Deutschland, 20.12.2004
Jörg Drews: In Böen wechselt mein Sinn
Süddeutsche Zeitung, 20.12.2004
Sabine Rohlf: Anleitungen zu poetischem Verhalten
Berliner Zeitung, 20.12.2004
Michael Lentz: Die Lebenszeilenfinderin
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 20.12.2004
Wendelin Schmidt-Dengler: Friederike Mayröcker
Zum 85. Geburtstag der Autorin:
Elfriede Jelinek, und andere: Wer ist Friederike Mayröcker?
Die Presse, 12.12.2009
Gunnar Decker: Vom Anfang
Neues Deutschland, 19./20.12.2009
Sabine Rohlf: Von der Lust des Worte-Erkennens
Emma, 1.11.2009
Zum 90. Geburtstag der Autorin:
Herbert Fuchs: Sprachmagie
literaturkritik.de, Dezember 2014
Andrea Marggraf: Die Wiener Sprachkünstlerin wird 90
deutschlandradiokultur.de, 12.12.2014
Klaus Kastberger: Ich lebe ich schreibe
Die Presse, 12.12.2014
Maria Renhardt: Manische Hinwendung zur Literatur
Die Furche, 18.12.2014
Barbara Mader: Die Welt bleibt ein Rätsel
Kurier, 16.12.2014
Sebastian Fasthuber: „Ich habe noch viel vor“
falter, Heft 51, 2014
Marcel Beyer: Friederike Mayröcker zum 90. Geburtstag am 20. Dezember 2014
logbuch-suhrkamp.de, 19.1.2.2014
Maja-Maria Becker: schwarz die Quelle, schwarz das Meer
fixpoetry.com, 19.12.2014
Sabine Rohlf: In meinem hohen donnernden Alter
Berliner Zeitung, 19.12.2014
Tobias Lehmkuhl: Lachend über Tränen reden
Süddeutsche Zeitung, 20.12.2014
Arno Widmann: Es kreuzten Hirsche unsern Weg
Frankfurter Rundschau, 19.12.2014
Nico Bleutge: Die schöne Wirrnis dieser Welt
Der Tagesspiegel, 20.12.2014
Elfriede Czurda: Glückwünsche für Friederike Mayröcker
Manuskripte, Heft 206, Dezember 2014
Kurt Neumann: Capitaine Fritzi
Manuskripte, Heft 206, Dezember 2014
Elke Laznia: Friederike Mayröcker
Manuskripte, Heft 206, Dezember 2014
Hans Eichhorn: Benennen und anstiften
Manuskripte, Heft 206, Dezember 2014
Barbara Maria Kloos: Stadt, die auf Eisschollen glimmt
Manuskripte, Heft 206, Dezember 2014
Oswald Egger: Für Friederike Mayröcker zum 90. Geburtstag
Manuskripte, Heft 206, Dezember 2014
Péter Esterházy: Für sie
Manuskripte, Heft 206, Dezember 2014
Wilder, nicht milder. Friederike Mayröcker im Porträt
Zum 93. Geburtstag der Autorin:
Einsame Poetin, elegische Träumerin, ewige Kinderseele
Die Presse, 4.12.2017
Zum 95. Geburtstag der Autorin:
Claudia Schülke: Wenn Verse das Zimmer überwuchern
Badische Zeitung, 19.12.0219
Christiana Puschak: Utopischer Wohnsitz: Sprache
junge Welt, 20.12.2019
Marie Luise Knott: Es lichtet! Für Friederike Mayröcker
perlentaucher.de, 20.12.2019
Herbert Fuchs: „Nur nicht enden möge diese Seligkeit dieses Lebens“
literaturkritik.de, Dezember 2019
Claudia Schülke: Der Kopf ist voll: Alles muss raus!
neues deutschland, 20.12.2019
Mayröcker: „Ich versteh’ gar nicht, wie man so alt werden kann!
Der Standart, 20.12.2019
Zum 96. Geburtstag der Autorin:
Fakten und Vermutungen zur Autorin und Interview 1, 2, 3 & 4 +
Archiv 1, 2 & 3 + Internet Archive + KLG + IMDb + ÖM + Kalliope +
DAS&D + Georg-Büchner-Preis 1 & 2
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Galerie Foto Gezett +
Dirk Skiba Autorenporträts + Autorenarchiv Susanne Schleyer +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + Keystone-SDA +
deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Friederike Mayröcker: Standart ✝︎ NZZ 1 + 2 ✝︎ SRF ✝︎
FAZ 1 + 2 ✝︎ Tagesspiegel ✝︎ FAZ ✝︎ Welt 1 + 2 ✝︎ SZ ✝︎ BR24 ✝︎ WZ ✝︎
Presse ✝︎ FR ✝︎ Spiegel ✝︎ Stuttgarter ✝︎ Zeit 1 + 2 + 3 ✝︎ Tagesanzeiger ✝︎
dctp ✝︎ Kleine Zeitung ✝︎ Kurier ✝︎ Salzburger ✝︎ literaturkritik.de 1 + 2 ✝︎
junge Welt ✝︎ ORF 1 + 2 ✝︎ Bayern 2 1 + 2 ✝︎ der Freitag ✝︎ Die Furche ✝︎
literaturhaus ✝︎ WOZ ✝︎ NÖN ✝︎ BaZ 1 + 2 ✝︎ Poesiegalerie ✝︎
Friederike Mayröcker – Trailer zum Dokumentarfilm Das Schreiben und das Schweigen.
Fakten und Vermutungen zur Herausgeberin + KLG + IMDb +
Archiv + PIA + weiteres 1, 2 & 3 +
Georg-Büchner-Preis 1 & 2
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Dirk Skiba Autorenporträts +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + Galerie Foto Gezett 1, 2 & 3 +
deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Elke Erb: FAZ ✝︎ BZ 1 + 2 ✝︎ Tagesspiegel 1 +2 ✝︎ taz ✝︎ MZ ✝︎
nd ✝︎ SZ ✝︎ Die Zeit ✝︎ signaturen ✝︎ Facebook 1, 2 + 3 ✝︎ literaturkritik ✝︎
mdr ✝︎ LiteraturLand ✝︎ junge Welt ✝︎ faustkultur ✝︎ tagtigall ✝︎
Volksbühne ✝︎ Bundespräsident ✝︎
Im Universum von Elke Erb. Beitrag aus dem JUNIVERS-Kollektiv für die Gedenkmatinée in der Volksbühne am 25.2.2024 mit: Verica Tričković, Carmen Gómez García, Shane Anderson, Riikka Johanna Uhlig, Gonzalo Vélez, Dong Li, Namita Khare, Nicholas Grindell, Shane Anderson, Aurélie Maurin, Bela Chekurishvili, Iryna Herasimovich, Brane Čop, Douglas Pompeu. Film/Schnitt: Christian Filips
Elke Erb liest auf dem XVII. International Poetry Festival von Medellín 2007.
Elke Erb liest bei OST meets WEST – Festival der freien Künste, 6.11.2009.


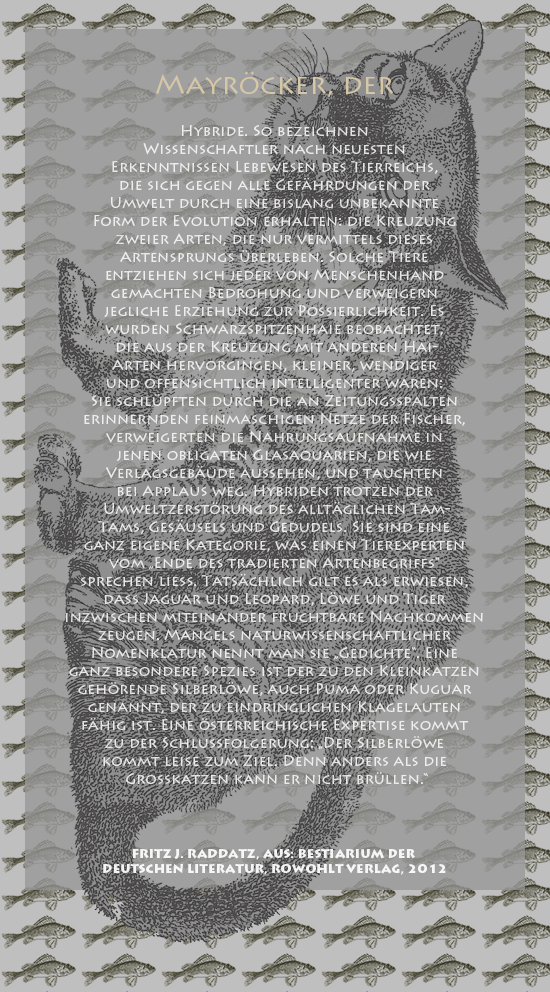













Schreibe einen Kommentar