Gerhard Falkner: Über den Unwert des Gedichts
-
Die Postmoderne ist die Kultur in den Wechseljahren.
- Dichtung ist Wahrheit.
- Der Kulturpessimismus verhält sich zu seiner Veranlassung wie das Bamberger Hörnchen zum Welthunger.
- Eine Geliebte trägt das Gedicht wie einen schwarzen Handschuh in stockdunkler Nacht.
- ICH SPRACHE NICHT, ICH SUCHE!
- Sind Gedichte unverständlich, so ist der, der sie nicht versteht, der Grund für ihre Unverständlichkeit.
- News is Advertisement for Reality.
- Die Tat feiert, das Wort wird putzen geschickt.
- Die Schönheit des Gedichts ist hartnäckiger als die Schärfe des Geschlechts.
- Die Entgegnung ist die einzige Erläuterung des Gedichts, die keine Obduktion ist.
- In der Entgegnung schöpft das Gedicht Verdacht auf seine Bedeutung.
- In der Gleichzeitigkeit gibt es keine Rechtzeitigkeit.
- Der Begeisterte erkennt das (wahre) Gedicht sogar am Geruch.
- Die Beschreibung eines Niedergangs beschleunigt diesen und vertieft ihn.
- Wo es nichts zu sagen gibt kann man von Glück erst reden wenn man schweigt.
- Das Gedicht macht den eigenen Körper erst spruchreif.
- Die Theorie muß man kennen, aber die Sinne müssen über die Theorie sich lustig machen.
- Der Wert des Gedichts bezeichnet im Nullpunkt als Unwert das Erlöschen jeglicher Idealität.
- Im Gedicht sitzen die Schwellkörper der Sprache.
- Ohne Poesie ist der Traum vom eigenen Körper rasch ausgeträumt.
- Die Sprache ist unhörbar, hörbar ist nur die Stimme.
- Das wahre Gedicht wächst einem schnell über den Kopf.
- Die französischen Denker sind die Sekretäre der deutschen Philosophie.
- Die Poesie ist der Wurf, von dem die Philosophie sich Notizen macht.
- Gedichte sind geradezu umsonst, damit eben aber auch – nahezu unbezahlbar.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaausw.
N-A-C-H-W-O-R-T
„Über den Unwert des Gedichts“ ist ein Auszug aus den „Ungeputzten Notizen“, in denen ich Aufzeichnungen zu Sprache, Dichtung und Zeitlage gemacht habe. Der dort agierende Widerspruch zwischen polemischer Verneinung und hilfloser Begeisterung wurde nicht aufgelöst, eine Systematisierung der Grundgedanken vermieden.
Der Begriff Poesie wird verallgemeinernd und vorsätzlich diffus gebraucht, sowohl in der breiten Auslegung, die ihm Aristoteles in seiner Poetik einräumt, wo er durch Epik, Komödie und Tragödie in die poetische Mimesis allgemein hineinreicht (obwohl da bereits eingeschränkt wird: „Allerdings verknüpft eine verbreitete Auffassung das Dichten mit dem Vers“), als auch im verabsolutierten Sinne der Romantik, Baudelaires und der Vormoderne, dann wieder als das schlichte, anspruchslose Poetische im Allgemeinen, bis zum kraftlosen Lyrikbegriff schließlich, zu dem er sich zuletzt banalisiert hat. Erst diese mangelnde Trennungsschärfe scheint mir, eine Ausdifferenzierung nach der umfassenden Veranlagung des Gedichts zu ermöglichen.
„Über den Unwert des Gedichts“ entwickelt sich zuerst um zwei Kerngedanken (Gedankenkerne), dem der „geführten Sprache“ (als nicht-poetischer, nicht animierender Sprache), und dem der „Entgegnung“, mit der eine Geschärftheit des Ohrs, ein unzeitgemäßer Wille zur Vertiefung, Verinnerlichung, Verdeutlichung und Wiederholung gefordert wird. In Übereinstimmung mit Rilkes „nirgends, Geliebte, wird Welt sein als Innen“ zielt die Entgegnung auf Setzung und Behauptung des emphatischen Raums: auf die innere Nach-Drücklichkeit, und grenzt den linearen Leser als unzulänglich und dem Gedicht nicht zumutbar aus.
Der Teil Differenz ist polemisch und beschreibt vagabundierend Einzelheiten, die zum Ruin der inneren Welt und zum Ende ihrer Dichtbarkeit führen. In die Unweigerlichkeit dieser auflösenden Prozesse tritt adlativ der im „kulturellen Gehege“ verkümmernde Dichter.
Dem Gedicht erwächst aber durch die breite Mißachtung, Schwerveräußerlichkeit und materielle Diffamierung ein nonkonformistischer Vorsprung, der einen Kunstbegriff von höchster Differenziertheit, Intensität und Unmittelbarkeit zuläßt. Eben dieser Vorsprung wird eingebüßt, wenn man eine öffentliche Vergewaltigung dem Gedicht zumutet, die es nur noch als Schrei darüber zur Kenntnis bringt.
Der experimentelle Charakter der „ungeputzten Notizen“, verschuldet durch die fragmentarische Lebensweise, die beirrende Widersprüchlichkeit, sprunghafte Ausführung und sprachliche Krassheit wurde meist abgeschwächt in dem Sinne, daß auf eine Ausformulierung in sich hingearbeitet wurde, um dem Gedanken Vorrang vor der interessanten Skizze einzuräumen, insbesonders aber auch, um das Geschmäcklerische abzuwehren, das experimentellen Schreibweisen heute von einer konfusen Schicht entgegengebracht wird.
Nach meinem Dafürhalten wäre es trotzdem, solange dazu noch die Möglichkeit besteht, angebracht den weiten Begriff der Poesie oder des Poetischen für die aus einer Unmittelbarkeit resultierende innere Nachdrücklichkeit, in der die Einzigkeit des Einzelnen lustvoll deutlich wird, und den engeren Begriff des Gedichts, wo auf dem Zusammenhang einer verdichteten und möglichst durch Form und Anordnung verstrafften Sprache, dieses poetische Ereignis auf seinem eigentlichsten Feld zur größten Wahrscheinlichkeit gebracht wird, beizubehalten.
Die Begeisterung aber, die das Gefühl von Existenz vermehrt, ist für die Poesie das „Erhebendste“.
Gerhard Falkner, Nachwort, im Frühjahr 1993
Über den Unwert des Gedichts
− Gerhard Falkners Poetik zwischen Wertkonservativismus und Postmoderne. −
Vielleicht hat Gerhard Falkner gerade eben sein wertvollstes Buch veröffentlicht. Das „wertvollste“, weil es sein gedankenreichstes, umfassendstes und auch luzidestes bisher ist; „vielleicht“, weil es kaum berechtigt ist, ästhetische Theorie mit Gedichten oder Kurzprosa zu vergleichen. Für die, die ahnen, daß es dennoch eine Ebene des Qualitätsvergleichs gibt, sei genauer wiederholt: Gerhard Falkner hat nach einigen Such- und Tastbewegungen den interessanten Versuch gemacht, eine Poetik als Wahrnehmungslehre in aphoristisch poetischer Form zu schreiben, für deren Gedankenreichtum manch anderer vielleicht 500 Seiten verbraucht hätte.
Falkners Bezugspunkte sind einerseits traditionell, ja wertkonservativ: Rilke, Heidegger, das Beharren auf dem metaphysisch poetischen Charakter der Sprache gegenüber ihrem Kommunikationssinn stehen im Vordergrund. Andererseits ist er ein ,postmoderner‘ Autor – im besten Sinne allerdings −, das heißt, er dekonstruiert theoretische Ambitionen dort, wo die Sprache der ästhetischen Theorie Dichtung ins gesellschaftstheoretisch Triviale verbracht hat:
Es gibt immer noch Dichter…, die sich einem Untergrund zurechnen, oder gar einer Avantgarde. Das ist einfältig… Es gibt keinen Untergrund mehr, weil es nur noch Oberflächen auf verschiedenen Netzebenen gibt, und erst recht keine Avantgarde, weil das Vorgreifen eines Entwurfs gar nicht entwickelt werden kann in einer Kultur der direkten Abfrage…
Wollte man den Doppelaspekt aus ,berufsständischem‘ Wertkonservativismus und philosophischer Zeitgeistsensibilität inhaltlich ausfüllen, so ergäben sich in etwa folgende Thesen: Der Wert des Gedichts stammt aus der Sprache und aus dem Verhältnis des Dichters zur Sprache. Damit stehen sprachliche Korrespondenzen und derjenige, der sich ihnen in seiner Weltsituation ausliefert, zur Debatte und nicht irgendwelche Formen „kritischen“, „berechnenden“ oder semantisch brillierenden Sprechens, die heute massenweise „Gedichte“ ausmachen. „Das Gedicht ist auf Sprache aus, aber die Sprache, die da ist, ist nichts.“ Sprechen im Sinne der Kommunikation bzw. Information „läßt Sprache verstreichen“.
Weiterhin ist ein Gedicht nicht nur ein Fall der Interpretation (des Lesens und Hörens), sondern der ästhetischen Korrespondenz:
Es ist ein Humbug, daß… immer so das Verstehen und Begreifen in den Vordergrund gerückt werde… erst die Entgegnung setzt es in Gang.
Worum es Falkner geht, ist, das Gedicht, den Prozeß des künstlerischen Umgangs mit Sprache überhaupt, dem sekundären Diskurs zu entreißen. „Entgegnung“ heißt, der unverstellten Sprache sich stellen, der Sprache der Korrespondenzen, so man sie gewahr wird. Falkner tastet sich mit einem an Ernst Jüngers Federbälle erinnernden Gespür auf das lebende Bedeutungsgeschiebe unter der Sprachoberfläche voran – etwa am Beispiel des Wortes „Mund“; dieser, ein Wort, das
für die meisten zuerst mal eine Stelle im Gesicht bedeutet, an der Essen und Reden sich kreuzen, ist gleichzeitig das Wort von unauslotbarer Reichhaltigkeit, das Runde ist darin ausgedrückt, wenn es sich selbst ausspricht, das Dunkle, das dahinterliegt, die Kunde, die Möglichkeit sich kundzutun, das Offene, das ins Geschlossene führt, die Mündung, welche die Erfüllung des Weges bedeutet und gegenüber liegen mundtot, Entmündigung usw. bis an die Peripherie des Unendlichen…
Jünger hatte sich das Recht zu solchen Betrachtungen von Baumgarten und aus Hamanns aesthetica in nuce geholt. Für die Germanistenohren der letzten Generation mögen sie wie ein Fall von intellektuellem Flurschaden klingen. Postmoderne Ästhetik jedoch ist keine Nostalgieform poetischen Philosophierens. Wer schreibt, kennt das Geflecht hochwirksamer Bezüglichkeiten, welches „Sprache“ nährt und poetischen Rang etabliert – nicht im Sinne genereller Elitisierung, diese Anmaßung hat nur die Poesiewissenschaft aufgebracht, und Falkner destruiert jeden dahingehenden Verdacht durch das Burschikose seiner Äußerungen, sondern in Anwendung auf das eigene Sprechen als einer Korrespondenz von Anspruch und Entgegnung.
Was solch ein Sprechen anbelangt, wäre nun gewissermaßen eine Poetik im Sinne eines primären Sprechens zu liefern – keine leichte Sache bei einem traditionell weit ins Sekundäre verfrachteten Gespräch. Der erste Eindruck ist denn auch: Ein Haufen starker Sprüche… – Doch ist da zum einen eine penible Ordnung zu entdecken, und da sind Wiederholungen und Registraturen, die in Mehrbezüglichkeit führen. Eine Einheit wird nicht daraus, aber ein Prozeß, etwas sich Bewegendes, das von den einzelnen Aphorismen vorangepeitscht wird. Die Passagen haben nichts Gewundenes, eher werden hier lapidare Urteile gesprochen, darunter manche, deren Knappheit an Beilschläge erinnert, ob Falkner nun über Literatur (den „durchgedrehten lyrischen Mittelstand“) oder über die Phänomene des hyperrealen technischen Raumes Rechenschaft gibt:
Die Nachrichtensucht ist eine stille Tobsucht
…
Das Innenleben ist eine Kolportage aus Sportschau, der heiße Stuhl und Radio Charivari, …der Geruch von Schönheit endet bei Serien von Karl Lagerfeld oder Paloma Picasso, die gnomische Gestalt eines anbrechenden Gefühls wird sofort belästigt von der Sprache des Sorgentelefons…
Zweigeteilt also ist die Perspektive Gerhard Falkners: wertkonservativ ist er aus Profession – und dort ahnt er die Unausweichlichkeit von Reflexionen, wie sie von Schopenhauer bis Cioran und Gomez Davila vorgelegt wurden. Seine Situation aber ist eingestandenermaßen die des bei Virilio als rasender Stillstand beschriebenen „Jetzt“ unserer informationssüchtigen Zeit, an deren technischer Haut ein Künstler sich entgegnungssuchend abarbeitet. Gedichte kommen zur Welt nicht durch verquere Grammatik und die Berechnung semantischer Anspielungen, ja sie sind nicht einmal „die Ausgeburt eines Gedankens“ (dies sollte wahrlich einmal für alle Kunstbemühungen theoretisch ausgefertigt werden), sie geschehen vielmehr im Hören auf das dunkle, wirklichkeitsbeeinflussende Feld der Korrespondenzen unterhalb der landläufigen Informationsgehalte, auf das, was Benn Vakuum nannte.
Man könnte Widersprüche herauslesen, man könnte Falkner selbst des Designs überführen, das er theoretisch ablehnt. („Wo das Design anfängt, wird’s flach.“) Man könnte, wenn man die Fotos im Anhang betrachtet, auch das Gefühl angesichts einiger Sätze bekommen, daß der Autor vielleicht doch um eine Spur zu klein für solch erhabene Gesten ist und gerade deswegen so kompromißlos daran festhalten muß… – Aber das weiß er vermutlich selber, und zwar mit jener Untrüglichkeit, mit der er nicht den Status des Theoretikers oder Essayisten, sondern den des Aphoristikers beansprucht. Falkner ist ein Ästhetiker seines eigenen und nicht irgendeines Wortes. Er hat zur Theorie gewechselt, ohne den Kontakt mit jenem Berührungspunkt zu verlieren, der Philosophie und Dichtung verbindet, d.h. ohne ins sekundäre Gerede zu fallen. Er ist ein schlagkräftiger Kritiker eines Literaturbetriebs, der zu seiner eigenen Karikatur verkommt, wenn er zwischen flotter Besinnungslosigkeit und verquerer Gesellschaftstheorie nicht bald herausfindet, und er ist einer der wenigen hierzulande, dem gegenüber den französischen Philosophen (den Sekretären der deutschen Philosophie) weder Proselytentum noch schreckensbleiche Abwehr übrigblieb, weil er nämlich mit ihren Vorbedingungen bei Nietzsche und Frege, Wittgenstein und Heidegger vertraut war.
Falkner ist Träger des bayrischen Staatspreises. Zuletzt erschien im Luchterhand Verlag der Gedichtband Wehmut und 1992 die zusammen mit Sylvere Lotringer herausgegebene Anthologie neuer amerikanischer Literatur Amlit. Der vorliegende Band wurde mit Unterstützung des DAAD in Weimar gedruckt und vom literarischen Colloquium Berlin herausgegeben. Für ihn gilt ein Aphorismus aus ihm selber:
Die Poesie ist der Wurf, von dem die Philosophie sich Notizen macht.
Reinhard Knodt, Neue Rundschau, Heft 2, 1994
Das Gedicht, das Genicht (Dollars and Sense)
1989, nach Veröffentlichung von wemut, seinem dritten, umfangreichsten und schwierigsten Gedichtband, kündigte Gerhard Falkner völlig überraschend an, daß er keinen weiteren Gedichtband veröffentlichen werde, lediglich Gedichte in Zeitschriften, in Privatdrucken oder, was diese Entscheidung ja nicht berührt, Veröffentlichungen in einem anderen Genre, wie dem hier vorliegenden Über den Unwert des Gedichts. Trotz der hohen Anerkennung seitens der Kritik setzte Falkner seiner öffentlichen Karriere als Dichter (ungeachtet aller bisher geübten Abstinenz vom Literaturbetrieb) ein Ende, wenn auch nicht seiner Existenz als Dichter, was das Schreiben (nicht Vermarkten) von Gedichten angeht. Diese seine eloquent vertretene Entscheidung verblüffte und stieß zunächst auf Unverständnis, folgte letztlich aber konsequent seinen Anschauungen über die Situation des Dichters in der Gesellschaft. In der hier vorliegenden Publikation, die als postscriptum zu dieser Entscheidung gelesen werden kann, als Formulierung seiner Poetik (und, was die Notizen zur Gesellschaft angeht, als eine Art „Aufzeichnungen aus einem Kellerloch“), entwickelt Falkner seine Ansichten über das Wesen von Gedicht und Dichter und über deren beider Armseligkeit in einer Zeit und Kultur, die ihnen unwirtlich und sogar feindselig gegenüberstehen.
Über den Unwert des Gedichts zerfällt dabei in theoretische und darstellende Texte. Den drei Hauptabteilungen folgt zunächst ein aphoristisches „Verzeichnis der Redundanzen“, wie sie genannt werden, von denen jede wiederholt und über den gesamten Text verteilt vorkommt, danach der aus drei Gedichten bestehende Zyklus „gloriam in expressis“ und schließlich die metakritische Spekulation des Autors über das, was von der Kritik als so schwierig empfunden wurde am Zyklus „gebrochenes deutsch“ in wemut. Der Band endet jedoch nicht mit dem letzten kürzeren Text „Über die Poesie“ und auch nicht mit dem knappen Nachwort. Es folgt eine Serie von zehn Fotografien, eine ironische, wenn nicht zynische Porträtserie von Falkner, die Renate von Mangoldt fotografierte.
Eine Porträtserie des Autors/Dichters, sowohl in einem Gedichtband als auch in einer Poetik, ist gewiß unüblich und scheint auf den ersten Blick nur eine raffinierte Variante wohlbekannter Selbstvermarktung zu sein, die den strahlenden Autor auf der Rückseite des Buchumschlags zeigt. Hier jedoch strahlt der Autor keineswegs. Die Porträtserie ist vielmehr integraler Bestandteil der inhaltlichen Struktur des Buches und besitzt eine triftigere Funktion als die, das Interesse des Lesers auf die Person des Autors zu lenken. Die Fotos verstärken den kulturkritischen Ansatz der Texte; sie beanspruchen eine Untersuchung und Würdigung als postmoderne Prolegomena zu den Texten und auf die Texte folgend. Das erste Foto zeigt Falkner in einem mächtigen Sessel, den Blick direkt in die Kamera gerichtet, während Sitz und Körper zur linken vorderen Bildecke gedreht sind. Eine Stoffdrapierung unmittelbar dahinter vermeidet ablenkende Details oder räumliche Tiefe und richtet, wie in der Porträtkunst der Renaissance, die Aufmerksamkeit des Betrachters zunächst auf die Augen, die, egal aus welchem Blickwinkel, dem Betrachter stets folgen, und schließlich auf das Wesen (-hafte) hinter diesen Augen. Fluchtpunkt und Raumtiefe sind sozusagen ins Innere des Porträtierten verlegt, nicht in die Abbildung selbst oder den Bildaufbau. Die Rückseite des Buchumschlags zeigt, „etwas verkleinert“, ein ähnliches Foto, das den Autor in der gleichen Haltung wiedergibt, den Blick jetzt aber ernst abgewandt, Buch und Autor haben sich hier für den Leser verschlossen. Die beiden Aufnahmen bilden die Eckpunkte, zwischen denen der Autor dargestellt ist als psychologisches Subjekt, das sich der Kamera zuwendet und endlich wieder verschließt.
Die übrigen Fotos zeigen den Dichter vor den Fassaden von Luxusgeschäften (Chanel, Cartier), Filialmultis (McDonalds), Massenmodebetrieben (Benetton) oder Banken. Entweder trägt er auf diesen Abbildungen eine Brille, oder er starrt ausdruckslos aus dem Bildraum in die Kamera. Im Unterschied zum einleitenden Foto ist hier nirgends Innerlichkeit oder psychologische Tiefe angestrebt, und der Bildhintergrund ist überfüllt mit glitzernden Fassaden, Konsumflitter und Firmenlogos, die nun (in grellem Widerspruch zum dichterischen Logos) über dem Poeten prangen, dessen individuelle Gegenwärtigkeit zusehends verblaßt, bis er auf dem letzten Foto schließlich nur noch von hinten zu sehen ist, nurmehr irgendeiner jener zahllosen Passanten, in die Betrachtung (und wohl auch Verachtung) eines Schaufensters vertieft.
Diese Porträts sagen also letztlich sehr wenig über den Dichter aus, der in der Bildfolge immer weniger als „beseelte“ Person oder Präsenz erscheint, eher wie ein Mannequin, eine ironisierte, gegen den Strich gebürstete Fotowerbung für eine Ware, die nicht ausstellbar und so gut wie unverkäuflich ist. Aus diesem Paradox heraus können die Fotos als postmodernes Zitat zum ästhetischen Ideal der klassischen Moderne, wie es etwa T.S. Eliot in seiner „Impersonal Theory of Poetry“ formuliert hat, aufgefaßt werden. Die Fotos zeigen zwar den Dichter, aber nur quasi den Aufriß, die Front, die entleerte „persona“, dargeboten als eine Art lustvolle und masochistische Fassade, die den biographischen und physiognomischen „Appeal“, der bei der Vermarktung so häufig den literarischen Wert ersetzt, attackiert und negiert. Im Hinblick darauf könnte die Fotoserie sehr gut „Über den Unwert des Gesichts“ heißen. Nicht oberflächlich (superficial), sondern „übergesichtlich“ (supra-facial), werfen die Fotos ein Licht auf die grundlegende Unvereinbarkeit von Poesie und Luxus bzw. Massenkonsum. Das Ganze erinnert an eine modernistisch/idealistische Umkehrung von Brechts berühmtem Kommentar zu den AEG-Werken, die Fotos sagen nichts über den Dichter oder seine Dichtung, dafür umso mehr über die ökonomischen Bedingungen für beide in der gegenwärtigen Gesellschaft. Die absichtliche désinvolture des Dichters verhöhnt den „Jahrmarkt der Eitelkeiten“ des Massenkonsums und spiegelt hinter scheinbarer Gleichgültigkeit die reale Gleichgültigkeit wider, wie sie heute gegenüber dem Gedicht und dem Dichter besteht. So illustrieren die Fotos metonym die gegenwärtigen, von der Ökonomie diktierten Existenzbedingungen für Dichtung, die den Dichter zwingen, im „Sichtbaren“ präsent zu sein. Auf dem Schaufenster eines Juweliergeschäfts heißt es: „Ein bißchen Gold sagt doch alles“. Gegen eben diese Umverpflichtungen von Sprache in materiellen Wert oder instrumentellen Gebrauch setzt Falkner das metaphysische sanctum des Gedichts, „das Gedicht als Denkmal des inneren Erlebnis“, den ultimativen „Unwert des Gedichts“, das unverkäuflich ist. Was die Fotos nicht zeigen können, ist das, was Falkner die „poetische Innenarchitektur“ nennt, im Gedicht, im Dichter und im Leser.
Die drei Abteilungen des theoretischen ,Aufrisses‘ verdeutlichen und verteidigen dieses sanktum, wobei aber die Texte häufig nicht einer linearen Argumentation folgen, sondern zwischen aphoristischer Aussage und apodiktischer Feststellung pendeln. Die Aufzeichnungen, ob sie nun aus einer Zeile bestehen oder über mehrere Seiten gehen, sind lapidar, aber höchst konzentriert im Ausdruck, ihre Konzeption ist komplex, paradox und provozierend. Hinzu kommt, daß durch absichtliche Wiederholungen (Textschleifen) auch die Anordnung der Texte signifikant wird; dies fordert vom Leser unmittelbares und durchdringendes Erkennen und zwingt zu genauestem Reflektieren und Zurückspringen, zur offenen Betrachtung und Wiederbetrachtung. Anders ausgedrückt, die Wirkung des Textes läuft in der Art und Richtung genau entgegengesetzt zur scheinbar simplen Ikonografie der Fotos, die erst einmal den Anschein erwecken, als würden sie die Bedeutung oder Berühmtheit des Autors unterstreichen. Im Unterschied dazu bietet das Lesen der Texte häufig Schwierigkeiten wie etwa das Lesen sogenannter schwieriger Dichtung der Moderne, obwohl sie auf deren Metaphorik vollkommen verzichten. Der dichterische Impetus verhüllt sich in der Konzeption, er existiert nurmehr incognito, wie sich auch die Person Falkners oder, um es genauer zu sagen, die Dichtung selbst ins Incognito und ins Kognitive zurückgezogen und damit das Primat von Form und dichterischem Bild dem Primat des poetischen Konzepts unterworfen hat. Diese Form einer poetischen Poetik, welche die Prosa mittels äußerster Verdichtung zur Poesie hochtreibt und umgekehrt, steht in der Tradition etwa Gottfried Benns, Adornos oder Heideggers, drei Autoren, deren Schriften über Sprache und Dichtung und zur Gesellschaft immer wieder durchklingen. In der Tat ist Falkners Über den Unwert des Gedichts wahrscheinlich die wortgewaltigste Aufforderung und auch Herausforderung, fundiert über Dichtung nachzudenken, seit Benns: „Probleme der Lyrik“ (1951), Adornos „Rede über Lyrik und Gesellschaft“ (1957) und Heideggers „Unterwegs zur Sprache“ (1959).
Falkners Text ist zugleich Vorwurf und Klage, Polemik und Beschwerde, er definiert die sozialen ebenso wie die metaphysischen Bedingungen des Gedichts und des Dichters und die Art und Weise, wie erstere die letzteren untergraben und zerstören. In einer Passage gegen Ende des Bandes attackiert Falkner dann die eigene literarische Form in der Art eines ex negativo verfaßten Klappentexts, in dem er ironisch die Schwächen hervorhebt, die das Buch gegenüber allgemeinen Leseerwartungen haben müßte:
Der Vorwurf dieses Buches wird hin und her gewälzt. Er wiederholt sich in ermüdender Weise im immergleichen, langwierigen Bedauern über die Viktimisierung des Dichters, der ausgedient hat in erkalteter und gar innerlich erstorbener Welt.
Getretener Käse wird Quark. Die stete Wiederkehr des bereits schon Bezichtigten, die unverholene Redundanz des Vorwurfs, die anhaltende Gereiztheit krasser Superlative, die veraltete Geste eines Telos in einem faden Nochmal und Nochmal sind im Hinblick auf die Sache und ihre Existenzbedingung im Kulturbetrieb aber erst in dieser penetranten Darstellung eine geeignete Wiedergabe.
Diese Art von Anti-Klappentext operiert wie das Foto auf der Rückseite des Einbands, auch hier wendet der Autor sich demonstrativ ab, indem er den eigenen Text kritisch, ja kaustisch, aus der gleichgültigen Sicht eines Unbeteiligten aburteilt. In beiden Fällen, sowohl am Ende des Fototeils als auch am Ende des spekulativen Teils des Buches, annuliert der abgewandte Blick (bzw. die Anwendung) das jeweilige Medium und damit den transitiven Charakter von Kommunikation, um Raum für das Poetische selbst entstehen zu lassen. Oberflächlich betrachtet könnten die Fotos einfach als Selbstdarstellung oder Werbetrick gelten, ebenso wie man den Text aus dem gleichen Blickwinkel als berechnend und selbstgefällig bezeichnen könnte, wie es Falkner an der vorhin zitierten Stelle ja selbst nahelegt. Trotzdem gehen die Fotos ebenso wie der Text dieses Risiko ein, um eben diese Grenzsituation zu erzielen, die den Leser oder Betrachter auf die differenzierten Details bestimmter Vorstellungen und Formulierungen immer wieder zurückwirft und ab einer gewissen Schwelle auf die Poesie als solche. Mit Hilfe der kunstvollen Konstruktion und der ausgefeilten Künstlichkeit von Über den Unwert des Gedichts unternimmt Falkner den Versuch, das unvermeidliche Paradox der Veröffentlichung zu unterlaufen und auf dem Markt der Massenmedien der immer ärger werdenden Widersprüchlichkeit von Poesie und Publicity zu entgehen.
Für Falkner verfügt die „Mediengewalt“ der Gesellschaft über eine Reihe von Strategien, die zusammenwirkend die „Innenwelt“ des Individuums und damit auch das Gedicht, das sich selbst sagt und ausdrückt und Anklang (Entgegnung) braucht in diesem Raum, liquidieren:
Von den Verhältnissen wird dem Gedicht sein Verschwinden nahegelegt. Der Raum für Wiederholung, Erinnerung, Besinnung ist ökonomisch nicht mehr vertretbar…
Das Gedicht überlebt lediglich noch „im abgesteckten Raum einer ihm zugemuteten Bedeutung ohne Wert.“ Aus der Intimität, die das Gedicht zwischen Sprache und Persönlichkeit schafft, erwächst ihm für die Gesellschaft eine Bedeutung, wie sie im Bergwerk der Kanarienvogel in seinem Käfig hatte, dessen Tod auf unbemerkbare, aber vorhandene giftige Gase aufmerksam machte, von denen alle bedroht waren. Ihrer Natur nach sind die gesellschaftlichen Verhältnisse kolonialistisch, auch wenn das nicht mehr gebunden ist an die Nation, sondern an eine wachsende, übernationale Hegemonie des Kapitals und der Technik über, nennen wir es mal in Ermangelung eines besseren Ausdrucks, den Geist:
Der Mensch wird vom Markt, von der Information etc. besiedelt… Das gewaltige innere Reich, das als einzige Ressource für die Regungen der Cultur und der humanen Gesamtverfassung gelten muß, wird gegenwärtig in Dimensionen, wie sie für den Regenwald oder die Ozonschicht gelten, vernichtet.
Das Wort „Reich“ wird dabei natürlich absichtlich provokant verwendet, und Falkner scheint für die gegenwärtige Lage eine Art „innere Emigration“ anzuempfehlen als Mittel und Weg einer rückerobernden Befreiung von Innenwelt aus den Zwängen und Fesseln von Technofaschismus und kybernetischem Kapital mittels des Gedichts. Die Dichtung, als „körperunmittelbarste Sprache“, wird durch diese Unmittelbarkeit, durch ihre nicht von der Masse vermittelte Dichte und die Konzentriertheit auf eigene Sprache, eigenes Denken und Gefühl, durch ihre „Intensität der Darstellung“, durch dies alles wird sie eine Form der Kritik und des Widerstands aus einem Untergrund intransitiver Signifikanz und ein Ausweg aus dem „inneren Tod“.
Mit bitterem Skeptizismus rekapituliert Falkner die Lage:
Die größere Beweglichkeit bezahlen wir mit einem schwindendem Raum, die hohen Geschwindigkeiten mit der schrumpfenden Zeit, die unendliche wissenschaftliche Einsicht mit der völligen Einbuße von Überblick, die Dichte der Kommunikation mit dem Zuendegehen des Sagens und die totale Information mit dem Verschwinden der von ihr aufgezehrten Wirklichkeit. Mit dem Gedicht verabschiedet sich (neben dem Lied) der letzte ehrenhafte Gesamtausdruck des Menschen. Durch die Sucht des Geldes und der Materialität und die intensive Nutzung des Innenlebens durch die Medien steht der Dichter vor seiner Ausrottung.
Falkners ,kulturpessimistische Poetik‘ verweist auf ihre Herkunft aus der Romantik und der Elegie und plädiert für eine Sprache des Sagens als Merkmal einer Individualität, die unter Belagerung steht; der Logos des Gedichts ist das Schlachtfeld (locus) dieses Kampfes. Das „lyrische Ich“ steht vor dem „Aussterben“, einfach weil der Mensch seine „innere Stimme verliert“, die wissentlich oder unwissentlich einer kommerziellen Instrumentalisierung ausgeliefert wurde:
(Der Mensch) nennt die Worte wie den Preis einer Sache.
Angesichts dieses allgemeinen Zerfalls von Bedeutung und Betrachtung in Konsum und Kommunikation erweist sich Falkners Über den Unwert des Gedichts als von allerhöchstem Wert.
Neil H. Donahue, Sprache im technischen Zeitalter, Heft 134, Juni 1995
Aus dem Amerikanischen von Nora Matocza
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Heinz Neidel: Sinn und Form
Nürnberger Nachrichten, 13.1.1994
Walter Hinck: Pfennigbeträge für Weltleistung
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 10.2.1994
Peter Michalzik: „Das Gedicht ist ein Dreck“. Interview
Süddeutsche Zeitung, 9.8.1994
Das „jüngste gedicht“
– Zur Poesie Gerhard Falkners. –
„Das Gedicht ist in jeder Hinsicht schöner als die Suche nach einem Parkplatz – dennoch sucht jedermann fortwährend einen Parkplatz, aber kaum irgendjemand das Gedicht“, schrieb Gerhard Falkner 1993 in einer größeren essayistischen Publikation. Über den Unwert des Gedichts versammelt Auszüge aus Falkners „Ungeputzten Notizen“, in denen er über mehrere Jahre hinweg Gedanken zu Dichtung, Sprache und Zeitlage niederschrieb. Es ist ein Text eigener Struktur, gemischt aus poetisch verdichteten Sentenzen, theoretischen Begriffen, Beobachtungen, Aphorismen, Gedichten – gebunden um Kerngedanken. Falkner nutzt die unkonventionellen Denkmuster und sprachlichen Genauigkeiten von Poesie, um die Sprache theoretisch zu durchleuchten.
Dennoch oder auch gerade wegen dieses Blicks auf Poesie entzog Falkner Ende der 80er Jahre sein „Sprachkraftwerk“ Dichtung der Öffentlichkeit, indem er jeglicher weiteren Publikation absprach. „Öffentlichkeit bedeutet Gewaltanwendung“. Es war die endgültige Verweigerung eines Poeten, „aus dem wortschatz land (zu) verkaufen“:
Der Dichter stirbt aus, weil eine in Pleonexie verrottende Gesellschaft seine Existenzbedingungen zerstört, die nämlich der Verfeinertheit, eines Gewissens des Ohrs, der Zeit (Muse) für rhythmische Wiederholung, aller Arten von Herzensgüte, Noblesse und Unterscheidungsfähigkeit… Man fordert vom Gedicht zunehmend den plakativen Griff, wie ihn die Werbung tut. Wenn sich das Gedicht darauf einläßt, wird es seinen Schwerpunkt ebenso verlieren wie die Werbung ihren Zusammenhang mit ihrem Gegenstand…
Nach siebenjährigem Innehalten erschien im vergangenen Jahr in der edition suhrkamp ein neuer Gedichtband Falkners unter dem Titel X-te Person Einzahl mit bislang unveröffentlichten Gedichten und Destillaten seiner früheren Lyrikbände. Vor einer Verantwortung (und sei es der gegenüber Sprache) vermag sich mancher Zeitgenosse, wenn auch unter Gewissensbissen, davonzustehlen. Wenn jedoch Falkner schreibt, ein Dichter „ist ohne mich verloren, denn ich bin sein gedicht“, wird begreiflich, warum er das Versprechen, seiner Dichtung ein Ende zu setzen, nicht vollends einlösen kann. Da er der „gegenwalt“ standhalten muß, bleibt ihm nur die Wahl seiner eigenen Mittel. Er muß zwanghaft anschreiben gegen eine „Vorstellung von Sprache“, die „im allgemeinen so lausig, wie es ein Blick auf die Uhr als Begriff von der Zeit ist“. Denn die „Sprache ist das Licht, das von uns heraus auf die Dinge fällt“. Sprache bleibt eine hoch infektiöse Angelegenheit. Kein noch so ausgeprägter Schutzmechanismus, keine Antikörper bewahren vor einer zwanghaften Infizierung mit diesem sich chamäleonhaft wandelnden Etwas, welches das Sein durchdringt wie ein Laserstrahl dichtes Gewebe.
Daß Falkner im Titel X-te Person Einzahl die Einzahl eines grammatikalischen Individuums an die Unendlichkeit bindet, scheint zunächst ein Widerspruch allein der Menge, eine Widerrufung der deutschen Grammatik. Den tieferen Grund für die Flucht hinter das Kreuz (das zu tragen ausschließlich ein Dichter bereit ist) legt die allgemeine Tatsache, daß Ichduersiees für den Zeugenstand nicht mehr in Frage kommen. Ihre Authentizität ist so echt wie die Nachrichten bei errteellsatteins, alle und alles sind unverwechselbar beliebig geworden. Ich läßt sich durch du, er durch es vertreten, und niemand scheint davon Notiz zu nehmen oder sich gar einen Reim darauf zu machen. Auch eine Mehrzahl bietet keine verläßliche Gesellschaft mehr, wie überhaupt das Wort „Wir“ stets als Fiktion (Gemein)Sinn stiften muß, ohne daß es je am Boden des gesellschaftlichen Reagenzglases nachweisbar existiert hätte.
gesichter aber:
absolutes parterre
gebaut wie cockpits
im absturz der jahre zerstört
Kein Schutz durch Menge. Also bleibt die EinZahl die einzig verläßliche Größe, die zählt. Sie läßt sich weder ersetzen noch vertreten. Denn sie ist einsam, und diese „auserlorenheit“ bildet keinen Tauschwert.
Ebenso ist die Negation des Wortes „Wert“ im Titel der Poetologie Über den Unwert des Gedichtes symptomatisch für die Haltung Falkners einer Zeit gegenüber, die ihre Sprache im Stich läßt. Die moderne Gesellschaft liefert ihre Worte und Bilder neuen und schnelleren Medien aus, Stärke und Anzahl der Geräusche nehmen zu – in dieser Vielfalt arbeiten die akustischen Worttürme und Beweglichkeitsmelder zunehmend gegeneinander. Falkner schockiert zunächst mit dieser Wortumkehrung. „Unwert“ bedeutet jedoch für ihn nicht Wertlosigkeit. Er provoziert einfach mit der Gegenbehauptung. Um den Wert eines Gedichtes zu entdecken, muß dieser aus einer anderen als der normativen Sicht bestimmt werden. Erst wenn die Poesie aus der pragmatischen Umklammerung der Gesellschaft und deren Grundbewegungen Werten, Messen, Wiegen und Abwägen erlöst ist, entfaltet sie Schönheit, Genauigkeit und menschliche Relevanz. Poesie ist in diesem Sinne wertfrei, sie ist für eine Warengesellschaft unbrauchbar. Gegen nichts zu tauschen, steht sie außerhalb einer berechnenden, bewußt täuschenden und vorsätzlich fälschenden Gewinnsucht. Aus dem pragmatischen Koordinatensystem herausgelöst, beginnt Poesie tatsächlich zu existieren.
Wer also, in jeder Hinsicht, Falkners „sprachsperrbezirk“ zu übertreten gewillt ist, den erwartet das „jüngste gedicht“. Die Schranken schließen sich, sobald die erste Seite seiner Arbeiten aufgeschlagen wird. Man findet sich wieder inmitten eines magischen Zirkels aus Sprache und „möchte sich entfernen / aber alles ist so in seiner nähe / gerückt daß kein auskommen ist“.
Cornelia Jentzsch, moosbrand, neue texte 6, august 1998
Sprünge ins Unbekannte
– Zu Gerhard Falkner. –
Drei Gedichtbände hatte Gerhard Falkner zwischen 1981 und 1989 veröffentlicht; als ich Anfang der neunziger Jahre nach ihnen suchte, ließ keiner sich finden. Stattdessen stieß ich 1995 in Berlin auf ein harmlos aussehendes, stark rosafarbenes Büchlein des Autors: Über den Unwert des Gedichts. Rasant ging es los, ab in den Untergrund. In einem kleinen Käfig sitzt der Sittich am Helm des Bergmanns, unmittelbar neben dessen Lampe. Kippt das Wetter, geht als Erstem dem Vogel die Luft aus. Kippt der Sittich, rette sich wer kann. Ich musste lachen, und es blieb das Lachen mir im Hals stecken: Einen so lustigen Dichter wie diesen Sittich hatte ich selten gehört. Neben der Lampe der Zeichen-Vogel, getragen am Kopf – unter Schutt und Stein. Rette sich, wer kann.
Hier sprach jemand erfinderisch, selbstironisch, übertreibend-exakt über die Grenze zwischen Sprechen, Nachreden und Nichts. Die Grenze zwischen Gedicht und – nun, eben keineswegs dem unsäglichen „Unsagbaren“, sondern unseren Diskurskonstellationen und Beschleunigungen im Medien-, Moden- und Markenrascheln, im Wettlauf um Geld, im Werben und Kalauern des Jetzt. Hier sprach jemand mit Leidenschaft. Gerhard Falkner schreibt über das Dichten, weil dieses Nachdenken vom „Normalrand“ her – in Prosa, mit Feuer und Witz – dieses Sprechen über die Bedingungen, unter denen der Dichter lebt in den Augen der anderen, in der Öffentlichkeit als jenem Raum, den jedes Gedicht braucht, um Gedicht zu sein, weil dieses Sprechen über das unsichtbare Exil und Exiliertwerden der „Dichter“, schlimmer noch Lyriker, das täglich stattfindet, sich ausbreitet, absichtlich schlecht versteckt hinter Lippenbekenntnissen zur „kulturellen Wichtigkeit“ der poetischen Sprachkletterei im Doch-Affenzoo, die Achtung vortäuschen und Missachtung nie verbergen – Frage: „Kann man davon leben?“ – Antwort: „Wie Sie sehen, bin ich tot“ – weil dieses Sprechen angesichts eines sich zunehmend verengenden und zugleich verdriftenden (aus der Sprache als Wissen und Können herausschwimmenden) Normalraums unabdingbar wird: auch als Hinweis darauf, dass die Person, die dichtet, dies nicht tut, weil sie zu dumm ist für anderes, sozusagen ein genereller Idiot, sondern weil sie ihre Intelligenz, ihre spezifische, etwa Falknersche Wachheit, ihre scharfe Beobachtungsgabe, ihre lang erprobte Intuition und Bewegungssicherheit in Räumen, von denen andere nicht einmal zu träumen wagen, nutzt, um uns in den Spuren unserer Sprache nachzugehen. Insbesondere auch „nach unten“. Damit wir merken, wann uns die Luft ausgeht.
ACH; DER TISCH
(Zur PoeSie des PoeDu)
Und er wird mich sagen hören: ach der Tisch!
ach der… wird mich sagen hören: ach der Tisch!
und er wird mich fragen werden: wo! Zu!
und er wird mich sagen hören, ach der
sagen hören… ach der… ach der Tisch!
der Tisch … mit dem Brot!
Und er wird mich haben wollen, haben wollen
wie ich sage, ach die… ach der Tisch!
Am liebsten zitierte ich dieses lange Gedicht zur Gänze. Als ich es zum ersten Mal las, riss ich die Augen auf: Da dachte jemand mithilfe eines Gedichts. Da kannte jemand die Theorien der Gegenstände, des Ich und des Du, und hatte sie abgestreift, ohne sie wegzuwerfen. Der „Tisch“, das vielfach malträtierte Standardbeispiel aus dem philosophischen Seminar: Wie konkret und intelligent stand er da. Wie machte dieser Falkner das? Er erwischte mich nicht kalt, sondern heiß. In den Schleifen seiner mit Wiederholung und Variation spielenden Sätze, seiner Musiksätze, die die Syntax öffneten und sich in neuen Mischungen zusammenfanden, gingen mir die Gedanken im Schädel rund, mit Gefühlen fürs Brotessen und Tischdasein, fürs unterm Tisch sein, fürs Ach und für, ach, das Ich.
Denken im Dichten setzt voraus, dass der Dichter sich gleichermaßen in Gedanken wie Wahrnehmung, in Sprachsinn wie Sprachlautung bewegt. Quer durch die Zeiten. Auch deswegen sind Falkners Gedichte immer Echoräume von Formen und Tonlagen. Auch deswegen übersetzt Falkner aus anderen Sprachen: Er hört zu. Horcht auf. Lernt, die Hand, der Sprache nachforschend, neu zu bewegen. Nomade musst und willst du bleiben.
Falkner ist ein Dichter des Satzes. Gewiss arbeitet er mit Bildern, Rhythmus, Wiederholung und Staffelung. Vor allem aber arbeitet er mit Fläche und Raum. Zahlreiche seiner Gedichte sind Teil von Zyklen, seine Gedichtbände Projekte. Langgedichte wie Gegensprechstadt – ground zero bauen sich flächig auf. Sie verfahren, ich übernehme ein Wort von Gerhard Falkner, polymer: Chemisch bedeutet das „aus vielen gleichen Teilen“ verzweigt gebaut. Erst so ergibt sich, im doppelten Sinn, der Geschmack eines Stoffs.
Im Satz, der Bilder zusammenfügt und der als Form, die selbst wiederum Verkettung verlangt, Bilder in Bewegung setzt, gewinnt Denken Form. Der Satz ist jenes Netz, das ausgeworfen sein muss, nicht, um den Gedanken „einzufangen“ – als gäbe es ihn außerhalb des Rhythmus- und Sprachepolymers bereits –, sondern um den löchrigen Raum zu markieren, in dem er Platz finden kann. Auf dass der Gedanke, gedacht in der Satzvariation, im Drehen des „Gegenstandes“, im Immer-neu-Atem-Holen, sich nicht setze, sondern entwickle in uns, den Lesern. An der Hand, am Tisch, beim Wort genommenes Denken, mit Brot für Körper und Geist. Um im Gedicht wach unterm Tisch zu sitzen, im Schatten des Objektes, beschützt und bedroht. Mit fühlenden Gedanken, in der Sicherheit der Wiederholung, liebkost von ihr, wenngleich mit den Forderungen eines anderen im Ohr, voller Sehnsucht nach allem, nach immer mehr. Als Spielball der raffinierten Zusammenstellungszärtlichkeit Falkners, die uns, manchmal mit Schärfe, manchmal verlockend schön, ins Ohr singt von uns selbst und „vom heute geweßenen Tage“:
und er wird mich fragen werden, ach der… ?
wird mich fragen wollen: ach der… der Ti?
mit dem Brot oben, dem Gedicht in seinem dunklen,
gebundenen Laib, das sich herleiert und mit dem
alles gesagt ist, mehr als alles, ich will von dem Brot oben
mehr als alles, ich will, abends, wenn die Drossel
verstummt, mehr als alles gehabt haben, es soll
so tränenlos geweint worden sein wie in einer Zeile
von Trakl, es soll mich, soll, soll, soll mich, fertig
fertig gemacht haben, fertig, fertig, es soll mich sagen
gehört haben: nicht du! Ich kann das Brot anklicken
und habe deine Brust: (eine Brust für Götter)
ich kann deine Brust anklicken
und habe dein Herz… (ein Herz für Götter)
aber nicht du! Nur das Brot
ich will nicht mehr gekonnt haben können, will
nach dem Brot, in das ich soviel Gewicht gelegt habe
nicht mehr gekonnt haben können
aber ich ach ich bin bin doch nicht
doch nicht zu haben!
Er hat seine Hände an mir haben wollen aber
ich bin, binbin nicht zu haben
nicht für Brot… und nicht… unter dem Tisch!
Wer hier Echos hört, hört richtig. Falkner arbeitet mit Wirklichkeitsbrüchen, Versatzstücken, Neuwörtern, Fachsprachen, technischen Entwicklungen, er klopft, hämmert, mutiert. Den Satz liebt er doppelt. Baut Stufen, führt uns in einen Raum. Und dann: der Satz als Sprung. Bei Falkner ist er immer beides: Kontinuität und Überraschung, Weiterführung und Bruch.
Auf der Höhe der Zeit?
Welch Ausdruck. Muss man nicht unter ihr liegen? Als schwerer Körper, offenen Nervs. Versteckt, kein Gegenstand mehr. Sich auflösend. Begeistert.
Im Satz wird der Leser vom Satz überrascht, weil sein Autor um Grenzen spielt: wie er uns etwas in Lücken durch Lücken hindurch erzählt, aus Null oder unter Null, als Gegensprechen, also Teil eines mechanisch bedroht-ermöglichten Dialogs, als Verschieben der Sprache im Worterfinden und Verhören, absichtsvoll.
In der Genauigkeit lächelt die Dichtung. Sie sieht auf jedes Wort. Falkner:
Die Konjunktion ,und‘, mhd. unde, ahd. unte, ist ein Knotenpunkt der gesamten Syntax und ein Wort ohne Synonym. In ,Äpfel und Birnen‘ kann kein anderes Wort die beiden Früchte zusammenzählen, in ,eins und eins‘ ebenfalls nicht. Das ,und‘ ist Exponent fast aller Nebensätze und ist mit der geheimnisvollen Kraft ausgestattet, ,die Andacht zum Unbedeutenden zu wecken‘.
Jeder Autor entwickelt seine Mittel und Besonderheiten: Sie sind nicht frei gewählt, sondern Schmerzpunkte, Brennstellen, Bündelungen. Sie rutschen mit uns unter den Tisch, bringen unsere Ängste, unser Dennoch, unsere Sehnsucht nach „Mehr“ auf den Punkt. Bei Falkner gehört Körperbewegung zu diesen Mitteln, gleitend, halb willkürlich. Und es gehört dazu: das sich selbst in Frage stellende Ich.
(…)
Hell Hören
Bärenohren ragen, die Muscheln nach vorn gerichtet, aus dem pelzigen Kopf. Man sieht an dieser Ohrstellung, dass Bären keine Fluchttiere sind. Anders als wir: Unsere Ohren sitzen seitlich. Angreifer sind wir und Flüchter, angewiesen darauf, rundum zu hören.
Falkners Satz-um-Satz-Genauigkeit bringt Texte zum Schwingen, damit wir uns mit Sprache einmal mehr um einen Gedanken drehen, mal zornig, mal augenzwinkernd, immer mit Bildkraft und ja, Schönheit und Harmonie. Sie sind das Ziel der Härte der Form. Allerdings in einem spezifischen Danach: nach „nach der Natur“. Nach dem Zynismus, dem Pathos, den Pathos-Tabus. In einer Welt, die Sprechformen für Gefühle dringend braucht, diese Gefühle zugleich aber fürchtet. Falkner tastet sie aus.
TÜBINGER STIFT
nur einen jener
elenden sätze
er schreiben noch wollte
die enden in
dieser ersatzlosen helle
innerster
sprache. sein körper
die stelle nicht mehr
noch seine stimme
die dringende drohung
schönheit
läge nicht in ihrer macht
denn schlackenlos die
zur notwendigkeit nur
wo sie ihr trotzt
Formt man die Ohren eines Menschen in Gips ab und setzt die getrockneten Schalen einem anderen so auf, dass aller Schall für ihn nun durch die Fremdohren gebrochen wird, hört der Proband nichts. Sein Gehirn ist so verwirrt, dass es die Signale nicht verarbeiten kann.
So unsere schwerfällige Physiologie.
Da lächelt die Dichtung. Mit ihr streift man sich die Ohren eines anderen über. Langsam öffnen sich seine Augen in uns nach innen und außen.
Und?
Zieh dir die fremd-vertraute Welt eines Falknerschen Gedichts über den Kopf, bis du Funken schlägst.
Ulrike Draesner, aus Ulrike Draesner: Heimliche Helden, Luchterhand Literaturverlag, 2013
Gerhard Falkner – Ein Dichter im Gespräch mit Ludwig Graf Westarp. Über Berlin und die Bedeutung kunstspartenübergreifenden Arbeitens.
Zum 70. Geburtstag des Autors:
Gregor Dotzauer: Seelenruhe mit Störfrequenzen
Der Tagesspiegel, 14.3.2021
Fakten und Vermutungen zum Autor + Laudatio + KLG + PIA
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Galerie Foto Gezett + Dirk Skibas Autorenporträts +
deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Gerhard Falkner liest auf dem XI. International Poetry Festival von Medellín 2001


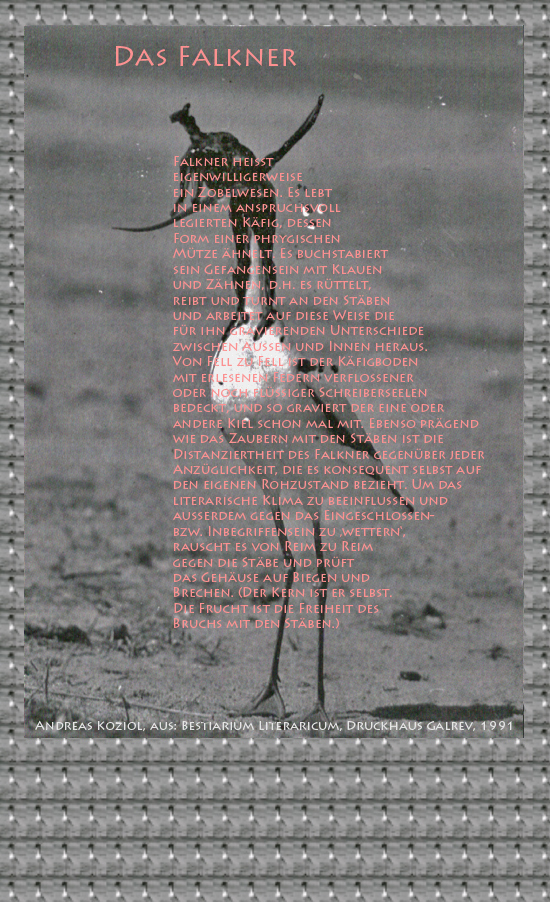












Schreibe einen Kommentar