Gunnar Ekelöf: Poesie
WENN MAN SOWEIT GEKOMMEN IST
Wenn man soweit gekommen ist in der Sinnlosigkeit
aaaaawie ich
wird jedes Wort wieder interessant:
Funde im Verscharrten
die man mit dem archäologischen Spaten wendet:
Das kleine Wort Du
vielleicht eine Glasperle
die einmal um einen Hals hing
Das große Wort Ich
vielleicht ein Feuersteinscherben
mit dem irgend ein Zahnloser sein zähes Fleisch
geschabt hat
Nachwort
Ein großer Teil der modernen Poesie, und zwar ihrer bedeutendsten Erscheinungen, hat das Mißtrauen gegen die Poesie selbst zu ihrem Ausgangspunkt gemacht. Dieses Mißtrauen richtet sich gegen das dichterische Gebilde als geschlossene Entität und selbstherrliches Kunstding, gegen den Dichter als das erhabene Mundstück allgemeiner und umfassender „Wahrheiten“, ja gegen die Sprache selber als Mittel menschlicher Kommunikation. Dieses Mißtrauen ist so wenig wie der „Modernismus“ überhaupt ein neues Phänomen. Es hat sich bereits eine eigene Tradition geschaffen: eine Tradition der permanenten Revisionen und Ausbrüche, Revolten und Neuanfänge. Die historischen Mächte und Tatsachen unserer Zeit haben dafür gesorgt, daß diese Tradition sich nicht zur Routine, in einen Akademismus der Diskontinuität hat verwandeln können. Sie sah sich unbarmherzigen Erfahrungen und Argumenten ausgesetzt, die sie gezwungen haben, stets lebendig zu bleiben.
In dieser Tradition ist Gunnar Ekelöf behaust. Heute, dreißig Jahre nach seinem Debut, zeichnet er sich immer deutlicher als ihr hervorragendster Vertreter in der schwedischen und skandinavischen Gegenwart ab: als ein Poet, der sich eine paradoxale Autorität erworben hat eben dadurch, daß er jeden autoritativen Anspruch der Poesie in Frage gestellt und immer aufs neue seine künstlerischen Positionen preisgegeben hat, sobald sie erreicht und gefestigt waren. Zuweilen mochte es so aussehen, als hätte er den jugendlichen Saboteur hinter sich gelassen, als welcher er in seinem Erstlingsbuch Senf på jorden erschien: als wäre die Notwendigkeit erstorben, die er seinerzeit verkündet hatte – „die Buchstaben zu zerbrechen“. In solchen Zwischenzeiten hat er eine Reihe der schönsten Miniaturen und der mächtigsten, am reichsten orchestrierten Gedichte geschrieben, welche die schwedische Lyrik besitzt; wie alle großen Dichter des Mißtrauens beherrscht er souverän die Werkzeuge, die er am liebsten zerschlüge. Nie aber hat er sich zur Ruhe gesetzt, und in seinen letzten Büchern hat er radikaler denn je verworfen, was im oberflächlichen Verstand als „künstlerisch“ gilt. Er arbeitet darin gerne mit Kinderreimen, Parodien und Nonsens-Versen. Vor allem andern aber bedient er sich eines nackt konstatierenden Stils von der äußersten Einfachheit. Wie ein Forscher unter den Ruinen eines sprachlichen Pompeji bewegt er sich, und die Funde, die er „mit dem archäologischen Spaten wendet“, erfüllen ihn mit Staunen und Ehrfurcht. Es scheint sein dichterisches Schicksal, sowohl die Rolle der vulkanischen Lava wie die des demütig arbeitenden Archäologen zu spielen. Und es gehört zu seiner Größe, daß er diese Rollen nicht nur zu wechseln, sondern auch in eine sinnvolle Beziehung zueinander zu setzen vermocht hat. Destruktion ist bei Ekelöf eine Voraussetzung für lebenswichtige Entdeckungen, und schroffe Gegensätze lösen sich früher oder später in Synthesen von schwindelnder Kühnheit auf.
Daß er ein Mann der Gegensätze ist, und zwar in jeder Beziehung, das ist übrigens der erste Bescheid, den seine Dichtung gibt. Zu einem Teil handelt es sich dabei gewiß um Kontraste, die eher auf Reichtum als auf Zersplitterung hindeuten. Das zeigt sich schon daran, daß der Aufrührer Ekelöf, wenn er will, auch ein Meister traditioneller Formen ist; überhaupt verfügt er, wie mancher andere Pionier des modernen Gedichts, über ein Traditionsbewußtsein, das dem der epigonalen Kulturkonservativen in Breite und Tiefe weit überlegen ist. Auf die eine oder andere Weise ist jede Epoche der schwedischen Sprach- und Literaturgeschichte für ihn von produktiver Bedeutung gewesen. Zeitweise hat ihn die visionäre Spekulation der Romantik angezogen; zeitweise berührte er sich aufs engste mit den polaren Kraftströmen des achtzehnten Jahrhunderts: Skepsis und Sensualität, Rationalismus und Mystik. Er übertreibt vielleicht, wenn er in einem Essay behauptet, der Schwede sei der „konsequenteste Vatermörder der Alten Welt“; wenn darin aber ein vorwurfsvoller Ton anklingt, so richtet er sich keinesfalls gegen Ekelöf selbst und seine eigene künstlerische Praxis. Ekelöf kennt in dieser Beziehung kein Vorurteil; wozu er Wahlverwandtschaft spürt, das macht er sich zunutze; was seine Leser verwirren mag, ist allenfalls die Breite seines Registers. Abgesehen von Schweden, dem er eine unauslöschliche Haßliebe entgegenbringt, war ihm lange Zeit Paris eine Art von Wahlheimat; der Menschenstrom auf den Boulevards hat ihn nicht weniger stimuliert als die Einsamkeit und Stille einer Dorfstraße in seinem eigenen Land. Heute zieht es ihn mehr nach Italien und nach Griechenland. Aber auch außerhalb Europas hat er Anknüpfungspunkte gefunden; es ist kein Zufall, daß er einmal an der London School of Oriental Studies immatrikuliert war.
Man könnte solche Bezüge reihenweise herstellen, etwa indem man von seinen literarischen Herkünften und seinem Aufenthalt in Zeit und Raum zu seiner Beschäftigung mit anderen Kunstgattungen überginge. Wie er selbst einmal geäußert hat, gilt sein tiefster Dank der Musik; sie war ihm sogar eine Quelle unmittelbarer Inspiration – nicht im Sinn einer herkömmlichen „Sangbarkeit“, sondern dem einer Poesie, die, wie er selber sagt, „mit Reprisen, Modulationen und Durchführungen von sprachmelodischen Themen“ arbeitet. Andrerseits hat er mehr über Malerei als über Musik geschrieben: Aufsätze und Bücher. Seine Interessen lassen sich überhaupt nicht erschöpfend darstellen, wenn man nicht riskieren will, am Ende bei der Kochkunst und bei der Kunst des Umgangs mit Katzen zu landen: gewiß auch dies Künste, die nicht ohne Bedeutung sein mögen. Die entscheidende Schicht von Ekelöfs Gegensätzlichkeit liegt indessen tiefer als alle Kontraste, die in seinen reichen Interessen und in seiner feinverzweigten Sensibilität gründen. Sein Reichtum ist von Zersplitterung und Spaltung zerfurcht. Das horazische disiecti membra poetae ist für Ekelöf mehr als nur ein ästhetisches Problem; nämlich eine psychologische Realität, die nicht leicht zu ertragen ist: „O meine verstreuten Glieder! / Wie sehnt ihr euch nach festem Halt / danach, ganz und anders ganz zu sein!“
Diese Erfahrung ist mit der Erfahrung des „Absurden“ verwandt, die seit dem Surrealismus (der für den jungen Ekelöf von nicht geringer Bedeutung gewesen ist) auf dem Grund so vieler neuartiger Gedichte liegt. „Absurd aber ist“, Camus’ rhetorischer Begriffsbestimmung in seinem Sisyphus-Aufsatz zu folgen, „die Gegenüberstellung des Irrationalen und des glühenden Verlangens nach Klarheit, das im tiefsten Innern des Menschen laut wird.“ Dem Irrationalen entspricht die Zersplitterung, die Auflösung der Welt und des Ich in bedrohliche und ruhelose Fragmente. Das Verlangen nach Klarheit drückt sich bei Ekelöf in der Sehnsucht nach Ganzheit aus, und zwar einer „andern“ Ganzheit als der des Systems: da die Systeme nur noch als Sagen oder Lügen erfahren werden können. Und das Mißtrauen gegen die Sprache ist für den Poeten Ekelöf – ebenso wie das Mißtrauen gegen den Roman bei den Autoren des nouveau roman in Frankreich – nur ein (wenn auch besonders brennender) Sonderfall jenes weit allgemeineren Mißtrauens, jenes mehr oder minder totalen Gefühls der Desillusion.
In einer solchen Lage bleibt kaum mehr übrig, als tabula rasa zu machen. Das ist Aufgabe und Schwierigkeit genug – jedenfalls dann, wenn jenes „Verlangen nach Klarheit“, als der ursprüngliche Antrieb der Auseinandersetzung, dabei nicht nach und nach in Vergessenheit geraten soll. Der junge Ekelöf konnte zwar seinen „Haß auf die niederschmetternde allgemeine Dummheit, auf den Staat und die Ideologien, auf Familie und Kirche, auf die Lüge und die Furcht“ ausrufen, aber er fühlte sich machtlos angesichts dieser Greuel, und er sah für sich selbst keinen andern Ausweg als Untergang oder Wirklichkeitsflucht: „Gift zum Sterben oder Träume zum Leben“. Später hat er Sent på jorden ein „Selbstmordbuch“ genannt; aber es blieb bei den Träumen. In Dedikation (1934) machte er sich zum Seher, zum voyant im Sinn Rimbauds, und spielte eine ganze Welt von Träumen gegen die unerträglichen Realitäten aus. Das war gewiß eine „andere Ganzheit“; aber keine, an der der Dichter auf die Dauer sein Genügen hätte finden können. Sorgen och stjärnan (1936) und Köp den blindes sång (1938), die beiden folgenden Bände, lassen uns spüren, wie die Träume nach und nach versinken. Der souveräne Seher wird bald zum wehmütigen Romantiker, und der Romantiker sieht einem jener Dichter ähnlich, die im Schweden der dreißig er Jahre gang und gäbe waren: jener Dichter, die in Kindheitserinnerungen und im Glauben „an die Sache des Lebens“ ihre Zuflucht suchten.
In alledem konnte man eine durchgreifende Verwandlung sehen; aber im Grunde ging es Ekelöf eher um die Einkreisung, die systematische Untersuchung jener Möglichkeiten, die das annehmbare, das „positive“ Glied der Alternative aus Sent på jorden offenließ. Der Ertrag dieser Arbeit war eine umfassende Kenntnis der verschiedensten künstlerischen Methoden, dazu einige schöne Gedichte; aber was die großen Fragen anging, so war das Resultat niederschmetternd. Die „Träume“ hatten nur neue Lügen mit sich gebracht, die sich den alten entgegen- und gegenüberstellen ließen. Nichts anderes ließ sich für das „Gift“ eintauschen als die rücksichtslose Anerkennung der eigenen Leere, der Zersplitterung, der hoffnungslosen Isolierung, die letzten Endes unser aller Schicksal ist. Im Kriegsjahr 1941 schrieb Ekelöf einen Aufsatz unter dem Titel „Der Weg eines Außenseiters“, der in eine programmatische Erklärung einmündet, die für seine ganze spätere Dichtung gilt:
Die erste Aufgabe eines Dichters ist es, sich selber ähnlich, also ein Mensch zu werden. Seine erste Pflicht – oder vielmehr sein bestes Mittel, um dieses Ziel zu erreichen – besteht darin, daß er seine unheilbare Einsamkeit und die Sinnlosigkeit seines irdischen Lebens vor sich selber eingesteht. Dann erst vermag er die Wirklichkeit aller Kulissen, Dekorationen und Vermummungen zu entkleiden. Auf keine andere Weise kann er andern von Nutzen sein, als dadurch, daß er sich in die verzweifelte Lage der andern – und aller – Menschen begibt. Die Sinnlosigkeit ist es, was dem Leben seinen Sinn gibt. Das ist, in aller Kürze, mein credo quia absurdum.
Im seIben Jahr ließ Ekelöf sein Buch Färjesång erscheinen. Dieser Band ist seine erste große Abrechnung mit der Welt, dem Ich und den Träumen. Er ist gleichzeitig sein erstes Werk, in dem der lyrische Apparat reduziert wird. Von der höhnisch verbogenen alchimie du verbe seiner ersten Bücher ist kaum mehr eine Spur geblieben, sowenig wie von der konventionelleren Wortmagie der späteren. Was hier vorliegt, ist eine „unpoetische“ Poesie, die streng an ihre Aufgabe gebunden bleibt: nämlich die, mit der größten möglichen Schärfe das neue Credo des Autors zu formulieren und zu erproben. Er geht dabei ganz ohne verzweifelte Gebärden zu Werke; das Leiden wirkt gleichsam windstill, aber der Vers gibt seinen Puls mit untrüglicher Genauigkeit wieder. Mehr kommt ihm nicht zu; aber mehr ist auch nicht vonnöten; jedes Mehr hätte das Gleichgewicht dieses asketischen und zugleich explosiv vitalen Buches zerstört. In einem seiner Gedichte ist die Rede vom „tiefsten Glauben, den nur gewinnt, wer nichts glaubt“. Ebensogut gibt es eine Poesie, die sich erst jenseits der Poesie eröffnet; sie ist es, der sich Ekelöf hier entgegentastet.
Von den Möglichkeiten und Schwierigkeiten seines Glaubens, von den sich wandelnden Formen, in denen er sich offenbart, und von seinen unerwarteten Konsequenzen hat Ekelöf in den letzten zwanzig Jahren gedichtet, gesprochen. „Erneuerung“, so schreibt er einmal, „bedeutet für mich die ständige Nachprüfung ein und desselben.“ In dieser Absicht geht er so weit, ältere Gedichte umzuschreiben oder frühere Fassungen, „Ursprungsmanuskripte“ späterer Werke hervorzuholen und zu publizieren; auch darin drückt sich sein Widerwille gegen alles Abgeschlossene, „Fertige“ aus. In den beiden Sammlungen Non serviam (1945) und Om hösten (1951), die vielen Betrachtern als seine wichtigsten Publikationen gelten, stellt er Gedichte und Fragmente nebeneinander, die zu ganz verschiedenen Zeiten entstanden sind, auf daß sie einander beleuchten, ergänzen oder widersprechen. Er kann fünfzehn Jahre oder noch längere Zeit an einer einzigen großen lyrischen Komposition arbeiten (En Mölna-elegi, vollendet und veröffentlicht 1960); aber er kann auch einen umfassenden Motivkomplex – wie etwa den der Grenzziehung zwischen dem „Wirklichen“ und dem „Unwirklichen“ – in ganz wenigen, halbverstreuten Zeilen zu Ende formulieren. Er mag zuweilen unberechenbar, nachlässig, ja launisch scheinen; in Wirklichkeit bleibt er seiner grundlegenden Erfahrung von den Bedingungen des Lebens und des Dichtens unerschütterlich treu. Er müßte sich selbst „der Lüge und der Furcht“ schuldigsprechen, gäbe er jemals vor, etwas anderes vorweisen zu können als disiecti membra poetae.
Was aber ist aus den schwindelnden Synthesen und aus der Sehnsucht nach einer andern Ganzheit geworden? Was die Synthesen angeht, so mußten auch sie begrenzt und provisorisch bleiben: blitzartige Verbindungen zwischen Erlebnisfragmenten, kaum angedeutete dritte Schritte im Taktmuster der Dialektik, überraschende neue Ausgangspunkte, die durch die äußerste Anspannung der Gegensätze erreicht werden. Was bleibt über die Sehnsucht nach dem Ganzen zu sagen? Sie mag ihren Lohn je länger je mehr in sich selber tragen, so wie der Glaube jenseits allen Glaubens sich je länger je mehr aus einem Vorsatz in eine Haltung der Frömmigkeit verwandelt hat. Der Wille, das Dasein zu demaskieren, hat sich bei Ekelöf immer mehr auf das konzentriert, was man gemeinhin das Mysterium des Todes nennt; in Strountes (1955) hat er, gejagt von allen Furien des Nihilismus, seinen Höhepunkt erreicht. Opus incertum (1959) und En natt i Otočac (1961) zeugen von einer gewissen Entspannung, einem Ausruhen in attischen Olivenhainen nach den Beschwernissen der Reisen in die Unterwelt, von einer Resignation, die zugleich vollkommene. Offenheit ist. Ekelöf kann sich bekennen zu „einer Weise zu leben, die es nicht gibt“ und „zur Kunst des Unmöglichen / aus Lebensmut und aus Selbstvernichtung / zugleich“. Das Unmögliche im Herzen zu tragen, die Einheit der Gegensätze sich ruhig zu vergegenwärtigen, ist genug. Der Rest ist Dunkelheit und Last, aber auch Stoff zu plötzlichen Freuden und Schimmer unvermuteter Zusammenhänge. Und schließlich der Tod, der nicht etwas Besonderes, Ausgezeichnetes ist, den es vielmehr bloß gibt, der im Dunkel oder im hellen Sonnenlicht da ist und darauf wartet, alles auszustreichen. Er hat keinen Sinn. Deswegen ist er sinnvoll. Weiter kommen wir nicht.
Davon spricht Gunnar Ekelöf mit den einfachsten und überraschendsten Worten, und das Mißtrauen ist nun fast ganz aus seiner Stimme geschwunden.
Bengt Holmqvist, Nachwort
Die Poesie der Gegenwart
ist universell und provinziell zugleich: beides im vornehmsten Sinn; sie ist gebunden an ihre eigene Sprache, aber auch an ein gemeinsames Bewußtsein; im Besonderen bringt sie das Allgemeine an den Tag. Die Sammlung Poesie setzt deswegen stets neben die Übersetzung das Original. Immer noch fehlen uns unentbehrliche Werke der modernen Poesie, besonders aus jenen Sprachen, die schwer zugänglich sind. Hier sollen sie vorgestellt werden: die alten Meister der Moderne und unter ihren jüngeren Nachfolgern die, deren Werk sich in solcher Nachbarschaft behaupten kann.
Suhrkamp Verlag, Klappentext, 1962
Gunnar Ekelöfs Universum
Immer deutlicher hat sich mit den Jahren abgezeichnet, daß Gunnar Ekelöfs Dichtung eine Sonderstellung innerhalb der schwedischen Lyrik einnimmt. Als Dichter hat er sich abgesondert, gleichzeitig aber aus dieser Absonderung heraus einen verblüffenden Einfluß auf Leser, Kritiker und jüngere Lyriker ausgeübt, und dieser Einfluß wirkt fort. Nicht zuletzt gilt das für die schwedische Lyrik der 60er und 70er Jahre: Lars Gustafsson, Göran Sonnevi, Göran Palm oder Tobias Berggren, sie alle bezogen sich auf Ekelöf als Lehrmeister.
Worin aber liegt die Eigenart Ekelöfs, was begründet die Anschauung seines Werks als einer Welt mit eigenen Gesetzen? Griffen diese jüngeren Lyriker nicht völlig verschiedene Seiten des Ekelöfschen Werks auf sei es nun die reine Form seiner Visionen, das Unbestechliche seiner Gedankenlyrik, das Alltägliche seiner Sachlichkeit oder das Träumerische seiner Montagetechnik – und verwiesen damit auf eine Komplexität, die allen Versuchen einer eindeutigen Antwort auf eine solche Frage widersteht? Die Eigenart Ekelöfs läßt sich unmöglich auf eine Formel reduzieren.
Wenn überhaupt von Gunnar Ekelöfs Poesie als einem Universum gesprochen werden kann, so ist damit eine Welt in ihrer Entwicklung gemeint, die in einer Art Spiralbewegung um die stets gleichen Grundprobleme kreist und dabei zu immer neuen Möglichkeiten ihrer Artikulation findet. Auch handelt es sich um kein in sich geschlossenes Universum, es wird durchströmt von einem ausgeprägten Traditionsbewußtsein, das sich noch weiter verstärkt; die Bedeutung der Intertextualität und der vielschichtige Dialog mit der großen klassischen Dichtung werden dabei immer offensichtlicher und kulminieren in Eine Mölna-Elegie (En Mölnaelegi, 1960) und im Spätwerk.
Schließlich. ist es ein Universum, das sich selbst aufhebt und das von Anfang an bemüht scheint, das Ziel des eigenen Unterfangens in einen Bereich jenseits der erfahrbaren Welt zu verlegen, in ein Nichts, das, mit unterschiedlichen Strategien, von der Erstlingssammlung spät auf erden (sent på jorden, 1932) bis zum postum erschienenen Band Partitur (1969) gesucht wird.
Wenn ich eine Formel, ein paar Zeilen als möglichen Einstieg in die paradoxe Welt voranstelle, die Ekelöfs Dichtung evoziert, so verstehen sie sich als einer von mehreren möglichen Ausgangspunkten. Sie stammen aus dem genannten Band Partitur:
Du bist das Sandkorn
auf dessen Unbestand
will ich meine Wüste bauen
Du bist die Mutter die Jungfrau ist
und in dem Spiegel der unter deinem Herzen hängt
werde ich mich wiedererkennen
Was diese Zeilen ausdrücken, ist, daß Ekelöfs Welt nicht nur in ihrer Bewegung zum Nichts hin eliminiert wird, sie wird auch entleert von einem Du, das angerufen wird und in seiner apostrophierten Abwesenheit auf das lyrische Ich zurückwirkt. Dieser Dialog existiert bei Ekelöf von Anfang an, bereits vor dem Debüt, seine besondere philosophische und mythologische Bedeutung erhält er aber erst in der Anrufung der Jungfrau in „Nimm und schreib“ (im Band Fährgesang, Färjesång, von 1941) und erreicht in den Gesängen des Fürsten im Dīwān über den Fürsten von Emgion (Dīwān över fursten av Emgión) von 1965 seinen Höhepunkt.
Was bedeuten jene paradoxen Zeilen: „Du bist das Sandkorn / auf dessen Unbestand / will ich meine Wüste bauen“? Die Anrede verkleinert das Nichts – die Wüste −, das hier gebaut werden soll, um es unendlich zu vergrößern. Nur, wie baut man eine Wüste? Und wie kann das Du, die angeredete Jungfrau-Mutter, zum Fundament für dieses Unterfangen werden?
Auf ebenso widersprüchliche wie grundlegende Weise wird das Du zugleich Ausgangs- und Zielpunkt des gesamten Schaffensprozesses. Über die Reduktion des Du soll die gewaltige Entleerung vollzogen und der Text selbst zu einer unendlichen Leere werden. Zugleich ist, wie im Fortgang des Textes deutlich wird, diese expansive Entleerung untrennbar verbunden mit einem Erkenntnisprozeß, jener Spiegelung, durch die das zu Beginn von sich abgetrennte Ich sich wiedererkennen können soll. Die Zeilen, die eine dialogische Poetik in enger Anlehnung an die via negativa der Mystik konstituieren, stehen nicht ohne Grund im Futur: ein Zustand jenseits von Sprache und Welt läßt sich nie ein für allemal erreichen. Die tiefe Ironie liegt darin, daß er sich bei Ekelöf nur durch die Sprache erreichen läßt.
Ausgehend von der Formel in Partitur könnte man also Ekelöfs Poetik als dialogisch und grenzüberschreitend bezeichnen, er bewegt sich ständig zwischen zwei Ordnungen, dem Männlichen und dem Weiblichen, dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren, dem Sein und dem Nichts. Sein Ausgangspunkt ist die „Nacht am Horizont“, wohin er u.a. Mallarmé gefolgt ist. Im Unterschied zu Mallarmé aber betrachtet er dieses Nichts als ein weibliches, kosmisches Prinzip, als seine Andere Seite, als das Abwesende, das er erst heraufbeschwören muß.
Es fragt sich, ob diese Realität überhaupt existieren kann, bevor der poetische Akt seinen Anfang nimmt. Ekelöf schreibt, daß er diese gewaltige Leere auf dem Sandkorn des Du bauen will, als sei das Nichts untrennbar verbunden mit der poiesis, dem Akt des Schreibens selbst.
Die Zeilen in Partitur verweisen somit auf einen Grundkonflikt von Ekelöfs Dichtung: Wenn dieses Andere vorhanden ist (als Nichts), warum dann schreiben? Andererseits: Wenn es nicht vorhanden ist, was ist es dann mehr als der Schreibakt?
Am Greifbarsten tritt dieser Grundkonflikt wohl in spät auf erden und im Dīwān über den Fürsten von Emgion hervor, wo das lyrische Ich mit quälender Intensität seinen Ausstieg aus der Wirklichkeit begehrt bzw. einer Blendung unterworfen wird, die das Ich gleichsam automatisch von der Bindung an das Sichtbare befreit. Das eine Leiden befreit selbstverschuldet oder brutal von außen eindringend – von einem anderen Leiden, der Anwesenheit in dem Schrecken einer von Gewalt, Kategorisierung und Unterdrückung geprägten Welt.
Ekelöfs Dichtung handelt negativ von dieser anderen Welt; die Rolle, die er als Poet einnimmt, ist die des Außenseiters und Sündenbocks, des gefangenen kurdischen Fürsten oder des Rebellen Luzifer, wobei er dessen Wahlspruch übernehmen kann: „Non serviam“. Und Ekelöf ist sich der Instabilität dieser Grenzposition zutiefst bewußt; an einer Stelle der Mölna-Elegie spricht er selbst die etymologisch verwurzelte Doppeldeutigkeit des lateinischen „sacer“ aus: „Verflucht seist du / verflucht heißt entschlüsselt heilig“.
Der Weg zum Nichts ist somit eingebettet in ein Muster von Gewalt, das der Dichter verdoppelt – als Zeichen, als Schutz und als Mittel, um seine Wunden vorzuzeigen und zu artikulieren – und das besonders greifbar wird in der grundlegenden Thematik der Blindheit.
Bei einer Beschreibung von Ekelöfs Universum kann man diese Blindheit unmöglich übergehen. Sie ist in sich Grenzmarkierung, die in zwei Richtungen verweist, auf den Gewaltzusammenhang einerseits und auf die heraufbeschworene Vision, die aus ihr erwächst, andererseits. Bei Ekelöf ist es der Blinde, der wirklich sieht; die Blindheit wird zu einem Mittel, um das Unsichtbare dramatisch heraufzubeschwören. Um die Zeilen aus Partitur zu travestieren, könnte man sagen, daß er in seiner Lyrik das Unsichtbare mit Hilfe der Blindheit „baut“.
Aber wenn auch der Blick von Anfang an in traumatischer Weise in Ekelöfs Welt ausgelöscht erscheint – was dazu beiträgt, der Sammlung spät auf erden ihren apokalyptischen Ton zu verleihen, wie er den Sonnenfinsternis-Szenarios, den fallenden schwarzen Schneeflocken und der sinkenden Abendsonne über dem Meer zueigen ist −, so wird jener Blick am Ende zum Träger der höchsten Erkenntnis. Das geschieht in der Trilogie des Spätwerks in einer Reihe eindrucksvoller Begegnungen, mit einer Klimax im Mittelstück des Bandes Führer in die Unterwelt (Vägvisare till underjorden, 1967), wo Luzifer genau in der Mitte des Buches dem Blick der unschuldsvollen Novizin begegnet. Diese Begegnung bildet eine Art Quintessenz, eine Vereinigung der Gegensätze, um die Ekelöfs Dichtung kreist: Männlich und Weiblich, Erfahrung und Unschuld, satanischer Aufruhr und mystische Auslöschung.
Eine andere derartige Begegnung vollzieht sich in dem großartigen Gedicht „Xoanon“ in Das Buch Fatumeh (Sagen om Fatumeh, 1966), das in seinem Verlauf die Verwandlung des Sichtbaren allein deshalb durchführt, damit der Blick der Jungfrau-Mutter direkt aus der Materie hervorgehen soll. Ekelöf läßt uns als Zeugen konkret an dieser Verwandlung teilhaben, er spricht zu einer Ikone, die er über seinem Bett hängen hatte und die er im Detail beschreibt, während er im gleichen Vorgang vor unseren Augen alle darstellenden Elemente des Bildes ablöst. Die Beschreibung fällt mit der Entkleidung zusammen – und Ekelöf hat seine Methode im Gedicht auch einen „Striptease“ genannt. Bezeichnend für die Tendenz Ekelöfs, sich mit Luzifer zu identifizieren, ist dabei, daß er als erstes die Christusgestalt ablöst. Die gesamte intime, erotisch aufgeladene Entkleidung erfolgt im Rahmen eines Dialogs mit einem weiblichen Du, eines en face-Kontakts, wie er spezifisch ist für die Ikonenmalerei, zu der es Ekelöf hinzog.
Mit der ersten Gedichtzeile stellt das Ich zunächst den Kontakt mit dem Du her: „Ich besitze, in dir, eine wunderwirkende Ikone“, um am Ende „das Auge von einem Ast“ in dem bloßgelegten Stück Holz als Antwort zu erkennen. Jenseits des Bildes und des Sichtbaren ersteht ein anderer Blick: „Du blickst mich an. Hodigítria, Philoúsa.“
Auch das Gedicht „Xoanon“ ist ein Beispiel für jene Poetik, die komprimiert in den Zeilen in Partitur angelegt ist. Ausgehend von der ätherischen Begegnung mit einem weiblichen Du läßt Ekelöf das Nichts in kosmische Dimensionen expandieren. Naheliegend ist auch, den erwiderten Blick in „Xoanon“ als eine Einlösung jener Spiegelung zu deuten, zu der die Zerstörung in den Zeilen aus Partitur Anlaß geben soll. Wenn das Du infolge des poetischen Akts das Ich sieht, ist dem Schreibenden jene Spiegelung gelungen, die die Ekelöfsche Dichtung die ganze Zeit über zu erreichen trachtet, über das radikal Andere jene Kluft zu Überwinden, die das Ich in der Initialsituation als so schmerzlich erlebt. Seine Dichtung gestaltet sich als Wiedereroberung einer verlorenen Welt durch die Blindheit hindurch; das Ich kann sich selbst nur durch die Andere, die Jungfrau-Mutter sehen.
Allerdings ist dieses Muster keineswegs einheitlich verwirklicht. Es wird variiert und mit einer Vielzahl von Strategien ausgedrückt. Kennzeichnend für Ekelöfs poetische Sprache ist ja nicht nur die Eliminierung der Askese – eine Legierung aus einer mallarméischen und einer orientalischen Technik der Transzendenz der Erscheinungswelt. Ekelöf ist ein träumender Melancholiker, der besonders in seinen ersten Sammlungen seine Gedichte als eine syntaktisch ungebrochene Bilderflut komponiert, unter anderem in der Nachfolge des Surrealismus und von Robert Desnos. Aber während diese Seite seines Schaffens nach dem Band Widmung (Dedikation) aus dem Jahr 1934 immer mehr in den Hintergrund tritt, gewinnt eine dritte Strategie stärker an Boden, eine Poetik des Grotesken und der Rhetorik des Nonsensverses, mit Wurzeln u.a. bei Schwitters, die mit der Distanzierung von der heroischen Rolle des Dichters zusammenhängt. Ihren Durchbruch erfährt sie in der Sammlung Unfoug (Strountes) von 1955, die in ihrem Interesse für Wortspiele und metapoetische Clownerien zu einer Vorgängerin der sogenannten postmodernen Literatur unserer Tage ernannt worden ist.
Die Heterogenität in Ekelöfs poetischem Ausdrucksspektrum ist groß, und die Schwenks zwischen seinen Sammlungen bisweilen verblüffend; gleichwohl ist das zugrundeliegende Muster die ganze Zeit über spürbar, die Kontinuität stets gewahrt. Auch wenn er surrealistisch komponiert, sich einem Träumen hingibt, das stark an Bachelards „la rêverie poétique“ erinnert, oder in der Manier der Groteske aufbegehrt, spürt er ständig die Grenzlinie zwischen dem Ich und dem Anderen auf, zwischen Sein und Nichts. Wenn er in Unfoug seinen Spaß mit verschiedenen Bedeutungen des Wortes „spjäll“ treibt – ein im Grunde unübersetzbares Spiel mit den Homonymen „spjäll“ – Ofenklappe – und „spjäll“ – (Rippen) Speer −, so geschieht das keineswegs ohne Nebenabsicht. Verändert hat sich nicht das Dilemma an sich, sondern nur die ironische Einstellung zum Dilemma. Die Aufgabe der Dichtung bleibt es, die Herrschaft der Bedeutung in Sprache und Denken zu unterminieren.
O was soll ich mit all diesen Klappen
Was soll ich mit diesen Wörtern
die eventuell ein und dasselbe bedeuten
offen oder geschlossen!
Sicher bin ich auf der falschen Halbkugel gelandet!
Ekelöf schreibt auf der „falschen Halbkugel“, er schreibt sich vom Abendland ins Morgenland vor, vom Sinn in die Sinnlosigkeit. Er schreibt mit einem indischen Blick, aber der Blick bleibt abendländisch verwundet oder vernichtet. Auf ergreifende Weise kann er in seinem Spätwerk an Ödipus auf Kolonos anknüpfen, der sich blind von seiner Tochter führen läßt.
Auch so sind die Zeilen in Partitur zu verstehen: das Du, das angesprochen wurde, ist das metonymische Sandkorn, das die Andere Halbkugel, den Orient, im Text expandieren lassen soll.
Ekelöf besitzt eine bemerkenswerte Fähigkeit, dieses Andere Reich, wie in „Xoanon“, als einen eingelassenen Leerraum oder eine unsichtbare Gegenwart vor unserem Blick erstehen zu lassen. Mit seiner tiefen Musikalität kann er dieses Andere „zwischen den Zeilen“ hervorrufen. Wenn er in dem von Michaux inspirierten Gedicht „Ich schreibe dir aus einem abgelegenen Land“ eine Position in dem Anderen Reich einnimmt, hat er die Perspektive gewechselt. Er befindet sich nicht mehr wie in Eine Nacht am Horizont (En natt vid horisonten, 1930/1962) auf dem Weg in die Auslöschung, sondern ist bereits dort, um den Adressaten zu instruieren, wie man dorthin gelangen kann; nämlich indem man „sich hinter sich läßt“. Dies ist eine via negativa, die nie auf sakrale Bejahung hinausläuft, sondern lediglich den Weg dorthin absteckt, sich dem Anderen mit Hilfe von Beschwörungen und magischen Wiederholungen annähert:
Das ist ein Land das Land ist
abgelegenes Land das Land ist
das abgelegenes Land ist
Die ganze Zeit läßt uns Ekelöf teilhaben an Entstehungsprozessen in der Divergenz zwischen dem ganz Kleinen und dem unendlich Großen, zwischen dem Begrenzten und dem Unbegrenzten oder dem Erniedrigten und dem Erhabenen.
Diese produktive Spannung läßt sich in vielerlei Weise formulieren, und sie prägt die Räumlichkeit bei Ekelöf, die zwischen der intimen, abgeschlossenen Wohnung des Träumers und den Eiswüsten der Askese pendelt. Und schließlich sind auch diese Pole miteinander verbunden, indem der intime Raum – sei es ein Boot, eine Höhle, eine Lappenkote, ein Zelt oder ein bronzenes Glöckchen, das den Körper einer Madonna formt – Abgeschiedenheit und Begrenzung erfordert und gerne auf dem Meer, auf einer Insel oder inmitten der Wildnis angesiedelt wird. Die Ambivalenz, die Ekelöfs Universum kennzeichnet – eine Welt, die sich selbst aufhebt in ihrer Bewegung auf das Andere hin −, lädt seine Räumlichkeit auf; bisweilen ist die Grenze zwischen Intimität und kosmischer Expansion nur hauchdünn. Diese Räumlichkeit schließt einen regressiven und beschwörenden Zug ein. In frühen Gedichten kann das intensive, sinkende Licht ins Gedächtnis zurückrufen, was Bachelard „la maison d’intimité absolue“ genannt hat – den pränatalen Raum, den Ekelöf in „Eine Julinacht“ in Non serviam (1945) anruft:
Laß mich meine Welt behalten
meine pränatale Welt!
Gib mir meine Welt zurück!
Dunkel ist meine Welt
doch im Dunkeln will ich heimgehn
durch Gras, durch Gehölz.
Ekelöf konstruiert ständig derart intime, einsame Räume. Und oft geschieht das in einer hypnagogen Traumphantasie, etwa wenn er sich im Wald verirrt und auf jene „wunderwirkende“ Madonna stößt, die einem bronzenen Glöckchen gleicht. Er läßt uns in ihr Inneres eintreten, das mit Edelsteinen geschmückt ist und in dem jeder Stein eine Kammer bildet, die zum Verweilen lädt. Das Interessante aber ist, daß dieser Rundgang in dem intimen Raum sich schließlich einen Weg hinauf sucht auf mallarméisch schwindelerregenden Wendeltreppen und in ihrem Kopf endet: „Dort war es leer. Das Schweben schwerelos.“ Der intime Raum grenzt nicht nur an das Nichts, er geht ins Nichts über. Wenn Ekelöf sich in dem Prosastück „Flucht aus der Wirklichkeit“ in eine Reihe einsamer Wohnorte fortträumt, gelangt er zuletzt in eine Lappenkote in der „Eiswüste“. Er bewegt sich in einer Geographie, für die es keinen Platz mehr auf der Karte gibt; er ist in einer „Eiswüste“ genauso gut in der Wildnis Lapplands wie in der Wüste Sahara. Es handelt sich um eine neutrale Zone, die für Ekelöf von befreiender Abstraktheit ist.
Diese Zone, die zusammenfällt mit jener Wüste, die auf dem Sandkorn des Du gebaut werden soll, ist in Verbindung mit der Jungfrau-Mutter ebenso intim wie abstrakt, ebenso fremd wie vertraut. Mit großer Selbstverständlichkeit kann Ekelöf schließlich den ganzen Kosmos als eine Gebärmutter auffassen, in der er selbst, einem blinden Spermatozoon gleichgesetzt, umherschwirrt. Seine Dichtung markiert den ebenso starken wie unmöglichen Wunsch nach einer Vereinigung mit diesem abstrakten weiblichen Raum.
Die Zeilen in Partitur als Teil des Spätwerks zeigen, daß der Impuls, die Wüste zu bauen, bis zuletzt erhalten bleibt. Seine paradoxe, sich selbst aufhebende Welt ist eine Welt, die sich in risikoreicher, unabgeschlossener Bewegung Über die Grenzen, kulturelle wie sprachliche, hinweg befindet. Er schreibt auf der Grenzscheide von Leben und Kunst über die Kunst, sich jeder Grenzziehung zu entziehen.
Anders Olsson, in: Akzente. Zeitschrift für Literatur, Heft 1, Februar 1991
Gunnar Ekelöf und die Jungfrau
– Ikonen und Gedichte. –
Gunnar – die Schmerzensreiche mit den Bildern meiner geliebten Erlösten bei mir und Dich und Deine Familie einmal getroffen und Deine Welt in den Gedichten bei mir bei mir – lege ich diese Worte aus der Nacht anbei. Ich kann sie ja nicht sprechen, darum schreibe ich seit Jahren Stummes auf… Lieber Gunnar, siehe, seit Jahren haben Sie mir die Minute zur Qual gemacht und dennoch, Bruder im Leiden, halte ich mich an die Mauer der Nacht gelehnt, weil Liebe und Freundschaft stärker sind!
So schreibt die deutsch-jüdische Dichterin Nelly Sachs im August 1962 an ihren Freund Gunnar Ekelöf. Einzig mit Ekelöf, von dem sie bereits um 1947/48 erste Gedichte übersetzt hatte, vermochte die im schwedischen Exil lebende Poetin in einem umfangreichen Briefwechsel ihr Weltgefühl einer existenziellen Verlorenheit auszutauschen. Ekelöf schenkte der von den Albträumen und Verfolgungsängsten heimgesuchten Dichterin bis zu seinem Lebensende nicht nur Zuspruch und Aufmerksamkeit, sondern lieh ihr auch eine Ikone, die sie „die Schützende“ und „die Schmerzensreiche“ nannte. Während der depressiven Schübe der Dichterin spendete die Ikone offenbar Trost und Linderung. Nach einer Weile wurde die Ikone gegen eine andere ausgetauscht, die nun als „Schwester“ bezeichnet wurde und die Nelly Sachs behalten durfte.
Die „Schmerzenreiche“, die „Panhagia“, repräsentiert eine Form des Weiblichen, die sehr ambivalent codiert ist. Sie ist ein erotischer wie auch religiöser Archetyp, eine Verlockung, zugleich aber in vielerlei Hinsicht eine Bedrohung. Die „Jungfrau aus Feuer und Nichts“ erscheint in den Texten Ekelöfs als eine Figur der Anbetung wie auch der Abgrenzung, Heilige und Dirne zugleich. Die Jungfrau – sie gibt sich aus Ekelöfs Perspektive „allen hin und niemandem“. Sie ist attraktiv und unberührbar zugleich.
Eine Aufzeichnung vom Dezember 1965, entstanden im Umfeld des Zyklus über den „Fürsten von Emgion“ markiert diese Ambivalenzen:
Ich beschreibe eine Jungfrau, die keine Mutter ist, weil sie keinen Sohn hat, die nicht Psyche ist, weil sie keinen Geliebten hat, die gut und gerne Dirne sein kann, weil sie sich allen und niemandem hingibt, die gut und gerne ein Wunschtraum sein kann, für den es keinen Namen gibt. Deshalb nenne ich sie namenlos. Ich betrachte also die Welt als von oben bis unten feminin. Es ist das eiertragende, gebärende Weibchen, angefangen von den Steinäxten bis zu den Atombomben. Wir, in dem Maß, indem wir befruchtend wirken, werden aus diesem sonderbaren Geschehen ausgestoßen. Sie aber behält ihre runde, heilig geometrische Form. Sie ist keine Beatrice und Dante habe ich beinahe zu hassen begonnen.
Es ist im Grund eine rätselhafte Aufzeichnung, die von Ekelöfs negativer Fixierung auf ein unberechenbar feminines Prinzip spricht. Der anbetungswillige Mann wird von der Jungfrau abgestoßen, sie selbst behält unanfechtbar das Heilige. Die „Panhagia“, die „Allheilige“, die „heilige Jungfrau“ ist ursprünglich ein Topos uralter vorderasiatischer Jungfrauenverehrung, der mit einem weiblichen Bild des Göttlichen verbunden ist. Für Ekelöf ist in seinem „Fürsten“-Zyklus und in seinem „Führer in die Unterwelt“ die Jungfrau meist ein Objekt der Verehrung.
In seinem fast unheimlichen Gedicht „Die Hypnagoge“ vermischen sich erotische und mystische Zeichen fast bis zur Ununterscheidbarkeit. Die „Hypnagoge“ meint ein Traumgesicht, hier das von der quasi-erotischen Eroberung der „wunderwirkenden Madonna“. Das lyrische Subjekt kriecht der Madonnengestalt unter den Rock – und dort, wo kein Sterblicher Zutritt hat, erscheint dem Träumenden das Innere der Madonna als „Schatzhaus“, funkelnd in den leuchtendsten Farben. Es ist eine seltsame Form der träumenden Kolonisierung des Heiligen.
DIE HYPNAGOGE
Im Wald du weißt es steht die wunderwirkende Madonna
Man stößt mit dem Fuß an den Sockel,
irregegangen zwischen den Bäumen
Sie gleicht deiner kleinen bronzenen Glocke, von der Form
eines kleinen Mädchens, mit aufgestelltem Kragen
Unüberschaubar und dunkel ist sie, aus schwärzlichem Silber
Kriechst unter den Rockschoß du, erblickst du das Innere
wie des Atreus Schatzkammer gewölbt, diese gewaltige Glocke
und wo kein Klöppel schwingt oben hängt jetzt das Nichts:
Fragst nach dem Sohn du, wisse, viele gibt es, X, Y, Z
Vielleicht findest du eine Tür in den Falten des Untergewands
und ertastest den Weg dir, seltsam Stiegen empor
die in ungewissen Windungen gehen, wie am Turm von Pisa
Schon das Gehen erzeugt Schwindel. Ungleich der Anstieg
Aspiral die Gravitation, und das Gleichgewicht, das
angeboren dir schien, tritt außer Kraft, dass du strauchelst
Oberhalb des Gewölbes die Taille, du siehst es am Gürtel
von innen, am farbigen Schimmer, gelb, violett, blutrot,
Bestückt mit Tafelsteinen, Rosensteinen, Granaten
Aquamarinen, Chrysolithen, Amethysten
Jeder Stein eine Kammer, dreiwinklig nach innen,
mit Diwanen zu beiden Seiten, die Hypotenuse das Fenster
oder rechteckig, mit drei Diwanen und einem Tisch in der Mitte
Man kann von Gemach zu Gemach gehen oder sich ausruhn lange
je nach Stimmung und Farbe. Alle Gemächer kann man durchschreiten
Nie kehrt man zurück, verändert hat sich der Blick
Höher stieg ich hinauf – konnte das Herz nicht sehn
schimmern aber den Brustschmuck gleich einer Fensterrose
auf ihrer Brust. Höher stieg ich hinauf, das eine, einzige Mal:
In ihr Haupt. Dort war es leer. Das Schweben schwerelos.
(Übersetzung: Klaus-Jürgen Liedtke)
In seinem Diwan, der Liedersammlung eines fiktiven kurdischen Grenzfürsten aus dem 11. Jahrhundert, entfaltet Ekelöf aber auch ganz innige, vorbehaltlos fromme Anrufungen der Madonna. Die Verbindung von Begehren und Destruktion erreicht ihre größte mystische Intensität in jenem Gedicht des Diwan, das auf die Begegnung mit der verdunkelten Ikone in der sogenannten Blachernenkapelle zurückgeht, die im Blachernenviertel von Istanbul liegt. Die Blachernenmadonna, so steht es in den Erläuterungen des Diwan-Zyklus, gilt als die berühmteste aller wundertätigen Ikonen.
„Hagiasma“ ist Ekelöfs Gedicht überschrieben. Das meint die Reinigungsquelle in der Blachernenkapelle. In Ekelöfs Gedicht verweist die Vokabel „zerküßt“ auf den Vorgang der allmählichen Auslöschung des Ikonen-Motivs. Alles Sichtbare auf der Ikone ist im Lauf der Zeit durch die Berührung der Lippen abgetragen worden – und wird in der lyrischen Anrufung emphatisch wiederholt. Poesie und Ikonen-Anbetung sind hier identisch.
DAS SCHWARZE BILD
Das schwarze Bild
unter Silber zerküßt
Das schwarze Bild
unter Silber zerküßt
Unter dem Silber
das schwarze Bild zerküßt
Unter dem Silber
das schwarze Bild zerküßt
Rund um das Bild
das weiße Silber zerküßt
Rund um das Bild
das Metall selbst zerküßt
Unterm Metall
das schwarze Bild zerküßt
Dunkel, o Dunkel
zerküßt
Dunkel in unseren Augen
zerküßt
Alles was wir nicht wünschten
geküßt und zerküßt
Alles, dem wir entronnen
zerküßt
Alles was wir wünschen
wieder und wieder geküßt
(Übersetzung: Klaus Jürgen Liedtke)
Michael Braun, Park, Heft 67, Dezember 2014
Fakten und Vermutungen zum Herausgeber + Archiv + KLG + IMDb +
Interviews + Georg-Büchner-Preis
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Brigitte Friedrich Autorenfotos +
deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Hans Magnus Enzensberger – Trailer zu Ich bin keiner von uns – Filme, Porträts, Interviews.
Hans Magnus Enzensberger – Der diskrete Charme des Hans Magnus Enzensberger. Dokumentarfilm aus dem Jahre 1999.
Hans Magnus Enzensberger liest auf dem IX. International Poetry Festival von Medellín 1999.
Fakten und Vermutungen zum Autor + IMDb + Internet Archive +
Kalliope
TV-Porträt über Gunnar Ekelöf Eine Welt, jeder Mensch…


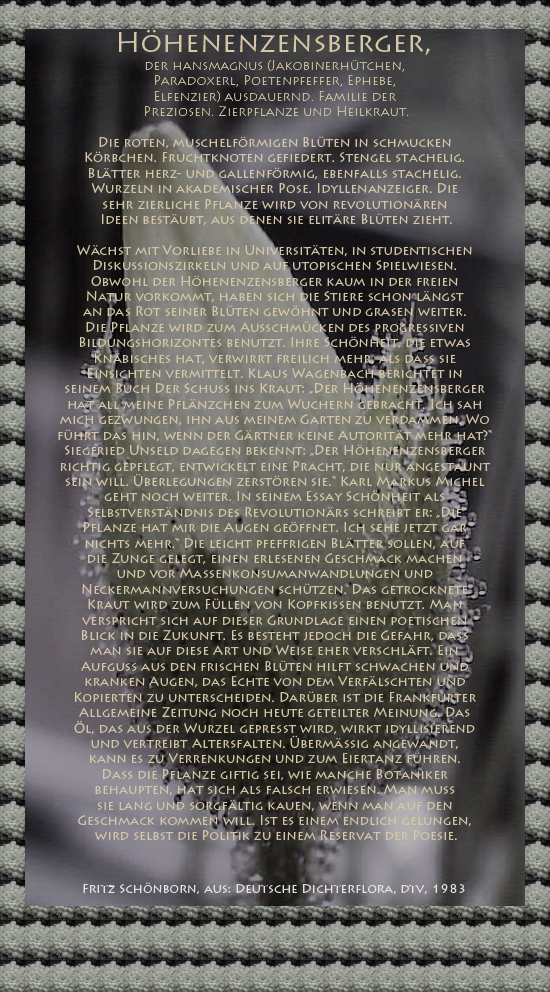
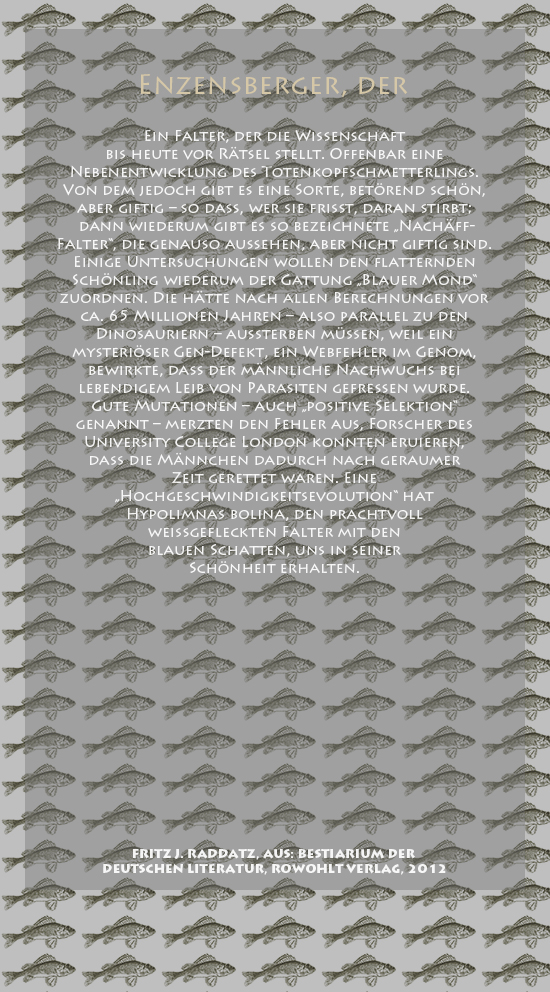












Schreibe einen Kommentar