Günter Kunert: Offener Ausgang
ASTRONOMIE
Wolkenhüllen sind zur Nacht
am Himmel aufgerissen, damit uns
jene Sterne sehen, auf die wir es
abgesehen seit dem ersten Blick.
Wer sich seit ungezählten Zeiten
endlich frei gedacht
vom Einfluß der Gestirne,
ahnt, daß da draußen
die grenzenlose Endlichkeit
ihm widerfährt
als strahlend Ungewisses:
es öffnet sich der Raum
und was hineingetragen wird in ihn,
es fällt auf uns zurück:
das ist ein Zwielicht,
altbekannt und irdisch.
Günter Kunerts Gedichte
lehren Sinnenfreude und Freude am Nachsinnen. Sie zeigen, daß poetische Paradoxie nicht paradox ist und schwarze Farbe zu sehen keine Schwarzseherei: sie suchen Hintergründe – in der Prinsengracht, Amsterdam, zum Beispiel oder in Rovinj, Istrien, in der Oxford Street oder in Kansas City. Das Gemälde der Alexanderschlacht wird beschrieben und die Photographie Lenins mit einer Katze – aber nicht nur beschrieben, denn Anschauung verwandelt sich in Deutung, optische Eindrücke und historische Vorgänge verdichten sich zu Gleichnissen. So wird erkennbar, daß Gartenpflege etwas mit Hexerei texanischer Herkunft zu tun hat und Fragmentarisches mit einem offenen Ausgang, frei für Zukünftiges und Zukunftsträchtiges. Kunerts Lyrik, die Fragen stellt, wird sinnfällig, weil sprachliche Virtuosität sich umsetzt in klare poetische Bilder.
Aufbau Verlag, Klappentext, 1975
Beiträge zu diesem Buch:
Rulo Melchert: Nach dem Maß der Notwendigkeit
Junge Welt, 1.12.1972
Klaus Krippendorf: Eine Poesie wie mit dem Stichel
Neues Deutschland, 13.12.1972
Jürgen Engler: Zeitgenössisches im Widerspruch
Ich schreibe, 1973
Karl Corino: Poesie mit (Marx-)Bart, Anpassung und Reserve
Deutsche Zeitung, 16.2.1973
Wolfgang Trampe: Günter Kunert, Offener Ausgang
Sonntag, 11.3.1973
Armin Zeißler: Wege unserer Lyrik
Neue Deutsche Literatur, Heft 6, 1973
Gerhard Rothbauer: Catull und Mulka
Neue Deutsche Literatur, Heft 6, 1973
Dieter Schlenstedt: Kraft gespannten Wesens. Zu Günter Kunerts Offenem Ausgang und seiner Poetik
Sinn und Form, Heft 6, 1974
Günter Kunert
Es ist der 4. Juli 1972. Berlin-Buch, unmittelbar hinter dem Klinikum gelegen das vorerst provisorische Anwesen: Ein Haus von pittoresken Proportionen, erinnernd an überdimensionierte Bahnwärterhäuschen, derzeit von den Kunerts bewohnt im Souterrain, an Expansion nach oben gehindert vom Begehren alteingesessener Bewohner, einer Komfortwohnung im Tausche teilhaftig zu werden. Der Lyriker, Epiker, Librettist, Hörspielautor, Filmeschreiber und Feuilletonist erscheint nach dem Klingelzeichen demzufolge von unten, führt den Besucher durch die Behelfsküche (in welcher Frau Marianne züchtig waltet) ins Zimmer: Augenfällig ein Sofa von rotem Plüsch, flankiert durch Tisch und Sessel, gülden gerahmt darüber der fotografierte Dichter mit einem fotografierten Beil über dem Scheitel der fotografierten Gattin, der Spruch darum verkündet: „Das Andenken der Gerechten / Bleibt im Seegen“. Ansonsten: Bücher, eigenverfertigte Malerei, Werbeplakate, die Siamkatze namens Yogibär, selbst geschnitzte Masken, ein Kupferkessel mit Holzkloben. Kunert (Jahrgang 29, Berliner durch Geburt, wehrunwürdig befunden in brauner Zeit, nach 45 Studium der bildenden Kunst, nunmehr Dichter mit Oberlippenbärtchen und lichtem Haupthaar) ist von höflicher Herzlichkeit. Während des Gesprächs bekritzelt er intensiv Papier und sagt, weil er denkt, offensichtlich, was er denkt.
Joachim Walther: Günter Kunert, Sie haben den Satz geschrieben: „Meine Erfahrungen, ich gestehe es ein, machen mich zum Realisten.“ Wenn ein literarisches Ich Realität erlebt, muß daraus nicht zwangsläufig Realismus entstehen. Könnten Sie das, was Sie unter Erfahrungen verstehen, etwas präzisieren?
Günter Kunert: Sie sagen, daß aus der Konfrontation mit Realität nicht unbedingt Realismus entsteht. Da beginnt schon das Problem, weil wir beide sicherlich unterschiedliche Auffassungen haben, was Realismus ist. Ich glaube eigentlich schon, daß stark beeindruckende Realitätserfahrungen zu einem Realismus führen. Das hängt von der Stärke der Erfahrungen ab…
Walther: Entschuldigen Sie, ich glaube, ich muß mich etwas verdeutlichen. Beispielsweise die Romantik: Diese Dichter fanden eine Realität vor, in der die heroischen Illusionen der Klassik als gescheitert betrachtet werden konnten, sie sahen keine reale Eingriffsmöglichkeit in gesellschaftliche Verfestigungen mehr, sie entwickelten die romantische Weltsicht.
Kunert: Ich halte auch die Romantik nicht für absolut unrealistisch. Da kommen wir jetzt auf den Punkt, nämlich: Was ist Realismus? Ich finde, daß in einem sehr großen Teil der Literatur der Romantik sehr viel Realität vorhanden ist, sie ist eben nur auf indirekte Weise da, sie tritt nicht äußerlich in Erscheinung. Sie ist insofern vorhanden, als sie Aufschluß gibt über die Befindlichkeit der Autoren und deren gesellschaftliche Situation. Ich habe mich eine Zeitlang eingehend mit Lenau befaßt, der als einer der letzten großen Romantiker gilt. Mit Romantik verbindet man den Begriff des etwas Nebulösen, des Realitätsfernen. Bei Lenau findet man vieles, was man bei anderen Realisten wiederfindet, nämlich ein dauerndes Empfinden des Bedrängtseins, auch des Verfolgtseins: diese Todessehnsucht bei Lenau, dieses ständige Um-den-Tod-Kreisen ist eine deutliche Fluchtbewegung, nicht nur eine Flucht aus der Wirklichkeit, sondern eine Flucht vor ganz konkreten Umständen und auch konkreten Personen. Und wenn man sieht, wie Lenau gelebt hat, unter welchen Schwierigkeiten, dann werden die Aufschlüsse in seiner Dichtung noch klarer. Wenn man die Psychogenese zu verfolgen sucht, dann stößt man sofort auf die Misere der Zeit und der Gesellschaft.
Walther: Müßte nach Ihrer Interpretation nicht auch das Märchen zum Realismus gehören, da doch auch hier Realität mittelbar spürbar ist: Sehnsüchte, die in der Realität nicht verwirklicht werden konnten. Es kann also auch hier von Gewünschtem auf nicht Vorhandenes rückgeschlossen werden.
Kunert: Ja, der Prüfstein ist immer der Verweis auf die Realität. Und es gibt eine realistische Literatur, die mit Realität wenig zu tun hat. Zum Beispiel halte ich Hemingway in großen Teilen für einen unrealistischen Schriftsteller, der eigentlich nur mit Dingen aus der Realität arbeitet, aber in der Grundhaltung, in der Grundtendenz absolut unrealistisch, ja im Grunde ganz romantisch ist. Das, was man den Romantikern vorwirft, wird dort produziert, nämlich eine merkwürdig verblasene Haltung zur Welt. Das finde ich in diesem ganz drastischen Realismus, der eben in vielem unglaubwürdig ist. Ich erinnere nur an „Durch den Fluß und in die Wälder“: Dieses Sterben des Generals, der noch einmal mit der Gondel durch Venedig fährt, herzkrank, der dann im Auto stirbt, dieser schöne Tod, dieses schöne Sterben. Das ist für mich ein ganz unglaubwürdiges und unrealistisches, romantisierendes Buch, das Hemingway vielleicht geschrieben hat, um sich aus einer sehr privaten Situation zu lösen oder zu erlösen. – Also, ich habe meinen Realismusbegriff noch nicht präzisiert, das wäre ja eine riesige Arbeit. Ich habe das Thema in manchen Äußerungen über das Schreiben lediglich berührt. Aber ich finde, daß für mich der Realismus in der Literatur oder eines Buches oder eines Stils oder einer Epoche – wie auch immer – eine ganz in die Sache integrierte Angelegenheit ist, die nicht äußerlich sichtbar sein muß.
Walther: Aus Ihrem eingangs von mir zitierten Satz geht hervor, daß Sie nicht auf Grund von literarischen Traditionen Realist sind, sondern auf Grund Ihrer Erfahrungen. Welche Erfahrungen waren das?
Kunert: Die Kindheit ist eine Zeit, in der man in einer anderen Realität lebt als in der, in der man real existiert. Ich aber bin in meiner Kindheit immer auf die richtige Realität verwiesen worden. Das ist meine persönliche Geschichte gewesen. Da hat sich dann auch mein – ja, soll man es Trauma nennen – entwickelt. Alles Schreiben hat sich eigentlich von Anfang an niemals als subjektiver Ausdruck erwiesen. Der Impuls zum Schreiben ist ja immer ein subjektiver, da ich mich aber stets als gesellschaftliches und als eine Art objektives Wesen empfunden habe, hat dieser subjektive Impuls im Ergebnis nichts Subjektives gezeitigt. – Es ist die Frage, die überall in der Welt gestellt wird, insbesondere von Germanisten: für wen man schreibt. Das ist eine Frage, die ich nie begreifen werde. Weil ich keine Scheidung zwischen Subjektivem, Privatem und Äußerem sehe, ich empfinde mich nicht als getrennt von der Umwelt, von der Gesellschaft, von der Erde, von all dem.
Walther: In einem Gedicht geben Sie Ihre Abneigung gegen Leute kund, die ihre Innerlichkeit zum Angelpunkt der Welt machen.
Kunert: Ja, darum mag ich auch Thomas Mann nicht. Das ist für mich kein Realismus, das ist für mich eine höhere Art des Märchenerzählens, aber des Märchens, wie Märchen eigentlich nicht sein sollten. Das ist die Art des Realismus, die verwerflich ist, die auf einer hohen künstlerischen Ebene eben nur vortäuscht und von der Welt ganz entfernt ist. Während im Gegensatz Kafka, bei dem sehr wenig konkret erscheint, ein unglaublicher Realist ist.
Walther: Mich reizt es, jetzt eine Frage zu stellen, auf die es möglicherweise keine Antwort gibt: Wenn man die stilistischen Eigenarten Ihrer Prosa und Lyrik betrachtet, fallen unter anderem Verknappung, reflektierender Intellekt, Paradoxien, Rhythmysierung gebräuchlicher Syntax auf. Es ist ein Stil, der im Gegensatz zum mittelhochdeutschen Poesieideal steht, die rede ze blüemen. Wo entsteht eigentlich in Ihren Texten das Poetische?
Kunert: Es ist natürlich schwer zu sagen: Was ist das Lyrische in einem Gedicht, was ist das Lyrische außerhalb der Sprache oder des Einfalls oder der Form, also außerhalb des Ästhetischen, was ist das? Ja, was ist es denn? Ich glaube, das ist ziemlich schwierig zu definieren. Man bringt eine ganze Masse von Unbewußtem ein, was bei aller Verstandesarbeit dann die Sache trägt. Man kann ein Gedicht kalkulieren, und es gibt Lyriker, die das gemacht haben und auch machen, man kann es ausrechnen, aber es entsteht dadurch noch lange kein Gedicht. Es kommt etwas hinzu. Was da hinzukommt – ich habe einmal versucht (man wird sich über die Dinge eigentlich nur klar, wenn man darüber schreibt), darüber zu schreiben, was ein Gedicht ist, und habe es genannt: Das Bewußtsein des Gedichts. Da habe ich versucht, eine Abgrenzung zu finden, und ich bin währenddessen darauf gestoßen, daß alle Lyriker (oder die meisten) Poetiken geschrieben haben. Es gibt eine Zusammenstellung von Rimbaud bis Becher, die Höllerer gemacht hat, etwa sechzig. Wenn man diese sechzig Poetiken liest, dann stellt man fest, daß keine stimmt und alle stimmen, das heißt jede weicht von der anderen ab, es gibt überhaupt keine Allgemeinverbindlichkeit, es gibt keine Theorie der Lyrik. Jeder Lyriker hat seine Hypothese, seine Theorie, seine Ansicht. Aber allen ist gemein, daß diese Theorien absolut divergieren vom Werk. Das heißt also, daß das Gedicht einen anderen Bewußtseinszustand, eine andere Bewußtseinslage benötigt und gleichzeitig erzeugt als jegliche andere geistige Produktion. Es scheint eine andere Art des Bewußtseins zu sein, die das Gedicht macht. Und dieses Bewußtsein ist nur ganz mittelbar beeinflußbar durch Theorie. Es ist ein stark autonomer Bewußtseinszustand, und jeder Eingriff, jede Verkennung dieses spezifischen Zustandes zerstört ihn, weil dieses Bewußtsein aus einer psychischen Basis wächst. Wo dieser merkwürdige Bewußtseinszustand nicht erscheint, erscheint auch kein Gedicht. Es gibt ja Dinge, die aussehen wie ein Gedicht und doch keins sind. Übrigens hat man diesen Zustand als schönen Irrsinn bezeichnet. Es ist was Wahres dran, es ist ein Zustand, der nicht hundertprozentig rational auflösbar ist. Dieser Zustand ist nicht aufhellbar und gleichzeitig anwendbar. Indem man ihn aufdeckt, zerstört man ihn.
Walther: Gibt es eine Kunertsche Poetik? Gibt es so etwas wie eine ungeschriebene Liste stilistischer Mittel und Möglichkeiten, die Sie bevorzugt anwenden?
Kunert: Ja, gefallen ist schon das Wort Paradoxie. Das halte ich für ein Grundprinzip von Lyrik, weil das die Spannung erzeugt, aus der ein Gedicht lebt. Das Gedicht ist vom Umfang eine ganz kleine Angelegenheit und benötigt wie alle Literatur ein Spannungsmoment. Das Paradoxische und Widersprüchliche und Gegensätzliche und Antinomistische – das ist eigentlich in allen Gedichten anwesend, entweder in der Sprache oder in der Idee. Das Paradoxische ist das Dialektische, weil es auch in der Realität lebt. Nichts in der Realität ist ja eindeutig, sondern immer mehrdeutig, widersprüchlich, in sich paradox. Für mich ist ein Gedicht schon realistisch, wenn es dialektisch ist, wenn die Paradoxie die Widersprüchlichkeit spiegelt. Es gibt sehr viele schlechte Gedichte, die sich sehr realistisch geben oder realistisch genannt werden, die aber von dieser Dialektik nichts enthalten. Insofern kann ein Gedicht über Goldfische oder Blumen oder abgeschnittene Fingernägel ganz realistisch sein. Der Realismus ist implizit – und nicht draußen dran.
Walther: Gilt das auch für Ihre Prosa? Durch präzises Beschreiben vorgefundener Wirklichkeit in konkreten Details entsteht ja auch nicht automatisch Poesie. Denken wir an die meisten Produkte der sogenannten konkreten Poesie, die im Detail äußerst genau ist, aber in der Montage und Addition dieser Details lediglich einen Materialreiz hat: Sprache bleibt Material.
Kunert: Ich beschreibe nicht nur, ich interpretiere auch gleichzeitig Wirklichkeit. Ich habe versucht zu deuten, zu erkennen und damit dem Leser etwas zu erkennen zu geben. Es macht nicht die präzise Beschreibung. Das Poetische ist vielleicht etwas Atmosphärisches oder eine Stimmung, das, was als menschliche Befindlichkeit ungesagt über das Beschriebene hinausquillt. Einer dieser grandiosen Beschreiber ist Walter Benjamin. Es gibt von ihm die Beschreibung eines Korridors, und es ist mehr als die Beschreibung dieses Korridors, es ist die Bedeutung des Korridors und die Deutung dieses Korridors in einer existentiellen, ja ontologischen Sicht. Dieser Korridor wird etwas Kulturhistorisches, Gesellschaftliches und gibt Auskunft über die Befindlichkeit der Menschen, die solche Korridore benutzen. Das breitet sich wie eine zweite Schicht über der Beschreibung aus. Darf ich dazu noch etwas sagen, weil mich das in letzter Zeit auch beschäftigt? Das Paradoxe: in der Realität war es ja immer da, es ist nur so spät wiederentdeckt worden, wir haben es erst über den Marxismus wiedergewonnen, es ist aber noch nicht vollständig in das Denken der Menschen zurückgekehrt… Heine hatte eine Theorie vom Sensualismus und Spiritismus, er meinte, die Welt sei zerfallen seit der Antike mit dem Aufkommen des Christentums in diese beiden Richtungen, auf der einen Seite also das geistige Kahle, Kalte, Christliche, Lebensverneinend-Asketische, auf der anderen Seite das Vitale, Lebendige, Sinnliche, Revolutionäre. Und natürlich ist was dran, es stimmt schon: Mit dem Christentum wird alles Dialektische, das schon in das Bewußtsein der Menschen gedrungen ist, wieder zerteilt, was sich dann in den Bildern von Gott und Satan, Himmel und Hölle widerspiegelt, diese absolute Teilung: Es ist nichts mehr Gut und Böse, sondern alles ist Gut oder Böse. Wohin es gehen muß, ist die Erkenntnis, daß alles zugleich Gut und Böse ist. Im Grunde leiden wir noch heute daran. Darin liegen die Schwierigkeiten vieler Menschen, daß sie zwar diese Dialektik einsehen, daß sie die aber nicht in sich integrieren können, sie erkennen sie und sehen sie und erkennen sie auch in großen gesellschaftlichen Prozessen, sind aber nicht in der Lage, sie für sich, für ihr alltägliches Leben, für alles das, was sie betrifft, auch anzuwenden. Sie denken immer noch alternativ: hü oder hott, schwarz oder weiß. Das aber geht nicht. Diese Dialektik suche ich im Paradoxen sichtbar zu machen. Es ist auch für mich eine Art innerer Beweger, dieses alltäglich Dialektische.
Walther: Selbst im Faust besteht noch diese figurale Trennung in Faustisches und Mephistophelisches. Eigentlich müßte es aber dahingehen, den Dualismus dieser beiden Prinzipien in einer Figur zu subsummieren.
Kunert: Das wieder zusammenzuführen, denn es ist ja zusammen, ganz genau das.
Walther: Hat sich bei Ihnen Stil entwickelt, oder war er von Anfang an da? Ist das also eine plötzliche Ausstülpung von Individualität oder ist das ein Prozeß?
Kunert: Es ist nichts, was da ist, das ist klar. Es ist etwas, was man sich erschreibt. Man versucht beim Schreiben, formal dem adäquat zu sein, was man sagen will. Es ist eine irrige Ansicht, wenn man sagt: Na, der versucht einen Stil zu finden oder zu erfinden. Man kann keinen Stil finden und erfinden, glaube ich. Es gibt Leute, bei denen er sprunghaft entsteht, Beispiel Heine, da gibt es wenige frühe Gedichte, die ganz in der romantischen Tradition stehen, wo das Heinesche noch gar nicht da ist, aber dann sofort, der Siebzehnjährige hat schon den typisch Heineschen Ton. Und es gibt Leute, bei denen er sehr langsam entsteht.
Walther: Sie kommen auch von der Satire. Und Satire bedeutet Analyse, Angriff zwecks Verbesserung kritikwürdiger Zustände oder Verhaltensweisen, vor allem Arbeit mit der Sprache. Gibt es so etwas wie eine ursächliche Beziehung von Satirischem und Epischem?
Kunert: Ich habe eigentlich mit Gedichten angefangen, die mehr oder weniger ironisch oder satirisch waren, aber das ist eigentlich nicht das, was man als Satire bezeichnet. Das hängt damit zusammen, daß ich damals fast alle Klassiker der Satire gelesen habe, in einer Situation die „nach Satire schrie“. Ich empfinde mich aber nicht als Satiriker.
Walther: Anders gefragt: Ist die Epik eine Sublimationsform der Satire? Denn es gibt viele hervorragende Epiker, die in frühen Jahren eine ausgesprochen satirische Ader hatten. Später dann wird die Kritik globaler, auch gerechter, sublimer. Offenbar ist dazu ein besonderes Sensorium nötig. Ist es, wenn nicht gesetzmäßig, dann auf jeden Fall fruchtbar, wenn der Epik Satire vorausgeht?
Kunert: Das kann sein, es muß nicht so sein. Es kann auf drei, fünf, zehn zutreffen, man kann das aber, glaube ich, nicht generalisieren. Aber sicher ist, daß Leute, die ein gewisses Maß an Ironie oder dunklem Humor haben, vieles kritischer sehen, und kritische Sicht ist ja immer die schärfere. Das kann schon so sein, wie Sie glauben. Man findet auch in der Literatur immer die Figuren am besten, am exaktesten, am genauesten gezeichnet, die mit Ironie, Witz, Satire, Bissigkeit gezeichnet. sind, die ernsten und tiefen Figuren sind meist farbloser.
Walther: Hängt das nicht auch mit dem Wunsch der Dichtung zusammen, daß sie Realität verbessern will?
Kunert: Nein, ich glaube nicht. Kein Mensch ist sich über die Wirkung von Literatur im klaren. Gäbe es eine Wirkungsforschung für Literatur, so wäre das im Grunde auch eine reduzierte, weil sie ja nur bestimmte Sachen erfragen wollte, und Sie wissen ja: Wie man in den Wald ruft, so schallt es heraus. Die ganze Wirkungsforschung ist eine zwielichtige Sache und wenig objektiv, weil sie zumeist ihre Ergebnisse schon präformiert. Zu welchem Zweck Literatur geschrieben wird? Literatur wird nicht zu einem Zweck geschrieben, das ist eine Illusion. Und Lyrik überhaupt nicht, das ist eine Lebensäußerung von Leuten – wie der Wal ein Blasloch auf der Nase hat und dadurch atmen muß, so hat der Lyriker ein Lyrikloch irgendwo, aus dem er Gedichte absondert. Das ist, finde ich, eine Art naturhafter Vorgang, der primär gar nicht auf irgend etwas zielt.
Walther: Primär sicher nicht. Ich verstehe Ihre Aversion gegen die Ansicht, daß Literatur zur Beförderung…
Kunert: … der Nachttopfproduktion…
Walther: … kurzfristiger ökonomischer Ziele dienen könne, aber sicher ist doch, daß es ein immanentes Anliegen des Dichters gibt, das sich auf die Realität, vorzüglich aber auf den Menschen bezieht.
Kunert: Auf den Menschen – das ist schon näher dran! Bei Lyrik ist es doch so: Lyrik – ich sage jetzt, was sie macht, nicht, was sie will – erweckt etwas im Leser, nämlich ein ganz bestimmtes Empfinden von sich selber. Mit diesem Empfinden ist ein Anstoß zur Selbsterkenntnis gegeben, zur Beschäftigung mit sich selber, zum Versuch dahinterzukommen, wer man eigentlich ist und wozu man da ist. Insofern haben Gedichte eine metaphysische Funktion, das ist das Merkwürdige und da liegt ihr Realismus, weil alle Menschen ein metaphysisches Bedürfnis haben, wie ich glaube. Sie sind in einer gottlosen Zeit natürlich ganz schlimm dran, weil sie die metaphysische Sicherheit verloren haben, wer sie sind, was mit ihnen geschieht und wozu sie existieren und was eigentlich der Endzweck dieser Existenz ist. Das wissen sie nicht mehr. Der Marxismus kann ihnen eigentlich immer nur materielle Zielvorstellungen vermitteln, nie metaphysische. Und alle Endziele sind eben die Heineschen Zuckererbsen, also ein erfülltes materielles Dasein. Nur: das materielle Dasein füllt merkwürdigerweise den Menschen überhaupt nicht aus, und er fragt sich, wenn seine Grundbedürfnisse gedeckt sind: Wozu das eigentlich? Ist das der ganze Sinn, nicht nur meiner Existenz? Was ist das eigentlich alles? Was soll das? Durch Gedichte entsteht in ihm, glaube ich, eine merkwürdige emotionale Verbindung, eine Art Kommunikation, nein: eine Art Kommunion, eine Verbindung mit seiner Außenwelt, mit seinem Universum, in dem er lebt. Und die Dichter, die natürlich auch nicht mehr wissen, was das alles soll, was wird und wozu alles da ist, denn sie sind ja wie die anderen Menschen auch in die Freiheit entlassen, vermitteln also nicht mehr (wie das die religiöse Dichtung konnte) das Ziel, sie vermitteln aber den Anstoß, daß da etwas Höheres sein könnte, was nichts Außerirdisches oder Religiöses oder Irrationales ist, nur, daß da eben etwas Höheres. ist als dieses materielle Hier und Jetzt. Wenn sich nun der Leser in seiner Glaubensfreiheit mit dem befaßt, was über seine materielle Existenz hinausgeht, dann kann er vielleicht zu der Einsicht gelangen, daß das größte und wesentlichste Ziel nichts anderes ist als er selber.
Walther: Also wirkt Poesie mittelbar doch auf Realität.
Kunert: Mittelbar schon. Wenn es dem Menschen gelingt, sich zu einem bestimmten Grade in der Realität zu erkennen, erkennt er natürlich auch, was die Realität aus ihm gemacht hat, wie sie ihn deformiert und verstümmelt hat. Das gibt natürlich auf eine mittelbare Weise den Impuls, die Realität zu verändern. Gedichte, die diesen Weg nicht gehen, sondern die direkt auf die Wirklichkeit zielen und die sagen: Du bist der und der und mußt das jetzt rasch verändern – diese Gedichte bleiben wirkungslos, weil der Prozeß im Leser übersprungen wird. Und das ist etwas, was nicht geht. Das ist der Grund für das Scheitern aller veräußerlichten Dichtung, die für eine kurze Zeit eine äußerliche Wirkung hatte, die aber auf die Dauer gar nichts machen kann, die den Menschen nicht verändert, daß er die Welt verändern kann. Das kann nur die Dichtung, die sich auf seine Psyche richtet. Nur die!
Walther: Wirkung entsteht also dadurch, daß die Wirklichkeit zweimal subjektiv gebrochen wird, erstens durch das Ich des Dichters und zweitens durch das des Rezipienten?
Kunert: Der Leser schreibt das Gedicht noch einmal, er vollzieht es noch einmal nach, und indem er es nachvollzieht, deutet er es aus. Das ist das Großartige der Lyrik, daß sie nicht eindeutig, sondern daß sie deutungsfähig ist, daß der Leser das starke Empfinden hat: Ja, so ist es, so habe ich es schon immer empfunden, nur konnt’ ich’s nie so ausdrücken, durch dieses Gedicht bin ich mir meiner eigenen unbewußten Erkenntnis bewußt geworden, es hat sich etwas ins Bewußtsein gehoben, was immer in mir war! Das ist das Großartige! Das kann geschehen durch Gedichte, durch Werke, die scheinbar gar nichts mit der Realität zu tun haben.
Walther: Der populäre Ausdruck von Wirkung ist ja der: Dieser Dichter hat genau gesagt, was ich fühle und denke, was ich aber nicht ausdrücken konnte. Es gibt Autoren, die diesen Effekt fast immer schaffen, beispielsweise ist Max Frisch so einer, es muß also gleichzeitig konkret und allgemein sein, um viele individuell anzurühren. Das wäre auch eines Gespräches wert, aber wir müssen noch ein paar andere Fragen bewegen, unter anderem die: Stehen Sie in der Tradition anderer Dichter? Ablesbar ist der Einfluß Brechts. Freundlichkeit, Erbarmen mit sich selbst, Lob der Dialektik und Didaktik spielen auch bei Ihnen eine Rolle.
Kunert: Ja und nein. Es sind schon Namen gefallen: Heine, Tucholsky, Sandburg, Masters, auch Whitman. Ich rede die ganze Zeit gegen die äußerlich wirksame Dichtung und komme merkwürdigerweise von da her, ich habe Rilke oder die Romantiker viel, viel später erst gelesen. Ich bin eigentlich mit politischer Dichtung, mit Weinert und all dem, aufgewachsen. Vielleicht erkenne ich es dadurch besser. Nun sind Freundlichkeit und Lob der Dialektik und auch die Didaktik keine Erfindung Brechts. Das Didaktische lag in der Zeit, das war die Zeit nach 45, das war die Zeit, in der es völlig legitim war, daß alles, was man schrieb, Aufrufcharakter hatte. Aufruf und Anruf und Aufforderungscharakter, das war die Aufbauzeit, in der man das Gefühl hatte, man müsse den Leuten etwas zurufen, ganz direkt, man müsse sie befeuern oder ermahnen. Da hat die Didaktik geblüht, nur ist sie bei uns überständig geworden, denn sie wurde fortgeführt, obwohl sie sich eigentlich überlebt hatte. Als ich meinen ersten Gedichtband schrieb, hatte ich schändlicherweise Brecht noch niemals gelesen. Später dann habe ich versucht, Lieder zu schreiben – was mir aber eigentlich nicht so sehr liegt, glaube ich. Das habe ich auch wieder abgebrochen. Mit acht oder neun Jahren habe ich Heine gelesen, mit siebzehn habe ich angefangen zu schreiben.
Walther: Gibt es Einflüsse in der Prosa?
Kunert: Ich habe viel gelesen, was mich überhaupt nicht beeinflußt, aber frappiert hat. Ich habe beispielsweise den ganzen Jack London gelesen, über vierzig Bände. Was mich beeindruckt, das ist mehr die reflektierende Prosa: Kafka, und auch der merkwürdige Jean Paul mit der sich selber erzählenden Erzählweise, auch die reflektierende, essayistische, philosophische Prosa von Benjamin bis Améry, die finde ich nun doch sehr bedeutend.
Walther: Wonach beurteilen Sie die Qualität von Literatur?
Kunert: Nach dem inneren Bezug zur Wirklichkeit. Das macht die Wahrheit eines Werkes aus. Das ist der Echtheitsstempel.
Walther: Könnte man vielleicht auch so sagen: Daß Literatur dort ist, wo ein eigener Ton vorherrscht, den man nirgends in der Syntax orten kann?
Kunert: Nein, das würde ich nicht sagen: Auch Journalisten können etwas zwischen den Zeilen vermitteln. Es ist auch nicht der besondere Ton. Nehmen wir mal Kafka: Das ist eine Schreibweise, in der sich viele offizielle Schreibweisen, auch ethnische Dinge, auch Dialektdinge mischen, das ist eine wenig persönliche Schreibweise, das ist eigentlich ein Sammelsurium, das verschmilzt…
Walther: Ja, aber das heißt doch, daß man es nicht mehr analysieren kann. Wenn man das analysieren könnte, dann müßte es einem pfiffigen Geist gelingen, wie Kafka zu schreiben. Das aber ist offensichtlich nicht möglich.
Kunert: Natürlich nicht, weil er nicht in Kafkas Bewußtseinslage ist. Ihm fehlt die Erfahrung Kafkas. Und er hat nicht diese außerordentliche Fähigkeit des Sich-bewußt-Werdens dieser Erfahrung. Er hat einen anderen Typ von Bewußtsein: Er ist fähig, das zu analysieren. Mit der Fähigkeit zur Analyse kann er aber nicht mehr schreiben. Es gibt ja die berühmte Heisenbergsche Unschärferelation, die sagt, daß Masse und Geschwindigkeit eines Elementarteilchen mit unserem Instrumentarium niemals zugleich bestimmt werden können. Ein bißchen kann man daran denken, wenn man über Literatur spricht. Der Untersuchende, dem dieses Instrumentarium zur Verfügung steht, ist nicht in der Lage, in sich so zu sein, daß er das auch schreiben kann. Woran erkennt man Kunst? Es gibt nie nur ein Motiv. Wie es beim Schriftsteller nie nur ein Schreibmotiv gibt, kann man nicht sagen: Dieser Mann hat den Krieg erlebt, und nun schreibt er gegen den Krieg, der Mann ist auf den Kopf geschlagen worden und schreibt nun dagegen, daß die Leute auf den Kopf geschlagen werden. Das gehört eben auch zu diesem dualistischen Denken, daß man immer reduziert auf eins. So spaltet sich auch der Maßstab in viele Meßwerte auf: Es ist der direkte Realitätsbezug, der unverstellte Wahrheitsbezug. Und der kann nur da sein auf Grund einer ästhetischen Form, denn er ist nur so zu vermitteln, nur so wird er überhaupt wirksam, sonst fällt er wie ein taubes Blatt zu Boden. Grob gesagt, sind es die beiden Dinge: Inwieweit der indirekte Realitätsbezug ästhetisch gelungen ist, also: Wie erscheint Realität mittelbar in einer Kunstform? Unmittelbar kann sie nicht erscheinen, weil unsere Realität nicht mehr einheitlich und geschlossen ist, wie sie es eben zur Zeit der geschlossenen Weltbilder war. Wirklichkeit kann nicht mehr erscheinen. Nur der Bezug zur Wirklichkeit kann erscheinen. In Christa Wolfs Nachdenken über Christa T. ist ja das Thema nicht die Wirklichkeit, sondern der Bezug zur Wirklichkeit, und damit ist die Wirklichkeit da. Jedes Buch, das heute versucht, die Wirklichkeit darzustellen, wäre von vornherein eine Lüge. Die Wirklichkeit ist in ihrer ungeheuren Aufsplitterung, Vielfalt und Interpretationsmöglichkeit gar nicht mehr darstellbar. Wenn ich aber viele Bezüge zur Wirklichkeit herstellen kann, dann vermittelt sich mir auch indirekt ein Bild von der Wirklichkeit. Der Bezug ist dann repräsentativ für eine Epoche. Mit zunehmender Mobilität der Menschen, mit der wachsenden Entwurzelung (denn das Leben der Menschen vor 200 Jahren war ja viel statischer, vegetativer) wird die Wirklichkeit verlassen, wird die Wirklichkeit als Konstante fragwürdig. Früher war die Wirklichkeit nicht in Frage gestellt. Da war der Einzelne, der schnell Vorübergehende, feststehend war die Gesellschaft mit ihrem weltanschaulichen Überbau. Das alles ist unsicher, sicher sind nur noch die Bezüge.
Walther: Wie eigentlich kommt Ihnen die Idee zu einer Arbeit?
Kunert: Das ist sehr unterschiedlich, es kommt darauf an, was man macht. Manche Dinge schreibt man konkret in einem Auftrag, jetzt mache ich beispielsweise ein Heine-Hörspiel. Dazu brauche ich einen Einfall, das ist ein formales Problem. Man sucht Lösungsmöglichkeiten und sucht die beste heraus. Wenn man Glück hat, dann findet man im Material schon Anregung dazu und nimmt sich daraus etwas. Bei Gedichten ist es ganz anders: Es ist manchmal nur ein Wort oder ein halber Satz, das schleppt man so mit, und aus diesem Wort oder halben Satz entwickelt sich dann das Gedicht. Man entwickelt es also von der Sprache her, und das, was man sagen will, kommt dann einfach hinzu. Oder man hat eben eine ungefähre Vorstellung und findet dann dazu eine sprachliche Form.
Walther: Jakobs sagte in einem Werkstatt-Gespräch, daß er am Tage 10.000 Einfälle habe, wesentlich seien nur die, die wiederkämen.
Kunert: Bei mir ist es anders. Ich weiß es gleich, daß dieses Wort etwas ist. Wenn ich es mir nicht sofort aufschreibe, ist es weg und kommt niemals wieder. Leider, denn auf die Art verliert man eine ganze Menge. Wenn man im Bett liegt, läuft ja das Gehirn weiter, wenn man dann eine Idee hat und steht nicht sofort auf, weil man schon zu müde ist, zu faul, nochmals Licht zu machen, und sich sagt: Ach, das schreibst du morgen früh auf – dann kommt das niemals wieder, und man ärgert sich, weil man sich sagt: Das war etwas Wichtiges. Vielleicht war’s gar nicht wichtig, aber man ärgert sich doch, weil es weg ist auf Nimmerwiedersehen.
Walther: Wenn Sie eine größere Prosa-Arbeit vorhaben, machen Sie dann Vorarbeiten, also Materialsammlungen, Kapiteleinteilungen und dergleichen?
Kunert: Nein. Nur bei meinem Roman Im Namen der Hüte habe ich mir einen Aufriß gemacht, von dem ich aber dann sehr stark abgewichen bin. Wenn ich eine Geschichte schreibe habe ich eine Vorstellung, wie das in etwa sein müßte, und mach mir drei oder vier Stichworte. Das ist das Schöne am Prosaschreiben: Es verändert sich, es verlebendigt sich, es verselbständigt sich. Durch dieses Abweichen von der Idee bekommt die Sache auch das Unmittelbare und Lebendige. Meine Geschichten sind meist direkt der Realität entnommen. Die Legende eines Schals ist entstanden, weil ich mich an jemand erinnerte, der 45 aus dem KZ kam mit einem riesigen amerikanischen Schal um den Hals und einer Wunde darunter und auf dem Wege von Auschwitz nach Argentinien hier Station machte.
Walther: Ist Schreiben für Sie eine lustvolle Verrichtung?
Kunert: Ja und nein, ja. Ganz schwierig ist es, eine größere Arbeit anzufangen, das ist furchtbar, das ist grauenvoll, man zögert es immer weiter ’raus, sich hinzusetzen, das ist wie ein Gang zum Krankenhaus um sich irgendwo operieren zu lassen. Aber dann schon: ja. Obwohl ich eigentlich immer gegen das Vollkommene bin und immer für das Fragmentarische (weil ich das Vollkommene für unmenschlich halte), ist es natürlich ein sehr schönes Gefühl, wie sich etwas beim Schreiben vervollkommnet. Ich lasse mich beim Schreiben auch tragen, gebe dem Schreiben nach, halte mich nicht an starre Vorstellungen, damit macht man ja vieles tot.
Walther: Brauchen Sie Anerkennung, oder bauen Sie auf Nachruhm?
Kunert: Nachruhm ist Betrug am Dichter, er hat ja nichts davon. Der Nachruhm ist etwas ganz Mieses, Übles, etwas Blödes. Nachruhm nützt nur den Mitfahren oder besser: den Nachfahren, die sich dann an den Namen hängen und davon leben. Die Anerkennung ist eine etwas zweideutige Sache oder eine paradoxe oder eine dialektische, wie auch immer. Sie ist positiv, wo sie die Lebensumstände sichert. Sie ist nicht gut, wo sie den Produzenten abbringt von seinen eigentlichen Absichten.
Walther: Braucht man nicht wenigstens gelegentlich eine Bestätigung?
Kunert: Es ist ganz schön, wenn man ein positives Echo hat. Auch Kritik, die Hand und Fuß hat, ist sehr schön. Aber wenn man lange darauf verzichten mußte, braucht man es nicht mehr. Es wäre mir vielleicht dienlich gewesen vor zehn Jahren, aber jetzt ist es nicht mehr wesentlich. Es ersetzt nicht die Gewißheit, daß das, was man macht, wirklich das ist, was man wollte. Nichts ist so schlimm wie die eigene Unsicherheit. Wenn ich mir meiner selbst nicht sicher bin, kann mir niemand Sicherheit geben oder mich darüber hinwegtäuschen, daß es nicht so ist.
Walther: Sind Sie sicher in der Beurteilung eigener Werke: Sind nach der Fertigstellung die ursprünglichen Intentionen verwirklicht worden?
Kunert: Früher oder später: ja. Wenn etwas ganz frisch ist, ist es ja immer gut. Dann legt man es hin und läßt es ablagern. Nach einer gewissen Zeit merkt man dann, was noch zu ändern ist.
Walther: Gibt es für Sie Bleibendes, daß Sie sagen: Dieser Text kann nicht besser gemacht werden?
Kunert: Ja, denn ich bin ja nicht mehr derjenige, der den Text geschrieben hat. Und selbst wenn ich mit dem Text jetzt unzufrieden wäre, kann ich das nicht ändern, weil es ein partiell anderer geschrieben hat. In seiner damaligen Haltung war das sicher das Maximale seiner Möglichkeiten. Es gibt aber auch Sachen, die man im Vorgriff schreibt, die ich heute genauso schreiben würde und wahrscheinlich morgen auch.
Walther: Würden Sie zustimmen, wenn ich Ihr Generalthema als das genaue Beobachten alles Ahumanen bezeichnen würde; die Mahnung an vergangenen und noch gegenwärtigen Faschismus; die Registrierung der Gefahren, Individualitäten zu verbiegen; die Wachsamkeit des Menschen zu fördern, ihn zu humanisieren und zu sensibilisieren?
Kunert: Hundertprozentig, auf jeden Fall. Wobei eben auch das Paradoxe eintritt, das zu tun, was man nicht kann: Die Vergangenheit aufzuheben, was unmöglich ist, oder das Erinnern unmöglich zu machen, was man nicht kann. Insofern ist das, was ich tue, absolut lebensnotwendig und anachronistisch zugleich. Man kann nicht das Vergessen aufhalten, das schwappt über alles hinweg. Man kann nicht die eigenen Erfahrungen vermitteln. Literatur hat nie etwas verhindern können. Die negativen Erfahrungen der Menschheit sind immer die gleichen: Das sind Unterdrückung, Ausbeutung, Tötung, Mord und Totschlag, die immerzu von der Literatur aufgegriffen werden, was aber überhaupt nichts nutzt. Doch es geht nicht anders, man muß dieses Nutzlose tun, denn ich glaube schon, daß dieses Nutzlose immer noch besser ist als gar nichts zu tun, weil dieses Nutzlose doch einen winzigen Damm darstellt. Der Verzicht auf jegliche Darstellung dieser Verbrechen legitimiert sie. In dem Moment, wo der Finger nicht mehr drauf zeigt, werden sie als Selbstverständlichkeit getan. Getan werden sie auch so, doch nicht als Selbstverständlichkeit. Literatur schafft keine praktische Aktivität, sie verhindert auch keine Aktivität, sie versieht Aktivitäten aber mit negativen und positiven Vorzeichen.
Walther: Brauchen Sie besondere Bedingungen zeitlicher, örtlicher und vielleicht auch atmosphärischer Art zum Schreiben?
Kunert: Es ist natürlich so: Man muß Ruhe haben. Das beste Arbeiten ist im Garten, weil es dort sehr ruhig ist. Ich setze mich morgens an den Tisch und habe nur eine Mütze auf dem Kopf und eine Badehose an und trinke literweise Tee. Dabei schreibt’s sich sehr gut. Die Texte durchlaufen meist drei Phasen: Handschrift, Maschinenfassung, korrigierte Maschinenfassung. Wenn man Glück hat, ist vielleicht ein kleines Gedicht in der ersten Fassung fertig. Von anderen Dingen muß man mehrere Fassungen machen. Von dem ersten Roman, vom ersten Kapitel machte ich sieben Fassungen wegen dieser auseinanderstrebenden Teile (realistische, ironische, sentimentale, groteske, ganz ernsthafte, essayistische).
Walther: Braucht Literatur neben dem besonderen häuslichen Klima auch ein besonderes kulturelles Klima? Hegel schrieb: Der Roman im modernen Sinne setzt eine bereits zur Prosa geordnete Wirklichkeit voraus. Ist das eine These, die lediglich auf das 19. Jahrhundert zutrifft, oder könnte man sie nach der Goetheschen Begriffsbestimmung der Epik, die Gesinnungen und Begebenheiten (im Gegensatz zu Charakter und Taten im Drama) darstellt, auch heute noch für gültig halten?
Kunert: Große Formen wie der Roman bedürfen einer gesellschaftlichen Kontinuität. Alle Brüche, kurzfristigen Störungen, wirken sich hinderlich und verhinderlich auf die großen Formen aus. Eine diskontinuierliche Entwicklung in einem historisch relativ kurzen Zeitraum bringt Schwankungen in der Kulturpolitik, in der Ideologie mit sich und damit in dem gesamten kulturellen Klima einer Gesellschaft. Wenn diese als Wechselbad erscheint, kann natürlich ein Werk, das längere Zeit zur Reife braucht, nicht gedeihen: es stirbt ab. Tritt so etwas öfters auf, werden solche großen Werke, für die ein großer innerer emotionaler wie geistiger Aufwand notwendig ist, nicht mehr entstehen. Es werden nur kleinere Arbeiten geschrieben, die von den kurzfristigen, klimatischen Veränderungen (Temperaturstürzen oder auch Sonnenscheinen) nicht so beeinflußt werden können.
Walther: Welche Eigenschaften (im Sinne von Tugenden) sollte nach Ihrer Ansicht ein Schriftsteller unabdinglich haben?
Kunert: Die primäre Tugend ist die der Unbestechlichkeit. Wobei es neben der Bestechlichkeit durch Geld eine Bestechlichkeit durch ganz positive Dinge gibt: Es kann jemand durch einen plötzlichen Glücksumstand, der sein Leben verändert und ihn mit Zufriedenheit erfüllt, von seinen Intentionen abkommen. Das ist das Schlimmste, was einem Schriftsteller passieren kann. Insofern sollte ein Autor aufpassen, daß er nicht von der Freundlichkeit der Welt bestochen wird. Die kann viel gefährlicher werden als eine goldene Uhr.
Walther: Welche vorbeugenden Mittel gegen diese Gefahr sehen Sie?
Kunert: Da gibt es nur die Möglichkeit der Selbstreflektion. Eine andere gibt es nicht.
in Joachim Walther: Meinetwegen Schmetterlinge. Gespräche mit Schriftstellern. Buchverlag Der Morgen, Berlin, 1973
Zum 80. Geburtstag des Autors:
Cornelia Geissler: Die Welt ertragen
Berliner Zeitung, 6.3.2009
Fred Viebahn: Ein unbequemer Dichter wird heute 80
ExilPEN, 6.3.2009
Reinhard Klimmt: Günter Kunert
ExilPEN, 6.4.2009
Hannes Hansen: Ein heiterer Melancholiker
Kieler Nachrichten, 5.3.2009
Renatus Deckert: „Ich bin immer noch naiv. Gott sei Dank!“
Der Tagesspiegel, 6.3.2009
Hubert Witt: Schreiben als Paradoxie
Ostragehege, Heft 53, 2009
Zum 85. Geburtstag des Autors:
Peter Mohr: Die Worte verführten mich
lokalkompass.de, 3.3.2014
Schreiben als Selbstvergewisserung – Dichter Günter Kunert wird 85
Tiroler Tageszeitung, 4.3.2014
Wolf Scheller: Die Poesie des Melancholikers
Jüdische Allgemeine, 6.3.2014
Zum 90. Geburtstag des Autors:
Reinhard Tschapke: Der fröhlichste deutsche Pessimist
Nordwest Zeitung, 2.3.2019
Günter Kunert im Interview: „Die Ideale sind schlafen gegangen“
Thüringer Allgemeine, 4.3.2019
Günter Kunert im Interview: „Die Westler waren doch alle nur naiv“
Göttinger Tageblatt, 5.3.2019
Katrin Hillgruber: Ironie in der Zone
Der Tagesspiegel, 5.3.2019
Benedikt Stubendorff: Günter Kunert – 90 Jahre und kein bisschen leise
NDR.de, 6.3.2019
Matthias Hoenig: „So schlecht ist das gar nicht“
Die Welt, 6.3.2019
Tilman Krause: „Ich bin ein entheimateter Mensch“
Die Welt, 6.3.2019
Günter Kunert – Schreiben als Gymnastik
mdr.de, 6.3.2019
Peter Mohr: Heimat in der Kunst
titel-kulturmagazin.net, 6.3.2019
Knud Cordsen: Der „kreuzfidele Pessimist“ Günter Kunert wird 90
br.de, 6.3.2019
Studio LCB mit Günter Kunert am 1.4.1993
Lesung: Günter Kunert
Moderation: Hajo Steinert
Gesprächspartner: Ulrich Horstmann, Walther Petri
Beim 1. Internationalen Literaturfestival in Berlin, am Samstag, den 16. Juni 2001, lesen im Festsaal der Sophiensäle in Berlin-Mitte die Lyriker Rita Dove (USA), Günter Kunert (Deutschland) und Inger Christensen (Dänemark), gefolgt von einer Podiumsdiskussion und Fragen aus dem Publikum (moderiert von Iso Camartin).
Fakten und Vermutungen zum Autor + DAS&D + Archiv +
Internet Archive + Kalliope + KLG + IMDb + Bibliographie
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Galerie Foto Gezett +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Günter Kunert: NDR 1 + 2 ✝ FAZ ✝ Welt ✝ AA ✝ Zeit ✝ FR ✝
NZZ ✝ Tagesspiegel ✝ SZ 1 + 2 ✝ MDR ✝ nd 1 + 2 ✝
Günter Kunert bei www.erlesen.tv.


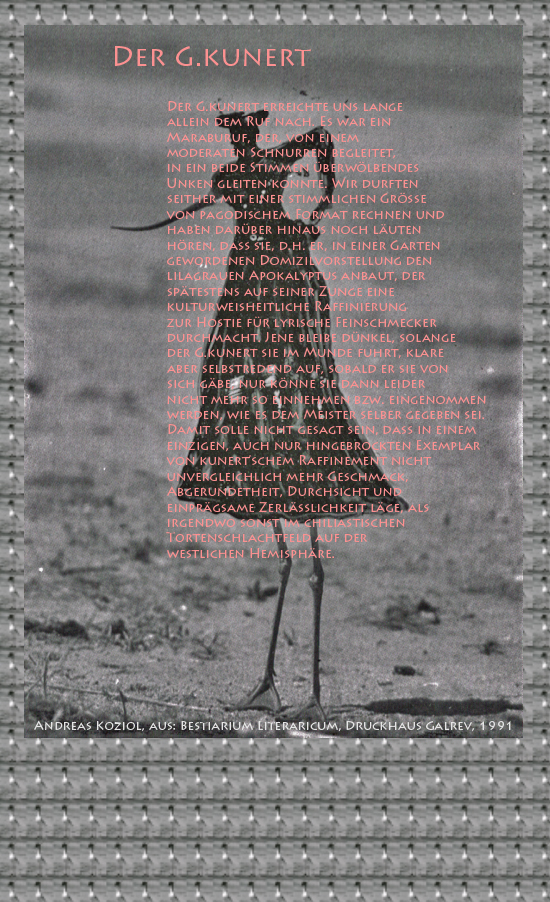
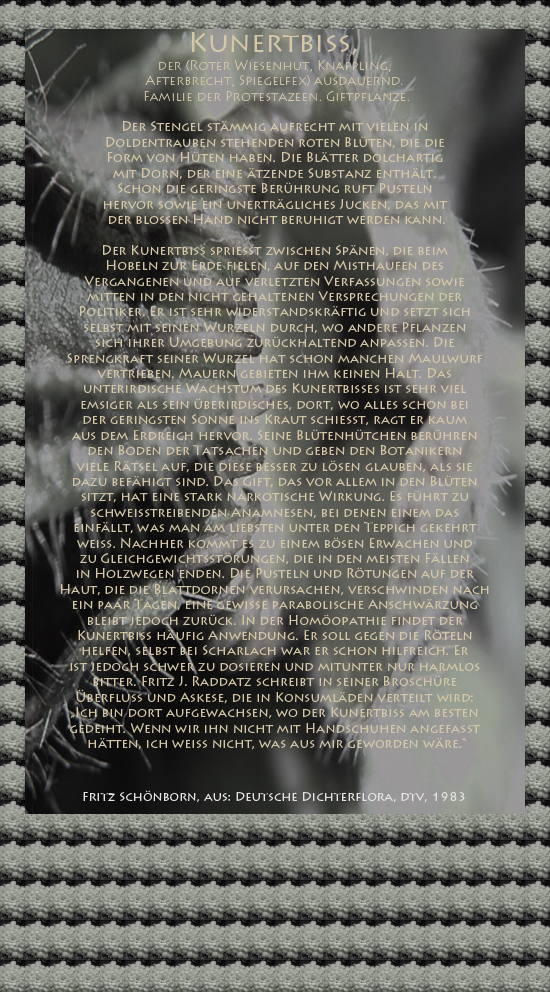
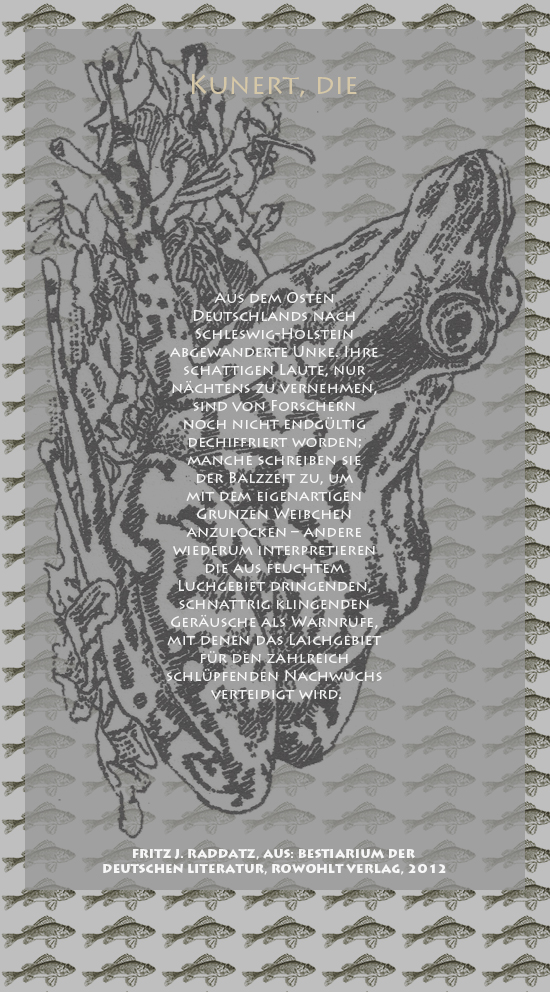
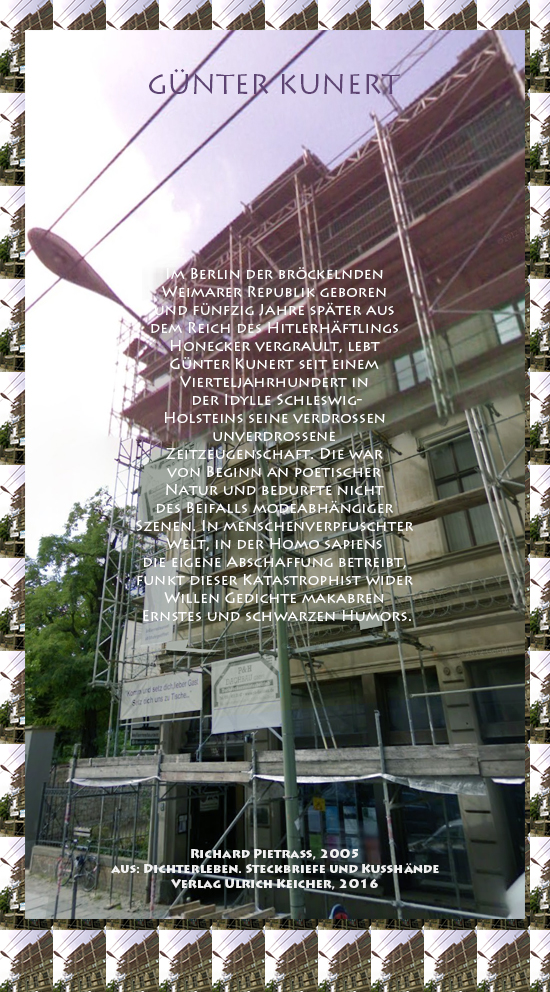












Schreibe einen Kommentar