H.C. Artmann: med ana schwoazzn dintn
nua ka schmoez how e xogt!
nua ka schmoez ned ..
reis s ausse dei heazz dei bluadex
und haus s owe iwa r a bruknglanda!
fomiaraus auf d fabindunxbaun
en otagring ..
daun woat a wäu
bis s da wida zuaqoxn is des loch
des bluadeche untan schilee
und sog:
es woa nix! oda: gemma koed is s ned!
waun s d amoe so weid bist
daun eascht schreib dei gedicht
und ned eea!
nua ka schmoez ned how e xogt!
nua ka schmoez ..
heit drong s as nua z gean
eana heazz (de dichta
de growla de schmoezxön)
bei jeda glengheid
untan linkn goidzaun
oda r iwa n lean briafdaschl
wia r a monogram ..
waun owa r ana r a gedicht schreim wüü
und iwahaubt no a weanaresch dazua
daun sol a zeascht med sein heazz
med sein bozwachn untan goidzaun
nua recht schnöö noch otagring ausse
oda sunztwo zu an bruknglanda gee!
H.C. Artmann liest „nua ka schmoez how e xogt!“ im Juni 1993
Noch ’n Gedicht: Nur kein Schmalz! von H.C. Artmann
Jede Provinz liebt ihren Dialekt: denn
er ist doch eigentlich das Element,
in welchem die Seele ihren Atem schöpft.
Goethe
Zwischen Breitensee und Ottakring, an der Dreiländerecke mit Fünfhaus, gar nicht weit von jenem bruknglanda in H.C. Artmanns programmatischem Gedicht, stand bis vor wenigen Monaten ein Stück Wiener Vorstadtprater. Es stand dort seit den Neunzigerjahren, wurde für uns Schulbuben ein über die Väter vererbter Begriff und bleibt, auch nach seiner Demolierung, mit dem schöneren Teil unserer Jugend verbunden. Auch in unserem Buch wirkt diese Erinnerung fort. Auf untergründige Weise hat sie Themen- und Bildwahl seiner Gedichte mitbestimmt, und wenngleich das auf den ersten Blick nicht erkennbar ist – ein zweiter auf den Bucheinband wird helfen, die Zusammenhänge zu klären.
Die Bilder, die wir dort sehen, gehörten zur Wanddekoration jenes nun schon legendären Ringelspiels. Mit ihrer schauerlichen Schönheit und makabren Intensität, mit ihrem naiven Raffinement haben sie die Bilderwelt der Vorstadtkinder bereichert, jahrzehntelang, bis sie – um die Dreißigerjahre – mit Märchenbildern überdeckt wurden, Bildern von der Stange, wie sie den Ideen und dem Geschmack der um Jugend und Profit besorgten Erwachsenen nützlicher erschienen sein mögen.
So führten unsere Bilder durch weitere Jahrzehnte eine Art Katakombendasein. Sie überstanden das Tausendjährige Reich ebenso wie vorher die Erste Republik und erblickten im Herbst 1957, im Zuge der Demolierung, zum zweiten Mal das Licht der Welt: einer veränderten Welt in einer veränderten Umgebung, nämlich auf einem Schutthaufen. Und von dort haben Artmann und seine Freunde sie, die schon wochenlang dem Regen, dem Wind und der Sonne preisgegeben waren, gerettet. Ist es mehr als nur Zufall, daß nun der sie besitzt, dessen Kinderträume von ihnen besessen waren? Mehr als nur Zufall, daß der ringlgschbüübsizza unseres Buchdeckels, der in vielfältiger Verlarvung Artmanns Dialektgedichte durchgeistert – als lemurenhafter blauboad, als besa geatna, als kindafazara, ja, noch als jovialer, aufs Backhähndl versessener hea onkl – daß also dieser Komtur aus Pappdeckel einem a u c h d u r c h i h n zum Dichter gewordenen Kind entgegentritt, körperlich, nach fast dreißig Jahren, und so eine Begegnung real nachvollzieht, wie sie bis dahin in Artmanns Gedichten zu vielen Malen, erinnert oder vorausgespürt, sich ereignet hat?
Eines ist sicher: der Zauber dieser Gedichte entspringt einer intensiven Beziehung zur Kindheit. Er selbst bleibt freilich unerklärbar, für manchen vielleicht auch un h ö r bar, denn nicht jeder, der Ohren hat, hört. Den aber, der ihm offen ist, mag dieser Zauber unversehens hinübernehmen in eine Kindheit, der beim domschakbiachln dauschn gee fon bradnsee ume in d rosnschdaagossn noch das Barfußgehen auf dem weichen Asphalt zum Abenteuer wird. Denn die Zeit ist aufgehoben in solchen Gedichten, und ein Kindheitserlebnis, ein Augenblicksgefühl, ein plötzlicher Wunsch oder Einfall wird in ihnen genau so zum dauernden Ereignis wie der Zustand nach einer Sintflut oder gar – nach dem Tod.
Damit ist das Gebiet umrissen, innerhalb dessen Erinnerung und Vorahnung, ästhetisierende Spielfreude und literarisches Raffinement, echte Imagination, ja Vision eines Dichters, gerade durch die Beschränkung auf einen lokalen Dialekt, der Dichtung einen neuen Bereich erschlossen haben, zumindest aber einen brachliegenden wiedergegeben. Einen neuen Bereich: eben jenes „Element, in welchem die Seele ihren Atem schöpft“, jenes Reservoir, das bisher, von wenigen Ausnahmen abgesehen, einem als schöpferisch geltenden Dilettantismus dazu gedient hat, alle im Dialekt enthaltenen Ansätze, alle Möglichkeiten für wirkliches Schöpfertum zu verjodeln und zu verdodeln. Wenigstens, soweit es den süddeutsch-österreichischen Raum betrifft. Und die Ausnahmen? Sind sie über lokale Gebundenheit innerlich hinausgekommen? Schrieb ihnen der Gebrauch ihres Dialekts – abgesehen von den geographischen Grenzen – weitgehend nicht auch die Themen vor? Schränkte er dadurch nicht den geistigen Spielraum ein? Zwang er nicht fast immer zur Konvention, erlaubte er, im ganzen gesehen, wesentlich mehr als die bloße Impression?
Man verstehe das nicht falsch: Natürlich wird kein Mensch von Dialektgedichten fordern, daß sie zur Welt sprechen, ja, nicht einmal, daß sie im gesamtdeutschen Sprachraum Gehör finden. Aber Welt h e r e i n zu holen in einen durch naturgegebene Grenzen beschränkten Kreis der Ansprechbarkeit, Welt, die jenseits der politischen und der Sprachgrenzen lebt und atmet und singt, ihre Art zu denken und zu erleben, ihren A t e m in den eigenen zu mischen, um so dem Hiesigen neue Impulse zu geben, unauffällig, fast spielerisch: d a s ist zu leisten, auch fürs Dialektgedicht. Und das ist hier erfüllt. Welt dringt herein in ein provinz-, ja bezirksbegrenztes Idiom.
Lassen wir uns nicht täuschen durch scheinbare Volkstümlichkeit oder gar Simplizität! H.C. Artmanns Dialektgedichte, obwohl m i t dem Mund des Volkes gesprochen, kommen nicht a u s ihm. Das dreimal Raffinierte an manchen seiner Stücke besteht ja gerade darin, daß auch der literarisch voraussetzungslose, schlichte Zuhörer ihre Sprache versteht und, Sprache mit Inhalt verwechselnd, nun auch diesen zu verstehen glaubt. Versteht er aber mehr als das Nur-Vordergründige, den „gschbas“? Würde man ihm nicht durch Erklären die Freude daran nehmen? Denn er hält ein Gebilde wert, dessen Wert für ihn durch einen Unwert – den Dialekt – bestimmt ist, und das für ihn unter Umständen seinen Wert verlöre, wollte man ihm beweisen, daß er, gerade weil er einen Unwert werthält, einen wahren Wert anerkennt. Das mag überspitzt klingen, und ich sage auch gar nicht, daß es vom Dichter von vornherein so gewollt war – aber daß es so ist, beweist das unerwartet starke Echo, das beim Rundfunk und in Wiener Buchhandlungen nach einer Radiosendung registriert wurde, und beweist in kleinerem Maßstab die spontan zustimmende Aufnahme, die diese Gedichte an allen bisher erfolgten Leseabenden gefunden haben.
Dabei muß man freilich eines berücksichtigen: Von vereinzelten Drucken in Zeitungen und Zeitschriften abgesehen, bekam die Masse der Zuhörer Artmanns Dialektgedichte noch nicht zu Gesicht. Der Kontakt vom Dichter zum Publikum schloß sich übers Gehör. Diese gesündere, viel ältere Beziehung erhält durch den vorliegenden Band einen Stoß, der auch gutwillige, aufgeschlossene Leser schockieren kann, wenn sie nicht das einzig Richtige tun: auch beim visuellen Aufnehmen ganz bewußt über das Gehör zu lesen. Das entspricht dem Zuhören noch am ehesten.
Eigentlich sollten Artmanns Dialektgedichte ja nur gesprochen werden. Dialekt ist nun einmal keine Schrift-Sprache, er ist lebendiger als sie, hängt sogar vom Sprecher ab (in der Schriftsprache ist es nahezu umgekehrt) und bedarf, wenn er schon geschrieben wird, einer durchaus individuell bestimmten, phonetischen Schrift. H.C. Artmann entschied sich für eine durch ihren Konservativismus radikale Lösung: er verzichtete auf sämtliche, von landesüblichen Dialektschreibern so gern gebrauchten, das Schriftbild nur entstellenden Hilfszeichen und findet mit unserem konventionellen Alphabet – noch vermindert um das v – das Auslangen.
Es ist eine große Erleichterung für den Leser, daß er sich nicht erst mit neuen Zeichen vertraut machen muß. Er hat sich genug mit den Vokalen zu plagen, die wie immer die Hauptschwierigkeit bilden: Das Wienerische färbt sie besonders stark, besonders unregelmäßig ein, und ihre Wiedergabe bleibt demgemäß unvollkommen. Authentische Schreibung würde etwa zwanzig neue Vokalzeichen erfordern. So bleibt als ideale und deshalb utopische Lösung nur, jedem Band eine Langspielplatte beizulegen.
Trotzdem: Solche Einschränkungen können nicht das Verdienstliche der Artmannschen Lautschrift mindern. Die Praxis zeigt, daß alle beim Lesen auftretenden Anfangsschwierigkeiten rasch verschwinden, und hernach erfreuen so exotische Schriftbilder wie mei ausdroknz heazz, zwischn zwa blaln babia, de salame da qaglschduazz da grisfoezuka, de gebuazzdoxkinda r iwa r ochzk, a xunz lamentawö, agazebam, bopöbam oder auch en naboleaun seine goidan odla nicht nur das Ohr. Es mag sogar sein, daß den oder jenen wienerischen Leser nach dem ersten Befremden, nach dem Erkennen, nach der dem Erkennen folgenden Heiterkeit und Freude ein heimliches Staunen ankommt über die neue, achtsame Beziehung, die Artmanns Schreibweise zwischen uns und unserem meist gedanken- und lieblos gebrauchten Dialekt stiftet.
Und wie bildkräftig, wie bündig ist dieser Dialekt! i hob en oedn augland lossn en da bude – welches hochdeutsche Äquivalent ließe sich neben diese Wendung setzen? Oder neben die folgende aus dem gleichen Gedicht:
jetzt wäu r e aum saund bin weng dia
jezt reibst ma r en gschdis!
Jemand „en gschdis reim“, dieser vom Tarockieren hergeleitete Ausdruck für den Abbruch einer Liebesbeziehung! Und wer traut sich zu, das resignierende es is do ee scho gaunz bowil / op s d jezt auf fedan büslsd / oda zuadegta met d uawaschln / auf d kamün und d hanslschliaffa… so anschaulich und lapidar ins Hochdeutsche zu übertragen? Trocken verdolmetschen läßt sich freilich alles, aber der Zauber ist dann verflogen, und was bleibt, erzeugt höchstens Gähn- oder Lachkrämpfe.
Ebenso verhält es sich mit der existenziellen Frage hot den heit olas de bodschn ausgschdregt?!, desgleichen mit der noch nie dagewesenen Erkenntnis noch ana sindflud / san olawäu / de fenztabreln fafäud –, und ähnlich mit der in sich persiflierten Stelle waun i amoe a bangl reis / zu deidsch: de bodschn schdrek –. Die selbstgerechte Feststellung eines bodenständigen Zingerle-Engleder noch vollbrachter Arbeit und ii – da blauboad fom brodaschdean / sizz solid in kafee bei an gschdregtn … läßt an Drastik vollends nichts mehr zu wünschen übrig.
Dergleichen ist unübersetzbar. Es „tritt unter einem einfachen, ja rohen Volke unwiderstehlich hervor“, und der Dichter mag sich seiner bedienen, ohne es zu verändern. Solche und ähnliche Stellen sind es auch, mit denen Artmann den unliterarischen Teil des Publikums für sich gewinnt.
Mit gleichen Sprachmitteln läßt sich aber auch gegenläufig verfahren. Das Wie solchen Verfahrens, bei dem der Dichter mit dem Material des Dialekts nunmehr g e g e n diesen arbeitet, ihn nachgerade dazu zwingt, etwas zu leisten, das bisher Domäne der Hochsprache war, ihm Resultate abgewinnt, die innerhalb der Dialektdichtung völlig neu sind, weil ihr jener Atem zugeführt wurde, von dem weiter oben die Rede war: dieser Austausch von Land zu Land, der einer unverbrauchten, vitalen Volkssprache Impulse gibt, welche in der sterilen Sprache mancher moderner Lyriker die absonderlichsten Auswüchse treiben – dieser gleichsam alchimistische Vorgang ist es, der einen zwar kleinen, aber um so wichtigeren Teil des Publikums fesselt und für Artmanns Dialektdichtung einnimmt.
Die Beispiele dafür, wie man Dichtung „als Zuwaog“ an den Konsumenten bringt, finden wir häufig in den gleichen Stücken, denen auch die vorigen Stellen entnommen sind. Da ist gleich das zuletzt erwähnte blauboad-Gedicht: Sein Vers heit brenan ma keazzaln / in bumpadn bluad gibt das Vorgefühl des Lustmörders nahezu unübertrefflich wieder. Die Assoziation zu Weihnachtsbaum und Allerseelenlichtern verleiht dieser makaber-flackernden Verlust überdies etwas rituell-Weihevolles und greift damit in den Bereich eines Humors, der gewiß nicht im deutschen Sprachraum zuhaus ist. Ganz anders, pathetisch, ja visionär ist dagegen der Fluch des von seinem Mädchen verlassenen Briefschreibers:
a schwoazze lufft fola fegl
wiad med mein leztn briaf augflong kuma
und auf d nocht duach s fenzta
fua dei bet zuwe fliang…
Das ist wohl die letztmögliche Steigerung der verliebt-idyllischen Anfangszeilen a dauwal miassad med an briaf / fon mia zu dia fliang. Von allen Gedichten unseres Bandes umspannt denn auch dieses die größte Empfindungsskala. Aber nicht d a r auf kommt es vornehmlich an: viel wichtiger ist, daß dichterische Formulierungen, die sonst vom großen Publikum unweigerlich als Überspanntheit, als „bledsin“ abgelehnt würden – falls er sie überhaupt zur Kenntnis nimmt – über den Dialekt ohneweiters akzeptiert werden, ja daß ein Zweifel, ob der Vision a schwoazze lufft fola fegl nicht doch die Version „a luft fola schwoazze fegl“ vorzuziehen wäre, gar nicht erst aufkommt.
Der schwoazze fogl, im vorigen Zitat noch Briefbote, wird zum Todesboten in dem Bild für ein zuspätkommendes Rettungsauto:
und waun so da dopözz bech hosd
und scho umeschdesd
zwischn soo fü eisn und benzin
befua de no dea schwoazze fogl
unta seine gloarofoamfligaln nimd…
Ganz ohne Härte, ist dieser Tod a bech und sonst nichts, und steht so in stärkstem Gegensatz zu unserer gehetzten, technisierten, neurotischen Welt aus soo fü eisn und benzin: als himmelschlüsselüberbringenden hamlechn hean lernen wir ihn kennen! Versöhnlicheres, das zugleich ironischer wäre, läßt sich nicht mehr denken.
Vielfältig sind bei Artmann die Bilder für Sterben und Tod. Irreal wie die Straßenbahnfahrt auf den Zentralfriedhof med n anasibzkawong / en an schwoazzn qaund / met dein batazel / en da linkn haund zum eigenen Begräbnis, so irreal ist auch das Wunschbild fargrobt s me daun scho liawa / en an luftbalaun / oda fomiaraus / en an gschdolan schdeklschuach. Neben Märchenmotiven, neben Erinnerungen an die Vagantenlieder früherer Jahrhunderte klingt da etwas vom alten Wiener Volkssängertum herein, das ganze Gedicht ist ihm in der Konzeption verwandt. Im Geist freilich weniger: die „schene leich“, ein Idol, für das mancher Wiener sein Lebtag im Leichenverein (!) einzahlt, wird recht pietätlos apostrophiert, dafür aber ins Poetische einer Himmelfahrt per Luftballon gewandelt. Französische Eleganz gegen bodenständige Behäbigkeit.
Beschließen wir diese Sonderbetrachtung mit der wohl stärksten Stelle des gesamten Bandes: mit Artmanns Beschwörung des unverrückbaren, unwiderruflichen Zustandes nach dem Tod. Als Rollengedicht ist dieses Stück das gewagteste, weil es, um wirksam zu werden, nur aus dem Leser selbst sprechen darf und dazu seine unbedingte Identifikation braucht. Die „Pendeluhr“ – lies „Herz“ – steht still, der „Schnee“, der zum nunmehr offenen „Fenster“ hereinkommt, formt sich zum Todesengel, und nur die leichenstarr daliegende Gestalt, deren Rolle jedem von uns gewiß ist, redet. Einfachste, alltägliche Requisiten vereinigen sich mit einem Nichts an sprachlichem Aufwand zu so suggestiver Wirkung, daß wir meinen, auch die Zeit stehe still. Und über der Totenstarre, eisig, noch einmal das Bild der Kindheit:
und drad se
und drad se
wia r a fareisz ringlgschbüü
und kumd ma bein fenzta r eine – – –.
Und dann der Schluß. Wie er aus dem Todesschlaf unmerklich den letzten Rest organischen Lebens ins Anorganische überführt, in eine Kristallisation, deren Beginn auch das Ende des Gedichts erzwingt, ein Ende, das aus dem Wort „anfangen“ besteht – das ist genial:
und mei schlof is scho soo diaf
das ma glaaweis und launxaum
winzege schdeandaln aus eis
en de aungbram
zun woxn aufaungan…
An den Ernst dieses Gedichts reicht nicht einmal das böseste des Bandes, das liad fon an besn geatna heran. Dennoch bildet es mit dem soeben besprochenen Schlußstück und mit dem existentialistischen Gedicht „wo is den da greissla?“ den Höhepunkt der Artmannschen Dialektdichtung. Wir gelangen zu dieser Wertung allerdings nur unter Verzicht auf die weitverbreitete, bequeme Forderung nach Schönheit und Moral im konventionellen, schönfärberisch-pädagogischen Sinn. Der bese geatna, diese nahezu klinisch studierte Rolle pathologischer Bosheit und Mordlust, wird im Zuge einer sprachlichen Meisterleistung zur Inkarnation alles Nachteiligen, zum Sinnbild des absolut Bösen, das der heraufkommende Morgen nur unterbricht:
und i schneid schneid schneid
das des bluad nua so
fon da sichl s c h r e i d
bis io da frua!
Der Kontrast zum Beruf des Gärtners, dieses Gleichnisses für die irdische Aufgabe des Menschen, und der Kontrast zum Zartesten, das die Erde hervorbringt, den Blumen, deren „Blut“ dem Rasenden schließlich fon o m d en d schuach rinnt, steigern die Brutalität ins Unmeßbare. Nur die Freude an der tadellosen Durchführung dieses Themas macht uns zunächst gegen sein Grausiges immun.
Unter dem bösen Blick, der Artmann manchmal eigen ist, wird auch das Beschauliche, das sonntags die häßlichen Gassen der Außenbezirke verschönt, zu Ekel und Überdruß. Aber nicht impressionistisch geschildert sind die leeren Häuserzeilen, sondern das Gefühl bei ihrem Betreten wird umgesetzt in Aktion: ein sich steigerndes Stakkato von Fragen wirft sich der Leere entgegen – und verstummt in dem trostlosen Echo der Wohnfassaden:
ka mendsch
ka gschia
ka saff
ka koin
ka soez
ka bacht…!
Die Antwort ist totenhaft:
wia batazeln aus wööblech
schaun s aus
de oweglossana roiboekn!
Und doch hat nicht alles de bodschn ausgschdregt, nein, jetzt bricht es los, höhnisch, als Antwort einer Zivilisation, die alles Erleben mit ihren Fabrikaten, Konserven, genormten Vergnügungen, klischierten Gefühlen, Zeitungs- und Radiophrasen verseucht und erstickt:
nua de radio san no doo…
nua de radio!
en ole fenzta san s do
und hean da nima r auf!!
Die gleichen Radios, denen der Dichter einen Teil seines Publikums verdankt, jetzt wenden sie sich, allen Überdruß eines leeren Sonntagsnachmittags, eines leeren Lebens stellvertretend, gegen ihn! Aus dem Irrsinn dieses circulus vitiosus hebt sich, ungewollt, abermals die Vision des Ringelspiels. Und w e l c h es Ringelspiels.
Noch aber steht am Ende dieses Gedichts ein vom Ekel diktiertes „Aufhören!“:
waun s nua zun renga aufaungad…
waun s nua scho wida mondog waa!!
Im darauffolgenden Stück ist dieser Ekel schon zum Entsetzen geworden, gegen das kein „Aufhören!“ mehr hilft. Statt der Radios dienen nun die aus dem Boden schießenden Wasserreservoirs dazu, dieses Entsetzen angesichts der unaufhaltsamen, weltweiten Entwicklung hinauszuschreien:
wos soi ma do mochn?
da duascht
da duascht
(op s d wüsd oda ned)
da duascht dea head se
nii und nima r auf!
Dieser duascht nach immer mehr Annehmlichkeit und Vergnügen, nach immer mehr Macht und Besitz: Welche Katastrophe bahnt sich da an! Artmann zeigt uns ihre Folgen. Langsam, stimmlos, tropfenweise fallen die Worte:
noch ana sindflud
san olawäu
de fenztabreln fafäud –
ka fogl singd mea in de bam
und de kefa schwiman en d lokn
med n bauch in da hee…
Die Spannung zwischen diesem und dem wossaresawaa-Gedicht findet nicht leicht ihresgleichen: die Breitenseer und Ottakringer Reservoirs dort –, tropfende Bäume, tote Käfer und ersoffene Kinos hier: wie wenig gehört doch dazu, das Bild der radikalen Vernichtung glaubhaft zu beschwören!
Ist für solche Gebilde die einschränkende Bezeichnung „Dialektdichtung“ noch zulässig? Befinden wir uns da nicht längst im Bereich reinster Ausdruckskunst? Einer Kunst, die mit geringsten Requisiten Wirkungen erzielt, um derentwillen die ausgedroschene Sprache moderner schriftdeutscher Lyrik häufig das gesamte siderische und kosmische Gerümpel vom Orion bis zur Milchstraße bemühen muß? Bei H.C. Artmann aber wird auch der Mond zum weana. Wie er, in den kastanien und agaze nistend, den nächtlichen Passanten seine glenzadn aung nochdrad / und wia r a r eana nochruaft: / secht s me den ned? / in bin genau so guad a weana / wia s es weana seizz!! / nuo das e hoed en kan gemeindebau won / und en kana kaukaseschn nuss… – das gehört zu den wirksamsten Stellen jedes Leseabends.
Damit sind wir unversehens zum ruhigsten, versöhnlichsten Abschnitt unseres Bandes gelangt: zu jenen Stücken, die der Kindheit des Dichters und seiner näheren Heimat verpflichtet sind. Die klare Luft, die sommersüber in der ersten Frühe se wia r a süwana fodn / aus n winawoed owaziagt in die Außenbezirke der Stadt, sie verklärt als Hauch des Elegischen auch die Strophen dieser Gedichte.
i won zimlech weit draust
geng schdaahof zua
anahoeb schdund fost
fon schdeffansbloz wek…
beginnt eines der zauberhaftesten, und beschwört dann jene seltsam-schwebende Stimmung, die im Morgengrauen manche Wiener Gegend dem Städtischen so sehr entfremdet, daß die grodnbledschn und brenesln hinta da blaunkn fon an logabloz, daß eine gschdetn fola kamün und hanslschliaffa genügen, um die Realität dieser Stadt von uns zu nehmen in einem Raum und Zeit auslöschenden Kindheitsgefühl. – Dazu bedarf es eines intensiven Erinnerungsvermögens, gepaart mit präzisesten Formulierungen. Aber wie leicht übergeht man diese Eigenschaften in so einfachen Bildern wie hier
und waun s d einegaunga bisd
en so a haus
zun diadafalbeowochtn
woa s soo küü drin
und soo schdüü
wia r en ana kiachn
en dera wos s grad zmitog
an köch kocht haum…
Von der Erinnerung zur Sehnsucht ist nur ein Schritt. Wie klein er ist, zeigt jenes liad, in dem Eingebung und Erinnerung sich mischen zum Bild einer kindhaften Melancholie, aus der es plötzlich aufsingt, unmittelbar wie nirgends sonst in Artmanns Gedichten:
fliang fliang
fliang mechad e hoed kena
one maschinarii
wia r a fogal
auf fligln…
Die Ur-Sehnsucht a l l e r Menschen, nicht nur der Dichter – s i e ist der eigentliche Motor, die „maschinarii“ hinter der maschinarii dieser Gedichte. Insofern gewährt uns dieses kleine, scheinbar so schlicht gefügte Lied den tiefsten Einblick in die Triebkräfte solcher Kunstäußerung. Ob wir das „fliang“-wollen als Weltflucht, als Streben nach Beherrschung der Mittel oder geistigem Erhobensein, als Sinnbild der Sehnsucht schlechthin oder nur einfach als Reiselust, als Wunsch nach Veränderung deuten, ist im Grunde gleichgültig. Wahrscheinlich resultiert es aus allen den genannten Komponenten – und nicht nur aus ihnen.
Aber auch mit der maschinarii allein, ohne zu fliang, läßt sich zurechtkommen. Dann entstehen Gedichte wie „waun zwa oede bem brakn“, „bit aunan häulechn loarenz“ (den Breitenseer Pfarrheiligen), oder wie die Gedenktafel auf eine inzwischen abgerissene Breitenseer Bedürfnisstätte:
waun s d fabei gesd
en suma
um d mitoxzeid…
ein Gedicht übrigens, mit dessen Schluß Artmann dem Leser noch rasch einen k.u.k. Schnurrbart anzaubert, den wir aufzuzwirbeln versucht sind bei der Stelle:
wia domoes
drunt aun da biawe!
Dies ist Humor der heimischen Art, und hier berühren sich Artmanns Dialektgedichte auch am ehesten mit Weinhebers Wien wörtlich, mit dem sie gern verglichen werden. Obwohl dieser Vergleich nicht bös gemeint ist, unterbliebe er besser, weil er Artmanns Gedichte auf eine ihnen wesensfremde Ebene stellt. Nichts gegen Wien wörtlich – aber von ihm zu diesem Band gibt es keine über die geographische Gemeinsamkeit hinausgehende Beziehung. In diesem Zusammenhang ist ein Wort des Wiener Kunstkritikers Alfred Sehmeiler von Bedeutung: er nennt Artmanns Dialektgedichte „makabre Litaneien aus der Wiener Vorstadt, etwas absolut Neues, das schärfer ist als die bisherige gemütliche Mundartdichtung, hintergründig, abgründig, das heißt, wirkliche Peripherie, geraunzter Schwarzer Humor, der hier den Stadtrand erreicht“. Kürzer läßt sich das mit Artmanns eigenen Worten sagen: Seine Gedichte sind med ana s c h w o a z z n dintn geschrieben. Und erst diese Formel bezieht auch die Liebesgedichte ein, ihre Freude wie ihre Enttäuschung.
Es sind ja auch Liebesgedichte besonderer Art. Sogar in ihrem Genre, das am ehesten zur Konvention und, über den Dialekt, auch zum Gemütskitsch tendiert, erweist sich Artmanns Originalität, und man kann sagen, daß auch mit ihnen eine neue Kategorie erstellt ist. Oder hat es bisher im Dialekt solche Liebesgedichte gegeben? Hatte da nicht fast alles einen ungewollt kitschigen oder zotigen Beigeschmack, bis hinunter in die tiefsten Niederungen des kommerziellen Wienerliedes und Schlagertextes, wo nur mehr Blödsinn und Geschmacklosigkeit herrschen? – Daran wollen wir denken, wenn wir Artmann med an briaf fon mia zu dia kommen hören, oder gar; wenn er alanech fia dii singt, ein Troubadour der Wiener Vorstadt von heute.
Dabei hätte dieses Liebeslied – vom Dialekt abgesehen – gar nichts Wienerisches mehr. Aber durch eine einzige Zeile – sie heißt auf da belaria oda bein e-wong – macht es Artmann zu einem der wienerischesten des Bandes.
Auch dieser Kunstgriff: erst hinterher, vom fertigen Gedicht aus, ist er kontrollierbar. Wie so viele andere, mit denen erlernbare Virtuosität dem Nicht-mehr-Erklärbaren seine Töne entlockt, mag auch er fast automatisch getan worden sein, ohne Vorausberechnung, aus einem Wissen, das sich nicht lernen läßt. Eben dieses Wissen an Hand einiger seiner Äußerungen aufzuspüren und nachzuweisen, hat meine Interpretation mit bescheidenen Kräften versucht.
Fassen wir zusammen:
Artmanns Dialektgedichte sind keine D i a l e k t gedichte. Auch keine Wiener Gedichte, sondern Gedichte aus Wien.
Nicht aus dem Wien, zu dem sich der Weg von Paris ab St. Pölten zu ziehen beginnt. Wienerisch ist nur die Sprache dieser Gedichte. Sie selbst bilden ein Spannungsfeld unmerklich-unablässigen Austausches von Eigenem und Fremdem.
Der Staatsbürger H.C. Artmann ist unter anderem auch Wiener. Der Dichter H.C. Artmann aber sieht das ringlgschbüü des Lebens mit anderen Augen
und schreibt es – nua ka schmoez ned! – hin
med ana s c h w o a z z n dintn.
Friedrich Polakovics, Vorwort
Willi Resetarits & der Stubnblues spielen „alanech fia dii“ von H.C. Artmann
Die Kunst liebt es,
überraschend zu kommen, und sie sucht sich gern konträre Eltern. Nach Nestroy hat der Holzhacker die Geometrie umarmt und da ist der Zimmermann daraus geworden. Die Kunst des Zimmermanns kann man aus der Welt nicht mehr wegdenken.
In Breitensee hat sich neulich die Wiener Vorstadt mit dem Surrealismus eingelassen und daraus ist – ein Dichter entstanden, ein wirklicher. Soll einer behaupten, daß man das hätte voraussehen können!
Ein Dichter, das ist ein neuer Ton, gerade der, auf den man am wenigsten gefaßt gewesen ist. Wenn man auch nur drei Zeilen eines einzigen dieser Gedichte liest, steigt in neuer Farbe eine neue Wiener Welt auf, die noch niemand besungen hat und die doch immer schon neben uns dagewesen ist: neue Häuser, Gassen, Bäume, Gegenden, makabre, traurige, seltsam anziehende. Und in dieser neuen Landschaft sind dann die starken alten Gefühle, die sich nie ändern, die jeder kennt, auf einmal so frisch wie der neueste Schnee.
Wie das der Dichter fertigbringt, das hätte mancher schon gern herausfinden wollen, aber es wirklich zu sagen, ist noch niemandem gelungen. Sicherlich kommen diese Gedichte ganz aus dem Wort, dem Wiener Wort – ins Hochdeutsche könnte man sie schwerlich übersetzen. Und doch sind sie weit mehr als Dialektgedichte. Sie sind in der Empfindung oft so einfach wie die ältesten Volkslieder, in der Form oft so kunstvoll wie der modernste vers libre, in der Entsprechung von Sinn und Klang oft vollkommen wie klassische, in der Fülle überraschendster kühner Bilder so reich wie barocke Dichtung. Im Grunde aber lassen sie sich mit gar nichts vergleichen, sind ganz und gar aus unserer Welt und Zeit.
Denn das Eigentlichste der Breitenseer Gedichte kommt, glaube ich, eben aus der unwahrscheinlich glücklichen Ehe der surrealistischen und der Wiener Sphäre. In ihr streift der Surrealismus das Kalte und Zerebrale ab, wird wirklich geheimnisvoll und sogar märchenhaft, und zwar in einer Umwelt, in der das Märchenhafte gar nicht vorkommen könnte. Das Wiener Leben und die Wiener Landschaft aber wird, ohne das Volksmäßige aufzugeben, eigentümlich schwebend und schwerelos. Und wie gut verbindet sich das Gruselige des Surrealismus mit dem ganz anders Gruseligen, das zu einer bestimmten Art Volksdichtung von jeher gehört.
Die Breitenseer Gedichte sind die Entdeckung eines neuen Wiener Kontinents und neuer Möglichkeiten der Dichtung. Man kann sich jetzt Wien ohne sie nicht mehr denken.
Hans Sedlmayr, Vorwort
Lyrik aus Breitensee
Der schmale Band mit dem in Praterbudenmanier gemalten Bildnis des Ringelspielbesitzers ist in kurzer Zeit die literarische Sensation Wiens geworden. Selbst wer sonst nicht über neue Verse zu sprechen pflegt, verschlingt diese. med ana schwoazzn, dintn – gedichta r aus bradnsee nennt sich das Buch, H.C. Artmann sein Autor, Otto Müller sein Verleger.
Ja: es ist eine Sensation, wenn ein junger Wiener Dichter über Dinge aus Wien in Wiener Mundart schreibt. Unser Poetennachwuchs befleißigt sich im allgemeinen einer möglichst abgeschliffenen Themenstellung und erhofft sich von dieser Farblosigkeit, daß die nirgends beheimateten Werke dann allerorten verstanden, gespielt und gelesen werden mögen. Die großen Amerikaner, Franzosen und Engländer machen es bekanntlich umgekehrt: die schreiben so lokal wie möglich. Und ihre Werke, die in ihrem Ursprungsort stimmen, stimmen dann meist auch überall anderswo in der Welt. H.C. Artmann also, bisher durch Funkarbeiten und poetische Studien hervorgetreten (oder vielmehr nicht hervorgetreten), steht nun mit einem Male als ein Fertiger da: als einer, der ein reales Milieu, eine in ihren Dimensionen genau stimmende Welt aufweisen kann. Und so stimmt es denn auch in der Poetik.
Er schreibt eine Orthographie, die einen fürs erste verblüfft. „a xunz lamentawö“ oder „bit aunen häulechn loarenz“ oder auch schlicht „libhazzdoe“ – solche Gedichttitel wird man erst nach einiger Übung lesen können. Und das sind erst die Titel! Artmann packt das Breitenseerische dort, wo es am breitesten ist. Ob seine Übertragung phonetisch richtig ist, darüber streiten zur Zeit die Dialektexperten der enteren Gründ; möglicherweise ist die Favoritner Variante anders als die stammersdorferische. Wie immer dem sei: hier sind echte Kunstwerke gelungen, von unverwechselbar eigener Handschrift.
Der Vergleich mit Weinheber liegt auf der Hand. Er stimmt nicht. Weinheber war der klassischen Form und dem impressionistischen Empfinden verpflichtet und suchte dem Vorstadtwienerischen mit einer immer noch halb hochdeutschen Orthographie gerecht zu werden. Artmanns Herkunft ist der schwarze Humor, sind Wedekindsche Bänkellieder und vorstädtische Balladen. Wie es Hans Sedlmayr ausdrückte:
In Breitensee hat sich neulich die Wiener Vorstadt mit dem Surrealismus eingelassen, und daraus ist ein Dichter entstanden, ein wirklicher.
Artmann singt vom „ringlgschbübisizza“, vom Mörder aus der Vorstadt und dem „kindafazara“, er singt von der Trostlosigkeit der Peripherie und ihrer verhaltenen Poesie, von den verlassenen Straßen, aus deren Fenstern das Radio gröhlt, und von „an briafdroga sei gschbenzt“. Seine Worte sind genau, daß sie auch das ausdrücken, was zwischen den Worten steht. Habemus poetam!
Otto F. Beer, Neues Österreich, 27.4.1958
„A xunz lamentawö“ – „Fabindunxbaun en otagring“?
Die Boulevardblätter singen das Lob des Bandes und seines Autors, die Auslagen der Buchhandlungen zeigen das Buch mit dem quadratischen Format und dem makabren Volkskunst-Einband, zeigen es an hervorragender Stelle, man spricht über diese Gedichte – und kauft sie auch. Eine kleine Sensation in einer Zeit, da hierzulande die Verkaufszahlen eines Lyrikbandes nur selten jene der Rezensions- und Dedikationsstücke überflügeln.
Vor einem Jahrzehnt erschienen die ersten Gedichte H.C. Artmanns – in der Zeitschrift des Theaters der Jugend (Neue Wege), modernistische Gebilde kleingeschrieben (dieser uralten Avantgarde-Sitte, die ja eigentlich die Germanisten vor gut hundert Jahren eingeführt haben, ist Artmann bis zu den Breitenseer Gedichten treugeblieben), schwer verständlich, an spanische Dichtung gemahnend und sich auch so gebärdend. Einige Jahre hindurch las man in den Neuen Wegen oft und regelmäßig Lyrik von Artmann. Im übrigen erschien dort auch schon vor mehr als einem Jahr eine Auswahl der „Gedichta“. In Buchform war allerdings bis jetzt nichts vorhanden, Artmanns Bekanntheit beschränkte sich auf einen Kreis von Freunden, meist avantgardistischen Malern und Literaten. Er liebte die Exklusivität, forcierte sie nicht selten durch ironisch-verschmitzte Legendenbildung um seine eigene Person, die in „St. Achatz am Walde“ geboren wäre, wobei es sich aber wahrscheinlich um einen nicht sehr geläufigen Ausdruck für „bradnsee“ handeln dürfte. Der Otto Müller Verlag sagt trotz ausführlichen Kommentaren darüber nichts aus.
Fest steht aber, daß Artmann von Anfang an ein wirklicher Dichter war, bei aller Skurrilität und dem oft Kapriolen schlagenden Hang zum Sonderbaren (er dichtete von Spanien bis Irland alles Ausgefallene nach – und vielfach besser als es die, soweit vorhandenen, Originale sind), ein Lyriker von Formgefühl und Gestaltungskraft wie kaum ein anderer seiner Generation – und vor allem wie kaum je ein betonter Avantgardist. Publikum und offizielle Literatur nahmen ihn jedoch nicht zur Kenntnis, bis die Stunde da war und der Mythos von „bradnsee“ in den Mittagsblättern verkündet wurde. Es wäre aber falsch, sich nun in Betrachtungen zu verlieren, wie sehr private Mythen- und Legendenbildung zum Erfolg beitrügen, und etwa den Paradefall Forestier (das lyrische Gegenstück zur Bunkermenschen-Ente von Gdingen) zu zitieren. Artmann ist nämlich stärker als seine Legende, seine Gedichta (und seine Gedichte) halten den Rummel schon aus!
Der Band selbst ist sehr ansprechend ausgestattet, die Montage der alten Breitenseer Ringelspielbilder als Umschlag ist ebenso wie das exakt und ernst interpretierende Vorwort (beides von Friedrich Polakovics, einem jungen Wiener Autor, der auch Artmanns bester mündlicher Interpret ist) gut gelungen: das Verblüffende ist – neben Hans Sedlmayrs Einleitung – das Druckbild. Janheinz Jahn, der Nachdichter von Negerlyrik, braucht nicht bemüht zu werden, wenn es manchmal auf den ersten Blick so aussieht, als stünden seine Negergedichte im Original da. Nein, es ist schon wienerisch, echter Dialekt der Großstadt, der Vorstadt, Mischung aus sprachschöpferischem Volkston, Gauneridiom und abgesunkenem Zeitjargon. So wird wirklich gesprochen – und nicht nur an der „Dreiländerecke“ der Bezirke, wo das „ringlgschbü“ stand. Die „verfremdende“ Wiedergabe in den Buchstaben des Schriftsprachealphabets, die zunächst auch dem „gelerntesten“ Wiener einige Schwierigkeit macht, ist gerade der besondere Reiz der „gedruckten“ Gedichte. Vorgetragen haben sie stärkere Momentwirkung, natürlich, aber schwarz auf weiß zeigen sie, daß sie nicht nur ein Jux sind, sondern echte Poesie. Gewiß, schwarz auf weiß kann man auch besser nachweisen, daß dieses oder jenes Gedicht im García-Lorca-Stil geschrieben ist. Aber was tut das schon! Artmann ist nicht nur ein geschickter Artist, ein Jongleur mit dem Volkston, er hat seine Gcdichte nicht auf „bradnsee“ zurechtgemacht, sondern aus der Mentalität der „entern grind“ heraus geschrieben, gedichtet, muß man sagen. In dieser Beziehung sind sie echter volkstümlich, als „Wien wörtlich“ von Weinheber, der oft zum wertenden Vergleich herangezogen wird.
med ana schwoazzn dintn läßt sich nicht ins Deutsche übertragen, es ist ja auch gar nicht notwendig. Artmann, dem skurrilen Kauz und echten Dichter, ist hier mehr als ein Augenblickserfolg gelungen. Er hat bewiesen, daß es von der Avantgarde zur Volkstümlichkeit eine echte Brücke geben kann – vielleicht sogar nicht nur jene über die „fabindunxbaun en otagring“, über deren „bruknglanda“ er sei „heazz“ warf…
Gerhard Fritsch, Die Presse, 11.5.1958
Hans Carl Artmann
– Ein Wiener Lyriker unserer Zeit. –
Innerhalb eines Jahres hat nun der 37jährige Wiener Hans Carl Artmann, dessen Namen bisher nur Eingeweihten bekannt war, die zweite Stelle dieser Erfolgsliste neuer Autoren nach 1945 erreicht. Im vergangenen Herbst war sein Buch Med ana schwoazzn Dintn – Gedichta r aus Bradnsee (Mit schwarzer Tinte – Gedichte aus Breitensee, verlegt bei Otto Müller) in Wien, Salzburg und anderen österreichischen Städten nach Boris Pasternaks Dr. Schiwago das bestverkaufte Buch; hinzu kommt der Schallplattenerfolg (Auf ana schoazzn Blodn). So scheint es Artmann nun (und glücklicherweise noch zu Lebzeiten) ähnlich zu gehen wie dem skurrilen Fritz von Herzmanovsky-Orlando, der zuerst jahrzehntelang belächelt wurde, ehe seine Bücher als Quelle eines viel tieferen und gar nicht mehr mitleidigen Lächelns entdeckt wurden.
Wo liegt die Ursache für den spontanen Erfolg Artmanns? Das Neue, das Einzigartige an seinen Mundartgedichten ist: er hält die Sprache im Augenblick des Entstehens fest; da, wo sie Sprache wird, wo sie am lebendigsten, am ursprünglichsten ist. Er hat den Dialekt an der Wurzel gepackt, wo er aus sich selbst, dichtet, wo er bei jeder Konfrontation mit der Wirklichkeit originär eine bildhafte, plastische Wendung hervorbringt, in der dieses Stück Wirklichkeit enthalten ist. So kommen uns alle seine Erfindungen und Neuschöpfungen ganz selbstverständlich vor: die Sprache erfindet für ihn, er braucht nur den Mund aufzumachen.
Nun, da wir die Gedichte Artmanns kennen, die den Wiener Dialekt für die moderne Dichtung entdeckt haben, fragen wir ums: warum waren uns Mundartgedichte eigentlich so unerträglich? Der Grund ist wohl darin zu suchen, daß der Dialekt meist in diletantische Vorstellungen dessen, was Dichtung zu sein hat, hineingepreßt und also vergewaltigt wurde („Gedicht ist, was sich reimt“); auch schien die Beschränkung auf eine bestimmte Mundart automatisch eine geistige Beschränkung und eine Beschränkung der Themenwahl zu bedingen; so daß der Dialekt, in ein Ghetto gesperrt, nur ausgetretene Pfade tappen konnte. Der Schreiber eines Dialektgedichtes dachte meist, er müsse sich nicht nur in ein literarisches Schema, sondern auch in eine simple Mentalität hineinempfinden; die Produkte wirkten dann durch ihren gewollt biederen Tonfall albern und durch die Wiederholung derselben Motive eintönig.
Artmann dagegen, und das ist das Neue, bleibt er selbst, auch wenn er Dialekt redet; er läßt den Dialekt frei im Reiche des Surrealismus und des schwarzen Humors herumstreifen; da kommt es dann zu seltsamen Begegnungen und Paarungen. Die Themen sind oft makaber, wie die Gedichte vom Ringelspielbesitzer, der ein Vorstadtblaubart ist und sich, der toten Frauen wegen, fürchtet, nachts ohne Licht zu schlafen. Ein ganz anderes, sehr gespenstisches Wien kommt hier zum Vorschein, dessen Atmosphäre auch Filme wie Der dritte Mann nicht annähernd einfangen konnten. Die Verwandlung des Alltäglichen ins Unheimliche erreicht Artmann mit sprachlichen Mitteln. So wird aus dem Winterhafen an der Donau, unterhalb dessen eine Wasserleiche angespült wird (in dem Gedicht „dod en wossa“, einer Paraphrase zu Eliots „Tod des Phlebas“ im Waste Land) durch die überraschende Voranstellung der Worte „en heabst“ plötzlich ein metaphysischer Ort. Artmann muß nicht den Kosmos und das Milchstraßensystem bemühen, er kommt mit den Requisiten des täglichen Lebens aus, so zum Beispiel, wenn er die Stimmung „noch ana sindflud“ schildert: verfaulte Fensterbretter, ein paar ertrunkene Käfer, und der Geruch im Kino, in dem in allen Reihen Hai- und Walfische gesessen sind. In einem anderen Gedicht entsteht aus der gutbürgerlichen Sonntagsruhe, durch Aufzählung geschlossener Lebensmittelgeschäfte, deren Rollbalkon wie „Partezettel“ herabgelassen sind, durch das Fehlen von Maggiwürfeln, Salzgurken und Niveaschachteln eine geradezu existentielle Leere.
Man würde Artmann Unrecht tun, wollte man ihn nun, weil das erste Buch, das von ihm vorliegt (nach einem verschollenen Sonderdruck Sprüche, Reime, Formeln, und Kirchhoflieder), im Dialekt geschrieben ist, als Mundartdichter festlegen. Diese Arbeiten, zuerst eher Spielerei, schließlich mit wissenschaftlicher Exaktheit betrieben (bis zur Entwicklung einer radikal phonetischen Lautschrift, und eines umfangreichen Wörterbuches) sind nur Teil eines großen, noch nicht publizierten Werkes. Artmanns Leidenschaft gehört der vergleichenden Sprachwissenschaft; seiner ausgedehnten Kenntnis fremder und entlegener Literaturen verdankt ein Kreis junger Wiener Autoren vielfach Anregung.
Etwa 1950 begann sich eine Gruppe junger Schriftsteller, alle um die zwanzig, keiner älter als dreißig, regelmäßig zu treffen; in den Neuen Wegen, einer vom Theater der Jugend (einer Organisation, die Schülern verbilligte Plätze zu Burgtheater- und Staatsopernaufführungen besorgt) herausgegebenen Zeitschrift, hatte sie sich ein erstes Publikationsorgan geschaffen. Bücher lagen noch von keinem vor. Diesem Kreis gehörten an: Gerhard Fritsch, inzwischen mit vier Gedichtbänden und dem Roman Moos auf den Steinen hervorgetreten; Andreas Okopenko, dessen Gedichte (Grüner November) vor zwei Jahren bei Piper erschienen sind; Ernst Kein, der 1958 zusammen mit Herbert Eisenreich den Staats-Förderungspreis für Prosa erhielt; Friedrich Polakovics, der als Interpret Artmanns bekannt wurde. Zuweilen kamen zu den Zusammenkünften: Jeannie Ebner, von der im vergangenen Herbst der (zweite) Roman bei Kiepenheuer & Witsch herauskam (Wildnis früher Sommer); der Erzähler Herbert Eisenreich (Böse schöne Welt, bei Henry Goverts), der damals noch in der Zuckerfabrik in Enns arbeitete, um das schreiben zu können, was ihm vorschwebte; der Psychologiedozent Walter Toman, der bald eine Berufung an eine amerikanische Universität erhielt; seine Groteskgeschichten legte Biederstein auf: Bußes kleines Welttheater. Es traf sich also dort gut die Hälfte einer neuen österreichischen Schriftstellergeneration, die Hans Waigel dann in den Jahren 1951–1954 in seinen Anthologien Stimmen der Gegenwart I–IV sammelte.
Artmanns Stellung in diesem Kreis darf vielleicht in etwa der Pounds in London bei Anbruch des ersten Weltkrieges umschrieben werden. Er wirkte anregend und hinweisend; wenn auch das, was er vertrat, nicht immer und von allen hingenommen wurde und oft zu langen Debatten führte. Durch seine Kenntnis der großen Werke der Weltliteratur im Original war er den meisten überlegen; wer hatte schon Proust, wer den Ulysses, wer gar Finnegan’s Wake gelesen? Damals gab es kaum deutsche Uebersetzungen, von Pound war nichts da, gerade Eliot allgemein bekannt und Hemingway dabei, stilbildend zu wirken. Die Franzosen (Eluard, St. John Perse) kannte man dem Namen nach. Artmann schuf für uns erste Uebersetzungen, übertrug vor allem aus den weniger geläufigen Sprachen, so aus dem Spanischen (García Lorca, Ramón Gómez de la Serna, Rafael Alberti, Pablo Neruda). Daneben gehörte seine Liebe der alten keltischen Dichtung. Er reiste nach Spanien und Irland, um sich Bücher, die es in Wien nicht gab, zu besorgen.
Diese Uebersetzungen und Arbeiten der Gruppe, die den Neuen Wegen zu „gewagt“ erschienen, kamen in hektographierten „Publikationen“ heraus, die bis 1953 Okopenko und später Artmann betreute. Inzwischen stellte sich bei einigen der Erfolg ein, die Gruppe ging auseinander, die Publikationen gingen ein.
Nach seinen Mundartgedichten haben die (verstreut gedruckten, aber oft vorgetragenen) Husarengeschichten Artmann in Wien bekanntgemacht. Hier spricht der Dichter in der Maske eines barocken Chronisten zu uns; während in den Dialektgedichten das Breitenseer Idiom mit dem Surrealismus eine Ehe eingegangen ist, so hat sich hier skurriler, urösterreichischer Humor zu der Vagantengesinnung eines François Villon (dessen Gedichte Artmann übrigens ins Wienerische übertragen hat) gesellt – das Ergebnis reicht von der Erfindung toller Husarenlisten bis zur Beschreibung imaginärer barocker Wurstsorten. Wieder ist es die sprachliche Verwandlungskraft, die den Leser (oder Hörer) fasziniert; so wird einmal aus dem historisch greifbaren Amsterdam durch Aenderung eines einzigen Buchstabens die mythische Stadt „Amsteldam“, der Hafen der Amseln.
Was ist es, das durch diese Sprache ans Licht will? Die einfachsten menschlichen Erfahrungen, die jeder kennt: Freude und Schmerz; Liebe und Tod; Angst und Verlassenheit. Es ist befreiend, vertrauten Empfindungen in fremdem Gewand zu begegnen; und über das, was einen selbst betraf, lächeln zu können. In allen Verkleidungen spricht Artmann als ein abenteuernder Sänger zu uns, als ein Barde, den es aus vergangener Zeit zu uns verschlagen hat, der mit allen sprachlichen Ingredienzien experimentiert, vielerlei Kunststücke beherrscht und mit einem weitreichenden Repertoire sein Publikum ergreift und fesselt, indes es glaubt, bloß unterhalten zu werden.
Wieland Schmidt, Die Tat, 14.2.1959
Den Wienern kommt das Wienerische abhanden
–Vielleicht ist es die schönste Sprache der Welt, und vielleicht gibt es auch keine bösartigere und keine hinterlistigere. Wie poetisch sie sein kann, zeigte der Dichter H.C. Artmann. Nun droht der Wiener Dialekt zu verschwinden. –
Ein Ehrengrab auf dem Wiener Zentralfriedhof hat sich H.C. Artmann noch zu Lebzeiten per Gedicht verbeten. Poetischer war ihm die Möglichkeit erschienen, in einem Luftballon die letzte Ruhe zu finden oder in einem gestohlenen Damenschuh. Als der Dichter starb, ging dieser Wunsch nicht in Erfüllung. Man trug seine Reste auf den „windverwehten Grabsteinpark“ am Rande Wiens, wo Artmanns Asche mit allen Ehren, die die Stadt zu bieten hatte, ihre Ruhe fand.
Das war vor neunzehn Jahren, und seither scheint es um den Büchnerpreisträger und wienerischsten aller Poeten geradezu gespenstisch ruhig geworden zu sein. Einem Filmprojekt zum hundertsten Geburtstag Artmanns hat der immerhin mit Kultur- und Bildungsauftrag versehene Österreichische Rundfunk ganz offiziell eine Absage erteilt.
In den sechziger Jahren, so heisst es launig in einem Brief, sei der Dichter „äusserst populär“ gewesen.
Aber das ist schon lange her und Lyrik heute lange nicht mehr so beliebt wie damals.
Fazit:
Deswegen sind wir der Ansicht, dass Thema und Person nur mehr für Liebhaber, also eine recht kleine Gruppe, relevant sind.
Was sollen sich die modernen Zeiten um modernde Poeten scheren! Und auch wenn sich die „recht kleine Gruppe“ plötzlich als ganzes Heer von in- und ausländischen Artmann-Liebhabern herausstellt, gibt diese Posse dem verkannten Kenner der österreichischen Seele postum recht. H.C. Artmann hat das Ungemütliche des Wiener Gemüts durchschaut wie kein anderer. Er hat die besten poetischen Miniaturen aus der Grundschlechtigkeit der Wiener gemacht. Weil er sie kannte. Weil er einer von ihnen war.
Aufgewachsen in Wien-Breitensee, war der später zum „churfürstl. Sylbenstecher“ avancierte Schuhmachersohn genauso proletarisch wie die Vorstadt. Aber mit zartem Herzen. Begabt für das Schöne und das Böse, das man in den Breitenseer Lichtspielen sehen konnte oder auf den Vignetten der Karussells und Buden eines Wurstelpraters. Niederträchtige Gärtner, Blaubärte und „kindafazara“ (die Wiener Form des Kidnappers) hat H.C. Artmann aus dem Genpool seiner Landsleute gezogen, um sie poetisch ins Grausame zu verfeinern.
Artmann hat den Grossteil seines Werks selbstverständlich auf Hochdeutsch geschrieben. 1958 aber erschien med ana schwoazzn dintn, der Gedichtband, der Artmann zum Pop-Star unter den jungen Literaten machte und in dem sich Seltsames begab. Aus den Dialekt-Zeilen leuchtet der Vollmond über dem Breitenseer Schnee. Den Verliebten pocht bis zum Hals ein Herz, auf das es finstere Blaubärte abgesehen haben. Das ganze schöne Drama aus Liebe und Tod hat der österreichische Poet in Worte gefasst, die ein Kontinent für sich sind.
Der „ringlgschbüübsizza“ und die „gebuazzdoxkinda“, der „qaglschduazz“ und der „malfuanauman“ öffnen sich dem Eingeweihten zu einer dichterischen Pracht, die sie sonst nicht haben. Sonst hätte Artmann sie ja auch auf Hochdeutsch hinschreiben können: Ringelspielbesitzer, Geburtstagskinder, Käseglocke, Mädchenvorname. Und die Tauben, Schwalben, Amseln? Dauwaln, Schwäuwaln, Aumschln. Per „aumschl“ schickt der Poet seiner Liebsten einen Brief, und wenn er einmal nicht mehr ist, dann wird sie das merken:
a schwoazze lufft fola fegl
wiad med mein lezztn briaf augflogn kuma
Vielleicht kreisen um das Wienerische auch schon die Totenvögel. Es steht nicht gut. Der Dialekt verschwindet aus den Vorstädten, wo es wie in allen Vorstädten ist. Die Bevölkerung ist durchmischt, und die bisher über Generationen weitergegebene Sprache ist dort längst nicht mehr das einzige Idiom. Der Konformismus der neuen Offenheit bedroht dabei etwas sehr Spezielles. Eine Grammatik und eine Bildlichkeit, die auf spielerische Weise vom Wortwörtlichen ins Metaphorische kippt und wieder zurück.
Neben allem, was sie sonst kann, kommt diese Sprache auch aus dem Variantenreichtum der Hinterlist. Sie versucht alles menschlich Schlechte gleichermassen zu verbergen, wie sie es gleichzeitig decouvriert. Auch wenn es nicht immer schön ist, ist das Wienerische so poetisch, dass die Wiener Gruppe, der H.C. Artmann angehörte, nicht um dieses herumgekommen ist.
Die schwoazze dintn ist das avantgardistische Denkmal einer Sprache, die jetzt offensichtlich auch der Österreichische Rundfunk für marginal erklärt. Dessen blaubärtiges Ansinnen, den toten Dichter H.C. Artmann auch noch um sein Nachleben zu bringen, liesse darauf schliessen. In der schwoazzn dintn schlagen viele Herzen. Dort sollte der Staatsfunk einmal nachschlagen. Unter „ausdrocknz heaaz“.
Paul Jandl, Neue Zürcher Zeitung, 26.7.2019
med ana schwoazzn dintn
– Dialektgedichte von H.C. Artmann im Unterricht. –
Der Deutschlehrer, gleich in welchem Bundesland und in welcher Schulform er unterrichtet, ist gezwungen, Schülern Texte in ihrer Sprache zu erschließen. Die Sprache der Schüler vom Lande ist in ihrer aktiven Kompetenz weitgehend auf den Dialekt eingeschränkt; auf die Eigensprache, die nicht nur „normwidrig“, sondern schriftlich schwer anwendbar ist.1 Der Dialekt erscheint „rangniedriger“ als die „Hoch-Sprache“, ist gesprochene Sprache der Schüler aus unteren Schichten und ländlichen Gemeinden.2 Dialektsprecher übernehmen die Fremdeinschätzung und das Vorurteil, daß ihre Sprache ein geringeres Sozialprestige besitze.3 Der Dialekt sei mit dem Odium der sprachlichen und sozialen Minderwertigkeit behaftet, wodurch die Lernenden beim Erlernen oder bei der Festigung der Hochsprache wegen der Minderung des Selbstbewußtseins stark beeinträchtigt würden.4 Die Kremser Resolution der Tagung des Internationalen Dialektinstitutes gipfelt daher in folgender Forderung:
Der muttersprachliche Unterricht müßte wesentlich dazu beitragen, die personale Identität und Selbstfindung zu ermöglichen und dadurch die soziale Handlungs- und Sprachfähigkeit entscheidend zu fördern. Dabei muß unbedingt an die Eigensprache des Lernenden angeknüpft werden.5
Diese gesellschaftspolitische Problematik wird durch einen zusätzlichen Aspekt erweitert. Die Germanistik hat die theoretischen Grundlagen, die mundartliche Texte erschließen könnten, noch nicht geschaffen. Deren Grundlagenwerke fußen auf literarischen Texten der von der Alltagssprache abweichenden „gehobenen“ Literatursprachen. Absolventen sind daher kaum in der Lage, mundartliche Texte von Schriftstellern und Schülern anders als mit den an den genannten Texten erprobten philologischen Termini und Methoden zu analysieren und zu interpretieren. Allerdings erschöpft sich die Aufnahme von Literatur nicht im Erfassen der poetischen Struktur. Texte müssen mehr sein als bloß philologisches Objekt. Dem Lesen von Dichtung im Unterricht kommt kommunikative Funktion zu. Lesen als Form der Kommunikation sollte zur Selbsterfahrung beitragen.
Gewinnt der Dialekt ein neues Prestige? Geld- und Prestigegewinn erzielte vermutlich „Humanic“ mit seinem „Lustschrei der Nation“ „F r a u n z“ und H.C. Artmanns „papiarane Schdiifö“.6 Der Dialekt dringe „wie Wildwuchs in die Domäne des bisher Hochsprachlichen“, so Peter Pabisch.7 Vor diesem Trend zur Wiederaufnahme und Aufwertung des Dialekts machen auch die Behörden nicht halt.8 DIE ZEIT meint, daß Dialekt „in“ sei (Nr. 48/1976), und Der Spiegel spricht von einer „Dialekt-Renaissance in Deutschland“ (Nr. 17/1976).
Die Anfänge des Dialektbooms liegen in den 50er Jahren.
Gerhard Rühm erinnert sich:
der differenziertere klang gesprochener sprache, der umgangssprache, wurde entdeckt, die transformation des dialekts, seine ,surreale‘ bildlichkeit, etwa wenn man redensarten wörtlich nimmt. auch angeregt durch die einbeziehung volkssprachlicher elemente in den gedichten lorcas, wollte artmann entsprechendes mit dem wienerischen versuchen. gleich seine ersten ,dialektgedichte‘ begeisterten mich sehr und regten mich zu eigener produktion an. wir bemächtigten uns sogleich des makabren, ,abgründigen‘, das das wienerische grosszügig anbietet und widmeten uns mit genuss der schockierenden wirkung ungewöhnlicher zusammenhänge in vulgärem habi tus. die verfremdung des dialekts als kulinarischer alltagssprache durch ,abstrakte‘ behandlung, bis hin zu einer nur noch lautlichen erfassung des wiener dialekts, seines tonfalls, in ,imaginären dialektgedichten‘ bezeichnen weitere möglichkeiten. der dialekt war damit – im gegensatz zur bisher naiven dialektdichtung – als ein bestimmter, manipulierbarer ausdruchsbereich in den materialbestand der neuen literatur aufgenommen.9
Das 1956 erschienene Heft der von Hans Weissenborn herausgegebenen Literaturzeitschrift Alpha, das der Dialektdichtung gewidmet ist und Texte von Gerhard Rühm und H.C. Artmann enthält, war in kürzester Zeit vergriffen.10 1958 stellte sich H.C. Artmanns überraschender Erfolg der schwoazzn dintn11ein. Er fand sich, so Rühm,
sozusagen über nacht als bestsellerautor in aller munde. strassenbahnschaffner kannten seinen namen und zitierten aus seinen dialektgedichten; er wurde populär, wie es nur selten einem dichter in Österreich gelang – allerdings als ,dialektdichter‘, auf kosten seiner anderen arbeiten.12
Als Artmann im Jänner 1969 im Hörsaal des Wallistraktes der Universität Salzburg im Rahmen der Leselampe las, erzielte die Leselampe einen Besucherrekord. Der Kritiker der Salzburger Nachrichten schrieb:
In breiteren Kreisen hat sich noch nicht herumgesprochen, daß Artmann nicht nur der Verfasser des Buches med ana schwoazzn dintn ist.13
1974 hat die schwoazze dintn Aufnahme in die Weltliteratur gefunden.14
1959 veröffentlichten Friedrich Achleitner, H.C. Artmann und Gerhard Rühm hosn rosn bae; Texte im Dialekt. Dieses Buch, so Rühm,
erregte eher im negativen sinne aufsehen, so sehr es auch von einem gewissen kreis begrüsst und gepriesen wurde…15
1960 wurde im österreichischen Fernsehen das Dialektstück „donauweibchen“ von Rühm und Artmann unter alleiniger Autornennung Artmanns gesendet.16
Helmut Qualtinger sang in den 60er Jahren auf LPs Dialektlieder von Artmann und Rühm.17
In der letzten Dialektwelle, die um 1973 zu rollen begann, kam das Vorbild H.C. Artmann wieder in vielen Texten zur Geltung (Alfred Gesswein: „rama dama“, „augfeude schtod“; Albert Janetschek: „Wia dgrisdbarnzuggaln in süwwabibia“; Christine Nöstlinger: „Iba de gaunz oamen kinda“; Bernhard C. Bünker: „De ausvakafte Hamat“, „An Heabst fia di“; Hans Haid: „Pflüeg und Furcha“, „Mandle Mandle sall wöl1“; Ossi Sölderer: „Mid meine Augn“; Josef Zoderer: „S MAUL AUF DER ERD“).18 Die Texte bestätigen, daß Artmann mit seiner schwoazzn dintn eine wichtige literarische Strömung und Mode vorweggenommen hat.
Mit schwarzer Tinte schreibt Artmann längst nicht mehr. Der Zugang zu seinen neuen Texten ist schwierig. Seit er mit Tinte in allen Farben schreibt, ist seine Popularität gesunken. Den Salzburgern ist er eine Bereicherung des Stadtbildes, der älteren Generation eine Legende und die junge kennt ihn nicht. Die Kritik war mehr an der Person als am Werk orientiert, und die Wissenschaft brachte über die schwoazze dintn lediglich Aufsätze hervor, die auf Teilaspekte beschränkt sind.19
H.C. Artmanns med ana schwoazzn dintn soll durch zwei Arbeitsschritte erschlossen werden:
– durch eine Vergegenwärtigung der Entstehung und der Aufnahme;
– durch eine Analyse und Interpretation ausgewählter Texte von Schülern im Unterricht.
1958 erschien der Band im Salzburger Verlag Otto Müller, eingeführt vom Kunsthistoriker Hans Sedlmayr,20 der 1948 in der modernen Kunst ein Symptom des „Verlusts der Mitte“ sah,21 was angesichts der sittlichen „Abnormitäten“, der Abweichung von der Norm des Schönen, des Guten und Menschlichen,22 befremdlich wirkt. Eine Lesung in der Salzburger Residenz im Sommer 1957 wurde, so Rühm,
für artmann der anstoss zu ersten verhandlungen mit dem reserviert-konservativen otto-müller-verlag. aber es bedurfte noch intensiver bemühungen des sonst suspekten hans sedlmayr („verlust der mitte“), …23
Angeblich besorgte Sedlmayr die Drucklegung, nachdem seine Gattin, die Schlagersängerin Maria von Schmedes, im Funkhaus in Wien bei einer Aufnahme die Texte zum erstenmal gehört hatte und sofort „Feuer und Flamme gewesen sei.24
Friedrich Polakovics, ein Wiener Literat und Lehrer, bereitete gemeinsam mit Artmann den Band vor und exegierte ihn sorgfältig.25 Er war auch bei Lesungen Artmanns bester Interpret.
Der Erfolg des teuren Buches (1958: S 42,–) war sensationell, und das „in einer Zeit, da hierzulande Verkaufszahlen eines Lyrikbandes nur selten jene der Rezensions- und Dedikationsstücke überflügeln“, so Gerhard Fritsch im Mai 1958.26 Auch in finanzieller Hinsicht ein gutes Geschäft, denn der Verlag bekam einen Geldpreis und verkauft bereits die 8. Auflage mit 23 bis 26.000 Exemplaren.27 Das quadratische Format und der in Bildfelder gegliederte Pappdeckelumschlag erinnern im ersten Augenblick an Kinderbücher. Die Bilder stellen eine Reproduktion einer in den Dreißigerjahren überdeckten Wanddekoration eines 1957 demolierten Ringelspiels dar.28 Die Ringelspielbilder wurden auf einer der Vorstadtwanderungen „am beliebten weg ins liebhartstal“ von Artmann und Rühm erbeutet.29 Sie weisen auf den Inhalt der Bänkelliedertexte, zeigen neben dem „ringlgschbüübsizza“ in „vielfältiger Verlarvung“30 eine harfespielende Straßensängerin (Wiener „Urtlweib“?).31
Der Bänkelsänger trug oder sang auf einem Podest (Bank) eine Geschichte vor und wies mit einem Stab auf Bilder, auf denen die Geschichte, in Episoden zerlegt, dargestellt war. Die farbigen Schilder dienten weniger als optische Paraphrase des Gesungenen, mehr als werbewirksames Lockmittel.32 Der Einband der schwoazzn dintn dürfte in der selben Absicht gestaltet worden sein.33
Das Schriftbild der Texte wirkte „schockierend“. Die Rezensenten mußten „Hieroglyphen“ entziffern, hatten Basic-English, Chinesisch, Kroatisch oder eine Bantusprache zu übersetzen.34 Artmanns phonetische Schreibweise weicht von der Duden-Rechtschreibung stark ab. Artmanns Intention war:
Ich bin ganz bewußt zu einer eigenen, ganz spezifischen Dialekt-Orthographie gekommen. Diese Sprache muß man bewußt lesen. Man liest sie wieder und wieder und damit kommt dann die echte Beziehung zum Gedicht.35
Er findet mit den Graphemen des deutschen Alphabets unter Aussparung des v und des y sein Auslangen und verzichtet auf jene Hilfszeichen, die die Klangfarbe der Vokale wiedergeben sollen. Da das Wienerische die Vokale besonders stark färbt, kommt ohne zusätzliche Zeichen die Klangfarbe nicht zur Geltung, doch eine authentische Schreibung des Breitenseer Wienerischen würde nach Polakovics zwanzig neue Vokalzeichen erfordern.36 Ob die Transkription des Breitenseer Idioms phonetisch richtig sei, darüber stritten sich schon die Dialektexperten der „entern Grind“.37 Progressiv oder radikal konservativ, Avantgarde- oder Altherren-Germanistik-Sitten, sind die Kleinschreibung der Wörter und die fast gänzlich fehlende Interpunktion. Daher auffallend das häufige Vorkommen von zwei oder drei Punkten, die das Nichtausgesprochene signalisieren.
Das in jedem Band angefügte unterhaltsame, stellenweise sarkastische „Wörterbuch“ wurde jenen Wienern gewidmet, „die, durch ein widriges Geschick ihrer Muttersprache entfremdet, anders des nötigen Verständnisses entbehren müßten“.38 Auch nach Studium der Worterklärungen zwingt die Lautschreibweise den Leser zum Dechiffrieren der Wörter, den Dialekt stammelnd wiederzuerlernen, der sich alsbald auch Nicht-Wienern als vertraut erweist.
„Eigentlich sollten Artmanns Dialektgedichte ja nur gesprochen werden“, so Polakovics.39 Eine Lösung des Problems bot der Verlag jenen Rezipienten an, die den Kontakt zum Dichter übers Gehör (Lesungen) nicht schließen konnten, indem in den ersten Auflagen jedem Band eine Schallplatte (Single) beigegeben wurde. Einen weiteren Rezipientenkreis erschloß die Langspielplatte Kinderverzahrer und andere Wiener, Lieder, vertont durch Ernst Kölz und gesungen von Helmut Qualtinger.40
Die Lesungen verliefen „spektakulär“, die Boulevardblätter sangen das Lob:
Es war, als ob plötzlich der ,Halbwilde‘ von seiner Maschin’ gestiegen wäre, um nach Herzenslust nach dem Prinzip ,Schreibe, wie du sprichst‘ zu räsonieren.41
Die Kritik war bis auf wenige Ausnahmen euphorisch; sie nahm aber keineswegs, wie Alfred Treiber behauptete, Breitensee „wörtlich“.42 „Der Vergleich mit Weinheber liegt auf der Hand. Er stimmt nicht“, schreibt Otto F. Beer.43 „Nichts von der bürgerlichen Behäbigkeit des ,Wien wörtlich‘, so sehr Weinhebers Ottakring auch an Artmanns Breitensee angrenzt“, meint der Kritiker der Österreichischen Neuen Tageszeitung.44 Weinheber und H.C. Artmann. Es gibt keinen Vergleich zwischen beiden“, sagt Walter Pollak.45 Nur wenige Rezensenten behaupteten eine Verwandtschaft und einer beschuldigte Artmann der Nachahmung des „unvergeßlichen Josef Weinheber“.46 Die überwiegend positive Kritik kam m.E. durch die Auswahl relativ harmloser Texte durch den Otto Müller Verlag zustande.47 Artmann konnte auch keine weiteren Texte im selben Verlag veröffentlichen, obwohl die schwoazze dintn ein Bestseller wurde und einen Preis erhielt.48 Die Texte des im Wiener Wilhelm Frick Verlag erschienenen Gemeinschaftsbandes der Wiener Gruppe hosn rosn baa sind formal und inhaltlich progressiver bzw. aggressiver. Was in Salzburg von Artmann selektiert wurde, sind „Giftblasen“, denen kein Verkaufserfolg beschieden war.49 Überdies, der „völkische Hammer“ schlug zu.50
Wie ist der Erfolg noch zu erklären? Die Rezensenten betonten immer wieder das „Dämonische“, „Makabre“, „Böse“ und das „Nachtseitige“ der Gedichte.51 Die Wertung bezog sich vornehmlich auf die Bänkellieder, die Mordgeschichten und Liebesgeschichten, die meist einen unglücklichen Verlauf nehmen, beinhalten (S. 17–38). Der klassische Bänkelgesang wollte unterhalten, schockieren, aber auch belehren. Die Lieder hatten eine stabilisierende, affirmative Funktion. „Die Darstellung von Verbrechen diente als ,Blitzableiter‘ für die irrationalen, unsozialen und kriminellen Regungen der Zuhörer“, so Nina Matt.52 In Artmanns Texten fehlt die moralische Intention des Bänkelgesanges und der Moritat. An die Stelle von gerechtem Schicksal und heiler Welt tritt eine zwischen den Menschen und im Menschen unveränderbar gewalttätige Welt. Artmann dürfte m.E. mit diesen „zugkräftigen Nummern“ den engen Leserkreis von Lyrik gesprengt und Wirkung auch in Gesellschaftsschichten, die der Lyrik fernstanden, erzielt haben.
Die Wirkungsbedingungen und die Rezeption durch achtzehnjährige Schüler einer Höheren Technischen Lehranstalt sollen nun analysiert bzw. dokumentiert werden.
Den Schülern wurde freigestellt, während der Unterrichtseinheit Eigensprache oder Hochsprache zu gebrauchen, um nicht den einen oder anderen zu diskriminieren. Das Umsteigen von Breitenseer Idiom auf die Eigensprache dürfte den Schülern allerdings leichter fallen als auf die Hochsprache.
Um den Schülern, deren Leseerfahrungen durch Mundartdichtung, Expressionismus, Balladen, sozialkritische Literatur, moderne Lyrik sowie durch Propaganda- und Werbesprachen mitgeprägt sind, den Weg zum Verständnis der Texte zu ebnen, wurde der Rezeptionsvorgang didaktisch gesteuert. Auf der ersten Rezeptionsstufe lesen Lehrer und Schüler Texte; Schüler äußern sich spontan und erzählen Texte nach. Auf der zweiten Rezeptionsstufe soll in Gruppen die poetische Struktur ausgewählter Texte analysiert werden. Insbesondere die Entschlüsselung der in den Texten metaphorisierten Sachverhalte soll Verständnisschwierigkeiten überwinden helfen. Auf der dritten Stufe sollen Texte interpretiert werden. Unter Interpretation wird nicht ein detektivisches Suchen nach dem Textsinn, sondern Kommunikation über Themen, die für die Schüler eine Bedeutung haben, verstanden.
Einige „zugkräftige Nummern“ wurden von mir zwecks Beobachtung der unmittelbaren Wirkung vorgetragen. Die spontanen Äußerungen ließen darauf schließen, daß die Bänkellieder eine starke affektive Wirkung ausüben. Eine kritische Distanz zu den Inhalten wurde nicht hergestellt.
Nachdem die ersten Leseschwierigkeiten der Schüler überwunden waren, was durch wiederholtes lautes Vorlesen eines Schülers unter Mithilfe von Kollegen und mir in lockerer Atmosphäre gelang, wurden einige Texte nacherzählt. Es stellte sich heraus, daß die Texte keine Geschichten mit kontinuierlichem Handlungsablauf beinhalten. Elemente der Erzählung sind in der Reihenfolge ihres Auftauchens vertauschbar.
Artmann schreibt vor allem Rollengedichte, Gedichte, die eine Beziehung zwischen zwei Menschen, die Beziehung des Ichs zum angesprochenen Du, thematisieren. Die Monologe des Ichs konturieren eine Bewußtseins- oder Gefühlssituation. Sie entziehen sich nicht dem einfühlenden Nachvollzug.
Den Schülern wurde nun die Aufgabe gestellt, die Sprache der Texte hinsichtlich ihrer Ausdrucksmittel zu analysieren.
Da sich die Metaphern nur im Kontext leicht verstehen lassen, wurde zunächst die Bildung von Metaphern und Assoziationsfeldern untersucht. Das Ergebnis:
Das Adjektiv schwarz ist ein Assoziationskern, der mit den Substantiven Tinte, Brief, Baum, Vogel, Luft, Käfer und Auto zu sprachlichen Bildern des Themas Tod kombiniert wurde. Diese Metaphern stehen folglich immer in einem negativen Bedeutungs- oder Assoziationsfeld. Schwarz ist die Tinte des Mannes, dessen Herz „austrocknete“ (psychischer Tod) (S. 34), schwarz sind die Vögel, die das Unheil ankündigen (S. 35), schwarz wurde die Luft, als die Unheilsboten den Brief überbrachten (S. 35), kohlschwarz ist der Käfer, der den Frauenmörder reitet (S. 18), und schwarz wie ein Vogel ist das Rettungsauto, das zu spät kommt (S. 72). Das Bild Wasser der Donau steht zweimal in einem negativen Assoziationsfeld. Die Leiche der ermordeten Frau treibt in der Donau nach Albern (S. 18). In „dod en wossa“ wird ein Ertrunkener bei Albern aus der Donau gezogen (S. 70/71). In Albern befindet sich ein Friedhof der Namenlosen. Die Bilder Blut und Herz sind die Assoziationszentren, die entweder in einem negativen oder in einem positiven Bedeutungsfeld stehen. Vor lauter Warten trocknete dem Unglücklichen das Herz aus (S. 34). Dem Blaubart brennen im pochenden Blut die Kerzen, nachdem er schon zweimal beim Scherenschleifer war (S. 18); das Pochen des Blutes soll durch Küssen zurückgehalten werden, damit es nicht wie eine rote Amsel aus dem Hals springt (S. 31). Im Anfangsgedicht wird dem „Schmalz“-Dichter geraten, sich sein blutiges Herz herauszureißen, ehe er zu dichten beginnt (S. 7). Die Bilder Blut und Herz stehen demnach für Seelenschmerz, Triebhaftigkeit, Liebe und „Schmalz“. Das Adjektiv rot ist der Assoziationskern, der mit den Substantiven Tinte und Amsel kombiniert wird. Diese Bilder stehen im Vergleich zu den ambivalenten Bildern Blut und Herz ausschließlich in einem positiven Bedeutungsfeld. Die rote Tinte ist das Bild für das liebende Herz (S. 34) und die rote Amsel das Bild für das Pochen des Blutes der Liebenden (S. 31).
Die Verfahrensweisen Artmanns sind die Kombination, die Bildung von Metaphern und von sprachlichen Assoziationsfeldern. Durch die Einbettung von Metaphern in Assoziationsfelder erschließen sich die Themen der Gedichte.
Da die häufige Verwendung rhetorischer Mittel unverkennbar ist, wurde den Schülern nun die Aufgabe gestellt, häufig gebrauchte „Figuren“ zu nennen und an einigen Beispielen zu belegen. Das Ergebnis lautete: Häufiges Vorkommen von entgegengesetzten Bildern und Bedeutungsbereichen (Antithese), von parallel konstruierten Sätzen (Parallelismus), von Wiederholungen von Wörtern am Anfang mehrerer aufeinanderfolgender Verse oder Sätze (Anapher), von Wiederholungen derselben Aussagen in variierter oder umschriebener Form (Variation und Tautologie), von Einsparung von Wortmaterial (Aposiopese und/oder Ellipse); seltenes Vorkommen von Überkreuzstellung der Satzglieder (Chiasmus), von ungewöhnlicher Umstellung von Adjektiven (Enallage) und von Abstufung der Wortfolge (Klimax, Antiklimax).
Beispiele für den Einsatz kontrastierender Bilder und Bedeutungsbereiche:53
Mit schwarzer Tinte wird auf weißes Papier geschrieben (S. 34). Das Gespenst des Briefträgers, das einen weißen und einen schwarzen Brief mit sich führt, ist das eine Mal von schwarzen Bäumen und das andere Mal von weißem Schnee umgeben (S. 74). Ein einsamer Betrunkener liegt unter einem Christbaum, der im Scheine der brennenden Kerzen mit Engeln, Silberfäden und Windbäckerei behangen ist (S. 53). Der Rundfunk meldet einen Frauenmord, während der Blaubart gemütlich seinen Kaffee schlürft, und dem gemütlichen Kaffeekonsum am Tag steht kontrastierend die Furcht in der Nacht gegenüber, ebenso wie der „libesdraum“ dem „bek s me n hakal zaum“ (S. 17/18). In „an briafdroga sei gschbenzt“ (S. 75) verfällt Sprache in eine Antithetik formalisierter bildhafter Gegensätze:
lauta weissa schneeeeeee
lauta weissa schneeeeeee
lauta schwoazze baaaaaam
lauta schwoazze baaaaaam
Dieser Einsatz kontrastierender Bilder und Bedeutungsbereiche bewirkt eine dissonante Spannung und konfrontiert das Heimelige, Idyllische und Klischeehafte mit der Realität des Todes oder zumindest mit dem bitteren Ernst der Realität. Artmann schreibt mehr als nur Geschichten von „asozialen Typen“, er persifliert und kritisiert unter Benutzung der affektiven Wirkung des Kontrastes Heimatdichtung, die frei wird von Stallduft, der der konventionellen Mundartdichtung anhaftet. Das Anfangsgedicht in med ana schwoazzn dintn, mit deutlichem Bezug auf das literarische Programm, geht der konventionellen Mundartdichtung an die Gurgel (S. 7) und das in hosn rosn baa, mit Bezug auf das „weana gmiad“, ersetzt das Repertoire der Heimatdichtung durch an Anti-Repertoire: „faschimpöde fuasbrotesn“, „foeschs gebis“, „qagln“, und „es gschbeiwlad fua r ana schdeeweinhalle“ (S. 49).
Beispiele für die Verwendung weiterer rhetorischer Mittel:
heit kumst ma ned aus
heit muas ade griang
heit lok ade au wia r a fogal (S. 18)
do ken e nix
do giw e kan bardaun (S. 21)
kölaschdiang
kölaschdiang (S. 19)
Sätze werden schlagwortartig verkürzt und parallel konstruiert. Ein Wort oder eine Wortgruppe wird am Anfang mehrerer aufeinanderfolgender Verse oder Sätze zwei- oder dreimal wiederholt. Aussagen, Drohungen und Prophetien werden wiederholt, variiert oder umschrieben. Der Vollzug des Liebesaktes und die Vollstreckung des gefällten Urteils werden nicht verbalisiert.
Die formelhafte Sprache beschreibt nicht Mordabsichten, sondern verkündet Drohungen und gefällte Urteile. Meist verharren Prophetie, Drohung und Urteil in einem schwebenden Zustand. Der Vollzug des Liebesaktes, der Vergewaltigung und die Vollstreckung des Todesurteils werden der Phantasie des Lesers überlassen. Das Nichtausgesprochene, häufig durch Punkte gekennzeichnet, schafft Leerstellen, die nach Füllung der Geschichten verlangen (met da zitrechn haund / met de zitrechn aung / ans zwa drei… (S. 19). Im „besn geatna“ wird der Vollzug des Massenmordes mittels biologisierender Bildlichkeit ästhetisch überhöht (S. 21).
Die Schüler teilten sich in sechs Gruppen (A, B, C, D, E, F) auf. Den Gruppen A, B, und C wurde die Aufgabe gestellt, Bänkelliedertexte ihrer Wahl zu interpretieren.
Formelhafte und beschwörende Sprache, Drohung und Prophetie im Schwebezustand, Mystifizierung und Biologisierung von Sachverhalten, Moralabstinenz, kontrastierende Verfahrensweise, Identifikationsangebot, Leerstellenbetrag und die daraus resultierende Unbestimmtheit der Texte54 forderten folgende Deutungen der „zugkräftigen Nummern“ heraus:
Gruppe A:
Die Bänkelliedertexte (S. 17–21) beinhalteten verbalisierte Tagträume eines potentiellen Mörders; in ihm glaubten Schüler ein „zweites Ich“, das jeder Mensch besitze, zu erkennen. Das, was dieses personifizierte „zweite Ich“ von Durchschnittsmenschen unterscheide, sei die Fähigkeit, das in allen latent vorhandene ohne Hemmungen auszusprechen. Hinter einer biederen Maske würde die grausige Realität versteckt und vergessen gemacht; man müsse vor sich selbst Angst haben. Durch die „do reit me a koischwoazza kefa“-Metapher bringe Artmann den naturbedingt triebhaften Charakter von Agression zum Ausdruck. Die von Artmann suggerierte Naturgegebenheit von Ursachen und psychischen Vorgängen war Gegenstand einer kontroversiell verlaufenen Diskussion. Schüler der Gruppe B argumentierten, Artmann verschleiere durch Mystifikation und, biologisierende Bildlichkeit die wirklichen Verhältnisse in einem repressiven System.
Gruppe B:
Die Ursachen von Angst, Träumen und Mordlust würden auf Andeutungen reduziert: „wäu ma d easchte en gschdis hod gem“ (S. 17), „… / fua lauta woatn .. “ (S. 34). In einigen Texten mystifiziere Artmann Ursachen und psychische Vorgänge: „und des farfluachte messa / hod se gaunz fon söwa / griad ..“ (S. 20), „mei gmiad / is ma fadistad / waun da mond zuanema duad / i hoed s daun nima raus / mi glist s fost noch an bluad“ (S. 21), „heit brenan ma keazzaln / in bumpadn bluad“, „do reit me a koischwoazza kefa…!“ (S. 18). Artmann zeige keine sozialen Widersprüche auf, nenne keine gesellschaftlichen Ursachen von Angst, Träumen und Mordlust, moralisiere auch nicht und führe keine Trennung von „Gut und Böse“ durch. Im „besn geatna“ drücke sich das „schlechte Gewissen“ einer Generation, die Nationalsozialismus, Krieg und Mord durch Mystifizierung und Biologisierung zu bewältigen oder zumindest zu verharmlosen versucht, aus. Diese Deutung stieß bei einigen Schülern der Gruppe A und C auf Kritik; die einen lehnten die ihr implizierte Kollektivschuldthese ab, die anderen meinten, die aufklärerische Absicht sei nicht erkannt worden. Die Deutung wurde hartnäckig durch den Vergleich der Wirkungselemente der NS-Propagandasprache mit denen der Sprache Artmanns zu untermauern versucht. Eine m.E. richtige Erkenntnis enthielt das Gegenargument, sowohl NS-Propagandasprache als auch die Sprache Artmanns bedienten sich der Mittel der marktwirtschaftlichen Werbetechnik: der Verknappung der Sprache, der Wiederholung, der Variation und Tautologie, der suggestiven Formel, der Mystifikation und der Identifikation.
Gruppe C:
Die Schüler schlossen an die Analyse der kontrastierenden Bilder an, indem sie den „besn geatna“ mit dessen „guter“ Vergangenheit konfrontierten. In ihr seien im heimatlichen Boden die Blumen gewachsen und gepflegt worden. Als der Mond zunahm, d.h. die „neue Zeit“ heranreifte, entpuppte sich der Gärtner als Produzent einer Weltanschauung, durch die die Menschen, die „Gewächse des Bodens“, wie Unkraut ausgerottet wurden. Artmann habe die „Blut- und Bodenliteratur“ durch Umdrehung ihres Repertoires persifliert und kritisiert.
Gruppe B argumentierte, Artmann wolle durch das Mittel der Mystifikation das Morden des bösen Gärtners als unvermeidliches Zeitgeschehen verstanden wissen.
Gruppe D
interpretierte das Gedicht „des neiche blagat“ (S. 49), das in von Menschenhand geschaffenes „Ding“ zum Thema hat (Dinggedicht):
Die Nylonstrümpfe auf der Plakatwand bedeuteten für den Produzenten Verkäuflichkeit, für den künftigen Verbraucher, die Frau, Attraktivität. Dem Mann, der die Werbung betrachte, der die „gschdödn haxn“ in Nylonstrümpfen über seinem Bett aufhängen möchte, für sie ein Viertel Wein zahlen würde, stehen sie für etwas Abwesendes und Wünschenswertes. Diese „Dinge“ werden aber nicht beim Namen genannt. Nylons, fetischartiges Objekt, und die Beine seien Attribute, die – überm Bett – stimulierend wirkten. Zu einem Geschlechtsverkehr biete sich nicht immer eine Gelegenheit. Ein Schüler argumentierte, das Aufhängen von Attributen der Frau sei keine Demonstration von Enthaltsamkeit. Der Mann sei ein kontaktgestörter Mensch, der sich selbst befriedige. Im weiteren Gespräch ging es vor allem um die Frage, ob die Bedürfnisse immer spontan befriedigt werden müßten oder ob man die Bedürfnisbefriedigung hinausschieben sollte. Den Texten, die den Tod thematisieren, wurden von den Schülern das geringste Verständnis entgegengebracht. Eine Ausnahme stellte das Gedicht „dod en wossa“ (S. 70/71) dar, das von der Gruppe E aktualisiert wurde. Der Text wurde als Ankündigung des Selbstmordes eines Schülers gedeutet. In den Kinos lief einige Wochen der Film Der Schüler Gerber, im Fernsehen Tod eines Schülers und eine Wiener Tageszeitung brachte eine Serie mit dem Titel Krisenherd Klassenzimmer, die pauschale Anschuldigungen gegen die Lehrer enthielt.
Der Selbstmord zum Sommerbeginn und die Mutter seien die Schlüsselstellen, die den Inhalt des Textes der Deutung zuführten. Nur die Bindung an die Mutter, symbolisiert durch das von ihr auf dem Hemd angebrachte Monogramm, könne den Selbstmord am Schulschluß verhindern. Die Zeichen, die sich an der Wasserleiche bildeten, könnten „des schene blaue“ der Mutter nicht ersetzen.
Auf meine Frage hin, welche Stelle oder welches Wort sie mit Schulschluß verbinden, nannten sie den Sommerbeginn. Doch auch dieses Wort ist im Text nicht auffindbar. Die Schüler argumentierten, der Vers „und da suma woa laung“ – die Zeit, in der die Leiche sich im Wasser befinde – verweise auf den Zeitpunkt des Selbstmordes. Die „kleinliche“ Frage konnte das Gespräch über Schulstreß nicht blockieren.
Der Gruppe F
wurde „Greißler“ zum Schlüsselwort für Bedürfnis nach direktem Gespräch, sozialer Wärme und Geborgenheit. Sie interpretierten das Gedicht „wo is den da greissla?“ (S. 66/67) in diesem Sinne. Die herabgezogenen Rollbalken, die aussehen „wia batazeln aus wööblech“, symbolisierten den Tod der Kommunikation oder zumindest die Störung und Unterbrechung der Kommunikationsbeziehungen und der sozialen Nähe. „nua de radio san no doo..“, Massendistributionsmedien, die den Menschen durch Fernversorgung mit Informationen und Unterhaltung in eine rezeptive und kommunikationslose Position drängten und ihm als beherrschende Mächte gegenüberträten. In diesem angst- und frustrationsbeladenen sowie kontaktgestörten Zustand erschalle der Hilferuf:
„wo is den da greissla?“
Artmanns Sprache ist trotz Breitenseer Idioms keine gesprochene Alltagssprache, sie ist Sprache mit rhetorischem Grundcharakter, eine Sprache der ritualisierten Beschwörung. „Artmanns Dialektgedichte sind keine Dialektgedichte. Auch keine Wiener Gedichte, sondern Gedichte aus Wien“, so Polakovics.55 Die „dialektalen Blumen“ wurden von Artmann gepflückt und „von oben nach unten“, eingebaut in die poetische und rhetorische Struktur, als „Kunstblumen“ zurückgereicht.
Die rhetorisch durchgeformten Textstellen erzielten die größte affektive Wirkung. Die oft dreimalige Wiederkehr desselben Wortes oder derselben Wortgruppe, der Gleichlauf der Satzglieder in mehreren aufeinanderfolgenden Versen oder Sätzen, die Wiederholung derselben Aussagen in variierter oder umschriebener Form, die Verknappung des sprachlichen Materials und das Nichtaussprechen von Vollzug und Vollstreckung „hämmern“ Drohung und Prophetie ein, organisierten und bewirkten affektive Zustimmung und evozierten Ängste der Schüler. Erst im Verlauf der Analyse der Wirkungselemente bildete sich eine kritische Distanz zu den Inhalten.
Einig waren sich die Schüler in der Auffassung, daß viele Figuren Artmanns kontaktgestört, vereinsamt und isoliert seien, in schlechten Wohnverhältnissen lebten, eine gestörte Beziehung zum anderen Geschlecht hätten, sexuell „verstopft“ und frauenfeindlich seien, sich in einer öden Sonn- und Feiertagssituation befänden und eine krankhafte Beziehung zum Tod hätten. Basis für die Kommunikation zwischen Schülern einerseits und zwischen Schülern und Lehrer andererseits gaben nicht nur Themen und Schlüsselwörter ab, die sich mit der primären Lebenswelt der Schüler verbinden ließen, sondern auch die, die der Vergangenheit angehören, aber in die Gegenwart hereinreichen.
Die Texte sind offen für Deutungen aus dem Problem-, Gegenwarts- und Vergangenheitsbewußtsein der Schüler. Die Unbestimmtheit der Texte hat die Vorstellungstätigkeit der Schüler intensiviert, die Meinung einiger aber im Verlauf des Gesprächs bestärkt, sie würden nichts Konkretes „hergeben“.
Zwar wurde den Schülern freigestellt, während der Unterrichtseinheit Eigensprache oder Hochsprache zu gebrauchen, doch dominierten alsbald eigensprachliche Äußerungen. Im Gegensatz zum hochsprachlichen Unterricht, der immer in Gefahr ist, künstlich und verkrampft zu sein, erbrachte der Gebrauch der Eigensprache eine Aktivierung zur Mitarbeit, eine Entkrampfung und ein Einverständnis zwischen Lehrer und Schülern.
An der Vermittlung der Hochsprache als Erziehungsziel soll nicht gerüttelt werden, doch zeigte sich, daß dialektaler Sprachgebrauch mitunter angebracht ist, weil ihm besondere Qualitäten auf der Ebene der partnerschaftlichen Beziehungen zukommen.
Gert Kerschbaumer, aus Josef Donnenberg (Hrsg.): Pose, Possen und Poesie. Zum Werk Hans Carl Artmanns, Akademischer Verlag Hans-Dieter Heinz, 1981
GEMISCHTER SATZ MIT H.C. ARTMANN
In einem Garten drei Lieben
blond, bleich und schön.
Die dreimal lebten, dreimal starben
und Schuhe kaufen gingen.
Das Strömende aus der Frucht
zum Munde geführt: alles duftet
und perlt. Die Welt stinkt aus
den Gullys von Schönbrunn.
(Dass das Herz bebt am Praterstern
dass er sehr wohl aus dem Krieg kommt
dass er an den Händen nicht Blut hat
dass er auf Händen über das Wasser geht).
In einem Garten drei Wahrheiten
gemischt, verschnitten, versetzt.
Der Winzer hält sich den Bauch
und wir achteln den Satz.
Tom Schulz
Adi Hirschal, Klaus Reichert, Raoul Schrott und Rosa Pock-Artmann würdigen H.C. Artmann und sein Werk am 6.7.2001 im Lyrik Kabinett München
„Spielt Artmann! Spielt Lyrik!“ (Teil 1)
„Spielt Artmann! Spielt Lyrik!“ (Teil 2)
Fakten und Vermutungen zum Autor + Reportage + Gesellschaft +
Facebook + Archiv + Sammlung Knupfer + Internet Archive 1 & 2 +
Kalliope + IMDb + KLG + ÖM + Bibliographie + Interview 1 & 2 +
Georg-Büchner-Preis 1 & 2
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Brigitte Friedrich Autorenfotos +
deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf H.C. Artmann: FAZ ✝︎ Standart ✝︎ KSA
70. Geburtstag + 10. Todestag
Zum 100. Geburtstag des Autors:
Michael Horowitz: H.C. Artmann: Bürgerschreck aus Breitensee
Kurier, 31.5.2021
Christian Thanhäuser: Mein Freund H.C. Artmann
OÖNachrichten, 2.6.2021
Christian Schacherreiter: Der Grenzüberschreiter
OÖNachrichten, 12.6.2021
Wolfgang Paterno: Lyriker H. C. Artmann: Nua ka Schmoez
Profil, 5.6.2021
Hedwig Kainberger / Sepp Dreissinger: „H.C. Artmann ist unterschätzt“
Salzburger Nachrichten, 6.6.2021
Peter Pisa: H.C. Artmann, 100: „kauf dir ein tintenfass“
Kurier, 6.6.2021
Edwin Baumgartner: Die Reisen des H.C. Artmann
Wiener Zeitung, 9.6.2021
Edwin Baumgartner: H.C. Artmann: Tänzer auf allen Maskenfesten
Wiener Zeitung, 12.6.2021
Cathrin Kahlweit: Ein Hauch von Party
Süddeutsche Zeitung, 10.6.2021
Elmar Locher: H.C. Artmann. Dichter (1921–2000)
Tageszeitung, 12.6.2021
Bernd Melichar: H.C. Artmann: Ein Herr mit Grandezza, ein Sprachspieler, ein Abenteurer
Kleine Zeitung, 12.6.2021
Peter Rosei: H.C. Artmann: Ich pfeife auf eure Regeln
Die Presse, 12.6.2021
Fabio Staubli: H.C. Artmann wäre heute 100 Jahre alt geworden
Nau, 12.6.2021
Ulf Heise: Hans Carl Artmann: Proteus der Weltliteratur
Freie Presse, 12.6.2021
Thomas Schmid: Zuhause keine drei Bücher, trotzdem Dichter geworden
Die Welt, 12.6.2021
Joachim Leitner: Zum 100. Geburtstag von H. C. Artmann: „nua ka schmoezz ned“
Tiroler Tageszeitung, 11.6.2021
Linda Stift: Pst, der H.C. war da!
Die Presse, 11.6.2021
Florian Baranyi: H.C. Artmanns Lyrik für die Stiefel
ORF, 12.6.2021
Ronald Pohl: Dichter H. C. Artmann: Sprachgenie, Druide und Ethiker
Der Standart, 12.6.2021
Maximilian Mengeringhaus: „a gesagt, b gemacht, c gedacht, d geworden“
Der Tagesspiegel, 14.6.2021
„Recht herzliche Grüße vom Ende der Welt“
wienbibliothek im rathaus, 10.6.2021–10.12.2021
Ausstellungseröffnung „Recht herzliche Grüße vom Ende der Welt!“ in der Wienbibliothek am Rathaus
Lovecraft, save the world! 100 Jahre H.C. Artmann. Ann Cotten, Erwin Einzinger, Monika Rinck, Ferdinand Schmatz und Gerhild Steinbuch Lesungen und Gespräch in der alten schmiede wien am 28.10.2021
Sprachspiele nach H.C. Artmann. Live aus der Alten Schmiede am 29.10.2022. Oskar Aichinger Klavier, Stimme Susanna Heilmayr Barockoboe, Viola, Stimme Burkhard Stangl E-Gitarre, Stimme
Ausschnitte aus dem Dokumentarfilm Die Jagd nach H.C. Artmann von Bernhard Koch, gedreht 1995.
H.C. Artmann 1980 in dem berühmten HUMANIC Werbespot „Papierene Stiefel“.


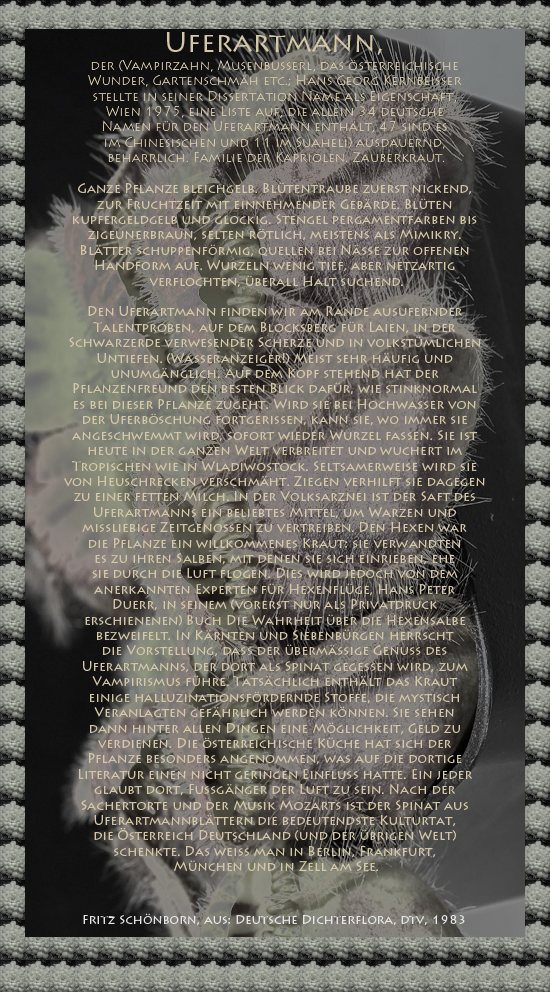












Schreibe einen Kommentar