Hans-Eckardt Wenzel: Antrag auf Verlängerung des Monats August
BEIM LETZTEN TON DES ZEITZEICHENS
Beim letzten Ton des Zeitzeichens
In der doppelten Nacht meines Zimmers
Öffnete ich, wie einen Gashahn,
Den Lautstärkeregler und ließ
Die gereizte Stimme des Kommentators
In mein verschlossenes Haus,
Wo ich es nicht lassen konnte, dieses
Warten, und ich wußte nicht, worauf.
So viele Worte und Töne, so viele Stimmen
Eroberten meine Festung, aber wie immer
Sagte keiner irgend etwas in all den fernen
Sendestationen, daß ich einschlafen konnte
Oder mich anziehen, aufgemuntert
Von eindeutigen Sätzen. Keiner
Sprach mit mir. Sie alle aus märchenhaften
Frequenzen ließen mich in der
Verschwimmenden Nacht zurück.
In dieser Verzweiflung brachte ich sie
Mit dem grünen Strich, der die Länder
Herholt und wegdrückt ins Rauschen
Auf der Skala möglicher Interpretationen,
Zum Schweigen, immer wieder zum Schweigen.
Ich wußte, daß sie den Satz nicht
Abbrachen, sondern unaufhörlich,
Ohne meine Gegenwart, weiter sprachen
Von Doppelten Rittbergern, Dissidenten,
Untergang, Freiheit; ja, das wußte ich,
So zufällig und fremd war ich.
Auch die Anrede: Liebe Hörer
Täuschte mich nicht, ich war
Nicht gemeint mit den
Psalmen und sinnlosen Chiffren
Einer ehemaligen Sprache. Nein,
Dies alles galt nicht mir.
Als meine Großmutter noch lebte,
Blickte sie oft stundenlang aufs diabolische
Muster des magischen Auges, befürchtend,
Die Flucht beginne wieder, aufgeregt
Suchte sie die Kurzwelle ab der nostalgischen
„Goebbels-Schnauze“, die weißen Strähnen
Im Gesicht. Damals erwachte ich, lauschte
Mit verschlossenen Augen dem Untergang
Fremder Schiffe. Diese Radio-Aktivität
Hielt mein Gehirn wach, ich dachte,
Dies alles gelte nur mir. Welche
Utopie. Welcher Irrsinn.
Der Sprecher im Radio antwortete
Nicht. Er zog sich die Jacke über,
Ging in die Kantine, trank Kaffee,
Setzte sich ins Auto, fuhr nach Hause.
Es war vierundzwanzig Uhr.
Der Nachtdienst besetzte die Studios,
Die Wellen des Glücks prügelten
Mich wütend in den Schlaf.
Und nun, über Jahre schon, immer wieder
Das angeblich letzte Zeitzeichen
Macht mich unruhig, denn nach dem
Letzten kam noch ein letztes und noch eins.
Vielleicht ist dieser Inkonsequenz
Meine Ausdauer geschuldet, mein Glauben
An einen noch nie ausgesprochenen Satz,
Das letzte Zeichen zum letzten Gefecht,
Wenn die Geigen mich nicht mehr vertrösten.
1) Ein geöffneter Brief
Lieber Herr A., Berlin, den 22.1.1986
vielen Dank für Ihren überaus interessanten Brief. Sie fragen, ob es nötig war, mein Buch ANTRAG AUF VERLÄNGERUNG … noch mit diesem „essay-ab-artigen Gebilde“ zu „verunreinigen“. Die „undisziplinierte Gedankenführung“ stört Sie ebenso wie mein „zielloses Wandern“ durch „zufällige Erkenntnisse“, „wahllose Zitate“; Sie erkennen keinen „Zweck, kein Ziel“, keine „Darlegung eines Problems“, keine „Analytik“, meine „ureigenste Position, Meinung“ wäre unauffindbar „verschüttet“, es fehle Ihnen Polemik…
Sehen Sie, es ist nie alles beisammen. Nach dauerhafter, pflichtgemäßer (nicht nur individueller) Lektüre meiner neuen Texte entdeckte ich ein Phänomen, dessen Ursache mich interessiert: Die Melancholie. Meine epikureische Traurigkeit, die sich besonders in den neuen Arbeiten übermäßig in den Vordergrund spielt. Ich muß mir eingestehen, daß es sich um keine Laune oder Stimmung handelt. Sogar bei grotesken oder satirischen Ausdrucksformen (von denen zu Ihrem „Vergnügen“ dies Büchlein „recht sauber gehalten wurde“) erblickte ich hinter jeder Grimasse ein trauriges Gesicht. Die Anhäufung nun vieler recht stiller, beobachtender (Klage-)Texte, die ihren Nährstoff in meiner Biografie fanden, machte mir dieses Zentrum deutlicher als zuvor. Der Gang meiner Überlegung (d.i. in diesem Fall oft das plötzliche Wiederkennen von Fundsachen) verdeutlicht ebenfalls meine Lage: Ich konnte nichts beschönigen (oder mit einem positiven Begriff gesagt: gestalten), begrifflich abheben, damit wäre mir nicht geholfen. Traurig kann nur sein, wer an der wirklichen Welt hängt, barbarisch verliebt ist in seine sinnliche Existenz, in den Genuß und den Ekel. Unsere Wirklichkeit wird durch Raum und Zeit bestimmt. Daß Zeit vergeht (auch spurenlos), macht traurig. Wer kann wohl länger die Luft anhalten zum Untertauchen: ein „gesellschaftlicher Widerspruch“ oder ein Mensch? Zeit kann eine dämonische Funktion erhalten. Nun ist Zeit zuallererst ein NAME, zu dem ich das BILD suchte, und das war erstaunlicherweise der Kreis. Ich ging dieser geometrischen Form nach, die ich unbewußt als Modell benutzte, um mir Prozesse im Verhältnis zur Zeit vorstellbar zu machen. Der Kreis aber ist eines jener bürgerlichen „heroischen Ideale“, die, je mehr sie im Gebrauch sind, einen Abstraktionsgrad erreichen, auf den wir uns nicht mehr bedingungslos einlassen dürfen, denn sonst findet das, was wirklich ist, keinen Platz mehr in unserem Denken, weicht Stück um Stück das Wahrnehmbare auf und verliert seine Prägnanz. Der Kreis ist ein Denkmuster, das nicht schulmäßig-systematisch etc. widerlegt werden kann, sondern dessen Macht und Herkunft aufgespürt werden muß. Nur so, glaube ich, können Denkstrukturen mittels leerer Abstraktionen aufgebrochen werden, um zu fruchtbaren Abstraktionen zu gelangen. Wie sonst soll die Generation, der ich angehöre, den Sinn ihrer Existenz im historischen Prozeß erkennen und kritisieren können, wenn sie in Begriffen denkt, die aus einer ganz anderen, anders bewegten und motivierten Zeit herrühren, wo gesellschaftliche Veränderung etwas anderes bedeutete. Andere Begriffe, die bereitstehen, unsere Unzufriedenheit in sich aufzunehmen, wie Etablierung, Anpassung, Realitätssinn etc. erzeugen nur Schuld- und Nichtigkeitsgefühle der Gegenwart gegenüber. Es geht also um keine primär theoretische Frage; praktisch: wohin kann ich in diesem neutralisierten Europa, auf dieser in Nord-Süd und Ost-West zerrissenen Erde meine Veränderungslust, meine Entdeckungsfreude, das Erlebnis des Lebens richten? Wie kann ich produktiv ausbrechen aus dem stoischen Kreislauf meines Lebens.
Sowohl die besondere Koppelung von Material als auch die assoziative, auf Widersprüchlichkeiten orientierte Anordnung von Eindrücken und Gedanken besitzen für mich Möglichkeiten der Entdeckung, die mir mit einer sukzessiven Methode versagt scheinen. Die Wahrheit liegt oft versteckt zwischen den einzelnen Versatzstücken, ist nicht formulierbar wie ein Lehrsatz, muß in einem kollektiven Prozeß gefunden werden. Einer alleine kann so was nicht. Denn die alten Abmachungen über Begriffe, in denen ein historischer Erkenntnisprozeß materialisiert vorliegt, sind fragwürdig; sie treiben zu einer Melancholie, deren Gründe nicht mehr auffindbar scheinen und in einem psychologischen Dschungel verschwinden.
Sie warnen mich vor „zuviel Benjamin“, vor „zuviel Theologie“; Benjamin liefere kein übernehmbares „Lehrmodell“. Mich hat nach der Lektüre der Benjaminschen Texte die Frage: wie konkret kann eine Geschichtsphilosophie überhaupt sein, tief berührt, hat mich wieder wach gemacht, meine Wahrnehmungen genauer wahr-zu-nehmen. Jegliches Interesse fehlt mir an einem philosophisch-scholastischen Rechtsstreit über Mängel und Vorzüge von Methodik usw. (Das brächte bloß eine geschickte Verdrängung der Melancholie ins Artistische!) Der Zustand unseres Denkens und unserer Sinne – das ist eine Fragestellung für mich.
Und ich möchte es in diesem Fall mit Goethe halten, der meinte, nur das könne wahr sein, was auch fruchtbar ist. Die Suche nach dieser Fruchtbarkeit erscheint mir darstellenswert. Daß ich damit „der Poesie keinen Dienst“ erweise, wie Sie meinen, ist mir vollkommen schnuppe! Warum das? – das wär einen anderen Brief wert.
Mit herzlichen Grüßen We.
Als derselbe und als ein anderer
vermag sich Hans-Eckardt Wenzel nach seinem Debüt Lied vom wilden Mohn (Förderpreis 1984) in seinem zweiten Gedichtband vorzustellen: heiter-ironisch, deftig, elegisch, verliebt, sehnsüchtig, utopisch… mit allen Saiten seines poetischen Instruments. Dabei verschont er uns nicht – verteilt mit seinen poetischen Vorschlägen (gerecht? ungerecht?) munter vom Fett, das (er) abbekam. Wenzel zieht seine Zwischenbilanz als Dreißigjähriger: Federn lassen oder Federhalter. Er öffnet die Schubladen im Kinderzimmer, blättert im Liebeskalender, sinniert nach über seinen neandertaler Zorn. Nach wie vor geht es ihm dabei um alles oder nichts. Für das Lebendig-Bleiben seiner Generation fordert er sogar einen (utopischen?) 32. August.
Mitteldeutscher Verlag, Klappentext, 1986
Poetische Erkundungen der Gegenwart
Steffen Mensching und Hans-Eckhardt Wenzel — zwei Dichter, deren Namen in keiner Besprechung junger Lyrik unseres Landes fehlen. Literaturwissenschaftler und Kritiker haben sich beider fast ausnahmslos freundlich angenommen. Auch beim Publikum finden sie Aufnahme. Dafür spricht nicht zuletzt die Nachfrage nach ihren jüngsten Gedichtbänden, Tuchfühlung von Mensching und Antrag auf Verlängerung des Monats August von Wenzel. Und das in einer Situation, in der Lyrik nicht unbedingt zur bevorzugten Lektüre gehört und der Leser unter einem breiten, vielfältigen Angebot wählen kann.
Mensching und Wenzel treffen trotz vieler Gemeinsamkeiten jeder auf seine Weise – den Ton, der „ankommt“. Die Autoren verarbeiten soziale Erfahrungen, mit denen sich viele Leser identifizieren. Im Klappentext zu Menschings Buch wird auszugsweise ein Gespräch wiedergegeben, das Christian Löser für die NDL mit dem Autor führte. Mensching sagte damals:
Ich versuche so, Handlungen aufzeigend, Haltungen vorzustellen, zu denen sich der Leser/Hörer in Beziehung setzen kann…
Sicherlich trifft das auch auf Wenzel zu. Mensching und Wenzel nutzen seit Jahren die Möglichkeit, sich mit verschiedenen Programmen direkt dem Publikum zu stellen.
Die Debüts von 1984, Erinnerung an eine Milchglasscheibe (Mensching) und Lied vom wilden Mohn (Wenzel), haben mit Recht Erwartungen geweckt. Der Qualität jener Bände wegen, aber auch in Hinsicht darauf, wie sich neue Erfahrungen in den lyrischen Arbeiten niedergeschlagen haben. Denn immerhin, man darf es nicht übersehen, ist sowohl Mensching als auch Wenzel inzwischen dem Jugendalter entwachsen. Jahrgang 1958 der eine, 1955 der andere. Beide haben gefestigte ästhetische Positionen, die in Aufsätzen und Gesprächen nachzulesen sind. In bezug auf Reflexion über das eigene Schaffen sind sie innerhalb ihrer Generation am weitesten gekommen.
Mir scheint dieser Hinweis zum Verständnis der jüngsten Gedichtbände von Mensching und Wenzel wichtig zu sein. Die Autoren sind um die 30, in einem Alter also, in dem allgemein Erreichtes und Nichterreichtes im bisherigen Leben gegeneinander aufgewogen wird, eventuell eine Korrektur übersteigerter Wunschvorstellungen erfolgt. So finden wir auch in den vorliegenden Büchern, daß Persönliches stärker in den Vordergrund tritt. Zweifellos Ausdruck eines gewachsenen Selbstbewußtseins, aber auch der Notwendigkeit, sich selbst zu befragen. Dabei haben beide Autoren nicht den Gestus des Drängens, der Unduldsamkeit verloren. Insofern erfüllen sie eine Erwartungshaltung. Beide setzen auf Reibung statt auf Glättung, um Wirklichkeit dialektisch zu erfassen.
(…)
Selbstbefragung auch bei Hans-Eckhardt Wenzel. An verschiedenen Stellen erfahren wir von zunehmender Melancholie. „Traurig kann nur sein, wer an der wirklichen Welt hängt, barbarisch verliebt ist in seine sinnliche Existenz, in den Genuß und den Ekel“, schreibt er im Anhang zu seinem Essay „Uhrengeschäft“ „Ich lebe gern“ heißt es in dem Gedicht „Geschwindigkeitskontrolle“: Aus dieser Liebe zur „sinnlichen Existenz“ ergeben sich für ihn Fragen nach den Möglichkeiten des einzelnen, Lust und Unlust auszuleben. Ironie, auch Selbstironie – die Maske des Clowns – sind ihm Mittel, nicht im Lamentieren zu verharren. Die von Wenzel bevorzugte Liedform ist zweifellos geeignet durch eingängige Rhythmen und mit einfachen Worten Stimmungen überzeugend mitzuteilen. Der Gefahr, statt einfach zu sein zu vereinfachen, entgeht er dabei nicht immer.
Hervorzuheben ist Wenzels Essay „Uhrengeschäft“. Eine Auseinandersetzung mit dem Problem der Zeit, mit Vergänglichkeit und Fortschritt. Interessant ist, wie Wenzel Gedanken verschiedener, auch weltanschaulich auf unterschiedlichen Positionen stehender Dichter und Theoretiker für sich produktiv macht. Er setzt fort, was er mit dem Essay „Chiron oder die Zweigestaltigkeit“ im Debütband begonnen hat.
Menschings und Wenzels jüngste Bücher haben die Erwartungen an sie sicherlich erfüllt, insofern wir auch hier die enge Verknüpfung von Persönlichem und Gesellschaftlichem finden. Die Auseinandersetzung mit der Dialektik von Ideal und Wirklichkeit ist weitergeführt worden. Ich nehme diese Bände als Angebot unter dem Gesichtspunkt des Dialogs zwischen Lesern und Autoren. Dieser schließt Streit ein, Hinweise auf Stärken und Schwächen.
Michael Hähnel, Neues Deutschland, 18.11.1987
Das wäre ja neu; daß wir loben, was uns aufstacheln will
Mensching und sein Kompagnon Wenzel (oder umgedreht?) sind auf diesen Blättern ein wenig gezaust worden weiland. Lob ist eine süße Sache, und wer wüßte nicht, daß an Süßspeisen eine Prise Salz gehört? Wer hat nicht schon, nach Parfait und Sahnetorte, mit Wollust in eine saure Gurke gebissen? Die Autoren und ihr Verlag ließen sich’s nicht verdrießen und legten binnen kurzem die zweiten Bände vor. Da habt ihr! Da haben wir nun. Hat’s geschmeckt? Ist’s bekommen? Schlägt’s an?
Um gleich Auskunft zu geben: Ja, es hat geschmeckt. (Die anderen beiden Fragen sind so kurz nicht zu beantworten…). Es hat geschmeckt, nicht all und jedes, aber Rezensent fand in beiden Töpfen genug für seinen Appetit – der von den ersten Bänden angereizt war. Er fand auch Zweifel bestätigt, Rückfragen genährt, und er denkt, daß es den Autoren darin ähnlich gehen wird. (Er nahm auch Anlaß zu Zweifel und Rückfrage an sich selbst. Hat sich der Autor, fragt sein eines Ich, der Leser, das andre, also ich, bewährt?) Nun denn –
Weniger spektakulär als beim Debüt kommen; die beiden nun daher, weniger (noch weniger?) „geschlossen“ wohl auch – Das mag daran liegen, daß der Reiz des Neuen fehlt und Bewährung und Fortführung gefragt sind. Beide Autoren sind nun um 30, und wir wollen uns freuen, daß es wieder Dichter gibt, die mit 30 nicht mehr Debütanten sind (und Verleger, die’s möglich machen). Man merkt’s den Büchern an, beiden. Die Autoren haben etwas hinter sich, haben Lob und Tadel erfahren, Positionen besetzt, nun gilt es Rückblick und Ausblick. In beiden Büchern Bilanzgedichte. Wenzel:
Ich öffne den grünen Schrank meines Kinderzimmers,
die Grabkammer meiner ägyptischen Zuckertüte,
Das Album, und nehme Abschied.
(…)
Dies alles gehörte einst mir
(„Abschied“).
Soviel Trödel („Die vollständigste Versammlung von Trödel / und Erinnerungen ist die Erde.“), unerfüllte Versprechungen, Prophezeiungen, Schlüssel ohne Schatulle, Unordnung – „ängstlich / Greift die Hand ins Vergangene, / in die Ruinen aus Zeit.“ Aber es fällt doch schwer, sich zu trennen von all den „Stempelkissen und Spendenmarken“, den „Trikoloren / Unter den Kaffeefiltern“. Schuld an allem bin ich (denn „alle schieben’s auf mich“, die Lebenden und Toten, siehe „Amtliches Schuldenbekenntnis“: Wenzel bleibt sich durchaus treu), und dennoch, auch wenn die Feen müde geworden sind, die Zauberer schweigen:
Das ist alles kein Grund zur Verzweiflung.
Einmal aber, und dieser Tag wird kommen, fliegt
der tote Schmetterling aus der Schachtel
Davon, denn in der Stunde des Abschieds
sind die Fenster geöffnet.
Nicht in jedem der neuen Gedichte wird der Vorgang so beim Wort genommen, der Gestus durchgehalten, und der gar nicht platte, der surreale Schluß reißt das Ganze zu Weiterungen auf. Benjamin/Klees „Angelus Novus“, der dem Band als Motto dient, im Hintergrund. Ähnlich das Gedicht „Sonntag“, Sonntagskinds Lebensbilanz und Ausblick. Wie war das doch, als ich ankam, hitzig, Mutter, was deinen Sohn „Anfällig gemacht (hat) für den Herbst, die Kälte, / Für die nebligen Monate des Verrats“? Zeiten, als er noch Vertrauen in Fliehkräfte hatte, als er „Mit einem Schritt die Erde bereisen (wollte) / Und alles in Ordnung bringen.“ (Wie Mensching, Partner schon damals, denn: „Als ich / 25 Kilo wog, war ich Gruppenratsvorsitzender, / ein semmelblonder Anarchist / mit blauem Halstuch. Mit einem Katschi aus Draht / kämpfte ich / gegen Piraten, Indianermörder, Faschisten und alle / andern Schweinehunde / dieser Welt.“), Ja, und die Zeit ist vorbei; auch wenn er’s noch nicht ganz einsieht, Wenzel, dieser „Dogmatiker besserer Zeiten“, und nicht Ruhe geben will – er muß; denn er wird. „Landschaften voller Plakatwände. / Fotografien genormter Freude, / Verschrobene Losungen“, okay, und er muß sich nun fragen (uns!):
Was hat er all die Jahre getan?
Warum hat er nichts ausrichten können?
Er wurde gar nicht gebraucht.
Man hatte es nur so gesagt.
(Hat es gesessen? Schlägt’s an?) Wenzel hat Wichtiges zu sagen, und er sagt es dicht, hier. Er macht es sich und uns nicht leicht (wie man gern sagt), er schwimmt nicht oben (Cummings: „Allein der Sportfisch schwimmt stromauf.“ Und: „Nichttotsein ist nicht Amlebensein.“) Er sucht nach Bedingungen für Leben, das mehr als bloß überleben ist, mehr als dahinleben. Er bilanziert. Sieht sich um.
Er sieht die schönen Mädchen
Das Haar ans dem Gesicht streichen,
Wenn sie die Straßen überqueren;
Er sieht weißhaarige Frauen,
Die ihn traurig machen, und er sieht
Betrunkene am Kiosk und eilig
Laufende Männer, die nach teurem Deo-Spray duften. Dein Sohn
Sieht nur noch!
Und nichts weiter.
Dagegen ist aufzubegehren, und es ist zu fragen, was geschehn ist und was wird. Der Aufstand der Trauer, der Freude, der Sehnsucht:
Hörst du nicht, wie er immer wieder
Seinen Kopf voller Sehnsucht
Gegen das S-Bahn-Fenster schlägt?
Ein Mitkämpfer, der „stirbt, wenn man sich ihn fangen will“. Mensching hat die Pole dieser Haltung, anläßlich eines frühen Gedichts von Wenzel, das Mühsam gewidmet war, beschrieben, er nannte es „ein – allerdings öffentlich ausgestelltes – individuelles Kampfprogramm“, und er hat Mühsams Gedicht „Streit und Kampf“ zitiert:
Nicht nötig ist’s, nach Schritt und Takt
gehorsam vorwärts zu marschieren.
Doch wenn der Hahn der Flinte knackt,
dann miteinander zugepackt
und nicht den Nebenmann verlieren!
Gut, das ist die Kontinuität; doch eine Sache für forsche Bekenntnisse ist das nicht. Streit und Kampf, nun ja: Streit ist vielleicht zu haben, aber wo ist der Kampf? Der Nebenmann; aber der Mitkämpfer? Das ist die Situation, vor der beide, Wenzel und Mensching, jetzt stehen, und sie wissen es. In ihren besseren Texten zumindest. Daß der Schluß des angeführten Gedichts im Vagen landet – sind’s nur die literarischen Nerven, mangelndes Sitzfleisch oder Schlamperei? Zuvörderst ist es die real vorhandene Klippe: nach der Forcierung des Talents das Land zu halten/zu baun. Sich der Besitzstände versichern. Sehnsucht gehört dazu, Trauer. Lebenslust und Sinnlichkeit. Das ist da, und damit ist zu arbeiten.
Das geschieht hier in vielen Texten im Thematischen, und es spiegelt sich nicht minder im Poetologischen wider, im Pendeln zwischen Reflexion und Sinnlichkeit. Wenzel scheint ein eher „sentimentalischer“ Dichter (aber zur Problematik solcher Begriffe weiter unten), dem aber gleichwohl schöne Texte gelingen, die vom Vertrauen auf den Gegenstand getragen werden – sei’s das Haar der Geliebten oder der Löwenzahn (ja – bei aller Gewichtigkeit, bei aller schuldigen Aufmerksamkeit für die großen Themen dieses Dichters wollen wir das schöne Detail, die kleine Geste, das Schüsselchen Löwenzahnsalat nicht geringachten), sei’s ein Zanderessen, ein verlassenes Bett, ein gewöhnlicher Tag mit ganz unmetaphorischem Schnee. Schön auch, wie ein kleines, privates Erlebnis, die verfrühte Ankunft der Geliebten, zur utopieträchtigen Reflexion über die „Zukunft unserer Sinne“ führt:
Werden sie vielleicht doch einmal nach allen verfeinerten Spezialisierungen der Zivilisation, dachte ich, diese in Tausende Bilder und Fakten zersplitterte Welt begreifen können, anschaubar machen, was unseren jetzigen Augen noch versagt ist, sehen? Vielleicht, in den späteren Berichten Homers, wird Penelope, während sie mit dem verkabelten Computer erfolglos nach ihrem Liebsten fahndet, die Freier trotzdem aus dem Haus jagen, nicht aus starrsinniger Treue. Ja, wahrhaft, voller Aufregung erwarte ich diese unbekannten Wahrheiten…
(so im dichten Prosa-„Orakel Nummer April eins“).
Bilanz auch bei Mensching, vor allem in dem meiner Ansicht nach wichtigsten Text des Bandes, dem Poem „Von mir aus“, Rückblick und Ausschau in dreifacher Hinsicht: biographisch, geschichtlich, poetologisch. Sein Schicksal, das seiner Generation, seiner Welt: „wie geschah es wie geschahs“ mit mir, und „mir war klar daß ich ein Deutscher war / und mir war klar / daß wir sehr alt werden müßten um zu begreifen / was mit uns geschieht“. Und zwar geschieht nicht mehr und nicht weniger, als daß einer sein bißchen Biographie, sein bißchen erlebter / angelesener Welt mobilisiert in einem Augenblick, wo es entgegen allem Anschein der „allgemeinen / kontinentalen / Verhärtung“ auf die sechste Ziffer hinter dem Komma ankommen könnte. Das mehr als 20 Seiten umspannende Gedicht ist eine einzige atemverschlagende surrealistische Montage – surrealistisch im Sinne Benjamins, der, wie Mensching im Gespräch zitiert, darauf aufmerksam gemacht hat, „daß surrealistische Dichtung nicht primär als Gedankenexperiment, als auf den Skandal angelegte Produktion zu verstehen ist; sie kommt aus der in sich chaotischen und sich widersprechenden Wirklichkeit der Großstadt, in der das tragischste Moment des Verkehrsunfalles neben dem Zeitungsblatt von vor sechs Tagen und dem Hund eines Börsenmaklers erscheint. Die Dinge kommen willkürlich zusammen und ihr Nicht-Zusammenpassen läßt eine viel tiefere Einsicht in soziale Bewegungen und Vorgänge, ein viel genaueres Hinterfragen zu als ihre logisch konstruierte Zuordnung.“ Soweit also Mensching, mit Benjamin, und er hat an dieser Stelle (Interview mit Christel und Walfried Hartinger) auch klargestellt, daß es nicht um mechanisches Ineinssetzen, sondern eher um eine „Weiterentwicklung der von den Surrealisten gefundenen Schreibweise geht, gewissermaßen um eine Umstülpung insofern, als wir es bei uns mit anderen sozialen Erfahrungen, auch sehr unvergleichbarem Wirklichkeitsmaterial zu tun haben.“ Das Gespräch wurde im Juli 1985 geführt, die Erinnerung an eine Milchglasscheibe war erschienen und hatte Furore gemach und jetzt konnte/mußte er mit seine Prometheus fragen, „warum wieso wieweiter“. In diesem Umkreis, ich weiß nicht, ob vorher oder nachher oder dabei, ist das Poem entstanden. Viele Stichworte des Gesprächs treffen wesentliche Probleme der Dichtung. Da ist von den Erfahrungen der Schulzeit die Rede, wird versucht, die Spezifik der eigenen Generation, der 1965 zur Schule gekommenen, im Unterschied zu den 1968/70 Nachrückenden zu bestimmen, was insbesondere das Verhältnis zu „gemeinschaftstiftende(n) Ideale(n)“ betrifft, wird gefragt, ob der bisher entwickelte Gedichttyp, ob die „gewisse Abgeschlossenheit und Fertigkeit der Texte“ tauglich sei für die Aufgabe, „die Widersprüchlichkeit, jenes Sich-Überlappen und Bekämpfen von verschiedenen Haltungen, Erfahrungen, von Zeitphasen usw. auch erkennbarer in ihrer Zerrissenheit darzustellen“. In diesem Zusammenhang wird die Tradition neu befragt, Mensching sieht bei den Surrealisten nach, bei Cardenal, Ritsos, Nezval… Nicht zuletzt geht es um eine neue Verbindlichkeit, um die Frage der Brauchbarkeit seiner Arbeit. Mit Blick auf die Aufnahme des ersten Bandes stellt er fest, daß er „teilweise nur sehr partiell analysiert oder global untersucht worden“ sei, daß „bestimmte Texte nur selten wahrgenommen werden, sondern immer nur eine Gruppe von Gedichten. Da entsteht eine gewisse Zweiteilung, die mir nicht so behagt, weil ich das Gefühl haben muß, für bestimmte Aspekte einvernommen zu werden“. Solche Überlegungen also setzten die Aufgabe, und wie wird sie gelöst? (Und wie lösen wir sie?)
Die „Selbstprüfung aus gegebenem Anlaß“ ist kein privates Scherbengericht. Sie geht uns mehr an als uns vielleicht lieb ist. Mehr als der biographische Rahmen eigentlich hergibt: Schule Bücherrücken Mädchenbrüste Winkelemente Schlitzohren asiatische Gewürze und und –
und das Geschichtsbuch unterm Kopfkissen der Fernseher mit den Panzern in der Prager Vorstadt die Abschiedsbriefe der Hingerichteten Stalinorgeln Entspannungspolitik – –
und Stalin Beria Che Guevara Cardenal Roosevelt Gagarin Trotzki – – –
alles das, einerseits, im verzweifelten Bemühen des Hineingeborenen um Welt, so generationstypisch wie vielleicht und gleichwohl vielen Gleichaltrigen eher fremd, wie es andererseits die Grenzen seiner Biographie, seiner Generation, ja seines kleinen Landes sprengt. Die Annäherung an Gestalten der Weltgeschichte etwa ist hier mehr als die forsche Geste, als die sie erscheinen mag. Zwei Passagen mögen dafür einstehen, Stalin:
aber Väterchen Väterchen ich war der letzte der
behauptete
du wärst an allem schuld
auch deine Fehler hatten einen gewissen Abstraktionsgrad
erreicht
ich las in der Zeitung du sollst Fehler gemacht haben
es klang so als wärst du dreimal am Nowski-Prospekt
bei Rot
über die Fahrbahn gelaufen
–
Roosevelt klebte seinen Kaugummi unter den
Verhandlungstisch
vor fünfzig Jahren
niemand hat es bemerkt nur ich der ich mich schon
damals
in Dinge mischte die mich nichts angingen
Nicht die Leerstellen seiner Biographie – die offenen Enden unserer Geschichte sind gemeint. Der sich hier zum Einmischen bekennt, der um Haltung ringt – er benennt und berennt unsere Haltungen. (Das alte liebe Mißverständnis: die Dichter legten ihre Probleme auf den Tisch, damit wir die unsern vergessen können). Der ruft uns an, Geschichte zu erinnern, um die Gegenwart zu bewältigen, Rissen nicht auszuweichen, Widersprüche produktiv zu machen, mit allen wirklichen Reibungen. Diskussion von Haltungen findet statt: „ich nicht sagte er ich sage nun was ich denke (aber was / er dachte / war schon nicht mehr von Belang)“, – „ohne Zweifel war es falsch davon zu sprechen ohne / Zweifel / falsch / länger darüber zu schweigen ohne Zweifel“. – „viele waren weggegangen jetzt dachte ich könnten wir / verlangen anzufangen / nach des andern Hand zu langen / eigentlich waren genug / weggegangen“.
„Der Zustand unseres Denkens und unserer Sinne“ – mit diesen Worten von Wenzel aus seinem „geöffneten Brief“ zum Essay „Uhrengeschäft“ ist auch Menschings Thema in seinem Poem zutreffend benannt. Das ist etwas anderes als besserwisserische Aufklärung über diese oder jene platte Wahrheit.
Die Wahrheit liegt oft versteckt zwischen den einzelnen Versatzstücken, ist nicht formulierbar wie ein Lehrsatz, muß in einem kollektiven Prozeß gefunden werden. (…) Denn die alten Abmachungen über Begriffe, in denen ein historischer Erkenntnisprozeß materialisiert vorliegt, sind fragwürdig; sie treiben zu einer Melancholie, deren Gründe nicht mehr auffindbar scheinen und in einem psychologischen Dschungel verschwinden.
Wenzels Überlegungen zu seiner eigenen assoziativ-sprunghaften Methode korrespondieren mit dem gleichzeitigen Nachdenken von Mensching, wie es zu dem Poem „Von mir aus“ geführt hat. Denn was er dort leisten wollte, verlangte mehr als eben ein Sammelsurium von mehr oder weniger banalen Dingen und einigen „frechen“ Anspielungen. Es ging darum, die eigenen Erfahrungen so in den Text zu bringen, daß mit ihnen umgegangen werden kann; darum, „die Texte offener zu machen und assoziativer; anstehende Probleme nicht nur als die unserer Gesellschaft, sondern auch als die der Welt, als epochale, elementare kenntlich zu machen, durch eine freiere und provokantere Fixierung zu dimensionieren“ (so Mensching im bereits zitierten Interview). Durch die offene und surrealistische Montage gelingt es ihm, ein Changierendes, sich allzu rascher Deutung und Festlegung Entziehendes zu schaffen, das dem Leser mehr abverlangt als manche früheren Texte (darunter auch im Band versammelte) und eben dadurch Raum schafft, den vorgeführten und den angerührten (eigenen) Erfahrungen mit Gedankenarbeit dazwischenzukommen. Wer spricht hier, oder schweigt, und wer übersetzt?
und ich brüllte schwitzen ins Telefon und das Telefon
schwitzt nicht
lauschte geduldig selbst in den Pausen und in den Pausen
sagte ich das Eigentliche sie waren zweideutig vieldeutig und
eindeutig
es kam darauf an wie man sie übersetzte
Und so wird der Text, auch hier, zum poetologischen Programm, Übungsfeld für Kommunikation. (Wann kommt das große allgemein Gespräch?). Dämmerungen, Übergänge, Lichtmetaphorik in zahlreichen Gedichte wie des ersten Bandes, so auch hier. Eine kleine Auswahl: das Versteckspiel, mit dem beide Bände eingeleitet werden; die Reihe der Abtönungen in „Kaum merkliche Veränderung“; die Milchglasscheibe…; im neuen Band besonders das Gedicht „Hotelzimmerdämmerung“ mit einer ganzen Toposkette von Übergängen, zwielichtigen Metaphern, Zwischenräumen und dem wichtigen und schönen, vieles bedeutenden Schluß:
im Türspalt
steht dein nackter Fuß, mit sanfter Gewalt
eroberte Zwischenräume,
mehr, sagst du, trauen sie uns nicht zu,
ich sage, daß sie sich bloß nicht irren,
in diesem Licht ist vieles möglich
Eine weitere Spur führt in die im Anhang des Bandes von Mensching gedruckte „unordentliche Lesart“ zu einem Gedicht von Ritsos; „unordentlich“, weil sie Bruchstücke montiert, Reflexionen, Zitate, Witze, Sentenzen, Gedichte; aber auf diesem Umweg schafft sie Bewegungsraum für Assoziationen und Deutung. Mitten darin nun eine Reflexion über das Licht, in der sich Deutung des Gedichts von Ritsos und Schlüssel (auch eines dieser „Schlüsselworte“ bei Ritsos/Mensching) zu Menschings Schreibkonzept verquicken:
Das Licht ist die Grenze, hier erfolgt der Aufbruch, die Rebellion. Jener ist außer sich, so viele Dinge sind ihm bereits entzogen, entfremdet worden, hier aber, am elementarsten, dringendsten Lebens-Mittel, beginnt seine Abwehr. (…) Was ist dies für eine Welt, derart verstellt von Barrieren, fremden Mächten und Medien, voller Filter, Gardinen, Scheiben, eine Welt beständig – wachsender Undurchschaubarkeiten, wo auch das Selbstverständliche nicht länger selbstverständlich bleibt, wo es, so eingefordert, das Unmögliche scheint, obwohl es das Mindeste ist. Verstehst du?
Von jedem Satz dieser Lesart, auch den hier fortgelassenen, führen Spuren zu Gedichten des ersten und zweiten Bandes von Mensching, zu beiden Eingangsgedichten, beiden Titelgedichten und auch zum biographischen Poem, an dessen Schluß die Linien noch einmal zusammengeführt sind, Form und Inhalt, alle Nuancen des Sagbaren und des Lebbaren, Angelika und die Genossen, die Friedenserklärung an alle, die Berliner Tauben, Deutschland meine Trauer, und:
ich verlange erbitte fordere nichts
als die Verteidigung aller Nuancen des Lichts
und des Schattens
Ein Aufklärer: er will mehr Licht. – Aber kein platter: er weiß um Schattierungen auch. Das ist die Fahne („einige verlangten daß ich Fahne zeige…“) und das Programm: Schreibprogramm. Kampfprogramm. Die zahlreichen Bekundungen von Trauer, Melancholie, Zweifel in beider Bänden (Mensching: „aber solange kann ich nicht warten ich ertrage die Erde / nicht wie sie ist“) sind nicht Identifikations-, sondern Arbeitsangebote, gerichtet auf kollektive Definition solcher Zustände. „Solche Momente“ (Wenzel) nicht zu zelebrieren, sondern zu benutzen. Bei aller Verschiedenheit der Temperamente, Schreibantriebe, Traditionen treffen sich hier beide in einer seltenen Kampfgemeinschaft. Nach dem kollektiven Antritt der Braun, Mickel, Kirsch… hier eine vielleicht „intimere“ Form von Kollektivität, aber kaum weniger fruchtbar. Wir sollten den Glücksfall wahrnehmen und annehmen.
Nicht alle Texte des neuen Bandes von Mensching haben jenen reichen, changierenden Ton. Manches inhaltlich gewichtig sich Gebende, vor allem im ersten Abschnitt, ist eher dürr parabelhaft. „Vor dem Sieherungskasten“: nun gut. „Auch ich hab“ manchmal „die Schnauze voll“ usw., was soll’s? Mehr als die eine Bedeutung ist da nicht drin. Menschings Kommentar:
Problematisch wird es dann, wenn man die Absicht merkt und verstimmt ist.
Genau das passiert in einigen dieser Texte, zum Beispiel auch in „Nur ein Beispiel“: wo sich eine schöne Stelle findet: „einige wissen es immer. Andere nicht. / Aber was hat das zu sagen? Rattatatam.“ Der Rest – ein Metallkasten, der nicht mehr als, ungefähr, ein Beispiel abgibt, trotz des aufdringlichen Hinweises im Titel und am Schluß. „Tuchfühlung“ ist da stärker, bis auf den bläßlichen Schluß, als brauchte es eine Fahne, ein Bekennerwort am Ende. Hier sind Texte, die nicht allzuviel Arbeit ermöglichen. Ich vermute – eben das, was zu überwinden war. (Brauchte der Verlag Texte aus der Schublade, den Band anzufüllen?)
Ein paar Worte noch zu den Liebesgedichten des dritten Abschnitts. Neben einigem Überflüssigen finde ich auch hier Wichtiges, das einen Strang aufnimmt, den schon die frühesten Gedichte von Mensching hatten – er hat ihn benannt mit Namen wie Neruda, Vallejo, Cardenal, Ritsos: Leuten, die nicht trennen „zwischen sozial engagierter und individueller (purer) Poesie, etwa zwischen Revolution und Erotik“. Dies in deutscher Dichtung nicht allzu Häufige, zu dem Mensching und Wenzel das Ihre hinzutun, kein geringes Verdienst. Ich nenne das Gedicht über „den Schlüssel von Jannis“, die „Nänie auf die Liebe“ und „Auch ich bin nicht ganz dicht“. Anrennen gegen Tabus, und die Entdeckung des Spermas als subversiver Substanz, die Schönheit des sich Vermischens/sich Einmischens. Hier ist etwas, in der einen wie der andern Richtung, das trägt und das zu Hoffnungen berechtigt.
Neben Wichtigem bringt auch Wenzel eine ganze Reihe braver Gedichte mit zitierfähigen Stellen, und die zitiert werden. Ob’s dem Autor recht ist? Er kann sich ja sein Publikum nicht aussuchen; und wenn wir’s streng nähmen, was wir ja gottlob nicht tun, müßten wir erst einmal klären, was wir mit uns wollen, bevor wir beurteilen, was der Autor mit uns bezweckt oder bei uns bewirkt. Und damit wäre, wie schon öfter bemerkt wurde, der arme Rezensent natürlich überfordert; oder soll ausgerechnet er den Anfang machen? Klammer zu. Und genug der Anforderungen an ihn und zurück zu denen an den Autor: dem wir nicht abverlangen wollen, daß er abstrakten Normen an Vollendung oder Kunstfertigkeit pp. genügen möge; aber aufregend soll’s schon sein dürfen.
Wenn ich draußen nichts erkenne,
Seh ich immerzu bloß mich.
Das ist nicht schlecht und wird gern zitiert werden, weil’s ungefähr das trifft, was wir vom Dichter erwarten (allgemeines Wohlgefallen!); aber viel unbräver als der Rest des Vierzehnzeilengedichts ist es auch nicht. Gesungen in einem Programm mag es seinen Platz haben.
Aber
(sagt mein anderer innerer Zensor), vielleicht war’s gar im Buch so geplant? Vielleicht soll der geneigte liebe Leser (wie er fünfzehn Seiten zuvor angeredet wurde) an dieser Stelle mehr oder weniger heftig zustimmend nicken, um dann auf der gegenüberliegenden Seite aufzulaufen, mit dem geneigten Kinn auf dem Gedicht zu landen, das just und passend so beginnt:
Ich koche mein Süppchen,
Auf Sparflamme.
Gestern nacht hat mich
Die Weisheit befallen.
Jetzt hegt und pflegt
– Wie eine Amme –
Der Schnaps
Mein allgemeines Wohlgefallen.
(wer lacht sich ins Fäustchen?)
Mensching und Wenzel stehen nicht nur zusammen auf der Bühne, und sie haben nicht nur annähernd gleiche Erscheinungszeiten für ihre jeweiligen neuen Bände (und warum sollte es nicht dabei bleiben?). Sie haben auch sonst eine ganze Menge gemeinsam. Zuerst zu nennen wäre da die beiden eigene Kopplung von Sinnlichkeit und weltveränderndem Anspruch, von Lebensgenuß und Revolution, wenn auch von jedem, entsprechend seinem Naturell, anders realisiert. Bei Mensching steht, wenn ich richtig sehe, die weltabbildende und -schaffende Kraft metaphorischen Sprechens im Vodergrund. Wenn der seine Liebe oder seinen Hunger nach Welt oder eine simple Beobachtung im Straßenbild oder was immer anspricht, meint er das Ganze stets mit. Als sein Problem hat er folgerichtig die Gefahr erkannt, die Stufe des unmittelbaren, spontanen Erlebens (Fühlens, Denkens) in allzu kunstfertiger Verwandlung in die Metapher im weitesten Sinne des Wortes (bis zum Gedicht als einem einzigen Tropus) zu überspringen. In surrealistischen Techniken wie im Rekurs auf Dichter wie Ritsos, Cardenal und andere und wohl auch in seiner Bühnenarbeit wirkt er dem entgegen.
Anders bei Wenzel. Gewiß hat sich die langjährige Zusammenarbeit im Liedertheater und darüber hinaus auf die Protagonisten ausgewirkt, und man kann, was negativ als Gefahr für den einen formuliert worden ist, sich vom anderen herabziehen zu lassen, positiv als Glücksfall werten. In dieser Zusammenarbeit bildete sich eine „theoretische“ Übereinstimmung im Kunstwollen und, wenn das Wort erlaubt ist, Weltwollen heraus, die sich vielfältig artikuliert: vom gemeinsamen Bezug auf literarische, philosophische und politische Traditionen, ich nenne Marx und Benjamin, Hölderlin und Mühsam, Kramer, Hoelz…, bis hin zu (ob übernommenen oder gemeinsam erarbeiteten) Motiven, zum Beispiel das Nicht-warten-Können oder das Radio als Vermittlung von Welt (dies letztere gewiß ein generationstypisches, wenn auch sehr verschieden gehandhabt).
Aber die Unterschiede: Wenzel ist spontaner und läßt seine – durchaus widersprüchlichen – Gefühle passieren, wenn auch nicht widerstandslos, wie gesagt wurde. Er hat einen Hang zum Sentimentalen, den er auch nicht unterdrückt, so wenig wie er sein Wissen um Zusammenhänge, seine zweite Regung gewissermaßen, verleugnet. Er verfügt über diesen Hang, nicht der über ihn. Daher der alles andere als einheitliche, alles andere als „Gesamteindruck“ seiner beiden Bücher, immer sowohl als auch, zur Irritation und zum Gewinn des Lesers. Ob er damit „der Poesie einen Dienst“ erweise, sei ihm „vollkommen schnuppe“, sagt Wenzel.
Neu erscheint mir bei wichtigen Texten des neuen Bandes eine gewisse „theoretische“ Anreicherung dieses Gefühls; obwohl der Augenschein mit Vorsicht zu genießen ist: des allgegenwärtigen Augenzwinkerns wegen, siehe auch und besonders Wenzels Essays oder „essay-ab-artigen Gebilde“, mit denen er seine Bücher, wie es in einem (fiktiven?) Brief an den Autor, den er real beantwortet, heißt: zu „verunreinigen“ pflegt („Ein geöffneter Brief“).
Man vergleiche etwa die (nicht in vorliegendem Band, sondern in dem Sammelband Positionen 2 des Mitteldeutschen Verlages gedruckten) „Allgemein wiederholte(n) Auslassungen zu einem hinlänglich bekannten Thema / Diskussionsmitschrift“ und suche den Protokollanten/Autor im Stimmengewirr. Die Reflexion hebt aber so an:
Nach dauerhafter, pflichtgemäßer (nicht nur individueller) Lektüre meiner neuen Texte entdeckte ich ein Phänomen, dessen Ursache mich interessiert: Die Melancholie. Meine epikureische Traurigkeit, die sich besonders in den neuen Arbeiten übermäßig in den Vordergrund spielt. Ich muß mir eingestehen, daß es sich um keine Laune oder Stimmung handelt. Sogar bei grotesken oder satirischen Ausdrucksformen (…) erblickte ich hinter jeder Grimasse ein trauriges Gesicht. Die Anhäufung nun vieler recht stiller, beobachtender (Klage-)Texte, die ihren Nährstoff in meiner Biographie fanden, machte mir dieses Zentrum deutlicher als zuvor. Der Gang meiner Überlegungen (d.i. in diesem Fall oft das plötzliche Wiedererkennen von Fundsachen) verdeutlicht ebenfalls meine Lage: Ich konnte nichts beschönigen (oder mit einem positiven Begriff gesagt: gestalten), begrifflich abheben, damit wäre mir nicht geholfen. Traurig kann nur sein, wer an der wirklichen Welt hängt, barbarisch verliebt ist in seine sinnliche Existenz, in den Genuß und den Ekel.
Im Umkreis solcher Überlegungen stößt der Autor (auch hier) auf einen Mann, vor dem der (fiktive?) Briefschreiber ebenso warnt, wie anderswo reale Briefeschreiber vor „zuviel Benjamin“ warnen zu müssen glaubten. Brechts „Widersprecher“ also, dessen geradezu modisch vielzitiertes Bild vom „Angelus Novus“, dem „Engel der Geschichte“, auch hier auftaucht: dem ganzen Band zum Motto. Koketterie, intellektuelle Mode oder mehr? (Auf Bezüge in Wenzels Texten wurde bereits hingewiesen).
„In jeder Epoche muß versucht werden, die Überlieferungen von neuem dem Konformismus abzugewinnen, der im Begriff steht, sie zu überwältigen.“ (sagt Benjamin, zitiert Wenzel). Oder in seinen Worten:
Wie sonst soll die Generation, der ich angehöre, den Sinn ihrer Existenz im historischen Prozeß erkennen und kritisieren können, wenn sie in Begriffen denkt, die aus einer ganz anderen, anders bewegten und motivierten Zeit herrühren, wo gesellschaftliche Veränderung etwas anderes bedeutete. Andere Begriffe, die bereitstehen, unsere Unzufriedenheit in sich aufzunehmen, wie Etablierung, Anpassung, Realitätssinn etc. erzeugen nur Schuld- und Nichtigkeitsgefühle der Gegenwart gegenüber.
Zu lernen ist, denke ich, von diesem Vorgang mehreres; geht es doch nicht (und geht es doch auch) um Wenzels Schreibkonzept. Wie kommen junge Menschen am Ende des Jahrzehnts (des Jahrtausends) dazu, ihren Anteil an vergangener und kommender (und laufender) Geschichte wahrzunehmen und wahrzuhaben? Da kann man sich nicht ruhig darauf zurückziehen, daß wenigstens einige schon die richtige Position finden. (Wenigstens Wenzel und Mensching?). Da könnte es lehrreich sein zu sehen, wie diese beiden um ihren Platz noch oder wieder ringen, die doch schon „etabliert“ schienen. Lehrreich auch, wie bestimmte Traditionen, ästhetische und weltanschauliche, wie also etwa Benjamin, auch und vielleicht gerade in seinen „theologischen“ Zügen, die Mensching zitiert, produktiv gemacht werden kann für heutige Sozialisationsprozesse.
Mich hat nach der Lektüre der Benjaminschen Texte die Frage: wie konkret kann eine Geschichtsphilosophie überhaupt sein, tief berührt, hat mich wieder wach gemacht, meine Wahrnehmungen genauer wahr-zu-nehmen. (Wenzel)
Diese Tendenz zu größerer Genauigkeit ist mir an beiden Büchern wichtig (ohne daß es mich Schwächen übersehen läßt: aber es findet Bewegung statt!). Beide suchen mit Brecht nach einer Ästhetik, die von den „Bedürfnissen unseres Kampfes“ abgeleitet ist, einer Ästhetik, zu deren schönsten Hoffnungen es also gehört, uns zu der Frage aufzustören: woher denn, wogegen, wofür… wir da eigentlich kämpfen sollen, na was? – Diese Autoren haben seit ihrem Start viel Lob erfahren und ein bißchen Kritik auch. Aber wofür das Lob, wogegen die Kritik? (Das wäre ja neu; daß wir loben, was uns aufstacheln will, nicht wahr?!). Also eine Ästhetik, der es um das bißchen Kritik und das viele Lob nicht geht. (Freilich, wir sind alle Menschen, also schon drauf angewiesen, aber… ): In diesem Aber steckt der Kern, oder besser: es ist der Kern, um den es lohnt, die Schale zu knacken. Eine Ästhetik, die auf Wirkung zielt: wo, wie, warum nicht… wären da angemessenere Fragen als die nach partiellem Ge- und Mißlingen. Die Autoren zielen auf das, was uns gelingt oder mißlingen kann, oder zu spät. Wollen wir darüber reden? Eine Kritik, die das Amt hätte, den Finger auf die wunden Stellen zu legen – nicht primär der Gedichte, sondern der Wirklichkeit, auf die jene zielen. Die Güte der Gedichte abliest an dem Grad, in dem sie uns dazu nötigen. So gesehen – ist das allgemeine Lob etwa kein warnendes Zeichen? Oder, teils unbewußte, Abwehr? Wen wundert’s, wenn die Autoren den Spieß umdrehen und zur Kritik des Lesers anheben. Schon die Anordnung der Gedichte (bei Wenzel) kritisiert Bedürfnisse, indem sie sie konfrontiert. Ach möchten wir doch, sagt das, mehr Unbescheidenheit entwickeln! Ach möchten wir mit diesen Texten, mit uns, umgehn. Wie, fragen sie, arbeiten wir damit? Mit den Autoren, ohne sie uns fangen zu wollen? Wie, also, bewähren wir uns? Ich frage nur.
Michael Gratz, Sinn und Form, Heft 5, September/Oktober 1988
Laudatio
– Heinrich-Heine-Preis 1989 und 1999 für Steffen Mensching und Hans-Eckardt Wenzel. –
Ungewohnte Form – zu einer Doppel-Preisverleihung haben wir uns versammelt, am Schnittpunkt der Jahre, für die die Ehrungen gedacht sind: der Heine-Preis für 1989, der Steffen Mensching, und der für 1990, der Hans-Eckardt Wenzel zuerkannt wurde. Zusammengehörigkeit der beiden Poeten wird so signalisiert, und zugleich wird ihre Differenz festgehalten. Manchen, die bloß die theatralischen Aktionen des Freundespaares erlebten, mag eine Art Kollektivwesen Wenzelmensching in Erinnerung geblieben sein, dessen zwei Gesichtern sie kaum die richtigen Namen geben können. Doch sind die Sprachen der Dichter ganz verschieden in den Bänden Erinnerung an eine Milchglasscheibe und Tuchfühlung von dem einen, in den Bänden Lied vom wilden Mohn und Antrag auf Verlängerung des Monats August von dem anderen.
Mensching: Spruchhaft verknappt die Erfahrung vorn Aufeinanderangewiesensein:
In dieser dunklen Welt
findet Halt nur
der einen anderen hält
oder:
All dies trage ich allein
Liebe Kälte Haß: Angst und mein
Verlassensein
nur nicht das
allein dies nicht
Zuversicht.
Metaphorik der Realität im poetischen Bild, Verweis auf Intermundien und in ihnen, drohend, auf offene Enden der Geschichte:
der eisenbeschlagene Stiefel tritt gegen die offene Tür, doch im Türspalt
steht dein nackter Fuß, mit sanfter Gewalt
eroberte Zwischenräume,
mehr, sagst du, trauen sie uns nicht zu,
ich sage, daß sie sich bloß nicht irren,
in diesem Licht ist vieles möglich
Lakonisch ist die Rede auch im lyrikbiographischen Selbstzeugnis, zurückgenommen ins Bild die poetische Stimmung, die die Äußerung anregte. – Wenzel dagegen: Eher rhetorisch ausgreifend-schweifend, satirisch, elegisch, reflektierend – ein Ich, gehetzt durch seine Gegensätze:
Ich lebe gern.
Um Verzeihung bitt ich für meine Hast,
Wenn die Schwalben aufbrechen oder Freunde
Verdächtigt werden, um Vergebung
Bitte ich euch für all die Niederlagen,
Die sich mit mir zu Tisch setzen,
Für die Verzweiflung über uralte Geschichten,
Die ich in zwei Minuten aufklären möchte.
… Ich weiß nicht, ist dabei von Belang:
In meinen Fingern, das Morsen
Fernster Stationen, unaufhörlich
Dieser Rhythmus, der meine Zeit
Kleinhackt in winzige Einheiten;
Oder die telepathische Sehergabe
Beim Abzählen der Sekunden, Sekunden
In denen ein Mensch stirbt.
Vielleicht ist das normal, und nur
Meine Unrast und irgendetwas mit Europa
Ist daran schuld. Aber ich lebe gern.
Und liedhaft einfach kann es zugehen in seinen Versen:
Immer Regen, morgen werden
Wieder Regen auf uns fließen
Immer Regen hier auf Erden
Immer so ein Tränengießen.
So verschieden also die, denen heute die Preise gelten, und doch gehören sie zusammen. Im Stil einer poetischen Arbeit zunächst, die Direktheit zum Prinzip macht, von Verkunstung nichts hält und auch zur heftigen Polemik sich bereit hält gegen das Verlangen zum rein Artistischen, zu vollendeten Sublimierungen, in denen, wie vermutet wird, sich die Probleme aufheben könnten, die den zwingenden Anlaß zum Sprechen gaben. Offenheit für den Widerspruch gehört zu dieser Direktheit, Vorzeigen der Risse der Welt, die, Heine hat das Bild vorgegeben, durch die Brust des Poeten gehen, und – gegen die Gefährdungen der Indifferenz – die Bereitschaft zur Aktion; sie kennzeichnet die Gestalten von den Ichs, die in den Gedichten der beiden Autoren auftreten, nicht weniger aber ihre poetische Tätigkeit selbst in ihrem Vermögen, sich in die Öffentlichkeit zu stellen und Öffentlichkeit herzustellen.
„Poetisch“ sage ich hier immer mit Bedacht: als „literarisch“ nämlich, in einem strengeren Sinn auf Schrift bezogen, das gedruckte Wort, wäre die Tätigkeit der beiden sehr unzureichend bezeichnet. Die Printmedien und die Wortsprache bilden nur eines der Felder, auf denen sie sich und uns versuchen. Ihr poetischer Ort ist ursprünglicher und moderner die Bühne, ihr Instrument der Körper, Ausdrucksmittel sind Mimik, Gestik, die Bewegungen der Finger, die Musik machen, die Stimme, die spricht und singt, flüstert und schreit. Die großen Programme von Karls Enkeln – Abende zu Mühsam, zum Sozialistengesetz, zu Marx’ „18. Brumaire“, zu Becher oder Goethe – habe ich in lebendiger Erinnerung, die Hammer-Revue und später, in anderen Gruppierungen, die Sichel-Operette oder die Clowns-Programme der Herren Wenzel und Mensching, die Auskunft gaben über Neues, Altes und Letztes aus der DaDaeR. Theaterarbeit am Berliner Ensemble und am TiP gesellte sich hinzu und Versuche für den Film. Kollektivität bei all dem, eine intensive, streitbare, vereinheitlichende und auch auseinandertreibende gemeinsame Arbeit im Entwurf und im Ausarbeiten der Programme, Zusammenspiel bei ihrer Realisierung, in die jeder von den beiden und von ihren Freunden und Freundinnen das Seine/Ihre einbrachte. Der Stil der Direktheit, Widerspruchsoffenheit, Aktionsbereitschaft prägte sich hier aus, die Un-Verschämtheit des Auftretens und nicht zuletzt der Wille, die poetischen Äußerungen zugänglich zu halten.
Des Preisens wohl würdig – aber steht uns der Sinn nach Preisen heute und hier? Was Wenzel und Mensching von Preisverleihungen hielten und halten, von jenem formalisierten Ritus in festlichem Rahmen, von jenen Massenausschüttungen aller möglichen Orden und Ehrenzeichen, die in regelmäßigen Intervallen Repräsentativbedürfnisse des Staates mit seinen absolutistischen Einbindungsversuchen koppelten – das haben sie in einer Szene des DaDaeR-Programms gezeigt, die sie in alle seine drei Fassungen aufnahmen: Es war ihnen Gegenstand eines Clowns-Spiels, das die Clownerie der Wirklichkeit enthüllte und auf groteske Weise ihren tödlichen Sinn: die empfindlicher Betroffenen wanden sich und sanken zu Boden.
Nicht nur Bücher, auch Preise haben ihre Schicksale. Als auf Initiative von Rudolf Leonhard 1947 der Heine-Preis zum zweiten Mal begründet wurde (zum ersten Mal stiftete ihn der Schutzverband deutscher Schriftsteller im antifaschistischen Exil 1936), war er ein Gemeinschaftsunternehmen des damals existierenden Schutzverbandes deutscher Autoren und einer Reihe von Verlagen, die die Gabe finanzierte. Als Preisrichter berief das Gremium eine Persönlichkeit ihres Vertrauens. Der Intuition und Urteilskraft eines einzelnen wurde hier die Entscheidung gegeben – wohl wissend, daß über künstlerischen Wert nicht abgestimmt werden kann und daß er einem institutionellen Beschluß nicht unterliegt. Solche Vorstellungen aber gerade werden womöglich in das spätere Preisverfahren eingegangen sein, in die Neustiftung des Heine-Preises 1956, die seiner staatlichen Usurpation gleichkam. Dem Literaturhistoriker, der sich für die Geschichte der literarischen Verhältnisse interessiert, sei diese Abschweifung verziehen; sie wird als Anregung vorgetragen, darüber nachzudenken, ob die Zeit nicht gekommen ist, dem Heine-Preis die ältere Würde zurückzugeben.
Hätte ich an Mensching und Wenzel gedacht, gesetzt, ich wäre der für die Preisverleihung Berufene gewesen? Ja, und dafür habe ich zumindest drei Gründe.
Erstens wäre ich gewillt gewesen, den Preis an einen von denen zu geben, die zu der jüngeren Generation von Autoren dieses Landes gehören. Seit ihrem deutlichen Auftreten Ende der siebziger Jahre – das mit einem Mißtrauen beobachtet wurde, welches nicht wenige von ihr außer Landes oder in die Bereiche der kleinen literarischen Kommunikation trieb – ist diese Generation längst zu einem entscheidenden Teil der Literatur in der DDR geworden. Sie hat mit Energie neue Erfahrungen eingebracht, die Empfindung von bleierner Zeit, von Stagnation, von verlogener Sprache und Sprachlosigkeit und den spöttischen, wütenden, trauernden oder sich ganz verweigernden Protest gegen die Katastrophe, die das Gegebene darstellte. Sie hat früh auf Haltungen verwiesen, die sich schließlich jüngst in der Rebellion auf den Straßen äußerten, welche in ihrem Anfang ja wesentlich auch – Analysen sind bis heute kaum vorhanden – eine Rebellion der Jugend war. Leute aus dieser Generation also hätte ich sicher gewählt, weil Preise ja nicht nur ein Werk ehren, ein Talent fördern, sondern auch Aufmerksamkeiten lenken können. Die große Verschiedenheit unter den Jungen und die nicht selten heftig geführte Auseinandersetzung zwischen ihnen, die sich an der ungleichen Art entzündete, sich der Realität zu stellen, hätte dabei verboten, an die Wahl eines Repräsentanten dieser Generation zu denken. Mensching und Wenzel sind besondere Exempel dieser Altersgenossenschaft, nicht Leute, die einfach für andere stehen können.
Was mir an ihnen seit langem auffiel und was ich an ihnen erstaunt bewundern konnte – das wäre mein zweiter Grund für eine Preis-Zuerkennung gewesen –, war ihre Art, sich gegen die Enge der Provinz zu wehren, in der sie zu leben hatten, sich gegen den Stillstand der Zeit kritisch zu behaupten, den sie scharf zu spüren bekamen: ihr poetischer Wille, sich vielfältig in Beziehung zu setzen zur Welt, über „Europas verzollte Sanitärkonstruktion“ hinaus, wie es bei Wenzel hieß, das „Verbindungsstück“ zu all den Unbegreiflichkeiten unserer Erde zu suchen, der poetische Wille, als „Student der ,Ästhetik des Widerstands‘“, wie Mensching es sagte, sich in Beziehung zur Geschichte zu bringen, sich im Prozeß der Kämpfe um ein anderes, lebenswertes und Leben ermöglichendes Dasein zu sehen, Rhythmen der revolutionären Bewegung zu begreifen, das Leid ihrer Unterbrechung, die Qual ihres schrecklichsten Abbruchs im Stalinismus, die Gewißheit ihrer Erneuerung aus der Not. Und bei all dem war mir ihr Bestreben wichtig, aus „allen Quellen“ – ich zitiere Mühsam, den Mensching und Wenzel zitieren – zu schöpfen, die Mut geben können, über Trauer, und Verzweiflung hinweg?, nein, durch sie hindurch diese Anstrengung weiterzuführen. Antifaschismus war ein Kernstück dieser Bezüge – das Programm Spanier aller Länder belegte es, wie es ein Film über die, Herbert-Baum-Gruppe hätte belegen können, an dem sie gearbeitet haben, den man aber nicht haben wollte. Und Gedichte zeigen es, wie der böse Text Wenzels zu einem Foto aus dem Lager Janovsk mit dem Ausruf der Schergen, die die Welt ausrotten: „Arbeit geht nie aus vom Totmachen von Schweinen“, oder wie Menschings Spruch „Ich lehne den Kopf an die graue Mauer / der Mahn- und Gedenkstätte / mehr als ich wünsche, weggehen zu können, möcht ich hier bleiben müssen.“ Daß dieses Thema quälend unerledigt ist, zeigt unsere Gegenwart.
Und mein dritter Grund, ihnen den Preis zu geben, wäre der Bezug auf Heine gewesen, der sich bei beiden findet und den Wenzel nun auch in seinem jüngsten Band Reisebilder ausdrücklich benennt, in dem er den Älteren als seinen „Lehrer“, als seinen „Wahlverwandten“ charakterisiert. Zwar ist es längst üblich geworden, im Zwang der Ehrenregularien Preise mit Namen auch an Autoren zu geben, die mit diesem Namen nicht viel zu tun haben – das jedoch hat mir nie gut gefallen. Bei Mensching und Wenzel liegt es aber nahe, weil sie ihm nahestehen mit ihrem Spott und Biß, mit ihren Träumen und ihrer Phantasie, mit ihrer Melancholie, mit ihrem Fernesein von einer mit sich beschäftigten Artistik wie von einer abstrakt politischen Tendenzpoesie. Heines Text „Verschiedenartige Geschichtsauffassung“ setzten sie an den Anfang der Revolutionsfeier, mit der ihr Spanienprogramm endete, die Erörterung der entgegengesetzten Ansichten von der Geschichte: ihrer Auffassung als eines ewig ergebnislosen Kreislaufs, in dem alle Zivilisation nur wieder der Barbarei, aller Enthusiasmus dem Fatalitätsgedanken weichen müsse, und ihrer Auffassung als eines sinnvoll gerichteten Vorgangs, in dem alle irdischen Dinge einer schönen Vervollkommenheit entgegenreifen, alle Menschen nur Staffeln, Mittel sind zu einem gottähnlichen, alle beglückenden Dasein. Beide Ansichten, so Heine und so Mensching und Wenzel, die ihn zitierten, wollen mit ihren lebendigsten Lebensgefühlen nicht übereinstimmen, sie verbieten es, die Kräfte an das ergebnislos Vergängliche zu setzen oder an eine Zukunft als Zweck, für den wir Mittel sind.
Das Leben ist weder Zweck noch Mittel; das Leben ist ein Recht. Das Leben will dieses Recht geltend machen gegen den erstarrenden Tod, gegen die Vergangenheit, und dieses Geltendmachen ist die Revolution. Der elegische Indifferentismus der Historiker und Poeten soll unsere Energie nicht lähmen bei diesem Geschäfte; und die Schwärmerei der Zukunftbeglücker soll uns nicht verleiten, die Interessen der Gegenwart und das zunächst zu verfechtende Menschenrecht, das Recht zu leben, aufs Spiel zu setzen. – ,Le pain est le droit du peuple‘, sagte Saint-Just, und das ist das größte Wort, das in der ganzen Revolution gesprochen wurde.
Le pain – das Brot – ein Recht! Was aber ist Brot heute für diese beiden, für Mensching und Wenzel, wonach geht der Hunger, was will er sättigen? Sie sehen einen Hunger, der in üppig-gefährlichem Konsum zu befriedigen wäre, in einer bloß quantitativen Erweiterung unserer bisherigen Lebensweise, in Sättigung auf Kosten anderer und auf Kosten derer, die nach uns kommen. Ihr Hunger aber ist der nach einer anderen Qualität, für die Kunst als Bild des Immer-Anderen eine Ahnung geben kann. Was sie gegen erneute Provinzialität und ihre abzusehenden Defizite zu setzen bestrebt sind, ist der Versuch, die globalen Entfremdungsverhältnisse aufzuheben, wie sie in der Rüstung, in der Versehrung der Natur und im wirklichen Hunger der vielen in der Welt extrem sich äußern, ist – auch wenn sie dem geringe Chancen geben – der Versuch, eine alternative, linke Kultur zu schaffen; die den Namen sozialistische Kultur verdient, die ein sinnvolles, offenes Dasein, ein Solidarischsein der Menschen ermöglicht. Und das Verlangen gilt einer poetischen Aktion, die Lebens-Not-Wendigkeiten verdeutlicht, die fortfährt, den Druck drückender zu machen durch das Bewußtsein des Drucks, die hart auf Not verweist und auf die Vernunft nicht zu verzichten bereit ist im Verfechten des Menschenrechts, die die Interessen der Gegenwart verficht, ohne Zukunft aufzugeben. Welche Wege Kunst dabei zu gehen hat, welche Haltungen nun nötig werden und welche Mittel brauchbar – dazu scheinen jetzt mehr Fragen als Antworten bereitzuliegen. Mensching und Wenzel wissen das, und es gibt Zuversicht, daß beide gute Frager sind.
Dieter Schlenstedt, neue deutsche literatur, Heft 448, April 1990
„Meine epikureische Traurigkeit“
Der zweite Gedichtband von Wenzel ist da. Die in ihm zuerst den Liedermacher suchen, werden ihn auch hier finden; Noten sind wieder beigegeben. Dazwischen Texte, die sich auf keinen – wie auch immer verstandenen –, Liedbegriff bringen lassen, sondern groß diskursiv ausholen oder, seltener, auf spruchhafte Dichte aus sind; auch dies wie im ersten Band. Weitere Schmuggerower Elegien tauchen ebenso auf wie offene und versteckte Hommagen und Zitate, und es gibt auch wieder Prosatexte; diesmal, mit den launigen Titeln „Orakel Nummer April eins“ und „… zwei“. („Nummer April…“ – gut; aber warum „Orakel“? Das erste verdient die Bezeichnung vielleicht noch wegen seiner utopischen Mutmaßungen; das zweite ist eher ein Dialog in platonischer Tradition, bei dem der Leser kaum zu orakeln, wohl aber zu bedenken bekommt.) Nicht zu vergessen: Auch diesmal ist ein Essay dabei. Schaut man nach Themen, Tonart und Konsistenz des lyrischen Ichs, wären weitere Verwandtschaften zwischen beiden Bänden zu benennen.
Der Band Lied vom wilden Mohn war mit einem mutwillig ironisierenden Paradoxon eröffnet worden: Die Zueignung an bestimmte Personen, ausgewiesen mit Initialen, gab Intimität vor, während ihre Anzahl (nicht weniger als 115) dies gerade ausschloß, ja eigentlich Öffentlichkeit meinte. Eine clowneske Geste (auf die sich Wenzel in seinen Texten wie auf dem Liedertheater wohl versteht) ebenso wie programmatische Ankündigung, daß es ihm um Gebrauchswert für viele, nicht um Erlesenheit für Poesiekenner geht. Soweit kennt man ihn nun. Die Introduktion des neuen Bandes ist von ganz anderem Karat; ein Epigraph, gefunden bei Walter Benjamin über Paul Klees „Angelus Novus“, den Benjamin und nach ihm Wenzel als „Engel der Geschichte“ sieht: Mit dem Rücken zur Zukunft, blickt er entsetzt auf die immer mehr Trümmer aufhäufenden Katastrophen, während ihn der Sturm des „Fortschritts“ in die Zukunft treibt. Eine Selbstvorstellung, wie sie der erste Band mit der ausdrücklich „Unpoetische(n) Vorbemerkung“ gab ist nicht mehr nötig. Der Autor weist, statt auf sich, das Angelus-Bildnis vor. Eine alles andere als unpoetische Geste; bis ins Biblische ausholende Metaphorik, die sowohl innerlyrische wie auch Zwiesprache mit mehreren Künsten, Künstlern und Kunstepochen hält. Sie führt demonstrativ eine geistige Haltung zum Geschichtsprozeß vor, die zugleich sinnlich-körperhaft Stellung in ihm als handelnd Behandelter wie auch Allegorie des Innewerdens der Epoche (oder der Menschheitsgeschichte im ganzen) darstellt. Unter solchem Vorzeichen liest man dann die Geschichte und wird gewahr, daß das Angelus-Bild zur Beschaffenheit des lyrischen Ichs geheime Korrespondenzen unterhält. Besonders wird dies spürbar etwa bei Gedichten wie „Geschwindigkeitskontrolle“, „Beim letzten Ton des Zeitzeichens“, „Ich koche“, „Plastik: Mutter mit totem Kind“, „Sonntag“, „Requiem für Max Hoelz“, „Antrag auf Verlängerung des August“, „Tage von so großer Dauer“, „Prüfe dein Gewicht“, „Verlassenes Bett“ – relativ unabhängig davon, ob es sich um Texte handelt, die auf Epochen- oder mehr auf Selbstanalyse aus sind, die hymnisch oder elegisch weit ausgreifen, die einen „öffentlichen“ oder intimeren Ton anschlagen, liedhaft oder poemartig, länger oder kürzer sind und so weiter. Auch ist mit dieser Aufzählung kein Wertetikett zwangsläufig zu verbinden, wenngleich eingestanden werden soll, daß es einen gewissen Zusammenhang zwischen der unmittelbaren oder mittelbaren Beziehbarkeit mancher Gedichte auf das Benjamin-Motto und dem poetisch-sprachlichen Gelingen zu geben scheint. Nun wäre es unsinnig, zu schlußfolgern, daß die Paßgerechtheit des Mottos poetischer Qualitätsausweis der Gedichte sei; im Anfang waren einzelne Texte, erst ihre Zusammenstellung zu einem Band heischte nach dem Auffinden eines Übergreifenden. Worin dies besteht, wird man erst in der Zusammenschau des Ganzen gewahr. Wenzel bringt es selbst auf den Punkt in dem nachgestellten „geöffneten Brief“:
Nach… Lektüre meiner neuen Texte entdeckte ich ein Phänomen, dessen Ursache mich interessiert: Die Melancholie. Meine epikureische Traurigkeit (…)
Melancholie also; und zwar nicht seufzende Klage über Unabänderliches („Die Klage / Kommt immer zu spät“, endet das „Requiem für Max Hoelz“), sondern das zornige Sich-nicht-Abfinden mit dem Weltzustand, das Trauer und Entsetzen ebenso einschließt wie (ironisches und selbstironisches) Ausharren um der Hoffnung unzähliger Toter und Lebender willen („alle(r) / Traumwitzigen Störtebeker“), um der Utopie eines zweiunddreißigsten August willen („Lachen wälzt sich / Statt Krieg durch Europa“, „An diesem Tag werde ich BRUDER sagen“ – Titelgedicht). Und dazu gehört durchgehend und folgerichtig inständiges Reflektieren über das Verhältnis von (Einzel-)Lebenszeit und Zeit als Menschheitsgeschichte wie als vierter Dimension des Raumes. Deshalb, als Suche nach der Ursache der Melancholie, nach Trost für den, dem als Materialisten die Tröstungen keiner Transzendenz helfen können, befindet sich der Essay mit dem sinnlich-plastischen und zugleich untertreibenden Titel „Uhrengeschäft“ unter den „not-wendigen Zu-Sätzen“ des Bandes, die nicht nur drei Lieder und mehrere Notenbeispiele aufnehmen, sondern durch das Großgedicht „Prüfe dein Gewicht“ eingeleitet und eben den Essay bedeutsam beschlossen werden.
Soll nur der Klappentext des Kunstbruders Mensching zum ersten Band die Beigabe eines Essays für wichtig befunden haben? Wollen wir nicht endlich wahrnehmen, daß, warum und zu welchem Ende wie geartete Essays beide Wenzel-Bände ergänzen?
Zunächst sei noch bemerkt, daß sich freilich die obengenannte Steigerung des lyrischen Ichs durch Korrespondenz mit dem Motto, die über Bekundung und notwendige (Selbst-)Behauptung individueller Einmaligkeit auf eine wesentliche, epochen„notwendige“ Haltung des Subjekts weist, nicht überall und gleichsam wie von selbst herstellt. Dem wirkt nämlich eine andere Intention entgegen, die im ersten Gedichtband noch stärker ausgeprägt war, aber auch in diesem wirksam bleibt: das bewußte Herunterstimmen der Sprechhaltung auf Alltäglichkeit, Gewöhnlichkeit, ja auf sprachliche Nachlässigkeit, „unkünstlerische“ Ausdrucksweise, die das Geformtsein eines Gedichts, gar nach tradierten Erwartungsmustern, für – scheinbare – Nebensache hält. Daß sich darin auch die Gefahr sprachlichen Mißlingens verbergen kann, ist bereits kritisch vermerkt worden. Auch im neuen Band finden sich Indizien solcher Gefahr. Gehört zum Beispiel „gewunken“ schon zu den unbeabsichtigten Entgleisungen unreflektierter Aufnahme von Alltagsrede: oder soll es, im Gegenteil, kalkulierter Verstoß gegen „gehobene“ (sich über alltägliches Leben/Sprechen/Erfahren hinweghebende) Sprechweise sein, so etwa wie „Prüfe dein Gewicht“ bewußt unpoetisch beginnt („Die möcht ich mal alle auf einem Haufen sehn,… die Groschen“)?
Die Frage zielt selbstverständlich nicht auf die Unterstellung, Understatement sei gleichbedeutend mit Sprachschluderei, sondern vielmehr darauf, ob gewolltes Understatement auch seine gewollte Wirkung bestmöglich erreichen kann, und das heißt: ob es sprachlich wirklich „dicht“ geraten ist. Hieran wird Wenzel weiter zu arbeiten haben, wenn er eines Verglichenwerdens von Liedermacher/-sänger und Dichter, das zugunsten des Interpreten und zuungunsten des Dichters ausfällt, überdrüssig sein sollte. Keinesfalls jedoch wird man von ihm erwarten dürfen, daß er Gedichte schreibt, um der Poesie vorrangig „einen Dienst zu erweisen“; dies sei ihm, erklärt er in dem erwähnten „Brief“, „vollkommen schnuppe“. Und so, wie er im ersten Band einen Text mit der Warnung, dies sei „kein Gedicht“, durchzog, so gibt er im zweiten eine „Verlustanzeige“ auf, sein „allerschönstes Gedicht“ betreffend. Das Bekenntnis seine Muse sei ein Schmuddelkind, ist Programm, mehr als clowneske Attitüde oder Unfähigkeit zum regulären Sprachgebrauch. „Warum das? – das wär einen anderen Brief wert.“ Ihn zu schreiben, kommt dem Rezensenten nicht zu; wenn man Wenzels Texte aufmerksam liest, findet man selbst Antworten. Eine mögliche hat mit jener Melancholie zu tun und befindet sich in bester Tradition: „Auch der Zorn über das Unrecht macht die Stimme heiser.“ (Brecht) „Diese Welt war nie die allerschönste der möglichen Welten“, befindet Wenzel; das Schöne als Beschönigung unschöner Wirklichkeit – das fürchtet der Autor aus guten Gründen, die man zu akzeptieren hat. Aber gerade der Ernst seiner Schreibmotive nötigt doch zum poetischen Gelingen; stellt der Leser solchen Anspruch, hat ihn Autor selbst provoziert.
Ein letztes zum Essay „Uhrengeschäft“. Er hebt an mit vorwurfsvoller Geste: „Euch frage ich, all ihr Götter auf Erden (…), was habt ihr unternommen zur systematischen Rettung der Paradiese?“ „Paradies“ meint nichts Jenseitiges, sondern Anspruch (nicht Bedürfnis!) auf „Genuß des Lebens“, der mit dem „Schmerz der Vergänglichkeit“ ständig kollidiert. Die Struktur dieses Essays ist nicht deduzierend-sukzessiv, sondern akkumulierend-assoziativ. Es wird nicht folgernd eine Antwort auf die angeschlagene Frage entwickelt, sondern in immer neuen Anläufen wird die Problemstellung auf ihre existentielle Tragweite hin angegangen, in verschiedenen Richtungen, auf verschiedenen Ebenen, spielend-ernst. Anreger (allen voran Benjamin, gefolgt von Epikur, Marx, Brecht) werden zitiert weniger als Gewährsleute, mehr als Material und Denkvorlage. Zwischenüberschriften tragen metaphorischen Charakter und ähneln in ihrer Funktion denen des Benjaminschen Passagenwerks; so entsteht ein Geflecht von Verweisungen und Bezügen. Der eigentliche Diskurs hat im Rezeptionsvorgang stattzufinden. Der mehrfach erwähnte Brief kann als Anleitung dazu gelesen werden:
Sowohl die besondere Koppelung von Material als auch die assoziative, auf Widersprüchlichkeiten orientierte Anordnung von Eindrücken und Gedanken besitzen für mich Möglichkeiten der Entdeckung (…). Die Wahrheit (…) muß in einem kollektiven Prozeß gefunden werden. Einer alleine kann so was nicht.
Ausstellen der eigenen Unvollkommenheit als Einladung zur gemeinsamen Anstrengung – es ist noch nicht ausgemacht, ob damit der Poesie „kein Dienst erwiesen“ wird. Auch so gesehen, erscheint der Essay als Pendant zu den Gedichten; auch wenn sein „Geschäft“ nicht so sehr poetologischer als vielmehr philosophischer Natur ist.
Freilich ist auf diese Weise eine Höhe des Anspruchs markiert, dessen Einlösung dem Autor auch weiterhin viel abverlangt.
Dorothea Gelbrich, neue deutsche literatur, Heft 419, November 1987
Zum 60. Geburtstag des Autors:
Torsten Wahl: Distanz zu den Siegern
Mitteldeutsche Zeitung, 30.7.2015
Torsten Wahl: Hans-Eckardt Wenzel hält sich tapfer am Rand
Berliner Zeitung, 31.7.2015
Hans-Eckardt Wenzel – Sänger, Dichter, Weltentdecker
Mitteldeutscher Rundfunk, 30.7.2015
Hans-Dieter Schütt: Hoch die Meerwertsteuer!
neues deutschland, 31.7.2015
Matthias Zwar: Der Clown mit den traurigen Augen
Freie Presse, 31.7.2015
Fakten und Vermutungen zum Autor + Facebook + Interview + IMDb
Porträtgalerie: deutsche FOTOTHEK
Hans-Eckardt Wenzel Soloprogramm 2006 bei den Osterburger Literaturtagen im Hotel Zum Reichskanzler.


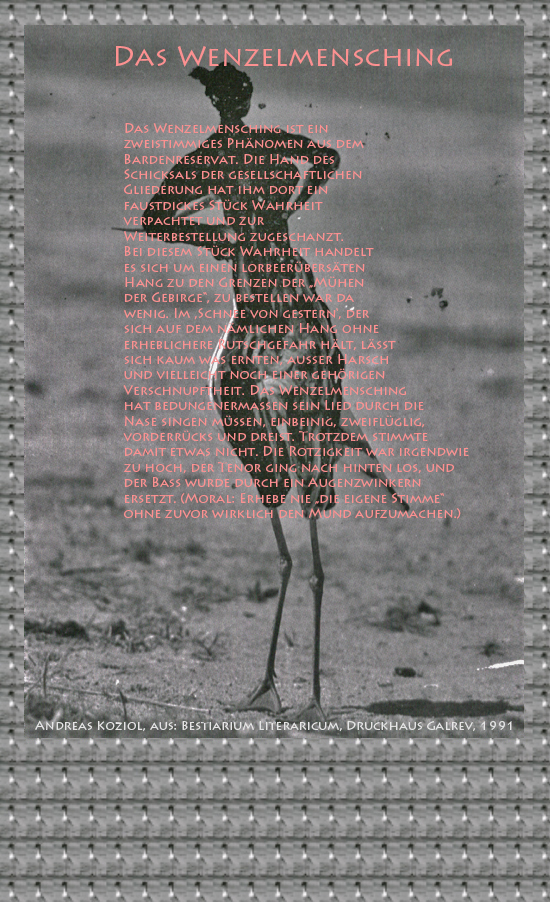













Schreibe einen Kommentar