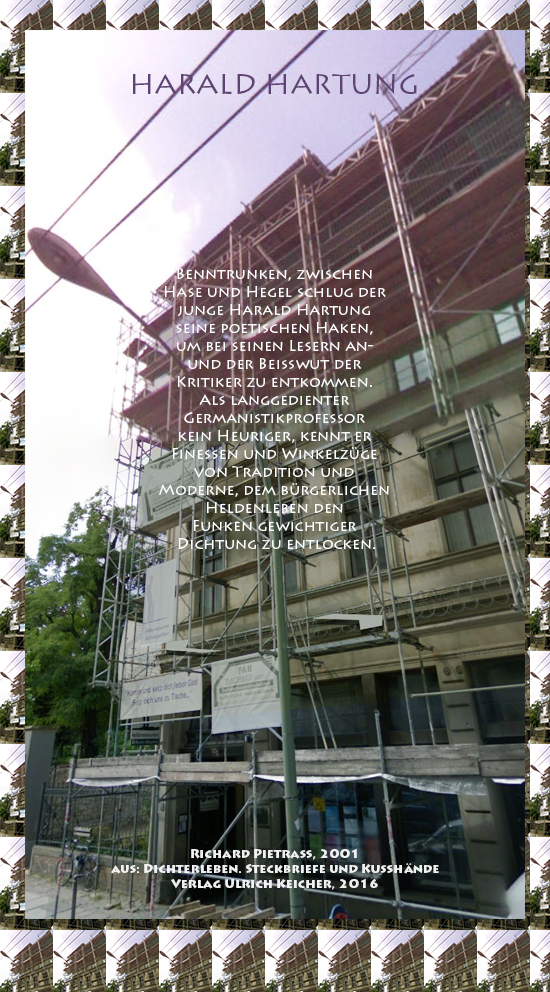Harald Hartung: Die Launen der Poesie
PLACEBOS, KWEHRDEUTSCH, VATERLANDKANAL
– Anmerkungen zur jungen Lyrik (1991)
von sprach-
placebos sind di szenen überfoll.
Thomas Kling
Vor einiger Zeit hieß es in der Laudatio auf eine junge Lyrikerin:
Die häßliche Verszeile, die mißlungene Wendung ist die eigentliche stilistische Leistung des modernen Dichters.
Das sagt man nicht in einer Preisrede, wenn man es nicht halbwegs ernst meint. Aber das Paradox, an das möglicherweise gedacht war, verliert seine Kraft, wenn ihm die Texte nicht entsprechen. Keine Rede also von diesen Gedichten. Das zweischneidige Lob, das ihnen galt, ist symptomatisch für eine Ratlosigkeit, die sich als Chuzpe gibt und – als Ausweg aus der permanenten Lyrik-Krise – das Phantom einer genialen sprachlichen Unkultur beschwört.
Nicht zu leugnen ist allerdings, daß es in der Lyrik der achtziger Jahre ein neues Biedermeier, eine Herz-Schmerz-Poesie gegeben hat, zu der Alternativen nötig sind. Doch das Problem sitzt tiefer als der Gegensatz von Kultur und Unkultur, von häßlicher und schöner Sprache. Enzensbergers These, wonach sich die meisten poetischen Erzeugnisse mit der Wiederaufbereitung ausgebrannten Materials begnügten, gilt ja nicht bloß für den konventionellen, sondern auch für den progressiven Flügel der jüngsten Lyrik. Nur ist hier das Problem noch verzwickter, weil im ostentativen Avantgarde-Anspruch das Konventionelle sich umso besser tarnt. Wer Reimgedichte und Sonette schreibt, muß schon einiges aufbieten, um zu zeigen, daß er nicht wie Eichendorff oder Rilke, ja nicht einmal wie Günter Kunert oder Ulla Hahn schreibt. Wer sich experimentell gibt, darf mit dem Respekt von Kritikern rechnen, die begreiflicherweise ungern zugeben, etwas nicht zu verstehen. So gehen die Recyclingprozesse vonstatten und der lyrische Betrieb weiter. Das Gedächtnis der Gegenwart ist ohnedies kurz. Die Imitationen überlagern die Originale, Imitationen die Imitationen; und ungewohnte experimentelle Techniken gehen in den allgemeinen Besitz über: in die Sprache der Werbung wie in den politischen Diskurs. Es war kein Lyriker, der im Herbst der deutschen Wende auf die plakatierten Parolen „Wir sind das Volk“ und „Wir sind ein Volk“, „Ich bin Volker“ als Trumpf setzte. Sind wir ein Volk von Dichtern – oder sind die jungen Leute nur gewitzter oder schneller mit ihrem Witz?
Derlei gehört zu den Wortspielen einer Generation. Aber es hat Tradition. Schon Arno Schmidt suchte einen „mä-10“, übte sich in „fonetischer Schreibunk“ und erforschte die mehrsinnigen Wurzeln der Wörter durch seine Etyms. In der Lyrik exerzierten, als Jux oder engagierte Wortbefragung, Ernst Jandl und Erich Fried diese Logopoeia, das Spiel mit Gestalt und Sinn der Worte: „eile mit feile / auf den fellen / feiter meere“ oder „Drei Tage dann kriecht der Krieg / als Wurm wieder aus.“ Inzwischen sind solche verbalen Manipulationen ubiquitär: Produkte eines semantischen Changierens zwischen Poesie und Kalauerei, Jugendsprache und Sprach-Rock. Beliebt (quasi als Sublimation der allgemeinen Rechtschreibschwäche) sind Ver-Schreibungen der verschiedensten Art – gleichermaßen beliebt bei jungen Lyrikern in Ost wie West.
Bei Thomas Kling liest man: „yachtinstinkt“, „sounnz“, „hautkot-ürfummel“, „taax: v-N-auge“, „reh-frenng: WOTTA SAILIN’“, „liedschattn“, „der ernste laichzug“, „sicher heizkräfte, drastische heizarmee“, „zrrmatt“. – Bei Bert PapenfußGorek: „seh-krankheit“, „tanzhodenkind“, „militanzte“, „wirrus“, „potenZierung“, „ver-lust“, „zmetter-lingue“, „fanten asien“ – Bei Sascha Anderson: „eNDe“ (= ND: Neues Deutschland), „MISS MEDEA WAHL“, „westöstlicher die wahn“. Bei Rainer Schedlinski: „trieft er ins schwarze.“ – Was von diesen verbalen Manipulationen trifft, was trieft in Schwarze? Sind es Äußerlichkeiten oder nicht auch Innerlichkeiten einer Generation? Symptome des Infantilismus, der Reflexion, der Sprachscham, des Widerstands – aber welchen Widerstands?
Zumindest in der DDR konnten Sprachspiel und -experiment so verstanden werden – als Gegenrede zum totalitären Diskurs. „der totalitäre diskurs der gesellschaft“, so Rainer Schedlinski in einem Sammelband,
determiniert den einzelnen bis in seine geringsten und intimsten tätigkeiten, indem er für alles, was einer tut, einen gesellschaftlichen sinn formuliert (…) was ich sagen will ist, daß die diskursive macht so mächtig, weil schlüssig ist, und daß diese schlüssigkeit sie derart vor der wirklichkeit abdichtet, daß ihre hermetik nur durch humor gelüftet („was immer lustig ist, ist subversiv“, orwell), durch Individualität verwässert, durch aggressivität aufgebrochen, oder durch kunst verlassen werden kann.
Sollte Schedlinski recht haben, dann wäre die junge Poesie nicht bloß witzig, aggressiv, individuell, sie setzte auch eine neue Wahrnehmung an die Stelle eines verfestigten (totalitären) Diskurses – sie leistete eine „Fertiefung Der Wahrnehmung“, um mit Bert Papenfuß-Gorek, dem Kollegen vom Prenzlauer Berg, zu reden.
Bert Papenfuß-Gorek, Sascha Anderson, Rainer Schedlinski
Noch vor einigen Jahren galten sie als aufrührerisch und subversiv, die Poeten der „Prenzlauer-Berg-Connection“, wie Adolf Endler sie anerkennend gruselnd genannt hat. Zwischen Anpassung und Dissidenz hatten sie einen dritten Weg gewählt: die Verweigerung, das Abtauchen in den Untergrund, zumindest in die Halb-Öffentlichkeit der Malerbücher und hektographierten Zeitschriften, der Lesungen in Kirchen oder privaten Zirkeln. Zuerst wurden diese scheinbar Semiprofessionellen ignoriert, dann behindert oder verfolgt, zuletzt zugelassen und in Reihen außer der Reihe auch von großen Verlagen der DDR publiziert. In dem langsam zerbröckelnden Staat schien Poesie noch einmal politisch wirksam zu sein: weniger durch ihre brisante Thesen als durch den Anarchismus der Sprache, durch ein witzig verfremdetes „Kwehrdeutsch“, das die unterschiedlichsten Einflüsse zwischen Barock und Experiment, Schwitters und Chlebnikow, Rotwelsch und Jugendsprache verarbeitete.
Daß es sich um die authentische Möglichkeit einer „dritten Literatur“ handelte, war bis vor kurzem unbestritten. Einwände, die es natürlich auch gab, bezogen sich allenfalls auf die Originalität bzw. Modernität dieser Literatur. Manfred Jäger etwa sprach von einer „nachgeholten Moderne in der realismusgeschädigten DDR“. Noch vor der Wende setzte sich freilich in den kleinen Zirkeln der nicht-offiziellen Literatur der Eindruck durch, daß auch das scheinbar Unverwertbare und Unvereinnahmbare integrierbar sein kann. Inzwischen wird der gesellschaftliche, politische, vor allem der moralische Status dieser Literatur in Frage gestellt. Das kann hier nicht interessieren. Zunächst einmal liegen keine Fakten auf dem Tisch, nach denen sich Schuld und Verstrickung aufdröseln ließen; und es ist fraglich, ob es unzweideutige Fakten überhaupt geben wird. Außerdem versteht sich, daß man Heroismus und Märtyrertum nur von sich selbst, nicht aber von anderen verlangen kann. Bleiben wir bei der Literatur, bei den Texten. Die Stasi vermochte viel, mehr als zu ahnen und zu befürchten war. Nur eines gewiß nicht: sie konnte nicht dichten. Sie hat, womöglich, literarische Zirkel durchsetzen, nicht aber erschaffen können. Ich bleibe bei den Texten; zunächst bei den jüngsten Publikationen einiger Prenzlauerberg-Autoren.
Der wohl passionierteste Sprachspieler unter ihnen ist Bert Papenfuß-Gorek, der Finder des Wortes „Kwehrdeutsch“. Sein Gedichtbuch Soja, eine Zusammenstellung neuester und älterer Texte, zeigt seine Methode voll entwickelt, fast schon als Manier. Die durchgehend verfremdete Orthographie wirkt gewöhnungsbedürftig, beruht aber auf vergleichsweise schlichten Tricks. Der Autor selbst verrät sein Rezept:
nach ueberstandener
seh-krankheit
erkennen
erweiterte augen die
riffgelaufnen
stabenschiffe
,ix‘ als ,ka-es‘ &
,zet‘ als ,te-es‘
Immerhin macht er uns kein X für ein U vor. Hat man sich erst einmal eingelesen, macht die „kwehrsprache“ kaum noch Probleme – zumal beim Lautlesen. Freilich geht dann auch schöne Doppeldeutigkeit verloren: die aparten „zmetter-lingue“ verlieren ihren linguistischen Charme.
Nun hat (oder hatte) das Sprachspiel auch politische Intentionen. Es möchte „wortschaetze gegen ferfestigungen“ mobilisieren. Doch gegen welche? Was ist, wenn bestimmte Bastionen und Dogmen gefallen sind? Und wie frei ist der Autor selbst? Fühlt er sich zwischen den politischen Ereignissen zerrieben oder liebt er das Finassieren? Seine Texte zeigen sich eigentümlich unentschieden. Mal will das Sprachspiel, „dass kommunismus / kommen muss“. Ein paar Seiten später wird das Chaos an- und ausgerufen:
Das KAOS Kaeme
Komm.
Ein anderes Mal wird Klage geführt um den „fruehling zu bald / immer zu welk“, vermutlich den Frühling der Wende.
Was soll da gelten? Halten wir uns an des Autors Eingeständnis der Ratlosigkeit:
ich such die kreuts & die kwehr
kreutsdeutsch treff ich einen
gruess ich ihn kwehrdeutsch
auf wiedersehen faterland
ich such das meuterland.
Die wirkliche oder gespielte Ratlosigkeit hat Gründe. Wir lesen Texte aus diversen Jahren, unterschiedlichen Situationen. Etliches stand schon 1989 in dem Band dreizehntanz. Das neue Buch ist zu einem guten Teil Reprise, und – mehr als ein Schönheitsfehler –: die neuen Texte fügen der Manier und den Themen des Autors nichts Wesentliches hinzu. Man liest mühsame Etüden und Exerzitien oder nachgetragene politische Epigramme. Etwa das auf Honecker gemünzte „99, 86“:
forn er hinten
ix bin nixt
wehI ix erix
tropft blut mein
in die urne
er oder ix
ix bei leibe
darum erix.
Schnee vom vergangenen Jahr. Gegen welche „ferfestigungen“ rennt Papenfuß-Gorek da noch an? Wo liegt jetzt das Meuterland, da Vater Staat und Mutter Sprache nicht mehr dräuen? Der Autor wird sich neue Themen suchen müssen, neue Techniken in einer Gesellschaft, die von der prinzipiellen Harmlosigkeit von Kunst ausgeht.
Sascha Anderson gab sich immer schon grimmig und ungemütlich. Er möchte kein Spieler sein. Seine Sache ist das Pathos, die dunkle Rede. Er taucht die Gedichte von Jewish Jetset in eine Sprachverdunkelung, in der die Gesten groß und pathetisch geraten, aber auch so rätselhaft wie die graphischen Chiffren, die A.R. Penck zu dem Band beisteuerte. Im Kern unmißverständlich sind aber einige Texte zu Anfang. Sie basieren auf persönlicher Erfahrung und sprechen von Verhör, Tortur und Gefangensein:
im anfang war die stunde auf dem stuhl, dem leeren,
rotberührten beins. der rest war sitzen, darauf
hoffen, glaube an und fraß, in mich hinein.
Das Ich wird „zum zeugen in eigner sache“ aufgerufen.
Das Titelgedicht „Jewish jetset“, das auf die Judenvernichtung anspielt, weiß: „das böse trägt von jetzt an keine stiefel / mehr“ – ein prägnanter Satz und von andauernder Aktualität. Nicht immer formuliert Anderson so genau. Andere Texte, die mit den historischen Vertreibungen der Juden zu tun haben, lösen ihr Thema in dunkle Assoziationen auf, denen auch die nachgetragenen Anmerkungen nicht aufhelfen. Etliche dieser Gedichte sind wohl nur ansatzweise zu verstehen; und vermutlich wollen sie auch gar nicht „verstanden“ sein. Das Sprachdunkel, so darf man annehmen, bot Schutz. Auf diese Hermetik zielt ein theoretisierender Einschub im Buch. Der „sinn“ erscheint Anderson als „eine treppe, richtungslos wie in den träumen, da das wissen, ob es aufwärts oder abwärts geht, keine postpsychologisch zu bezeichnende rolle spielt“. Um aber seiner alogischen Schreibweise doch so etwas wie eine theoretische Begründung zu geben, träumt Anderson von einem „struktur-orientierten, polyedrischen ansatz der literatur“. Was „polyedrisch“ gedacht sein mag, erscheint dem Leser oft als Geröll von Sprachbrocken. Wo es sich zu neuen Strukturen ordnet, ist auch immer wieder die Sprachskepsis mit komponiert:
ach wie verfluch ich vater
und muttersprache, die dem umzugsgut im eisenbahncontainer ähnelnde
fähre des verstands.
Nach Andersons Neo-Avantgarde wirken die Gedichte in Rainer Schedlinskis Die Männer der Frauen geradezu konventionell. Der Autor ist ganz altmodisch an Themen wie Alltag und Liebe interessiert, und da lauern natürlich Epigonie und Sentimentalität. Schedlinski läßt sich auf beide ein, doch er findet, gewissermaßen im letzten Moment, den Dreh, um dem Kitsch zu entgehen. Er schreibt etwa:
Was ich brauche ist diese elende liebe
ohne die steifen bekanntschaften.
Das wäre pubertär, folgte nicht der Vers:
an diesem behaarten ort auf der straße.
Immer wieder sind es einzelne Beobachtungen, die zeigen, daß Schedlinski ohne Pseudotiefsinn Wirklichkeit bezeichnen und verwandeln kann. Etwa zwei Zeilen in einem Liebesgedicht: „mein gesicht ist über den kopf gespannt wie ein trockener film“ und „das lachen zerrt am mund wie elektroden.“ Der Autor weiß, „die dichter erzählen viel, wenn der tag lang ist.“ Deshalb wohl beansprucht er keinerlei Vorrecht der Poeten aufs Sprachproblem: „es sind dieselben worte mit denen wir lügen.“ Aber natürlich hält Schedlinski an dem einen Vorrecht der Dichter fest: präzis zu träumen. Er formuliert es in der Maxime „die schiffbrüchigen halten die ufer zusammen.“
Barbara Köhler, Kerstin Hensel
Auch Barbara Köhler und Kerstin Hensel (beide Absolventinnen des Leipziger Literaturinstituts Johannes R. Becher) geben sich nicht ostentativ avantgardistisch. Ihre Bindung an die lyrische Tradition ist stark und unverkennbar – durchaus nicht zum Nachteil ihrer Gedichte. Das zeigt zunächst Barbara Köhlers Debüt Deutsches Roulette. Gewiß finden sich Einflüsse und Anspielungen in Menge, ist der autobiographische Stoff noch nicht immer eingeschmolzen, herrscht bei den gewählten Formen noch ein gewisses Probestadium zwischen Prosa und Vers, Notiz und Sonett. Aber Kraft und Substanz sind erkennbar und werden nicht epigonal geglättet. Barbara Köhler hält sich an Vorbilder (und so prekäre wie die Bachmann oder Hölderlin), doch gibt ihr dieser Halt die Chance, eigene Erfahrung einfließen zu lassen. So in dem Sonett „Endstelle“, einer Variation auf Hölderlins „Hälfte des Lebens“, Es beginnt:
DIE MAUERN STEHN. Ich stehe an der Mauer
des Abrißhauses an der Haltestelle;
erinnre Lebens-Läufe, Todes-Fälle,
vergesse, wem ich trau in meiner Trauer.
Die Form also provoziert die Einfälle, so auch in „Rondeau Allemagne“:
Ich harre aus im Land und geh, ihm fremd,
Mit einer Liebe, die mich über Grenzen treibt,
Zwischen den Himmeln. Sehe jeder, wo er bleibt;
Ich harre aus im Land und geh ihm fremd.
Das beschreibt knapp, formelhaft eine Dialektik von Liebe und Entfremdung.
Kerstin Hensel, die auch mit Prosa hervortrat, hat bereits mehrere Lyrikbände veröffentlicht (mit diversen Überschneidungen in den Ost- und West-Publikationen). Bei ihr gibt es Liebes- und Naturgedichte, die erstaunlich frei und sicher mit ihren Vorbildern umgehen. Allenfalls zeigen ein paar der Kirsch abgelauschte Manierismen und ein paar Kraftmeiereien à la Brecht und Mickel, daß diese frühe Sicherheit auch ihre Probleme hat. Man merkt wohl an gewissen lokalen oder thematischen Eigenheiten, daß diese Gedichte in der DDR geschrieben wurden. Sie sind nicht apolitisch und klammern Gesellschaftliches und Politisches keineswegs aus. Aber es fiele gleich schwer, Kerstin Hensels Verse als Zeugnisse der Dissidenz oder der Affirmation zu begreifen. Ihr Klima ist gewissermaßen primär poetisch. Karl Mickel, als ihr Mentor, nennt die Autorin „eine Echte aus der Hexenzunft“ – nach Sarah Kirsch und Irmtraud Morgner. Das ist schön gesagt, aber auch Ausdruck einer Verlegenheit. Sarah Kirsch brachten ihre Zaubersprüche von 1973, gelinde gesagt, politische Ungelegenheiten. Der Nachfolgerin im Metier konnte applaudiert werden. Sie kennt keine Angst vor Epigonie und kann, unter welchen Prämissen auch immer, die Gegenwart als Arbeitsbedingung akzeptieren: „In keiner Zeit wird man zu spät geboren“, heißt es in einem Sonett.
Dieser hochgemute Satz gilt für Sprache und Thematik gleichermaßen. Kerstin Hensel schreibt Sonette (einige sogar im barocken Alexandriner) und freie Verse nebeneinander. Ihre Ausdruckslust ist nicht von Sprachzweifel angekränkelt, auch wenn sie einmal schreibt:
An allen Worten nagen die Ratten:
ngedul Mißge Uh Wahr ei.
Man achte darauf, welche Worte genannt werden: Ungeduld, Mißgefühl, Wahrheit. Sie überläßt uns deren politische Ausdeutung.
Die politische Lesart ist in Kerstin Hensels Gedichten ohnedies immer nur eine unter mehreren und meist nicht einmal die überzeugendste. Ihre besten Stücke genügen sich selbst; auch da, wo sie parabolisch wirken. Als Beispiel das Gedicht „Erfüllung“:
An frühen Tagen fuhr ich gerne Zug, da
Hinter mattgeschwitzten Scheiben
Brach das Land
Aus allen Fugen Furchen. Was es trug
An stolzen Früchten
Trug der Sand.
Und hielt ich an, sprang ab
In voller Fahrt
Brach ich
Mir Bein und Hals und hart
Schlugs mich ins volle
Korn das rauschend kühlte.
So zog ich leer dahin
So kams, daß ich, was mich nicht
Füllte, fühlte.
Das Gedicht „Erfüllung“ zeigt die Dialektik seines Themas, den Widerstreit von Fülle und Leere. Natürlich ist das auch politisch zu lesen, doch ebensogut poetologisch. Kerstin Hensel kann den Avantgarde-Anspruch mit mildem Spott unterlaufen:
Im Süßseim der Avantgarde
Steht das Gewebe.
Dagegen! Dagegen!! Sein oder laufen.
Thomas Kling, Durs Grünbein, Uwe Kolbe
Aber es gibt wohl so etwas, das sich als Avantgarde versteht. Thomas Kling (aus Düsseldorf, jetzt in Köln) und Durs Grünbein (aus Dresden, jetzt in Berlin) wären ihr wohl zuzurechnen.
Thomas Kling ist schon so etwas wie ein Star dieser Szene. Sein zweiter Gedichtband geschmacksverstärker verleugnet nicht das Synthetische seiner Intention: einem verbrauchten Reiz soll offenbar aufgeholfen werden:
UND DER LETZTE KONKRETE KALAUER
KOMMT DANN „BITTE MIT GESCHMACKSVERSTÄRKER“.
Man ergänze: der letzte Kalauer der Konkreten Poesie. Ihn wendet Kling methodisch gegen die zeitgenössische Realität, um ihre Banalität zu würzen. Der Titel des neuen Bandes brennstabm zielt auf eine weitere Forcierung: Sprachgewohnheiten und Realitätsauffassungen sollen gleichsam erhitzt und aufgeschmolzen werden. Das geht seit Arno Holz nicht ohne Polemik gegen die Lyrikkonvention ab. „von sprach- / placebos sind di szenen überfoll“, diagnostiziert Kling, und wendet sich gegen „jauche-permanenzn. im grenz- / gang ertaubte claims. die abgegrastn / ausgegrenztn schädel!“
Solch ein Rundumschlag verpflichtet; und Kling ist viel zu gewitzt, um nicht seine Kritik unter einen mentalen Vorbehalt zu stellen:
den sprachn das sentimentale
abknöpfn, als wär da nicht schon so gut
wi alles im eimer; bausch der im
hohn bogen in ein op-behältnis
fliegt.
Wo alles im Eimer ist, läßt sich der Gestus des Wegwerfens als artistische Leistung bewundern. Deshalb sind Art und Unart dieser heftigen Lyrik an Beispielen zu prüfen. Etwa an „di zerstörtn, ein gesang“, einem mehrteiligen Gedicht, das die Kriege unseres Jahrhunderts als einen Albtraum von Bildern und Sprachsplittern („aus schwer zerlebtn trauma-höhlen“) zu fassen sucht. Es zeigt vielleicht am deutlichsten, worin Klings Begabung liegt. Ich zitiere Nr. 5 von 9 Teilen:
hart umledertn herznz. unsere schwere.
geschüzze so bricht der tag an die rattnnacht.
nachte nachte rattrimachte im böschunx-, im
ratten-mohn. wir sind noch WIR WAREN UNTER DER
WEISZN (jiddisch, di mond) da waren wir,
DAS WARNEN WIR. UMSONST-GESANG.
Das ist von einer kruden Schönheit. Der Autor schließt hier an gewisse Möglichkeiten Celans, das Schlimme im grotesken Sprachduktus einzufangen.
Rolf Dieter Brinkmann dagegen (es ist ja erlaubt zu lernen) ist Klings Vorbild in seinen Alltagsszenen. Immer wieder einmal findet man im Sprachschotter Details, in denen etwas aufblitzt. Etwa:
ich lecke di
achsel des sommers; der sommer ist eine frau.
Oder Kling gelingen Blicke auf „gestokkte“ Bilder oder eine satirische Szene wie „taunusprobe. lehrgang im hessischen“:
kajalflor zu heavy metal sounnz (vorher-
sage: grölender stammtisch), gerekktes
hinterzimmer-, jetzt gast-stubn-,heill!!‘
di theknmannschaft, pokalpokal, trägt
501 trägt wildleder-boots, drittklassiger
western den sie hier abfahrn HEILHEILHEIL!!!!
Vorerst aber ist der sprachliche Furor bei Thomas Kling größer als der Zugewinn an poetischer Realität.
Durs Grünbein (Jahrgang 1962) ist der jüngste in unserer Reihe. Sein erster Band Grauzone morgens zeichnete die damalige DDR so:
In dieser
Grauzonenlandschaft am Morgen
ist vorerst alles ein
toter Wirrwar abgestandener Bilder, z.B.
etwas Rasierschaum im
Rinnstein, ein Halsband
oder im Weitergehn ein Verbotsschild.
Auch hier winkte Brinkmann herüber, ohne Grünbeins „Grautonskala“ wesentlich zu beleben. Grünbeins eben erschienener zweiter Band Schädelbasislektion zeigt einen beträchtlichen Fortschritt der Entwicklung, was Sprache und Form wie die Themen angeht. Das kurze Reimgedicht wie der quasi dramatische Monolog, die lyrische Anekdote wie der materialienreiche Flächentext stehen dem Autor gleichermaßen zur Verfügung. Auch Grünbein sollte man da aufsuchen, wo er suggestiv und präzis ist. Bei einer lyrischen Anekdote wie der vom Toten, der „dreizehn Wochen / Aufrecht vorm Fernseher“ saß. Bei einer Passage in einem längeren Gedicht, die das Sprachproblem dialogisch auseinanderlegt: „Nein, ich erträume nichts mehr.“ „Bist du krank?“ / „Es sind die Worte, hörst du?“ „Ruh dich aus…“ / „Es ist das Feilschen, nicht der Klang.“ „Kann sein.“ / „Wir hängen alle in der Sprache fest, im leeren Raum.“ Oder bei Texten, die Benns Thema von Verhirnung und Regression als Schädelbasislektion wieder aufnehmen.
In Grünbeins Band gibt es auch schon lyrische Reflexe auf die politischen Ereignisse der Wende. Diese „Sieben Telegramme“ haben originelle Passagen (¡Ich sah: Hitlers Ohr rosig im Bunker der Reichskanzlei“). Ihr appellatives Moment fällt dagegen, gelinde gesagt, ungeschickt aus:
Komm zu dir Gedicht, Berlins Mauer ist offen jetzt.
Wehleid des Wartens, Langweile in Hegels Schmalland
Vorbei wie das stählerne Schweigen… Heil Stalin.
Grünbein ist (zum Glück) kein lyrischer Reporter. Unübersehbar an seinen Gedichten ist jedoch, daß er sich (begünstigt durch seine Jugend) zunehmend von einer spezifischen und begrenzten DDR-Thematik löst.
Uwe Kolbe hat seinerzeit, das heißt 1980, mit seinem ersten Buch Hineingeboren einer ganzen Generation junger DDR-Lyriker das Stichwort gegeben. Franz Fühmann hatte damals den jungen Mann mit einem „Ecce poeta!“ begrüßt und geschlossen:
Schwer genug wird er’s noch haben; er macht sich’s ja selbst schwer, denn leichter geht’s nicht. Er schaut ja auch nur aus wie der Hans im Glück, und wir wollen ihm heute wünschen, daß er seinen Goldklumpen nie wegtauscht.
Das hat Kolbe auch nicht tun wollen. 1987 übersiedelte er mit einem Visum der DDR in die Bundesrepublik.
Vaterlandkanal, das Lyrik und Kurzprosa als „ein Fahrtenbuch“ zusammenfaßt, ist Kolbes viertes Buch. Es zeigt die Probleme, die dieser Hans im Glück mit seinem ehemaligen Lind seinem jetzigen Land hat, deutlich genug. Unterm Titel „Der eherne Kreis“ heißt es zu Beginn:
Ich habe mein Land verloren.
(…) Sein Name war Fingerhut.
Ich habe meine Finger noch
und schenke mir den Rest.
Wer sich für die Zensurpraxis der DDR interessiert, findet, datiert, nun all die Texte nachgetragen, die seinerzeit der Zensur zum Opfer fielen. Ein 1979 geschriebener „Gruß an Karl Mickel“ etwa ist von präziser Gnomik und äußerstem Freimut:
Zugeb ich, daß ich ganz privat
so reflektiere nah am Hochverrat,
und meine Gerade nenn ich Grat:
Am einen Fuß die Schelle klirrt,
der andre nimmt ein Bad
in Eselsmilch.
Deutlicher ließ sich nicht formulieren, wie sehr die opponierende Poesie Teil des Systems war. Die auf Dauer unvermeidliche persönliche Deformation ist in einem ebenfalls verbotenen Text von 1982 auf den Punkt gebracht:
Wirklich, es gibt so eine innere Freiheit, die aus Gleichschaltung beinahe Genuß zieht.
Aber die andere, die neue Freiheit – was ist mit ihr? Kolbe setzt, notgedrungen, auf „Erlebnislyrik“, die die Erfahrung von Entfremdung und Verlust in gerafften Bildern zu bewältigen sucht:
Erlebnislyrik, große Not, ein feuchtes
Überborden, Hans Heimatlos der Name.
Kam hergeschwomen, ließ es hinter sich,
sein Wilhelmsstrand, sein Vaterlandkanal.
In solchen Versen, mag sein, steckt ein Stück Sentimentalität. Kolbe hat seiner Sprache das Sentimentale nicht à la Kling „abknöpfn“ wollen. Aber damit ist noch nicht entschieden, ob seine Lyrik zu den „sprachplacebos“ zählt. Überhaupt ist, bei Gedichten, so schnell nichts entschieden. Sie brauchen Zeit. Sentiment und Desperation, Sprachspiel und Erfahrungsnotat gehören zueinander. Der erweiterten deutschen „Szene“ könnte ein neuer Widerstreit von Experiment und Erfahrung zugutekommen.
Die Pflaumen im Eisschrank
– Harald Hartungs Essays und Rezensionen zur Poesie. –
Einen „Kritikopoeten“ hat sich der Dichter und Kritiker Harald Hartung einmal genannt, eine „Personalunion von Lyriker und Essayist“. Acht Gedichtbände hat er seit 1970 veröffentlicht, dann eine umfangreiche Sammlung aus alten und neuen Texten (Aktennotiz meines Engels, 2005), seither den neunten Gedichtband Wintermalerei (2010) und die zwischen Prosagedicht und essayistischer Reflexion balancierenden Notate Der Tag vor dem Abend (2012). Siebenundzwanzig Jahre lang, von 1971 bis 1998, hat er, in vieler Hinsicht Nachfolger Walter Höllerers, an der Technischen Universität Berlin Geschichte und Theorie der Lyrik gelehrt, zeitweise auch am Poetikinstitut der Universität Leipzig. Die umfangreiche Fortschreibung von Höllerers Theorie der modernen Lyrik, die er 2003 zusammen mit Norbert Miller unternommen hat, gehört ebenso zu den nachlesbaren Ergebnissen dieser Arbeit wie einige Essaybände – und eine schier unüberschaubar große Zahl von Lyrik-Rezensionen, die im Laufe von mehr als drei Jahrzehnten in der Zeitschrift Merkur und im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erschienen sind. Bekannt geworden ist er mit Essays, die von Lyrik handeln (nur nicht von seiner eigenen), und den Anthologien Luftfracht und Jahrhundertgedächtnis, die wunderbare Poesie enthalten (nur nicht seine eigene).
Für seine Gedichte hat Harald Hartung Auszeichnungen erhalten wie den Droste-Hülshoff-Preis 1987, den Würth-Preis für Europäische Literatur 2004 und den Literaturpreis Ruhr 2012. Und für seine Essays hat ihm die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung 2009 den Johann-Heinrich-Merck-Preis für Essay und Kritik verliehen. Dieses poetisch-essayistische Doppelwerk könnte Anlass geben, ein altes deutsches Vorurteil ein- für allemal zu revidieren. Denn dieser Gelehrte ist einer der wichtigsten Lyriker in der gegenwärtigen deutschen Literatur. Und dieser Lyriker ist einer der gelehrtesten Kenner, der scharfsinnigsten Analytiker und souveränsten Vermittler lyrischer Weltliteratur, die wir im deutschen Sprachraum haben.
*
In Harald Hartungs großer Anthologie Luftfracht. Internationale Poesie 1940 bis 1990 steht eines seiner Lieblingsgedichte, zugleich eine der lyrischen Ikonen der Moderne. Es ist W.C. Williams’ Gedicht „This is just to say“:
I have eaten
the plums
that were in
the icebox
and which
you were probably
saving
for breakfast
Forgive me
they were delicious
so sweet
and so cold
Das ist alles, und es ist unauslotbar. Ein Zettel auf dem Küchentisch, eine prosaische Nachricht zwischen Liebenden, so ,realistisch‘, dass man sich das Gedicht unschwer als objet trouvé vorstellen kann, als einen nur durch Zeilenbrüche und Pausen versförmig eingerichteten Text. Und doch ist es voller leiser Hinweise auf die Beziehung zwischen Absender und Leser, auf Seelisches und Körperliches: die Sinnlichkeit der Geschmacksnervenreize, die Verbindung von Süßigkeit und Kälte, Dinge und Umstände, die sich auch als erotische Metaphern lesen lassen – die Pflaume, die nächtliche Versuchung –, die Bitte um Vergebung statt bloß um Verzeihung, die tiefe und selbstverständliche Zutraulichkeit, die von der Notiz mit keinem Wort behauptet, aber mit jedem gezeigt wird. Wie viel kühle und süße Wirklichkeit, welche Tiefe in der reinen Oberfläche! Der Beiläufigkeit der Mitteilung entspricht die musikalische Rhythmisierung ihres prosaischen Tonfalls. In der Lakonie, mit der ein alltäglicher (oder nächtlicher) Zettel zum Gedicht wird, ereignet sich die Verklärung des Gewöhnlichen, wird der Alltag zur Poesie.
In Hartungs Anthologie findet sich Williams’ Gedicht genau in der Mitte. Das mag Zufall sein, doch diese Verse bilden so etwas wie den Polarstern, an dem sich die weltweiten Erkundungsfahrten des Anthologisten selbst, des Dichters und Kritikers, ausrichten. Es nimmt diese Position nicht wegen seiner spezifischen Ausdrucksformen ein, auch nicht wegen der spezifisch angelsächsischen Traditionslinie der Moderne, zu der es gehört und der Hartung sich verbunden fühlt, sondern in seiner Verbindung von Sujets, die gemeinhin als romantisch gelten dürfen, mit sachlicher und handwerklicher Präzision, in der Einheit von Understatement und dem, was Goethe „Weitstrahlsinnigkeit“ nennt. Diese Einheit bildet so etwas wie das Urmeter, an dem sich alles kritische Maßnehmen des Rezensenten Harald Hartung orientiert. Dies vorausgesetzt, gibt es in Hartungs lyrischer Wunderkammer viele Schreibweisen; sie ist erfüllt von den unterschiedlichsten, gern auch dissonanten Stimmen. Wie Auden und Wallace Stevens, so gehören auch Philip Larkin und Eugenio Montale zu den Hausheiligen seines modernen Kanons, Tomas Tranströmer und Czesław Miłosz ebenso wie Frank O’Hara, Pasolini nicht weniger als Ungaretti, oder, nur wenig weiter entfernt, Emily Dickinson.
Es ist bezeichnend für diese Offenheit, dass Hartung die – mit Brecht zu sprechen – „pontifikale Linie“ der modernen Poesie mit derselben Aufmerksamkeit verfolgt wie die „plebejische“. Darum geht er in seinem letzten Essayband Ein Unterton von Glück dem Umgang mit Odenmaßen in der Poesie des 20. Jahrhunderts ebenso aufmerksam nach, wie er, am anderen Ende des lyrischen Spektrums, in der neusachlichen Poesie Erich Kästners eine in die industrialisierte Metropole verschlagene empfindsame Naturlyrik wiederentdeckt. Derselbe Kritiker, der Inger Christensens streng gebaute Dichtungen als einen „Kosmos aus Sprache“ bewundert und Oskar Pastiors Wörterspiele als strenges „Exerzitium“ begreift, rühmt Robert Gernhardt als einen „Profi des Leichten, das schwer zu machen ist“. Unterschiedlichstes ist ihm willkommen. Nur ist und bleibt er, wie Erich Kästner, den er als einen „Virtuosen des Mittleren“ empfiehlt (und dessen Gedichte er ediert hat), „spinnefeind der unechten Tiefe, die im Land der Dichter und Denker nicht aus der Mode kommt“; so Kästner in einem essayistischen Selbstporträt. Man muss nur gleich hinzufügen: Hartung ist ihr feind um einer Dichtung willen, die man ohne Falsch „tief“ nennen dürfte. Einer Dichtung wie der Verse über die Pflaumen im Eisschrank.
Denn bei Williams, so schreibt Hartung in einem hier auf Seite 76 nachzulesenden Artikel, „könnten junge Poeten auch heute lernen, ohne jemand imitieren zu müssen – man muss nicht gleich beim späten Celan anfangen“. Lernen, ohne imitieren zu müssen: die Eröffnung dieser Möglichkeit hat mit ebenjener Dichtungsauffassung zu tun, für die dieser Lyriker steht, mit einer Aufmerksamkeit, die nicht von der Poesie zum Poeten zurück –, sondern durch sie hinaus ins Freie geleitet wird:
Williams führt uns nicht auf seine Person oder Manier zurück, sondern ins Offene: in die Wirklichkeit.
*
Wie die in Harald Hartungs Essays erörterten poetischen Vorbilder und poetologischen Fragen nicht ohne spürbare Folgen für seine eigene Dichtung geblieben sind, so haben sich aus seinen Arbeiten als Lyriker, als Kritiker und Lehrer Essaybücher ergeben, die das öffentliche Nachdenken über die moderne Poesie in Deutschland auf neue Grundlagen gestellt haben. 1975 erschien sein sachkundiger Rückblick auf Experimentelle Literatur und Konkrete Poesie, 1985 die Lagebeschreibung Deutsche Lyrik seit 1965, 1996 eine glänzende Porträtgalerie gegenwärtiger Welt-Lyrik von Pound und Pessoa bis zu Brodsky, Walcott und Inger Christensen, in dem umfangreichen Band Masken und Stimmen.
Seine Gedichte hat Hartung, immerhin schon seit 1957, veröffentlicht unter so schönen und gewissermaßen halblauten Titeln wie Reichsbahngelände oder Langsamer träumen, Arte povera, Das gewöhnliche Licht, Wintermalerei. Ganz genau und alltäglich klingt das alles, ganz leise und leicht, und dabei geht es um Gedichte auf Leben und Tod. In ihrer gar nicht gewöhnlichen Beleuchtung zeigt sich, was Goethe, in durchaus eigener Sache, einen „realistischen Tic“ genannt hat. Manchmal ist Hartung, der Bergmannssohn aus Herne, als „Neorealist“ beschrieben worden. Und oft hat er selbst von seinem Bemühen gesprochen, das Wirkliche als Wirkliches zu fassen und Stilisierungen ebenso zu meiden wie die naive Mimesis. So kommen selbstreflexive „Snapshots“ zustande wie dieser, der nur fünfmal zehn Silben umfasst:
Ein paar einprägsame Fotos werden
immer geschossen aus solchem Anlaß
etwa an einer Straße wo dann zwei
Männer liegen wovon der eine noch
lebt während das Foto geschossen wird
Als Kritiker und Poetologe wie als Poet ist Hartung ein Meister der präzisen Aussparung, der unaufdringlichen Reflexion: ein Lehrer der Lakonie. Die spektakuläre Sprachgeste ist bei ihm die eben deshalb bewegende Ausnahme. Gerade als die Ironie zeitweise unter dem Slogan „irony is over“ verabschiedet werden sollte, blieb Hartung ihr höflicher und entschiedener Verteidiger. Ihren subtilsten Ausdruck findet sie in seinem spielerischen und durch das Spiel hindurch wieder ernsthaften Umgang mit Sonetten und Ghaselen – und erst recht in jener Silben zählenden Metrik, die Hartung in seinen poetologischen Essays beschrieben hat und die schwebend die Balance hält zwischen spröde prosaischem Duktus und rhythmischer Akzentuierung. Wie Auden und Sylvia Plath geht der Belesene so zurück hinter das Gleichmaß des Jambenflusses wie hinter die versförmig umbrochene Prosa, gewinnt er dem silbenzählenden Prinzip nuancierteste Ausdrucksqualitäten ab. Zu ihnen gehört auch die Spannung zwischen dem Schema und der Abweichung, die es erst ermöglicht.
Diese prosaische Verstechnik enthält in nuce Hartungs Poetik, und sie sagt einiges auch über den Umgang des Kritikers und Essayisten mit dem Gedicht. Sie kreist um die Idee einer verborgenen Ordnung (und der Verborgenheit der Ordnung), einer Schönheit, die sich beinah verlegen ins Unauffällige und Ungefällige kleidet. Ihr Ziel ist die überspielte Tiefe, die auf skeptische Distanz gebrachte und doch nicht aufgegebene Hoffnung, der verlangsamte Traum. Es ist die ironische Resignation, die einen unauflöslichen Restbestand an Renitenz umhüllt (und deshalb auch die letzten Dinge sehr zart berühren kann).
Die Dichtung Harald Hartungs verwirklicht exemplarisch ebenjene Poetik, die der gleichnamige Essayist proklamiert:
eine Überwindung der sterilen Gegensätze von Artistik und Engagement, hermetischer und offener Poesie oder wie die Gegensatzpaare sonst heißen.
Seit die Ausgabe seiner gesammelten Gedichte im Jahr 2005 ihm endlich den verdienten Ruhm als Lyriker eingebracht hat, lesen sich darum auch Hartungs poetologische Essays anders und neu; sie zeigen gewissermaßen ihren doppelten Boden, auch wenn er über seine eigene Arbeit nur ausnahmsweise, dann allerdings auch umso lehrreicher geschrieben hat. „Notizen im Glashaus“ lautete schon die Überschrift des Schlusskapitels in seinem Lyrik-Buch von 1985; im Untertitel „Über Lyrik schreiben“ hat er damals das Wort „(Über)“ unauffällig eingeklammert.
Hatte Hartung schon sein Buch zur deutschen Gegenwartslyrik mit der Doppelperspektive auf das Schreiben von und über Lyrik beendet, so standen am Ende auch des Essaybandes Ein Unterton von Glück (2007) Bemerkungen „Über einige Erfahrungen beim Schreiben von Lyrik“: Erinnerungen an die eigenen lyrischen Anfänge, Bekenntnisse zu Lieblingsdichtern. Nun in erklärtermaßen ganz eigener Sache formuliert Hartung eine leidenschaftliche Verteidigung einer Poesie als genauer Form – in unauffälligen metrischen Regulierungen beispielsweise, die kein Leser bemerken muss und die doch dem Autor jene produktive „Erschwerung der Form“ auferlegen, in der die russischen Formalisten einst einen Fundamentalsatz aller Poesie erkannt haben. Das, was Valéry die „errechneten Verse“ genannt hat, entfaltet in diesem Werkstattbericht einen ganz eigenen poetischen Glanz, in der ironischen Aneignung der Sonettform ebenso wie in Inger Christensens zauberischem Spiel mit mathematischen Prinzipien.
*
Wo immer also der Essayist und Kritiker Hartung über Poesie und Poetik schreibt, da entwickelt der Theoretiker Hartung aus der praktischen Anschauung seine Poetik, und da gibt der gleichnamige Dichter Einblick in seine lyrische Werkstatt. Da zeigt er, wie man Gedichte macht. „Machen oder Entstehenlassen“, heißt eine 2001 gehaltene Rede, die – wen wundert es – das Benn’sche Entweder-Oder als eine Scheinalternative ausweist. Tatsächlich hält Hartung Lyrik für lehrbar; der Begriff des „Meisters“, so hat er bemerkt, müsse nicht immer nur an den des Jüngers denken lassen; er verbinde ihn lieber mit dem des Lehrlings.
Meisterschaft ist für diesen Meister das Ergebnis eines Handwerks – in jenem Sinne des Wortes, den sein programmatischer Essay im Merkur 1999 proklamierte und der mittlerweile fast schon redensartlich geworden ist. Dabei stammt die Beschreibung der Lyrik als der „Sache der Hände“ aus einem Brief Paul Celans an Hans Bender:
Und diese Hände wiederum gehören nur einem Menschen […] Nur wahre Hände schreiben wahre Gedichte.
Um Menschen und um Wahrheit geht es, und gerade deshalb ist im Augenblick des Schreibens die poiesis zuerst techné. Gerade deshalb geht es, wo immer der Lyriker und Essayist Harald Hartung auf Wahrheit aus ist, zuerst um die Fügung der Motive, um den Fall der Verse, um das Zählen von Silben. „Dem Romanautor“, liest man in einem seiner Essays, „verübelt niemand, dass er von Thema, Plot und Hauptfiguren redet“, allein der Lyriker soll noch immer „singen, wie der Vogel singt. […] Selbst Kritiker misstrauen der poetologischen Reflexion, sie hätten sonst nicht das Wort ,Kopflastigkeit‘ erfunden.“
Nicht zufällig sind einige der ihm liebsten und nächsten Dichter diejenigen, denen die Reflexion und Selbstkritik ihrer Schreibpraxis noch dringlicher waren als die großen Entwürfe der Metaphysik und die Geschichtsphilosophie. „Was waren das für Zeiten, in denen das Handwerk noch geholfen hat“, ruft er aus, bezeichnenderweise als eine offene Frage, und anstelle einer Antwort verweist er auf jene Widmung, die T.S. Eliot dem Waste Land vorangestellt hat:
For Ezra Pound, il miglior fabbro.
Auch die in der Rolle des fabbro betriebene Kunst des kritischen Essays über die Poesie ist eine Sache der Hände, und hier wie dort müssen die Hände danach sein.
Gerade weil Hartungs Essays gern mit Beobachtungen zu handwerklichen Fragen beginnen, bleiben sie auch dort anschaulich, wo es hinaufgeht in die Höhenlagen ästhetischer Theorie. So führt schon eine frühere Studie unter dem bescheidenen Titel „Über einige Motive der Droste“ gerade deshalb an jenen Punkt, an dem es in diesen Dichtungen um Sein und Zeit geht, weil die Aufmerksamkeit auf durchaus technische Schreibverfahren gelenkt wird. Über Ernst Meisters Verwandtschaft mit W.C. Williams und über die metrische „Atemwende“ in Robert Schindels Versen hat Hartung maßgebliche Essays geschrieben. Und für die jüngste deutsche und internationale Lyrik von Dirk von Petersdorff bis zu Jan Wagner, von Jeffrey Yang bis zu Tomaž Šalamun ist dieser Kritiker der kundigste Begleiter, den man sich wünschen kann – als Leser wie als Autor.
In seinen Besprechungen ihrer jeweils neuen Gedichtbände liegt dem Poeten und Kritiker, dem Kritikopoeten Hartung daran, seine Maßstäbe offenzulegen, indem er sie anwendet, sie in der Praxis überprüft und notfalls aufs Spiel setzt. Bereitwillig macht er sich angreifbar, lädt sogar zum Widerspruch ein, weil er weiß, dass Poesie ohne Dissidenz nicht zu haben ist. Weil der Kritiker Harald Hartung die Dogmengeschichte der lyrischen Moderne besser kennt als die meisten seiner Kollegen und Mitstreiter, eben deshalb ist er außerstande, zum Dogmatiker zu werden. Gewiss, auf der Hut vor der enttäuschten Liebe und dem Absturz aus dem Höhenflug des Enthusiasmus ist Hartung zum notorischen Skeptiker geworden, vorsichtig noch im Lob. Die schönste Ausdrucksform seiner Skepsis ist die Höflichkeit der Diskretion und der aufmerksamen Distanz.
Harald Hartungs Gedicht-Rezensionen verbinden darum Distanz und Empathie ebenso selbstverständlich wie Strenge und Lässigkeit, bis in die Nuancen des Tonfalls. Und soviel lieber er lobt als verreißt, so nimmt er doch den Goetheschen Grundsatz sehr ernst, dulden heiße beleidigen. Denn, um das Goethewort zu vervollständigen, „Toleranz sollte eigentlich nur eine vorübergehende Gesinnung sein; sie muss zur Anerkennung führen“. Wo aber diese unmöglich ist, da hat auch die Duldung ihr Recht verloren.
Und die größte Skepsis des Kritikers Hartung gilt der deutschen Kunstreligion und ihren neu- und nachromantischen Fortwirkungen bis in die Gegenwart. Wo immer die dionysische Trunkenheit zur Selbstbesoffenheit der Dionysiker zu werden droht, da erinnert er an die Möglichkeiten eines lyrischen Realismus als Aufmerksamkeit für die Dinge (auch für die Dinge, die unsere Wörter sind), als „realistischen tic“ und als Liebe zu jener Ironie, die Thomas Mann eine Form der Lebensfreundlichkeit genannt hat. Doch, heilig kann auch ihm, dem großen Nüchternen, die Poesie werden: dort, wo sie sich ans „Heilignüchterne“ hält, wo sie nicht in die Sackgasse der falschen Feierlichkeit und Selbstfeier gerät, sondern wo sie die Pflaumen im Eisschrank entdeckt, als seien sie eine Offenbarung, süß und kalt.
*
Der vorliegende Band, der in enger Zusammenarbeit mit dem Autor zusammengestellt wurde, versammelt einige seiner jenseits der Tagesaktualität lesenswerten Kritiken aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, gegliedert nach den Dezennien von 1980 bis in die unmittelbare Gegenwart. Jeder der drei Teile wird eingeleitet durch einen über die Einzelbände hinausblickenden Überblicks-Essay aus dem Merkur. Dabei sind ,Verrisse‘ nur ausnahmsweise aufgenommen worden; umso mehr Gewicht aber wurde auf die Balance zwischen Neuerscheinungen und kanonischen Texten, von deutschsprachiger und internationaler Poesie gelegt und auf die Verbindung von Neuerscheinungen junger und Wiederentdeckungen älterer Poesie.
Für Harald Hartung ist die mit Williams als Weg „ins Offene: in die Wirklichkeit“ verstandene und betriebene Lyrik längst zu einer Lebensform geworden. Von dieser redend, kann selbst er ausnahmsweise ein großes Wort gebrauchen. „Ich suchte in Formen Halt – und fand in ihnen Freiheit.“ Dieser prosaische Satz, gesagt in einer programmatischen Rede, klingt selber fast wie ein Vers. Und er kommt einem Bekenntnis wohl so nahe, wie das bei diesem sonst so diskreten und bekenntnisscheuen Dichter-Kritiker möglich ist. Was da mitschwingt, das haben alle Leser Hartungs in diesen Gedichten und Essays erfahren. Er selber hat es formuliert im Titel seines früheren Essaybandes: Ein Unterton von Glück.
Heinrich Detering, Nachwort
Welcher Liebhaber von Lyrik
wünscht sich nicht ein kritisches Kompendium, das ihm einen Überblick über die wichtigsten Gedichtbücher, die wichtigsten Strömungen der aktuellen deutschen und internationalen Lyrik gibt?
Hier ist es. Harald Hartung, Autor bedeutender Lyrikbände, ist zugleich einer unserer wichtigsten Literaturkritiker. In Die Launen der Poesie erscheinen jetzt seine Aufsätze und Kritiken zu Gedichtbänden von H.G. Adler, Adonis und John Ashbery bis Peter Waterhouse, Wolf Wondratschek und Adam Zagajewski, die er für die Frankfurter Allgemeine Zeitung und für die Zeitschrift Merkur schrieb. Was für den Tag bestimmt schien, hat sich in seiner Frische und Intelligenz erhalten und wird in Buchform in seiner ganzen Komplexität sichtbar.
Hartung ist ein leidenschaftlicher Verteidiger einer Poesie der genauen Form. Sein Gefühl für die Qualität von Poesie ist unbestechlich. Er zeigt an Beispielen auf, was die Zeit überdauert. Von Mätzchen ist er nicht zu beeindrucken, von Tricks nicht zu blenden. Seine Urteile sind differenziert und zugleich entschieden. Hartung spricht von Poesie anschaulich und unterhaltsam. Oder mit Heinrich Detering zu reden, der für diesen Band ein fasziniertes und faszinierendes Nachwort schrieb:
Hartung ist einer der gelehrtesten Kenner, der scharfsinnigsten Analytiker und souveränsten Vermittler lyrischer Weltliteratur, die wir haben.
Wallstein Verlag, Klappentext, 2014
Die Äpfel des Pegasus
– Harald Hartung und Kerstin Hensel versuchen, den Wert von Lyrik zu beurteilen. –
Hartung schummelt. Das sei gleich zu Beginn gesagt, sonst fangen die notwendigen Diskussionen am falschen Ende an.
Harald Hartung, 1932 in Herne geborener deutscher Lyriker und Literaturkritiker der FAZ, verspricht in seinem Buch Die Launen der Poesie, Deutsche und internationale Lyrik seit 1980 zu betrachten. Ein Kapitel widmet sich da Ossip Mandelstam, ein anderes Oskar Loerke und wieder ein anderes Emily Dickinson. Hab’ ich da was falsch im Gedächtnis? – Mal nachschlagen, also doch nicht: Ossip Mandelstam (1891–1938, Russe). Oskar Loerke (1884–1941, Deutscher). Emily Dickinson (1830–1886, US-Amerikanerin). „Internationale Lyrik“ ist das, aber „seit 1980“?
Ja, schon gut, wichtige Übersetzungen dieser wichtigen Lyriker sind nach 1980 erschienen. Also hat Hartung sie in den Band integriert. Und ein Fehler ist das nicht, wenn man wenigstens ein paar Dichter auf den 375 Seiten findet, denen diese Bezeichnung, mit Fug und Recht zusteht.
Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Aber fast.
Es wird auch in deutscher Sprache wieder vermehrt Lyrik geschrieben, jubeln die Lyrik-Anhänger, es sind ihrer wenige genug, in regelmäßigen Abständen zwangsoptimistisch. Doch was nützt es, wenn ein Großteil der Produktion, ich sage das ganz offen, nichts taugt?
Zweifacher Verfall
Hartungs Launen der Poesie sind somit Bestandsaufnahmen eines zweifachen Verfalls – der Lyrik und der Kritik an ihr. Hartung ist selbst Lyriker. Offenbar will er seinen Kollegen nichts
antun. Er findet doch wirklich
immer noch etwas Gutes.
So kann man leben:
jeden Tag ein paar Sätze aufschreiben.
Andere sind Arzt
oder fahren Omnibus
dichtet der keineswegs unberühmte Rainer Malkowski zu Hartungs Freude, und ich zitiere diesen Vers nur, weil ihn auch Hartung als offenbar beispielhaft für die Qualität dieses Lyrikers zitiert. Würde freilich etwa ein Unfallchirurg ebenso viel von seinem Handwerk verstehen, wie Malkowski von dem seinen hier erkennen lässt, dann wären die Opfer des in vergleichbarem Ausmaß kenntnisreichen Omnibusfahrers schlicht verloren. Es sei denn, man bringt Lyrik auf die Formel der Beliebigkeit: Ein Gedicht ist, was der Autor zu einem Gedicht erklärt.
Der Zeilenfall, der
die Pros
an
Stellen zerhackt, die
den Lesefluss hemmen, gehört
dazu.
Natürlich kann man nicht mehr dichten wie Anno dazumal. Aber die Kenntnis von Vers und Reim ist für einen Dichter unabdingbar, das stellt auch die Lyrikerin Kerstin Hensel in Das verspielte Papier fest, einem Buch, in dem sie versucht, Kriterien zur Wertung von Lyrik festzulegen.
Bitte genau lesen: „Die Kenntnis von Vers und Reim“ steht da, nicht „die Anwendung von Vers und Reim“.
Mir fällt da stets ein, was der beklagenswert jung verstorbene, hochbegabte österreichische Maler Dietmar Traum über seine Zunft mir sagte: „Am Akt kannst du ihn erkennen – am Akt und am Kreis.“ „Ihn“, damit meinte er den Maler, dem solche Bezeichnung rechtens zukommt. Der freihändig gezeichnete Kreis und der Akt sind Grundlagen des Handwerks. Nur, wer sie beherrscht, kann in seinem Werk dann auf sie eventuell auch verzichten. Denn „Verzicht“ bedeutet immer, etwas, worüber man verfügt oder verfügen kann, nicht anzuwenden oder auszuüben. So konnte etwa der Komponist Carl Orff darauf verzichten, eine Fuge zu schreiben (denn er hatte das entsprechende Handwerk gelernt, wendete es in seinen Werken aber nicht an). Aus dem Verzicht kann Kunst entstehen, aus dem Unvermögen nicht.
Das ist die Crux von Hartungs Kritiken: Er kann das Unvermögen nicht orten, oder er will es nicht. Zugleich zeigt er damit, wie schwer selbst subjektive Urteile (die Unmöglichkeit der Objektivität in Sachen Kunst setze ich voraus) bei der Lyrik sind, sollen sie halbwegs begründet sein.
Wobei ich den Lyriker Bertolt Brecht als Messlatte gar nicht erst herbeizitieren will –
Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten!
Das arglose Wort ist töricht. Eine glatte Stirn
Deutet auf Unempfindlichkeit hin. Der Lachende
Hat die furchtbare Nachricht
Nur noch nicht empfangen.
Wer kann das denn heute noch in der deutschsprachigen Lyrik?
Nach Brecht
Einer ist da, der kann es in seinen besten Momenten wenigstens nachmachen:
lies keine oden, mein sohn, lies die fahrpläne:
sie sind genauer. roll die Seekarten auf
eh es zu spät ist. sei wachsam. sing nicht
dichtet Hans Magnus Enzensberger, und ihn als Großmeister der zeitgenössischen deutschsprachigen Lyrik zu preisen, sagt gewiss auch etwas aus über sie.
Doch die Begabungen sind, oder waren, vorhanden. Der schnelllebige Literaturbetrieb freilich, der gerade bei der Lyrik lieber auf Eintagsfliegen setzt als sich von Kritikern vorwerfen zu lassen, man würde nur das Herkömmliche bewahren, hat sie von der prosazerstückelnden Massenware verschütten lassen, wie im Fall des 2008 verstorbenen Dichters Peter Maiwald. Man kann
seine Gedichtbücher aufschlagen, wo man will: Selbst in den schwächsten Versen spürt man sofort: Hier schreibt ein nicht nur geborener, sondern auch gelernter Lyriker:
Kassandra sitzt im Keller.
Es hört kein Mensch ihr Schrein.
Die Mauern decken sich
Mit Menetekeln ein
hebt etwa sein Gedicht „Kassandra“ an.
Das kommt gewiss von Brecht, aber es geht seinen eigenen Weg, wie es auch Peter Rühmkorf unternimmt:
Bon voyage , euch beiden
rund um Welt und Uhr –
Liebe geht mit Leiden
um wie von Natur.
Maiwald veröffentlichte in dem von Hartung abgesteckten Zeitrahmen mehrere Gedichtbände, vom 2008 verstorbenen Rühmkorf kam im Rahmen der Werkausgabe auch die gesamte Lyrik heraus. Maiwald wird von Hartung überhaupt nicht erwähnt, Rühmkorf ein einziges Mal beiläufig.
Vielleicht hat es Hartung ja nicht so mit Reim und Vers (obwohl er Robert Gernhardt angemessen würdigt)?
oh und die sorgsame stille der hände wenn der mond sich
verspinnt an geschlossenen blüten von blumen
und
ich muß ein lob des trommelns dichten ein lob dieser Kunst
der regen hat sie erfunden aber seither lernten sie manche
heißt es bei einem Dichter, der ebenfalls nur nebensätzliche Erwähnung findet: H.C. Artmann, der, neben (der entsprechend gewürdigten) Friederike Mayröcker und dem (nicht gewürdigten, aber wenigstens erwähnten) Peter Huchel, wahrscheinlich bedeutendste deutschsprachige Lyriker der Nachkriegszeit erhält von Hartung gerade mal einen Vergleich zugedacht. Auch die Gesamtausgabe von Artmanns poetischem Werk fällt, wie auch die Huchels, in Hartungs Betrachtungszeitraum. Es fällt schwer, hier nicht absichtliche Ausblendungen anzunehmen.
Das Unmessbare
Die deutsche Lyrik, um es also auf den Punkt zu bringen, hat im Evangelium nach Harald Hartung keinen Rühmkorf, keinen Maiwald, keinen Artmann und keinen Huchel. Aber wenigstens wird Ulla Hahn gewürdigt, auf deren Poesie zwischen Kitsch und Können ja immerhin auch ein Marcel Reich-Ranicki hereingefallen ist. Soll man da dann noch nach der Würdigung Dana Rangas verlangen, die dichtete:
Linda, Thomas, macht die Augen zu. Trauert und esst, denn eure Angst wird wachsen.
Mittag oder Mitternacht, kein Gesicht
ist stets zu lesen
und dieses Niveau in „Wasserbuch“ durchhält? (Nebenbei bemerkt: Wann kommt ihr nächster Gedichtband? – 2011 liegt schon etwas zurück.)
Vielleicht hätte sich Hartung, statt auf Prosazerstückler und Stichwortklitterer zu vertrauen und für bedeutende Dichtung auf das 19. oder das frühe 20. Jahrhundert auszuweichen, an ein paar Qualitätskriterien halten sollen, wie sie Kerstin Hensel dem Leser an die Hand gibt – diskutabel auch das, zweifellos. Denn ihre Kriterien sind völlig subjektiv, und eine Agnes Miegel nur herunterzuputzen, weil sie 1936 ein Hitler-Gedicht geschrieben hat, ist auch reichlich oberflächlich, wenn man nicht im gleichen Atemzug Brechts stalinistische „Erziehung der Hirse“ und Heiner Müllers Lenin-Hymnus von 1970 nennt. Doch wenn Hensel dem Leser auch keine objektivierbaren Kriterien, keine Lyrik-Waage in die Hand gibt, so stößt sie doch das Denken an: Ist das gute oder weniger gute Lyrik? – Man möge selbst urteilen, aber bitte begründet. Im Fall eines Artmann oder eines Huchel fällt das leicht. Doch es gibt ja eben auch noch einen Malkowski, und keineswegs nur ihn.
Edwin Baumgartner, Wiener Zeitung, 17.4.2014
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Henning Heske: Harald Hartung erhellt die Lyrik der letzten dreißig Jahre
seitenauslinie.wordpress.com, 8.6.2014
MichaelKrüger: Ein Heiliger im Dienst der Poesie
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 31. 5. 2014
Mirjam Springer: Hartung, Harald: „Die Launen der Poesie“
Arbitrium, Heft 1, 2015
Am 12.2.2013 sprach Harald Hartung mit Jan Wagner in der Literaturwerkstatt Berlin in der Reihe Klassiker der Gegenwartslyrik über sein Werk.
Am 2.2.2006 las Harald Hartung im Literarischen Colloquium Berlin und sprach mit Jan Wagner über sein Werk.
Zum 70. Geburtstag des Autors:
Bleutge, Nico: Langsamer Träumer
Stuttgarter Zeitung, 29.10.2002
Walter Helmut Fritz: Das Ziel kommt zu dir
Badische Zeitung, 29.10.2002
Jörg Plath: Ruhe unterm Riesensegel
Der Tagesspiegel, 29.10.2002
Zum 80. Geburtstag des Autors:
Felicitas von Lovenberg: Von Wurzeln und Flügeln
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 28.10.2012
Zum 90. Geburtstag des Autors:
Andreas Platthaus: Bei ihm müssen es keine Fixierungen sein
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 29.10.2022
Hannes Krauss: Harald Hartung schreibt Gedichte, um verstanden zu werden
Westfälische Rundschau, 29.1.2022
Fakten und Vermutungen zum Autor + Antrittsrede + KLG +
Kalliope + DAS&D + Johann-Heinrich-Merck-Preis
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Galerie Foto Gezett
shi 詩 yan 言 kou 口