Harald Hartung: Ein Unterton von Glück
DER TÜRKE HINTER DEM AUTOMATEN
ODER DIE VERBORGENE REGEL
− Über einige Erfahrungen beim Schreiben von Lyrik. −
I
Eine politische Journalistin, an klassischer Musik interessiert, schrieb einem Lyriker von Rang: „Ich mache mir nichts aus Gedichten, aber schon gar nichts aus Lyrik.“ Der derart angemachte Autor notierte nüchtern: „Sie unterschied also diese beiden Typen.“ Gottfried Benn – denn er war der Adressat – erwähnt dies in seiner berühmt gewordenen Marburger Rede Probleme der Lyrik. Ein zentraler Satz daraus lautet: „Das neue Gedicht, die Lyrik, ist ein Kunstprodukt.“ Eine über fünfzig Jahre alte These; doch an ihrer Wahrheit hat sich nichts geändert. Noch immer ist die Lyrik ein Kunstprodukt, was ihr einen leichten Stich ins Synthetische gibt. Wer hier an Kunsthonig denkt, dem erscheint der Hymettos besonders fern: sein von Horaz besungener Honig, oder sein weißer und blauer Marmor. Wir bleiben also bei der Lyrik und beim Lyriker, denn sonst müßten wir uns Dichter nennen; ein Ehrentitel, der neuerdings wieder leichthin vergeben wird. Da halte ich es lieber mit Hilde Domin, die den Lyriker in die solide Nähe der Chemiker, Physiker, Mathematiker rückt. Ich denke eher noch an den Erfinder eines Fakes, an die Geschichte vom ersten Schachautomaten.
Der berühmte Automatenbauer Baron von Kempelen hatte ihn konstruiert und an den Wiener Musiker Maelzel für dessen Schaustellungen verkauft. Der Automat war ein großer, tuchüberschlagener Kasten, hinter dem der Schachspieler im Gewand eines Türken saß, der bei jedem Zug mit dem linken Arm ein paar ruckartige Bewegungen machte, während man die Mechanik schnurren und klappern hörte. Vor jeder Demonstration leuchtete Maelzel mit einer Kerze ins Kasteninnere, um zu belegen, daß kein Mensch, sondern bloß Stangen und Zahnräder darin waren.
In Baltimore mag Edgar Allan Poe den Automaten gesehen haben. Poe hat jedenfalls 1836 einen Essay über das Problem einer schachspielenden Maschine geschrieben, „Maelzels Schachspieler“. Darin weist er nach, daß in der Maschine ein Mensch verborgen sein mußte, der die notwenigen Bewegungen ausführen konnte – wenn auch in unbequemer Lage (um dem hineinleuchtenden Licht auszuweichen). Mehr noch, er schritt zur Frage fort, nach welchem Prinzip eine schachspielende Maschine zu konstruieren wäre, und zu der Hypothese, bestimmte Erweiterungen würden sie befähigen, alle Spiele zu gewinnen.
Nun haben wir bereits Schachcomputer, die gegen Großmeister eine Chance haben, und besitzen – dank Enzensberger – auch einen Poesie-Automaten, der mit Hilfe eines Zufallsgenerators Texte auswirft, die es mit manch konventionell erzeugter Lyrikware aufnehmen können und zudem merkwürdig stark an Enzensbergers eigene Gedichte erinnern. Freilich hat man nicht gehört, daß Enzensberger das Dichten aufgegeben hat, und auch Poe hat seinerzeit der Versuchung widerstanden, seine poetologische Überlegungen auf einen Poesie-Automaten zu richten.
Er hätte sonst nicht die Kriminalgeschichte erfunden; und auch nicht – in Analogie zum perfekten Mord – das perfekte Gedicht. Poe dürfte den Satz des Novalis nicht gekannt haben, wonach Schönheit „ein Erzeugnis von Vernunft und Calcul“ ist, aber er handelte danach oder gab doch vor, es zu tun. Das entscheidende Dokument ist seine „Philosophy of Composition“ von 1846. Dort wendet er sich gegen die Auffassung, Poesie entstehe aus dem schönen Wahn oder entrückter Inspiration. Er setzt dagegen, was er den „modus operandi“ nennt, das heißt eine methodische Herstellung, und demonstriert sie an der Verfertigung seines Gedichts „The Raven“ (Der Rabe). Er sagt:
Meine Absicht ist, eindeutig festzustellen, daß sich keine Einzelheit dieses Gedichts aus Zufall oder Intuition ergeben hat; es entstand vielmehr, Schritt um Schritt bis zum Abschluß, mit der Präzision und der ungebrochenen Folgerichtigkeit einer mathematischen Berechnung.
Der geniale Einfall Poes bestand darin, die von der älteren Poetik angenommene Reihenfolge der dichterischen Akte umzukehren: was Resultat scheint, die Form, ist somit der Ursprung des Gedichts. Der Anfang des dichterischen Prozesses ist für Poe die Wahl des Umfangs, des Effekts, eines gewissen Tons – und dann erst des Themas, das nach den älteren Regeln am Anfang stünde. Ich verzichte darauf, anzuführen, was ihn auf den Ton der Trauer als höchsten Ausdruck der Betrachtung des Schönen führt, auf den Tod einer schönen Frau als das poetischste Thema der Welt und darauf, daß dieses am ergreifendsten aus dem Munde eines vereinsamten Liebhabers klinge. Poes Schlußfolgerung wirkt wie ein Rezept:
Nun hatte ich also zwei Vorstellungen miteinander zu verbinden: die eines Liebenden, der den Tod seiner Geliebten beklagt, und die eines Raben, der ständig das Wort „nevermore“ wiederholt.
Nun – so könnte man meinen – war nur noch das Gedicht selbst zu schreiben. Aber künstlerisch fängt ja die Sache erst an. Wollen wir Poe seinen Entstehungsbericht abnehmen? Oder haben wir eine seiner Kriminalgeschichten vor uns, übertragen auf den Bereich der ästhetischen Theorie? Entscheidend ist:
Der Lyriker Poe wartete nicht auf einen Schach- oder Poesie-Automaten. Er nahm die Sache selbst in die Hand und insinuierte, poetische Perfektion sei eine Frage der poetologischen Reflexion. Er mimte selbst den Türken. Und da auch ich nicht auf das Schachspiel, sondern auf die Lyrik hinauswill, lautet meine These: In jedem Gedicht, so artifiziell es sich gibt, ist ein Mensch verborgen. Die ruckartigen Bewegungen, die eine Mechanik vortäuschen, sind Bewegungen der Poetologie, Akzentuierungen der subjektiven Vorlieben seines Verfassers.
Poes Wirkung auf Baudelaire – und damit auf die europäische Moderne – war ungeheuer, nämlich die einer „sonderbaren Erschütterung“, eines mächtigen Impulses. T.S. Eliot freilich hielt die berühmte „Philosophy of Composition“ für einen bloßen Schabernack oder aber für „ein Stück Selbsttäuschung“ über die Art, wie Poe das Gedicht geschrieben zu haben wünschte. War also Poes „Philosophy“ eine Mystifikation, seine Vorstellung von der totalen Machbarkeit eine Falle? Wenn ja, dann tappten auch Paul Valéry und Gottfried Benn hinein, oder taten doch so. Valéry nahm Poe so ernst, daß er ihn als seinen Vorläufer anerkannte und sich selbst als den Endpunkt der Reihe setzte, also: Poe – Mallarmé – Valéry. Dabei hielt er sich zugute, nicht auf altüberlieferte Kategorien zurückgegriffen, sondern „alles auf rein analytischer Basis“ neu aufgenommen zu haben: Lyrik erscheint so als rationale Magie. Dazu gehört auch Valérys Einbeziehung der Naturwissenschaften. Wenn man etwas näher hinsieht, verbleibt gerade der szientifische Bezug weitgehend im Metaphorischen; so etwa Valérys Ansicht, das Kunstwerk gleiche höchst geheimnisvollen Körpern, „die die Physik erforscht und die Chemie sich zunutze macht“. Indem er der Naturwissenschaft Geheimnisse bescheinigt, gewinnt die Poesie um so leichter ein analytisches Moment.
Ähnlich Gottfried Benn und seine Vorstellung vom Labor, darin der Dichter tätig sei. „Es ist ein Laboratorium“, so die berühmte Stelle, „ein Laboratorium für Worte, in dem der Lyriker sich bewegt. Hier modelliert, fabriziert er Worte, öffnet sie, sprengt, zertrümmert sie, um sie mit Spannungen zu laden, deren Wesen dann durch einige Jahrzehnte geht.“ Doch ehe man sich versieht, ist das Labor wieder verlassen, und Benn geht auf die Troubadours zurück und berührt Nietzsches Begriff der Artistik.
Bescheidener gesagt: Lyrik ist also auch Handwerk, Werk der Hände. Dem Romanautor verübelt niemand, daß er von Thema, Plot und Hauptfiguren redet – das sind solide Begriffe. Sie setzen einen Plan, ein Konzept voraus, eine bestimmte Abfolge der Kapitel, womöglich ein graphisches Schaubild man kennt dergleichen von Böll, Doderer oder Uwe Johnson, detailreich, gar farbig illuminiert. Ohne ein mehr oder minder deutliches Konzept setzt sich kein seriöser Romancier an den Schreibtisch.
Und der Lyriker? Er soll wohl singen, wie der Vogel singt. Ganze Serien von Selbstinterpretationen haben das Klischee nicht beseitigt, daß des Dichters Aug’ immer noch im schönen Wahnsinn rollt. Selbst Kritiker mißtrauen der poetologischen Reflexion, sie hätten sonst nicht das Wort „Kopflastigkeit“ erfunden. Nun wird man dort, wo es an Köpfen nicht mangelt, über solche Vorurteile hinweg und zur Tagesordnung übergehen. Diese will ich durch ein paar Fragen bezeichnen: Woher kommen Gedichte und kann man Gedichte planen? Was ist ihr Stoff? Kommen sie aus der Sprache oder aus der Welt? Geht die Form dem Gehalt voraus oder umgekehrt? Wann arbeitet man mit freien, wann mit vorgegebenen Formen? Kann man heute noch reimen? Wie steht das einzelne Gedicht zum Zyklus und wie der Zyklus zum Buch? Der Romancier schreibt Romane, der Dichter Gedichtbände. Er selbst ist ihr Protagonist.
Doch wer ist der Dichter? „Le poète – c’est moi“; derjenige, der hier schreibt und seine Schwierigkeit hat, „Ich“ zu sagen. Zum Glück ist dieses Ich nicht privat, sondern, mit Rimbauds berühmter Formel, ein anderer – hilfsweise „lyrisches Ich“ benannt. Unter dieser Maske rede ich über Erfahrungen beim Schreiben von Lyrik. Doch wer Erfahrung sagt, hat schon geschrieben und veröffentlicht. Warum also nicht gleich beim Weiterschreiben beginnen? Da ist der hermeneutische Kreisel schon im Schwung. Weiterschreiben ist zudem das probate Remedium für die immer lauernde Frage: Warum nicht aufhören?
Zunächst aber: wie schreibt man weiter? Im Frühjahr 1996 erschien mein Band Jahre mit Windrad. Für den Autor nicht bloß das Dokument einer Arbeitsphase, sondern auch das der historischen Zäsur von 1989, präsentiert mit gehöriger Verzögerung. Geschichte braucht Zeit, eh sie – wie man so schön sagt – ihren Niederschlag im Gedicht findet. Dafür – und um überhaupt einen Eindruck von diesem Buch zu geben – zwei Beispiele aus der Gedichtgruppe „In der Nähe der Glienicker Brücke“. Das erste stammt aus dem Jahr 1992:
ZU DEN AKTEN
Wir wissen, sagt der Mann, grinst und fixiert mich
wir wissen alles über Sie! (Soll wohl
ein schlechter Scherz sein, denk ich an dem Abend
vor wieviel? dreizehn Jahren; rätsele
daran herum bis ichs vergesse) Gestern
in eine Menge Leute eingeklemmt
(der Redner langweilte) von irgendwo
fühl ich mich angestarrt: es war von damals
der Mann, ich kenn ihn unter Tausenden
Ich seh ihn fragend an, er weicht mir aus
als wüßte ich nun alles über ihn.
Der Text – in prosanahen Blankversen – ist eine lyrische Nachschrift: die Begegnung mit einem IM aus der westberliner Kulturszene ist authentisch. Der Autor hat die Situation und ihre untergründige Symbolik sprechen lassen. Bei dem Titel „Zu den Akten“ darf der Leser an die Gauck-Behörde, aber auch an den gleichnamigen Gedichtband von Günter Eich denken.
In einem anderen dieser um 1989 kreisenden Gedichte heißt es: „Die Geschichte geschieht, wir bleiben Spaziergänger.“ Die historische Vertiefung überläßt der Autor einer Allegorie, die ihm Ende 1991 als Zeitungsmeldung begegnete. Sie verlegte den Untergang Pompejis um ein Vierteljahr Richtung Gegenwart, vom August auf den November:
NUTZEN DER ARCHÄOLOGIE
Heißer August, die Asche als glühender Regen −
so stimmig liest sich die klassische Katastrophe
Aber in Wahrheit reiften schon die Granatäpfel
gärte der Wein in den Fässern, trugen die Leute
Kappen aus Pelz, ein Nordostwind wehte gewöhnlich
(der transportierte dann auch den tödlichen Fallout)
Also November! Auch ein Fortschritt der Wissenschaft:
drei Monate Frist für die Bewohner Pompejis
(wenn auch post festum aber doch besser als garnichts)
Die Ahnungslosen, wären sie dankbar gewesen?
So wenig wie wir. Wie nachsichtig sind die rückwärts-
gewandten Propheten. Gerne wimmeln wir weiter.
Die Geschichte verschont uns nicht, sie gibt manchmal Aufschub. Der Autor vermittelt die Botschaft durch die Ironie der Form. Die aufgeschobene „klassische Katastrophe“ erscheint in dreizehnsilbigen Zeilen, die durch die eingestreuten Daktylen das elegische Maß äffen, aber weder Hexameter noch elegische Distichen sind. Ironie gilt auch den rückwärts gewandten Propheten, den Historikern. Das anmaßende lyrische Ich selber geht im plebejischen Plural unter: „Gerne wimmeln wir weiter.“
Nicht zu verkennen ist, daß Lyrik hier als Biographie traktiert wird. Gedichte als Selberlebensbeschreibung ist das Stichwort. Mein Stichwort. Ich bemühe dazu zwei Eideshelfer: Giuseppe Ungaretti, für das Pathos von Biographie, und Philip Larkin, für seine Ernüchterung. Mich hat immer Ungarettis Wort bewegt, der Ehrgeiz des Dichters sei seine schöne Biographie. „Dieses Buch“, schreibt Ungaretti im Vorwort zu L’Allegria, „ist ein Tagebuch. Der Autor hat keinen anderen Ehrgeiz (…) als seine eigene schöne Biographie zu hinterlassen. Die Gedichte sind daher seine formalen Qualen, aber er wünscht ein für allemal begreiflich zu machen, daß die Form ihn bloß quält, weil er von ihr fordert, daß sie den Veränderungen seines Sinnes, seines Gemüts entspreche, und wenn er irgendeinen Fortschritt als Künstler gemacht hat, so möchte er, daß dies nichts anderes bedeute, daß er auch einige Vollkommenheit als Mensch erreicht hat.“ Nicht daß ich die Worte des großen Ungaretti für mich in Anspruch nehmen wollte, aber sie stellen doch einen Zusammenhang her zwischen Wahrheit und Poesie.
Lyrik kann eine nüchterne Wahrheit haben; aber auch die wird immer paradox sein, eben weil sie zugleich Poesie ist. Deshalb liebe ich auch die kaustische Nüchternheit Philip Larkins. In einem Interview und vielleicht aus bloßer Provokationslust heraus äußerte er:
Ich glaube, ich versuche immer, die Wahrheit zu schreiben, und würde kein Gedicht schreiben wollen, das suggerierte, daß ich ein anderer sei als der, der ich bin (…). Nehmen Sie zum Beispiel Liebesgedichte. Ich würde es als falsch empfinden, ein Gedicht zu schreiben, das vor Liebe für jemand überschäumt, wenn man nicht gleichzeitig die Person heiratet und mit ihr einen Hausstand gründet.
Eine ernste Beschränkung, die Larkin seinem Gedicht auferlegt. Nicht die Kunst entscheidet übers Leben, sondern das Leben über die Kunst. Man muß freilich ergänzen, daß sich hinter dem Vorsatz zur Wahrheit eine Selbsttäuschung verbergen kann, die besonders schwer zu fassen ist. Zudem wäre es um die erotische Poesie schlimm bestellt, hätten sich die Autoren von Liebesgedichten je an Larkins Gebot gehalten und die jeweils angedichtete Person geheiratet. Larkin blieb übrigens Junggeselle, und einige seiner Gedichte lassen sich durchaus als Liebesgedichte lesen.
Wie Poe benötigt auch Larkin eine Produktionshypothese, ohne die kein Lyriker auskommt. Sie liefert ihm ein Phantom, dem er lebenslänglich nachläuft. Sie ermöglicht, nach allen Anfängen, das Weiterschreiben. Sie führt hinein in die Fragen des Handwerks, führt hinein in die Dialektik von Machen und Entstehenlassen.
Mein erstes Stichwort dazu heißt Notizbuch. „Nur keine Notizen, keine verräterischen Einblicke“ meinte Gottfried Benn und verriet so, wie wichtig Notate und Vorarbeiten sind. Aber auch: aus welch unscheinbaren Formulierungen Gedichte hervorgehen können, welch peinliche Erdenreste dem ausgeglühten Gebilde vorangehen. Majakowski sprach von „Halbfabrikaten“ und meinte, ein gutes Notizbuch sei wichtiger als die Fähigkeit, in abgelebten Versmaßen zu schreiben.
Gedichte kommen also selten aus heiterem Himmel, eher von einem Zettel auf dem Nachttisch. Auf einem dieser Zettel lese ich die Zeile: „Oft fehlt ein einziges Korn den Uhren der Toten“. Rätselvoll genug ist sie. 13 Silben, leicht rhythmisiert. Aber sind sie auch verwendbar in einem Gedicht? Vielleicht ließe sich ein Kontext, eine Erweiterung finden. Wahrscheinlich ist es falsch, diesen Keim dem Licht der Öffentlichkeit zu exponieren. Er könnte im Notizheft oder auf einem PC-Speicherplatz ruhen wie andere Zeilen, Reimpaarungen, Schnappschüsse, Epiphanien. Das Entscheidende ist das produktive Chaos dieser Notizen, ihr Nichtgeordnetsein. Nur keine Systematik. Nur keine Zensur, das heißt keine Frage nach der Qualität. Der lyrische Stoff wartet auf das punktuelle Zünden der Welt im Subjekt, wie es Friedrich Theodor Vischer nannte. Auf den fruchtbaren Moment.
Das ist der Moment der Fähigkeit. Man hat lange in diesen Notizen geblättert, mißmutig, deprimiert, aber dann schließt sich an eine Zeile eine andere an oder zwei Bilder treten miteinander in Beziehung, und man ist mitten in der Fabrikation. Valéry hat das unnachahmlich präzis formuliert:
Es gibt Verse, die man findet. – Die anderen macht man. – Man vervollkommnet diejenigen, die man findet. – Die andern „naturalisiert“ man. – Zwei Manöver in entgegengesetzter Richtung, um die Fälschung zu erreichen: die „Vollkommenheit“.
Aber damit ist die Frage nicht berücksichtigt, ob die beiden Manöver sich auf einen Plan beziehen, auf ein Konzept, das bereits bestand oder sich jetzt, im aktuellen Prozeß, entwickelt. Sieht das, was ich da zu machen im Begriff bin, nach einem künftigen Sonett aus und – wenn ja – soll es also eins werden? Oder – schwieriger und weiter gezielt – soll aus diesem entstehenden Text ein weiteres Sonett in jener Reihe werden, die ich schon begonnen habe? Ich weiß, daß etliche Lyriker das Sonett nicht mögen. Aber es ist das Modell für vorgegebene Form, Exempel für lyrische Planung. Will sagen: Man schreibt nicht nur das, was kommt, nämlich im Suchen, Finden und Machen; man schreibt auch, was man schreiben möchte, im Planen und Konstruieren. Ich gebe ein Beispiel für extremen Konzeptionalismus, für die völlige Durchplanung einer Struktur.
Das Stichwort dafür lautet System. Inger Christensen vertritt das, was man in Dänemark „Systemdichtung“ nennt, nämlich eine Poesie, die ihren Fortgang und ihre Struktur durch vorgegebene Regelungen ermöglicht und „objektive“, wissenschaftlich verifizierbare Elemente mit dem subjektiven Ausdrucksbedürfnis verbindet. Ein Beispiel dafür ist das 1981 erschienene Alphabet, ein Langgedicht von etwa siebzig Seiten, Christensens bedeutendstes Werk. Es beruht auf zwei miteinander verbundenen Konstruktionsprinzipien, einem endlichen und einem virtuell unendlichen. Zum einen ist es die Abfolge der Buchstaben im Alphabet, die die Reihenfolge der Abschnitte bestimmt und das Vokabular des Gedichts beeinflußt. Zum andern ist es die sogenannte »Fibonacci-Folge«, die Struktur und Umfang des Textes fixiert. Diese Folge, benannt nach dem mittelalterlichen Mathematiker Leonardo Fibonacci, ergibt sich dadurch, daß sich jedes folgende Glied aus der Summe der beiden vorangegangenen Glieder errechnet: also 1 + 1 = 2/ 1+ 2 = 3 / 2 + 3 = 5 / 5 + 3 = 8 usw.
Die ingeniöse Verbindung der bei den Prinzipien besteht darin, daß Christensen dem Buchstaben a eine Zeile, dem Buchstaben b zwei Zeilen, c drei, d fünf, e acht Zeilen usw. zuordnet; wobei ihr bei der Konzeption des Gedichts nicht entgehen konnte, wie enorm die Fibonacci-Folge schon nach wenigen Schritten ansteigt. Dem Buchstaben n sind immerhin 610 Zeilen zuzuordnen; und hier bricht – 12 Buchstaben vor Ende des Alphabets – das Gedicht ab. Die totale Ausfüllung des Systems hätte vermutlich einige tausend Seiten erfordert.
Christensens eigener Kommentar verfolgt, wie das Werk selbst, zwei differente Strategien; eine positive und eine destruktive. Zunächst sagt sie:
Ich finde, alphabet hat etwas Biologisches. Ich hätte ja nicht einfach schreiben können 1, 2, 3, 5, 8 usw., das heißt Fibonaccis mathematische Reihe – niemand würde das als Gedicht betrachten. Aber ich vertraue darauf, daß, wenn ich etwas schreibe, das teils ich selber bin, teils in der Welt ist – in diesem Falle also Mathematik −, daß diese Kombination aus den Zahlen und meinen Worten so etwas wie ein natürlicher Organismus wird. Übrigens bin ich später dahintergekommen, daß Dinge in der Natur, in der Botanik, mit Fibonaccis Reihe übereinstimmen.
Gegenläufig dazu ist Christensens Idee von Explosion, Destruktion oder Erweiterung ins Imaginäre:
Als das Weltall geboren wurde, geschah folgendes: Alles, was anfangs zu fast nichts zusammengepreßt war, explodierte und breitete sich nach allen Seiten aus, eine Bewegung, die andauern wird, bis die Ausbreitung so groß ist, daß alles zu verschwinden und wieder zu nichts oder fast nichts zu werden scheint.
Was mich an Christensens Konzept und Theorie interessiert, ist nicht der mögliche wissenschaftliche Gehalt, sondern der poetologische Plan, der den Novalis-Satz bestätigt, wonach Schönheit „ein Erzeugnis von Vernunft und Calcul“ ist. Die Dialektik von Machen und Entstehenlassen ist hier glanzvoll entfaltet. Das große Gesetz erlaubt die Freiheit im Detail. Aber der Autor, der in das Gesetz eintritt, ist auch im System gefangen – bis zur Vollendung oder, wie hier, zum Abbruch. Zudem muß man daran glauben, daß die Dichtung ebenso biologistisch verfährt wie die Natur. Schließlich muß man akzeptieren, daß Dichtung sich den Prinzipien der Naturwissenschaft unterwerfen sollte.
Wer dagegen die Poesie selbst kommandieren lassen will oder auf den Primat des Erlebens, der Erfahrung, der persönlichen Biographie setzt, wird nach Prinzipien in der Poesie selbst suchen; nach ästhetischen Momenten wie Zahl, Proportion, Klang, Rhythmus, Bild und Logos. Ich komme in diesem Kontext aufs Sonett zurück – auch aus dem Grund, weil es die Frage nach dem Reim aufwirft.
Der Reim ist – maritim und mit Karl Kraus gesprochen – das „Ufer, wo sie landen, / sind zwei Gedanken einverstanden.“ Was leider auch der reimende Dilettant beweist. Das Selbstgereimte ist der Versuch, diese Identität – und damit die eigene – sprachlich zu retten. Den Artisten reizt die Diskrepanz, die Möglichkeit, aus der Differenz der Gedanken Funken zu schlagen. Das heißt: Ironie wird unvermeidlich. Kein Zweifel aber auch, daß Ironie eine Schwundstufe von Pathos ist, und daß dem Fremdwort in dieser Pathosreduktion eine wichtige Rolle zugewiesen ist. Gottfried Benn hat diese Möglichkeit exzessiv genutzt, aber er war wohl auch der letzte, der, um den Preis von Sentiment und Sentimentalität, den Reim als Form von Ernst, ja Pathos eingesetzt hat.
Mein Beispiel betreibt diese ironische Reduktion auch in der Verkürzung seiner Zeilen. Das Sonett wird zum ironischen Lied.
SATURA
Der Puls ist noch palbabel
das Hirn noch sporogen
Doch zwischen Kalb und Kabel
will uns kein Gott erstehn
Schon leichtes Magendrücken
verändert den Diskurs
Wir sehen in den Lücken
den Schatten des Komturs
Vom Ein- zum Appenzeller
da war wohl ein Moment
als würde alles heller
Nun lesen wir die Daten
die uns an uns verraten
als unser Testament
Auch Kommunikation verfällt dieser Ironie, ist aber in ihr – säkularisiert – vielleicht noch einmal möglich. Wir sind die Gefangenen unserer Daten – unsere Codes sind unsere Testamente. Auch der Titel zielt auf die „Fülle“ in der Ironie. „Satura“ ist ursprünglich eine der Ceres dargebrachte Schüssel mit mannigfaltigen Erstlingsgaben (lanx satura). Von daher wird „satura“ kulinarisch zum Mischgericht, zum „Allerlei“, zur volkstümlichen dramatischen Mischform, schließlich zur beißenden oder lächelnden Satire im Sinne Horaz’, Martials oder Iuvenals. Auch die Moderne kennt Satura, Satire. Eugenio Montale hat 1971 den Band, der sein Alterswerk eröffnet, Satura betitelt, und natürlich kann ich mir nicht verkneifen, sein scherzhaftes Diktum zu erwähnen: seine früheren Verse habe er „im Frack“ geschrieben, die späteren „im Schlafanzug“. Mein kleines Sonett ist eine Huldigung an Montale; und der Titel Satura steht auch über einer ganzen Abteilung meiner neuen Gedichte. Hier dominiert mit der Ironie die feste Form und der Reim.
Andererseits liegt der Schluß nahe, daß die ernsten Töne ohne das Reimspiel auskommen müssen. Aber kommen sie ohne Versmaß aus? Verstheorie gilt als besonders unmusisch; dabei hat sie es gerade mit der Musik der Verse zu tun. Was aber kann an die Stelle des Reims und der abgemessenen Metren treten? Es ist eine alte Frage, seit Klopstock.
Seit vierzig, fünfzig Jahren dominiert bei uns der freie Vers, der seine rhythmische Figur Zeile um Zeile neu findet, manchmal aber nur zu Zeilen abgeteilte Prosa ist, Flattersatz, wie der Drucker sagt. Dieser vers libre, dieser free verse setzt nicht weniger Meisterschaft voraus als jede gebundene Form. Er spielt mit der Möglichkeit, Prosa in Vers und Vers in Prosa übergehen zu lassen. Doch eben diese Geschmeidigkeit leistet der Willkür Vorschub. Zumal es das Prinzip des Freiverses ist, daß die Form an sich keinen Widerstand bietet. Sie ist Form von Fall zu Fall, Form ex post: das fertige Gedicht kann rhythmische oder zahlenmäßige Analogien zeigen, muß es aber nicht. Man könnte also boshaft sagen: „Die Moderne gibt sich mit wenig zufrieden.“ Das war, wieder einmal, Valéry.
Was soll die Pointe dieser Bemerkungen zur Metrik sein? Ich zitiere eine Stelle aus Valérys Cahiers. Er spricht dort von einem, wie er sagt, kaum bekannten ästhetischen Paradox: „Die äußerste Verschwisterung der Form mit dem Inhalt wird am besten verwirklicht, indem der Form Bedingungen auferlegt werden, willkürliche, präzise, von außen kommende – jedoch verborgen −, denen sich dann auch der Inhalt beugen muß – so wie ein Körper in einem Kraftfeld oder in einem gekrümmten Raum.“ Die Stelle ist zunächst so unerhört nicht, denn Valéry variiert einen Gedanken, der paradigmatisch aufs Sonett zutrifft. Was mich fasziniert, ist nicht der Preis der Regeln und ihrer zeugenden Willkür, sondern die Parenthese im eben zitierten Satz, das „jedoch verborgen“. Regeln ja – aber verborgene! Regeln, die auch der geübte Leser nicht sofort erkennt (Sonett, Hexameter, Blankvers). Regeln, die dem Blick der Gewohnheit, ja selbst des Trainings entgehen. Solche Regeln – und da schlägt das vernünftige Calcul in Magie und Mystizismus um – sind auch dann wirksam, wenn der Leser sie nicht bemerkt. Diese Valéry-Stelle erscheint mir als Bestätigung einer Praxis, die ich schon lange, nämlich seit den siebziger Jahren betreibe. Es geht um eine bestimmte Regelung der Verszeile, die man nicht hören kann, von der ich aber hoffe, daß sie sich dennoch auf irgendeine Weise dem Hörer mitteilt. Etwa im Schlußstück aus einem Zyklus von sechs Gedichten, betitelt „Blätter für Zachäus“:
Am Weg die Sykomore wächst schneller
als du hinaufgelangst auf diesen Baum
dich dem milden Mann zu empfehlen der
von der Menschenmenge erwartet wird
Sie werden auf den falschen tippen auf
die Tiara oder das gelbe Trikot
Doch gesetzt du tippst auf den richtigen −
da ist noch das Handicap mit dem Baum
Auch ist der Kühlschrank leer und kein Feuer
unter dem Herd
Der Evangelist Lukas (19,1-6) erzählt die Geschichte von Zachäus, dem obersten der Zöllner, der begehrt, Christus zu sehen und, da er zu klein ist, auf einen Maulbeerbaum steigt. Christus, der vorbeikommt, sieht ihn und ruft ihn herab, denn er will bei ihm einkehren. Zachäus nimmt ihn mit Freuden auf; und die, die dies sehen, wundern sich, daß Christus bei einem Zöllner, einem Sünder einkehrt. Meine Variante der Zachäusgeschichte ist etwas parodistisch geraten: das lyrische Ich scheitert schon an seiner Unfähigkeit, den Maulbeerbaum zu besteigen; von den mangelnden Küchenvorräten und dem Feuer ganz zu schweigen. Wie zu dieser negativen Parabel des Verfassers metrische Technik paßt, kann ich nicht entscheiden. Das Gedicht besteht aus zehn Zeilen, die Zeile jeweils aus zehn Silben, die keinem vorgegebenen Rhythmus folgen, sondern eben nur gezählt sind. Eine Ausnahme macht Zeile 10; sie hat nur vier Silben. Der Text bricht ab: „Auch ist der Kühlschrank leer und kein Feuer / unter dem Herd.“ Der Poet exponiert willentlich oder unwillentlich – seine Armut. Er gibt sich eine Regel und vermag nicht einmal die letzte Zeile zu füllen. Seine Pumpen und Röhren funktionieren nicht sonderlich gut. Aber vielleicht gehört das in sein System.
Ich spreche hier in Bezug aufs Silbenmaß in eigener Sache; aber ich habe die silbenzählende Technik nicht erfunden. Ich wunderte mich nur, als ich sie bei Auden fand und bei Sylvia Plath – vermutlich als Ersatz für den die englische Lyrik dominierenden Blankvers, als Chance, die Zeile metrisch stark zu modulieren. Wenn es neben den gegebenen auch die errechneten Verse (Valéry) gibt, ist auch eine Regelung erlaubt, die dem Gedicht selbst nicht ausdrücklich beigegeben wird. Je rigider diese verborgene Regel, um so größer des Autors Hoffnung, daß sie den poetischen Geist freisetzt. Calcul ist die Ersatzhandlung, die diesen Geist hervorrufen möchte. Calcul als eine andere Art Beschwörung, als ein Tanzen in Ketten.
Der weise Montale überschrieb das letzte Kapitel eines seiner Bände mit „Conclusioni provvisorie“ (Provisorische Schlüsse). Die beiden Gedichte, die man dort findet, heißen „Piccolo testamento“ (Kleines Testament) und „Il sogno del prigioniero“ (Der Traum des Gefangenen). Ein wunderbares Paradox: der Dichter will den Abschluß, das Testament, doch jeder Schluß will Befreiung aus den Kerkern, will ins Offene.
Inhalt
− Die Sache der Hände. Eine schüchterne Erinnerung
− Langeweile – die Ersatzmutter der Musen. Goethes Venezianische Epigramme
− Der Dichter und sein Schatten. Adelbert von Chamisso als Lyriker
− Dampfschiff, Mergelgrube, trunkene Flut. Über einige Motive der Droste
− Ich probierte auch einmal antike Maße. Die Oden-Strophen Georg Brittings
− Der sachliche Romantiker. Erich Kästners Lyrik – wiedergelesen
− Wandloser Raum. Der Lyriker Ernst Meister
− „seltsam! vgl. Todesfuge.“ Paul Celan und Trakls Palette
− Ein Unterton von Glück. Einladung, die Gedichte Ludwig Greves zu lesen
− Ikarus, Kassandra, graue Fee. Günter Kunerts Lyrik nach dem Utopie-Verlust
− Lethe und Memoria. Dem Dichter Robert Schindel zum Mörikepreis
− Emil oder Die Engel. Zu den Gedichten Alfred Brendels
− Der Türke hinter dem Automaten oder Die verborgene Regel. Über einige Erfahrungen beim Schreiben von Lyrik
− Hase und Hegel. Mein erstes Buch.
− Die Rückseite des Teppichs. Rede zum Würth Preis für Europäische Literatur
Harald Hartung ist ein Kenner der internationalen Lyrik,
der Geschichte der Gattung, ihrer Formen. Seine Essays sind voller Anmut und lehrreich zugleich – für die Leser und für die Schreiber von Gedichten.
Der Dichter Harald Hartung, der ein bedeutendes lyrisches Werk vorgelegt hat, ist zugleich einer der besten Lyrikkenner. Seine Kritiken setzen Maßstäbe. In Essays und Anthologien bringt er uns die Stimmen der Weltlyrik nahe.
Es ist der „Unterton von Glück“, den Hartung in seinen Essays über Dichter und Gedichte zum Klingen bringt. Er entwickelt auf amüsante Weise, wie die Langeweile für Goethe zur Mutter der Musen wird, oder wie Dampfschiff, Mergelgrube und trunkene Flut bei der Droste zusammenkommen. Von den Gedichten Alfred Brendels schlägt er den Bogen zurück zu Erich Kästner. Er zeigt auf, wie sich der frühe Celan auf Trakls Palette bezieht. Oder Robert Schindel auf Lethe und Memoria, Günter Kunert auf eine verlorene Utopie. Hartung betreibt die Wiederentdeckung Ernst Meisters und Ludwig Greves. Er liest aus den Oden jene Freiheit, wie sie die strenge Form erst ermöglicht. Nicht zuletzt spricht der Lyriker Hartung in eigener Sache, wenn er die Erfahrungen beim Schreiben reflektiert.
Wallstein Verlag, Ankündigung
Das ist Sache der Hände
− Langeweile als Musenmutter? Für Gedichte haben gewisse Kritiker das Wort „Kopflastigkeit“ erfunden. Harald Hartung zeigt uns, dass Lyrik vor allem eins ist: Handwerk. −
Dass der Kritiker und Essayist Harald Hartung, dessen Essaybuch Masken und Stimmen und dessen Sammlung Luftfracht exzellente Kompendien der modernen Weltpoesie präsentierten, selbst eines der eigenständigsten lyrischen Œuvres der deutschen Gegenwartsdichtung vorgelegt hat, das ist vielen Lesern erst verspätet bewusst geworden, mit dem Erscheinen der gesammelten Gedichte vor zwei Jahren. Nun aber, da dieser Band ihm endlich den verdienten Ruhm als Lyriker eingebracht hat, lesen sich auch seine poetologischen Essays zur deutschsprachigen Lyrik anders und neu. Was früher als elegant vermittelte Gelehrsamkeit wahrgenommen wurde, zeigt nun seinen doppelten Boden. Indem der Kenner Hartung über Poesie und Poetik schreibt, in leichthändig geschriebenen Studien von unaufdringlicher Belesenheit, gibt der Dichter Einblick in seine eigene lyrische Werkstatt.
Eine Werkstatt im Wortsinne ist es, was Hartung an die Stelle ekstatischer Entrückungen oder gefühliger Innerlichkeit setzt. Meisterschaft ist für diesen Meister das Ergebnis eines Handwerks – in jenem Sinne des Wortes, den sein programmatischer Essay im Merkur 1999 proklamierte und der mittlerweile fast schon redensartlich geworden ist. Dabei stammt die Beschreibung der Lyrik als einer „Sache der Hände“ aus einem Brief Paul Celans an Hans Bender: „Und diese Hände wiederum gehören nur einem Menschen. Nur wahre Hände schreiben wahre Gedichte.“ Hartungs Essay über Hände und Handwerk steht am Anfang der fünfzehn Essays zur deutschen Lyrik von Goethe bis Gernhardt, die sein neuer Band versammelt. „Was waren das für Zeiten, in denen das Handwerk noch geholfen hat?“, fragt er scheinheilig und verweist zur Antwort auf jene Widmung, die T.S. Eliot dem Waste Land vorangestellt hat: „For Ezra Pound, il miglior fabbro“.
Hartungs Werkstattberichte und -besichtigungen rücken Gedichte von Goethe bis zu Celan dergestalt in neue Perspektiven, dass dem Kenner überraschende Einsichten eröffnet und zugleich doch neugierigen Neulingen vergnügliche Einführungen geboten werden. Gerade weil er mit Vorliebe mit Beobachtungen zu handwerklichen Fragen beginnt, bleiben seine Analysen auch dort sinnlich konkret und sensibel, wo es in die Höhenlagen ästhetischer Theorie hinaufgeht. So findet er in Goethes „Venezianischen Epigrammen“, die oft gegen die vermeintlich erlebnistrunkenen „Römischen Elegien“ ausgespielt worden sind, eine Poetik des schöpferisch bewältigten Ennui, die den Rang dieser Texte neu bestimmt: eine so energische wie erfolgreiche „Inthronisation der Langeweile als Musenmutter“.
So führt ein Essay unter dem bescheidenen Titel „Über einige Motive der Droste“ gerade deshalb an jenen Punkt, an dem sich in den Dichtungen „halluzinatorisch die Tiefe der Zeit öffnet“, weil er mit der scheinbar bloß technischen Neugier auf wiederkehrende Nebenmotive einsetzt. So spürt er dem diskreten Umgang mit Odenmaßen in der Poesie des zwanzigsten Jahrhunderts nach, bei Georg Britting und Ludwig Greve, und beantwortet wie nebenbei die Frage, wie die produktive Auseinandersetzung mit derartigen Formtraditionen möglich sein könnte, ohne in blasse Epigonalität zu verfallen.
Mit derselben Aufmerksamkeit entdeckt er am anderen Ende des Spektrums, in der neusachlichen Poesie des glanzvoll als „Virtuose des Mittleren“ verteidigten Erich Kästner, eine in die industrialisierte Metropole verschlagene Naturlyrik. Und in den programmatisch formstreng-konservativen Versen Adelbert von Chamissos spürt er die Augenblicke jener „offenen Disparatheit“ auf, in denen sich die beunruhigende Moderne wie ein Abgrund öffnet. Bis zu Ernst Meister und Günter Kunert spannt sich der Bogen, zu Robert Schindel und, als Überraschungsgast, Alfred Brendel.
Die Vorzüge dieser nüchternen, sachlichen und ebendarum so sensiblen Wahrnehmung zeigen sich am deutlichsten dort, wo sie sich auf die, mit Brecht zu reden, „pontifikale Linie“ der modernen Poesie richtet. Ein nur wenige Seiten umfassender Essay über Paul Celan befasst sich mit dessen Studien zur Farbgebung bei Georg Trakl, weiter nichts. Weiter nichts? Wer unter Hartungs Anleitung verfolgt, wie der Nachfahre den Umgang des Vorgängers mit der Kombination von Farbadjektiven studiert, bekommt zu sehen, was so vielen umstandslos ins Metaphysische gehenden Celan-Studien entgeht: wie hier ein Poet als neugieriger Philologe sein lyrisches Hand-Werk betreibt, wie er seine Hände „wahr“ machen will. Überzeugender als in dieser dichten Fallstudie könnte Hartungs Plädoyer für die Poesie als „Sache der Hände“ kaum begründet werden.
Und in ebendieses Plädoyer mündet der Band nach dem weiten Bogen durch zwei Jahrhunderte am Ende wieder ein: in Bemerkungen „Über einige Erfahrungen beim Schreiben von Lyrik“, Erinnerungen an die eigenen lyrischen Anfänge, Bekenntnisse zu Lieblingsdichtern wie Ungaretti und Christensen. Nun in erklärtermaßen ganz eigener Sache formuliert Hartung die leidenschaftliche Verteidigung einer Poesie, deren von Celan proklamierte „Wahrheit“ sich durch „wahre Hände“ artikuliert, als genaue Form – in unauffälligen metrischen Regulierungen beispielsweise, die kein Leser bemerken muss und die doch dem Autor jene produktive „Erschwerung der Form“ auferlegen, in der die russischen Formalisten einst einen Fundamentalsatz aller Poesie erkannt haben.
Das, was Valéry die „errechneten Verse“ genannt hat, entfaltet in diesem Werkstattbericht einen ganz eigenen poetischen Glanz, in der ironischen Aneignung der Sonettform ebenso wie in Inger Christensens Spiel mit mathematischen Prinzipien oder in jenen silbenzählenden Verfahren, die Hartungs eigene Poetik mit derjenigen W.H. Audens verbindet. „Dem Romanautor“, bemerkt Hartung, „verübelt niemand, dass er von Thema, Plot und Hauptfiguren redet, allein der Lyriker soll noch immer singen, wie der Vogel singt. Selbst Kritiker misstrauen der poetologischen Reflexion, sie hätten sonst nicht das Wort ,Kopflastigkeit‘ erfunden.“ Ob es freilich auf Last oder Lust hinausläuft, das hängt ganz vom Kopf ab. Liest man die Essays dieses miglior fabbro, so stellt sich ein, was der Buchtitel ohne Übertreibung verspricht: „Ein Unterton von Glück“.
Heinrich Detering, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 24.1.2008
Weiterer Beitrag zu diesem Buch:
Beatrice von Matt: Handwerk als goldener Boden der Lyrik
Neue Zürcher Zeitung, 1. 7. 2008
Am 2.2.2006 las Harald Hartung im Literarischen Colloquium Berlin und sprach mit Jan Wagner über sein Werk.
Zum 70. Geburtstag des Autors:
Bleutge, Nico: Langsamer Träumer
Stuttgarter Zeitung, 29.10.2002
Walter Helmut Fritz: Das Ziel kommt zu dir
Badische Zeitung, 29.10.2002
Jörg Plath: Ruhe unterm Riesensegel
Der Tagesspiegel, 29.10.2002
Zum 80. Geburtstag des Autors:
Felicitas von Lovenberg: Von Wurzeln und Flügeln
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 28.10.2012
Zum 90. Geburtstag des Autors:
Andreas Platthaus: Bei ihm müssen es keine Fixierungen sein
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 29.10.2022
Hannes Krauss: Harald Hartung schreibt Gedichte, um verstanden zu werden
Westfälische Rundschau, 29.1.2022
Fakten und Vermutungen zum Autor + Antrittsrede + KLG +
Kalliope + DAS&D + Johann-Heinrich-Merck-Preis
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Galerie Foto Gezett
shi 詩 yan 言 kou 口


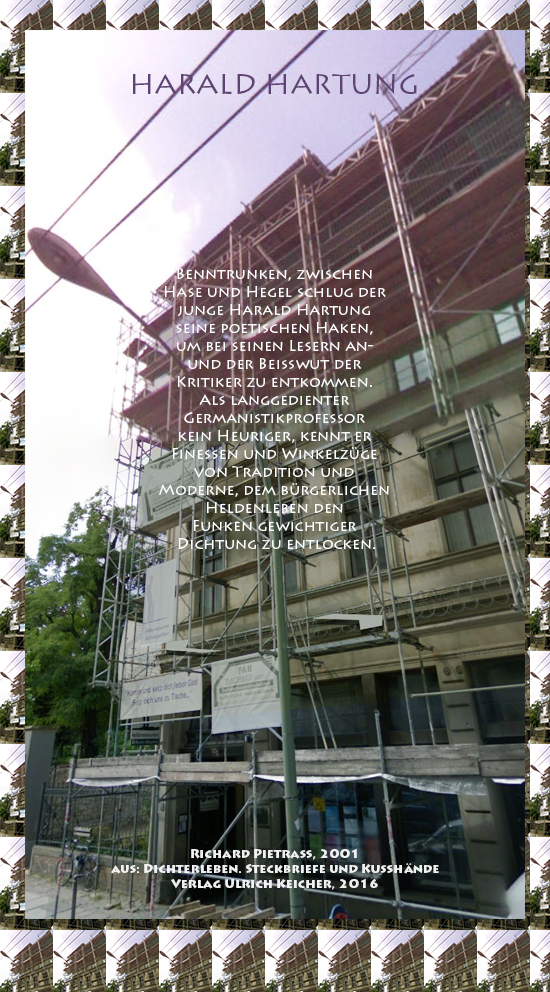












Schreibe einen Kommentar