Heiner Müller: Heiner Müller liest Heiner Müller (CD)
Anläßlich seines 60. Geburtstags
am 9. Januar 1989 las Heiner Müller in der Berliner Akademie der Künste eigene Gedichte und zwei Prosatexte. Die Aufzeichnung dieser Lesung erschien im Januar 1999 zu seinem 70. Geburtstag erstmals auf CD.
Alexander Verlag, Ankündigung
Aus der Minderheit der Illusionszerstörer
– Über Heiner Müller. –
Das erste Mal stieß ich 1981 auf Heiner Müller. Da war ich zwanzig, arbeitete als chirurgische Schwester im Operationssaal eines Karl-Marx-Städter Klinikums und setzte mein kärgliches Gehalt zum größten Teil in Bücher und Theaterkarten um. In jenem Jahr wurde Heiner Müllers Stück Der Auftrag aufgeführt; unter der Regie von Axel Richter, Ulrich Mühe spielte den Sklaven Sasportas. Das Stück und die Inszenierung waren eine Sensation, streitbar, aufregend für Beteiligte wie Zuschauer. Ich glaube, ich habe es zehn Mal angesehen. Ich muss dazu sagen, dass ich in diesem Alter gerade erst auf den Weg gekommen bin, aus einem kleinbürgerlichen Arbeiterhaushalt, in einer durch den Krieg schwer verletzten Stadt, und in einer Zeit, in der einige kritische Köpfe noch Fragen nach der gesellschaftlichen Verantwortung stellten; die sich über die Rolle des Einzelnen in der Geschichte, über das Versagen, die Verführungen, über den Verrat „an der Sache“, das heißt an der Idee des Sozialismus als einer besseren Gesellschaft, „das mögliche Ende der Schrecken“, ernsthaft Gedanken machten.
Heiner Müller war – wie übrigens auch Volker Braun – in Karl-Marx-Stadt eine Art Initialzünder für einen kleinen widerständischen Kreis, in den ich mich vom Rande aus einfädelte – tollkühn in meiner Unerfahrenheit, aber hochgradig neugierig auf das, was da auf der Bühne geschah. Die Bühne war der Zerrspiegel der Gesellschaft. Nicht, dass ich damals alles verstanden hätte – aber es war wohl zunächst Heiner Müllers Sprache, dieser Vers, dieser Drive, der aufrüttelte, der Ungeheuerliches verkündete, in seiner hämmernden Diktion, in seiner unglaublichen Bildhaftigkeit – ERINNERUNG an eine Revolution – was war das? Was hieß das für mich, die Zwanzigjährige, die von der Geschichte und dem Wort Revolution nur die Schul-Klischees im Kopf hatte? Vor allem war die Begegnung mit Heiner Müllers Dramatik zunächst das Kennenlernen meiner eigenen Lust, hinter die gesellschaftlichen Oberflächen, die Lügen- und Verheißungsgespinste zu steigen, eine poetisch-durchschlagende, sinnlich-expressive Sprache zu finden – auch für das, was mich umgab. Heiner Müller war ja die Generation zwischen meinen Großeltern und Eltern – und die schwieg, zumindest an unserem Familientisch. Als Tochter von Kriegskindern hatte ich das Bedürfnis, dieses Schweigezelt abzureißen.
Nachdem also in Karl-Marx-Stadt Müllers Auftrag in den subversiv infizierten Kreisen hoch- und runterdiskutiert wurde – im Theater, das tatsächlich noch ein Ort war, an dem Substanzielles verhandelt wurde – wollte ich alles von Heiner Müller lesen. Eine Dramaturgenfreundin besorgte mir das Textbuch vom Auftrag. Bei Reclam gab es die Ausgabe Zement, die mich, ich gebe es zu, als ungespielter Text nicht besonders beeindruckte. Ich erinnere mich, dass – wie damals üblich – hektographierte oder von Hand abgeschriebene Prosa und Gedichte Müllers kursierten. Aus meiner poetischen Fresssucht heraus habe ich eine Notaktion gestartet und meinen Onkel Erwin, einen strammen Antikommunisten aus Ingolstadt, der mich bislang mit Mickey-Maus-Heften versorgt hatte, gebeten, mir beim nächsten Ostzonen-Besuch doch bitte ein paar richtige Bücher mitzubringen, nämlich welche von Heiner Müller. Der Name Müller klang in Onkel Erwins Ohren unverdächtig. Und siehe: er überreichte mir ein paar Wochen später – und es war das letzte Mal, dass er mir etwas Gedrucktes aus dem Westen mitbrachte – vier Paperbacks – die Rotbuch-Ausgaben mit Heiner Müllers Texten. Der Onkel warf sie auf den Tisch und schimpfte: Wenn er gewusst hätte, dass er in seiner Buchhandlung nach Büchern eines Kommunisten fragen würde – ER, der stadtbekannte Automobilhändler –, hätte er meinen Wunsch nicht erfüllt. Jetzt würde man sich das Maul zerreißen; wegen einer Nichte aus dem Osten! Die ganze Familie war entsetzt. Immerhin, einen Erfolg konnte Onkel Erwin verzeichnen: Müller killed Mickey Maus.
Die Rotbuch-Bände gingen von Hand zu Hand und zerbröselten leider sehr schnell. 1989 erschien dann das Heiner Müller Material bei Reclam – und auch der Band weist deutliche Gebrauchsspuren auf. Heiner Müller war für mich Aufbauhelfer und Sprachzertrümmerer. Weil er schwierig und gleichsam erlösend war; gehörte er einer Minderheit an, die für mich Rettung bedeutete aus dem verlogenen Alltag – die Minderheit der Illusionszerstörer.
Kerstin Hensel, aus Ingrid Sonntag (Hrsg.): An den Grenzen des Möglichen. Reclam Leipzig 1945–1991, Ch. Links Verlag, November 2016
Brecht
(…)
Die Nationalsozialisten, die die Vernichtung von Menschen automatisierten, sie in einem Maßstab, in einer Art und Weise durchführten, die wie nie zuvor Bürokratie, Technokratie und Perversion vereinte, nannte Bertolt Brecht wie jeder fühlende Mensch Verbrecher. Diese hatten auf ihrem Weg zur Macht jedoch nicht behauptet, die Menschheit zu erlösen. Bei ihnen war die Rede von Volk und Nation, von Rasse, von Auserwählten. Sie schlossen die einen aus, um den anderen Raum und gestohlenen Reichtum zu verschaffen. Sie logen, aber in ihren Worten des Hasses qualmten schon die Scheiterhaufen. Mein Kampf war keiner für die Aufhebung der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen. Hitler hatte als Diktator Ideengeber, hatte Theoretiker und Techniker zu Mittätern. Aber die nationalsozialistische und faschistische Weltanschauung war weder vor ihrer Machtergreifung noch wurde sie danach eine weltweit verbreitete, von Künstlern illuminierte, von Dichtern besungene Lehre zur Veränderung der ganzen Welt. Sie war nicht das Richtige, das nur von den Falschen zur falschen Zeit im falschen Land falsch betrieben wurde. Das Richtige, das Wahre, das Heil, das Gute war auf der Seite von Lenin und Stalin, von Mao Tse-tung und Pol Pot. Abertausende Philosophen und Dichter standen zu dieser Lehre und verbreiteten sie. Wie mit Dissidenten, mit Abtrünnigen verfahren wurde, davon spricht Hans Sahl ganz unaufgeregt. Dabei ist die Ermordung Leo Trotzkis dafür Beispiel und Symbol.
*
Diesen Versuch schreibt einer, der sich zur Zeit seiner musischen, seiner musikalisch-lexikalischen Prägung umstandslos auch auf Mick Jagger und Wolf Biermann berief. Diese Selbstverständlichkeit ist eher selten Thema, gehört aber in den Kontext: Neben dem Hölderlin’schen „Aber“, neben der Kleinen Aster und dem Gott der Stadt, außer Trakls und García Lorcas Guitarre, jenseits der Legenden aus Guatemala, einem gewissen Aas oder dem Schläfer im Tal, neben, vor allem vor dem Sonett lief eine andere Tonspur. Sie bestand im täglich gehörten populären Lied, in seinen Melodien und seinen Texten. Da gab es Black Power und Wortkaskaden von Stevie Wonder, das Hippie-Sentiment von Neil Young und das hintergründige von Leonard Cohen, und es gab den Sexappeal des Rhythm ’n’ Blues. Nicht allzu fern davon erklingen die Lieder Heines, Brechts und Biermanns. Diese nicht gerade zimperlichen Dichtermänner, diese eitlen Kerle, diese ausdrücklich männlichen Produzenten von Duftmarken, diese Popstars begleiteten die Genese meines eigenen Gedichts auch. Wenn oben von Sinn und Zweck die Rede war, gehört auf die Seite des Sinns das Erhabene, das echte Pathos der Erfahrung. Der Zweck dagegen braucht und erzeugt Profanierung. Skrupel entfallen dabei. Was Romeo unter Julias Balkon singt, geht auf Konkretes aus. Da scheint sich der berüchtigte blutige Nachfolger des dichterischen Worts, die Tat zum Gedanken in Heines deutschem Wintermärchen durchaus zu verstehen mit den Männern die sich umstandslos der Frauen bedienen und ihnen ein Gedicht oder ein Lied hinterlassen. Es gibt diesen kaum mäandernden, diesen eher geradlinigen Fluss in der maskulinen Dichtung. Und es gibt alle Formen von Sublimation andererseits, von den ritualisierten altägyptischen Liebeskarmen und dem Marienkult bis zu Wolfgang Hilbigs Sehnsucht in dem Gedicht „geste“:
ach nirgends nur ein mund voll wind.
Brecht, der Verführer und Szene-Typ, der Macher, zielstrebig und seine Ziele erreichend, immer auch Impresario seiner selbst und Zirkusdirektor, wo immer das Zelt stand, er sehnte sich nicht lange, sondern holte sich, worauf er aus war. Der Zweck im Leben heiligte ihm alle Mittel der Dichtung. Der Zweck im Gedicht folgte konsequent dem, was Brecht für tauglich im Leben erkannt hatte. Ein Star wurde und blieb er sowieso, vom Durchbruch und Dauerbrenner der Dreigroschenoper bis zum Weltruhm mit Mutter Courage. Er machte Stars wie Lotte Lenya, er wurde gespielt von welchen wie Hans Albers oder Charles Laughton. Dazu gehörte auch der Hautgout des politischen Dichters, des Linken, des anrüchigen Freunds der Sowjets. Bei Brecht war das von Anfang an auch Attitüde, wurde Geschäftsmodell, wurde seine Marke.
*
Mit dem zuletzt Gesagten sind wir übergangslos bei Heiner Müller. Mit einer gewissen Scheu dennoch. In der Szene Ostberlins kannten, mochten und verehrten ihn wohl alle. Jeder wusste einen seiner Witze weiterzuerzählen. Das war familiär, das war wie Theaterkantine, das war bei ihm zu Hause, ob damals in Pankow oder später gegenüber dem Bärenschaufenster des Tierparks, in dem großen Betonriegel, wo auch manch anderer einen separaten Eingang hatte. Das war seine Zigarre und, im Unterschied zu Brecht, sein Whisky. Ich will hier nichts kleinreden. Das kann ich auch gar nicht. Heiner Müller genoss Autorität. Sie speiste sich aus ähnlichen Quellen wie die Brechts seinerzeit. Der größte Teil davon war Persönlichkeit, das, was man wohl natürliche Autorität nennt. Müller war ein Theatermann pur, und er war ein privater wie politischer Clown nach Brechts Fasson auch. Nicht davon zu trennen: die private Haltung als politische, die politische mit größter Selbstverständlichkeit privat. Er betrieb für die Bühne den Kult des Arbeiters ganz in Brechts Sinn, deutlich in seinem ersten großen Stück Lohndrücker, 1958 uraufgeführt. Hier ging sogar die Idee, den Ausnahme-Maurer Hans Garbe zum Helden eines Stücks zu machen, auf Brecht zurück. Eine Parallele in der Haltung des Künstlers als Geschäftsmann bestand auch darin, dass Müller eine Zeitlang die Mitarbeit seiner ersten Ehefrau, der Dichterin Ingeborg Meyer alias Inge Müller, an dieser wie an anderen Arbeiten verleugnete. Brechts Farbe trägt auch der Faible für Vorlagen aus dem Osten: Zement von 1972 und die Lieferungen der Wolokolamsker Chaussee der 1980er Jahre. Was mir von Heiner Müllers Theater in Erinnerung ist: 1. Die kulinarische Inszenierung von Shakespeares Macbeth an der Ostberliner Volksbühne. Bühne: Robert Wilson. Übersetzung (war das wirklich eine Neufassung des Stücks?): Heiner Müller. Inszenierung: die beiden. Die Lady: Corinna Harfouch. Macbeth: Michael Gwisdek. In (beinahe) fast allen anderen Rollen: Ulrich Mühe, sehr gelenkig, irgendwann wie eine der gestauchten Figuren des Malers Francis Bacon, nicht nach Velazquez, mehr nach Hieronymus Bosch. Alles von sehr weit hinten gesehen. Trotzdem alles nah herangeholt durch Konstruktionen über die Sitzreihen weg. Das gespiegelte Spiel vorn und hinten, oben und unten. Unerhört schön. Dramatisch auch, nämlich Shakespeare. Usurpation der Macht, wie immer und überall! Eros und Thanatos die blutigen Hände ineinander (rote Handschuhe), immer das Ganze, das alle betrifft. Heiner Müllers Anteil war sicher immens, nämlich an der Ästhetisierung des großen Stücks. – 2. Philoktet, in aller ungenauen Statik der Erinnerung. Die Düsternis der Bühne ist noch da. Stimmt das? Wenige Männer darauf. Deutsches Theater, Kammerspiele. Alexander Lang als Philoktet, glaube ich, groß im Raum stehend, den Bogen auf dem Rücken, der Held mit der stinkenden Wunde, der sich verweigert. Odysseus – wer? Christian Grashof, Selbstdarsteller durch alle großen Figuren an der Schumannstraße, meist beeindruckend. Eine Nebenszene bei Homer, die drei großen griechischen Tragiker nahmen sich ihrer an. Müller arbeitete wohl nach Sophokles, der den Helden einsam zeigt auf seiner Insel, mit der nie heilenden Wunde. Blut, Gestank, die List des Listigen, des Schlitzohrs Odysseus. Die Diskussion immerzu darum, ob einer nun wieder mit in die Schlacht, zum Schlachten will oder nicht. Die Sache mit dem Orakel, mit der Zukunft, mit dem Sieg nur dann, wenn… Das Thema ein Gleichnis. In meinem Verständnis stand die Schlacht um Troja für „das letzte Gefecht“. Alles andere, die Verweigerung des Protagonisten, seine Überlistung, ergab so einen aktuellen Sinn. Die Männer, düster da in der düsteren Landschaft. Kammerspiel das Ganze, intensiv, bannend, gestisch bis zu intensivster Einfühlung des Zuschauers. Der Bogen des Herakles, den Philoktet besitzt, ist schließlich wichtiger als der, der ihn trägt. Erfüllung des Orakels durch Mord. So geht das. So sieht eine Maßnahme aus. Troja wird fallen. – 3. Der Auftrag. Die Vorlage von Anna Seghers, eine karibische Geschichte von der schweigenden Eminenz im ostdeutschen kulturpolitischen Gemenge. Die Situation, die Heiner Müller einbaut, nachdem er die Revolutionäre in der Karibik mit ihrem Auftrag und mit ihren Sprüchen vom Tod gezeigt hat: wie es Funktionäre aus dem gewohnten Fahrstuhl-Fahren in die dritte Welt verschlägt, in die Wirklichkeit also, in die wirkliche Fremde, in die Absurdität. Die große Hilflosigkeit mitten im Export der Revolution. Dass gar nichts da ist außer der Hilflosigkeit. Dass gar nichts da ist außer der Leere des reinen Machterhalts. Dass da nichts zu exportieren ist, schon gar nicht eine Revolution. Wie Heiner Müller da, irgendwo in dieser Dritten Welt, die damals noch so hieß, auch in der DDR (Alte Welt; Neue Welt; Dritte Welt – eine Sache der Kartographie), wie er da also eine Hoffnung hinwirft, auf irgendein Land projiziert, auf das Unfertige da, auf das Offene. Wie er auf dieses Offene setzt als einem vorderhand und unbedingt Fremden, Neuen, Neugierigen. Jedenfalls auf der Bühne, wo ich es damals sah und so auffasste. Die Diskussion, die zum Schluss der Rahmenhandlung, in diesem Trinidad und Bühnenjamaika geführt wird, fügte aus meiner Perspektive den gefangen gesetzten Revolutionären in Dantons Tod nicht viel hinzu. Ebenso wenig entfernt schien mir die Mitteilung des Ganzen von dem Bühnenstück Großer Frieden Volker Brauns. Dessen Message von der Bühne des Deutschen Theaters herab lautete 1979 ganz ähnlich: Zurück in die Wälder! Nach Che Guevaras Vorbild. Die Dritte Welt kein Zufall! Die Hoffnung war verschoben in wärmere Zonen, nach Bolivien, in die Dschungel, in afrikanische Savannen – überallhin, wo DDR-Bürger sich erst einmal hinträumen mussten, was sie sich überhaupt erst einmal vorstellen mussten, bevor daran zu denken war, es wäre real. Spekulation auf dem Theater also. Exotische Vorführung und Rückgewinnung der verlorenen Mutter, der Hoffnung auf die Große Ordnung, die da komme. Amen!
Nationalpreis der DDR I. Klasse für Kunst und Literatur an Volker Braun 1988.
Nationalpreis der DDR I. Klasse für Kunst und Kultur an Heiner Müller 1986.
Nationalpreis der DDR I. Klasse für Kunst und Literatur an Bertolt Brecht 1951.
Internationaler Stalin-Preis der UdSSR an Bertolt Brecht 1954.
*
Heiner Müller war ein begeisterter Grenzgänger zwischen Ost und West, insbesondere zwischen dem einen und dem anderen Berlin tauchte er gern durchs Labyrinth der Grenzschleusen, saß mal im Kempinski am Kurfürstendamm und schnitt die Havanna an, saß mal im Grandhotel Unter den Linden und tat dasselbe, nachdem der passende Zigarrenabschneider sogar für obligaten Glattschnitt aufgetrieben war. Derlei Anekdoten sind überliefert, weil Heiner Müller sie selbst zum Besten gab. Er thematisierte sein Hin und Her, vom Überfliegen der kleinen DDR kündet ein Gedicht aus deren letzten Jahren, post festum 1992 veröffentlicht:
MANCHMAL WENN ICH MEINE PRIVILEGIEN GENIESSE
Zum Beispiel im Flugzeug Whisky von Frankfurt nach (West)Berlin
Überfällt mich was die Idioten vom SPIEGEL meine
Wütende Liebe zu meinem Land nennen
Wild wie die Umarmung einer totgeglaubten
Herzkönigin am Jüngsten Tag.
Abgesehen davon, dass Müller neben den thematisierten Privilegien seinen Ruhm auch in der Wahrnehmung durch die genannte Wochenschrift genoss, ist das kleine Werk wie eine Lupe für seinen poetischen Kosmos: Deutschland; die DDR; der politische Eros; die Liebe; der Tod; irgendein möglichst großes Mythologem, das wesentlich den Tod einschließt. Heiner Müller also pendelt, bleibt der DDR treu, auch wenn er zwischen New York, Bochum und der Ostberliner Volksbühne unterwegs ist. Er gehört zu den Etablierten, die Nachwuchsautoren unterstützen moralisch sowieso, in seinem Fall mit Witz und Whisky, mit Geld, wenn es sein muss, mit Interventionen höheren Orts. Dass er das alles, wirklich alles kann, hat mit seiner Position zu tun innerhalb eines Systems, das in SBZ und DDR das erste Mal mit, durch und anhand von Brecht etabliert wurde. Es basiert auf vorzeigbarem Talent, kritischer Distanz, Produktivität und Bereitschaft zum Mitspielen aus eigenen Interessen, vor allem aus Hedonismus. In Müllers Autobiographie in Gesprächen, Krieg ohne Schlacht, heißt es dazu ungeschminkt:
Dieses Parteiergreifen für die DDR hing mit Brecht zusammen. Brecht war die Legitimation, warum man für die DDR sein konnte. Das war ganz wichtig. Weil Brecht da war, mußte man dableiben. Damit gab es einen Grund, das System grundsätzlich zu akzeptieren. Ein Beweis für die Überlegenheit des Systems war die bessere Literatur, Brecht, Seghers, Scholochow, Majakowski. Ich habe nie daran gedacht, wegzugehen. Vielleicht ging es nicht darum, ob der Sozialismus in der DDR gewinnen könnte oder nicht, das ist schon eine zu praktische oder politische Überlegung. Brecht war das Beispiel, daß man Kommunist und Künstler sein konnte – ohne das oder mit dem System, gegen das System oder trotz des Systems.
Hierher gehört durchaus der Umstand, dass Heiner Müller in der Liste der „besseren Literatur“ mit Scholochow einen Schriftsteller nennt, dessen Hauptwerk eine Hervorbringung der sowjetischen Sicherheitsorgane war. Die Schöpfung des Stillen Don durch geheime Ghostwriter, um nach der unliebsamen Auszeichnung Boris Pasternaks einen Nobelpreis für ein systemkonformes Werk zu erringen, war bekanntlich erfolgreich. Und Heiner Müller war, was die finsteren Hintertreppen der Apparate anging, allzeit interessiert und bestens informiert.
Brechts Haltung als Künstler im Staatssozialismus, Patrix für Heiner Müller, kam am und nach dem 17. Juni 1953 auf den Punkt. Manchmal erinnerte sich der Meister markant der Antike, von der er sich sonst wohl vor allem aus Gründen der Distinktion zum Mainstream der Dichter gern fernhielt. Schon im Exil hatte er Ovids Schicksal zitiert. In den Buckower Elegien nimmt der Antikebezug deutlich an Umfang zu. Neben dem Handwerkszeug ostasiatischer Miniaturen benutzt Brecht antike Bilder: das Schicksal der Trojaner, Zitate aus dem Horaz. Mittendrin eine berühmte Gruppe von Damen, der man sonst bei ihm nicht begegnet: „Die Musen“.
Wenn der Eiserne sie prügelt
Singen die Musen lauter.
Aus geblähten Augen
Himmeln sie ihn hündisch an.
Der Hintern zuckt vor Schmerz
Die Scham vor Begierde.
Von wessen Musen, von welchen Künsten und denen, die sie ausüben, handelt wohl diese Rede? Alle Finger des Meisters weisen, jedes Wort verweist auf ihn selbst. Schmerz und Lust, wie in anderen Konstellationen, all überall stehen sie hier für die Hauptempfindungen des „Denkenden“, des Dichters im Sozialismus. Der nicht anders kann, als davon im Gleichnis zu schreiben. Dass in der Figur des „Eisernen“ Stalin gemeint ist, verblasst mit dem Abstand. Wird der kritische Dichter derlei veröffentlichen? Brecht tat es nie. Im Gegenteil. Kurz zuvor schrieb er das Lehrgedicht „Die Erziehung der Hirse“. Und um den 17. Juni 1953 herum geht von ihm aus die Bereitstellung des Berliner Ensembles und des Gewichts der eigenen Person für die Belange der Regierung, der Einheitspartei. Ulbricht und Genossen reagieren aber nicht. Sie sind mit sich selbst befasst. Ihre Macht beruht in dem Moment der Bloßstellung nicht auf der ästhetischen Legitimation des sozialistischen Experiments, sondern auf den sowjetischen Panzern.
Heiner Müller tritt Brechts Nachfolge an. Mangel an Zuwendung zur arbeitenden Klasse, Mangel an Volkstümlichkeit (!) beim Dichter führt in seinem Gedicht „Orpheus gepflügt“ zur Bestrafung:
Bauern, durch den Jagdlärm aufgeschreckt, rannten von ihren Pflügen weg, für die kein Platz gewesen war in seinem Lied. So war sein Platz unter den Pflügen.
Zur Rolle der Kunst hat Müller 1964, nachdem er Ekkehard Schall in der Brecht-Bearbeitung von Shakespeares Coriolan sah, Vorstellungen gemischter Provenienz:
Das Schreckliche schön das heißt als unnötig gezeigt
Denn die Wirklichkeit muß sichtbar gemacht werden
Damit sie verändert werden kann
Aber die Wirklichkeit muß verändert werden
Damit sie sichtbar gemacht werden kann.
Auch der Theoretiker Brecht hat das vor Müller schon besser gesagt, selbstverständlich ohne Rilke-Referenz. Und Heiner Müllers „Fragen für Lehrer“ paraphrasieren deutlich schwächer als Volker Brauns daran lehnende Verse Brecht:
Die Fragen, die ihr das Leben stellt,
Stellt die Jugend dir, Lehrer, Betriebsleiter, Parteisekretär.
Dein Schweigen ist keine Antwort, deine Ausreden
Schaffen die Fragen nicht aus der Welt.
Vermutlich sah so kritisches Denken aus, als es 1963 in der Zeitschrift Forum erschien. Der Brecht-Gestus aber war sowieso nur noch Gestus, erreichte das Vorbild nicht. Auch Heiner Müllers „Lenin-Lied“, 1970 im Zentralorgan der Einheitspartei, dem Neuen Deutschland, erschienen, unterbietet Brechts Maßstäbe der Svendborger Gedichte zwei Menschenleben danach auf erschütternde Weise:
Es wächst sein Werk, die Sowjetmacht
Es wächst in jeder Klassenschlacht
Die Einheit der Partei.
Volker Braun, Karl Mickel, Sarah Kirsch, Adolf Endler, die meisten heute noch nennenswerten Vertreter der sächsischen Dichterschule waren damals, nach 1968, schon weit davon entfernt, sich öffentlich aus irgendwelchen taktischen Gründen noch so zu entleiben. Müller hat derlei einerseits aus grundsätzlicher Überzeugung vertreten, andererseits mit Sarkasmus kommentiert. Pragmatisch gesehen, hat er sich damit den weiteren Fortgang der Theaterarbeit in Bochum, Mailand und Ostberlin erkauft. Einen der Schlüssel zu seinem Verhalten, den zentralen, möchte ich orten:
Vermutlich 1990, als Erich Honecker nach seinem Sturz der Strafverfolgung ausgesetzt war und unter sowjetischem Schutz nach Moskau ausgeflogen wurde, widmet er ihm ein Gedicht. Er hat es nicht eigens geschrieben. Vielleicht zum Erstaunen des Lesers gibt es hier eine Wiederbegegnung: Heiner Müllers Gedicht ist eine Übersetzung aus Ezra Pounds Gedichtband Cathay, der 1915 in London erschienen war. Es handelt sich um die Nachdichtung eines Gedichts des chinesischen Altmeisters Li Bai. Müller übernimmt die japanische Umschrift Rihaku von Pound:
Leichter Regen auf leichtem Staub
Die Weiden im Gasthof
Werden grün werden und grün
Aber du Herr solltest Wein trinken vor deinem Abschied
Denn du wirst keine Freunde haben
Wenn du kommst an die Tore von Go
(für Erich Honecker nach Ezra Pound und Rihaku)
Heiner Müllers Fassung unterscheidet sich punktuell von der englischen Pounds. Es könnte auch im Deutschen von den Weiden heißen, sie würden „grün und grüner“. Und es wäre nicht falsch zu sagen, „du“ würdest am Ziel der Reise „keine Freunde haben um dich“, „about you“. Damit wäre genauer gesagt, dass der Angesprochene diese Reise allein unternimmt. Eine Abweichung aber überwiegt alle anderen. Die ist in der Umgangssprache, wenn das Englische zum Deutschen kommt, eher unauffällig. Heiner Müller konnte nachweislich lange Interviews auf Englisch bestreiten. Er wusste also, was er tat. Als einer, dessen Beruf das Schreiben war, wusste er es sowieso. Er tilgte die Höflichkeitsform in der Anrede, wie sie in Übersetzungen aus dem alten Chinesisch bei derlei Auftritten die Regel ist. Eva Hesse gibt in ihrer Fassung den ersten der drei Verse, in denen der Protagonist angesprochen wird, so wieder:
Ihr aber, Herr, tätet wohl, vor eurem Fortgehn Wein zu trinken.
So gesagt, kann kein Zweifel bestehen, dass es sich um einen abreisenden Herrn handelt, um einen Mann von Stand. Nicht so in Heiner Müllers Gedicht für Erich Honecker. Ich darf mir die Augen reiben:
Aber du Herr solltest Wein trinken
… Es kann kein Versehen sein. Diese Anredeform ist belegt. Sie gilt dem Gott des Alten Testaments, den Psalmisten war sie geläufig, uns ist sie es in der Fassung Luthers: Aber du, Herr, bist der Schild für mich (Psalm 3,4); Aber du, Herr, sei nicht ferne (Psalm 22,20); Aber du, Herr, bist der Höchste und bleibest ewiglich (Psalm 92,9 ). Heiner Müller hat sein Gedicht 1992 veröffentlicht. Es gab Revision durch den Autor und Lektorat. Der Alexander Verlag wirbt 2015 mit einem Zitat Harald Hartungs für die fünfte Auflage der Ausgabe:
Heiner Müllers Gedichte beleuchten den Weg vom Epiker und Didaktiker im Gefolge Brechts zum Anarchisten und Dekompositeur.
Das mag sein.
Ist nun die Vergöttlichung des abgedankten Generalsekretärs und Staatsratsvorsitzenden durch die Zueignung der Übersetzung mehr der Anarchie oder mehr der Dekomposition zuzuschreiben? Oder verlässt in der Dichtung Heiner Müllers vielleicht Gott, einhundert Jahre nach Nietzsche, noch einmal die Welt, jedenfalls deutschen Boden? Oder hat Heiner Müller auf dem Weg vom Didaktiker zum Anarchisten sich derart mit Erich Honecker angefreundet, dass er ihn duzte? Wollte er damit vielleicht die lässige Haltung kopieren, die der Hamburger Rocksänger Udo Lindenberg schon 1983 im „Sonderzug nach Pankow“ einnahm? Geboren ein Jahr nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, eine Welt entfernt von Heiner Müllers verinnerlichter Rücksicht, seiner Verstellung und seinen Tabus, nannte er Honecker in seinem Song den „Oberindianer“ der DDR und ging ihn ohne Respekt an:
Du ziehst dir doch heimlich auch gerne mal die Lederjacke an
Und schließt dich ein auf’m Klo und hörst West-Radio
Udo Lindenberg hatte mit diesem und dem Titel „Wir wollen doch einfach nur zusammen sein“ („Mädchen aus Ostberlin“) mehr Erfolg unter jungen DDR-Bürgern als je eine DDR-Rockband oder irgendein Dichter.
Die Frage nach der großen Geste im kurzen Gedicht Heiner Müllers ist nicht vom Tisch, nur in den Kontext gestellt. Natürlich besteht die Möglichkeit, dass Müller seine Nachdichtung zueignete in dem Moment, als die neue ost-westdeutsche Öffentlichkeit, als der gesellschaftliche Mainstream darauf aus war, die vertriebenen Funktionäre juristisch zu belangen. Vielleicht missbilligte er das. Wie Müller ja ausdrücklich, im Chor mit Stefan Heym und Monika Maron, seiner Verachtung freie Bahn ließ für diejenigen, die seit November 1989 erst einmal nichts anderes taten, als in die Kaufhäuser und auf die Märkte mit den symbolischen Bananen zu strömen. Dazu wäre zu sagen, dass weder für Heym noch für Müller noch für Volker Braun, Stephan Hermlin, Franz Fühmann, Christa Wolf oder (ab 1986) den Autor dieser Zeilen der Besuch von westdeutschen Kaufhäusern ein besonderes Problem darstellte. Das schwarz-weiß-blutige Raster des Weltenganzen, wie es Heiner Müller als Theaterautor und Kommentator gern beschwor, auch mit dem Interesse an Männern der Geschichte von Alexander und Cäsar über Danton bis Lenin, Hitler und Stalin, ganz à la Mode Bertolt Brecht, darauf schaute er von oben herab. Die sprachlichen Gesten dabei immer so groß wie die Zigarren, die Körpersprache sonst möglichst diskret. Nur beim Fußvolk, wenn es nicht in Jamben sprach, nicht den klugen Chor gab, sondern schließlich einfach rief „Wir sind ein Volk!“, wenn es nicht als bühnentauglicher Held Ringöfen mauerte oder am schlammigen Rand der Chausseen sein Blut für die schwarze oder die weiße, die rote oder die braune Sache vergoss, wenn es auf irgendeinem Kurfürstendamm in die Schaufenster glotzte, da war es einem peinlich darum. Und so, vielleicht, war es gut für das moralische Immunsystem, mehr noch für die intellektuelle Autonomie, dem letzten Führer des Sozialismus auf deutschem Boden, dem Antifaschisten Erich Honecker die Ehre zu erweisen.
In der Zeit, als Heiner Müller das Gedicht schrieb, übernahm er erstmals eine öffentliche Funktion, die Präsidentschaft der Akademie der Künste (Ost), und hatte sie inne bis zu deren Vereinigung mit der Akademie der Künste (West) im Jahr 1993. Ebenso wurde der weltweit bekannte Dramatiker 1992 bis zu seinem Tod 1995 einer der Intendanten des Berliner Ensembles. Seine Verbindung zur Brecht-Bühne ging mindestens auf das Jahr 1973 zurück, als sein Stück Zement von der damaligen Leiterin des Theaters Ruth Berghaus inszeniert wurde. Die Anrede des Gedichts, dessen Herkunft und Zueignung sind alles andere als Zufall. Für diesen Anlass eine Referenz an das alte China aufzunehmen verweist deutlich genug auf die Brecht-Tradition. Die Herkunft von Pound erhöht den Anspruch, ist für den Fall elitär. Die Übernahme einer Übersetzung von Pound ist einerseits „geschuldet“ der weitgehend synthetischen Arbeitsweise Heiner Müllers, andererseits ist mit der Nennung dieses Namens die Komplexität des 20. Jahrhunderts und seiner Positionen präsent. Pound war einer von der anderen Seite. Sein Name war und ist kontaminiert durch sein Engagement für den italienischen Faschismus. Diesen leicht zu durchschauenden Hinweis braucht Heiner Müller. Nun aber die Anrede des Herrn, der abreist, als jener Herr, der auf dem Weg nach Emmaus von seinen Jüngern gebeten wird, zu bleiben, noch bevor sie wussten, wer der war, der mit ihnen ging:
Bleibe bei uns!
Geht ein deutscher Staatsanwalt gegen den Antifaschisten und Kommunisten Honecker vor, sieht der Ex-Hitlerjunge Heiner Müller die Welt zusammenbrechen. Es geschieht etwas, was nicht geschehen darf. Der Protagonist des schwer errungenen Glaubens, des notwendigen und zur Basis jedes weiteren Gedankens gewordenen Antifaschismus-Kommunismus geht. Gott stirbt nicht, aber er geht. Die Legitimation entfällt. Der Grund geht. Das jahrzehntelang implizite Gegenüber des Dichtens und Denkens wird nicht mehr sein! Der Dichter verliert seinen Halt. Ein gewaltiges Sentiment bricht sich Bahn, das in Heiner Müllers Texten oft genug lauert in mehr oder minder schwarzer bis launiger Brechung und Verbrämung. Immer kurz davor, das Gelächter nicht mehr zurückhalten zu können, wie bei Beckett, wie bei Kafka. Hier kann es und will es sich auch nicht verstecken in den Zeilen eines fast 1.300 Jahr alten Gedichts. Der im Gedicht geht, der da gehen muss, er „sollte [ … ] Wein trinken vor dem Abschied“. So wäre es nur ein freundlicher Gruß? In Emmaus brach der Auferstandene unerkannt das Brot für die Jünger, „da wurden ihre Augen geöffnet, und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen“. Heiner Müller stand das so vor Augen, sein Ohr gab es so wieder, sein Verstand war an dem nämlichen Punkt. Der Mönch Luther half ihm. Kleinere Münze gab es nicht.
Geist und Macht sagen einander Adieu. Und nur dem Geist tut es weh.
(…)
Uwe Kolbe, aus Uwe Kolbe: Brecht, S. Fischer Verlag, 2016
HEINER MÜLLERS GRAB,
revisited
Unbeschriebenes Gras nichts Goldenes
Nichts als ein Name daumengroß Antiqua
Auf der Stele türmt sich der Nachlass
Der Verehrer alles was Herakles braucht
Im Land ohne Winter ein nasses Streichholz
Steinchen einzelne Glückspfennige ein
Schiefer Bleistift in den Rasen gerammt
So kommt kein Hund bis nach Hellas
Ohne Papiere auf allen Vieren immer die
Milchstraße entlang du brauchst Devisen
Das rote Strumpfband die Havanna für Z.
Und die Hölle liegt dir zu Füßen kläffend
Winselnd läßt sie sich in den Rachen greifen
Und spuckt dir die Geschwüre aus die ihren Magen
Bevölkern die Helden des letzten Jahrtausends
Noch unverdaut steigen sie aus dem Schlamm
Neugeborene Krieger die alte Brigade
Von Bauschutt weiß das Haar zu allem bereit
Auf der Suche nach Arbeit
Troja ist aufgebaut schleift Troja
Cäsar ist tot es leben die Cäsaren
Fegt die Asche weg
Von den Stufen des Kapitols schultert die Spaten
Der Führer schenkt den Juden eine Stadt
Der Bauherr des Dnepr-Staudamms Sieger im letzten Krieg
Befiehlt den Steinen aufwärts zu rollen den Köpfen
Und nach Feierabend ins Theater
Trojas Tanz ums goldene Pferd Applaus im Parkett
Der Philosoph erzieht seinen Mörder Beifall in den höheren Rängen
Während Feuer gelegt wird im Foyer
Die Ausgänge sind bereits bewacht und
In der Garderobe wartet der Feind mit dem Pferdelächeln
Auf seinen Wink reißen sich die Schauspieler ihre Masken ab
Revolutionäre aller Länder Vorhang
Und grüßt mir den Mann der die Geschichte erfand
Im Gras liegend rauchend
Ruth Johanna Benrath
H. M. (FOTO)
Du signierst auf Deinem Gesicht:
Zigarre, Brille, Stirn
ein papiernes Spiegelbild
Deiner selbst.
Zur Geschichte erstarrt
im Moment der Zeitenwende
sprichst Du von „Kommentar“
und lachst – und schweigst fortan
Jörg Waehner
EINE EPISODE DER OSTDEUTSCHEN LITERATURGESCHICHTE
An einem Vormittag im Frühjahr Neunzehn-
hundertzweiundachtzig bemerkte der Dichter
Heiner Müller einen deutlichen Verlust
der Perspektive, als er, in seinem Arbeitszimmer
im 14. Stock des Hochhauses am Tierpark
in Ost-Berlin sitzend, die Türme der Karl-Marx-Allee
am Horizont nicht mehr erkannte. Entweder,
dachte er, sind es die Augen, der Smog
oder die Fenster. Er prüfte seine Brillen, er besaß
dutzende, die er immer verlegte, konnte aber
keine erhöhte Sehschwäche feststellen.
Die Luftverschmutzung schien ihm nicht
schlimmer als gewöhnlich, auch hatte weder
Die Stimme der DDR noch der RIAS
Warnmeldungen versendet, folglich mussten
die Scheiben, die ungeputzt waren
seit seinem Einzug vor drei Jahren, die Ursache
des Übels sein. Also beschloss er selbst
Hand anzulegen und holte zu diesem Zweck einen Eimer
Warmwasser und eine alte Unterhose als Lappen.
In dem Moment, als er, im offenen Fenster
die kleine Trittleiter bestieg, die ihm diente,
ungeliebte Bücher in die obersten Fächer
der Regale zu verbannen, lief, vierzig Meter
unter ihm, der Nachwuchsautor Peter
Brasch, von der U-Bahn kommend, ein Manuskript
unterm Arm und eine Flasche Whisky
in der Tüte, über den Platz, sah blinzelnd
zum Himmel und entdeckte den Meisters
sprungbereit auf dem Sims, Jessenin,
Majakowski, Pavese und Kleist fielen ihm ein,
er fuchtelte wild mit den Armen und warf
seine schwarze Lederjacke als Warnsignal
in die Luft, um auf sich und seine Ankunft
aufmerksam zu machen, schrie Nein
und weiter: Tu’s nicht, Heiner, die Welt
braucht dich, zugegeben ein pathetisches Wort
für einen Märzvormittag in Berlin-Lichtenberg
im Jahr Neunzehnhundertzweiundachtzig.
Braschs gut gemeinter Ruf war so laut
wie verzweifelt, Bären in den Freigehegen
am Tierparkeingang, gerade erwacht
aus dem Winterschlaf, verkrochen sich knurrend
in ihre künstlichen Höhlen, Kassiererinnen
der nahe gelegenen Konsum-Kaufhalle stürzten
in Kittelschürzen aus Dederon
vor die Tür und unterstützten den Dichter
in seinem Appell, auch Rentner
und Kinder traten hinzu und schrien, was
sie zu schreien gewohnt waren: Druschba,
Freundschaft, so dass der Dramatiker
in lichter Höhe, mit dem Schlüpfer
schmierige Scheiben reibend, schließlich
und endlich den Auflauf am Boden bemerkte
und entschied, die Säuberung auszusetzen, wer
so lange wie er auf Durchblick
verzichtet hatte, könnte getrost
noch einige Tage länger ohne Aufklärung leben,
er ging, den Kollegen in die Wohnung
zu bitten, zum Fahrstuhlschacht und ertrug,
nicht ohne ein Gefühl hitziger Fremdscham,
dass der, den er als diabolischen Witzbold
schätzte, an seiner Schulter zu weinen begann
und ihm sagte, dass er ihn, wenn auch
ohne libidinöse Erwartung, liebe, ein Geständnis,
das den Meister, entgegen seiner Gewohnheit,
veranlasste, Braschs immerhin sechs Jahre
gelagerte Flasche noch vor zwölf Uhr zu erbrechen.
Steffen Mensching
Hans Magnus Enzensberger: Überlebenskünstler Heiner Müller
Zum 75. Geburtstag des Autors:
Christine Richard: 75 Jahre Heiner Müller: Dichtung & Drugs
Basler Zeitung, 8.1.2004
Gunnar Decker: Das Messer im Herz der vertrauten Lüge
Neues Deutschland, 9.1.2004
Ulrich Seidler: Im Besitz der Dichtung
Berliner Zeitung, 9.1.2004
Rüdiger Schaper: Die Explosion der Bilder
Der Tagesspiegel, Berlin, 9.1.2004
Michael Bienert: Manschetten sind keine Sprengsätze
Stuttgarter Zeitung, 12.1.2004
B.K. Tragelehn: Heiner Müller 75
neue deutsche literatur, Heft 553, Januar/Februar 2004
Zum 10. Todestag des Autors:
Jörg Sundermeier: Stumme Worte
die tageszeitung, 30.12.2005
Arno Widmann: Ein Freigänger beider Systeme
Berliner Zeitung, 31.12.2005/1.1.2006
Frauke Meyer-Gosau: Das Denkmal weiß nichts von Geschichte
Literaturen, Heft 1/2, 2006
Jörg-Michael Koerbl: Das Paradoxon vom Dichter
Abwärts!, Nr. 46/47, Januar 2023
Zum 80. Geburtstag des Autors:
Hans-Dieter Schütt: Auf der Gegenschräge die Toten
Neues Deutschland, 8.1.2009
Jens Bisky: Deine Braut heißt Rom.
Süddeutsche Zeitung, 9.1.2009
Matthias Heine: Nicht so tot, wie viele glauben
Die Welt, 9.1.2009
Peter Laudenbach: Das Orakel spricht
Der Tagesspiegel, Berlin, 9.1.2009
Ronald Pohl: Bonmots und Schamottöfen
Der Standard, Wien, 9.1.2009
Stephan Schlak: Neue Gespenster am toten Mann
die tageszeitung, 9.1.2009
Zum 20. Todestag des Autor:
Peter von Becker: Das Licht der Finsternis
Der Tagesspiegel, 29.12.2015
Alexander Kluge: Was hätte er in dieser Zeit geschrieben
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 30.12.2015
Peter Jungblut: Heiner Müller zum 20. Todestag
Bayerischer Rundfunk, 30.12.2015
Heiner Müller – Weltautor mit DDR-Prägung
MDR, 30.12.2015
Wolfgang Müller: Wie aus Reimund Heiner wurde
Deutschlandradio Kultur, 30.12.2015
Tom Schulz: Dramatiker des Aufstands
Neue Zürcher Zeitung, 1.1.2016
Zum 90. Geburtstag des Autors:
Thomas Hartmann: Heiner Müller – ein Getriebener des „Erfahrungsdrucks“
mdr.de, 9.1.2019
Hans-Dieter Schütt: Dunkel, das uns blendet
neues deutschland, 8.1.2019
Mathias Broeckers: Heiner Müller, die Zigarren und die taz
blog.taz.de, 8.1.2019
Ulf Heise: Stern im Sinkflug
Freie Presse, 8.1.2019
Ronald Pohl: Warum der Dramatiker Heiner Müller in der Epoche der Likes und Emojis fehlt
Der Standart, 9.1.2019
Günther Heeg, Kristin Schulz, Thomas Irmer, Stefan Kanis: „Ich glaube an Konflikt. Sonst glaube ich an nichts.“
mdr, 8.1.2019
Thomas Irmer: Wer war Heiner Müller und was bedeutet er heute?
mdr, 9.1.2019
Peter von Becker: Protagonist der Zukunft
Der Tagesspiegel, 21.2.2019
Alexander Kluge: Heiner Müller zum 90. Geburtstag
Volltext, Heft 4, 2018
Zum 25. Todestag des Autors:
Steffen Georgi: „Der Tod ist das einfache…“
mdr KULTUR, 30.12.2020
Carl Hegemann: Er hatte wohl leider recht, der Prophet Heiner Müller
Berliner Zeitung, 30.12.2020
Matthias Reichert: Heiner Müllers Eltern im Reutlinger Exil
Schwäbisches Tagblatt, 30.12.2020
Cornelia Ueding: Arbeiter im Steinbruch der Literatur
Deutschlandfunk, 30.12.2020
Ronald Pohl: Der rote Landschaftsplaner: Heiner Müllers ökologischer Auftrag
Der Standart, 30.12.2020
Joachim Göres: Andenken zum 25. Todestag von Heiner Müller ist umstritten
MOZ, 23.12.2020
Peter Mohr: Zwischen Rebellion und Tradition
titel-kulturmagazin.net, 30.12.2020
Achim Engelberg: Gestern & Heute: Der planetarische Klassiker Heiner Müller
piqd.de, 30.12.2020
Fakten und Vermutungen zum Autor + Homepage + Archiv +
Internet Archive + ÖM + Baukasten + KLG + IMDb + Kalliope +
Facebook 1 & 2 + Interviews 1 & 2 + Georg-Büchner-Preis 1 & 2
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Galerie Foto Gezett +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + Keystone-SDA +
deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Heiner Müller: Die Zeit 1 + 2 ✝ Der Spiegel 1 + 2 + 3 ✝
TdZ ✝
Trauerrede von Alexander Kluge am 16.1.1996 im Berliner Ensemble.
Jürgen Kuttners Müller-Sprechfunksendung vom 16.1.1996 in der richtigen Reihenfolge und eher ohne Lücken…
Thomas Assheuer: Der böse Engel
Frankfurter Rundschau, 2.1.1996
Lothar Schmidt-Mühlisch: Meine Gedanken sind Wunden in meinem Gehirn. Vom Irrglauben der Revolution zur sprachgewaltigen Weltverachtung: Zum Tode des Dramatikers und Theaterregisseurs Heiner Müller
Die Welt, 2.1.1996
Gerhard Stadelmeier: Orpheus an verkommenen Ufern. Unter deutschen Irrtrümmern. Zum Tode des Dramatikers Heiner Müller
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2.1.1996
C. Bernd Sucher: Zur Weltliteratur gezwungen.
Süddeutsche Zeitung, 2.1.1996
Jürgen Busche: Mit ihm war kein Staat zu machen. Zum Tod von Heiner Müller
Wochenpost, 4.1.1996
Fritz-Jochen Kopka: Ein Kern, der unberührt blieb
Wochenpost, 4.1.1996
Hansgünther Heyme: Reflexe aus westlicher Ferne Eine Hommage an Heiner Müller
Süddeutsche Zeitung, 9.1.1996
Birgit Lahann: Nun weiß ich, wo mein Tod wohnt
Stern, 11.1.1996
Gisela Sonnenburg: Oberlehrer und Visionär. Heiner Müller verstarb
DLZ 11.1.1996
Martin Wuttke: In zerstörter Landschaft. Meine Erinnerungen an Heiner Müller
Süddeutsche Zeitung, 16.1.1996
Stephan Hermlin: Zum Abschied von Heiner Müller. Rede zur Totenfeier für Heiner Müller im Berliner Ensemble am 16. Januar 1996
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 17.1.1996
Friedrich Dieckmann: Trauersache Geheimes Deutschland. Wanderer über viele Bühnen im zerrissenen Zentrum: Totenfeier für Heiner Müller in Berlin
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 18.1.1996
Hans Mayer: Der Hund, der mir ein Stück Brot hinwarf
SoirÈe, S2 Kultur, 27.4.1996
Uwe Wittstock: „Ich bin ein Neger“
Neue Rundschau, Heft 2, 1996
Frank Hörnigk u.a. (Hg.): Ich wer ist das/Im Regen aus Vogelkot Im/KALKFELL/für HEINER MÜLLER. Arbeitsbuch
Theater der Zeit, 1996
Michael Kluth:Apokalypse mit Zigarre. Der Dramatiker Heiner Müller
SFB/NDR/ORB/DW, 1996
Jürgen Flimm: Zwischen den Welten
Theater heute, Heft 2, 1996
Thomas Langhoff: Der rote Riese.
Theater heute, Heft 2, 1996
Günther Rühle: Am Abgrund des Jahrhunderts. Über Heiner Müller – sein Leben und Werk
Theater heute, Heft 2, 1996
Heiner Müller liest Texte und spricht über Inge Müller.
Heiner Müller – Gesichter hinter Masken – Gespräch & Werkzitate.



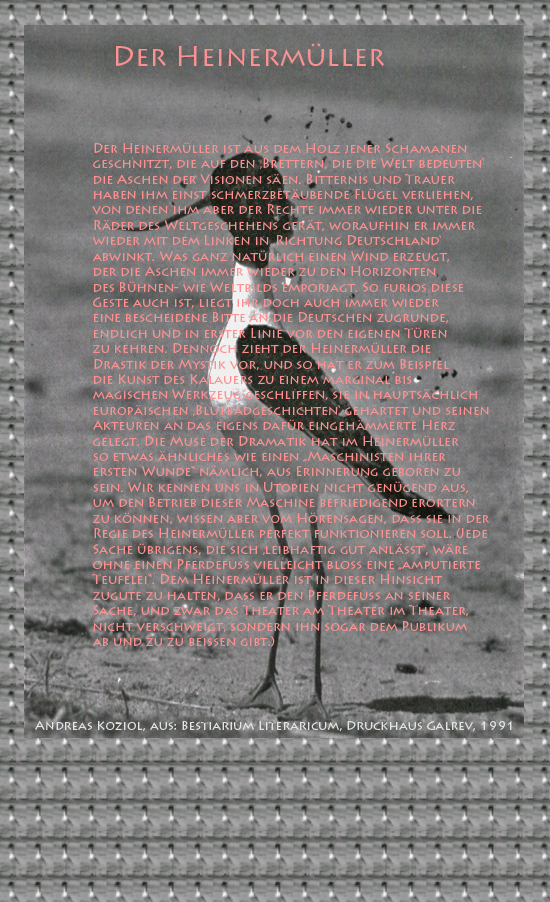
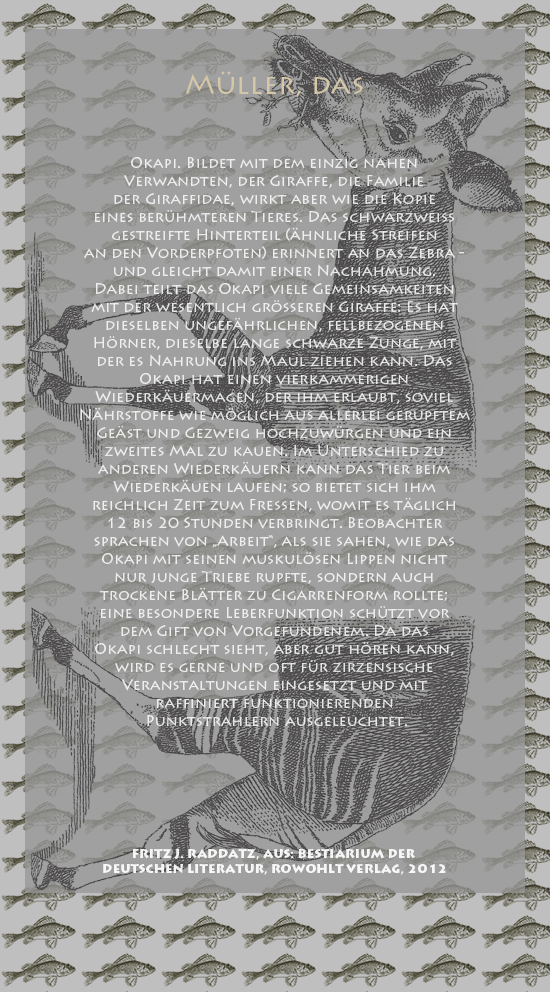












Schreibe einen Kommentar