Ilma Rakusa: Zur Sprache gehen
TRANSIT. TRANSFINIT. ODER: WHO AM I?
… Das verdunkelte Zimmer war meine Urszene. Ich träumte, ich phantasierte, ich sehnte mich und machte „Null Reisen“ im Kopf. Ich war eine „Weltforscherin“ der Imagination, und dabei formten sich Worte, die zu gegebener Zeit aufs Papier wollten. Noch heute lebe ich in der Spannung zwischen sinnlich-realer und imaginativer Exploration, zwischen der Neugier des Aufbruchs und der Ruhe kreativer (mitunter auch elegischen) Innehaltens. Sehnsucht ist dabei ein Hauptimpuls. Sehnsucht wonach? Sehnsucht nach der Sehnsucht, wäre wohl die zutreffendste Antwort. Trotzdem versuche ich zu präzisieren: Sehnsucht nach Lebensfülle, die sich in Bewegung äußert, und Sehnsucht nach Totalität (Für beide Sehnsüchte steht bei mir die Chiffre des Meers). Totalität hat aber nicht nur metaphysischen, sondern auch demiurgischen Charakter. Ich möchte literarisch eine Welt erschaffen, die möglichst viel Welt speichert, ausgehend von persönlichen Erfahrungen, Lektüren und Utopien. Und ich möchte für das Mitzuteilende eine Form finden. Die Sehnsucht nach der Form ist einer meiner Hauptimpulse, ein genuin mitteleuropäisches Streben, wie es Danilo Kiš in seinem brillanten Essay Mitteleuropäische Variationen (1986) formuliert hat:
… eine allen Schriftstellern mitteleuropäischer Herkunft gemeinsame Eigenschaft ist das Bewußtsein der Form: Form als Streben, dem Leben und den metaphysischen Zweideutigkeiten Sinn zu verleihen; Form als Suche nach einem archimedischen festen Punkt im uns umgebenden Chaos; Form als Gegengewicht zur Desorganisation der Barbarei und irrationalen Willkür der Instinkte…
Alle meine literarischen Arbeiten illustrieren die Formsuche: ich habe – im Bereich des lyrischen Genre – Akronyme und Neunzeiler geschrieben, im Bereich der Prosa den Dialog mit fremden Texten zum Konstruktionsprinzip gemacht, Essays akrostichonartig aufgebaut (so daß die ersten Buchstaben der einzelnen Abschnittte das Titelwort ergeben). Dabei geht es mir nie um schiere Spielerei, vielmehr um eine Recherche aus der Erkenntnis, daß die Phantasie zu ihrer Entfaltung strenger Formgesetze bedarf. Dennoch bleibt das Bemühen oft hinter dem Ideal zurück. Und da die Unerreichbarkeit des Ziels Teil der Sehnsucht ist, verstehe ich mich als schreibende Nomadin, unterwegs mit einem work in progress. …
Podiumsdiskussion zum Symposion der Deutschen Literaturkonferenz am 24.3.2007 unter der Überschrift Lost in Translation.
Silke Behl spricht mit Ilma Rakusa über ihre Literatur und existentielle Schönheit.
Silke Behl spricht mit Ilma Rakusa über ihr Werk und die europäische Geschichte und Gegenwart.
Literarische Selbstgespräche … keine Fragen stellte Astrid Nischkauer – Von und mit Ilma Rakusa
Katja Scholz fragt und Ilma Rakusa antwortet: „Ich kann von Glück reden, wenn mir ein Gedicht an einem Tag gelingt.“
Lesung von Ilma Rakusa aus ihrem Buch Mein Alphabet und Gespräch mit Julia Schröder am 17.12.2019 im Literaturhaus Stuttgart.
ILMA RAKUSA
Magensausen
Leb gern
in großen küchen
sitz oft am herd
mach urlaub
in der speisekammer
bin gern allein
mag dampf
übern wassertopf
hab immer kuchen
auf dem blech
renn flink
wenn ich einsam bin
zur nachbarin.
muss nur:
vom walde
komm ich,
hab dich
zum fressen gern
flüstern,
schon springt
das herz ihr auf
lässt mich hinein
Peter Wawerzinek
Zum 70. Geburtstag der Autorin:
Terézia Mora: Das Geschenk
Neue Zürcher Zeitung, 2.1.2016
Volker Breidecker: Die Fahrende
Süddeutsche Zeitung, 29.12.2015
Fakten und Vermutungen zur Autorin + KLG + Interview + DAS&D
Laudatio: 1, 2 & 3 + Lesung + Archiv
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Dirk Skibas Autorenporträts + Brigitte Friedrich Autorenfotos
shi 詩 yan 言 kou 口
Ilma Rakusa – Verleihung des Schweizer Buchpreises 2009.


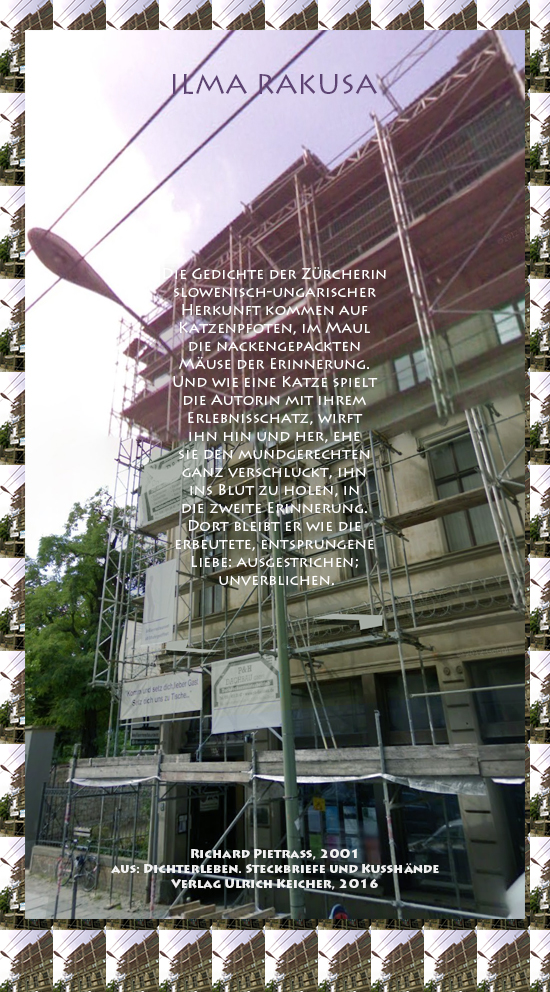












Selbstvorstellung
Anläßlich der Aufnahme in die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung
Triest. Die Stadt ist in die britisch-amerikanische Zone A und in die jugoslawische Zone B unterteilt. Ich lebe mit meinen Eltern in der Zone A. Beim Baden in Barcola, mit Blick auf das Märchenschloß Miramar, höre ich Italienisch, Englisch, Slowenisch. Die Sprachenvielfalt wird mir so selbstverständlich wie das Geräusch der Brandung. Sie beruhigt, sie ist meine Heimat. Und dort in Triest, hinter den heruntergelassenen Jalousien des rostroten Hauses, wenn das Leben zur Siesta-Zeit zu einem fernen Echo verebbt, entdecke ich – hellwach die Spiele der Phantasie. Erfinde mir aus Lichthasen die Welt. Werde zur Ritzenlugerin. Ohne jene Jalousien, so weiß ich heute, hätte es kein Schreiben gegeben. Das Stilleben der Zeichen verdankt sich der Camera obscura.
Triest war Glück, Zürich – protestantisch und meerlos – machte Fremdheit bewußt. Da setzte man mich, die ich Schnee nur vom Hörensagen kannte, zum Beispiel auf einen Schlitten und ließ mich einen Hügel hinunterrasen. Der Spaß endete mit einer Schädelfissur. Ich mußte lernen, vieles auf einmal. Ich lernte Deutsch, lernte Skifahren. Ich beobachtete sehr genau. Ich las unersättlich. Mit zwölf nahm ich heimlich Dostojewskis Verbrechen und Strafe aus dem Bücherschrank. Das Buch erschloß mir eine neue Welt. Von Fürst Myschkin, dem Idioten, konnte ich mich erst recht nicht mehr trennen. Seither lockte der russische Kontinent, groß und rätselhaft. – Daß ich mein erstes Gedicht auf Thomas Manns Grab in Kilchberg schrieb, hatte keine tiefere Bewandtnis. Ich mochte mehr den Ort als den Autor. Und wo genau Joyce lag, dem ich doch von Triest nach Zürich gefolgt war, wußte ich damals noch nicht.
Doch zurück zu den Anfängen. Geboren wurde ich am 2. Januar 1946 im slowakischen Rimavská Sobota, als Tochter einer Ungarin und eines Slowenen. Die Stationen meiner Kindheit hießen Budapest, Ljubljana, Triest. Im Schulalter kam ich nach Zürich. 1964 machte ich dort Abitur und begann ein Studium der Slawistik und Romanistik. Während eines Auslandsemesters in Paris, 1965-1966, sang ich im russischen Kirchenchor an der Rue Daru und spielte Orgel in Saint-Séverin. In Leningrad dann, 1969, verbrachte ich die Tage recherchierend in der Saltykow-Schtschedrin-Bibliothek. Unvergeßlich sind jedoch vor allem die Abende: die Küchensessionen bei Borschtsch und Tee, die endlos-intensiven Gespräche mit Freunden, die Ungedrucktes von Pasternak, Zwetajewa, Mandelstam rezitierten, als wäre Dichtung das Wichtigste auf Erden, wichtiger als alle Politik, wichtiger als das tägliche Brot. – 1971 promovierte ich mit einer Arbeit zum „Motiv der Einsamkeit in der russischen Literatur“ und trat eine AssistentensteIle am Slawistischen Institut der Universität Zürich an. Weiter als bis zur Lehrbeauftragten habe ich es nicht bringen wollen. Schreiben, Übersetzen hatten – und haben – Vorrang.
Zwei Passionen – nicht im Widerstreit, wohl aber in zeitlicher Konkurrenz, beide abenteuerlich genug als Mittel zur Erkundung diverser Fremdheit. „Was ich auch schreibe“, heißt es in einem frühen Text von Botho Strauss, „es schreibt über mich. Ich schreibe unaufhörlich den Fremden, der mich bedroht“. Ein Gefühl der Differenz hat alle meine Schreibversuche diktiert, als lebte ich in einem no man’s land, mit Verlaß nur auf die Sprache. Der Singular ist hier bewußt gesetzt und meint: die Sprache versus Nation, Ethnie (oder was anderer brisanter Zuschreibungen mehr ist), aber auch die Schreibsprache, nämlich Deutsch. Obwohl mehrsprachig aufgewachsen, habe ich mich erst im Deutschen wirklich eingerichtet. Nur im Deutschen verfüge ich über alle Ausdrucksregister, einzig das Deutsche ist Zielsprache meiner Übersetzungen – sei es aus dem Russischen, Serbokroatischen, Französischen oder Ungarischen. Am Deutschen erprobe ich wieder und wieder, wieviel Fremdheit einer Sprache zuzumuten ist, wieviel Verfremdung sie verkraftet. Vor allem der Übersetzungstransfer läßt das Hüben nicht untangiert. Gleichzeitig aber setzt er den Vermittler rauhsten Herausforderungen aus.
Ich schätze mich glücklich, daß ich mir die Herausforderungen selber aussuchen durfte: poetische Prosa von Marina Zwetajewa und Marguerite Duras, von Danilo Kiš und Alexej Remisow. Jedes Buch war eine Gratwanderung, ein kleines Weiterkommen auf dem Weg des sokratischen „Ich weiß, daß ich nichts weiß.“ Oder anders, lyrischer formuliert: Der Lebensstrudel hat ein Häufchen Buchstaben hinterlassen. Gemurmel oder reine Phantasie. Auf dem Tisch liegt die Sprache und knistert. Ein Kind der Jalousien.
Ich danke der Akademie für das Vertrauen, das sie mir entgegengebracht hat.
Ilma Rakusa 1996, aus: Michael Assmann (Hrsg.): Wie sie sich selber sehen. Antrittsreden der Mitglieder vor dem Kollegium der Deutschen Akademie, Wallstein Verlag, 1999.