Ingeborg Bachmann: Die gestundete Zeit
BOTSCHAFT
Aus der leichenwarmen Vorhalle des Himmels tritt
aaaaadie Sonne.
Es sind dort nicht die Unsterblichen,
sondern die Gefallenen, vernehmen wir.
Und Glanz kehrt sich nicht an Verwesung. Unsere
aaaaaGottheit,
die Geschichte, hat uns ein Grab bestellt,
aus dem es keine Auferstehung gibt.
Der Ruhm Ingeborg Bachmanns
wurde bereits durch ihren ersten Gedichtband – Die gestundete Zeit – begründet, der 1953 erschien, ein Jahr nach ihrer Lesung bei der Gruppe 47. Er liegt nun nach Jahren wieder als Einzelausgabe vor. „Ein einziger Gedichtband… und schon war ihr Name bekannt, auch solchen, für die Lyrik sonst nicht eben zum täglichen Brot gehört“, schrieb Günter Blöcker in der FAZ.
Der Textgestalt dieses Buches liegen die erste Ausgabe (Frankfurt a.M. 1953) und die Ausgabe letzter Hand (München 1964) zugrunde.
R. Piper Verlag, Klappentext, 1983
Lyrik
Als im Herbst vorigen Jahres die Dichterin Ingeborg Bachmann gestorben war, da konnte man aus den Nachrufen neben dem Entsetzen über den schrecklichen Unfalltod auch eine gewisse Verlegenheit herausspüren. Ingeborg Bachmann, so hatte es den Anschein, passte nicht mehr so recht ins Bild der zeitgenössischen Literatur, ihr Roman Malina (1971) und ihre Erzählungen Simultan (1972) hatten einen Grossteil der Kritik befremdet; es mehrten sich die Stimmen der Skepsis gegenüber einer Autorin, die einst unbestritten auf dem Gipfel des literarischen Ruhms gestanden hatte.
Ingeborg Bachmann selbst hat sich gewiss keine Illusionen über die Launen des Publikums und der Kritik gemacht, die ihre Lieblinge von einst immer wieder so rüde vom Thron stösst. In ihren Frankfurter Poetik-Vorlesungen von 1959/60 hatte sie selbst von dem „inoffiziellen Terror“ gesprochen, „der ganze Teile der Literatur und jeder Kunst für eine Zeit in Acht und Bann tut“, und sie fuhr fort: Die wechselnden Erfolge der Werke oder ihre Misserfolge liessen weniger auf sich selber „als auf unsere eigene Konstitution und auf die Konstitution der Zeit schliessen“.
Heute ist eine allgemeine Unterschätzung der Lyrik festzustellen; auf die Blütezeit der Poesie in den fünfziger Jahren, die bis etwa in die Mitte der sechziger Jahre reichte, folgte zunächst eine Zeit, die Lyrik nur noch als politische Dichtung und Lehrgedicht gelten lassen wollte, bis schliesslich die ganze Gattung als privatistisch, innerlich und damit als angeblich gesellschaftlich irrelevant verketzert wurde. (Dass das Pendel sich inzwischen schon wieder in die andere Richtung zu bewegen scheint, bei der politischen Linken eine neue Sensibilisierung einzusetzen beginnt, sei nur am Rande vermerkt.)
Wenn wir heute die Gedichte der Ingeborg Bachmann lesen, dann sollten wir, um sie recht verstehen und beurteilen zu können, nicht vergessen, wann sie geschrieben und veröffentlicht wurden.
Gedichte haben, wie alle Literatur, ihre Zeit. Nicht als ob sie ausschliesslich als historische Texte betrachtet werden müssten und zeitgenössische Kritik ihnen gegenüber unangebracht wäre. Aber zunächst ist doch einmal der geschichtliche Ort zu erkennen. Es wäre höchst ungerecht, vor zwanzig Jahren entstandene Gedichte so zu beurteilen, als seien sie heute, 1974, geschrieben.
Anlass zu solchen Ueberlegungen gibt ein kürzlich im Verlag R. Piper (München) erschienener Band, der Ingeborg Bachmanns beide Gedichtbände Die gestundete Zeit und Anrufung des Grossen Bären zusammenfasst. Dies ist keine kritische Ausgabe, auch keine Gesamtausgabe – die Publizierung der gesamten Lyrik Ingeborg Bachmanns einschliesslich verstreuter und nachgelassener Gedichte bleibt einer späteren Edition vorbehalten –, sondern lediglich ein unkommentierter Nachdruck der beiden Bücher von 1953 und 1956. Allerdings hätte der Verlag darauf hinweisen sollen, dass bei Die gestundete Zeit nicht die Erstausgabe zugrundegelegt wurde, die Alfred Andersch 1953 in der Frankfurter Verlagsanstalt herausgegeben hatte, sondern die spätere Ausgabe aus dem Piper-Verlag, in der das Gedicht „Beweis zu nichts“ fehlt und die dafür um den Text „Im Gewitter der Rosen“ erweitert wurde.
Beim Lesen dieses Gedichtbuches beginnt man sich wieder zu erinnern an die Faszination, die einst von dieser Lyrik ausging, die in den fünfziger Jahren geradezu stürmisch gefeiert und allenthalben diskutiert und interpretiert wurde. Denn in der Tat brachte Ingeborg Bachmanns Dichtung seinerzeit einen neuen Ton in die deutschsprachige Lyrik, in der, neben dem alles überragenden Alterswerk Benns, eine zunehmend karger und ärmer gewordene Trümmerpoesie dominierte. In dieser Lage wirkte Ingeborg Bachmanns Dichtung befreiend, weil in ihr gedankliche Härte mit hoher Musikalität verbunden ist, lyrischer Intellekt und angespannte Subjektivität eine Verbindung von Gegenwart und Mythos erreichten.
Hier wurde mit einer bis dahin kaum bekannten Intensität des Denkens und Fühlens, des Intellekts und der Vitalität Gegenständlichkeit und Abstraktion ineinander verwoben, wurde Reflexion in einprägsame Bilder umgesetzt; mit raffinierter Artistik wurden die Elemente volkstümlicher Poesie, wurden Märchen, Sage und Mythos ins moderne Gedicht eingeschmolzen; mit souveräner Selbstverständlichkeit knüpfte die Dichterin an die formalen und thematischen Traditionen abendländischer Poesie an und schöpfte deren Arsenal aus. In diesen Gedichten wird eine existentielle Spannung ausgetragen zwischen Gefühl und Intellekt, Kalkül und Inspiration. Und wenn es uns heute so scheint, als ob sich in dieser Dichtung die Waage bisweilen doch allzu stark zur Seite des Gefühls hin geneigt habe und nicht alle Gedichte die Anspannung ausgehalten haben, der sie ausgesetzt sind, so wird das auch mit dem von der Dichterin selbst erwähnten Wechsel in der Konstitution des Betrachters und der Zeit zu tun haben. Im übrigen dürfte Ingeborg Bachmann selbst diese Gefährdung erkannt haben, als sie nach 1956, auf der Höhe des Ruhms, keinen Gedichtband mehr veröffentlichte und 1959/60 in Frankfurt eine Poesie forderte, die „scharf von Erkenntnis und bitter von Sehnsucht“ sein müsse.
Gottfried Benn hatte einst gesagt, auch bedeutenden Lyrikern gelängen allenfalls ein halbes Dutzend Gedichte, die überdauern. Es ist heute gewiss noch zu früh zu entscheiden, welche Gedichte Ingeborg Bachmanns die Zeit überdauern werden. Aber Texte wie „Die grosse Fracht“, „Die gestundete Zeit“, „Früher Mittag“ und „Alle Tage“ aus dem Buch von 1953, „Das Spiel ist aus“, „Anrufung des Grossen Bären“, „Erklär mir, Liebe“ und „An die Sonne“ aus der Sammlung von 1956 faszinieren noch immer, nach zwei Jahrzehnten – und das ist in der Literatur beinahe schon eine Ewigkeit.
Ein Erschrecken rührt den Leser an, wenn er jetzt, nach dem Tode Ingeborg Bachmanns, im letzten Gedicht „Lieder auf der Flucht“, ihres zweiten und zugleich letzten Gedichtbandes, die Zeile liest: „Wart meinen Tod ab, und dann hör mich wieder“, und die Schlussverse:
Die Liebe hat einen Triumph und der Tod hat einen,
die Zeit und die Zeit danach.
Wir haben keinen.
Nur Sinken um uns von Gestirnen. Abglanz und Schweigen.
Doch das Lied überm Staub danach
wird uns übersteigen.
Jürgen P. Wallmann, Die Tat, 16.11.1974
Weitere Beiträge zu diesem Buch
(Erstausgabe/Neuausgabe/Hörbuch):
Gespräch mit der jungen Ingeborg Bachmann
BR Retro Gespräche und Interviews, 10.6.1953
[Klaus Wagner]: Bachmann, Stenogramm der Zeit
Der Spiegel, 18. 8. 1954
Clemens Heselhaus: Suche nach einer neuen Dichtung
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 18. 9. 1954
Heinz Piontek: Ingeborg Bachmann „Die gestundete Zeit“
Welt und Wort, Heft 9, 1954
Albert Arnold Scholl: Die gestundete Zeit. Junge deutsche Lyrik nach dem Kriege
Schweizer Rundschau, 1954/55
Günter Blöcker: Nur die Bilder bleiben
Merkur, Heft 163, September 1961
Günter Blöcker: Auf der Suche nach dem Vater
Merkur, Heft 276, April 1971
Karl Krolow: Nach zwei Jahrzehnten. Neuausgabe der Gedichte Ingeborg Bachmanns
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 21. 3. 1974
Hilde Spiel: Das Neue droht, das Alte schützt nicht mehr
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 10. 8. 1974
Jürgen P. Wallmann: Ingeborg Bachmann: Die gestundete Zeit–Anrufung des Großen Bären. Gedichte. Serie Piper No. 78
Literatur und Kritik, Heft 86/87, 1974
Wilfried Heck: Ingeborg Bachmann „Die gestundete Zeit“. Eine Interpretation
Diskussion Deutsch, Heft 1, 1978
Jochen Hieber: Süße Früchte allein sättigen nicht
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 15. 5. 2004
Uta-Maria Heim: Spuren einer Liebe
Mannheimer Morgen, 10. 7. 2004
Irene Fussl: Die gestundete Zeit der Ingeborg Bachmann
logbuch-suhrkamp.de, 17.10.2023
Beate Tröger: Ingeborg Bachmanns erster Gedichtband „Die gestundete Zeit“ neu aufgelegt
der Freitag, 01/2024
Junge Dichterinnen
Von den Dichterinnen der Nachkriegsgeneration ist Ingeborg Bachmann wohl diejenige, die am zugänglichsten zu sein scheint – im tiefsten dennoch am unzugänglichsten ist. Sie hat vor zwei Jahren eine Auswahl ihres bisher erschienenen Werks selbst getroffen und in der Reihe Die Bücher der Neunzehn erscheinen lassen. Sie nahm Einladungen zu Leseabenden an, sie signierte ihre Bücher, aber sie war und blieb in kühler Distanz, entschlossen, ihr Werk und nicht ihre Person sprechen zu lassen. Und dieses Werk begegnet ebenso begeisterter Zustimmung wie Kritik und sogar Ablehnung.
Seit sie 1952 die ersten Gedichte veröffentlichte, sie 1953 und 1956 in schmalen Bändchen herausgab, wirkt sie als unüberhörbare Stimme im Konzert der Nachkriegsliteratur mit. Unüberhörbar, doch keineswegs aufdringlich. Der neue Ton ihrer Dichtung manifestiert sich scheu und oft kühl, und nur ein geübtes Ohr mag die bebende Spannung mancher Strophe fühlen, wird die Bedrängnis ihrer Bilder und Gefühle wahrnehmen. Die grosse Gefolgschaft und Leserschaft darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass ihr Werk nicht Gebrauchsliteratur, sondern hohe Kunst ist, die sich nicht auf Anhieb erschliesst, sondern um die man sich zu mühen hat. Dass hohe Belohnung den sich Mühenden erwartet, das steht wiederum auf einem andern Blatt.
Als ihr Heimatland Oesterreich den Schicksalstag des 15. März 1938 erlebte, war sie ein Schulmädchen von zwölf Jahren. Beim Zusammenbruch von 1945 begann sie gerade ihr Studium – Rechtswissenschaft und Philosophie – in der noch geteilten Stadt Wien. Und als endlich die Verhältnisse sich zu normalisieren begannen, schloss sie mit einer Arbeit über die Existentialphilosophie Martin Heideggers ab. Zwei Jahre später liest sie auf einer Tagung der Gruppe 47 – einer Gruppe von politisch engagierten Publizisten mit literarischen Ambitionen – und erhält im folgenden Jahr, 1953, da ihr erster Gedichtband erscheint (Die gestundete Zeit), auch den Preis dieser Gruppe, als vierte in der Reihe nach Günter Eich, Heinrich Böll und Ilse Aichinger. (Die Preise wurden unregelmässig vergeben. Die Geldbeträge wurden zuerst von der McCann-Companie, später von Rundfunkstationen und Verlegern gespendet.) Beim Rundfunk arbeitet Ingeborg Bachmann, denn auch – wenn auch nur für kurze Zeit –, um sich dann schon früh dem eigenen Schaffen zu widmen.
Der Piper-Verlag, der seit zehn Jahren ihre Werke verlegt, hat vor zwei Jahren ein handliches Einführungsbändchen herausgegeben mit allen Angaben, die zur äusseren Kenntnis nützlich sein können. Das gleiche Bändchen präsentiert indessen auch sechs Stimmen von anerkannten Kritikern, die dem Neuling eine sehr willkommene Einführung in Gehalt und Form eines Werks bieten, das sich sonst nur allmählich in allen seinen Dimensionen erschliesst. Diese Abrundung – Einführung in das Werk und zusammenfassender Auswahlband, fast zur gleichen Zeit herausgegeben – lässt auf eine gewisse Zäsur schliessen, auf ein Zurückholen der inneren Kräfte zu neuer Entfaltung. Wir dürfen uns auf diese Neuentfaltung freuen.
tzo., Neue Zürcher Nachrichten, 16.8.1966
„Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar“
– Zur Dichtung der Ingeborg Bachmann. –
Ingeborg Bachmann ist am 17. Oktober 1973 in Rom an den Folgen einer Verbrennung gestorben. Ein solch grauenhafter Tod bleibt im Gedächtnis hängen, und es fällt schwer, nicht ständig bei der Lektüre des Werkes dieses Ende vor Augen zu haben; denn durch diese Todesart wird ihre Dichtung zum Mythos.
Biographische Fakten auf Texte zu übertragen, ist auch im Fall Ingeborg Bachmanns fragwürdig. Die Wahrheit der Biographie gerät oft ins Anekdotische und niemand kann mit dieser Wahrheit die Dichtung ausschöpfen. Es scheint, als gäbe der öffentliche Teil ihrer Biographie mehr Aufschluß über den Literaturbetrieb der 5oer und auch 6oer Jahre und weniger über ihr Werk, das sie Beurteilungsversuchen mit biographischem Ansatz immer sehr aufmerksam entzogen hat. In einer ihrer biographischen Notizen sagt sie:
Ich habe meine Jugend in Kärnten verbracht, im Süden, an der Grenze, in einem Tal, das zwei Namen hat – einen deutschen und einen slowenischen. Und das Haus, in dem seit Generationen meine Vorfahren wohnten – Österreicher und Windische –, trägt noch heute einen fremdklingenden Namen. So ist nahe der Grenze noch einmal die Grenze: die Grenze der Sprache – und ich war hüben und drüben zu Hause, mit den Geschichten von guten und bösen Geistern zweier und dreier Länder; denn über den Bergen, eineWegstunde weit, liegt schon Italien.
Ich glaube, daß die Enge dieses Tals und das Bewußtsein der Grenze mir das Fernweh eingetragen haben. Als der Krieg zu Ende war, ging ich fort und kam voll Ungeduld und Erwartung nach Wien, das unerreichbar in meiner Vorstellung gewesen war. Es wurde wieder eine Heimat an der Grenze: zwischen Ost und West, zwischen einer großen Vergangenheit und einer dunklen Zukunft. Und wenn ich später nach Paris und London, nach Deutschland und Italien gekommen bin, so besagt das wenig, denn in meiner Erinnerung wird der Weg aus dem Tal nach Wien immer der längste bleiben.
Manchmal werde ich gefragt, wie ich, auf dem Land großgeworden, zur Literatur gefunden hätte. – Genau weiß ich es nicht zu sagen; ich weiß nur, daß ich in einem Alter, in dem man Grimms Märchen liest, zu schreiben anfing, daß ich gern am Bahndamm lag und meine Gedanken auf Reisen schickte, in fremde Städte und Länder und an das unbekannte Meer, das irgendwo mit dem Himmel den Erdkreis schließt. Immer waren es Meere, Sand und Schiffe, von denen ich träumte, aber dann kam der Krieg und schob vor die traumverhangene, phantastische Welt die wirkliche, in der man nicht zu träumen, sondern sich zu entscheiden hat.
Später ist vieles so gekommen, wie man es kaum zu wünschen wagt: Universitätsstudium, Reisen, Mitarbeit an Zeitschriften und Zeitungen und später die ständige Arbeit im Rundfunk. Das sind alltägliche Stationen eines Lebens, die austauschbar und verwechselbar sind; das Leben selbst beruft sich nicht auf das Mittelbare.
Ingeborg Bachmann wurde 1926 in Klagenfurt als ältestes von drei Kindern geboren. Ihr Vater war Lehrer und Hauptschuldirektor, ihre Mutter betrieb eine Strickwarenerzeugung in Niederösterreich. Während ihres Studiums der Philosophie veröffentlichte sie im Alter von 20 Jahren kleine Erzählungen und promovierte 1950 über Die kritische Aufnahme der Existentialphilosophie Martin Heideggers in Wien. Ihr erstes Hörspiel Ein Geschäft mit Träumen wird ohne großes Echo 1952 gesendet, und im gleichen Jahr legt die Dichterin ihren ersten Roman Stadt ohne Namen bedeutenden Verlagen vor. Diese lehnen ab. Als dann 1953 ihr erster Gedichtband Die gestundete Zeit von Alfred Andersen in der Buchreihe Studio Frankfurt herausgegeben wird, hat Ingeborg Bachmann schon die ersten Lesungen vor den Mitgliedern der Gruppe 47 hinter sich und hat auch deren Literaturpreis erhalten. Walter Jens bezeichnet die Lesung der Autorin als „die Sekunde des Umschlags“ in der deutschen Nachkriegsliteratur, aber ihr Gedichtband fand in der Tagespresse nur ein spärliches Echo. Joachim Kaiser meint zwar rückblickend auf die Lesung:
Sie las einige Gedichte, die dann veröffentlicht wurden, und man wußte: Dieser Ton, diese Ferne, dieses Wagnis und diese zarte Unerbittlichkeit gehören nur ihr,
aber das Desinteresse der Kritiker und Rezensenten dauerte noch an. Den ,Durchbruch‘ zur schnellen Berühmtheit erreichte Ingeborg Bachmann, als im August 1954 das Nachrichtenmagazin Der Spiegel ihr den Titelbericht widmet. Das Foto zeigt auf der Titelseite das Gesicht der 27jährigen Dichterin. Sie trägt einen unerbittlichen Kurzhaarschnitt, ihr Hals ist von einem hochgeschlossenen schwarzen Kragen verdeckt. Der Ausdruck ihres Gesichtes ist ernst und konzentriert sich in einem dunkel geschminkten Mund. Die Augen scheinen einen fernen Punkt zu durchdringen. Ein existenzialistisches Pathos ist unverkennbar. Unter dem Foto steht: „Gedichte aus dem deutschen Ghetto“.
Ingeborg Bachmann wird als Reisende vorgestellt, deren Italienbegeisterung auch in ihrer Lyrik Eingang findet, ebenso wie ihre individuelle, stark von der Philosophie Heideggers und Wittgenstein sowie der Zwölftonmusik geprägte Existenzform:
Nicht zufällig hat die Bachmann, Adeptin des hochmusikalischen Logistikers Wittgenstein und Studentin aus Wien, dem Geburtsort der als ,Gehirnmusik‘ verschrienen Zwölftönerei, jahrelang selbst komponiert. Die junge Lyrik arbeitet häufig mit ähnlich zerebralen Mitteln wie die Neutöner: mit der Verkürzung, mit der Disharmonie, mit dem Kontrast und bewußt durcheinandergeschüttelten Bezügen. Wie in der Musik, liegen auch in der Lyrik die Mittel zu solchen Montagen zu klar auf der Hand, als daß sie nicht auch für kühl synthetisches, für Sinn-loses Gedichtemachen gebraucht werden könnten.
Bei dieser Art des Produzierens spielt der Verstand eine Herrenrolle wie bei den jungen amerikanischen Dichtern der Jahrhundertmitte. Das Gedicht wird ,gemacht‘, die Herstellungstechnik ist beinahe lehr- und erlernbar. „Ich glaube, daß bei keiner schriftstellerischen Hervorbringung so viel nachgedacht wird wie beim Gedichteschreiben“, sagt die Bachmann.
Der scharf trainierte Intellekt der Doktorin, das also, was romantische Zeiten als einer lyrischen Begabung feindlich ansahen, befähigt sie zum Gedichtemachen nach moderner Auffassung.
Schon in diesem kurzen Ausschnitt des auch heute lesenswerten Artikels wird deutlich, was im gekühlten Jargon so sehr an der lyrischen Begabung dieser ,Doktorin‘ faszinierte: neun Jahre nach dem verlorenen Krieg bietet sich eine junge Österreicherin an, zumindest die deutschsprachige Lyrik mit einer internationalen Kultur zu verbinden. Ausführlich wird von der ,Herstellungstechnik‘ berichtet, die in diesem aufbauwütigen Land eine exponierte Rolle spielt, die Intellektualität der Autorin wird herausgehoben, da in Paris die Weltkulturmode des Existenzialismus von Intellektuellen hervorgebracht worden ist; die ,jungen amerikanischen Dichter‘ sind unbenannt – obwohl die erste exakte Anleitung, ein Gedicht ,herzustellen‘ von Edgar Allan Poe stammt. Auch die ,Zwölftönerei‘, deren jüdische Vertreter nie in politischen Diskredit kamen und die im Dritten Reich als ,entartet‘ galt, wird als internationale Modernität beschworen. Und schließlich wird Ingeborg Bachmann zitiert: diese kleinen deutschsprachigen Gedichte erfordern selbstverständlich allergrößtes Nachdenken.
Es ist unbestritten: erst durch den Artikel des Spiegel wurden viele Kritiker aufmerksam, und von diesem Zeitpunkt an ist der Rang der Bachmannschen Lyrik kaum mehr ernsthaft bezweifelt worden. Die Interpretationsansätze gingen weit auseinander – aber der Tenor des Lobes blieb gleich.
Neben ihrem lyrischen Werk hat Ingeborg Bachmann immer auch essayistisch gearbeitet. Schon 1954 lag ihr Aufsatz über Musil vor, und nicht zufällig wird sie erste Dozentin für Poetik an der Frankfurter Universität. Sie liest 1959/60 über ,Probleme zeitgenössischer Dichtung‘. Die Bekanntschaft mit Hans Werner Henze, den Ingeborg Bachmann bei ihrer ersten Lesung der Gruppe 47 kennengelernt hat, entwickelt sich sehr produktiv. Henze komponiert 1955 die Musik zu ihrem zweiten Hörspiel Die Zikaden, 1957 werden von ihm die Gedichte „Im Gewitter der Rosen“ und „Freies Geleit“ vertont. Beide Gedichte sind ihrem zweiten Gedichtband Anrufung des Großen Bären von 1956 entnommen. Zwei Jahre später entstehen das Libretto zu Henzes Oper Der Prinz von Homburg und das Hörspiel Der gute Gott von Manhattan, für das sie den Hörspielpreis der Kriegsblinden erhält.
Die Reisende läßt sich von 1958 bis 1962 abwechselnd in Zürich und Rom nieder, sie ist längst eine Weltbürgerin geworden. Sie übersetzt Gedichte von Giuseppe Ungaretti. Nach einem einjährigen Aufenthalt in Berlin 1963 führen sie ihre Reisen nach Prag, nach Ägypten und in den Sudan. Im gleichen Jahr erhält sie den Büchnerpreis, 1968 den Großen Österreichischen Staatspreis. Nach längerem Schweigen erscheint 1971 ihr großer Roman Malina, er knüpft an den Erzählband Das dreißigste Jahr an, den sie 1961 publiziert hatte. Der zweite Erzählband mit demTitel Simultan wurde 1972 publiziert und bringt ihr den Anton-Wildgans-Preis der Österreichischen Industrie ein. Ihre letzten Reisen führen sie nach Polen, wo sie auch die Konzentrationslager Birkenau und Auschwitz besucht hat.
In seinen Anmerkungen zur Ingeborg-Bachmann-Kritik hat Peter Conrady von „fragwürdiger Lobrednerei“ gesprochen. Und, in der Tat, die größtenteils pauschalisierenden Hymnen über ihre Gedichte haben der Dichterin letztendlich vielleicht mehr geschadet als genützt. Nicht ohne diesen Hintergrund ist es zu verstehen, daß Ingeborg Bachmann in einem Fernsehinterview 1971 äußerte, keine Gedichte mehr schreiben zu wollen. Widerstand und Denkanstöße fehlten. Eine der Hauptbemühungen der Rezensenten richtet sich darauf, emsig nachzuweisen, welche Ähnlichkeiten zu Dichtern des Expressionismus (Lasker-Schüler, Trakl, Heim, Benn) bis zur deutschen Romantik und Hölderlin bestehen. Immer wieder wird auf die nahe österreichische Tradition (Musil, Wittgenstein) hingewiesen. Aber eine analytische Rezeption bleibt die Ausnahme. Philologische Genauigkeit einerseits und Phrasendrescherei auf der anderen Seite können die auffällige Wirkung ihrer Sprachkonstruktion nicht erklären. Der entscheidende Impuls ihrer Wirkung schien auch von ihrer Person und der um sie konstruierten Aura auszugehen. Wilhelm Genazino schreibt dazu:
Es hat in den fünfziger Jahren viele (männliche) Bewunderer dieser Autorin gegeben; damals sind auch einige Huldigungskritiken geschrieben worden, die zum Teil heute noch die Bachmann-Rezeption bestimmen.
Auch wer, wie ich, Ingeborg Bachmann nicht persönlich gekannt hat, erinnert sich an den erlesenen Ruf der Dichterin in den fünfziger Jahren. Noch auf den Fotos, die damals von ihr veröffentlicht wurden, war ihre persönliche Würde erkennbar, eine fast erotische Unerbittlichkeit, die sich dazu eignete, von Männern idealisiert zu werden. Die rücksichtslose, herrische Emotionalität, die sie ausstrahlte, flößte allerdings auch Angst ein. Angst vor der fühlbaren Gewissheit, daß diese Frau gegen einen Partner, von dem sie sich subjektiv nicht mehr angenommen oder verstanden wußte, grausam vorgehen würde, grausamer als die Grausamen, die sie in ihrem Werk beschrieben hat. Max Frisch, der das Zusammenleben mit Ingeborg Bachmann ausprobiert hat, schrieb (in Montauk) über sie: „In ihrer Nähe gibt es nur sie, in ihrer Nähe beginnt der Wahn.“ Max Frisch hat zwar versucht, auf ein paar Seiten einige Aspekte ihres Verhaltens zu beschreiben, aber dennoch wird daraus nicht hinreichend klar, was wir unter ,Wahn‘ in diesem Fall zu verstehen haben. Aus den Mitteilungen von Frisch geht nur hervor, daß dieser Frau außer einer großen Hingabe eine mindestens ebenso große Rücksichtslosigkeit eigen war.
In den fünfziger Jahren war es noch leicht, einen solchen gefühlsmässigen Irrationalismus als weiblich oder gar tief menschlich zu bewundern. Die Disziplin, die heute in aufgeklärten Partner-Beziehungen versucht wird, weiß sich von solchen Übergriffen beschädigt und weist deshalb überzogene Gefühlsansprüche oder -erwartungen zurück. Vielleicht hängt es mit diesem Anschauungswandel zusammen, daß Ingeborg Bachmanns Werk heute nicht mehr die Ausstrahlung der fünfziger Jahre hat. In der heutigen Auseinandersetzung der Geschlechter spielt ihr Werk keine Rolle. Ingeborg Bachmann ist nicht mehr das bestaunte gefühlsstarke Idol, das sie noch gewesen war, zumindest für große Teile der intellektuellen Jugend. Wer sich ihr heute nähern will, muß sich ihres Werkes erinnern. Lebendig ist es nicht.
Der Schlußsatz ist ein vernichtendes Urteil – doch dieses Urteil fegt über das Werk der Ingeborg Bachmann hinweg. Denn dieser Text aus dem Jahr 1978, der so scharf über die entschwundene Mystifizierung spricht, unterliegt ihr selbst noch einmal: es wird in der männlichen Projektion von der möglichen Grausamkeit Ingeborg Bachmanns als Frau gesprochen, abgeleitet von den Personen ihres Werkes. Nur: dort sind die Grausamen beinahe ausschließlich Männer. Man steht vor dem Paradox, daß der Frau durch die Idolbildung die Grausamkeit zugeschrieben wird, mit der diejenigen, die das Idol geschaffen haben, noch aus seinem Absturz Gewinn ziehen. Die zweite Mystifizierung: Was nicht mehr lebendig ist – Genazino beschreibt es selbst –, ist der Mythos. Aber auch der Mythos soll enden, daß das Werk der Ingeborg Bachmann nicht mehr lebendig sei. Im Zuckerwasser der männlichen Rezipienten wurde nämlich die Thematik ersäuft, angesichts derer die Kritiker immer ratloser wurden: diese unzeitgemäße radikale Darstellung der Weiblichkeit, wie sie uns vor allem im Roman Malina begegnet.
Doch in der Lyrik ist diese Weiblichkeit nur ein Themenbereich und nicht der auffälligste. Die Unentschiedenheit des weiblichen und männlichen Sprechens zeigt sich häufig in der Verwendung des lyrischen Ich: vordergründig spricht es meist mit Männerstimme, gefiltert von Erfahrungen der Weiblichkeit:
(…)
Drüben versinkt dir die Geliebte im Sand,
er steigt um ihr wehendes Haar,
er fällt ihr ins Wort,
er befiehlt ihr zu schweigen,
er findet sie sterblich
und willig dem Abschied
nach jeder Umarmung.
(…)
Diese Strophe des Gedichtes „Die gestundete Zeit“ hat den Gestus des zeit-losen Liebesgedichts. Auch das dargestellte Leid erscheint unspezifisch und ungebunden an die Zeit, sieht man vom Bild in der ersten Zeile ab; die im Sand versinkende Geliebte war in Buñuels Film Ein andalusischer Hund zu sehen und später in Becketts Theaterstück Glückliche Tage. Ingeborg Bachmann nimmt eine traditionelle Metaphernwelt auf und überführt sie in eine ferne, allgemeine und kosmische Mobilität. Mit diesem Verfahren begründet sie den Ruf, zeitgeschichtliche Themen aus ihrer Lyrik auszusparen. Im Gedicht „Früher Mittag“ aus dem 1. Gedichtband heißt es:
(…)
Sieben Jahre später
fällt es dir wieder ein,
am Brunnen vor demTore,
blick nicht zu tief hinein,
die Augen gehen dir über.
Sieben Jahre später,
in einem Totenhaus,
trinken die Henker von gestern
den goldenen Becher aus.
Die Augen täten dir sinken.
In diesen volksliedhaft anmutenden Zeilen ist die Herkunft der Zitate leicht zu ermitteln, denn Wilhelm Müllers „Lindenbaum“ und die Anspielung auf Goethes Lied vom „König in Thule“ sind nicht zu übersehen. Es steckt aber im Gedicht auch eine Dissonanz, die aus dem Geschichtsbewußtsein der Ingeborg Bachmann herrührt. Gerade jenes wurde von vielen ihrer Bewunderer und Kritiker hartnäckig ignoriert. Die untrügliche Erkenntnis, daß die Vergangenheit nicht vergangen ist, im Gegenteil „die Henker von gestern“ äußerst aktiv die Gegenwart gestalten, ist die grausame Wahrheit, die in der scheinbaren Einfachheit liegt. Folgerichtig heißt es in dem Gedicht „Alle Tage“:
Der Krieg wird nicht mehr erklärt,
sondern fortgesetzt. Das Unerhörte
ist alltäglich geworden. (…)
Mit unseren heutigen Augen gelesen sind diese Zeilen nur zu wahr und haben den Charakter einer beschworenen Realität. Das Allgemeine kann man nicht genauer sagen. Der Rückgriff auf die Metaphern ist nicht nur als Zitat zu verstehen, in dem eine ungelöste Fremdheit bestehen bleibt. Er ist auch ein Tribut an die Geschichte, die Anstrengung, an einer durch den Nationalsozialismus verdrehten, getöteten, verhöhnten Kultur, Literatur, Sprache anzuknüpfen. In dieser Vorgehensweise liegt ein großer ästhetischer Ernst. Ingeborg Bachmann, der die Abstinenz von Politik und Zeitgeschichte gern nachgesagt wurde, ist nicht zufällig 1958 dem Komitee gegen die Atomrüstung beigetreten und hat 1965 zusammen mit anderen Persönlichkeiten die „Erklärung gegen den Vietnamkrieg“ unterzeichnet. Sie hat sich auch erfolgreich beim Piper-Verlag dagegen gewehrt, daß der Nazidichter Hans Baumann (bekannt durch das HJ-Lied: „Es zittern die morschen Knochen“) Gedichte von Anna Achmatova übersetzen und publizieren konnte. Ebenfalls 1965 tritt sie für eine Verlängerungsfrist für Naziverbrecher ein. Uwe Johnson zitiert in seinem Buch Eine Reise nach Klagenfurt Ingeborg Bachmann:
Es hat einen bestimmten Moment gegeben, der hat meine Kindheit zertrümmert. Der Einmarsch von Hitlers Truppen in Klagenfurt. Es war so etwas entsetzliches, daß mit diesem Tag meine Erinnerung anfängt: durch einen zu frühen Schmerz, wie ich ihn in dieser Stärke später überhaupt nicht mehr hatte. Natürlich habe ich das alles nicht verstanden in dem Sinne, in dem es ein Erwachsener verstehen würde. Aber diese ungeheure Brutalität, die spürbar war, dieses Brüllen, Singen und Marschieren – das Aufkommen meiner ersten Todesangst.
Geschichte ist weder in ihrem Leben noch in ihrer Dichtung ausgeklammert. In der Lyrik hat die geschichtliche Zerstörung auch die Natur ergriffen. Die Bilderwelt der Natur führt oft in apokalyptische Zustände: „Wo Deutschlands Erde den Himmel schwärzt, sucht die Wolke nach Worten und füllt den Krater mit Schweigen“, steht im Gedicht „Früher Mittag“. Dennoch geht es – vor allem im zweiten Gedichtband – um Aufbrüche aus der – wie Ingeborg Bachmann sagt – „kalten neuen Zeit“. Das Ziel ist unbekannt. In den Gedichten „Ausfahrt“, „Abschied von England“, „Herbstmanöver“, „Lieder auf der Flucht“, „Alle Tage“ und anderen ist meist nur der Ort des Aufbruchs darstellbar. Die Raum-Zeit-Probleme lösen sich auf. Das Schiff als Topos wird zum Symbol der Fahrten und Irrfahrten, Inseln tauchen auf, südliche Länder, die letzten Orte der Sehnsucht. Der Süden wird als Land der Wiedergeburt, als „erstgeborenes“ Land gesehen. Er wird zum realen und zum dichterischen Exil. Im Süden ist es hell, im Land der Herkunft dunkel. Die Räume öffnen sich für ein freieres Leben. Es öffnet sich der ganze Weltenraum:
ANRUFUNG DES GROSSEN BÄREN
Großer Bär, komm herab, zottige Nacht,
Wolkenpelztier mit den alten Augen,
Sternenaugen,
durch das Dickicht brechen schimmernd
deine Pfoten mit den Krallen,
Sternenkrallen,
wachsam halten wir die Herden,
doch gebannt von dir, und mißtrauen
deinen müden Flanken und den scharfen
halbentblößten Zähnen,
alter Bär.
Ein Zapfen: eure Welt.
Ihr: die Schuppen dran.
Ich treib sie, roll sie
von den Tannen im Anfang
zu den Tannen am Ende,
schnaub sie an, prüf sie im Maul
und pack zu mit den Tatzen.
Fürchtet euch oder fürchtet euch nicht!
Zahlt in den Klingenbeutel und gebt
dem blinden Mann ein gutes Wort,
daß er den Bären an der Leine hält.
Und würzt dieLämmer gut.
’s könnt sein, daß dieser Bär
sich losreißt, nicht mehr droht
und alle Zapfen jagt, die von den Tannen
gefallen sind, den großen, geflügelten,
die aus dem Paradiese stürzten.
Hier wird das Sternbild des „Großen Bären“ assoziiert auf eine Bilderwelt, die bis ins Alttestamentarische zurückführt. Schon im Buch Job, Kapitel 40, gibt es das Riesentier Behemot; es ist Symbol für die Schöpfungskraft Gottes. In diesem Gedicht füllt der Große Bär als Fabelwesen und apokalyptisches Untier genauso den Weltraum aus wie der Waldbär oder der harmlose Tanzbär auf dem Jahrmarkt; er spielt sogar mit den Engeln, die aus dem Paradies gestürzt sind. Immer kommt dem Bär eine übermenschliche, ja vernichtende Gewalt zu. Der Gedichtsorganismus wirkt geschlossen und offen zugleich, da die Regeln der Syntax nicht verletzt werden; auf der anderen Seite vermögen sie den Bedeutungen keinen festgelegten Rahmen zu geben. Je weiter die Bilder in das Weltall hinausführen, umso reiner stehen sie nebeneinander. Das Besondere dieser Bilder ist aber deren Dramatik. Die lyrische Souveränität des Sprechens entsteht durch eine selbstverständliche Musikalität: Laute wirken wie Akkorde, man kann sie wie einen Klangkörper abtasten.
Die Autorin spricht eine Sprache ohne Schuld. Die Strenge dem Wort gegenüber und das Ausschöpfen seiner Expressivität ergeben eine unverwechselbare Spannung. Sie wagt es, ihre subjektiven Gedanken und Gefühle in einem expressiven Pathos vorzutragen. Joachim Kaiser bemerkt dazu:
Da das Expressive und Pathetische nicht mehr benutzbar war, weil es durch den Faschismus in so scheußlicher Weise zur Alltagstimmung gehörte, war die Bachmannsche Intensität besonders auffällig. Trotzdem wurde dieses Pathos begrüsst.
Reich-Ranicki schreibt zurückblickend :
Auch fällt es auf, daß in den 5oer Jahren, da man feierliche Töne verabscheute, Ingeborg Bachmann mit einer häufig pathetischen und ins Würdevolle stilisierten Lyrik erfolgreich war, daß sie in einer Zeit, die angeblich großen Worten mißtraute, mit Versen überzeugen vermochte, die mit einem reichlichen Bestand eben großer Worte fußen, zumal allgemeiner geographischer, naturwissenschaftlicher und kosmischer Begriffe. Da gibt es ,Kontinente‘, ,Berge‘, ,Hügel‘ und ,Krater‘, ,Küsten‘, ,Häfen‘, ,Inseln‘, ,Meere, Seen und Ströme‘, ,Winde, Nebel und Wolken‘. Ihre Lyrik ist voll von ,Himmel‘ und ,Erde‘, ,Sonne‘, ,Mond‘ und ,Sternen‘, wir hören von ,Planeten‘ und ,Kometen‘, von ,Firmamenten‘, ,Horizonten‘, ,Feuerzonen‘ und Wendekreisen‘. Dieses System von Schlüsselwörtern ergibt ein gigantisches Welttheater.
Große, ,alte‘ Worte also, denen der Sinn zwar noch nicht ganz ausgetrieben worden ist, die aber oft disparat, ohne Verbindung nebeneinander stehen oder als Bilder selbst nicht unversehrt sind. Ingeborg Bachmann ist schon früh an der Nachkriegswelt verzweifelt, umso entscheidender ist es, daß sie in dem Gedicht „Rede und Nachrede“ sagt:
Mein Wort errette mich.
Ingeborg Bachmann liebt die Wörter und verzweifelt an allem, was außerhalb der Wörter liegt. Ihre Sprache plappert nie. Jedes Wort ist eine singuläre Einheit, das mit einer libidinösen Aura umgeben ist. Das Wort als kleinste Insel, als „Herzland“. Die Kluft, der Abgrund, der sich zwischen den Wörtern auftut, ist so spannungsreich, daß kein Kompromiß in der Stimmung entsteht.
Sprache ist von ihren Ursprüngen her gesehen magisch und zweigeschlechtlich. In der Geschichte des Patriarchats hat sich aber ein sekundäres Kraftfeld herausgebildet. Es ist dem Vater zugeordnet und hat bewirkt, daß das Weiblich-Matriarchale abnimmt, beziehungsweise durch völlige Verdeckungen kaum mehr zu erkennen ist.
Das Schreiben der Ingeborg Bachmann hat ganz direkt und schmerzvoll mit dieser Zweigeschlechtlichkeit zu tun. Sie ist in den großen Sog der Väter geraten, aber sie ahnt den anderen, fernen Bereich. Vor der zu fernen Erinnerung des Weiblich-Archaischen türmt sich die Symbolgewalt der patriarchalen Metaphernwelt auf. Diese gilt.
Mit den Vätern der Dichtung kämpft Ingeborg Bachmann jedoch nicht. Sie erkennt deren Erbe an. Mit den exponierten Patriarchen der neuzeitlichen Philosophie, die die Sprache zu ihrem Thema gemacht haben und die beide in deutscher Sprache denken, hat sie sich kritisch auseinandergesetzt: Martin Heidegger und Ludwig Wittgenstein.
Für die angehende Dichterin bildete der zentrale Satz Wittgensteins: „Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt“ eine Herausforderung. Als Grenze der Welt faßt sich nach Wittgenstein das denkende Ich auf, das sich der Unzulänglichkeit und Ohnmacht seiner Sprache bewußt ist. Ihm bleibt immerhin die Erkenntnis aus dem Tractatus: „Wovon man nicht sprechen kann, darüber muß man schweigen.“ Diese Aussage bedeutet in der Konsequenz den Tod jeder Dichtung. In einem Aussagesatz wird von etwas oder über etwas gesprochen, zum Beispiel über die Welt; die Dichtung hingegen spricht sich selbst. Der Dichter erzeugt selbst ein Stück Welt. Dieses geschriebene Stück Welt umschließt auch das Mythische, das Wittgenstein das „Unaussprechliche“ nennt, also etwas, was nach Wittgenstein nicht in Worte gefaßt werden kann. Für Ingeborg Bachmann ergibt sich daraus der Schluß: die dichterische Sprache geht in ihrer Darstellungskraft und ihrer Erkenntnismöglichkeit über die philosophische Sprache hinaus, da sie das Mythische, also das „Unaussprechliche“ auszusprechen vermag. Heidegger hatte unter dem Anspruch, Denker zu sein, philosophisches und dichterisches Sprechen verschmolzen; an Wittgenstein geschult mußte Ingeborg Bachmann jedoch auf der Trennung bestehen und in ihrem Erkenntnisinteresse am Primat der dichterischen Sprache festhalten. So kritisiert sie Heidegger schon 1949 in ihrer Dissertation:
Die Grunderlebnisse, um die es in der Existentialphilosophie geht, sind tatsächlich irgendwie im Menschen lebendig, und drängen nach Aussage. Sie sind aber nicht rationalisierbar, und Versuche hierzu werden immer zum Scheitern verurteilt sein. Heidegger sagt zwar, daß ,dieses Philosophieren‘ das er im Auge hat, geschehe, sofern der Mensch existiere; aber ihm gerät es zu Vergegenständlichungen und Gedankenbildern, die, obwohl er es nicht wahrhaben will, mit dem Verstand verstanden werden müssen, um aus seinem Werk heraus, in dem er es zu vollziehen glaubt, zum Leser zu finden. Zum Vollzug aber kommt man beim Sprechen über Existenz nicht, sondern es bleibt beim Sprechen darüber, beim ,Gerede‘ über feinfühlig bemerkte ästhetische Tatbestände, wie zum Beispiel über das ,Gerede‘ selbst.
Dem Bedürfnis nach Ausdruck dieses anderen Wirklichkeitsbereiches, der sich der Fixierung durch eine systematische Existentialphilosophie entzieht, kommt jedoch die Kunst mit ihren vielfältigen Möglichkeiten in ungleich höherem Maß entgegen. Wer dem ,nichtendenden Nichts‘ begegnen will, wird erschüttert aus Goyas Bild Kronos verschlingt seine Kinder die Gewalt des Grauens und der mythischen Vernichtung erfahren und als sprachliches Zeugnis äußerster Darstellungsmöglichkeiten des ,Unsagbaren‘ Baudelaires Sonett „Le gouffre“ empfinden können, in dem sich die Auseinandersetzung des modernen Menschen mit der ,Angst‘ und dem ,Nichts‘ verrät.
Ingeborg Bachmann argumentiert mit Wittgenstein gegen Heidegger, dessen mystifizierende „Scheinsätze“ den genauen Abgrenzungen von „Sagbarem“ und „Unsagbarem“, den Aussagen und dem Schweigen Wittgensteins gegenüberstehen. Sie kennt den Mangel beider Denker und begegnet ihm später mit der Praxis ihrer Dichtung. Ihr Wirklichkeitsbereich ist mehr als die von Wittgenstein auferlegte Grenze und die von Heidegger betriebene Ästhetisierung des Scheins. Ihr gelingt zunächst dieser Weg zwischen den Gedankenkonstruktionen dieser beiden philosophischen Patriarchen hindurch.
Eine Lösung ist dieser Weg nicht, aber er überwindet die Stummheit. Denn die Gefährlichkeit des Heideggerschen Denkens wurde von Ingeborg Bachmann nicht erkannt. Heideggers Denkweg führt im Nachzeichnen der abendländischen Metaphysik unweigerlich in den Nihilismus. Dieser Philosoph hat den Begriff der „Seinsvergessenheit“ geprägt – doch was gibt es in dieser „Erkenntnistheorie“ so eifrig zu vergessen?
Dank dieser Vergessenheit (die auch bei Freud auftaucht) konnten die großartigsten Denk- und Sprachmodelle errichtet werden, aus deren Zirkel es keinen Ausweg gibt. Woher aber die Angst kommt, bleibt unbegriffen. Der Nihilismus ist die suggestionsstarke Gestalt eines sekundären Schicksals: das ,primäre‘ Sein hört spätestens bei den alten Griechen auf; es ist wie das Paradies eine verschollene Welt, in der es die Möglichkeiten des Matriarchats gibt und damit eine andere Seinsweise. Die Heideggersche Angst kommt aus dem Wissen vom Beginn einer neuen Seinsweise (Patriarchat) und dem daraus folgenden Gesetz, daß es auch enden muß. Gerade aus dieser Angst heraus wird das Davor verdrängt. So hilft die Seinsvergessenheit, eine der größten Verdrängungs„leistungen“ unserer Kultur, bei der Konstruktion des philosophischen Denkens und Sprechens als einem endlosen Zirkel. „Viel täuscht Anfang und Ende“, sagt Hölderlin.
Sprachangst hat Ingeborg Bachmann nicht. Aber sie erteilt dem ganzen Problem des dichterischen Sprechens, das, abgegrenzt vom philosophischen sich kunstvoll, Stil- und geschmackvoll sich als Teil der Welt einzurichten versteht, 1967 in ihrem letzten Gedicht eine radikale Absage:
KEINE DELIKATESSEN
Nichts mehr gefällt mir.
Soll ich
eine Metapher ausstaffieren
mit einer Mandelblüte?
die Syntax kreuzigen
auf einen Lichteffekt?
Wer wird sich den Schädel zerbrechen
über so überflüssige Dinge –
Ich habe ein Einsehen gelernt
mit den Worten,
die da sind
(für die unterste Klasse)
Hunger
aaaaaaSchande
aaaaaaaaaaaaaTränen
und
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaFinsternis.
Mit dem ungereinigten Schluchzen,
mit der Verzweiflung
(und ich verzweifle noch vor Verzweiflung)
über das viele Elend,
den Krankenstand, die Lebenskosten,
werde ich auskommen.
Ich vernachlässige nicht die Schrift,
sondern mich.
Die andern wissen sich
weißgott
mit den Worten zu helfen.
Ich bin nicht mein Assistent.
Soll ich
einen Gedanken gefangennehmen,
abführen in eine erleuchtete Satzzelle?
Aug und Ohr verköstigen
mit Worthappen erster Güte?
erforschen die Libido eines Vokals,
ermitteln die Liebhaberwerte unserer Konsonanten?
Muß ich mit dem vernagelten Kopf
mit dem Schreibkrampf in dieser Hand,
unter dreihundertnächtigem Druck
entreißen das Papier,
wegwerfen die angezettelten Wortopern,
vernichten so: ich du und er sie es
wir ihr?
(Soll doch. Sollen die andern.)
Mein Teil, es soll verloren gehen.
In diesem Gedicht läßt Ingeborg Bachmann nicht nur das lyrische Sprechen hinter sich; sie erkennt gerade auch in ihrer eigenen sprachlichen Virtuosität ein Problem. Während sie in dem Gedichtzyklus Lieder auf der Flucht sagen kann: „Von meinem letzten Wort noch umklammert / das Meer und der Himmel“, führen die „Worthappen erster Güte“ immer weiter von ihr weg. Das „ungereinigte Schluchzen“ trifft sie mehr, als die gereinigte Artistik. Die Wirklichkeit hat sie beim Schreiben eingeholt.
Das herausragende Thema der Lyrik, der dramatischen Dichtungen und der Prosa Ingeborg Bachmanns ist das der Liebe, beziehungsweise der Liebesklage. Diese Autorin, die stets auf dramatische Distanzierung achtet, bricht bei dem fernen oder nahen Wunschziel Liebe aus. Doch die Begegnung der Geschlechter ist, wo nicht möglich, von einer gefährlichen Tendenz des Scheiterns, des Rätsels, der Unbegriffenheit geprägt. In dem paradigmatischen Gedicht „Erklär mir Liebe“ heißt es:
Du lachst und weinst und gehst an dir zugrunde,
was soll dir noch geschehn –
Erklär mir, Liebe!
In den Liedern auf der Flucht gibt es Passagen verwunschener Liebesbegegnung; doch im gleichen Zyklus führt die „Liebesleiter“ ins Nichts und die Qual wird so groß, daß die Zeilen hinausgeschrien werden:
„Erlöse mich! Ich kann nicht länger sterben.“
Wenn alles aus ist, kann das schreckliche Resümee gezogen werden:
Die Liebe hat einen Triumpf und der Tod hat einen,
die Zeit und die Zeit danach.
Wir haben keinen.
Die Liebe als Wahnidee, als Fiktion, eine immer scheiternde Utopie. Die Liebe als eine Ekstase der Unmöglichkeit. Es gibt nur ein Gedicht, in dem in sehr großer Zartheit die Liebe ins Märchenreich heimgeholt wird. In dem Gedicht „Das Spiel ist aus“ ist der Geliebte zugleich der Bruder, der mit der Geliebten die gemeinsame Fahrt durch die Mythen – und Märchenwelt angetreten hat, und, nachdem das Spiel aus ist, kann die verschwiegene Begegnung zweier Geschlechter möglich werden.
DAS SPIEL IST AUS
Mein lieber Bruder, wann bauen wir uns ein Floß,
und fahren den Himmel hinunter?
Mein lieber Bruder, bald ist die Fracht zu groß
und wir gehen unter.
(…)
Wir müssen schlafen gehn, Liebster, das Spiel ist aus.
Auf Zehenspitzen. Die weißen Hemden bauschen.
Vater und Mutter sagen, es geistert im Haus,
wenn wir den Atem tauschen.
Diese außergewöhnliche und inzestuöse Liebe erinnert stark an die Geschwisterliebe von Ulrich und Agathe in Musils Mann ohne Eigenschaften.
Dort wird gesagt :
„Er will nicht, daß es bloß eine Liebesgeschichte werden soll“, dachte sie; und fügte hinzu: „Das ist auch mein Geschmack.“ Und gleich darauf dachte sie: „Er wird keine andere Frau nach mir lieben, denn dies ist keine Liebesgeschichte mehr; das ist überhaupt die letzte Liebesgeschichte, die es geben kann!“ und sie fügte hinzu: „Wir werden wohl eine letzte Art Mohikaner der Liebe sein.“
Vor allem in den Liebesgedichten tritt das lyrische Moment hinter der dramatischen Bewegung zurück. Die Rezipienten haben, indem sie fasziniert auf diese Lyrik starrten, diesen Aspekt kaum beachtet.
(…)
Ria Endres, Neue Rundschau, Heft 4, 1981
Interview
Josef-Hermann Sauter: Mit Bedacht wird an Ihrer Lyrik immer wieder die organische Verschmelzung traditioneller und moderner Dichtungselemente hervorgehoben, in der Sie das Zeitgefühl prägnant zu erfassen suchen. Welchen Dichtern der Vergangenheit, Frau Bachmann. fühlen Sie sich besonders verpflichtet, und welche Haltung nehmen Sie gegenüber der Tradition ein?
Ingeborg Bachmann: Was die Kritik mit Bedacht und mehr wohl noch mit Unbedacht äußert, ist der schlechteste Ausgangspunkt für die Unterhaltung mit einem Autor – verzeihen Sie. Wenn ich eins wäre mit diesem abgestempelten und durchinterpretierten Gespenst, das Elemente verschmilzt und einige andere Seiltänze und Tiefenausflüge vollbringen soll, würde ich meine Schreibmaschine zumachen und auf und davon gehen. Aber die Dichter der Vergangenheit – versuchen wir es mit denen: Ich bewundere natürlich viele, sehr verschiedene, und von Zeit zu Zeit andere, so daß mit der Aufzählung von Namen wenig gesagt wäre. Dabei langweilen mich Gedichte meistens, ich lese fast keine mehr, hier und da erinnere ich mich an eine früh gehörte Zeile, an einen Ausdruck, und wenn mir etwas sehr gefällt, wenn ich meine, es müsse ,gerettet‘ werden, dann verwende oder variiere ich einen Ausdruck, gebe ihm einen neuen Stellenwert. Das ist also, wenn Sie so wollen, ein Verhältnis zur Vergangenheit, ein Arbeitsverhältnis, das zum Beispiel in der Musik seit jeher vorkommt.
Sauter: Im September 1823 sagte Goethe im Gespräch mit Eckermann :
Die Welt ist groß und reich und das Leben so mannigfaltig, daß es an Anlässen zu Gedichten nie fehlen wird. Aber es müssen Gelegenheitsgedichte sein, das heißt, die Wirklichkeit muß die Veranlassung und den Stoff dazu hergeben… Alle meine Gedichte sind durch die Wirklichkeit angeregt und haben darin Grund und Boden. Von Gedichten aus der Luft gegriffen halte ich nichts.
Empfinden Sie, Frau Bachmann, Ihre Gedichte im Goetheschen Sinne als Gelegenheitsgedichte?
Bachmann: Ja, als Gelegenheitsgedichte. Und genau in diesem Sinn. Ich habe auch darum viele Jahre keine Gedichte mehr geschrieben, weil ich eben nicht Gedichte schreiben kann, oder ich könnte es zwar, mag aber nicht, wenn da nichts ist, außer verfügbaren selbstentwickelten Techniken, und eben der Luft. In den Frankfurter Vorlesungen, wenn ich mich recht erinnere, habe ich in einem ähnlichen Zusammenhang geschrieben, es liege eben nichts in der Luft.
Sauter: Hugo Friedrich, der westdeutsche Literaturwissenschaftler, charakterisiert in seiner 1960 erschienenen Struktur der modernen Lyrik die zeitgenössische bürgerliche Lyrik knapp so:
Überall beobachten wir die Neigung, sich so weit wie möglich von der Vermittlung eindeutiger Gehalte fernzuhalten.
Sind Sie – wie ich – der Meinung, daß ein Schriftsteller den Fragen der Zeit nicht ausweichen sollte, sondern sich ihnen stellen müßte?
Bachmann: Dieser Meinung wäre ich gern, wenn mich die ,Fragen der Zeit‘ nicht noch mehr beunruhigten, als es verlangt wird. Denn was sind die Fragen der Zeit? Ich glaube, es wird mit dieser Formulierung einer der vertracktesten Komplexe zu einfach benannt. Die Fragen der Zeit meint zwar jeder zu kennen, aber es ist wirklich die Frage, ob nicht zu jeder Zeit bedeutende Schriftsteller hinter die Kulissen dieser Fragen gesehen haben und sich also erst ans Entdecken der wirklichen Fragen machen. Man muß sich diesen Fragen also nicht nur stellen, sondern diese Fragen immer wieder entdecken, das ist weitaus mühevoller. Dann kann man sich ihnen stellen.
Sauter: Für Gottfried Benn heißt dichten, „die entscheidenden Dinge in die Sprache des Unverständlichen erheben, sich hingeben an Dinge, die verdienten, daß man niemanden von ihnen überzeugt“. Grundsätzlich anders ist der Tenor Ihres Werkes, das eine solche subtile Beziehungslosigkeit ausschließt. Wem wollen Sie verständlich sein, Frau Bachmann, und wen wollen Sie mit Ihrer Dichtung wovon überzeugen?
Bachmann: Ich will verständlich sein, möchte es auch immer mehr werden – aber das schließt nicht Subtilität, meinetwegen streckenweise Schwerverständlichkeit aus. Bestimmt aber Beziehungslosigkeit, wie Benn und andere sie kultiviert haben und kultivieren. Man muß – denke ich – und darf eine hohe Meinung von seinen Lesern haben. Aber wem verständlich sein? Eben diesen Lesern, die wir ja nicht kennen und von denen man sich viele wünscht, und da geht es einem so, daß mehr Freude über einen unbeholfenen als über einen routinierten, abgebrühten ist, weil man dem unbeholfenen Leser noch ein Licht aufstecken kann.
Vor kurzem ist in Basel ein Schweizer Landarbeiter zu mir gekommen in einer Buchhandlung, er sagte stockend, das habe ihm gefallen, was ich gelesen habe, und nun möchte er gerne Bücher von mir kaufen, aber er fragte sich und mich, ob das nicht zu hoch für ihn sei, er habe ja keine Schulen besucht wie die anderen Leute, die auch in der Lesung waren. Nun weiß ich wirklich nicht, was ihm beim Lesen passieren wird, ein Fiasko könnte es auch werden, aber an ihn denke ich stellvertretend für viele, unsicher, immer zweifelnd, ob ich meine Leser gefunden, sie gewonnen oder verloren habe.
Sauter: Sie sprechen in Ihren Frankfurter Vorlesungen von der „Kunst als Veränderndes“ und es heißt in der einen Vorlesung:
… und wenn die Gesellschaft sich der Dichtung entzieht, wo ein ernster und unbequemer, verändernwollender Geist in ihr ist, so käme das einer Bankerotterklärung gleich.
Wie beurteilen Sie eigentlich die Rolle des Künstlers in der heutigen Zeit, und wie schätzen Sie seine Verantwortung ein?
Bachmann: Die Rolle des Künstlers – das ist mir etwas zu Fiktives. Es gibt doch sehr verschiedene Rollen, die Künstler haben, zugeteilt bekommen oder sich anmaßen. Und sie reichen vom Gewissen der Nation bis zu den letzten kauzigen Spitzwegfiguren, von Politikern, die Gedichte schreiben, bis zu Schriftstellern, die Politik machen. Hinzu kommt, daß diese Rollen in der kapitalistischen und sozialistischen Welt verschieden aussehen müssen und sich am meisten noch ähneln durch eben den ernsten und unbequemen Geist, den verändernwollenden, wo er zutage tritt, wo ein kritisches Verhältnis zu der jeweiligen Wirklichkeit diese Wirklichkeit überhaupt erst beweist. Wo nichts mehr zu verbessern, nichts mehr neu zu sehen, zu denken, nichts mehr zu korrigieren ist, nichts mehr zu erfinden und zu entwerfen, ist die Welt tot.
Sauter: Worin sehen Sie für sich Schwierigkeiten, Frau Bachmann, die unmittelbare Gegenwart künstlerisch in den Griff zu bekommen, denn Sie formulierten selbst, daß es wohl niemand glaube, „daß Dichten außerhalb der geschichtlichen Situation stattfindet“.
Bachmann: Für mich selber habe ich lange Zeit die Schwierigkeit darin gesehen, daß ich deutsch schreibe, zu Deutschland nur durch diese Sprache in Beziehung gesetzt bin, angewiesen aber auf einen Erfahrungsfundus, Empfindungsfundus aus einer anderen Gegend. Ich bin aus Österreich, aus einem kleinen Land, das, um’s überspitzt zu sagen, bereits aus der Geschichte ausgetreten ist und eine übermächtige, monströse Vergangenheit hat. – Jetzt hingegen scheint mir das als Handicap für Prosaschreiben nicht mehr so groß, im Gegenteil, ich merke mehr und mehr, seit ich an dem ersten Roman schreibe, der Wien zum Schauplatz hat, die Zeit ist die Gegenwart, daß ich nicht einmal aus der Not eine Tugend machen muß, sondern daß dieses einstige geschichtliche Experimentierfeld mir mehr und Genaueres über die Gegenwart zu sagen hat als etwa ein Aufenthalt hier, wo man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht.
Sauter: In Ihrer Vorlesung Fragen und Scheinfragen formulierten Sie: Die Kunst gibt „uns die Möglichkeit zu erfahren, wo wir stehen oder wo wir stehen sollten, wie es mit uns bestellt ist und wie es mit uns bestellt sein sollte“. Darf man diesen Satz als Ihr Bekenntnis zu einer wirklichkeitsverpflichteten und verändernwollenden künstlerischen Arbeit nehmen?
Bachmann: Ja, und ich danke Ihnen, daß Sie diesen Satz genannt haben, denn im Sprechen bleibt man ja hinter dem Schreiben zurück und tappt tolpatschig in den Gegenden herum, in denen man sich schreibend schon einmal zurechtgefunden hat
Aufgenommen am 26.7.1965, aus Josef-Hermann Sauter: Interviews mit Schriftstellern. Texte und Selbstaussagen, Gustav Kiepenheuer Verlag, 1986
Ekkehart Rudolph im Gespräch mit Ingeborg Bachmann im Jahr 1971
ZIGARETTCHEN IM BETTCHEN
Das Ingeborg-Bachmann-Lied
Sie hieß Ingeborg. Ingeborg Bachmann.
Sie schrieb schwierige Literatur.
Und obwohl sie aus Klagenfurt stammte
Ist sie Teil der deutschen Kultur.
Was sie schrieb, steht in Bibliotheken
Was sie schrieb, steht im Bücherregal
Sogar in Schulbüchern steht es
Doch den Schülern ist es egal.
Dabei gab sie sich wirklich Mühe
Sie schrieb auch sehr ambitioniert
Doch die groschenheftgeilen Leser
Hat Lyrik nie interessiert.
„Ohne Sorge, sei ohne Sorge“
Hieß ihre mahnendste Zeile
Doch die Menschen zuckten die Achseln
Und sagten: „Och, ist nicht so geil, ey.“
Es ging um Reklame und war kritisch gemeint
Doch es ging nicht voran im Gedicht
Weil sich auf Sorge nichts reimt
Höchstens borge, und das mochte Ingeborg nicht.
Man nannte sie Ohnesorg Bachmann
So zynisch sind hier die Leute
Und nachdem sie im Schlaf verbrannte
Sang eine herzlose Meute:
„Sie hieß Ingeborg Bachmann
Und rauchte gern im Bettchen
Noch ein Zigarettchen
Noch ein Zigarettchen!“
Ihre Verse hat keiner verstanden
Und manche haben gelacht
Doch die Geste des lässigen Rauchens
Hat sie berühmt gemacht.
Sie hieß Ingeborg. Ingeborg Bachmann.
Sie war eine dichtende Dame.
Und obwohl sie Werbung so hasste
Hinterlässt sie Raucherreklame.
Wiglaf Droste
Bachmann Loops von Tim van Jul
Stimmen zu Ingeborg Bachmann
Hermann Burger: Abend mit Ingeborg Bachmann
DU, Heft 9, 1994
Peter K. Wehrli: Unverbunden in Zürich
DU, Heft 9, 1994
Uwe Johnson: Good Morning, Mrs. Bachmann
DU, Heft 9, 1994
Inge Feltrinelli, Fleur Jaeggy, Toni Kienlechner, Christine Koschel, Inge von Weidenbaum: Römische Begegnungen
DU, Heft 9, 1994
Hans Magnus Enzensberger: Überlebenskünstlerin Ingeborg Bachmann
Heinz Bachmann: „Die Ärzte wollten dringend wissen, ob es irgendwelche Medikamente gab“
Die Welt, 5.9.2023
Ingeborg Bachmann erhält den Georg-Büchner-Preis 1964. Dankesrede und kurzer Fernsehbericht über sie inklusive Interview. Außerdem Rezitation des Gedichts „Die große Fracht“.
Zum 10. Todestag der Autorin:
Christa Wolf: Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar
DU
Zum 30. Todestag der Autorin:
Rolf Löchel: Es schmerzte sie alles, das Leben, die Menschen, die Zeit
literaturkritik.de, Oktober 2003
Zum 40. Todestag der Autorin:
Jan Kuhlbrodt: Zum 40 Todestag von Ingeborg Bachmann
signaturen.de
Zum 75. Geburtstag der Autorin:
Susanne Petersen: „Keine neue Welt ohne neue Sprache“
Sonntagsblatt
Diemut Roether: Ein Ungeheuer mit Namen Ingeborg
die taz, 23.6.2001
Otto Friedrich: Zum 75. Geburtstag von Ingeborg Bachmann
Die Furche, 20.6.2001
Zum 80. Geburtstag der Autorin:
Evelyne von Beime: „Doch das Lied überm Staub danach / wird uns übersteigen“
literaturkritik.de, Juni 2006
Zum 90. Geburtstag der Autorin:
Ria Endres: „Es kommen härtere Tage“
faustkultur.de, 15.6.2016
Hans Höller: Ingeborg Bachmann: Phänomenales Gedächtnis ganz aus Flimmerhaar
Der Standart, 25.6.2016
Zum 95. Geburtstag der Autorin:
Hans Höller: Die Utopie der Sprache
junge Welt, 26.6.2021
Zum 50. Todestag der Autorin:
Hannes Hintermeier: Horror vor der Sprache der Bundesdeutschen
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 25.11.2022
Edwin Baumgartner: Bachmann für Verehrer
Wiener Zeitung, 24.11.2022
Ingeborg Bachmann: Eine poetische Existenz auf der Rasierklinge
Kleine Zeitung, 16.10.2023
Hans Höller: Kriminalgeschichte der Autorschaft
junge Welt, 17.10.2023
Claudia Schülke: Elementare Grenzgängerin
Sonntagsblatt, 11.10.2023
Paul Jandl: Vor fünfzig Jahren starb Ingeborg Bachmann an schweren Brandverletzungen. Dann gab es Gerüchte über einen Mord, und es entstand ein Mysterium
Neue Zürcher Zeitung, 17.10.2023
Teresa Präauer: Nur kurz hineinlesen – und nächtelang hängen bleiben
Die Welt, 17.10.2023
Andrea Heinz: Erinnerung an eine Unvergessene: Vor 50 Jahren starb Ingeborg Bachmann
Der Standart, 17.10.2023
Fakten und Vermutungen zur Autorin + Forum + IMDb + ÖM + KLG +
Archiv 1, 2, 3 & 4 + Internet Archive + Kalliope +
Georg-Büchner-Preis 1 & 2 + Interview
Porträtgalerie: Keystone-SDA + deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口


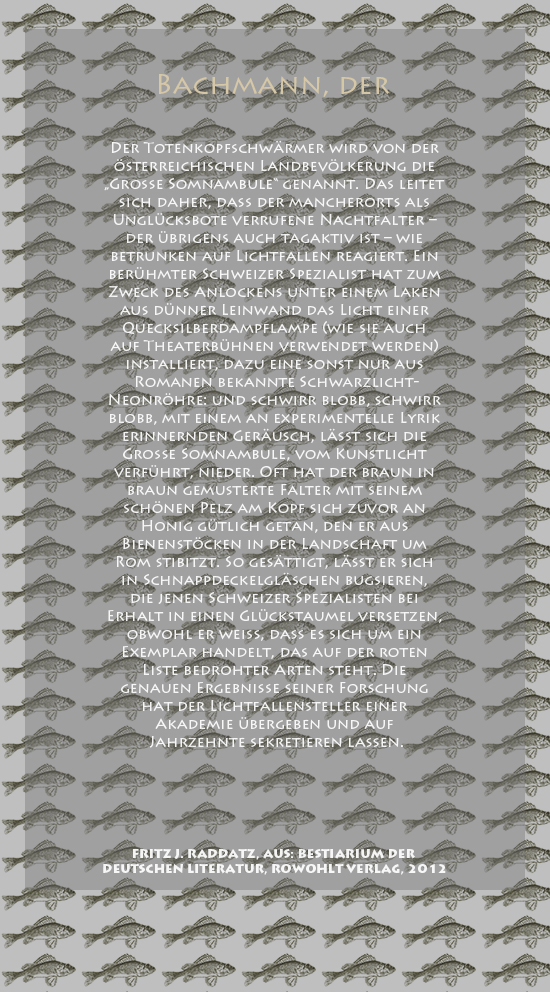












Schreibe einen Kommentar