Jan Wagner: Australien
QUALLE
gefräßiges auge,
einfachste unter den einfachen –
nur ein prozent trennt sie von allem,
was sie umgibt.
stoße dich weiter vor
ins unbekannte: ein brennglas, geschliffen
von strömungen und wellen; eine lupe,
die den atlantik vergrößert.
In seinem vierten Lyrikband
sucht Jan Wagner (unter anderem) den kürzesten Weg nach Australien, zum anderen Ende der Welt – gefunden hat er in jedem Falle den direkten Weg zur Beglückung seiner Leser.
Wer den gesamten Kanon lyrischer Formensprache derart beherrscht und sich seiner mit nonchalanter Virtuosität bedient wie Jan Wagner, steht leicht unter Elfenbeinturmverdacht. Wie schön, dass Jan Wagner schon im Titel seines neuen Lyrikbandes diesem Verdacht die Grundlage entzieht: Australien zeigt diesen Ausnahmelyriker als Reisenden, rund um den Kompass und ans andere Ende der Welt, quer durch Raum und Zeit, zeigt ihn als Entdecker, Landschaftsmaler, Spiritisten und immer als Brennmeister hochprozentigen Geschichtendestillats. „Man ist glücklich in Australien, / sofern man nicht dorthin fährt“ – diese Verse von Alvaro de Campos hat Jan Wagner seinem Band vorangestellt und zum poetischen Programm einer Weltreise umgemünzt. Er durchstreift alle Himmelsrichtungen und Kontinente, reale wie imaginäre, und egal, ob er einen Gecko betrachtet, den Lake Michigan besingt oder doch noch nach Australien gelangt – wo immer Jan Wagner uns hinführt, fördert er Überraschendes zu Tage, Seite um Seite beglückende Poesie.
Berlin Verlag, Ankündigung
„Nicht schon wieder ein Fernwehbändchen“
– Beim ein oder anderen Leser mag vielleicht das schön und schlicht gehaltene Buch Australien des 1971 in Hamburg geborenen Lyrikers Jan Wagner, welches 2010 im Berlin Verlag erschien, diese Erstreaktion provozieren. Auch das den Versen vorangestellte Motto des portugiesischen Dichters Álvaro de Campos, eines der Heteronyme Pessoas, zielt offenbar in diese Richtung: man sei glücklich in Australien, sofern man nicht dorthin fahre. –
Geht es also womöglich um die Verklärung nicht aus eigener Anschauung erlebter Orte? Wer Jan Wagner kennt, wird diese Möglichkeit sogleich ausschließen wollen. In seinen bisherigen Publikationen hat sich der Autor im Gegenteil vor allem als ein sehr genauer Beobachter vorgestellt, dem es scheinbar mühelos gelingt, von der sezierenden Beschreibung ausgehend zu lyrisch anspruchsvoller Eleganz zu finden. Spekulation ist also nicht Wagners Sache, kann auch verallgemeinert kaum je Sache der Lyrik als Gattung sein.
Und doch schlagen wir einen Gedichtband auf, der sich schon durch seine Untergliederung im weitesten Sinne als „Reiseliteratur“ definieren lässt: Süden, Westen, Osten, Norden, Australien sind die fünf Kapitel überschrieben, in denen uns Wagner seinen Kosmos aus Tieren, Pflanzen, Persönlichkeiten, Landschaften, Jahreszeiten, Erinnerungen und sanft tastenden Einsichten über das Dasein nahebringt. Dabei sind die Orte stets nur Ausgangspunkt für das genuine innere Erleben. Mit der ihm eigenen Feinfühligkeit und einer metaphorisch eigenständigen Formulierungsweise („und immer irgendwo ein pasch / von schafen über den hang gewürfelt:) fällt es Jan Wagner nicht schwer, den Leser reisewillig zu machen, Reisen, auf denen es um das Entdecken geht, um Erfahrungen, nicht um die Ankuft an irgend einem topografischen Ziel. Dabei geht der Autor unter anderem auch auf Lebensformen ein, die gemeinhin nicht Gegenstand von (ernstgemeinter) Lyrik sind.
zerfällt im maul des karibus
so kalt und luftig wie ein schneekristall.
wie sie die katastrophen
verschläft, die dürrezeiten, unbewegt,
bis sie ein tropfen
wasser nach jahrzehnten plötzlich weckt.
Diese Verse über eine Flechte charakterisieren Abgeschlossenheit, Geduld, das bedingungslose In-Sich-Selbst-Gekehrt-Sein und machen diese Begriffe auf ihre ganz ursprüngliche Weise für uns erfahrbar. Wagner bleibt dabei stets dem Ästhetischen zugewandt, selbst wenn er beispielsweise das Phänomen einer Sonnenfinsternis aufgreift und damit blanken Horror heraufbeschwört:
von dem, was kommen wird, von fremden mächten,
die sich im grenzland sammeln, prophetien
von sieben seuchen, sieben übeln,
von hungerschwärmen, sinkenden profiten,
dem blut im milchkübel.
Wagner ist vordergründig betrachtet kein ausgesprochen „moderner“ Lyriker. Aus seinen Versen spricht eine große und ihm offenbar sehr wichtige formale Traditionsbezogenheit. Wir begegnen hier dem Lied, der Ballade, Terzinen, dem Haiku („ein zug schleppt leuchtend / seine fenster vorüber, / gläser voller öl.“) und allen voran immer wieder dem Sonett, die Wagner allesamt aber nicht etwa als vorgefundene Gussformen verwendet, sondern sie sich so subtil für seine sprachlichen Mitteilungen einrichtet, dass sie immer wieder neu aufblitzen und oft nur durch das äußerliche Erscheinungsbild erkennbar werden, im Falle des Sonetts etwa durch die letztlich als verbindlich zu betrachtenden vierzehn Zeilen. Das genau aber ist ein Charakteristikum echter und wohlverstandener Modernität. Wagner spielt gekonnt mit aufscheinenden Reimen und Assonanzen, die jedoch nie irgendwo so stark hervortreten, dass sie aufs erste Lesen als solche ins Auge fallen würden. Er erweist sich einmal mehr als großer Sprachmelodiker, wie in der wunderschönen lyrischen Prosa über den Gecko, wo es heißt:
ein wandernder riß, der sich hinten schließt, während er in laufrichtung das weiß zerteilt, rot und pulsierend, eine winzige lavaspalte.
Gerade vielleicht auch mit dem Titelgedicht „australien“, in welchem von zwei kleinen Jungen erzählt wird, die der Tristesse ihres Daseins dadurch zu entfliehen trachten, dass sie davon träumen, sich durch ein Loch bis ans andere Ende der Welt zu graben. Dieses Schlussgedicht zielt noch einmal auf das Einende allen Reisens: die Erfahrung, das alles Erfahrbare letztlich in uns selbst ist (oder im Gedicht?). Der innere Kosmos findet sich wieder im äußeren und umgekehrt. Der Band Australien ist eine der ganz großen literarischen Freuden der vergangenen Jahre, von einer anrührenden Tiefenschärfe, wie sie leider nur selten den Weg zwischen zwei Buchdeckel findet.
Jan Wagner, der übrigens in diesem Winter für ein Jahr als Stipendiat der Villa Massimo nach Rom gehen wird, ist einer der wenigen Autoren, die man nicht unbedingt als Lyriker bezeichnen muss – man darf ihn getrost und im besten Sinne einen Dichter nennen und sich schon jetzt auf die literarische Lese seines Italienaufenthaltes freuen.
Marcus Neuert, rezensionenwelt.de, Februar 2011
Häuptling Hononanz
– Mit Jan Wagners Gedichtband Australien in den Süden der Sprache. –
Australien ist ein Projekt. Zwei Kinder fangen mittags an zu graben im Ödland hinter der Autobahn, „wo sich die brücke in der brache / verlor“. Und während sie graben, entfalten die Zeilen das wüste Panorama einer spätzivilisatorischen Urlandschaft, in der das „abwasserrohr mit seinem biblischen / dunkel“ sein schlichtes Rinnsal „predigte“ oder das „paläon- / tologische Autowrack wie ein fossil vom lehm verschluckt“ dalag, während ein Fesselballon die Szene querte mit Werbung „für bier / oder gelee“. Die Buben graben unermüdlich, bis nach sieben Strophen das Ziel ihres Tuns deutlich wird und seine Erfüllung: Sie fragen sich, wann sie auf Kohleflöze stossen, wann auf Erz, bis endlich „irgendwo ein koala // die erde sich bewegen spürte“ und „zwei verschmierte“ Knaben zu sehen bekam, die dann „in dem mythischen, dem mostrich- / gelben abend“ verschwanden. Am Ende steckt der Spaten am Rand, wie ein „fahnenmast“. Die Kinder haben sich durch die Erde gegraben, den Koala erstaunt und einen Kontinent entdeckt. Damit wird der Landname Australien zur Landnahme des Dichters.
Auch wenn die poetische Kompassnadel über alle Himmelsrichtungen streift, kommt „Australien“, das titelgebende und letzte Gedicht, als ein realer Ort im Lyrikband Jan Wagners nicht vor. Im Kapitel „Süden“ trifft sie auf das Chamäleon und den Olivenbaum, die Sestinen-Spiegelwelt einer Antonietta Gonzales, gemalt von (vermutlich) Lavinia Fontana, oder die Lichtfracht einer abendlichen Fähre über den Comersee, wo an der Promenade früh gefallene grüne Kastanien liegen wie gestreckte Waffen: „morgensterne“. Unter „Westen“ erscheint der Tukan oder der amerikanische Stuntman Evel Knievel, Strassenzüge in Ohio unter einem Himmel, „der für nichts wirbt als sich selbst“. Das Kapitel „Osten“ streift Szenen vor allem aus dem deutschen Osten und Polen, mit Rübezahl, dessen Name, wörtlich genommen, die historische Landschaft um Schreiberhau und Krummhübel öffnet und radikalisiert zu einem psychischen Moment, einem „trüben acker nur ein haufen / von zuckerrüben, ungeheuer, zahllos“.
Im „Norden“ zeigen sich der schwedisch-finnische Dichter Johan Ludvig Runeberg (1804–1877) und der dänische Poet Morti Vizki (1963–2004), Kopernikus kommt mit einem Fläschchen Blausäure im Mantel, eine Winter- und Windszene aus Hiddensee im Dezember verweht. Und dann wird die wie Schwarzeis spiegelnde Flügeldecke eines Steinway zum epiphanen Kindheitsmoment, wenn sie sich verwandelt in den gefrorenen See, auf dem das in die Tiefe träumende Kind plötzlich von einem Puck getroffen wird (dem wörtlichen Steinway, dem Stein, der auf den Weg geschickt wurde).
Gedichtideen entzünden sich an Wörtern: an Zitaten („Der Mann wird einem Baume gleich“, Paul Gerhardt) und Anspielungen (das Flechten-Gedicht dürfte eine Hommage sein an die flechtenkunde von Hans Magnus Enzensberger, dessen früher Ton immer wieder anklingt). Andere Texte entwickeln sich aus Erinnerungsmomenten, Überblendungen, in die Déjà-vus einschlagen wie Meteoriten und das Ich schlagartig akut sein lassen, „nirgendwo anders als hier“. Hier, das ist der Moment des Gedichts, das wörtlich „südliche Land“ (Australien) der Poesie. Im letzten Kapitel, „Australien“, kommen dann ein Ort in der Westsahara vor, eine Insel im Atlantik, ein Wassermann oder ein Stalker, musikalische Phantasien über die Schnecke, den Hagel und den Staub, aber nichts, was Australien geografisch verpflichtet wäre.
Wagners Australien wurde noch nie betreten, es ereignet sich nur hier, wo ein Häuptling spricht:
ich bin der letzte eines volkes,
allein mit der geschichte, einer sprache,
die mit ihm untergeht
Das Gedicht heisst „hononanz“, und die Tante im Gedicht, die „das thema torte / in schmale kapitel teilt“ fragt: „was heisst das denn? was ist das für ein wort?“ Es ist eine Vokabel, die zwischen Assonanz und Homonym schillert (und damit zwei rhetorische Grundtechniken preisgibt), in dem das deutsche Wort Hohn sich mischt mit dem lateinischen honor, Ehre. Die Friedenspfeife des Häuptlings, „das kalumet // liegt kalt im schoss“, während in Assonanzen und Alliterationen „das dorf noch immer qualmt“ und mit jenem „qualmt“ dann doch zurückbindet an „das kalumet“, das „kalt“ im Schoss liegt. Ein lautlicher Firnis schliesst die Oberfläche dieser traumhaft schönen Texte ab, ein Spiegelglanz aus Laut-Lichtern, wo auf dem Jahrmarkt, den die „frühen buchführer“ besuchen, vielleicht nur deshalb „anis“ ausliegt, weil die Silben das Wort „papier“ vorbereiten.
Angelika Overath, Neue Zürcher Zeitung, 2.4.2011
Die Auferstehung des Wracks als Fossil
– Sich die Welt erschließen mit Lyrik? Und auch in wüsteste Gegenden vordringen? Das geht. Mit Jan Wagner ist das Dasein überall zu ertragen. Selbst in Australien. –
Natürlich landet man am Ende in Australien. Dabei ist die Warnung, die Jan Wagner seinem Gedichtband voranstellt, eindeutig. Man sei glücklich in Australien, erklären die Verse Álvaro de Campos’ (das ist eines der Pseudonyme von Fernando Pessoa), sofern man nicht dorthin fahre. Auch wenn das in seiner paradoxen Rätselhaftigkeit nicht recht aufzulösen ist, klingt es nur allzu wahr, zumindest angesichts des letzten Gedichts in diesem Band. Denn was sich unter dem Titel ebenjenes Kontinents offenbart, sind nur noch die Abwässer und verrotteten Hinterlassenschaften der Zivilisation:
ein kaleidoskop zerbroche-
ner flaschen“, „das paläon-
tologische autowrack, wie ein fossil
vom lehm verschluckt
Nicht eben ein glückverheißender Ort.
Womöglich aber ist das noch gar nicht Australien. Die beiden Jungen jedenfalls, die das „wir“ in diesem Gedicht bilden, wähnen sich noch nicht am Ziel. Sie graben sich durch den Abfall hindurch in nachgerade feierlicher Erwartung von „kohle- / flözen / und erz“, um schließlich zu verschwinden „in dem mythischen, dem most- // richgelben abend, wo am rand / ein spaten steckte wie ein fahnenmast“. Etwas sonderbar Friedliches hat dieses Graben und Eintauchen, gleichsam etwas Triumphierendes durch den wie ein Banner in die Erde gerammten Spaten, das gar nicht recht zu der trübseligen Endzeitstimmung der Umgebung passen mag.
Es passt dann aber wiederum doch. Liest man dieses Gedicht – und mit ihm die übrigen, die Wagner in diesem abschließenden von insgesamt fünf Zyklen versammelt – auch als poetologisches Statement, dann sind es eben dieses Suchen und dieses Vordringen, die mehr als das Ankommen selbst Grund und Wesen des Daseins und Glücks ausmachen. Und damit natürlich auch das Wesen des Schreibens. Wagner schaut, indem er diesen Bewegungen nachspürt, auf die vermeintlich wenig bedeutsamen Erscheinungen der Natur wie auf eine Schnecke, „deren fuß ihr bauch ist: / sie bewältigt ihren weg nicht, / sie verzehrt ihn“. Und unvermutet erkennt Wagner in diesem unspektakulären kleinen Tier etwas hinreißend Schönes, ein „kleines grasschiff, immer in schräglage“, „zieht sie einen silberschweif / hinter sich her, ähnlich den fallenden / sternen – nur langsamer, / langsamer“.
Aber auch auf das Getriebensein schaut Wagner, auf die hässliche Seite des Suchens, dem etwas Zerstörerisches innewohnt. Von dem Abenteurer Michel Vieuchange, der zu Anfang des 20. Jahrhunderts darauf brannte, Smara, die verbotene Wüstenstadt, zu sehen und deshalb „die endlosen wochen im tragekorb / als schmutziges, gottloses bündel“ ertrug, immer in Erwartung des tödlichen Skorpionbisses oder der Ruhr, die im verschmutzten Wasser lauerte, erzählt eines der Gedichte. Eine animalische, gleichsam gruselige Studie des Suchens gilt einem Pitbull, der sich in sein Opfer verbeißt und nicht von ihm lassen kann:
das fell
zu klein für das, was sich unter ihm bündelt,
die batterie von muskeln, erschütternd
in seiner häßlichkeit: durch eine brille
aus blut vor den unterlaufenen augen
starrt er dich an, während ein tropfen
speichel sich von seinen lefzen abseilt.
Gleichermaßen in alle vier Himmelsrichtungen bereist Wagner die Welt in den ersten vier Zyklen von Australien – so heißt auch der ganze Band, der vierte des 1971 Geborenen – und bringt Bilder mit, die von erstaunlicher Einprägsamkeit und Tiefenschärfe sind. Mit einer ruhigen, durch alle Zeit- und Bewusstseinsschichten dringenden Aufmerksamkeit nimmt Wagner seine Umgebung wahr und lässt sie verschmelzen zu Gedichten, die immer in der Balance bleiben zwischen dem Nichtselbstverständlichen und dem Selbstverständlichen, zwischen Beobachtung und dem ins Imaginäre Ver- und Weitergesponnenen. Sei es der Traum des Murmeltiers unter der Veranda, sei es die Variation auf Paul Gerhardts Gedichtzeile „der mann wird dem baume gleich“, die man noch so oft lesen kann und nicht den Moment wird fixieren können, in dem aus dem Mann, der eben noch „rauschen / von laub im ohr“ hatte, ein Baum wird, der „seinem sturm entgegen“ wächst.
Womöglich ist das auch deshalb so herrlich unmöglich, weil Wagners Verse selbst irgendwo dazwischen schweben, zwischen vom Wind durchrauschter Leichtigkeit und im Untergrund Verwurzeltem. Ist es einerseits immer das Besondere, das Überraschende einer Beobachtung oder eines Gedankens, das in seinen Gedichten plötzlich mit umwerfender Klarheit aufblitzt, dann ist dieses Besondere doch stets aufgehoben in der Selbstverständlichkeit der Welt.
Dieses Aufgehobensein, ohne sich zu einem diffusen Einerlei zu vermengen, vollzieht auch die Sprache Wagners, die ruhig ist wie der Blick des Weltreisenden. Das Prinzip, dass die Verse sich unmerklich reimen, als würde die Welt just an dieser Stelle für einen Moment beinahe harmonisch zusammenklingen, beherrscht Wagner wie kaum ein anderer. Poetologisch wie das abschließende kann man deshalb auch das erste Gedicht dieses Bandes lesen: „ein astronom / mit einem blick am himmel und dem andern / am boden – so wahrt es den abstand / zu beiden“, heißt es über das Chamäleon, das hoch auf einem Ast sitzt, als würde es dort schon seit Jahrhunderten verweilen.
Komm herunter, rufen wir. doch es regt
sich nicht, verschwindet langsam zwischen
den farben.
Wiebke Porombka, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1.2.2011
Auf der Gorch Fock zu lesen
– Wind und Weite: Jan Wagners Gedichtband Australien. –
Im letzten Gedicht scheint Jan Wagners neuer Band Australien sein Ziel erreicht zu haben: Es heißt „australien“. Aber wo sind wir? In einer Brache, fern einer Autobahn, bei einem Abwasserrohr und Autowracks, in einem Niemandsland also, mutmaßlich am Großstadtrand. Natürlich sagt der Dichter das schöner, das Abwasserrohr überrascht „mit seinem biblischem dunkel und dem schlichten rinnsal, das es predigte“, das Autowrack ist „paläontologisch… wie ein fossil / vom lehm verschluckt“. Ein Metaphernkünstler entwirft eine Jeff-Wall-Szenerie. Sie könnte überall auf der Welt sein, aber nicht notwendig in Australien.
In diesem unmarkierten Gelände fangen zwei Jungen zu buddeln an und fragen sich, wie lange sie graben müssen „bis wir es mit felsen / zu tun bekommen würden, kohle- / flözen / und erz? wie lange, bis irgendwo ein koala // die erde sich bewegen spürte, / um etwas seltsames zu sehen: / ein loch im boden, zwei verschmierte / jungen, die bis zehn // zu zählen versuchten…“.
Erst jetzt scheint „Australien“ erreicht, indem man nach einer Grabung durch den ganzen Erdball auf der anderen Seite heraussteigt. So sind Kinderträume, und sie beginnen an irgendeinem Stadtrand, den man sich in eine mythische Abenteuerfremde zurechtfantasiert, obwohl man eigentlich nur hinter die eigene Wohnsiedlung gelaufen ist.
Jan Wagners Band hat fünf Kapitel, erst nach den vier Himmelsrichtungen benannt, das letzte dann „Australien“. Eine poetische Heimat- und Weltkunde also, die in vielen Gedichten konkrete Orte erkennen lässt, von den Hopfenfeldern in Franken bis zu amerikanischen Ebenen; manche tragen Orts- oder Ländernamen – Nicosia, Frombork, Ohio –, andere sind nach Pflanzen, Tieren, Dingen, ja nach Dichtern und Personen benannt.
Überall spricht nicht ein ausgebuffter, globalisierter Globetrotter, sondern ein neugierig-weltfreundlicher, jungenhafter Abenteurer, dem das Allernächste so aufregend schön wird wie die Welt auf der anderen Seite des Planeten.
Im Gedicht „zwetschgen“, dem wunderbaren Lobpreis spätsommerlicher Fruchtfülle, steht der Dichter „im zentrum eines ganzen baumes/ wie leonardos mann im kreis“, und er bringt den Baum so ins Zittern, dass die ganze Fruchtfülle hinabprasseln kann. Der Leonardo-Mann zeigt in alle vier Weltgegenden, die ihm ihre Schönheitsfrüchte abwerfen. Ohio:
die holzhäuser in blau und grau,
aufgewärmt von der sonne.
die grillenmaschine, die langsamer schnurrt,
und ein himmel, der für nichts wirbt als sich selbst
…
im norden liegen die großen seen,
und der wind geht durch bis nach chile.
Mit dem Wind hat es Jan Wagner überhaupt, denn der Wind zeigt „die riesenhafte Weite der Welt an, in der nur einzelne Flecken vorübergehend Heimat werden können:
die ganze nacht lang tobte der sturm
ums weiße holzhaus, zusammengehalten
von nichts als dem dünnen lampenschein
seiner zimmer.
(„vom lake michigan“).
Das Hopfengedicht erzählt vom Wachsen und Blühen über die vier Jahreszeiten, es endet in winterlicher Kahlheit und zugleich in einem Akzent von altmodischer Gemütlichkeit, erzeugt von dem Saft, den man mit dem geernteten Hopfen macht:
nur fahnenstangen bleiben.
die mondluft in den nackten dörfern
trägt das gedröhn der schenken über land.
Natürlich zeigt Jan Wagner, der junge Meister, der soeben mit dem Hölderlin-Preis 2011 ausgezeichnet wurde, auch diesmal, was er als Dichter kann, wie viele Tonfälle, Versklänge und Formen ihm zur Hand sind. Balladen zum Beispiel, im Gedicht „tätowierungen“:
die erste machte ihm ein maat,
als er auf einer matte
aus bast lag, stunden vorm beschuß
der spanischen armada…
– übrigens gern auf der „Gorch Fock“ zu lesen:
und knatternd überm fockmasttop
die knochen der piraten –,
mit einem satz ins meer hinab
die nackte haut zu retten
Wagner liebt Wörter wie „Fockmasttop“, „Dommel“ oder „Quecke“, handfeste, aber etwas entlegene, gegenständliche Ausdrücke, die sympathisch uncool sind.
Wer sich in diesen durch die Kontinente ziehenden Band vertieft – warum nicht beim Herumsitzen auf den überall gleichen Flughäfen im Warten während irgendeiner Verkehrskatastrophe? –, bekommt unweigerlich gute Laune, was nicht nur am Bilderreichtum, der Klangfülle, der schieren Wortschönheit eigentlich jeden Gedichts liegt, sondern auch an der Beigabe eines reizenden Humors, der sich am ehesten zeigt, wenn man sich die Gedichte laut vorliest.
Man mache die Probe beim Gedicht auf eine Schnecke:
die schnecke betrachten, während sie uns
kaum wahrnehmen kann, zu eilige schemen
jenseits der bühne, flüchtiges am rande
eines anderen größeren dramas,
und das heißt: schnecke.
Und als wolle Wagner zeigen, dass er alles kann, gilt gleich das nächste Gedicht dem Hagel:
hagel-
körner, aus denen nichts wachsen wird.
bis auf die kostbare stille danach,
das kühle hagelfeld der stille.
Das größere Drama, das Schnecke heißt, und die Stille nach dem Hagel: Wann hat es das in der deutschen Lyrik seit Barthold Heinrich Brockes’ Irdischem Vergnügen in Gott aus dem 18. Jahrhundert gegeben? Gewiss, immer wieder, hie und da. Jan Wagner bietet seine poetische Schöpfungsseligkeit schlanker als der voluminöse Brockes, biedermeierfrei, bubenhaft überraschend, mit begeisternder Könnerschaft. Er ist einer unserer Besten.
Gustav Seibt, Süddeutsche Zeitung, 4.2.2011
Im Auge der Qualle
Zwischen zwei Polen reimt sich Jan Wagners Gedicht-Buch Australien ins Offene, Fremde, Neue. Den einen könnte man mit Joseph von Eichendorff nennen:
Ach, wer da mitreisen könnte!
Den anderen mit Fernando Pessoa:
Nur äußerster Mangel an Einbildungskraft rechtfertigt, dass man auf Reisen geht; existieren ist reisen genug.
Romantik à la Eichendorff findet sich in dieser Wagner-Welt-Lyrik durchaus, wenngleich nicht plump-platt. Vielmehr greift der findige Dichter lustvoll intelligent zu den altehrwürdigen Registern, schaltet vielleicht sogar Demutspfeife und Tremulant zu, ergötzt sich an überlieferten Formen, die ihm so nett erscheinen, dass er sie – um formalen Ballast erleichtert – übernimmt in sein Wortwandern.
Das führt zuweilen und sehr anrührend durch die Bezirke der Kindheit, ihre verblichenen Farben und Liebesgeschichten, dann weit darüber hinaus: nach Idaho und Ohio, Nikosia, Kopenhagen, zu einer namenlosen mittelamerikanischen Missionsstation, denen jeweils eigene Gedichte gewidmet sind. Da klingt und singt und swingt es in den Wörtern, wie man es von Wagner kennt, nicht nur in seinem eigenwilligen Reim, dem er lange schon geschickte Anklangsbeine gemacht hat. Überhaupt sind seine Wörter sehr gut zu Versfuß.
Dass die Reisen des Augenblicks in Pessoas Sinn auch ohne angestrengte Fernfluchten genügen, um Welten zu entdecken, verraten die vielen Metamorphosen in den Gedichten; beispielhaft in „gecko“, wo das Tier zum Wandriss wird, zur Vulkanspalte, dann zur Speise der Ameisen, die es wimmelnd abbilden, bis das Gerippe zum Fischerbootwrack und schließlich bloß noch zum „zahnstocher im breiten maul des august“ seine Form wandelt. Auch in „steinway“ erfrischt die Vertauschung der Perspektiven die Sicht, die den Leser immer öfter animiert, selbst die produktiv verwirrende Dichter-Brille auszuprobieren.
Mit ihrer Hilfe wird ihm die animalische Vielfalt dieser Lyrik ins Auge stechen; all die Tukans, Pitbulls, Murmeltiere, Krähen, Bienen, Chamäleons, Pferdebremsen, Aale, Wisente und Eichhörnchen.
qualle
gefräßiges auge,
einfachste unter den einfachen –
nur ein prozent trennt sie von allem,
was sie umgibt.
stoße dich weiter vor
ins unbekannte: ein brennglas, geschliffen
von strömungen und wellen; eine lupe,
die den atlantik vergrößert.
Nicht nur hier scheint eine – ganz und gar nicht süßliche – Naturfrömmigkeit auf, die bestätigt zu werden scheint von den Dutzenden Pflanzen, dem Preis der Landschaften in allen vier Himmelsrichtungen und manch menschlicher Idylle.
Doch schon zu Herodots Zeiten wusste man, dass auch in Arkadien der Tod Wanderfreunde fand, und Jan Wagner weiß es immer noch, so dass er ihn mal als Freund Hein, mal als eine bös züngelnde Zerstörungslust in seinen Gedichten loslässt:
der brand wuchs schneller als ein slum
Weil ihm viel gelingt, springt ein Fehler, eine Ungenauigkeit hie und da ins Auge. Bienen leben nicht in Waben, Straßenbahnen und Reißverschlüsse ergeben ein schönes Bild, doch wären sie die Zipper, die Gleise die verbundenen Zahnreihen, und eine Toccata lässt sich leichtestens von einer Fuge unterscheiden.
Beinahe regten die dreißig freien Seiten ebenfalls zum Mäkeln an, böte das Schock Wagner-Gedichte nicht so viele Denkbilder, dass sie – einer Petersburger Hängung gleich – des Freiraums dazwischen geradezu bedürfen. Wissen wirbelt fröhlich durch die Wörter, Historien wachsen sich aus in mythische Flunkerfreude, die Tradition in China, Dänemark und Preußen-Sachsen spielt hinein, dazu die Zeitgeschichte und ein wenig Film.
Ein belebender, beflügelnder Südwind, nach dem man erst den Süden selbst und dann Australien benannte, streicht durch Jan Wagners Zeilen, eine nicht unbrisante Brise, ein klärender, Auftrieb bietender Luftstoß, der vieles mitbringt und mehr noch erzählt.
Rolf-Bernhard Essig, Frankfurter Rundschau, 6.4.2011
Die fünfte Himmelsrichtung
– Gedichtband Jan Wagner verzaubert den Leser in seinem neuen Werk Australien mit filigraner, pathosfreier Kunst. –
Am Anfang des vierten Gedichtbandes Australien von Jan Wagner stehen Verse über das Chamäleon. Über das Tier also, das seine Farbe der Umgebung perfekt anzupassen weiß; eine Fähigkeit, die sich (natürlich) übertragen lässt auf das Schreiben von Wagner, der in diesem Jahr seinen 40. Geburtstag feiert, und von dessen Gedichten einige das Zeug zu Klassikern haben. In „chamäleon“ lesen wir:
die augenkuppeln, mit schuppen
gepanzert, eine festung, hinter der
nur die pupille sich bewegt, ein nervöses
flackern hinter der schießscharte
[…]
komm herunter, rufen wir. doch es regt
sich nicht, verschwindet langsam zwischen
den farben. es versteckt sich in der welt.
Wagners Lyrik ist eine des scharfen Blicks. Stets ist die Perspektive des Sprechers distanziert und klar umrissen: „mit einem blick am himmel und dem andern / am boden“ werden voller Konzentration und Ruhe Gegenstände, Personen, Landschaften und Tiere betrachtet. Dabei wird die Subjektivität des Sprechenden nie ausgestellt, findet man kein Ich-Pathos, herrscht äußerste Zurückhaltung. Wie das Chamäleon tritt der Sprecher hinter das Angeschaute zurück, verschwindet zwischen den Klängen und Farben der Worte, öffnet Raum für die Imagination des Lesers.
58 Gedichte, die hier in vier nach den Himmelsrichtungen benannten Abschnitten und einem fünften Abschnitt „Australien“ versammelt sind, laden zu einer Sprach-Entdeckungsreise ein. Und zwar entgegen der gängigen „Nicht-ohne-Seife-Waschen“-Richtung: zuerst geht es nach Süden, der (lyrischen) Sehnsuchtsdestination schlechthin, dann auf den Spuren der Pioniere nach Westen, von dort richtet sich der Blick nach Osten, dann in Richtung des unwirtlichen Nordens, um schließlich „terra australis“ zu erkunden, jene Landmassen, die lange als Gegengewicht zu den Landmassen der nördlichen Hemisphäre betrachtet wurden. Vorgegeben wird der Richtungswechsel jeweils durch eines der Gedichte in den vorangehenden Abschnitten, ein Wort in einem Vers kündigt den neuen Kurs schon an.
Geführt wird man auf der Reise von freundlich-bestimmten Fingerzeigen. Sie deuten häufig auch auf geistes- oder literaturgeschichtlich signifikante, bisweilen auf skurrile Biografien wie in der „elegie für knievel“, die den amerikanischen Motorrad-Stuntman Evel Knievel besingt. Oder auf historische Ereignisse, wie etwa in „frombork“, das den Namen jener Stadt in Masuren trägt, in der Kopernikus lebte und an seinem Hauptwerk De revolutionibus orbium coelestium libri VI arbeitete, in dem er das heliozentrische Weltbild beschrieben hat.
So wohnt man lesend jener lyrischen Vermessung der Welt bei, die Jan Wagner seit seinem ersten Gedichtband Probebohrung im Himmel aus dem Jahr 2001 beharrlich und mit unverkennbarem Ton vorantreibt: so leichtfüßig wie handwerklich präzise und mit sicherem Gespür für kleine, wirkungsvolle Verschiebungen wird vermeintlich Vertrautes flink ins Unheimliche gewendet, wird stets die Kleinschreibung gepflegt, wodurch alle Worte gleich behandelt und zuweilen mehrdeutig werden. Assoziationsräume werden eröffnet, Kontexte aufgerufen. In „der brennende hain“ über einen Waldbrand im Abschnitt „Süden“ heißt es „nach einer weile / krähte ein hahn. ein hahn. ein hahn“ und man darf hier natürlich auch an Petrus’ Verrat („Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben!“) denken.
In Australien erweist sich Wagner zudem einmal mehr als versierter Spieler auf der Klaviatur des lyrischen Formenkanons. Der Griff zu tradierten Gedichtbauplänen erfolgt mal streng nach Ordnungsschema, etwa wenn sich unter der Überschrift „von den ölbäumen“ 15 Haiku aneinander reihen, mal spielerisch in freier Variation die Baupläne unterlaufend.
Häufig sind unreine Reime, in denen der Bezug zwischen zwei Worten klanglich hergestellt und zugleich aufgebrochen wird. Dadurch gerinnen die Formen nicht zur Pose, wirken tatsächlich als jene „Korsette, in denen man paradoxerweise freier atmen kann“, als die Wagner sie mehrfach charakterisiert hat. Und niemand braucht hier mit der kleinen Versschule gewappnet Silben und Zeilen zu zählen. Denn dass die Gedichtkörper ein Rückgrat haben, das die Worte stützt und trägt, dass hier jemand an der Sprache präzise gefeilt und poliert, seine Anordnungen genau geprüft hat, wird man ohnehin zur Kenntnis nehmen.
Konkret in ihrer Anschauung und kunstvoll in der Struktur sind diese Gedichte ausbalancierte Wahrnehmungsinstrumente und Zeugen von Wagners vielfach gelobtem, poetischem Vermögen, das in seiner Zeit stehend aus ihr hinauszuragen scheint. So viel ausgeruhte Zurückgelehntheit könnte ein bisschen beängstigend wirken, den Verdacht der Sterilität oder den Wunsch nach stärkerer Auflehnung gegen die Tradition aufkommen lassen. Doch die erneute Probe aufs Exempel, etwa mit dem Gedicht „murmeltier“, lässt die Zweifel vergessen: „einsam in seinem palast aus erde und dunkel“ und im Winterschlaf „sechs monate zusammen- / gerollt zu einem fast perfekten kreis“ erfährt das scheue Tier eine meisterhafte Charakterisierung, wird zum Sinnbild wachträumender, mal betriebsamer, mal innehaltender Eremitenhaftigkeit.
Dass Australien ein Zitat des portugiesischen Großmeisters Fernando Pessoa alias Álvaro de Campos aus dessen Gedicht „Oxfordshire“ vorangestellt ist, verortet Wagners Dichtung an einem nicht erreichbaren, aber dennoch zu suchenden Ort, ohne den die Welt trostloser wäre. Es ist quasi die fünfte Himmelsrichtung, das utopische Terrain der Poesie, das es Dichtern und Lesern zu behaupten und zu erkunden gilt: „Man ist glücklich in Australien,/sofern man nicht dorthin fährt“. So ist zwar nach der Lektüre von Australien – um noch einmal Álvaro de Campos zu zitieren – „die Ferne nach wie vor da, wo sie war“. Dennoch haben diese Gedichte, ent- und neu verzaubernd, den Blick darauf verändert.
Beate Tröger, der Freitag, 22.1.2011
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Gisela Trahms: In alle Himmelsrichtungen und darüber hinaus
culturmag.de, 1.12.2010
Stefan Höppner: Der fernste Ort
literaturkritik.de, Mai 2011
Christian Dinger: Der Verkleidungskünstler
litlog.de, 29.5.2013
Hans-Dieter Fronz: Austern in Austerlitz
Badische Zeitung, 24. 12. 2010
Richard Pietraß: Im Reich der Gegenfüßler
Der Tagesspiegel, 26. 12. 2010
Himmelsbohrungen
– Laudatio zur Verleihung des Hölderlin-Preises an Jan Wagner am 21. Oktober 2011 in Tübingen. –
Die Ehre, die Laudatio zum Tübinger Hölderlin-Preis zu halten, verschafft mir das Vergnügen, über einen der besten unserer jungen Dichter zu sprechen, über Jan Wagner. Denn Wagner ist, bei allem was er sonst ist, nämlich Kritiker und Übersetzer englischer Lyrik, vor allem eines: jemand, der Verse, wirkliche Verse schreibt, keinen Flattersatz. Er ist Dichter. Daran will ich mich halten.
Vom Dichter sagt man gern und etwas mitleidsvoll, er sei ein König ohne Land. Ist er das wirklich? Ich scheue mich nicht, auf einen schlichten Merkspruch zurückzukommen, den man früher gern zitierte:
Wer den Dichter will verstehen, muß in Dichters Lande gehen.
Soll heißen: der Dichter besitzt Land, Lande gar. Ich will gar nicht erst fragen, was Hölderlins Land ist (Schwaben? Griechenland?), sondern die Frage auf Jan Wagner beziehen und gleich beantworten: Jan Wagners Land, behaupte ich keck, ist Australien.
Australien – so jedenfalls lautet der Titel seines neuesten, seines vierten Gedichtbandes. In ihm durchstreift er die bekannten vier Himmelsrichtungen und schließt – als gäb’s eine fünfte Richtung – mit Australien.
Jan Wagner ist in Hamburg geboren, und das liegt bekanntlich bei Wandsbek und seiner Chaussee. Doch anders als Ringelnatzens reisesüchtigen Ameisen taten ihm zu Wandsbek nicht die Füße weh. Wie also ist er überhaupt nach Australien gelangt? Diese Frage hat schon die Kritik beschäftigt, die Wagners Australien-Band enthusiastisch begrüßte. Mindestens drei Rezensenten wollten sich vergewissern, ob Jan Wagner dort gewesen oder angekommen ist. Alle drei behandeln das Titel-Gedicht vom Schluß des Bandes. Es beginnt:
wir fingen mittags an:
wo sich die brücke in der brache
verlor, von fern, die autobahn:
durch ein kaleidoskop zerbroche-
ner flaschen,
ein wurzelwerk von quecken
und alten teppichen versteckt
hinter dem flüßchen,
dem abwasserrohr mit seinem biblischen
dunkel und dem schlichten
rinnsal, das es predigte.
wir gruben. (…)
Wer ist es, der hier zu graben anfängt in einer spätzivilisatorischen Abfall-Landschaft nahe einer Autobahn? Es sind – erfahren wir in der vorletzten Strophe – „zwei verschmierte jungen“. Und wie und wonach graben sie? Sie graben, „bis wir es mit felsen / zu tun bekommen würden, kohle- / fläzen / und erz? wie lange noch, bis irgendwo ein koala / die erde sich bewegen spürte“.
Soll heißen, sie sind bei den Koalas angekommen, in Australien also. Sie gruben, um eine Landnahme zu bewerkstelligen – eine imaginäre Landnahme, für die als Symbol ein Spaten im Boden steckt – quasi als Fahnenmast. Graben als poetisches Tun. Es ist die Poesie, die uns in die fünfte Himmelsrichtung führt, auf die andere Seite des Globus.
Der Geist ist ein Wühler, sagt Jacob Burckhardt; der Poet ein Bohrer, sagt Jan Wagner. Dichten als Bohren – das ist ein Motiv, das ihn von Anfang an begleitet. Sein allererster Gedichtband, 2001, also vor zehn Jahren erschienen, trug den Titel probebohrung im himmel. Und so fange ich bei Wagners Anfang an, mit meinen eigenen Bohrversuchen.
Das Gedicht, das den Titel für die Probebohrung liefert, gibt sich als Reiseeindruck einer Bahnfahrt. Es heißt „Hamburg-Berlin“:
der zug hielt mitten auf der strecke. draußen hörte
man auf an der kurbel zu drehen: das land lag still
wie ein bild vorm dritten schlag des auktionators.
ein dorf mit dem rücken zum tag. in gruppen die bäume
mit dunklen kapuzen. rechteckige felder,
die karten eines riesigen solitairespiels.
in der ferne nahmen zwei windräder
eine probebohrung im himmel vor:
gott hielt den atem an.
Was als Reiseeindruck erscheint, ist so schlicht wie raffiniert. Die Raffinesse steckt in den Bildern und Metaphern. Wenn draußen – außerhalb des Zuges – nicht mehr an der Kurbel der Bahnschranke gedreht wird, tritt Stille ein: sie erinnert an jene stills, die der Kinematograph erzeugt. Auch die zweite Strophe wendet die Landschaftseindrücke in die Stille, in das Bild eines Solitärspiels. Das Dorf, die Kapuzen-Bäume, die Felder sind Spielkarten, eben: „die karten eines riesigen solitairespiels“. Strophe 3 aber bringt die metaphysische Pointe von den Windrädern, die eine Probebohrung im Himmel vornehmen. In dieser Metapher kollidiert unsere Technologiehybris mit dem Gottesgedanken.
Wagner verschärft die Dialektik von Fortschritt und Metaphysik in seinem zweiten Band, in Guerickes Sperling (2004). Sie kennen ihn: Otto Guericke (1602–86), Bürgermeister von Magdeburg, erfand unter anderem die Luftpumpe. Sie kennen sein Experiment mit den luftleer gepumpten Halbkugeln, die von zweimal acht Pferden nicht auseinandergerissen werden konnten – als Nachweis der Macht des atmosphärischen Luftdrucks. Hier der Eingang des Titelgedichts, das einen ins Vakuum einer Glaskugel gesperrten Sperling zeigt:
hier sitzt
der sperling, der wie eine weingeistflamme
zu flackern angefangen hat – die luft,
die immer enger wird.
Der Schluß kommt auf den Sperling zurück: „dieser tote sperling“, flüstert einer, „wird noch durch einen leeren himmel fliegen.“ – Eine frappierende Wendung. Die atmosphärische Leere der Vakuumpumpe wird zur Analogie der metaphysisch entleerten modernen Welt. Mit Gottfried Benn zu sprechen: zum „leeren Raum um Welt und ich“.
Jan Wagner als Analytiker einer durchrationalisierten technischen Welt, als metaphysischer Dichter – das ist erst der halbe Wagner. Denn Kritik und Metaphysik ergreifen uns nur dort, wo der Gedanke sinnlich wird und wir die Fülle der Welt erfahren. Wagner ist ein Dichter solcher Fülle. Sein dritter Band bringt für alles, was man vermissen könnte, vollgültigen Ersatz. Schon der Titel ist hedonistisch: 18 Pasteten (2009).
Achtzehn Pasteten also. Das legt nahe, daß Wagner weder den Genuß scheut noch den Vorwurf des Kulinarischen. Er macht den biedermeierlichen Freiherrn von Rumohr zum Eideshelfer des eigenen Metiers. Über den titelgebenden Zyklus setzt er einen Satz aus Rumohrs Geist der Kochkunst:
Es läßt sich alles Ersinnliche zu Pasteten verwenden, und in der Zusammensetzung derselben kann ein braver Koch recht deutlich zeigen, daß er Einbildungskraft und Urteil besitzt.
Wagner zielt mit seinen Pasteten auf ein traditionsreiches literarisches Genre, auf pastiche und pasticcio, die ihre Herkunft aus den romanischen Küchen nicht verleugnen. Auch hier geht es um das Nachkochen, um die Mischung der Zutaten. Literarisch meint das: Stil-Nachahmung als Mystifikation oder Huldigung. Proust sah solche Imitation als „Purgativ“. Er schrieb pastiches, um seinen persönlichen Stil zu finden. Man weiß, mit welchem Erfolg. Und Jan Wagner? Was füllt er als „braver Koch“ in welche Formen? Wie groß ist die Skala seiner Kochkunst? Sein Repertoire reicht vom Nachkochen bis zu eigenständigen Kreationen. Er scheut auch nicht das Nachschreiben großer Vorbilder. So ist sein Sonett vom „schläfer im wald“ ein Remake des berühmten Sonetts „Le dormeur du val“ von Arthur Rimbaud. Rimbaud schrieb das Gedicht im Oktober 1870, während des Deutsch-Französischen Krieges. Wagner zeigt den wie schlafend in Kraut und Gras liegenden Soldaten nicht mit den zwei Einschüssen auf der rechten Seite. Er schließt mit der Zeile: „ein rosenstrauß an seine brust gepreßt“. Einzig dieses Bild erinnert an die zugefügte Gewalt. Ästhetisierung des Schreckens? Erpreßte Versöhnung?
Versöhnung schon. Um die geht es Wagner. In seinem Gedicht „dezember 1914“ liefert er einen Bericht über die spontane Versöhnung deutscher und englischer Soldaten zwischen den beiderseitigen Schützengräben – die Vision eines Austauschs, in dem nichts „zu tauschen übrig blieb außer den gräben / im rücken und ihrem namenlosen hunger“.
Diesem namenlosen Hunger korrespondiert bei Wagner die Suche nach dem sinnenhaft Dinglichen. „Dinge machen aus Angst“ war einst Rilkes Devise. Wagner nimmt das existentielle Vibrato weg. In seinen Ding-Gedichten ist er ein mit heiterer Neugier ausgestatteter Beobachter. Beschreiben ist reiner Genuß, Skepsis sein Regulativ. Wagners Dinge sind Kunst-Dinge, auch wenn sie als Tiere, Steine oder Landschaften erscheinen. Wo die Naturphänomene grob oder überproportioniert wirken, bringt die Finesse des Autors sie aufs gewünschte Format. Er nimmt es keck mit dem Nashorn auf und ermutigt uns, desgleichen zu tun. Haben wir uns an das grobschlächtige Tier gewöhnt, setzt er seine Pointe. Er appliziert einen kleinen Vogel, den Buphagus, „den es auf seinem rücken balanciert / wie ein stück sèvreporzellan, / ein mokkatäßchen, überraschend zart“.
Ist nicht auch der Dichter solch ein Vogel, der auf der plumpen Materie balanciert – und sich schmarotzend von ihr ernährt? Es verwundert nicht, wenn wir bei Wagner immer wieder auf Eßbares, Nahrhaftes stoßen. Die letzte der achtzehn Pasteten ist eine „quittenpastete“. Sie folgt dem Weg der Quitten übers Entkernen und Entsaften bis in die bauchigen Gläser „für die / dunklen tage in den regalen aufge- / reiht, in einem keller von tagen, wo sie/ leuchteten, leuchten“.
Was hier als stille Reserve für kommende dunkle Tage lagert, ist in bauchige Gläser gefaßt, hier in die Form einer antiken Ode. Was bleiben soll – so könnte man Hölderlins vielzitierten Vers über das Stiften paraphrasieren –, konserviert der Dichter. Konserviert es in klassischen Formen oder doch in solchen, die alte Formen aufrauhen und aufbrechen.
Einen poeta doctus hat man ihn genannt. Wagner wird das Etikett weiter tragen müssen. Das Lob, das darin steckt, klingt ambivalent. Es kaschiert oft nur den blanken Neid. Wagner kann viel, und er ist klug genug, um zu wissen, daß man nicht alles können kann. Er spart am volltönenden Reim, er liebt die Anklänge, Halbreime, Assonanzen. Er paart „spitzen“ mit „schwitzend“, „zigaretten“ mit „ratten“. Ja, er foppt uns mit dem bloßen Augenreim: „Leuten“ – „Aleuten“ – man muß es zweimal lesen! Er brilliert in einer der schwierigsten Formen der Lyriktradition, in der Form der Sestine, die den Dilettanten einschnürt und den Meister befreit. Wagner schreibt auch Sonette, Terzinen, Villanellen, Haikus und, wie erwähnt, Oden. Wenigstens eine will ich zum Schluß zitieren – und dies ihrer Schönheit, nicht der bloßen Kunstfertigkeit wegen:
SUPALPINE MEDITATION
eine krähe strich über wipfel fort und
kehrte wenig später als flugzeug wieder.
auf dem schrägen wiesengrund schob ein
stier sein
aaaaaschwarz durch den mittag.
still das dorfmuseum, das in erwartung
letzter dinge ruhte (das dielenknarren);
tief im see die fahrschiffe mit den schweren namen der kaiser.
mit dem licht erloschen die schafe, traten
berge in ihr dunkel zurück, hoch oben
kreisten satelliten, durchforschten den geklöppelten himmel.
Man könnte dies – mit Hölderlin – eine „Abendphantasie“ nennen, eine Phantasie, die eine bukolische Landschaft von Wiese und Wald mit Flugzeugen und Fährschiffen bestückt und droben die Satelliten als Agenten unserer Himmelsbohrungen kreisen läßt. Das alles gefaßt in eine sapphische Strophe, die dem Schrittmaß der Sprache eine Ruhe und Würde verleiht, die das Aktuelle transzendiert. „subalpine meditation“ ist eine sapphische Ode wie Hölderlins „Unter den Alpen gesungen“. Hölderlin schrieb diese seine einzige sapphische Ode im Frühjahr 1801 im schweizerischen Hauptwil. Darin sucht er im Angesicht der bukolischen Landschaft die „Heilige Unschuld“ unter den Menschen und Erscheinungen. Die Ode endet mit einem Rekurs auf den Dichter und seinen Beruf:
Frei will ich, so
Lang ich darf, euch all’, ihr Sprachen des Himmels!
Deuten und singen.
Deuten und singen – das tut auch Jan Wagner. Einige unserer besten Literaturpreise stehen unter dem Patronat großer Dichternamen. Auch dieser. Das verführt die Laudatoren und kann die Dichter beschweren. Heute und hier ist der Laudator frei und glücklich. Jan Wagner, der sich nie explizit auf Hölderlin beruft, hat teil an jener hölderlinschen Freiheit der Sprachen, seien sie des Himmels oder der Erde. Ihm gebührt Lob und Dank.
Harald Hartung, Sinn und Form, Heft 3, Mai/Juni 2012
Denis Scheck trifft Jan Wagner in Druckfrisch.
Jan Wagner liest bei faustkultur.
Poetry Crossings: Jan Wagner, Monika Rinck, Alistair Noon und Adrian Nichols lesen im Studio Niculescu am 15.4.2011 ausgewählte Gedichte und übersetzen sich gegenseitig.
Salon Holofernes – mit Jan Wagner. Judith Holofernes spricht mit Künstlern über das Kunstmachen.
Ein Gedicht und sein Autor: Ursula Krechel und Jan Wagner am 17.7.2013 im Literarischem Colloquium Berlin moderiert von Sabine Küchler.
Fakten und Vermutungen zum Autor + Homepage +
KLG + AdWM + IMDb + PIA +
DAS&D + Georg-Büchner-Preis 1 & 2 + Arno-Reinfrank-Literaturpreis
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Galerie Foto Gezett 1 + 2 +
Dirk Skibas Autorenporträts
shi 詩 yan 言 kou 口
Jan Wagner liest in der Installation Reassuring Synthesis von Kate Terry aus seinem neuen Gedichtband Australien im smallspace, Berlin.


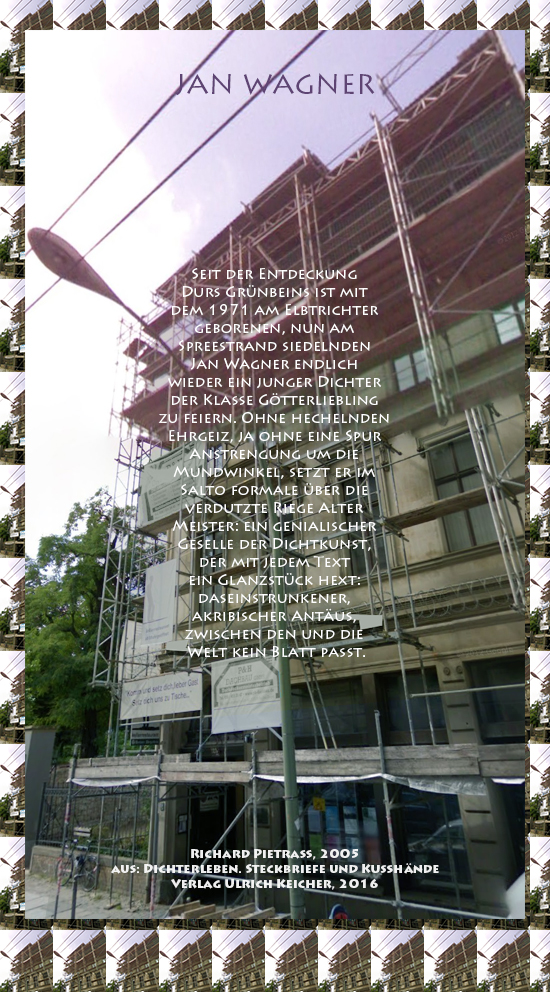












Schreibe einen Kommentar