Kerstin Hensel: Gewitterfront
ZITAT CZECHOWSKI
Noch auf dem Sterbebett werde ich
Nicht erwachsen sein.
Sagts und krault sich
Die Zähne: die müssen all bald raus! Sagts
Und zieht die Un-Leidlichen
Leute vom Spielbrett herunter und deckt sich
Gut zu.
Sinnlichkeit und Spielfreude,
starkes Gefühl und dessen ironisch-verzwickte Rücknahme kennzeichnen die vielgestaltige Dichtung der Kerstin Hensel. Aus einer literarischen Hoffnung ist längst die Gewißtheit einer unverwechselbaren Stimme geworden.
Mitteldeutscher Verlag, Klappentext, 1991
Beitrag zu diesem Buch:
Peter Leistenschneider: Spiegelfrau und Rapunzel
Freitag, 13. 9. 1991
„Mein Thema ist die Dummheit –
die gibt es auch heute nicht zu knapp…“
Karl-Heinz Jakobs: Diese Konferenz über Chancen für eine humane Gesellschaft vergangenen Herbst in Prora, warum haben Sie an ihr teilgenommen?
Kerstin Hensel: Die Mischung der Leute hatte mich interessiert, die ich auf der Einladungskarte las: Kant und Neutsch auf der einen Seite, Zwerenz und Jakobs auf der anderen. Und dann natürlich, weil ich gerne etwas über unsere Chancen erfahren hätte.
Jakobs: Und haben Sie es erfahren?
Hensel: Nein. Es glich wohl alles eher einem Hahnenkampf.
Jakobs: Die Kulturkämpfe in der DDR haben Sie selbst wohl nicht miterlebt…
Hensel: Anfang der achtziger Jahre herrschte schon die gemilderte Form. Ich habe mich von Anfang an auf meine Arbeit konzentriert. Ich bin ein sogenanntes Mauerkind: 1961 geboren, bin mit der Mauer aufgewachsen und kannte nichts anderes.
Jakobs: FDJ?
Hensel: Ja, natürlich. Ohne die lief ja nichts.
Jakobs: Haben Sie der DDR eine Chance gegeben?
Hensel: Sowas fragt man sich als Kind natürlich nicht. Aber als ich zu denken begann, spürte ich, daß da was nicht stimmen konnte. In der Schule wurde uns ein freundliches Bild von der Lage im Land gegeben, das im Widerspruch zu den Realitäten stand. Was wurde da zum Beispiel über Denken und Trachten der Jungen Pioniere geschwatzt, das keinen Bezug zum Leben hatte: Ein Junger Pionier ist ehrlich, fleißig und hilfsbereit…
Jakobs: Das sind alte Pfadfindertugenden…
Hensel: Auch biblische. Und was war? Die Kinder hatten gar keine Motivation, ehrlich, fleißig und hilfsbereit zu sein. Wenn einer seine Meinung sagte, wurde er zurechtgewiesen.
Jakobs: Nun hätten Sie aber mit gutem Beispiel vorangehen können.
Hensel: Für den Preis der Klassenkeile, ja.
Jakobs: So gerüstet traten Sie in die Literatur ein und machten Ihre Bilderbuchkarriere.
Hensel: Ich?
Jakobs: Ja, steht in einem Artikel über Sie.
Hensel: Daß da geschrieben steht, ich hätte eine Bilderbuchkarriere gemacht, versteh ich bis heute nicht. Was ist denn damit gemeint?
Jakobs: Daß Sie gefördert wurden, Geschrieben: veröffentlicht, gute Kritiken…
Hensel: Das stimmt nicht. Auf die erste Veröffentlichung habe ich wie jeder andere Jahre warten müssen. Mir ist es gegangen wie allen, daß die Hälfte meiner Gedichte, Prosaarbeiten und Bühnenstücke ungedruckt blieben. Und meine ersten – allerdings nicht öffentlichen – Kritiken waren haarsträubend: Sie stempelten mich ab von „entartet“ bis „faschistisch“.
*
Jakobs: Und so auf Vordermann gebracht, machten Sie dann das, was ich vorhin nannte…
Hensel: Eins stimmt: Ich habe sehr früh ein Poesiealbum bekommen. Drei Jahre danach einen ordentlichen Gedichtband. Aber erst 1989 ging es mit dem Erzählband weiter, dann allerdings in bestimmter Regelmäßigkeit… Mein ursprünglicher Beruf aber war Krankenschwester in der chirurgischen Abteilung…
Jakobs: Wie? So richtig mit: „Skalpell“ – „Tupfer“ – „Zange!“?
Hensel: Ich habe die Arbeit mit Freude ausgeführt. Das ist ein bodenständiger Beruf. Man kann das Ergebnis seiner Arbeit gleich absehen: Das Bein, das angenäht wurde, wuchs wieder an, die Wunden schlossen sich. Das ist ein anderes Gefühl als heute, wenn man seine Bücher auf dem Müllhaufen wiederfindet.
Jakobs: Aber den Weg von der Krankenschwester zur Lehrbeauftragten sehe ich immer noch nicht.
Hensel: Das ist dem schon fast göttlichen Zufall zu verdanken, daß ich 1987 Karl Mickel kennenlernte. Dozent an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin. Durch ihn wurde ich in das Fach „Deutsche Verssprache und Versgeschichte für Schauspieler“ eingeführt.
Jakobs: Wann haben Sie denn das studiert?
Hensel: Vieles weiß ich von Mickel, vieles weiß ich aus der eigenen Arbeit, anderes aus der Literatur- und Bühnepraxis…
Jakobs: Und sie selbst schreiben gebundenen wie ungebundenen Vers…
Hensel: Richtig. Und daß ich strenge Verse schreibe, wird mir mancherorts übel angekreidet. Weil: In strengem Vers zu schreiben ist im Sinne west-deutscher Vers-Unkultur nicht modern. Reimen und Versmaß werden als altmodisch, als stalinistisch verschrien. Auf der einen Seite wird mir eine Bilderbuchkarriere nachgesagt, auf der anderen Seite, daß ich auf dem Gebiet des Verses eine Stalinistin sei. Weil ich ab und zu auch in regelmäßigen Versen und gereimt schreibe. Das macht man nicht. Das gehört sich nicht.
Jakobs: Sie schreiben also Sonette…
Hensel: Selbstverständlich. Wenn ich das richtige Thema habe.
Jakobs: Auch Alexandriner?
Hensel: Einmal, als Parodie, anders geht das heute nun wirklich nicht…
Jakobs: Georg Maurer erzählte mal, daß in seiner Jugend „Dem Bürger fliegt vom spitzen Kopf der Hut!“ der Leitvers seiner Generation gewesen sei. In meiner Jugend war es: „Wer baute das siebentorige Theben?“ Gibt es für Sie etwas ähnliches?
Hensel: Vielleicht: „Wer, wenn ich schriee, hörte mich denn…“
Jakobs: Nach „Ihrer Generation“ zu fragen hab ich mich nicht getraut…
Hensel: Das hängt sicher damit zusammen, daß Maurers Generation oder Ihre noch literarische Leitbilder hatten, die in derselben Zeit lebten. Hinzu kommt, daß Georg Maurer für die Generation der heute fünfzig- und sechzigjährigen Lyriker in der DDR ein Lehrer war, der einen Kreis um sich geschart hatte. Das haben wir heute nicht. Ich persönlich kann zwar Mickel in einigen literarischen Fragen als meinen Lehrer ansehen, aber das ist Zufall und gilt nicht für andere. Bei den Leuten Ihres Alters in der DDR spüre ich immer wieder, daß da untereinander trotz aller Feindseligkeiten von „meiner Generation“ die Rede ist. Das ist bei mir und „meiner Generation“ nicht mal in Ansätzen vorhanden.
Jakobs: Dann sprechen wir von Ihrem „Lebensgefühl“…
Hensel: Mein „Lebensgefühl“, vorausgesetzt, es gäbe so etwas, wäre: Ich lebe gern, arbeite gern und… Ich weiß, solche Gefühle entsprechen nicht dem allgemeinen Zeitgeist… Was soll ich sagen: Ich schreibe auch gern.
Jakobs: Und wieso nennen Sie die alte BRD eine Hit- und Plundergesellschaft?
Hensel: Das war eine Provokation…
Jakobs: Oder war es Neid?
Hensel: Worauf?
Jakobs: Weil Sie so spät in den Genuß des westlichen Überflusses gekommen sind…
Jakobs: Nein. Selbst als Kind oder als Teenager, da man ja anfällig für Modisches ist, habe ich dieses Gefühl von Besitzen-Wollen nie gehabt. Der Schnickschnack des Westens hat mich nie interessiert. Während andere in meinem Alter Levis hinterhergelaufen sind, habe ich keine Niethosen getragen, und das nicht mal aus Bewußtsein. Ich bin kurz vor dem Fall der Mauer im Westen gewesen und habe gesehen, was es da alles gab, bei dem meine Landsleute später reihenweise umgefallen sind vor Begeisterung. Ich habe das nie begriffen… Den Satz, den Sie vorhin zitierten, habe ich in einem Zusammenhang gesagt, als es ums Vergleichen mit der DDR ging. Da habe ich das überspitzt herausgehauen, weil andererseits auch die DDR heute mit Schlagwörtern runtergemacht wird. Nun werden Sie mir vielleicht Arroganz nachsagen: Aber auch heute will ich nicht so leben, wie man in Westdeutschland lebt. Nicht aus Bockigkeit, sondern ich finde im Westen keine Werte, die ich bisher vermißte und die ich unbedingt haben müßte… Sehen wir mal von bestimmten kulinarischen Dingen ab… Am West gibt es nichts Erstrebenswertes, das ich noch erreichen möchte.
*
Jakobs: Gab es denn in der DDR so viele Werte, die einen ausfüllten?
Hensel: Für mich schon. Für mich, was ganz wichtig war, und was durch nichts zu ersetzen ist, war das mein Freundeskreis, der mir glücklicherweise bis heute erhalten geblieben ist. Wir waren ständig im Widerspruch zur DDR, nur nicht so populistisch-prominent… Wir haben alles verlacht… Andere Freundschaften gibt es längst nicht mehr, weil sich herausgestellt hat, wer da alles bei der Stasi war. Unter meinen Freunden nicht ein einziger…
Jakobs: Und Ihre Akte?
Hensel: Es gab zwei Anwerbungsversuche, und beide schlugen fehl. Ich erhielt das Prädikat: „Untauglich!“ In Karl-Marx-Stadt das erste Mal: Eines Tages besuchten mich zwei junge Männer. Die sahen aus wie lebendig gewordene Klischees von Agenten: schwarze Lederjacken, schwarze Schirme… Es hatte geregnet an dem Tag… Wir sind von der Staatssicherheit. Wir haben gehört, daß sie Autorin sind und begabt. Bei uns im Amt gibt es so viele dumme Menschen. Wir möchten gerne mit Leuten Kontakt bekommen, die sich mit jungen Schreibenden zu unterhalten verstehen. Wollen sie nicht bei uns mitmachen?… Darüber war ich so erschrocken, vor allem, weil sie mir so direkt ein Beispiel ihrer eigenen Dummheit gegeben hatten, daß ich spontan „Nein!“ sagte. Die kamen nie wieder… Und in Leipzig war es ähnlich.
Jakobs: Wieso sind die gerade auf Sie gekommen?
Hensel: Meine erste Geschichte, die ich in der Öffentlichkeit vorgelesen hatte, war auf massive böse Kritik bei den Kulturfunktionären gestoßen. In einem so kleinen Ort wie Karl-Marx-Stadt verbreitet sich sowas wie ein Lauffeuer. Und da dachten die wohl, mit mir, einer „Kritisierten“, in dissidentische Kreise zu gelangen…
Jakobs: Worum ging es denn in Ihrer Story?
Hensel: Sie hieß: „Die Katzen“ und handelte von einer alten und einsamen Frau, die stirbt, weil sich niemand um sie kümmert, und da sich auch niemand um die Katzen kümmert, krepieren auch sie…
Jakobs: Nun können Sie schreiben was sie wollen, oder ist Ihnen durch den Zusammenbruch der DDR Ihr Thema genommen?
Hensel: Nein, Ich weiß, das viele Kolleginnen und Kollegen klagen: Mein Thema ist weg! Mein Thema war nie die DDR, und ich habe mich auch nie als DDR-Schriftstellerin gefühlt. Mein Thema ist die Dummheit. Um Dummheit darzustellen, brauche ich nicht die DDR. Dummheit ist grenzüberschreitend, und sie gibt es auch heute und hier und wahrlich nicht zu knapp.
Neues Deutschland, 22.1.1993
Gespräch mit Kerstin Hensel
– Birgit Dahlke führte am 12.1.1993 in Berlin das folgende Gespräch mit Kerstin Hensel. –
Birgit Dahlke: Du hast in den letzten beiden Jahren der DDR jeweils ein Buch veröffentlichen können, warst Du demnach nicht zu inoffizieller Publikation gezwungen? Auch in Leipzig wurden inoffizielle Zeitschriften herausgegeben. Deine surrealistische Prosa hätte doch da ganz gut hineingepaßt. Warum fehlt Dein Name darin?
Kerstin Hensel: Diese Hefte kursierten natürlich, auch am Literaturinstitut, aber mich hat das damals nicht so interessiert. Und ich habe die auch nicht interessiert, ich war in dem Kreis einfach nicht drin. Wenn ich drin gewesen wäre, hätte ich da sicher auch veröffentlicht, da spielt der Zufall eine Rolle.
Dahlke: Nur der Zufall? Nicht politische Differenzen?
Hensel: Sicher, ich hatte auch eine andere Schreib- und eine andere Lebenshaltung.
Dahlke: Es spielt sicher auch hinein, daß Du weniger Kontakt mit Deiner eigenen Generation hattest als vielmehr mit Dichtern und Malern der älteren Künstlergeneration…
Hensel: Ja. Die „älteren“ waren mir von der Schreibhaltung her näher. Was mich damals interessierte, war Goethe, Hölderlin, Kleist, Grass, Büchner…
Ich würde meine Nichtbeteiligung auch gar nicht vorrangig politisch sehen. Ich hatte eine andere Lebenshaltung als die Leute aus dem Kreis um die inoffiziellen Zeitschriften, ich hatte nicht diese „abgefuckte“ Lebenshaltung. Ich hab’ nicht extrem, nicht exzessiv gelebt und konnte es auch nicht, wollte es nicht. Dieses völlige Verdammen, dieses völlige Gegen-Sein, das war nicht Meins. Erstens, weil ich ein Kind hatte und nicht immer am Rande des Selbstmords leben konnte, oder am Rande des Alkoholismus, was ja immer mit diesen Gruppen verbunden war. Ich hatte einfach ein anderes Lebensgefühl, das war nicht feiner oder lieblicher, es war auch tief verzweifelt an vielen Stellen, aber es war nicht das einer Gruppe.
Dahlke: Als Kutulas Dich zur Mitarbeit an seiner Zeitschrift einlud, hast Du das ja auch getan, an der Karl-Marx-Städter inoffiziellen Zeitschrift A3 warst Du ebenfalls beteiligt.
Kanntest du auch keine Frauen aus dem Berliner oder Leipziger Kreis?
Hensel: Überhaupt nicht. Ich kannte überhaupt ganz wenig schreibende Frauen.
Dahlke: Ist Dir das damals aufgefallen, war es ein Verlust?
Hensel: Eine ganz wichtige Frau war für mich Gabriele Berthel. Sie schrieb auch Gedichte, war aber nicht populär, bewegte sich nicht in „höheren“ Dichterkreisen. Sie war sowas wie meine Lehrerin, und meine Freundin. Und Freundinnen hatte ich natürlich schon, aber wenig schreibende. Ich habe mich auch nicht darum gekümmert, habe es immer auf den Zufall ankommen lassen.
Dahlke: Wie ist es mit literarischen Vorbildern, gab es da Dichterinnen? Ich habe zweimal in Rezensionen einen Hinweis auf Bachmann gelesen.
Hensel: Als ganz junges Mädel gefiel mir, was die Bachmann schrieb. Inzwischen hat sich das sehr, sehr relativiert, vor allem in bezug auf ihre Prosa. Es gibt nach wie vor einige Gedichte, die ich außerordentlich gut finde, aber ich bin von dieser weinerlichen Haltung der Bachmann, die auch Mode war, völlig abgekommen. Hier von einer Tradition zu sprechen… Ich gebe zu, sie hat mich eine Weile beeinflußt, aber ich habe das, denke ich, doch ziemlich abgeschüttelt, jedenfalls ist das mein Gefühl.
Dahlke: Kannst Du Deine Beziehung dazu noch etwas näher beschreiben?
Hensel: Ich habe versucht, mich damit auseinanderzusetzen, z.B. in „Ulriche und Kühleborn“, meiner Erzählung, die sich ja unmittelbar mit der Bachmann-Erzählung „Undine geht“ beschäftigt. Da habe ich versucht, mich mit der Haltung auseinanderzusetzen und eine andere dagegenzusetzen. Also kann man sagen, daß sie mich beeinflußt hat, und wenn als Gegensatz. Mit Malina und anderem ist es so: da ich immer mehr zur komischen Weitsicht gelangte, was die Bachmann nie tat, ergab sich eine Distanz.
Dahlke: Du bist eigentlich auch die einzige schreibende Frau, die ich kenne, die komisch, satirisch arbeitet.
Hensel: Ja, ich kenne auch keine sonst, jedenfalls nicht im Lande. Ich fühl’ mich auch ein bißchen allein auf weiter Flur, nicht direkt einsam, aber… Na gut, die Jelinek ist vielleicht eine, die mit ähnlichen Mitteln arbeitet, wo es nicht diese totale Weinerlichkeit gibt. Das ist was, wo ich mich wenigstens provoziert fühle, auch nicht angezogen, aber provoziert.
Dahlke: Gibt es sonst noch irgendwelche Dichterinnen, die Dich interessieren?
Hensel: Daß mich die Morgner sehr interessiert hat, ist klar. Aber ich muß auch sagen, daß ich die Morgner erst spät kennengelernt habe, erst nach Hallimasch. Da merkte ich, hier gab es schon mal eine Frau, die mir künstlerisch näher war. Frauen, die mich sonst noch begeistern, sind Barock-Dichterinnen, da könnte ich ja ins Schwärmen geraten: Catharina Regina von Greiffenberg z.B., die ich schon lange gern herausgeben möchte, doch kein Verlag zieht mit. Oder die Österreicherin Christine Lavant. Das sind für mich bedeutende Leute. Sie sind aber nicht sehr bekannt, weil sie Ausnahmen sind, keine Richtungen bestimmen.
Dahlke: Wodurch bist Du auf sie gestoßen?
Hensel: Auf Christine Lavant bin ich durch Karl Mickel gestoßen, der vor Jahren mal einen Lavant-Abend mit der Schauspielerin Christine Gloger gemacht hat.
Dahlke: Noch mal zurück zum Kreis um die inoffiziellen Zeitschriften. Es gab ja in diesem Kreis ein ausgeprägtes, auch bewußt kultiviertes Aussteigerbewußtsein. Ich denke mir, daß sie Dich als „etabliert“ abgeschrieben hatten, als eine, die Auszeichnungen bekam (1983 das Becher-Diplom des Kulturbundes, 1987 das Seghers-Stipendium der Akademie der Künste), die ja immerhin in Sinn und Form veröffentlichen konnte. Kannst Du Dich erinnern, wie es zu Deinen ersten Veröffentlichungen, z.B. in Temperamente 3/1983, gekommen war? Da warst Du ja immerhin erst 22. Mit 27 erschien Dein erstes Buch (1988).
Hensel: Wenn ich richtig erinnere, war damals Peter Gosse am Literaturinstitut der erste, der Sinn und Form vorschlug, Gedichte von mir zu veröffentlichen. Als das geschehen war, zogen andere Zeitschriften nach: NDL, Temperamente. Da habe ich nicht viel dazu getan.
Dahlke: Wie bist Du ans Literaturinstitut gekommen, warum?
Hensel: Durch Bewerbung, ganz normal. Warum? Weil ich raus aus dem medizinischen Beruf wollte, ohne daß ich zu der Zeit auf die Idee gekommen wäre, „Schriftstellerin“ zu werden. Ich wußte gar nicht, was das ist.
Dahlke: Dein erster Gedichtband ist ja relativ früh erschienen, ein Jahr später dann gleich die Erzählungen, wie erklärst Du Dir das?
Hensel: Der Gedichtband war in der Öffentlichkeit gut aufgenommen worden, die Prosa ging dann relativ komplikationslos über den Verlagstisch. Ich sage nicht: ohne Komplikationen, das würde nicht stimmen. Ich schieb’s auf die Zeit, es war Ende der 80er Jahre, da war viel mehr möglich. Da ich noch sehr jung war, hatte ich auch keine Vergangenheit. Ich war nicht unbeliebt, weil ich zu der Zeit, als man sich noch unbeliebt machen konnte, noch gar nicht „da war“. Aussteiger war ich nicht. Außerdem hatte man in der Kulturpolitik gemerkt: wenn man die Schraube noch enger zieht, passieren noch mehr Unglücke, als ohnehin schon passiert sind. Das war sicher ein Grund. Der andere Grund, denke ich, war einfach der, daß ich gute Texte geschrieben habe.
Dahlke: Du hättest auch gar nicht viel früher veröffentlichen wollen. Fühltest Du Dich nicht behindert?
Hensel: Nein, ich habe auch gar nicht so sehr auf Veröffentlichung hingearbeitet.
Dahlke: Gab es keinerlei Komplikationen mit dem Lektorat im Mitteldeutschen Verlag?
Hensel: Ach doch, aber das habe ich alles verdrängt. Es durften einige Gedichte nicht erscheinen, aber ich war mir in meinem eigenen literarischen Urteil auch noch gar nicht so sicher. Heute weiß ich, ob eine Geschichte von mir gut ist oder nicht. Das wußte ich damals nicht. Es gab natürlich auch Texte, die zurecht nicht gedruckt wurden, weil sie einfach nicht gut waren, das würde ich nicht als Zensur ansehen, sondern als notwendiges Lektorat.
Dahlke: Es entstand nicht so ein Druck, der Dich zur Suche nach anderen Publikationsmöglichkeiten veranlaßt hätte?
Hensel: Nein, ich war eben auch nicht so publikationsgeil. Das Schreiben und die Auseinandersetzung mit meinen Freunden waren mir eigentlich viel wichtiger als unbedingt publizieren zu wollen. Natürlich habe ich mich dann gefreut, das ist schon klar, aber es war nicht so mein Drang.
Dahlke: Hast Du Lesungen gemacht, bevor Dein Buch herauskam?
Hensel: Nein. So was gab’s gar nicht. Ich habe in kleinem Kreise gelesen, in Werkstätten, damals war die Zeit der Werkstätten.
Dahlke: Du meinst das Schweriner Poetenseminar?
Hensel: Ja, Schwerin und dann war ich ja damals viel mehr als mit Prosa und Lyrik mit Dramatik beschäftigt. In dem Dramatikerkreis, den es gab, hatte ich viel mehr an Kritik und an Zensur auszufechten, als mit Prosa und Lyrik. Auch an den größeren Theatern, es war viel, viel schwerer für mich, da reinzukommen. Meine Dramatik ist ja bis heute nicht auf der Bühne. Das halte ich wirklich für Zensur, was da passierte und noch passiert.
Dahlke: Noch passiert?
Hensel: Ja, daß auch heute Theaterstücke nicht gespielt werden, nicht weil sie nicht gelungen sind, sondern weil sie bestimmten Anforderungen, Publikumsanforderungen, Staatstheateranforderungen nicht entsprechen.
Dahlke: Meinst Du nicht, daß es auch damit zu tun hat, daß moderne Dramatik schwer auf der Bühne umzusetzen ist?
Hensel: Na gut, andere Dinge bewältigen die Regisseure ja auch, wenn’s berühmte Leute sind, da betreiben sie ja auch Aufwand. Es gibt nichts, was im Theater nicht geht.
Dahlke: Das heißt, es hat sich in dieser Hinsicht für Dich nichts verändert?
Hensel: Was die Dramatik anbelangt, ist es sogar noch schlechter geworden, obwohl ich einen sehr rührigen Theaterverlag habe (Nyssen & Bansemer Köln). Ich muß noch dazu sagen, daß das komischerweise die Hörspiele überhaupt nicht betrifft, die ich alle ohne Komplikation irgendwo produzieren konnte. Es betrifft komischerweise nur die Bühnendramatik. Deshalb wage ich die Vermutung: das kann nicht an der Qualität liegen.
Dahlke: Es hat mit der Aufmerksamkeit der Gesellschaft zu tun, Theater wird als ein gesellschaftliches Ereignis wahrgenommen, Hörspiele im Rundfunk nicht.
Hensel: Wenn man die Maschinerie eines Staatstheaters sieht, kann man eigentlich nur davonlaufen.
Dahlke: Hattest oder hast Du Probleme mit der Einteilung in „offizielle“ und „inoffizielle“ Literatur, „engagierte“ und „autonome“ oder „Aussteiger“-Literatur?
Hensel: Ich habe mich schon manchmal geärgert über diese Einteilung. Ich denke, daß alles, was man schreibt, in irgendeiner Weise Engagement ist. Ob es nun eine Haltung für oder gegen etwas ist.
Dahlke: Hast du Abweisung, Ausgrenzung erlebt?
Hensel: Nein. Als ich nach Berlin kam und so nach und nach in Kontakt mit Leuten z.B. aus der Prenzlauer-Berg-Truppe gekommen bin, traf ich bei einigen Leuten auf freundliche persönliche Zustimmung, also Papenfuß z.B. oder Häfner, oder auch Gerhard Wolf. Das sind Leute, die – denke ich jedenfalls – mich akzeptiert haben, obwohl einige Vorurteile hatten, die haben sich beim ersten Biertrinken gelegt. Sicher nicht bei allen…
Dahlke: Die haben aber auch Deine Texte gelesen?
Hensel: Ja, wir haben einmal eine Lesung zusammen gemacht. Weil die keine Frau hatten. Sie wollten öfter noch eine Frau dabeihaben, so als Petersilie, damit kam dann die Mischung zustande: Prenzlauer Berg und ich. Das war aber lustig, wir haben uns prächtig verstanden.
Dahlke: Du hast ihre Texte dann auch gelesen? Welche haben Dir gefallen?
Hensel: Papenfuß’ und Häfners.
Dahlke: Wie kam es zu Deiner West-Lizenz?
Hensel: Das hat der Mitteldeutsche Verlag gemacht. Oder die haben auch auf der Buchmesse ein Auge drauf geworfen gehabt, der Luchterhandverlag hatte doch damals das Monopol für DDR-Literatur. Ich habe mich darum nicht gekümmert.
Dahlke: Hast Du dadurch „Westgeld“ verdient?
Hensel: Das war verschwindend gering. Auch, was der Mitteldeutsche Verlag bekam, war nicht viel.
Dahlke: In welcher Auflagenhöhe kam Dein Lyrikband drüben heraus?
Hensel: In einer tausender Auflage und Hallimasch ein bißchen mehr.
Dahlke: Noch einmal zum Problem „offizielle“/„inoffizielle“ Literatur. Fühlst Du Dich im Nachhinein benutzt? Man hatte ja mit der Veröffentlichung Deiner Texte ein Alibi: das ist unsere junge Autorin, seht her, was wir für junge Künstler tun…
Hensel: Erstmal habe ich das gar nicht bemerkt, weil mich die offizielle Kulturpolitik wirklich nicht interessiert hat, weder der Verband, doch die Kongresse, mich hat mein Schreiben, mein Leben viel mehr interessiert. Ich gebe ja zu, das war auch eine gewisse Blindheit, aber auch eine Form, bestimmte Formeln zu ignorieren. Als ich dann auf einem Schriftstellerkongreß von Hermann Kant erwähnt wurde und gar nicht wußte, wozu ich geladen bin, da begann ich darüber nachzudenken: was mache ich falsch. Ich konnte dann aber nichts finden, weil das, was ich schrieb, wirklich meins war und niemandem zu Kreuze kroch. Da habe ich gewußt, irgendwas ist faul an diesem Land. Es traf ja dann auch Wenzel und Mensching, die das auch nicht ganz ernst nahmen.
Dahlke: Du warst auch nicht an dem Versuch jüngerer AutorInnen beteiligt, den Verband zu verändern, ihre Interessen anzumelden? Es gab doch 1988/89 so ein Manifest, an dem auch Wenzel und Klaus-Peter Schwarz beteiligt waren, in dem auf die Praxis des Verbandes aufmerksam gemacht wurde, Dreißigjährigen den ewigen Kandidaten-Status anzuhängen, jungen Schreibenden viel zu wenig Publikationsmöglichkeiten einzuräumen usw. Es ging um die Gründung eines „Aktivs junger Autoren“ und um einen Autorenverlag, glaube ich.
Hensel: Das kam gar nicht richtig zustande. Ich war ja dann im Schriftstellerverband, aber ich hatte schon immer etwas gegen Zentren, ich habe auch was gegen Verbände. Ich hab’ im Sandkasten schon allein gespielt und bin auch ausgesprochen allein schreibend, in keiner Gruppe. Deshalb konnte ich auch keine Gruppe gründen.
Dahlke: Wann hast Du Dich zur Freiberuflichkeit entschieden? Oder besser gesagt, für den Beruf einer Schriftstellerin. So richtig „freie“ Phasen gabs ja eigentlich gar nicht: aus dem medizinischen Berufsleben bist Du ans Literaturinstitut gegangen, dann…
Hensel: Dann bin ich drei Jahre ans Leipziger Theater gegangen, danach holte mich Mickel nach Berlin, an die Schauspielschule. Das ging nahtlos, ich war also nie zwischendurch freiberuflich, so, daß ich immer nur geschrieben hätte. An der Schauspielschule bin ich seit fünf Jahren, auch jetzt noch, und habe dort drei Tage in der Woche zu tun, also zwei Tage frei.
Dahlke: Da schaffst Du so viel? Deine Bilanz ist ja beeindruckend.
Hensel: Ja, die Zeit, die ich habe, muß dann auch genutzt werden. Deswegen sehe ich das gar nicht so als freiberuflich.
Dahlke: Von der Arbeit in der Schauspielschule lebst Du mit Deinem Sohn?
Hensel: Davon lebe ich, ich mache also wenig Lesungen, in Berlin schon öfter mal, aber große Lesereisen sind ganz außergewöhnliche Aktionen.
Dahlke: Das hat sich ja nun so ergeben, willst Du es auch? Spielst Du manchmal mit dem Gedanken der Freiberuflichkeit?
Hensel: Manchmal denkt man, es wäre ganz gut, wenns ein bißchen weniger wäre, aber wenn ich dann wirklich mal eine Woche habe, werde ich schon unruhig.
Dahlke: Dann gibt es auch keine sozialen Einschnitte mit dem Ende der DDR.
Hensel: Nein, ich habe immer gearbeitet, war nie von Aufträgen oder Stipendien abhängig und will das auch weiterhin so halten. Ich habe dadurch auch eine gelassenere Haltung zu diesen Dingen. Man kann aber auch nicht sagen: sucht Euch sowas, so eine Möglichkeit gibt es ganz, ganz selten.
Dahlke: Kommen wir zum Thema „schreibende Frau“. In vielen Interviews hast Du diese Frage zurückgewiesen, wo Du darauf eingehst, tust Du es ironisch. In einem Essay, in dem Du vorrangig von Dir selbst sprichst, benutzt Du die scheinbar geschlechtsneutrale Formel vom „Schriftsteller“. Warum?
Hensel: Es liegt vielleicht daran, daß ich alles beides zuhause bin, sein muß, Mann und Frau. Daß ich keine Rollenteilung habe. Aus diesem Grund sehe ich mich nicht als eine bewußt weibliche Autorin. Das, was ich mache, ist eine Arbeit, die von Frauen wie Männern gleichermaßen gemacht wird. Es gibt da für mich kein Pardon. Es gibt sicher Unterschiede. Je älter ich werde, um so mehr begreife ich natürlich auch, daß es zwischen Mann und Frau nicht nur den „kleinen Unterschied“ gibt, auch im Schreiben. Das wäre für mich aber nach wie vor kein Thema, das man abgelöst von Literatur betrachten könnte. Als Forschungsgegenstand schon, Unterschiede zwischen männlichem und weiblichem Schreiben gibts ganz gewiß. Aber ich würde nicht betont weiblich schreiben wollen. Ich würde es auch nicht unterschiedlich bewerten, der Bewertungsmaßstab ist nach wie vor der der Literatur. Natürlich gibt es eine weibliche Sicht, die unterscheidet sich, Gott sei Dank, von der männlichen, soweit würde ich gehen, ohne jetzt beschreiben zu können, worin die besteht. Anna Seghers wäre allerdings schon die Ausnahme. Vielleicht geht eine Frau, da muß ich wieder an die Morgner denken, leichter mit bestimmten Dingen um, ich meine nicht oberflächlicher, hat ein anderes Blut. Aber da müßte man jetzt ganz lange darüber nachdenken, ehe ich Vermutungen loslasse.
Dahlke: Stimmt meine Beobachtung, daß Du die Frage nach dem Geschlecht „des Autors“ zunächst abgewiesen hast, weil es ein Qualitätsurteil darsteillte? Du wolltest gleichberechtigt anerkannt sein, das äußerte sich auch in der Abweisung der Frage.
Hensel: Es war auch Mode, danach zu fragen, mit welchem Geschlecht man schreibt. Das war für mich völlig unwichtig, weil meine Literaturerlebnisse nicht davon abhängig waren, und ich hoffe, meine Leserschaft ist sowohl männlich als auch weiblich. Deshalb hat mich das als Frage nicht so sehr interessiert, abgewiesen habe ich es ja nicht.
Dahlke: Doch, ich finde schon, daß Du die Frage bewußt abgewiesen hast.
Hensel: Na gut, aber es war einfach nicht mein Thema. Es relativiert sich jetzt einiges.
Dahlke: Würdest Du meiner Behauptung zustimmen, daß es in Deinen Texten doch untergründig Züge weiblichen Schreibens gibt? Daß das abhängig auch vom Thema der Erzählung ist?
Hensel: Das kann ich selbst nicht sagen. Abstreiten würde ich es nicht. Wenn ich Analysen lese, denke ich manchmal schon: das stimmt, das hast Du ja toll gemacht. Wenn man selber beim Schreiben darüber nachdenken würde, würde das nicht gehen, dann könnte ich das nicht mehr schreiben.
Dahlke: Würdest Du sagen, es gibt Erzählungen, die Du als Erzählerin geschrieben hast, und andere als Erzähler?
Hensel: Nein. Ich schreibe eigentlich immer als „ich“, als etwas Androgynes. Ich denke, daß Erzählenkönnen eine handwerkliche Frage ist. Zwischen einem Erzähler wie Böll oder einer Erzählerin wie Seghers gibt es für mich keine Qualitätsunterschiede.
Dahlke: Ist „Erzähler“ oder „Erzählerin“ denn ein Qualitätsurteil?
Hensel: Hm, ich weiß nicht…
Dahlke: In dieser Geschichte „Lilit“ z.B. wird auch stilistisch ganz deutlich, daß Du in besonderem Maße beteiligt bist. Nach meinem Verständnis schreibst Du über die Unmöglichkeit gleichberechtigten Zusammenlebens unter den gesellschaftlichen Bedingungen der Gegenwart.
Hensel: Das ist keine Erzählung, da bin ich ganz altmodisch. Hier erzähle ich nicht. Es ist irgendwie ein Drive, dichterische Prosa in der Ich-Form. Ich erzähle nicht, beim Erzählen hat man doch eine bestimmte distanzierte Haltung, hier ist es etwas sehr Gedrängtes, das ist eine andere Art von Distanz. „Lilit“ muß ja nicht ich sein, es ist ein Rollenstück: „Ich. Lilit“ ist eine Rolle. Da würde ich mich sehr wehren, daß man das gleichsetzt. Soweit ich weiß, ist das meine einzige Ich-Form.
Dahlke: Ja, gerade dieser Unterschied zu den anderen Texten war mir ja aufgefallen. Vielleicht war Deine Wahl des poetischen Mittels doch nicht so frei, hat mit dem Gegenstand oder der Nähe des Gegenstands zu Dir zu tun… Kommen wir nochmal zu dem Text in der Anthologie von Anna Mudry: Obwohl Du dort, wie gesagt, ironisch mit der Frage des Geschlechts beim Schreiben umgehst, antwortest Du doch im folgenden ziemlich ernsthaft, schilderst Deine soziale Situation zu Beginn Deines Schreibens: allein mit Kind in der Kellerwohnung, feucht, Ratten, kein Geld… Das war ja ziemlich hart. Und wiederum auch eine typisch weibliche Erfahrung; ich kenne keinen Mann, der unter ähnlichen Umständen allein mit einem Kind zu leben versucht hat. Mich wundert, daß Du darüber nicht geschrieben hast. Vermeidest Du ganz bewußt die Nähe zwischen Autorin und Erzählerin?
Hensel: Ich schreibe wenig Ich-Texte, dadurch werde ich selten mit meinen Figuren identifiziert. Meine Freunde erkennen natürlich, daß ich in jeder Figur drin stecke, wenn auch nicht biographisch. Viele Leute erwarten eine solche Identifizierung, da sind schon die kuriosesten Dinge in Lesungen passiert: daß man mir meine Texte nicht abgenommen hat, weil ich anders aussehe, als meine Texte sind, weil man etwas anderes erwartete von einer Autorin… Ich bin in der Öffentlichkeit ein ziemlich zickiger Mensch, das führt zu Widersprüchen, ständig.
Dahlke: Und wenn Du dann noch Satiren liest… Dadurch, daß Du viel satirisch arbeitest, verfügst Du über größere Distanz, das hält Dir wahrscheinlich manches vom Körper weg.
Hensel: Ja, ich will auch nicht, daß die Leser mein Privatleben erfahren, sondern daß sie mein Leben erfahren, meine Erfahrungen.
Dahlke: Im gleichen Text sprichst Du davon, daß Du in der Öffentlichkeit die Erfahrung machst, anders behandelt zu werden, weil da eine kleine junge Frau liest und nicht ein fünfzigjähriger Mann. Gleichzeitig weist Du die Festlegung auf das Geschlecht ab.
Hensel: Ja, die Festlegung; ich weise das Problem ja nicht ab, ab aber dieses einzige Beurteilen aus dieser Perspektive heraus. Einen Mann fragt niemand, ob er sich beim Schreiben als Mann fühlt. Nun hat das natürlich damit zu tun, daß, wenn man die Literaturgeschichte durchforstet, es eben auffällt, daß es weniger Frauen gibt. Das hat ganz sicher Gründe, die sind aber so vielseitig, da kann man wahrscheinlich bis in die Hirnstruktur hinein nachforschen… Man kann es nicht nur gesellschaftssoziologisch auffächern.
Dahlke: Da hast Du ganz sicher recht. Nun wurde Dir die Frage nach geschlechtsspezifischen Erfahrungen als Autorin eher von außen aufgezwungen. Wie ist das heute, beschäftigt es Dich inzwischen auch „von innen“?
Hensel: Ja, das ist schon so. Irgendwann kann man ja nicht immer nur abwehren, sondern muß auch mal einen Standpunkt bestimmen und formulieren. Ich bin eigentlich nicht für Standpunkte, wenn sie nicht literarisch sind. Inzwischen weiß ich, manchmal muß man das machen, dann können sich alle darauf beziehen und in zehn Jahren können sie mich wieder fragen. Natürlich war ich mehr oder weniger gezwungen dazu, aber nur zwingen würde ich mich nicht lassen, es interessierte mich dann schon.
Dahlke: Würdest Du zustimmen, wenn ich Geschlechterbeziehungen als eines Deiner Hauptthemen bezeichne?
Hensel: Geschlechterbeziehungen sind Menschenbeziehungen. Nur Geschlechtsbeziehungen gibts nicht, wie es eben nicht nur Sexualität gibt… Es muß immer eine Menschenbeziehung da sein.
Dahlke: Natürlich, aber…
Hensel: Nicht natürlich, es gibt ja so viele Diskussionen, wo es zwar um Geschlechter geht, aber nicht um Menschen…
Dahlke: Aber trotzdem gibt es doch auffällig oft in Deinen Texten Beziehungen zwischen Mann und Frau und nicht nur die zwischen zwei Mädchen, wie bei den Zwillingen in Hallimasch.
Hensel: Diese Zwillinge sind ja auch eher ein Gleichnis, da geht es um das Gleichsein bis ins Letzte, als gesellschaftliches Gleichnis. Aber auch die anderen gestalteten Beziehungen sehe ich immer auch als Gesellschaftliches, als Metaphern.
Dahlke: Ganz bestimmt, Deine Geschlechterbeziehungen geben immer Aufschluß über Gesellschaft allgemein. Bei alldem habe ich nie begriffen, warum Du dann nicht über Geschlechter reden wolltest.
Hensel: Weil für mich immer zwei Geschlechter dazu gehören. Mich hat nie jemand nach meinem Verhältnis zu Männern gefragt, immer nur nach dem zu Frauen, als Frau.
Dahlke: Und? Was würdest Du dazu sagen?
Hensel: Dazu würde ich sagen, daß ich sie liebe, obwohl sie so feige sind.
Dahlke: Aber daß diese Frage nicht gestellt wird, ist interessant.
Hensel: Nicht nur mir nicht. Z.B. bekommt kein Mensch mit, wie erotisch die Morgner die Männer beschreibt, immer wird nur auf ihre Frauenfiguren gesehen.
Dahlke: Stimmt, sie geht eigentlich so mit Männern um, wie sonst nur mit Frauen umgegangen wird, sie behandelt sie als sexuelle Wesen.
Ich muß aber noch mal aufs weibliche Schreiben zurückkommen: das „Ich“ in dem „Lilit“-Text ist eindeutig weiblich…
Dahlke: Ja, sicher. Aber der Text ist auch eine Ausnahme, da interessierte mich eben wirklich die „andere Frau“, und dieser Waschlappen als Mann. Ich gebe Dir mal „Ulriche und Kühleborn“, da ist das ähnlich, auch lyrische Passagen, das wird Dich interessieren. Und dann hast Du mein ganzes Schema von Frauen im Roman vorgeführt.
Dahlke: Schon in Deinem Erzählungsband gibt es ja mindestens drei Varianten weiblicher Existenz.
Hensel: Es ist mir auch viel wert, daß man nicht nur das gestaltet, was man selber im Moment ist, daß man verschiedene Möglichkeiten…
Dahlke: … durchspielt?
Hensel: Durchspielt, ja. Man kann es sowieso nur durchspielen, wo man es selber in irgendeiner Form auch einmal durchgemacht hat, wenn auch nicht unbedingt in der Realität, aber wenn man beteiligt ist, sonst geht’s überhaupt nicht, denke ich.
Dahlke: Wenn Du selbst Deine Poetik beschreibst, sprichst Du von „erfahrener Erfindung“, von der Verknüpfung von Empirischem und Fiktivem. Vielleicht gibt es da, wo sich geschlechtsspezifische Erfahrungen in den Vordergrund drängen, ein größeres Gestaltungsproblem, geraten Authentisches und künstlerische Souveränität in Widerspruch. Die lyrischen Passagen im Prosatext zeigen ja die Überschreitung von Genre-Grenzen an.
Hensel: Ja, „Lilit“ ist wirklich auch ein Austesten des Genres gewesen, das ist völlig richtig. Nur, wenn man an die Grenze eines Genres kommt, dann ist die Grenze aber auch die Grenze. Eine Grenze kann man nicht erweitern, das ist für mich uninteressant. Wenn ich die Grenze erreicht habe, gehe ich wieder ein Stück zurück und werde wieder Erzählerin, das ist das viel Schwerere. „Lilit“ zu schreiben, war gar nicht schwer, Du hast einen bestimmten Drive und läßt Dich treiben.
Dahlke: Was bedeutet der Satz: „Ich sträube mich, den Weg weiter nach innen zu gehen, nach beschreibbaren Wurzeln zu suchen“?
Hensel: Das bedeutet die Ablehnung der Erforschung des Privaten für die Öffentlichkeit.
Dahlke: Meinst Du damit eine Erwartung von außen oder…
Hensel: Von außen wie auch von innen. Manchmal hat man Angst vor seinen eigenen Abgründen. Z.B. schreibe ich seit vielen Jahren nicht mehr Tagebuch. Ich könnte es nicht mehr, aus Angst vor diesen inneren Abgründen…
Dahlke: Die Texte von Gabriele Stötzer-Kachold werden Dir dann sehr fremd sein.
Hensel: Das ist mir sehr fremd, ja.
Dahlke: Würdest Du das als Kunst bezeichnen?
Hensel: Darüber möchte ich nicht urteilen, ich würde mal sagen: für mich nicht, das kann ich auch begründen, mit meinen ästhetischen Kriterien. Aber deshalb lasse ich es trotzdem gelten.
Dahlke: In einem früheren Gespräch sagtest Du, daß Dir die Gefängnis-Texte gefallen.
Hensel: Ja, da ist eine gewisse Gestaltung zu sehen. Kachold ist ein Beispiel für viele andere, die nicht mit der Beherrschung der Form arbeiten. Da komme ich auf Hermlins Abendlicht, wo extreme Dinge beherrscht gesagt sind. Das ist seine Ästhetik. Gerade in dieser lauten, schreienden Zeit, wo nichts mehr beherrscht wird.
Dahlke: „Wahrscheinlich ist der Preis einer Dichterin, den sie ihr Leben lang zu zahlen hat, die Isolation“, schreibst Du. Einige Zeit früher sprachst Du von der Isolation jedes Künstlers… Erfährst Du als Künstlerin eine besondere Isolation?
Hensel: Ein Dichter ist auch isoliert, aber auf eine andere Weise. Ich glaube schon, daß eine Dichterin in direktem Sinne isoliert ist, im Leben und im Beruf, es trifft sie in doppelter Weise. Es gibt kaum eine Dichterin, die sich einfach an einen Schreibtisch setzen kann, ihre Werke verfaßt, während der Mann Geld verdient. Es ist nämlich meistens umgekehrt, der Dichter hat eine Frau, die ist Ärztin oder so… Andersherum ist es nur in ganz, ganz seltenen Fällen. Wer erträgt das schon?
Dahlke: Im Kontext-Verlag liegt seit längerem ein Gespräch von Dir mit Elke Erb. Welches Verhältnis hast Du zu ihren Texten? Als ich Dich nach schreibenden Frauen fragte, fiel ihr Name nicht.
Hensel: Sie war früher nicht wichtig für mich, da kannte ich sie nicht. Aber sie wird mir von Jahr zu Jahr interessanter. Sie ist eine große Dichterin. Auch wenn wir völlig fremde Welten sind… aber das zieht uns an. Kachold würde mich nicht anziehen, aber Elke Erb ungeheuer. Nicht Vorbild, weil das was anderes ist, aber es gibt Texte von ihr, die ich hoch achte, das ist Form, das ist groß.
Dahlke: Nochmal etwas anderes: im Sondeur, Heft 2, war 1990 Deine harte Kritik an Annett Gröschners Vergewaltigungstext „Maria im Schnee“ zu lesen.
Siehst Du das heute genauso, auch wenn Du um die Authentizität des Erlebnisses weißt?
Hensel: Das wußte ich damals schon. Das brauchte mir niemand zu sagen, das war an der Form zu merken. Was ich kritisierte, bezog sich ausschließlich auf stilistische, literarische Dinge. Ich schrieb auch, das sei ein gerichtlicher Fall, kein literarischer. Das meint, daß ich Authentizität, wenn sie so gestaltet ist, ablehne.
Dahlke: Nun hat ja Literatur unter anderem auch die Funktion in der Gesellschaft, auf andere Weise als juristische Prozesse, die latente Gewaltgefahr ins öffentliche Bewußtsein zu bringen. Vergewaltigung ist m.E. gerade heutzutage unbedingt Stoff für Literatur.
Hensel: Ein Stoff ist es auf jeden Fall, Stoff für Literatur ist ja alles. Aber so, wie es da steht, ist es völlig unbewältigt.
Dahlke: Du vermißt Souveränität, aber geht es hier nicht gerade erstmal darum, zu beschreiben, wovon geredet wird, wenn von Vergewaltigung gesprochen wird? Und gesprochen wird ja viel, nur dringt das Ausmaß der Gewalt kaum in die Öffentlichkeit. Geht es nicht zunächst um Sicherung des Empirischen, wie Du es nennst? Meinst Du, es könnte jeder über Vergewaltigung schreiben?
Hensel: Ich würde mir zutrauen, was über Vergewaltigung zu schreiben, ohne daß ich je vergewaltigt wurde.
Dahlke: Das wäre ein anderer Text, haben nicht beide Berechtigung?
Hensel: Es gibt zwei unterschiedliche Arten zu schreiben. Ich könnte im Affekt überhaupt nicht schreiben, ob nun freudig oder grausam, da kann ich nicht schreiben. Ich muß warten, bis ich mich beruhigt habe, bis sich das Erlebnis gesetzt hat und ich einen Draufblick habe. Dann gibt es andere, die können nur im Affekt schreiben, sollen sie ja auch machen, aber es ist nicht meins und ich kann immer nur von meinem Standpunkt aus urteilen. Ich habe ja handwerkliche Dinge kritisiert, darauf lege ich wert. Ich ärgere mich furchtbar, wenn so ein wichtiges Thema schusselig dargestellt ist.
Dahlke: Das verstehe ich. Annetts Geschichte hatte ja auch eine Art therapeutischen Effekt, da wären wir wieder bei Kachold. Aber vielleicht weisen das Fragmentarische und die Stilbrüche darauf hin, daß es nicht möglich ist, über dieses Thema als souveräne Erzählerin zu schreiben.
Hensel: Das würde ich bezweifeln. Ich denke, jedes Thema ist gestaltbar.
Dahlke: Ich kenne keine Literatur darüber.
Hensel: Ich auch nicht, aber das heißt ja nicht, daß es nicht geht. Es gibt ganz bestimmt Texte, da müßte man einmal bis in die Weltliteratur hinein suchen. Also für mich wäre es kein Tabu-Thema, es müßte natürlich in meine Geschichte passen…
Dahlke: Aber es ist nach wie vor ein gesellschaftliches Tabu, auch wenn viel drüber geredet wird.
Hensel: Ja… andererseits wird jetzt ständig von Kindesmißhandlung, Kindesmißbrauch geschrieben, das ist ja gerade Mode, es gibt Hunderte von Büchern darüber, aber Frauen… Ich habe allerdings einige sehr interessante Diskussionen im nichtliterarischen Bereich mitbekommen.
Dahlke: Hast Du die Kritik damals von Dir aus geschrieben oder bist Du darum gebeten worden?
Hensel: Ich bin von Temperamente gebeten worden, sie hatten mir die Geschichte auch zugeschickt.
Dahlke: Annett erzählte, daß positive Kritiken zurückgehalten wurden, der Schreiberin abtelegrafiert wurde…
Hensel: Wurde nicht allen abtelegrafiert? Das Heft ist doch damals nicht erschienen.
Dahlke: Das ist heute schlecht nachzuprüfen, wenn es stimmen würde, wärest Du mit Deiner ehrlichen Meinung ganz schön instrumentalisiert worden…
Hensel: Das wäre schlimm, aber das kannst Du nicht verhindern, das ist heute auch noch so.
Dahlke: Zum Abschluß die „Stasi-Frage“: Gab es für Dich einschneidende Erkenntnisse durch die Gauck-Behörde?
Hensel: Ich habe meine Akten noch gar nicht angefordert. Das liegt daran, daß ich da einen Tag zur Polizei muß, dann ist wieder ein Tag zum Schreiben weg. Ich will es aber tun, es gibt schon Dinge, die mich interessieren, ganz massiv.
Dahlke: Durch Akten anderer Leute gab es keine bösen Überraschungen?
Hensel: Es gibt einen Fall, wo sich herausstellte, daß eine Freundin dort Mitarbeiterin war, aber es hat mich eigenartigerweise nicht übermäßig vom Stuhl gehauen. Die Beziehung zu ihr hat sich nicht geändert. Eher muß ich sagen, daß mich gestern die Sache mit Heiner Müller ziemlich bewegte, weil das eine andere Dimension hat, weil es mehr betrifft, als eben nur Müller. Das ist schon ziemlich finster.
Dahlke: Hören wir etwas optimistischer auf: woran arbeitest Du?
Hensel: Bei Suhrkamp kommt jetzt eine Erzählung heraus, über Kindheit, sicher auch meine. Dann bin ich dabei, ein Hörspiel zu schreiben, das ist aber mehr Handwerk. Außerdem will ich noch eine Erzählung schreiben, die übrigens eine in der Ich-Form sein wird.
Dahlke: Das beschließt Du richtig?
Hensel: Ja, es geht um einen anderen Blickwinkel. Das beschließe ich richtig, ich muß mich selbst zu einer anderen Sicht zwingen. Es wird aber eine Erzählung sein, die überhaupt nicht aus meinem Milieu kommt, sondern aus großbürgerlichern, halb-adeligem.
Dahlke: Wie Du mit den Formen spielst…
Hensel: Ja, als ich den Roman abgeschlossen hatte, wußte ich, so, das war jetzt Dein polyphoner Roman, das machst Du nicht nochmal.
Dahlke: Warum?
Hensel: Das ist abgeschlossen, alles, was man wiederholt, wird ein Abklatsch. Deswegen lieber mal ein Reinfall und den wirfst Du dann weg und machst was Neues.
Dahlke: Gibt es eine Form, die Du als „Deine“ herausgefunden hast?
Hensel: Sicher hat sich mein Stil gefestigt. Bestimmte Dinge fallen mir jetzt leichter als vor zehn Jahren, aber daß ich die Form gefunden hätte, nein. Mir schwebt immer noch die große Erzählung vor, die ich noch gar nicht erreicht habe, das wird ein Lebenswerk sein. Aber ist doch gut, wenn ich das weiß.
Dahlke: Eine Form von Erzählung sagst Du?
Hensel: Ein bestimmter Stil von Erzählung, Zurückgenommenheit und… Obwohl ich ein ruhiger Mensch bin, gibt es in meinen Texten so ein Drängen… das muß irgendwie begrenzt werden.
Dahlke: Klingt ja hart.
Hensel: Ja, das ist hart. Immer das, was man nicht ist, muß man ja darstellen…
Dahlke: Zum Schluß: in welcher Weise erlebst Du das Ende der DDR und die gesamtdeutsche Gegenwart?
Hensel: Es ist alles noch schlimmer, als ich dachte, alles, was mit diesem Deutschland zu tun hat. Ich war vorher schon völlig desillusioniert. Das heißt ja nicht, mit dem Leben am Ende, aber daß das, was man schon zu DDR-Zeiten vermutet hatte, wirklich so schlimm ist, das ist schon bitter. Daß man von nichts Gutem reden kann. Daß ich immer zorniger werde und immer mehr das Komische sehe, das Affentheater, das auf der ganzen Linie stattfindet.
Dahlke: In den Rezensionen zu Hallimasch entdecken die einen Kritiker im Nachhinein den Untergang der DDR schon als Voraussage, die anderen werfen Dir vor, daß von DDR-Alltag keine Rede sei. Es gibt z.T. richtig gegensätzliche Interpretationen ein und derselben Textpassage.
Hensel: Das Schärfste war ein Amerikaner, der mich fragte, ob es in meinen Geschichten immer so viel zu essen gebe, weil es in der DDR so schlecht darum bestellt sei… Die haben gedacht, wir würden hier mit Gittern vor den Fenstern leben.
Dahlke: Machst Du weiterhin einige Lesungen?
Hensel: In der Volksbühne habe ich letztens einmal gelesen, in nächster Zeit gibt’s Lesungen in Lüneburg und Kiel.
Dahlke: Erlebst Du Unterschiede bei Lesungen im Osten und im Westen?
Hensel: Ja, positiv wie negativ. Früher habe ich lieber im Osten gelesen, jetzt lese ich lieber im Westen, da ist die Achtung vor einem, der schreibt, der zu ihnen kommt, größer.
Deutsche Bücher, Heft 2, 1993
Brigitte Schwens-Harrant im Gespräch mit Kerstin Hensel – „Die Realität ist es, die übertreibt“.
Fakten und Vermutungen zur Autorin + Facebook +
Archiv + KLG + IMDb + PIA
Porträtgalerie: Autorenarchiv Susanne Schleyer + Galerie Foto Gezett +
Dirk Skiba Autorenporträts + Brigitte Friedrich Autorenfotos +
Keystone-SDA + deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Kerstin Hensel liest das Gedicht „Erste Hoffnung“ auf der Großen Nacht der Poesie des 2. ÖKT in München.


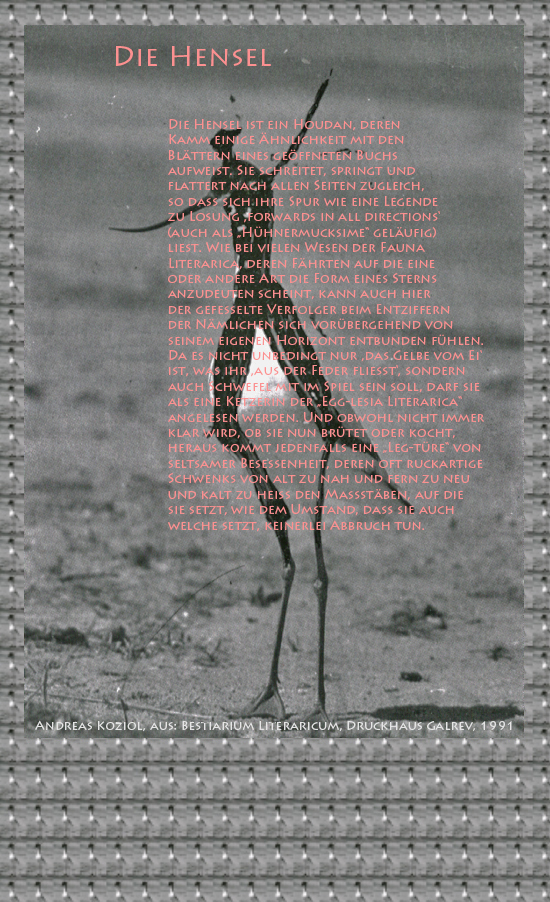
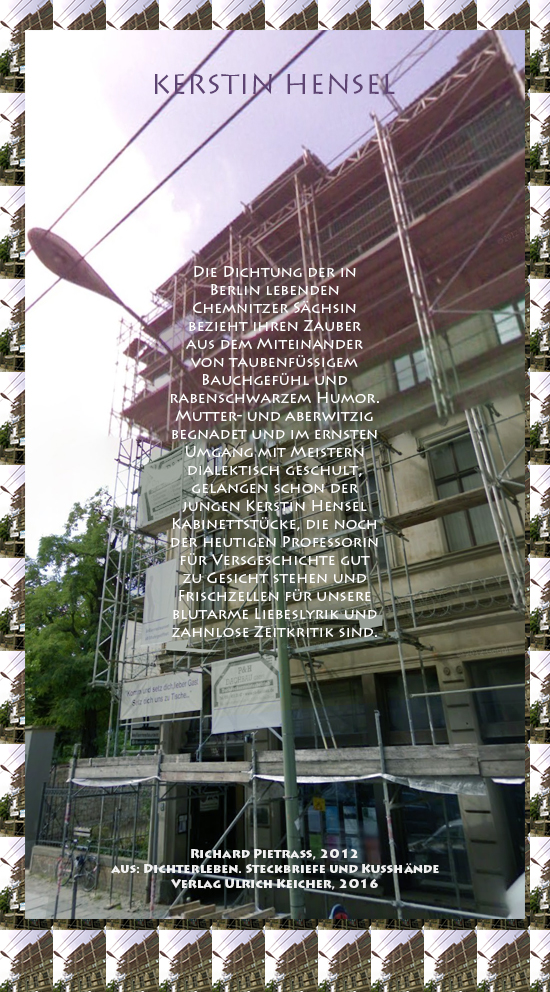












Schreibe einen Kommentar