Kerstin Hensel: Poesiealbum 222
LAMENTO IN MEDIAS RES
(Lied für Do)
Ach dieses VielzuEnge
Ach dieses VielzuSchwere
wenn ich den alten Mantel
mir nicht mehr überhänge
frier ich nicht mehr.
Ach dieses VielzuLange
Ach Esistvielzuspät
wir wolln uns übernehmen
in ungebrochnem Gange
bis uns die Lust vergeht.
Kerstin Hensel
In ihren Texten spricht sich eine junge Frau auf junge Weise aus: hellwach, brüsk, rücksichtslos. Da ist eine unverstellte Lust an den Worten, ist eine die Form fügende und sprengende Unbändigkeit! Kerstin Hensel will nichts geschenkt, nichts geglättet, mißtraut den bequemen Wegen. Aus der Mitte des Erlebens – betroffen und beteiligt – zieht sie mit immer weiterem Radius weltgreifende Kreise.
Ankündigung in John Keats: Poesiealbum 221, Verlag Neues Leben, 1986
Rigoros,
sensibel und herausfordernd suggestiv sind die Texte von Kerstin Hensel, (durch-)dringende Telegramme werden hier zugestellt. Die Absenderin, zwischen „Blutkirsche und Mohn“ erregt atmend, weiß um ihr und unser „verlierbares Fleisch“, um die schwierige Balance von „Herzas und Herzaus“. Wer ist, muß noch werden können – in dem Magnetfeld der Pole: Verlangen und Verlust. Immer geht es um alles, ums Leben: das Schwere, das einfacher nicht zu machen ist.
Gabriele Berthel, Verlag Neues Leben, Klappentext, 1986
XYZ – Im Alphabet der Generationen (I) – Mit Kerstin Hensel, Peter Neumann im Literarischen Colloquium Berlin am 15.3.2023
Der Blick durch die Clownskleider
auf die Knochen: Kerstin Hensel
„Man muss wissen, was der Zeitgeist stammelt, um dagegen eine Sprache zu setzen“, schrieb die Autorin Kerstin Hensel 1997 in einem Aufsatz zur Poetik der Prosa. Damit hat sie veranschaulicht, was sie seit ihren Schreibanfängen vor über 30 Jahren immer wieder versucht hat: Ihre Sicht der Welt darzustellen und dabei anzuschreiben gegen Widersprüche in dieser Welt, gegen Mitläufertum, Spießertum und althergebrachte Ordnungen. Indem sie diese in Frage stellt, zeigt sie die Brüche der modernen Gesellschaft auf und die Verlorenheit des Menschen in ihr.
Kerstin Hensel wurde 1961 in Chemnitz, ehemals Karl-Marx-Stadt, geboren. Zunächst war sie als Krankenschwester tätig, bis sie von 1983 bis 1985 ein Studium am Literaturinstitut Johannes R. Becher in Leipzig aufnahm. Anschließend arbeitete sie bis 1987 am Theater der Jungen Welt in Leipzig. Seit 1987 unterrichtet sie Verssprache und Versgeschichte an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin; seit 1988 lebt sie in der Hauptstadt. Als Schriftstellerin zeigt Kerstin Hensel große Vielseitigkeit und bewegt sich in verschiedenen Literaturgattungen: Sie schreibt Erzählungen, Romane, Essays, Gedichte, Theaterstücke, Hörspiele, Drehbücher. So erschienen unter anderem die Gedichtbände Stilleben mit Zukunft (1988), Schlaraffenzucht (1990) und Bahnhof verstehen (2001), die Erzählungen Hallimasch (1989) und Tanz am Kanal (1994), die Romane Gipshut (1999) und Im Spinnhaus (2003), die Theaterstücke Ausflugszeit (1989) und Klistier (1997) sowie das Hörspiel Der Fensterputzer (1992). Außerdem arbeitete sie bei den Filmen Leb wohl, Joseph (1989) und Der Kontrolleur (1995) mit. Für ihre Werke wurde Kerstin Hensel unter anderem 1987 mit dem Anna-Seghers-Preis der Akademie der Künste Berlin, 1991 mit dem Leonce-und-Lena-Preis der Stadt Darmstadt und 1999 mit dem Gerrit-Engelke-Preis der Stadt Hannover ausgezeichnet. 1995 erhielt sie ein Stipendium der Villa Massimo in Rom.
Durch Kerstin Hensels Werk zieht sich die Schilderung der Lebensverhältnisse und -haltungen der Menschen in der ehemaligen DDR. In Milieudarstellungen werden deren Sprache, Denken und Alltag beschrieben, die kleinen Kämpfe des täglichen Lebens in einem Umfeld, aus dem die Autorin selbst kommt. Kerstin Hensel, eine „DDR-Autorin“ also? Sie selbst wehrt sich gegen diese Klassifizierung, sollen doch für sie Texte bei aller Zeitkritik über die jeweiligen (ohnehin wechselnden) gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse hinausweisen. Daher ging es ihr auch zu DDR-Zeiten beim Schreiben stets um das „übergreifend Menschliche“: „Was mich interessierte, war nicht der Staat, es waren die Menschen in diesem Staat. Mich hat kein Staatssystem geprägt, sondern die Menschen darin.“
Tatsächlich liegt Kerstin Hensels Fokus auf dem Menschen selbst – auf dem Menschen und den alltäglichen Plagen seiner kleinen Existenz. Ihre Texte sind die kritische Bestandsaufnahme der Welt, in der er lebt. Durch bewusste Überzeichnung wird die moderne Zeit in ihrer Fragwürdigkeit gezeigt. Zu dieser Überzeichnung gehören auch Ausflüge ins Märchenhaft-Unwirkliche und das unverhoffte Einbrechen des Übernatürlichen: Im Roman Auditorium panopticum fliegt eine bereits für tot gehaltene Studentin in die Lüfte und fällt als alte Frau wieder herab; in Im Spinnhaus tragen Frauen ihre Kinder zehn Jahre im Bauch, ohne sie zu gebären. Doch diese irrealen Elemente täuschen nicht hinweg über die Darstellung einer oft traurig realen Gegenwart. Nicht, wie es sein sollte, sieht der Leser – sondern wie es ist. Die Wirklichkeit spricht für sich selbst. Der Mensch müht sich durch diese Wirklichkeit, und er stößt dabei an Grenzen, an selbst gesetzte einerseits, an von außen gesetzte andererseits. Kerstin Hensels Mensch ist ein einsamer, ein isolierter, er ist ein Außenseiter, ein Verlierer. Den Figuren in ihren Romanen und Erzählungen gelingt es nicht, sich anzupassen an den allgemein anerkannten Lebensrhythmus der anderen. Sie werden ausgestoßen und verlacht und verstehen meist nicht einmal warum. Dadurch ergibt sich eine andere Perspektive auf die Gesellschaft und ihre scheinbar allgemeingültigen Regeln: Die Perspektive von unten oder vielmehr von außen. Eine Perspektive, die so manches in Frage stellt, was doch eigentlich als so normal gilt. Die dieses scheinbar Normale komisch, absurd, sogar aberwitzig wirken lässt. Ironischer, ja sarkastischer Humor ist keinem der Texte abzusprechen.
Das lyrische Ich in Kerstin Hensels Gedichten ist ebenfalls oft isoliert und erscheint in seiner Unsicherheit Ziel- und Heimatlosigkeit, in seiner Angst vor Zurückweisung und Verlust. „Ein feiges Tier“ durchschwimmt sein Blut: Einsamkeit. Groß, zu groß ist die Kluft zwischen Ich und Welt.
Eine etwas andere Perspektive ist auch für die Sprache und Technik in Kerstin Hensels Lyrik charakteristisch. Sie benutzt Wortspiele, Verfremdungen, Übertreibungen, Sinnverdrehungen, collagenhaften Einbau von Zitaten: Gegenstände werden aus ihrem vertrauten Kontext gelöst und bekommen so mitunter einen neuen Sinn. Wer in den gewohnten Bahnen denkt, wird aufgerüttelt, wer Altbekanntes lesen will, enttäuscht. Die Dinge sind eben nicht immer, was sie scheinen (sollen).
„Den Leser in das Labyrinth der Geschichten, also der Geschichte hineinzugleiten, daß er sich irgendwann darin auskennt, könnte etwas sein, worauf es mir ankommt“, formulierte Kerstin Hensel einmal ihre Absicht. Nicht Lebenshilfe wolle sie leisten, keine Ratgeber schreiben, auch nicht schockieren. Ihre Literatur speist sich aus dem Leben selbst, meist satirisch überspitzt, grotesk verzerrt, komisch überzeichnet: Der Blick muss „durch die Clownskleider auf die Knochen gehen“. Die Welt ist nur scheinbar aufgeklärt, geordnet und eindeutig: Hinter der schönen Fassade tun sich Abgründe auf. So bleiben einem auch die „weltgereisten überseebunten Früchte“, die auf dem Markt angeboten werden, im Halse stecken:
Wie gemalt
Glänzt das Obst und kann sich nicht riechen. Nur ich
Lieg angeschlagen unter dem Tisch
Des Händlers
Und stink ihm.
Birgit Holzer: Meine erste Frage kann man wohl jedem stellen, der schreibt: Warum schreiben Sie, was ist für Sie die Motivation dafür?
Kerstin Hensel: Wenn man es ganz allgemein sagt und etwas pathetisch: Es ist immer eine Auseinandersetzung mit der Welt, in der man lebt – ob im Persönlichen, im Kleinen oder im Großen. Jedenfalls bei mir ist es so, seit ich mit 17, 18 Jahren angefangen habe zu schreiben.
Holzer: Und woher kam der Antrieb, sich gerade auf diese Art und Weise mit der Welt auseinander zu setzen?
Hensel: Ich habe schon in der Kindheit viel gelesen, habe mir Märchen und Theaterstücke ausgedacht. Das ist immer die mir gemäße Art gewesen, mich mit der Welt auseinander zu setzen – ich bin zum Beispiel kein sportlicher Mensch, kein Mensch, der gerne Wettkämpfe macht oder sich sonst irgendwie aktivistisch betätigt.
Holzer: Wollen Sie mit ihrer Dichtung etwas Bestimmtes aussagen? Bezwecken Sie etwas damit?
Hensel: Es gibt keinen Zweck der über das hinausgeht, was geschrieben steht. Wenn ich irgendeine Mission hätte, wäre ich Missionarin geworden. Es kommt immer darauf an, was der Leser damit anfängt.
Holzer: Stichwort Leser: Denken Sie an ein bestimmtes Publikum, wenn Sie schreiben, haben Sie Ihre Leser dabei vor Augen?
Hensel: Nein, an bestimmte Leser denke ich beim Schreiben nicht. Aber ich will natürlich erreichbar sein für diejenigen, die meine Sachen lesen.
Holzer: Sie würden auch schreiben, wenn es nicht verlegt, nicht gelesen würde?
Hensel: Natürlich! Die ganzen Ur-Schreibantriebe haben mit dem Verlegen überhaupt nichts zu tun. Ich schreibe, weil ich etwas sagen muss und etwas mitzuteilen habe – ob das dann verlegt wird, ist völlig zweitrangig. Man kann ja eh nichts machen. Wenn es nicht verlegt wird, ist es ja trotzdem geschrieben.
Holzer: Hat man Ihrer Meinung nach als Dichter und Autor eine Aufgabe, etwas zu vermitteln und damit auch eine gewisse Verantwortung?
Hensel: Nein, wenn es noch etwas gäbe, das über das Geschriebene hinausgeht, müsste man andere Mittel ergreifen. Man hat als Schriftsteller nicht mehr Verantwortung für sein Handeln und Tun und sein Leben als jeder andere Bürger auch. Bei Journalisten ist es vielleicht so, die stehen mit ihren Artikeln oder Sendungen in einer ganz anderen Alltagsverantwortung. Bei Schriftstellern, jedenfalls bei denjenigen, von denen ich jetzt spreche, die anspruchsvollere Literatur schreiben und keine Groschenromane, steckt die Verantwortung in dem, was sie schreiben.
Holzer: Sie haben mit 17, 18 Jahren angefangen zu schreiben – was schreiben Sie da, wie begann alles?
Hensel: Zunächst waren es wirklich nur Anfänge. Man kann nicht sagen, das ist die große Literatur gewesen. Als junges Mädel war ich theaterversessen und wollte Theaterstücke schreiben. Das erste handelte gleich von Jesus – das war jene Selbstüberschätzung, die man in dem Alter manchmal hat. Später schrieb ich dann auch Gedichte und kleine Erzählungen – aber all das noch nicht unter dem literarischen Aspekt. Ich bin nicht wie viele andere durch ein Germanistik-Studium zum Schreiben gekommen, sondern zunächst ohne germanistischen Hintergrund, allein durch das Lesen und aus der Lust heraus selber zu erfinden.
Holzer: Sie haben ursprünglich den Beruf der Krankenschwester gelernt – wann haben Sie diesen aufgegeben zugunsten des Schreibens?
Hensel: Zunächst habe ich parallel zur Arbeit geschrieben; aufgehört habe ich dann, als Freunde gesagt haben, bewirb’ dich doch mal fürs Literaturinstitut in Leipzig, vielleicht hast du ja Glück und sie nehmen dich. Ich habe ja kein Abitur und damals in der DDR war das die einzige Möglichkeit, ohne Abi zu studieren. Da ich letztendlich nicht bis in die Ewigkeit in Karl-Marx-Stadt im Krankenhaus arbeiten wollte, habe ich mich beworben und bin angenommen worden. Da habe ich dann gesagt: Krankenschwester ade. Es ging ja gar nicht anders, ich konnte das ja nicht nebenbei machen. Und dann bin ich nach Leipzig ins Literaturinstitut gekommen und war dort sozusagen erst einmal auf dem Weg der Literatur.
Holzer: Was haben Sie dort gelernt?
Hensel: Man lernt am Literaturinstitut eine ganze Menge – nur nicht, wie man schreibt. Aber was sehr schön war: Man lernt lesen. Es gab eine wunderbare Bibliothek und ich habe dort viele Bücher gelesen und bin auch Leuten begegnet, die mir schon etwas anderes gesagt haben, als ich vorher wusste.
Holzer: Ist es denn der Anspruch des Literaturinstitutes in Leipzig zu lehren, wie man schreibt?
Hensel: Anders als heute war es damals der Anspruch des Literaturinstitutes von der Gründung an, dass Leute aus der Arbeiterklasse, die einen Beruf gelernt haben, die Gelegenheit bekommen, sich weiter- und auszubilden. Es war nicht der Anspruch, dass alle Schriftsteller werden. Aus jedem Studiengang sind letztendlich höchstens einer oder zwei in den Beruf gegangen.
Holzer: Diente das Studium am Literaturinstitut dann einfach als Auszeit?
Hensel: Ja, das Studium war eine Art Auszeit. Das war eine ganz idealistische Geschichte. Heute vertritt das Literaturinstitut in Leipzig eher die Ansicht, dass man die jungen Schreibenden marktgemäß ausbildet, also dass sie wirklich zum Ziel haben, auf den Markt zu kommen und sich zu verkaufen. Das war bei uns nicht einmal im Ansatz der Fall.
Holzer: Wenn man hört, dass Sie zunächst Krankenschwester waren und diesen Beruf später aufgaben, um auf das Literaturinstitut zu gehen und dann Autorin zu werden, erscheint das sehr mutig: Sie wussten ja zunächst gar nicht, ob Sie vom Schreiben leben können.
Hensel: Daran habe ich auch nie gedacht. Ich habe das nie mit dem Ziel gemacht, ich will Schriftstellerin werden, sondern habe mir gesagt: Mal sehen, was kommt und ich bin ja immer noch Krankenschwester, ich kann jederzeit wieder zurück. Und Arbeit gab’s damals immer, es war ja nicht wie heute, dass man Arbeit suchen musste. Also war ich da ganz frohgemut. Mit wenig Geld konnte ich schon immer auskommen – ich hatte keinerlei Zwänge.
Holzer: Im Literaturinstitut haben Sie also nicht gelernt, wie man schreibt – aber kann man Schreiben überhaupt lernen?
Hensel: Man kann ein gewisses Handwerk lernen, aber das habe ich nicht dort gelernt, das habe ich mir selber, autodidaktisch beigebracht. Dass man Dinge lernen kann, wie man auch in der Malerei bestimmte Dinge lernt oder in der Musik, das sehe ich auch bei der Arbeit mit meinen Studenten an der Schauspielschule. Den Rest muss man mitbringen, das ist dann schon das, was man an Begabung oder Fähigkeiten besitzt. Aber es gibt lehr- und lernbare Dinge.
Holzer: Was ist das zum Beispiel? Worauf kommt es an beim Schreiben?
Hensel: Gerade bei Gedichten kann ich lernen: Was ist ein Versmaß, was ist ein Vers, was ist ein Hexameter, was ist ein Reim – die rein technischen Dinge, die ja bis ins 19. Jahrhundert noch Schulstandard waren. In humanistischen Gymnasien konnte im 19. Jahrhundert jeder ein Sonett schreiben. Diese Dinge sind lernbar und mehr ist wahrscheinlich schon gar nicht mehr zu vermitteIn. Allerdings habe ich den Eindruck, man kann, jedenfalls wenn man die richtigen Leute trifft, lesen lernen: Man kann wirklich lernen, wie man zwischen den Zeilen liest, wie man Anspielungen versteht, wie man bestimmte Tricks durchschaut.
Holzer: Lesen also als Grundvoraussetzung fürs Schreiben?
Hensel: Ohne Lesen geht eigentlich gar nichts.
Holzer: Man kann sich also nicht einfach hinsetzen und sagen; Ich schreibe jetzt drauflos, erfinde die Literatur quasi neu, dazu brauche ich die alte nicht?
Hensel: Das glauben natürlich viele und es gibt auch viele, die machen das so und sagen, anderes interessiert mich überhaupt nicht, ich interessiere mich nur für mich selbst – aber das wird nichts. Ich kenne nicht ein einziges Beispiel von jemandem, der den Schritt in die Literatur geschafft hat mit dieser Haltung. Es gibt ja keinen Text, wo vorher nicht schon etwas war, es gibt keinen Text, der sich auf nichts bezieht.
Holzer: Aber muss man sich beim Schreiben gezwungenermaßen auf vorherige Texte beziehen?
Hensel: Das nicht, aber man muss wissen, was vor einem geschrieben wurde, nicht alles, das geht gar nicht, aber grundsätzlich.
Holzer: Woher kommen die Ideen und Anregungen für das, worüber Sie schreiben?
Hensel: Das, was mich umgibt, wo ich lebe, was ich sehe, wie ich es aufnehme, wie ich es sehe – das liegt alles sozusagen auf der Straße. Literatur speist sich ja aus mehreren Säulen: Aus dem Leben selbst, aus der Literatur und aus der Fantasie. Das sind die drei Dinge, die miteinander verwoben und verzahnt sind. Und man muss eben auch etwas zu sagen haben.
Holzer: Zum Thema des Interpretierens von Gedichten. Ich selbst muss ehrlich zugeben, dass ich nicht bei allen Ihren Gedichten weiß, was dahinter steht, und finde es auch nicht immer heraus. Ist es für Sie frustrierend, wenn der Leser nicht versteht, wie Sie ein Gedicht gemeint haben oder was Sie damit gemeint haben?
Hensel: Das merke ich ja gar nicht oder kaum. Es ist auch so: Ein Gedicht, das verschlüsselt ist und mehrere Ebenen hat, verstehen, interpretieren oder analysieren, auch das kann man lernen. Man braucht eben ein gewisses Hintergrundwissen. Ich denke, man muss Symbole kennen, man muss ein Gespür für poetische Sprache, für Metaphern haben, man muss vielleicht auch die Bibel, die Antike, die Geschichte kennen. Ich sage jetzt: Man muss – es gibt eben so viele Anspielungen bei allen Gedichten, da kommt man nicht drum herum. Und was man jetzt nicht kann, kann man vielleicht in zehn Jahren, wenn man sich weitergebildet hat. Wenn ich daran denke, wie ich mit 20 Jahren Gedichte von Ingeborg Bachmann gelesen habe … Zehn Jahre später war das schon ganz anders. Klar hat jedes Gedicht einen Hintergrund und man muss vor allem in der Lage sein, mit Assoziationen zu arbeiten. Es gibt unassoziative Menschen, die können überhaupt nichts mit Gedichten anfangen, weil das Gedicht nicht pure Sprache ist, sondern verschlüsselte.
Holzer: Muss man denn, um Ihre Gedichte verstehen zu können, etwas über Sie als Person wissen oder über die Zeit, in der Sie leben?
Hensel: Über mich muss man gar nichts wissen. Aber man muss, denke ich, schon über die Zeit oder über die Zeiten, in denen der Autor gelebt hat, Bescheid wissen. Man muss wissen, in welcher Zeit seine Gedichte entstanden sind, weil ohne Zeitgefühl nichts passiert. Um einen Autor zu verstehen, kann man auch nicht nur den einen lesen, sondern man muss eben wirklich die ganze Korona der Autoren lesen, die in der Zeit gelebt haben. Ohne Brecht oder Müller erschließen sich viele meiner Gedichte nicht, es hängt alles miteinander zusammen. Oder wenn Sie ein Gedicht von Brecht analysieren wollen, geht es nicht ohne das Wissen über die Literatur, die er wiederum gelesen hat. Es ist eine unheimliche Fleißarbeit.
Holzer: Oft bauen Sie ja auch direkt Zitate anderer Autoren in Ihre Gedichte ein, in dem Gedichtband Bahnhof verstehen beispielsweise von Gottfried Benn. Ein Problem, wenn man seine Gedichte nicht kennt oder Benn gar nicht kennt…
Hensel: … dann muss man Benn lesen.
Holzer: Kommt es denn vor, dass ein Leser mit einem Ihrer Gedichte zu Ihnen kommt und es erklärt haben möchte?
Hensel: Nein, und das lehne ich auch ab. Ich geben manchmal Hilfestellung, das passiert aber selten. Zu toten Dichtern kann man auch nicht gehen und sagen: Erklär’ mir mal. Außerdem ist es meistens so, dass der Schriftsteller oder der Dichter sich ganz schwer tut, selber seine Arbeit zu erklären. Denn wenn es da noch etwas zu erklären gäbe, hätte er es ja anders geschrieben. Ern Gedicht ist nicht bis aufs Letzte erklärbar. Man kann es aber schon entschlüsseln und bis zu einem gewissen Punkt auch benennen.
Holzer: Die einzige, richtige Lösung für ein Gedicht – gibt es die überhaupt?
Hensel: Nein. Es gibt nicht die einzig richtige Lösung, aber es gibt auch keine unendlichen Lösungen. Gedichte, die unendlich interpretierbar sind, sind keine guten Gedichte. Wenn jeder etwas anderes darin sieht, ist der Text schwach. Aber das kommt immer auf die Fähigkeit des Rezipienten an: Wie stark kann er assoziieren, was kann er selbst an eigenem Leben, an eigenen Erfahrungen hineinbringen? Deswegen gibt es keine Eins-zu-eins-Interpretation.
Holzer: Denken Sie, dass – etwa bei Lesungen, in der Schule oder auch in Seminaren an der Universität – manchmal auch zu viel interpretiert und in Gedichte gelegt wird?
Hensel: Ja, es wird oft überinterpretiert. Das ist aber nicht schlimm, denn ein Gedicht ist auch Material und mit diesem Material kann man arbeiten. Es kann natürlich totale Fehlinterpretationen geben.
Holzer: Beispielsweise haben wir in unserem Seminar über Gegenwartslyrik Ihr Gedicht „Die greise Schlaraffia lüftet ihren Rock“ analysiert und einer der Studenten assoziierte bei diesem Titel die Anfangsszene der Blechtrommel von Günter Grass, in der die Großmutter ihre zahlreichen Röcke lüftet, um einem Fliehenden Unterschlupf zu gewähren. Handelt es sich hierbei dann um eine Überinterpretation?
Hensel: Das ist eine wunderbare Assoziation. Selbst wenn ich die nicht gedacht habe – wenn sie im Gedicht drin ist, ist es richtig und gut und man kann überhaupt nichts dagegen sagen. Ich kann es gar nicht mehr so genau nachvollziehen, ob ich diese Assoziation beabsichtigt habe. Es kann sein, aber das merke ich mir nicht. Dieser Prozess des Arbeitens geht einher mit allem, was ich gespeichert und aufgesogen habe, auch an Literatur.
Holzer: Sehen Sie es als Problem, dass viele das lyrische Ich mit Ihnen als Person, also mit dem Autor oder der Autorin gleichsetzen?
Hensel: Das ist in der Tat eine Schwäche der Literaturkritik, dass man immer denkt, dass das Ich in der Literatur gleichzeitig der Autor oder die Autorin ist. Obwohl Lyrik wohl die Literaturgattung ist, die am persönlichsten ist. Aber ich schreibe zum Beispiel so gut wie gar nicht von mir selbst; andere tun das allerdings.
Holzer: Aber gerade auch Ihre Liebeslyrik hat zumindest den Anschein, sehr persönlich zu sein. Vielleicht denkt der Leser deshalb schnell, dass hier der Autor oder vielmehr die Autorin spricht.
Hensel: Natürlich, aber das ist auch eine Kunst, dass man etwas wirklich persönlich schreibt, ohne sich selbst zu meinen. Eigene Erfahrungen stecken ja drin. Aber das Autoren-Ich ist nie wirklich deckungsgleich mit dem lyrischen Ich.
Holzer: Worauf kommt es Ihrer Meinung nach beim Interpretieren eines Gedichtes an? Wie analysieren Sie selbst ein Gedicht – haben Sie eine Methode dabei?
Hensel: Erst einmal, indem ich immer am Text bleibe. Ich nehme Vers für Vers und sehe, was an Assoziationen stattfindet. Beim Entschlüsseln ergibt sich das wie ein Maggiwürfel, wie ein Konzentrat und dann muss man das Wasser der Gedanken darüber kippen, damit es eine Suppe wird. Und diese Gedanken müssen nacheinander kommen. Es gibt auch kein Rezept dafür. Ich zwinge meine Studenten immer, den Kopf einzusetzen und alles, was sie wissen und mitbringen und assoziieren, dafür zu verwenden. Es gibt sicher wissenschaftlichere Methoden, Wissenschaftler machen das anders – aber ich bin kein Wissenschaftler. Doch ich glaube, ich kann trotzdem Gedichte analysieren. Bei allen Gedichten muss man auch lernen, einen historischen Blick zu haben. Man muss mit den Köpfen anderer denken können. Das ist auch so eine Schwierigkeit, die verkümmert ist. Man denkt immer: Gefällt es mir, stimmt es mit meinem jetzigen Lebensgefühl überein oder nicht? Aber die Fähigkeit zu erkennen, dass andere Köpfe anders denken, ist etwas, das ich wirklich empfehle.
Holzer: Sie sind ja auch eine Person der Öffentlichkeit: Ab und zu ist in den Feuilletons von Ihnen zu lesen, manchmal machen Sie Lesereisen durch Deutschland. Wie gehen Sie damit um, bekannt zu sein, gefragt zu sein, angefragt zu werden?
Hensel: Also, ich bin nicht populär. Es gibt sozusagen verschiedene Grade der Prominenz oder der Bekanntheit und ich bin bei wenigen bekannt. Es gibt einen kleinen Kreis der Kenner und das ist auch gut so. Diese Sucht vieler Leute, mediengerecht zu sein, angefangen beim Äußeren bis hin zur Vermarktung, ist nicht mein Ding. Das habe ich auch gar nicht nötig. Dadurch, dass ich einen Brotberuf habe, muss ich keine solchen Sachen machen. Aber ich freue mich natürlich, wenn jemand kommt und fragt – da freut sich, glaube ich, jeder. Ein-, zweimal im Monat gibt es Lesungsanfragen, das mache ich immer ganz gerne. Aber mehr auch nicht.
Holzer: Wollten Sie immer einen gewissen Grad von Erfolg und Bekanntheit erreichen, zumindest als Sie angefangen haben zu schreiben? Mit 17, 18 Jahren träumen ja viele vom großen Ruhm.
Holzer: Nein, daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Es hat mich auch nicht interessiert, weil ich gar nicht wusste, was das ist. In der DDR war es anders mit dem Erfolg. Es war ja nicht wie heute, wo Erfolg Medienpräsenz bedeutet und Geld und Preise. Aber irgendwann wollte ich dann natürlich, dass die Leute, die meine Geschichten hören und lesen, etwas damit anfangen können, damit auch provoziert werden. Das wollte ich schon, das ist aber nicht der Erfolg, den Sie meinen. Mein Ehrgeiz war und ist immer, den Text möglichst gut zu machen, sodass er stimmt. Was dann in der Öffentlichkeit damit geschieht, ist nicht mein Problem. Der Text kann ja auch verrissen werden.
Holzer: Ob es dann ein Bestseller wird oder nicht…
Hensel: … das ist eher ein Problem des Verlages. Die haben natürlich immer die Hoffnung, es verkauft sich gut. Meine Bücher werden keine Bestseller, aber das ist nicht mein Problem.
Holzer: Ist es auch eine Chance, beispielsweise bei einem Interview für eine Zeitung etwas loswerden zu können – vielleicht auch politisch?
Hensel: Wenn ich wirklich etwas zu sagen habe zum politischen Alltag oder zum aktuellen Geschehen, dann geschieht das nicht über ein Gedicht oder eine Erzählung, sondern entweder über einen Zeitungsartikel oder über den Rundfunk. Es gibt verschiedene Podien, wo man etwas sagen kann. Als ich so Mitte, Ende 20 war, habe ich so etwas öfter getan und habe auch viele Dinge gemacht, die ich heute nicht mehr machen würde; aber das muss auch so sein. Das Interesse, mich in einem bestimmten Literaturbetrieb zu engagieren, ist nicht mehr sehr groß. Das tun andere Leute, mit anderen Mitteln und anderen Charakteren.
Holzer: Denken Sie, ein Dichter sollte politisch sein oder kann er auch zu politisch sein?
Hensel: Jedes Gedicht ist irgendwo politisch. Selbst ein Kitschgedicht über Blümchen zeigt eine Haltung gegen etwas. Doch wenn sich der Dichter zu sehr einlässt mit Parteien und Regierungen, wenn er im Schulterschluss mit den Herrschenden steht, lehne ich das ab. Aber der Dichter ist ein Bürger und als Bürger muss er für sich selbst entscheiden, wie weit er sich engagiert. Das muss aber gar nichts mit der Dichtung zu tun haben, sondern mit ihm als Mensch, als Persönlichkeit. Da unterscheidet er sich nicht von den anderen, der eine macht’s mehr, der andere weniger. Wobei ich immer denke: Alltagspolitik und Gedicht – meistens wird das nichts.
Holzer: Sie gehören ja auch zu denjenigen, die man unter die DDR-Autoren einreiht. In vielen Interviews mit Ihnen ist dieses Thema sehr präsent.
Hensel: Ich bin so eine Zwischengeneration, 1961 geboren, und natürlich sind fast 30 Jahre meines Lebens in der DDR geschehen. Das war mein Sozialisierungspunkt und jeder schreibt immer darüber, wo er herkommt, egal ob er aus der DDR kommt, aus Ostpommern oder sonst wo. Das ist Thema eines jeden Schriftstellers: Die Herkunft. Insofern hat mein Schreiben natürlich etwas mit der DDR zu tun. Aber inzwischen sind es so viele Jahre, die man schon in der neuen Welt lebt, die ja auch nicht von einem Tag auf den nächsten anders war. Ich würde mich nie als DDR-Schriftstellerin bezeichnen, sondern ich bin eine deutsche Schriftstellerin mit dieser Vergangenheit und andere haben eine andere.
Holzer: Es liegt wohl deshalb nahe, Sie als DDR-Schriftstellerin zu bezeichnen, weil in Ihrem Werk, gerade in der Prosa, das Thema Heimat und Herkunft eine wichtige Rolle spielt. Ihre Geschichten spielen in Sachsen, in Chemnitz, auch in Berlin.
Hensel: Ja, das sind eben meine Landschaften, die ich kenne. Bei Günter Grass würde man auch nicht sagen, das ist ein westdeutscher Schriftsteller oder ein Danziger oder was weiß ich was. Wenn es über die Provinz nicht hinausreicht, dann ist irgendetwas faul.
Holzer: Hat sich denn durch den oder nach dem Mauerfall etwas an Ihrem Schreiben geändert – da sich ja etwas in Ihrer Umgebung geändert hat?
Hensel: Wenn sich diesbezüglich etwas an meinem Schreiben geändert hätte, dann wäre das schlimm. Denn wenn ein politisches Ereignis ein ausschlaggebendes Element wäre, dass sich etwas am Schreiben ändert, dann macht man irgendetwas falsch. Man schreibt nicht im Sinne einer Gesellschaftsordnung oder einer politischen Richtung. Wer davon abhängig ist, für den ändert sich alles oder es bricht alles zusammen. Aber mich haben immer Menschen und Geschichten interessiert. Die gab es damals, die gibt es heute. Und wenn sich etwas ändert, dann höchstens, dass man mit Mitte 40 anders schreibt als mit 21, aber rein fachlich oder rein stilistisch. Wenn man meine ganz frühen Sachen und die jetzigen vergleicht, dann zieht sich, denke ich, etwas durch, was ich vorhin als Weltsicht beschrieben habe. Die hat sich nämlich kaum geändert.
Holzer: Wohin ich mit meiner Frage hinauswollte: Sie sagen ja, das Umfeld prägt einen Menschen und prägt das Schreiben – und Ihr Umfeld hat sielt seither doch in einer gewissen Weise verändert.
Hensel: Das Umfeld prägt den Menschen nur bis zu einer gewissen Zeit ganz entscheidend. Was danach kommt, sind Variationen. Menschen prägt vor allen Dingen die Kindheit und die Jugend und dann ist man geprägt. Dann muss man zurechtkommen, auch mit anderen Bedingungen.
Holzer: Haben Sie denn den Mauerfall damals begrüßt?
Hensel: Ich begrüße nie Dinge, die mit einer großen, jubelnden Masse vonstatten gehen, egal was das ist: Ob das der Weltmeistersieg der Fußballmannschaft ist oder der Fall der Mauer. Ich nehme es wahr und beobachte: Mal sehen, was wird. Natürlich war es Zeit, dass das ganze System zusammenbrach, aber das hat man irgendwie auch vorher schon gewusst. Nur dass es so schnell geht und so heiter – das nicht. Ich stand nicht da und habe gejubelt. Aber ich bin froh, dass es so ist.
Holzer: Denken Sie, es ist eine Schublade, in die man Sie schiebt, wenn man Ihre Herkunft oft so stark betont?
Hensel: Ja, Schubladen gibt es oft und man wird gerne in eine Schublade gesteckt oder katalogisiert. Aber wenn Literatur nur mit ihrem festgelegten Ort zu tun hat, dann ist sie langweilig.
Holzer: Wie ist es mit Literatur, katalogisiert als Literatur von Frauen? Ist es so, dass die Leute aufhorchen, wenn es eine Frau ist, die schreibt – spielt das eine Rolle?
Hensel: Das weiß ich nicht. Das Frauen-Thema ist überhaupt nicht mein Thema. Es gibt keine Frauen-Literatur, es gibt nur gute und schlechte Literatur. Ob die von einem Mann oder von einer Frau ist, ist völlig gleichgültig. Es gibt ja unheimlich viele Vereine und Organisationen, die sich nur mit Frauen oder Dichterinnen auseinander setzen, doch das halte ich für eine ziemliche Fehlstrecke. Es ist auch veraltet, so etwas festzuschreiben auf Frauen.
Holzer: Werden Sie manchmal in eine Reihe gestellt mit anderen schreibenden Frauen, vielleicht auch aus dem Osten – wie Anna Seghers oder Christa Wolf?
Hensel: Sicher. Es gibt ja sogar Lexika, zum Beispiel ein Frauen-Lexikon oder ein Literaturlexikon der Frauen, wo ich dann auch aufgeführt bin. Warum es solche Reihungen gibt – das gibt es halt. Klar kenne ich diese Schriftstellerinnen und beziehe ich mich auf sie; aber das tue ich nicht, weil es Frauen sind, sondern weil mich deren Literatur interessiert.
Holzer: Zum Thema Gegenwartslyrik: Gibt es dabei momentan eine Strömung? Die Literatur der vergangenen Jahrzehnte und Jahrhunderte wurde ja auch immer in Epochen eingeteilt, zumindest im Nachhinein.
Hensel: Es gibt heute so viele Strömungen, ich habe sie gar nicht alle im Kopf. Ich muss ehrlich sagen, ich habe den Anschluss verloren an das, was passiert in der Lyrik. Die neuen Medien spielen eine große Rolle: Es gibt Internet-Lyrik, Lyrik-Mails und vieles mehr. Doch ich arbeite ohne Internet und habe es nicht so mit den neuen Medien und Lyrik-Richtungen wie Rap oder Spoken Poetry. Ich nehme es zwar wahr, dass es das gibt, aber ich komme da nicht mehr rein. Das ist einfach etwas, das jenseits meiner Welt und meines Verständnisses liegt. Manchmal ist es der Fehler in der Literaturforschung oder -kritik, dass man Generationen trennt. Es gibt zum Beispiel eine Anthologie mit dem schrecklichen Titel Lyrik von Jetzt, da sind dann nur Leute drin, die 15 bis 25 Jahre alt sind. Es gibt aber Hunderte von Dichtern, die 40, 50, 60, 70 Jahre alt sind und auch Lyrik schreiben – jetzt, heute. Die Generationen werden abgeschnitten und eine neue Jugendgeneration soll reinkommen. Das finde ich sehr verhängnisvoll, denn es gibt natürlich sehr viel mehr Lyrik und Gedichte von verschiedenen Generationen. Direkt einen Trend und eine Richtung zu bestimmen, wie man das noch nach 1945 konnte, wo es vielleicht drei Richtungen gab, könnte ich heute nicht mehr.
Holzer: Aber Sie setzen sich nach wie vor auseinander mit anderen Autoren und Lyrikern?
Hensel: Mit denen, die ich kenne, mit denen ich befreundet bin, die natürlich kaum jünger sind als ich, setze ich mich natürlich auseinander. Das nehme ich schon alles wahr. Aber die ganz jungen Autoren … Ich kenne sie fast gar nicht.
Holzer: Denken Sie, es wird heute noch Lyrik gelesen?
Hensel: Es gibt wieder einen richtigen Lyrik-Boom – Gott sei Dank. Jedenfalls hier in Berlin gibt es sehr viele Veranstaltungen: Lyrik-Nächte und -Festivals, monströse Dinge mit Event-Charakter. Es wird in der Tat wieder sehr viel Lyrik gelesen, vorgelesen, selber geschrieben. Ich finde das schon ganz gut, auch wenn diese Großveranstaltungen nicht mein Geschmack sind. Die Lyrik selber ist nicht tot.
Holzer: Welche Lyrik, hat Sie selbst in Ihrem Schreiben geprägt? Haben Sie Vorbilder?
Hensel: Es gibt so viele Gedichte, die ich gelesen habe und die mir irgendwie nahe gegangen sind – da kann ich mich jetzt nicht auf ein paar festlegen. Klar komme ich aus dem Stall von Brecht und ich habe als „Lehrmeister“ Lyriker gehabt, die auch aus diesem Stall kamen. Das ist eine ganz bestimmte Ästhetik oder Weltsicht derer, von denen ich komme: Das sind Bert Brecht und Volker Braun und Heiner Müller und Karl Mickel und Günter Kunert und Sarah Kirsch und Ingeborg Bachmann – also alles Leute mit einer bestimmten Weltsicht. Das hat mich sehr wohl geprägt. Ob das stilistisch nachweisbar ist, weiß ich nicht.
Holzer: Und jeder findet seinen eigenen Stil.
Hensel: Ja, wenn man den nicht hat, kann man sich nicht durchsetzen.
Holzer: Wenn man Ihre Lyrik liest und auch die Prosa, habe ich den Eindruck, es kommt tatsächlich eine ganz bestimmte Weltsicht zum Vorschein: Eine gewisse Skepsis, wenn auch immer verbunden mit Humor. Gerade bei den Gedichten im neuesten Band Bahnhof verstehen glaubte ich eine solche sehr skeptische, sogar resignative Weltsicht herauslesen zu können. Steckt hinter dieser Skepsis Pessimismus?
Hensel: Es ist eine realistische Weltsicht. Optimismus und Pessimismus sind keine literarischen oder Kunst-Begriffe, sondern das sind Zustände, in denen man sich befindet oder nicht befindet. Aber es geht ja um die Wirklichkeit, um die Welt, um die Gegenwart und die ist, wenn man die Augen aufmacht, nicht heiterer, als ich sie dargestellt habe. Der Weltzustand ist eben so – wie ist er denn sonst? Die Blümchenlyriker gibt’s ja auch. Man kann sich ja immer aussuchen, was man liest.
Holzer: Warum handelt es sich bei den Figuren in ihren Erzählungen so oft um Außenseiter?
Hensel: Weil mich die Mitläufer nicht interessieren – außer: Die Mitläufer werden Außenseiter. Siegertypen interessieren mich immer nur in dem Moment, wo sie herunterfallen.
Holzer: Oftmals kommen sogar dieselben Figuren vor: In Ihren Erzählungen und Romanen begegnet Ihrem Leser immer wieder die Semmelweis-Märrie und auch die Zwillinge Liese und Lotte Möbius.
Hensel: Ja, einige Figuren zitiere ich in meinen Romanen. Doch hinter diesen Dingen steckt nichts Tieferes.
Holzer: Woher kommen bei Ihnen die Anregungen für die Figuren, denken Sie dabei auch an Menschen, die Sie kennen?
Hensel: Manchmal, manchmal auch in der Physiognomie, aber nicht immer. Ich habe zwar auch schon Porträts geschrieben, wo sich die Leute wieder erkannt haben. Aber die habe ich immer so übertrieben, so überzogen, dass das nicht wirkliche Porträts sind.
Holzer: Sie schreiben Lyrik, Prosa, Theater- und Hörstücke – gibt es dabei eine Gattung, die Ihnen mehr liegt als die anderen? Warum benutzen Sie verschiedene Gattungen?
Hensel: In dem Moment, wo ich etwas schreibe, liegt mir immer nur das jeweilige Genre. Wenn mir etwas nicht liegen würde, würde ich es nicht machen. Es zwingt einen ja keiner dazu. Es gibt auch Dinge, die ich gar nicht schreibe, zum Beispiel Kinderbücher oder Krimis. Manche Dinge kann oder will ich nicht, an manchen Dingen habe ich kein Interesse. Man kann auch nicht jedes Ding in jeder Gattung verarbeiten, es gibt einfach Sachen, die gehen meiner Meinung nach nur auf dem Theater, oder es gibt auch Dinge, die gehen nur im Hörspiel.
Holzer: Interessiert Sie auch Film?
Hensel: Ich habe Drehbücher für drei Spielfilme geschrieben, das erste für den Regisseur Andreas Kleinert, dann einen Film für Stefan Trampe. Das geschah immer in Zusammenarbeit mit der Filmhochschule in Potsdam, wo ich auch eine Zeitlang Poetik für Schauspieler unterrichtet habe.
Holzer: Unterrichten einerseits, Schreiben andererseits: Sehen Sie das als Doppelbelastung?
Hensel: Nein. Es ist gut, dass ich einen Beruf habe, der mich zwingt, morgens aufzustehen, geregelt zu leben. Man kann es auch lernen, den Kopf frei zu bekommen fürs Schreiben. Andere haben das auch getan: Büchner war Arzt, Benn war Arzt, Kafka saß tagsüber in seinem Büro – das ging auch. Schreiben hat etwas mit Arbeit zu tun hat, mit Fleiß und Disziplin.
Berlin, Juni 2004
Aus: Andrea Bartl (Hrsg.): Verbalträume. Beiträge zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, Wißner-Verlag, 2005
Aufbruch 1989 – 2019 Erinnern Kerstin Hensel erinnert sich…
Brigitte Schwens-Harrant im Gespräch mit Kerstin Hensel – „Die Realität ist es, die übertreibt“.
Fakten und Vermutungen zum Poesiealbum + wiederentdeckt +
Interview
50 Jahre 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6
Fakten und Vermutungen zur Autorin + Facebook +
Archiv + KLG + IMDb + PIA
Porträtgalerie: Autorenarchiv Susanne Schleyer + Galerie Foto Gezett +
Dirk Skiba Autorenporträts + Brigitte Friedrich Autorenfotos +
Keystone-SDA + deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Kerstin Hensel liest das Gedicht „Erste Hoffnung“ auf der Großen Nacht der Poesie des 2. ÖKT in München.
Keine Antworten : Kerstin Hensel: Poesiealbum 222”
Trackbacks/Pingbacks
- Kerstin Hensel: Poesiealbum 222 - […] Klick voraus […]


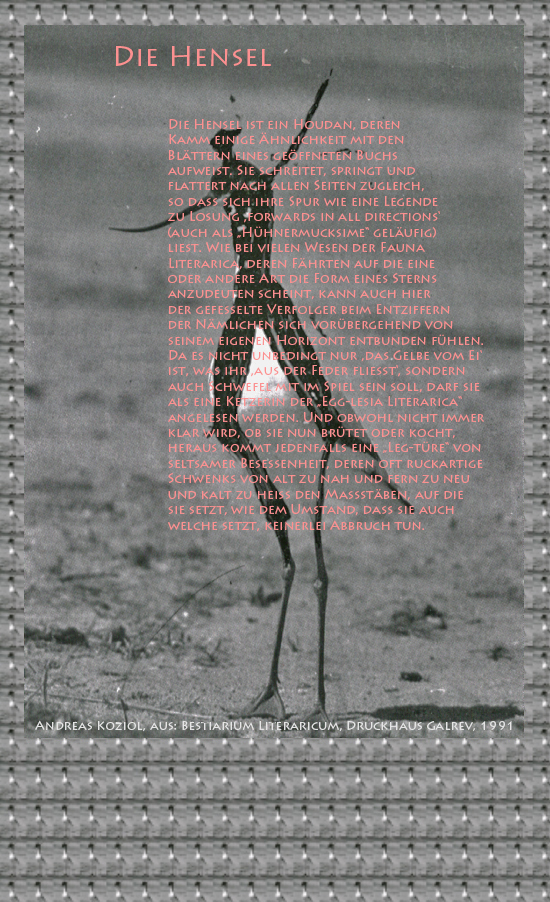
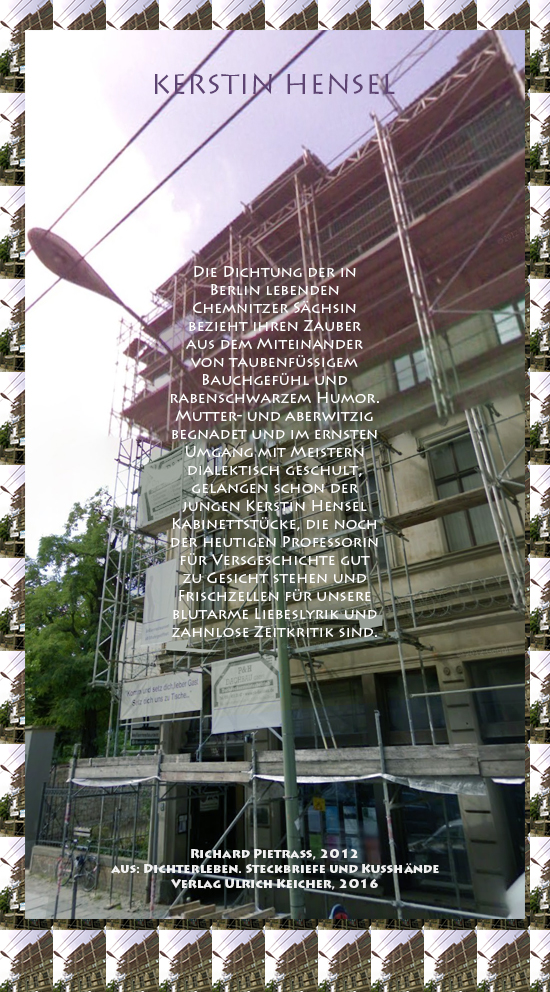












Schreibe einen Kommentar