Kurt Bartsch und Gerhard Melzer (Hrsg.): Alfred Kolleritsch
„ICH MAG MICH NICHT FORTSTEHLEN…“
Riki Winter: Ihr erster Roman Die Pfirsichtöter und Ihr erster Gedichtband erinnerter zorn erschienen im Jahr 1972. Warum haben Sie erst so relativ spät zu veröffentlichen begonnen?
Alfred Kolleritsch: Das hat biographische Gründe; auf der einen Seite war die Thematik, die ich in den Pfirsichtötern angeschnitten hatte, eine sehr persönliche. Ich habe Teile meiner Kindheit, das Aufwachsen in der Südsteiermark, im Umkreis eines Schlosses, sozusagen in einem Schloßpark, verarbeitet und habe das Erlebte in Modelle verpackt. Das heißt, ich habe versucht, philosophische Modelle und Strukturen mit diesen, meinen Inhalten zu füllen, die Inhalte durch diese Strukturen zu interpretieren. Im Grunde genommen war das ein sehr starkes und intensives Nahverhältnis zu dem, was als biographisches Material vorhanden war; das brachte eine gewisse Scheu mit sich, mit etwas herauszukommen, das eigentlich schon 1965/66 fertig war. Zum anderen habe ich erst in dieser Phase – 1960, als ich zum Forum Stadtpark kam – zu begreifen begonnen, was die Moderne ist, ich habe erst damals begonnen, moderne Literatur zu lesen und zu verstehen. Bis dahin war ich blockiert durch eine schlechte Ausbildung als Germanist und als Mittelschullehrer. Ich habe schon seit dem sechzehnten Lebensjahr geschrieben und mußte einsehen, wie fern ich damals von dem war, was für mich heute Schreiben bedeutet. Erst spät habe ich dann wirklich zu schreiben begonnen, eben in der Zeit, als die damals Jungen wie Wolfgang Bauer, Barbara Frischmuth oder Peter Handke von sich aus und vorab geschrieben haben. Das hat mich dann in eine weitere Konfliktsituation gebracht, war ich doch der, der die Zeitschrift manuskripte gemacht hat und der Ältere. Es scheint halt gerade das Jahr 1972 gepaßt zu haben, daß ich das aus der Hand gegeben habe, auch von meinen Freunden gedrängt, es zu tun.
Winter: Sie haben erwähnt, von einer schlechten Ausbildung geprägt gewesen zu sein – Sie waren allerdings auch schon früh beteiligt an der Gründung des Forum Stadtpark, an der Gründung der manuskripte. Es muß in Ihrem Umgang mit der Sprache, mit der Literatur schon so etwas wie ein Ahnen gegeben haben, daß man mit der Sprache zu anderen Ufern kommen könnte.
Kolleritsch: Ich habe schon in den späten 50er Jahren begonnen, mich intensiv mit der klassischen Moderne zu beschäftigen. Ich habe damals bei der Grazer Urania eine Arbeitsgemeinschaft zu Benn und Rilke geleitet, so bin ich durch diese Leuchten der Moderne mit der neueren Literatur in Berührung gekommen. Durch eine Begegnung mit Alois Hergouth kam ich ins Forum. Alois Hergouth, dieser steirische Dichter, den ich wegen seines weltanschaulich-kritischen – damals kritischen – Engagements sehr geschätzt habe. Ausschlaggebend war auch eine Lesung von Gerhard Rühm 1959 im Grazer Künstlerhaus und sein Auftreten bei den Samstagnachmittagskursen in der Grazer Urania. Damals habe ich begonnen, das mir Nahe in dieser Weise schreibend zu bewältigen.
Winter: War nicht die Beschäftigung mit der Literatur, vor allem mit der Literaturzeitschrift, die Sie herausgegeben haben, auch eine Motivation, an der eigenen Sprache weiterzuformen.
Kolleritsch: Sicherlich, die manuskripte waren ein begleitender Lernprozeß. Ich habe dann ja auch als Deutschlehrer bewußt mit den Formen der modernen Literatur gearbeitet und hab dadurch auch immer wieder Schwierigkeiten gehabt. Man kann ja in den manuskripten nachlesen, was veröffentlicht wurde. Vor allem die Begegnung mit der Wiener Gruppe, mit Gerhard Rühm, Friedrich Achleitner, Oswald Wiener, dessen Roman Die Verbesserung von Mitteleuropa ich in einigen Folgen in der Zeitung veröffentlicht habe. Das war für den Schreibenden, der auch Herausgeber war, schon eine schwierige Zeit, zu prüfen, ob man selber auch hinzutreten kann zu diesen Schreibenden. Und es war vor allem Oswald Wiener, der mir viel Zuspruch gegeben hat. Auf der einen Seite war ich der Ablehnende, der sehr viel zurückschicken mußte, auf der anderen Seite war ich derjenige, der sich erst mühsam in dieses Schreiben hineinfinden mußte.
Winter: Sie sind ja in all den Jahren – bis heute – der „Beurteiler“ von Literatur geblieben. Hat sich in den langen Jahren für Sie ein Kanon von Kriterien zur Beurteilung von Literatur herausgebildet?
Kolleritsch: Das ist begrifflich schwer darstellbar, man könnte vielleicht anhand eines Textes Kriterien vorlegen. Ich bin immer davon ausgegangen, daß ich Texte gelesen und gegengelesen habe. Die Kriterien sind immer beim sogenannten schlechteren Text gelegen. Man findet doch – vielleicht nicht automatisch, aber man könnte sagen prozeßhaft – das heraus, was einem als das Gewichtigere erscheint, bei all den Möglichkeiten des Irrtums. Oft habe ich im Unterricht versucht, fünfzehn oder zwanzig Gedichte, sogenannte gute und schlechte, vorzulesen und dann von Schülern Bewertungen einzufordern. Es war immer überraschend, daß die Texte von sich her so gesprochen haben, daß wir fast immmer zu einer hohen Übereinstimmung gekommen sind. Ich glaube, es wäre ganz schlimm, wenn man ganz genau so eine Art Poetik vorlegen könnte. Texte müssen sich ja auch erst bewähren dadurch, daß sie gelesen werden. Oft ist es auch vorgekommen, daß mir etwas nicht geeignet erschien, was dann doch einen guten Weg genommen hat. Ich habe meine Situation hier immer mit einem Fußballtrainer verglichen, der eine Fülle von Fußball spielenden Menschen vor sich hat und entscheiden muß, wer besser in die Mannschaft paßt, mit der man antreten will. Wenn es schief geht, fällt es doch weniger auf die Spieler als auf den, der sich für sie entschieden hat, zurück.
Winter: Wenn man Ihre Romane und Prosatexte überblickt, so tauchen immer wieder einige Themen auf, die quasi leitmotivisch durch ihre Literatur führen: das ist zuerst einmal das Prinzip der Ordnung. „Wer Gesetze verletzt, stört den Ablauf der Dinge“, heißt es zum Beispiel in den Pfirsichtöter. Die Ordnung, die sich wie ein Korsett um die individuellen Bedürfnisse nach sinnlicher Erfahrung, nach gedanklicher Freiheit legt.
Kolleritsch: Ich bin immer davon ausgegangen, daß das, was ich selber mitgelebt habe – ich will nicht sagen erlebt habe – das einfach mein In-der-Welt-Sein ausgemacht hat, für mich als Hintergrund gedient hat. Ich bin kein Schriftsteller, der mit Fiktionen arbeiten kann, so sehr auch Fiktionales in diesen Texten drinnen ist. Ich habe mich immer auf diese Erfahrungen zurückbezogen, weil ich ja auch von ihnen berichten wollte. Nun bin ich aber in dem Sinn kein Realist, der glaubt, er kann das, was er gesehen hat, abbilden. Ich bin also von der Frage ausgegangen, wie kann ich das, was ich gesehen, gehört habe, was man mir erzählt hat, verstehen. Verstehen kann man aber nur, indem man das, was gegeben ist, in eine Ordnung bringt und es heranträgt an Verstehensmodelle.
Winter: Ich habe den Eindruck, daß die Ordnung, von der in Ihren Büchern die Rede ist – gemeint ist jetzt nicht die Ordnung des Textes, die Struktur, sondern eine Ordnung, die Zeichen ist für Macht und Herrschaft –, daß diese Ordnung die Personen Ihrer Romane leiden gemacht hat. Es geht doch den Protagonisten Ihrer Romane immer wieder darum, sich zu widersetzen, sei es, daß sie wie Gottfried in der Grünen Seite die Sprache verlieren, weil er von der An-Ordnung des Bildes/der Bilder überwältigt, von einer Art Lähmung befallen wurde, sei es…
Kolleritsch: Das wäre der zweite Schritt; ich habe vorhin davon gesprochen, mit welchen Formen, Sprach- und Verstehensformen ich an diese Welt herangegangen bin, deren sogenannte Ordnungen durch diese Bücher für mich aufzubrechen waren. Ich habe das so versucht, daß ich in den Pfirsichtötern, aber auch noch in der Grünen Seite zu zeigen glaubte, welcher Herkunft, welchen Ursprungs diese Ordnungen sind, nach denen diese Menschen unbewußt – gar nicht bewußt – gelebt haben. Dabei sind mir philosophische Studien zu Hilfe gekommen, weil ich glaube, daß jede Gemeinschaft, jede Gesellschaft, in der Menschen leben, irgendwelchen Modellen folgt. Da habe ich in den Pfirsichtötern das Modell der Trennung von Bleibendem und Vergehendem ganz sinnlich vor Augen gehabt, und alles von mir Erfahrene und Erlebte hat sich darin erschlossen, das heißt, es hat sich in dieser Form ganz wunderbar dargestellt. Diese Vermittlung von oben und unten, Adel und Untertanen. Diese gesellschaftlichen und ökonomischen Strukturen waren nach solchen philosophischen Modellen noch weiter zu durchleuchten. Ich wollte an diesen Modellen Kritik üben, aber nicht von der Warte eines Gegenmodells aus, nicht mit einer neuen oder anderen Ideologie. Mir ist es darum gegangen, diese Ordnungsidentitäten zu brechen, wie Oswald Wiener einmal gesagt hat: schreiben heißt, mit der Brechstange in Identitäten hineinzufahren, aufzubrechen, aufzusprengen. Aber, ich bin nicht der Anarchist, der glaubt, das alles abschaffen zu können, und ich zitiere nicht gerne Karl Popper, aber wenn er sagt, daß es immer nur Entwürfe, Theorien, Hypothesen sind, mit denen man sich an der Wirklichkeit entlangschleicht, um sie zu verstehen, so muß ich ihm recht geben. Man sollte sich doch nicht irgendwelchen Wahrheiten auf den Rücken setzen und darauf durch die Welt reiten. Man sollte sich befreien von Wahrheiten.
Andererseits habe ich die Menschen, die ich beschrieben habe, immer sehr geliebt, auch wenn sie in diesen Formen, in diesen ,Wahrheiten‘ gelebt haben. Man kann sie nicht so eindeutig abqualifizieren, wie ich es selbst oft getan habe, weil auch das – im Wittgensteinschen Sinne – Lebensformen sind, Haltegriffe, an denen Menschen ihre Existenz aufhängen. Das darf man alles nicht so verachten, denn die Verächter, das sind meistens die Chefideologen, die hängen selber auch in ihren Sicherheitsgurten.
Winter: Sie haben von Brüchen, von Verunsicherungen gesprochen. Diese Brüche gehen in Ihrem Roman mitten in die Individuen hinein, das heißt, diese Herrschaftsverhältnisse machen Angst. Diese Angst schreiben sie nun Ihren Figuren – so könnte man sagen – in den Körper hinein. Man hat das Gefühl, daß Ihre Protagonisten diese Angst sehr körperlich erfahren. Dieses krampfhafte Verharrenmüssen in den Notwendigkeiten der äußeren Ordnung sucht und findet ein Ventil, eine sinnliche Erfahrung, die diesen Ordnungen und Ordnungsprinzipien, diesem Hin und Her zwischen Ordnung und Züchtigung nicht unterworfen ist: das Kochen und Essen. „Das war eine Geschichte, zu der man Schweinefleisch essen muß, sonst ist sie nicht zu ertragen“, liest man zum Beispiel an einer Stelle.
Kolleritsch: Wenn man es freudianisch sieht, kann man sagen, Angst taucht dann auf, wenn man sich Ordnungen gegenüber schuldig fühlt. Diese Angst, die in meinen Büchern auftaucht, ist die Angst, in dieser Ordnung zu leben. Sie entsteht dadurch, daß die Menschen nicht wagen, diese Ordnung anzuzweifeln, es gelingt ihnen aber auch nicht, sich mit dieser Ordnung gänzlich zu identifizieren. Letztlich ist das auch eine Ich-Schwäche, man hat sich nicht getraut, Ich zu sagen, vielleicht aus Ohnmacht, aus Feigheit, sicherlich auch aus realen Zwängen heraus. Das ist eine Seite dieser Angst. Wenn dem nun mitunter das Essen, das Sinnliche, das sinnliche Verwandeln entgegentritt, so meine ich auch den Umgang mit der Natur, mit dem, was dem Menschen gegeben ist. Diese Figuren haben ja nie sich selbst ganz leben können, man mußte auf Begierden verzichten, man hat all diese Möglichkeiten des menschlichen Daseins, die sich nicht zu einem System zusammendrehen lassen, nicht gewagt zu leben. Das macht ja auch die Spannung dieser Strukturen aus. Es war auch mein Ansinnen, mich von dieser Angst nicht fortzustehlen, sie als eine Möglichkeit menschlicher Erfahrung zu begreifen.
Winter: In Ihren Romanen kehren Sie immer wieder an die Orte Ihrer Kindheit zurück, die Südsteiermark, das Schloß Brunnsee, Graz. Ist Ihr Schreiben ein Entlangschreiben an der eigenen Biographie, oder anders gesagt, der Versuch, das Allgemeine im Individuellen wiederzufinden?
Kolleritsch: Ich glaube, daß überall auf der Welt sich Gleiches wiederholt, daß diese Ordnungen, diese Strukturen, von denen wir gesprochen haben, da und dort die Faktoren sind, die menschliches Zusammenleben bestimmen. Ich möchte es aber dort demonstrieren, wo ich auch die Erfahrung habe, ich mag mich nicht fortstehlen. Meine Selbsterfahrung ist eben an diese Orte gebunden, weil ich meine, daß ein Ort auch mehr ist, als man landläufig als Ort versteht, daß sich an einem Ort eine ganz bestimmte Form von Welt eröffnet. Das sehe ich also nicht als Flucht ins Regionale, sondern als ein genaueres Schauen dort, von wo man herkommt.
Winter: Würden Sie sich vom autobiographischen Schreiben im klassischen Sinne abgrenzen wollen?
Kolleritsch: Das will ich gar nicht, ich möchte nur diesen inzwischen in Mißkredit geratenen Begriff des autobiographischen Schreibens erweitern. Es ist bislang der gesamten Philosophie und auch der Psychologie nicht gelungen, wissenschaftlich eindeutig, semantisch klar zu definieren, was man unter einem Selbst zu Verstehen hat, und was eine „Selber-Lebensbeschreibung“ – wie es Jean Paul einmal genannt hat – eigentlich ist. Ich glaube nicht, daß es dieses abgekapselte Selbst gibt, mit seiner Innenwelt, in der dann der Schriftsteller auf verschiedenen Wendeltreppen auf- und niedersteigt, sondern für mich ist jedes Selbst draußen in der Welt. Von dem von dieser Welt gerüttelten Selbst wird dann die Biographie geschrieben, also die Beschreibung des Lebens. Leben heißt ja immer Mitsein mit anderen, da ist die Natur, das Ökonomische, das Politische genauso miteinbezogen. Goethe hat viel Autobiographisches geschrieben, aber das ist auch eine Darstellung der Zeit, in der er gelebt hat. Man hat Handke den Elfenbeinturm vorgeworfen. Selbst wenn er gesagt hat, „ich bin ein Bewohner des Elfenbeinturms“, so hat er darauf beharrt, daß das Ich, das Dasein, das er selber verkörpert, der Ort ist, wo die Dinge, die zu beschreiben sind, aufscheinen. Insofern bin ich für die Erweiterung des autobiographischen Schreibens und bin der Meinung, daß es auch kein anderes geben kann.
Winter: „Er schlug den Sohn, weil er das Fremde suchte“, heißt es einmal. Die Suche nach dem Fremden, nach dem hinter der Wahrheit, hinter der Ordnung Verborgenen – ist das die Aufgabe, die Sie Ihren Figuren, auch sich selbst auferlegt haben?
Kolleritsch: Ich würde sagen: schon. Diese Stelle aus dem Allemann ist eine meiner wichtigsten Erfahrungen gewesen. Diese so gefürchtete und ambivalent geliebte Vaterfigur über den Sohn herfallend, weil er in eine Situation geraten ist, die des Vaters Hoffnungen zerbrochen hat, – wo er aus Liebe zu sich selbst und zu dem Kind zur Verzweiflungstat schritt. Er hat das Negativ-Fremde bestraft. Das Kind hat in dem Augenblick, in dem es gezüchtigt wurde, mit dem Züchtiger Mitleid bekommen, Mitleid, weil es gesehen hat, hier tobt Verzweiflung. Ich habe das selber so oft erlebt, – wenn man jetzt zurückgeht ins nicht Beschriebene –, daß diese Enge nicht nur Grausamkeit ist, das ist auch Wehrlosigkeit, Verzweiflung, vielleicht eine grausliche Form des Protests.
Winter: Aber ist nicht diese Suche nach dem Fremden, nach dem Fremden, das zumeist hinter den gültigen Wahrheiten, Gesetzen etc. versteckt ist, ist das nicht auch ein positiver Aspekt, der sich durch Ihre Literatur zieht?
Kolleritsch: Das Fremde hat natürlich einen negativen Aspekt auch, das Dumpfe, Atavistische. Aber im Grunde ist ja das Fremde, das Noch-Verborgene dasjenige, das sich noch nicht erschlossen hat, das sich der Hoffnung verweigert, nicht enthüllt hat, noch nicht Ereignis geworden ist. Das macht die Innere Bewegung des Menschen aus, daß er in diese Fremde weitergehen will, um Erfahrungen zu machen. Der Hegelsche Weltgeist, der glaubt, daß irgendwann alle Widersprüche, das heißt alles Fremde sich zu einer großen systematischen Wahrheit auflösen wird, erfüllt sich nicht. Ich glaube auch nicht, daß die Menschheitsgeschichte so linear verläuft, das Fremde bleibt. Es wäre schrecklich, wenn es nichts Fremdes mehr gäbe, dann wäre alles fremd, alles.
Winter: „Hinter den Augen beginnt der Weg, der die Welt freigibt“, schreiben Sie in Ihrem Brief an den Sohn Julian. Was findet sich da hinter den Augen, eine Sprache der Lyrik, eine Sprache, die sich „der Selbstherrlichkeit des Verstandes widersetzt“?
Kolleritsch: Die sogenannte Wirklichkeit, die bewirkte Welt, scheint immer die Schwelle zu sein, hinter der es nicht weitergeht. Hinter den Augen aber, so glaube ich, gibt es eine verborgene Freiheit, die Welt immer wieder neu zu sehen, neu zu machen. Das könnte der Ort sein, wo die Welt freigegeben wird für Möglichkeiten, für neue Entwürfe, ob in der schreibenden Kunst, der bildenden oder der Musik. Das ist vielleicht das, was Kant die Einbildungskraft genannt hat, Sartre hat es die Freiheit genannt, den Ort, wo sich Welt in der Kunst erneuert. Dieser Brief an den Sohn meinte auch, daß jeder, dem sich die Welt erschließen soll, irgendwann erfahren soll, daß er sich dieser vorgegebenen Wirklichkeit letztendlich entgegenstellen kann oder könnte. Ich glaube, die Kunst ist der Ort, wo die – von mir etwas pathetisch bezeichnete – Welterneuerung geschehen kann. Die Wahrheit ist ein Geschehen, das vom Menschen immer wieder zu erfahren und zu ordnen ist.
Winter: In einer Rede mit dem Titel „Warum ich schreibe“ erzählen Sie, daß man Ihnen in der Schule auf sehr drastische Weise abgewöhnt hat, mit der linken Hand zu schreiben. Sie mußten sich auch da einer im Grunde willkürlichen Ordnung unterordnen. Am Ende dieser Rede heißt es:
Ich werde weiterschreiben und meine linke Hand suchen und wieder das finden, was mich der Dorfpfarrer gelehrt hat, und dazu die genauere, unverstelltere Welt suchen und die Erfahrungen, deretwegen man überhaupt die Augen öffnet.
Schreiben sie jetzt mit der linken oder der rechten Hand?
Kolleritsch: Ich schreibe mit der rechten Hand, ich denke links. Das bedeutet für mich, den Weg zu verlassen, der ausgetreten, der vorgegeben ist, zumindest immer auf den zweiten Weg zu achten, obwohl ich der Meinung bin, daß es viele viele Wege gibt. Besonders schön sind sie, wenn sie Holzwege sind.
Inhaltsverzeichnis
I. GESPRÄCH
– Riki Winter: Ich mag mich nicht fortstehlen
II. AUFSÄTZE, ESSAYS, ANALYSEN
– Manfred Mixner: Die Zeit ist das Ende der Wahrheit
– Gerhard Melzer: Im Zeichen des Schlosses
– Rüdiger Wischenbart: Ein Bild fürs Leben
– Kurt Bartsch: Das Ende der Wahrheit oder Erziehung zu Ideologieskepsis
– Helmut Heißenbüttel: … im Vertrauen, daß der Leser weiterdenkt
– Peter Strasser: Es gibt Tage, an denen die Dinge die Namen der Dinge sind
– Norbert Mayer: Die trügerische Welt der Wahrnehmung
III. KRITIKEN, REDEN
Zum Roman Die Pfirsichtöter (1972):
– Ludwig Harig: Die kurze Ewigkeit der Kapaune
– Eckhard Henscheid: Das ging leider schief
Zum Roman Die grüne Seite (1974):
– Herbert Gamper: Flucht in den Vulkan der Bilder
– Klaus Ramm: Die grüne Seite
– Wolfgang Bauer: Rede auf Alfred Kolleritsch
Zum Gedichtband Einübung in das Vermeidbare (1978):
– Peter Handke: Der tiefe Atem
– Beatrice von Matt: Bloßlegungen
– Nicolas Born: Einübung in das Vermeidbare
Zum Gedichtband Im Vorfeld der Augen (1982):
– Peter Horst Neumann: Frei sein für Dinge
Zum Gedichtband Absturz ins Glück (1983):
– Michael Krüger: Gedanken im Fleisch
– Wilfried Ihrig: Absturz ins Glück
Zu Gespräche im Heilbad. Verstreutes, Gesammeltes (1985)
– Urs Widmer: Gespräche im Heilbad
Zum Gedichtband Augenlust (1986):
– Herbert Wiesner: Wovon einmal die Rede war, ist aus der Rede fort
– Michael Buselmeier: Nichts für das Auge
Zum Auswahlband Gedichte (1988):
– Werner Krause: Fahne aus Eis
Zum Roman Allemann (1989):
– Thomas Rothschild: Wer leistet Widerstand – alle Mann?
– Gerhard Melzer: Der versiegelte Sinn
IV. VITA
– Franz Weinzettl: Daten zu Alfred Kolleritschs Leben und Werk
V BIBLIOGRAPHIE
– Franz Weinzettl
– Mitarbeiter dieses Bandes
NACHTRAG ZUR POETIK
für Alfred Kolleritsch
1
Gedichte sind mißtrauisch,
sie behalten für sich, was gesagt werden muß.
Sie gehen durch geschlossene Türen
ins Freie und reden mit den Steinen.
Sie führen uns fort.
Wenn wir sie aufhalten wollen, heißt es:
Es gilt das gesprochene Wort.
Jeder weiß, daß sie uns wegschreiben
mit wenigen vergeßlichen Zeilen.
Einmal las ich ein Gedicht
über Wolken, das wandernde Volk.
Es goß in Strömen. Und von unten,
wo sich der Teich langsam füllte,
hörte ich das Quengeln der Frösche.
2
Ein Wort aus jedem Monat nehme ich mit
auf meine grand tour ins Warten,
etwa sechshundert Worte, mein ganzes Leben.
Einige kann ich nicht mehr finden,
sie haben sich in Briefen versteckt,
die als vermißt gelten.
3
In Krakau kürzlich, zur Erinnerung
an Czesław Miłosz, kam das Böse zur Sprache,
wie es sich heute zeigt, im Gedicht oder
in andrer Verkleidung.
Einer aus Gdańsk, vormals Danzig, hatte es gesehn
im Sterben einer Frau, in ihrem Schmerz.
Es war herrliches Wetter in Krakau,
die Tuchlauben quollen über vor Menschen,
und Maria mit dem Lämmchen
gab sich alle Mühe, den Frieden zu wahren.
Das Böse war anwesend, das stand fest,
aber immer, wenn man es greifen wollte,
hatte man den Ärmel der Jacke eines Dichters
am Wickel, also nichts in der Hand.
4
Irgendwann versucht jeder Dichter,
ein Gedicht über Wasser zu schreiben,
über Wasser oder das Wasser,
eigenhändig.
Nicht wie die großen Maler,
die für jede Welle einen anderen Pinsel,
und für den eilenden Bach einen Schüler hatten,
und für das Meer einen Meisterschüler,
der die Welle malen konnte, wenn sie bricht,
sonst nichts. Man mußte den Hunger
des Meeres spüren, seine Unersättlichkeit.
Wir haben es schwerer.
Manche haben es bei der Anrufung belassen,
andere den Rhythmus der Wellen belauscht.
Auch das ruhige Wasser, das uns zeigt,
war und ist ein Motiv des Erschreckens.
Einer behauptete in einem großen Gedicht,
Wasser habe keine Erinnerung und keine Geschichte,
von ihm haben wir nie wieder gehört.
5. Theologische Fragen
Einer sitzt auf den Treppenstufen von St. Anna,
sein Yoghurtbecher halb gefüllt mit Münzen.
Er hat die Hosenbeine hochgezogen,
damit seine Wunden freiliegen oder das,
was einmal seine Beine waren.
Er sei unsterblich, mit diesen Worten
bettelt er um Geld, andre sterben meinen Tod.
Die jungen Leute im Café gegenüber
haben keinen Bock auf Offenbarung
und wissen nicht, was ihnen blüht.
6. Erster Januar, gute Vorsätze
Ich beginne ein neues Notizbuch
für Fragen, die keine Antworten brauchen.
Wie lange hält sich der Schnee
auf den Zweigen des Vogelbeerstrauchs?
Gestern ging ich im Traum
auf einer Rolltreppe in die falsche Richtung,
ich wollte die Rückgabezentrale aufsuchen,
mein Verfallsdatum war abgelaufen.
Woher kommt meine unerträgliche Sanftmut?
Und, wie schon in den letzten Jahren,
warum hat der Stein nicht eine Stimme?
7
Die Wolken rasen, als liefe ein Ultimatum ab,
und die Zweige, in denen der Wind sich verirrt,
schlagen verzweifelt die Luft.
Aus den Schulen der Stille
mit ihren hochgebildeten Fenstern
fällt kaum noch Licht auf meinen Weg.
Wissen ist nicht mehr schön,
es ergreift uns nicht mehr.
Ach, ihr weitblickenden Wolken!
Irgendwo spielen noch Kinder,
man hört ihr begeistertes Rufen.
Und plötzlich trudelt ein Ball
mir vor die Füße, und ein Kind befiehlt:
Spiel mit!
8
Auf den verschlafenen Wegen ging ich
Hinunter zum See, um der Post zu entkommen.
Seit Tagen redet der Briefträger mit mir
von den letzten Dingen: dem Duft
der Weidenkätzchen nach dem Regen,
der Wahrheitstreue unserer Erinnerungen
und daß man um Himmels willen Gott
nicht immer wieder mit der Vernunft
quälen solle. Unterm Redeschwall
steckt er mir Todesanzeigen zu,
schwarzrandige Briefe, mit Rilkes Versen
vom Hiersein bedruckt oder mit Benn.
Unsere Generation nimmt Abschied.
Welche Verse von uns werden es
in die Anthologie des Todes schaffen?
Der See lag vor mir wie schmelzendes Wachs,
ruhig und träge und ohne Tiefe,
wie ein kindlicher Traum des Glücks.
Michael Krüger
Alfred Kolleritsch im Gespräch mit Eberhard Büssem am 17.2.2006 in der Sendung alpha-Forum
Fakten und Vermutungen zu Gerhard Melzer + Kalliope
Fakten und Vermutungen zu Kurt Bartsch + IMDb + KLG + Archiv +
Internet Archive + Kalliope
Porträtgalerie: deutsche FOTOTHEK
Zum 75. Geburtstag von Alfred Kolleritsch:
Barbara Frischmuth, Friederike Mayröcker, Franz Weinzettl und Lydia Mischkulnig gratulieren
Zum 80. Geburtstag von Alfred Kolleritsch:
Harald Miesbacher: A. K., die manuskripte, ihre Autoren und ich…
manuskripte, Heft 191, März 2011
Rainer Götz: Rede zum 80. Geburtstag von A. K. Literaturhaus Graz (16.2.2011)
manuskripte, Heft 191, März 2011
Anton Thuswaldner: Alfred Kolleritsch: Der Dichter als Denker
Die Furche, 17.2.2011
Fakten und Vermutungen zu Alfred Kolleritsch + ÖM + KLG + IMDb +
Archiv 1 & 2 + Internet Archive + Kalliope
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Brigitte Friedrich Autorenfotos
Nachrufe auf Alfred Kolleritsch: NZZ ✝︎ falter ✝︎ SZ ✝︎ Standard ✝︎
Krone ✝︎ FAZ ✝︎ Kleine ✝︎ faust ✝︎ fixpoetry ✝︎ Tagesspiegel ✝︎ Furche ✝︎
Präsentation des Lyrikbandes Es gibt den ungeheuren Anderen von Alfred Kolleritsch im LITERATURHAUS GRAZ am 5.2.2013.
Ausschnitte aus der gemeinsamen Lesung von Alfred Kolleritsch und dem Grazer Schauspieler Daniel Doujenis.


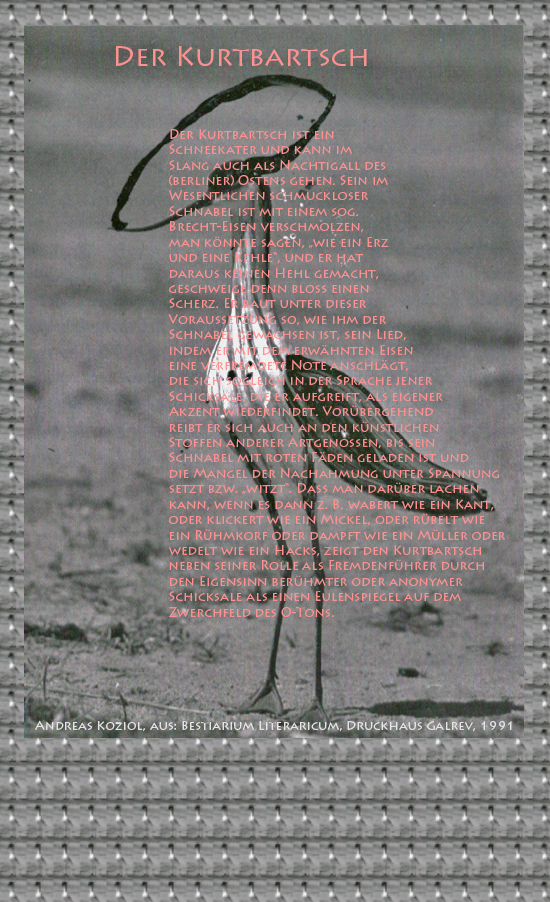












Schreibe einen Kommentar