Lutz Seiler: pech & blende
GRAVITATION
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaamit abstand
entstehen härtere zeichen. das bein
zuckt im traum, hörst du
aaaaadie blätter der strasse, insekten
auf tönernen füssen, die alte
führung verschwindet, gekippt nur
ein zucken innerhalb
des apparats. das schilf
spricht sich ein; morgen
werden die schlangen begradigt.
jedes gedicht geht langsam
von oben nach unten, von unten
nach oben, es verwahrt
seine sture natur, die sich noch
mit ihren abgebrannten blütenköpfen
nach der sonne dreht. das ICH
verkörpert sich selbst, wenn es
die decke zurückschlägt
greift es ohne zu zucken der mumie
ins herz. jedes gedicht
geht auf ameisenstrasssen
durch die schallbezirke seiner glocke.
am abend kehren wir müde zurück.
das spinnenbein
zuckt noch, weit abgeschlagen
vom hinkenden rest. ein rinnsal
am fenster und die robiniengeschwader, im knick
schon versteinert, machen mit schatten
alles dicht. der wind
zentriert uns im haus, während wir schlafen. während
wir eingerollt, angehockt
zurückkriechen in
die figuren der urzeit und was
uns über den gekrümmten rücken noch
hinausschiesst auf die eingeschneiten bahnen. jemand
wollte noch das wasser kontrollieren, jemand
notierte das gas. das ICH
liest den eisernen zähler, der
dir in den adern hängt: jedes gedicht
nagt am singenden knochen, es
ist auf kinderhöhe abgegriffen
und erzählt
Lutz Seilers Gedichte
sind „Erkundungen der Kindheitslandschaften zwischen Abraumhalde und paramilitärischen Formierungen, sie überzeugen durch ihre Intensität der sinnlichen Ausdruckskraft und ihre vielschichtige Bilderwelt. Seine ganz eigene, suggestive Stimme eröffnet einen glaubwürdigen poetischen Raum, wie er in der Gegenwartsdichtung selten zu finden ist.“, heißt es in der Begründung zur Verleihung des Kranichsteiner Literaturpreises 1999 an den Autor. In einer gehärteten Sprache außerhalb aller Moden sucht Seiler nach dem Essentiellen, nach den Spuren unseres Herkommens. Seine Gedichte rufen die dunklen Seiten unseres Daseins auf, graben tief im Vergangenen, legen dessen Schichten frei.
Suhrkamp Verlag, Klappentext, 2000
Sonntags wird der Himmel geschleift
– Wie die Bilder den Menschen in die Knochen fahren: Lutz Seiler, der Dichter der ostdeutschen Landschaft. –
Diese Stimme ist nicht sehr laut. Aber beharrlich. Sie hat sich Zeit gelassen. Um so sicherer trifft sie jetzt ihren Ton. Lutz Seiler, 1963 in Gera geboren, hat 1995 in einem kleinen Verlag seinen ersten Gedichtband veröffentlicht: berührt / geführt. Durch Lesungen und Beiträge in Zeitschriften fand er in den letzten Jahren ein größeres Publikum. Angesehene Literaturpreise hat er inzwischen gewonnen. Er lebt vor den Toren Berlins. Aber an der großen Stadt gehen seine Verse vorbei. Seine Stimmgabel ist auf seine Herkunftswelt geeicht, auf das östliche Thüringen, auf die Orte und Figuren einer Kindheit nahe den finstersten Industrieregionen der DDR. Der neue Band pech & blende trägt diese Finsternis an der Stirn, im Titel. Fügt man die beiden Teile zusammen, so hat man die „Pechblende“, das strahlende Uranerz, das in der DDR für die Atommacht Sowjetunion abgebaut wurde. Seit nunmehr zehn Jahren ist der Staat DDR untergegangen. In Seilers Gedichten tauchen seine Katastrophenlandschaften wieder auf. So der „tickende Schutt“ im Gedicht „grasland“, das so beginnt:
sonntags wird der himmel geschleift.
und, an den verträumten
todestagen ihrer dörfer, wiederholen
sie das spiel: aus der schonung kommt wind…
Es klingt nach Überhöhung. Aber tatsächlich hatten in dieser Abraumwelt manche Dörfer datierbare Todestage. So das Dorf Culmitzsch aus dem Titelgedicht des Bandes, das im Zuge des Uranabbaus vom Erdboden verschwand. Nach alter Bergbau-Mythologie sind die Steine die Knochen der Erde. Seiler greift die Vorstellung auf und macht zugleich umgekehrt die Knochen der Menschen zu Uranerz. Im Gedicht „doch gut war“ geht aus der Zerlegung der Redewendung vom „strahlenden Lachen“ die radioaktive Kontaminierung als Spaltprodukt hervor:
kehrte er heim, so lachte
ein mann mit strahlender Hand
Der Mann ist ein Vater. Er hat Kinder. Aus ihrer Perspektive faßt Seiler die Großangriffe auf die Landschaften, auf die Knochen ins Auge. Einmal laufen die Kinder um die Wette, die Eier dürfen dabei nicht vom großen Löffel fallen. Sie könnten immer weiter laufen:
bis über den oberen viehweg hinaus
bis ronneburg, bis grossenstein
bis dass die welt in scherben fällt
Ronneburg, Großenstein, das sind Ortsnamen, in denen sich das „Haldenglühn“, der strahlende Abraum, verdichtet. Aber Seiler geht es nicht um Reportage, um die Dokumentaraufnahme der Orte und Landschaften. Er sucht nach den Bildern ihres Inwendigwerdens: wie sie den Menschen in die Knochen fahren. Das gilt auch für die zweite Bildquelle, aus der diese Gedichte schöpfen, für die Welt der Ordnung, der Erziehungsrituale, der Geographiestunden und Besuche an sowjetischen Ehrenmälern. Über ihr schwebt das Gegenbild zur finsteren Pechblende: Juri Gagarin, der Mann im Kosmos. Er gehört – „mutter, vater, gagarin & heike“ – zur Familie. Er schwebt über „tischdienst“ und „milchdienst“, über die steifen Mützen der Schüler, über ihre „anstalt“ hinweg:
Wir hatten
gagarin, aber gagarin
hatte auch uns
Im letzten Gedicht kreist die tote, ungeliebte „hortnerin“, kreisen Ranzen, Brottasche und Turnbeutel „auf verlassnen umlaufbahnen“. Über dem Gedicht mit der Gagarin-Formel steht:
mein jahrgang, dreiundsechzig, jene.
Auf Jahrgänge blickt zurück, wer sich an seine Schulzeit erinnert. Aber nicht das Klassentreffen gibt hier die Perspektive vor. Sondern die Suche nach der exemplarischen Erfahrung, nach den prägenden Bildern der eigenen Generation. Dazu gehören auch die Alten, die das Jahrhundert seit 1914 in den Knochen haben. Das Exemplarische ist bei Seiler strikt ortsgebunden. Es ist, auch wenn einmal ein Lied von Procol Harum herüberweht, vom Osten nicht ablösbar. Und, vom ersten Gedicht an, nicht von der Peripherie, von den „Vororten“. So findet hier die Gegenstimme zur aktuellen Metropolensehnsucht in der deutschen Literatur ihren reinsten, vollkommen unprovinziellen Ausdruck. Man nehme nur den „grossraum berlin“:
letzte-kolonien-geruch & schwerer
einsatz an den lauben…
Präziser, mit avancierteren Mitteln als bei Seiler ist die Datschenwelt kaum je ins Bild gefaßt worden, die Nische als heimelig-unheimlicher Ort. Oder die weiße Elster bei Gera, Kanäle, an denen Jugendliche nächtlichen Musikdampfern nachblicken. Nur am Rande des Horizonts um Vorort und Abseits kommt das ganz große, das endgültige Fortgehen in den Blick:
wir wären wenn wir hätten
gehen können immer fort
bei uns geblieben
Lutz Seiler lebt in Wilhelmshorst, in jenem Haus, das Peter Huchel bewohnte, als er noch Chefredakteur der Zeitschrift Sinn und Form war, und entwirft das Veranstaltungsprogramm für die Huchel-Gedenkstätte im Erdgeschoß. Als die Kulturpolitiker der DDR Huchel die Zeitschrift nahmen, schrieb er das Gedicht „Der Garten des Theophrast“. Es erschien in dem Band Chausseen Chausseen (1963):
Tot ist der Garten, mein Atem wird schwerer,
Bewahre die Stunde, hier ging Theophrast
Lutz Seiler hat sein Gedicht „die poesie ist mein schiesshund“ Peter Huchel gewidmet. Es ist, mit seiner Abgrenzung gegen die „beschriftungshierarchien der stadt“, durchaus programmatisch. Und es gibt darin, als perspektivischen Fixpunkt, „die robinien theophrasts“. Aber technisch ist das Gedicht von Huchels poetischem Kosmos meilenweit entfernt. In der Welt von Sinn und Form oder bei Stephan Hermlin waren die Koordinaten von Zeit und Raum unter allen Katastrophenbildern noch intakt. Die Verse und Rhythmen waren noch Fluchtpunkte. Theophrast war von einem Schwarm großer Gestalten von Polybios bis Lear umgeben. Südlich-antike Landschaften versprachen Trost. Seiler hat sich davon energisch gelöst. Theophrast ist nur noch ein Einzelgänger, eine ferne Reminiszenz. Mißtrauisch gegen feste Reimschemata, wirft er seine Zeilen wie Girlanden über die Satzstrukturen, im Spiel mit Binnenreimen und Alliterationen, Dylan Thomas sehr viel näher als Peter Huchel. Die Vögel, allgegenwärtig und nicht selten vom Himmel fallend, verleugnen ihre surrealistische Abkunft nicht.
Täglich
pendelt der vorort unter
den bäumen stündlich
fallen am Himmel der höfe
zerriebene schwalben & sauber
gestopfte kommen herauf
Seilers Gedichte verlangen ein rhapsodisches Sprechen. Seine Stimme läuft an der langen Leine des Schriftbandes. Aber sie will nicht hinaus in den Rap oder die merkbare Einfachheit des Popsongs. Auffällig, aber unpolemisch abwesend sind in diesem Buch das Fernsehen, die Computer, die virtuellen Datenströme, das Englische. Es gibt nur das Radio, die Gagarin-Kindheit vor leuchtenden Röhren und Skalen, das Rauschen entschwindender Frequenzen. Während allerorten die Obsessionen der Virtualisierung, die Mythologien der Vernetzung und frei flottierenden Zeichen blühen, heißt hier das Grundgesetz „gravitation“, im Mehrfachsinn von „zu grunde gehen“. Es verlangt vom Gedicht die Nähe zur Kompaktheit der Dinge und Körper, die Erdung aller Strahlen und Ströme, die durch das Ich hindurchgehen:
jedes gedicht
nagt am singenden knochen,
es ist auf kinderhöhe abgegriffen
und erzählt
Dieses schmale, großartige Buch ist wie eine Muschel: ein Stück Deutschland ist darin eingeschlossen und rauscht.
Lothar Müller, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2.9.2000
Schwierige Schichten
Warum ist Robert Gernhardt gut und gern zwei Stunden zuzuhören? Dem Dichter ist ohne Ermüdung zuzuhören, weil den Gedanken seiner Gedichte ohne weiteres zu folgen ist. So leicht macht es der Lyriker Lutz Seiler seinen Zuhörern nicht. Nach dem vierten, fünften von Seiler vorgetragenen Gedicht mit eigenen Gedanken abzuschweifen ist keine Schande für die Zuhörer. Selten eignen sich Seilers Gedichte fürs sofortige Verstehen, sprich Verständigen. Seilers Gedichte brauchen die Geduld der Leser, die Lyrik lieben. „doch wenig / führt durchs gedicht. etwas vielleicht.“ schreibt der Leiter des Huchel-Hauses in Wilhelmshorst nicht selbstzweifelnd oder -kritisch in seinem Peter Huchel gewidmeten Gedicht. Allemal führt eher eine elegische denn erheiternde Stimmung durch Seilers Gedichte. Die Stimmung, nicht das Wesentlichste, kann das Eigentliche sein. Die Juroren, die den Lyriker 1999 mit dem Kranichsteiner Literaturpreis dekorierten, lobten die „vielschichtige Bilderwelt“, wie das Juroren schon 1001mal getan haben, wenn sie Lyrik beurteilen. Was wollen uns die Juroren damit sagen? Ist jene „vielschichtige Bilderwelt“ eine Welt, in der Bild auf Bild geschichtet ist? Ist jene Vielschichtigkeit nicht eher ein verdeckendes Dilemma denn ein Vorzug der Dicht-Kunst? Wer beim selbständigen Lesen der Gedichte Schwierigkeiten hat, zu den Schichten der Bilderwelt des Verfassers vorzudringen, sollte auf seine Gefühle achten, um wahrzunehmen, welche Stimmungen die Stimmungen der Gedichte möglich machen. Wer zum Fühlen bereit ist, wird am ehesten zum Autor neben dem Autor. Also der Leser, der die gedankenschweren, assoziativen Texte weiterschreibt. Das ist der Leser, der auch dazu in der Lage ist zu dechiffrieren, denn die Lyrik des Lutz Seiler liest sich wie ein Prosatext, in dem so manche Stelle geschwärzt ist. Um politisch, um polemisch zu sein, muß der Lyriker seine Lyrik nicht politisieren. Er muß nicht polemisieren. Ihm ist das Poetisieren Pflicht. Was nicht bedeutet, den reichlich abgegriffenen Lyrik-Wort-Schatz zu polieren. Vokabeln wie Himmel und Horizont, Sonne und Sterne, Mond und Meer, Wald und Wiese, Feld und Fluß hat Seiler zwar nicht verbannt. Wann immer jedoch Geläufiges sich vordrängt, immer drängt’s der Autor zurück. Die Diktion macht die Dichtung des Lutz Seiler so dicht, daß die Leser häufig draußen bleiben. Nur ein wacher Kopf und ein williges Gefühl öffnen Tür und Tor zu den Texten. Derart direkt und deutlich wie in dem Gedicht „im osten der länder“ ist der Dichter selten. Er sagt: „wir wären wenn wir hätten / gehen können immer fort / bei uns geblieben.“ Bei sich bleibt, wer seine Art hat, wie Lutz Seiler, und so, auf seine Art, bei Lutz Seiler ankommt. Das ist die Chance. Um die nicht zu verpassen, sollte die Warnung des Verfassers von pech & blende nicht mißachtet werden, der sagt: „jede deutung hängt uns weit / nach vorn zur luft heraus.“ Na bitte! Grund genug für den Rezensenten, sich nicht vom kalten Luftzug erwischen zu lassen.
Bernd Heimberger, Berliner LeseZeichen, Heft 8, 2001
Sprachverführung
– Suggestion und Wortmusik in Lutz Seilers Gedichten. –
Lutz Seiler kommt aus Gera. Dennoch ist er Lyriker. Ganz genau genommen stammt er nur aus dem Landkreis Gera, wenn auch in Sicht und Ruchweite der thüringischen Industriestadt. Von dorther, wo der reale Sozialismus kilometerlang die Erde aufgeschlitzt hat, um ihr aus den Eingeweiden das radiowellig strahlende Gold herauszuoperieren (zwecks Verwendung in friedensschaffenden Raketensprengköpfen). Aus dem Nirgendwo riesiger Abraumhalden, aus einer über und durch die Köpfe der Menschen plangewirtschafteten Kraterlandschaft, die jeden Geigerzähler jubeln läßt und bald in eine fröhlich strahlende Bundesgartenschau umgewandelt werden wird.
Wohin Seiler auch geht, die Verkarstung wandert mit. Zum Pionierbaubatallion hinter Dessau zum Beispiel. Dort wird sie, hat Seiler nach der Buchmesse vergangenen Jahres erzählt, zur absurden Spielwiese, auf der man aus Sand und Kiefernstämmen Flakstellungen und Panzer bastelt, um die elektronischen Argusaugen der Nato-Aufklärungsgeschwader mit diesen ,,Attrappen“ zu foppen. Dem zukünftigen Dichter erfüllt sich das kuriose Brachland erst mit Leben, als er einen makulierten Band mit Huchel-Gedichten aus dem Motordämmfilz seines Fünftonners holt – und „Horch, es rascheln Totenkronen. / Nebel ziehen und Dämonen“. Die Mondlandschaft bekommt einen Sinn: Sie wird Tribüne für die Winkelzüge poetischer Phantasie. Schimären gibt es auch in anderen Seiler-Geschichten, dieser zum Beispiel:
Ich ging im Schnee mit den nervösen Nachkriegspeitschenlampen im Genick über die Wiener Mozartbrücke. Dort hockte noch an einem Strick ein müder Irishsetter. Er war tot und wartete auf mich, das heißt, ich band den Strick vom Sockel des Geländers und begann das Tier ein wenig hin und her zu schwenken…
Die Geschichte findet sich im neuen Gedichtband, seinem eigentlichen Debüt, wenn man so will, denn ein dezent und schön illustrierter Vorgängerband im Oberbaum-Verlag (aus dem eine Handvoll Gedichte übernommen wurden) wurde 1995 von Kritik und Lesern nahezu übersehen. Jetzt hat der Suhrkamp-Verlag Seiler ins Programm genommen, und der Dichter erlebt seine eigene Wende – Stipendien und Preise stellen sich wie von selbst ein. Die Geschichte mit der vierbeinigen Schimäre an der Leine gehörte stets zum Korpus der gekürten Texte. Unter der Rubrik „Gedicht“ geht sie so:
ich ging im schnee mit den nervösen
nachkriegs peitschen lampen im genick
über die wiener mozart brücke dort
hockte noch an einem strick ein müder
irish setter […]
„Gedicht“. Entwurf zu einem Gedicht oder, trotz der sinnlich starken Prägung „nachkriegspeitschenlampen“, ein Erzähltext mit nachträglich arrangierter Zeilenneuordnung?
Wie auch immer, Geschichtenerzählen macht Lutz Seilers Dichtung letztlich ohnehin nicht aus. Und daß sie eine Art lyrische überhöhte Innenansicht des komatösen Honecker-Systems sei, wie in fast allen Rezensionen und Lobreden zu lesen und zu hören war, bestreitet der Dichter selbst mit gutem Recht. Seilers Poesie ist die Sozialisation des Dichters keineswegs Zweck, sondern Mittel. Er benutzt den Erfahrungsüberdruck, die Brandmarkung durch Kollektiv- und Parolenzwang, um sich in und mit der Sprache aus der Umklammerung des Diskursiven und offiziell Geordneten zu befreien. Die syntaktische Ordnung wird in einen halluzinatorisch mit Assonanzen und Metaphern aufgeladenen, rhythmisierten Klangassoziationsstrom überführt. So bedingungslos, daß Seiler den Manierismus nicht scheut – etwa die Klangkonstruktion um des Effektes willen wie in „wie gut / tat dann das ratten klatschen“ – und gemeinplätzige Dekrete der Art ,das geht heute nicht mehr‘ ignoriert, solange es der suggestiven Audition zugute kommt. Das ist, in Verbindung mit den phantasmagorisch fragmentierten Partikeln einer DDR-Sozialisation, eigenwillig und unverwechselbar, unerhört im buchstäblichen Sinne. Partienweise entfalten Seilers rhythmisierte Parataxen einen Sog, eine halluzinogene Intensität, die man unter seinen Generationsgenossen vergeblich suchen wird. Etwa in Seilers Echo des epochemachenden „Es kommen härtere Tage“:
mit abstand
entstehen härtere zeichen. das bein
zuckt im traum, hörst du
die blätter der strasse, insekten
auf tönernen füssen. Die alte
führung verschwindet, gekippt, nur
ein zucken innerhalb des apparats.
Berechtigtes Lob ist gefallen, verschwiegen wurde eines: Die Rückhaltlosigkeit, mit der Seiler sich jedem konzeptuell planenden Willen versagt, um sich der klang-rhythmischen Bilderassoziation ganz zu überlassen, irritiert und provoziert. Oft kommt er dem nahe, was man eine Spätform des automatischen Schreibens nennen könnte. Wo die Sprache regiert, zählen unsere Begriffe, wo der „Sinn“ endet, nicht mehr viel. Wir sind herausgefordert: Was ist bewußtseinserweiternder Kontrollverlust, was ist Willkür? „Wenn unser sinnen sorgsam seine schlafen / bettet in der luft lamellen“: Wer verführt hier wen, der Dichter die Sprache oder die Sprache mit den koketten Alliterationsdessous den Dichter, oder ist das womöglich sogar die falsche Frage, wenn sich ein Dichter zum Sprachrohr des anarchischen Eigenwillens der sprachlichen Assoziation macht? „einmal begründet sind wir ein bast / auf der borke“: Das spricht sich gut, aber ist es auch kunstvolle Musikalisierung oder eine Fingerübung in walhallischem Alliterationsweben? („Wie bang und bleich / verblüht ihr so bald!“). Wie weit darf die Assonanz hervortreten, ohne daß wir es statt musikalischer Intuition „Effekt“ nennen dürfen? Sprache soll unter Umgehung der Bewußtseinsinstanzen wie Bläschen aus einem tiefen gärenden Sud hervorplatzen, die Botschaft verstehen wir wohl – allein wie schwach darf die Zensur sein, um dem Unwillkürlichen, das sich um unsere Begriffe von Sinn nicht besonders kümmert, die Ehre zu geben? Und wann ist es keine unwillkürliche Assoziation mehr, sondern willentlich angestrengte Suche nach dem Entlegenen? Hier: „vergleiche / mit krätze-erloschenen hasen: als / zuerst deine füsse erblinden…“? Und wie ist es mit „die faust // bei der hand, den reim / an der wand begann ihr das wandern“. „hand“ – „wand“ – „wandern“, ist das nicht zufällige Silbenassoziation, der hinterher mühsam ein Sinn auferlegt wird? Dürfen wir fragen, wo die Scheidelinie liegt, hinter der das Zusammenzwingen eines Objekts mit einem kategorial unpassenden Verb nicht mehr Tagtraum, sondern bloße äußere Manipulation ist? „wir hissten […] / täglich die feuchte der angst / an unseren händen“. Sicher, solche Grenzziehungen hängen allemal an einem irreduziblen subjektiven Faktor, an der individuellen Konstitution der Phantasie. Doch widerstrebt der Poetik der klanglich-halluzinatorischen Selbsttätigkeit nicht, daß öfters deutlich die Handgriffe erkennbar bleiben, mit denen Seiler einander fremde Realitätsebenen verschränkt? Die vorsätzlich kategorial verschobenen Adjektive und Präpositionen etwa: „singende brände aus / asche&salz in den leitungsmasten“; „was geschieht ist vernebelt / vom speichel der vögel das ohr / schläft im öl“; „paar / pfund augen welpen unterm lid“. Und wo wird die Grenze des unwillkürlichen Schreibens zur bloßen Inszenierung eines solchen Schreibens überschritten, zum gar nicht unwillkürlichen, sondern sehr klar oder auch allzu klar gewollten Verdichten der Assonanz um seiner selbst willen? „so / brach sie die lachnot der schafe, tanzend, wie abraum / asche sich aufhob vom ofen- / blech“. Was ist Klangtaumel und was Assonanzwut? „die wurzel ihres hustens / leuchtete uns / die stiege herunter“: Daß Hustgeräusche die Treppe hinunterleiten, ist ein reizvolles Bild und verträgt durchaus eine Verfremdung durch das aufs Visuelle gehende Verb – das ja im übrigen auch in der Alltagssprache metaphorische Verwendung findet („heimleuchten“). Die auf die Vertauschung der Sinneskanäle aufgestockte zweite Verfremdungsebene durch das per u-Assonanz gefundene Genitivattribut, zerstört das nicht den suggestiven Reiz? Soviel Manierismus vernichtet den anschaulichen Kern, ohne daß eine tiefere Imaginationsebene dafür entlohnte. Mitunter verquickt sich der Trieb zum Silbenspiel mit lebensgeschichtlichen Splittern sehr glücklich:
pfiff ein betörend töricht
wanderlied.
Entlegen und doch plastisch und intensiv die Phantasie eines an den „zart verästelten gerippen“ von Hundekadavern entlangstreichenden und so ins Schwingen gebrachten Windes. Einfach und wirkungsvoll auch:
wir hatten
den tischdienst, den milchdienst.
Gleich darauf aber wird angehängt:
den druck
einer leerkraft in den augen gelee
in den ohren bis
sie verstummte
die schwerkraft
Schwerkraft, ein tönendes Ding? Eine Metapher für das Unmerklichwerden des Luftdruckes oder mißglücktes Bemühen um tieferen Sinn, weil die pure Klangassoziation, offensichtlich Aufhänger der Erfindung, nicht genügt?
wir hatten alpaka
am ascher, die nägel, verrissen
& einsam wie crusoe im schiefer, tief
im radio schlief das radiokind mit
röhren&relais
Das Komprimieren der Vorstellung eines ganz ins radiophone Tönen versunkenen Kindes zum Bild eines koboldartigen, ,schlafenden radiokindes‘ ist betörend. Doch ist die Verkettung der Glieder durch „schiefer“ – „tief“ – „schlief“ Intuition oder Mechanik? Und ein Vergleich wie der mit dem Nagel, „einsam wie Crusoe“, das ist der Tod der Sinnlichkeit. „alpaka am ascher“: In den siebziger Jahren, als Alpakawolle eine Unzahl von Wohnzimmern zierte, war das physisch gut möglich, doch die Gefahr, ein walhallischer Willkürakt zu sein, ist groß. Seiler ist ein imponierend radikaler Grenzüberschreiter, aber wie alle Grenzgänger stets gefährdet: Der Grat zwischen Musik und Geraune ist schmal: „ein / ostvorstädtischer tanzpädagoge / langsamer als alraun, gebar…“; „zusammen gefasst / steht man wie ast“, „am haar aus / blankem gestank“. Es geht der Sprache an solchen Stellen wie einem, der allzu lange, über das Stadium der Entzückung an der freigesetzten Energie hinaus, in die Sonne gesehen hat. Man kneift die Augen zu und torkelt halb berauscht, halb schmerzverzerrt dahin – und jetzt sollen wir glauben, die farbigen Flecken hinter den Lidern seien nicht einfach ein Phänomen physischer Überreizung, sondern in jedem Falle ein mystischer Schimmer. Andererseits gibt es ja auch jene hehre Tradition, nach der man unter Aufbietung von viel Weisheit alle Selbstschutzreflexe ablegen lernt, sich unaufhörlich singend im Kreise dreht und taumelnd und schwindelnd entrückte Zustände erreicht. Eigenartig bei alledem, daß Seilers Talent gerade dort, wo er seinen Willen zum Gesuchten nicht ganz hoch spannt, am sichersten wirkt.
beim urinieren, im schutzwald
beim sprechen, wir hatten
zitate: dass wir den schattenseiten des planeten
wenigstens eine lichte entgegenhielten
erst alle gemeinsam & dann
jeder noch einmal still für sich, wir hatten
kein glück […] wir grüssen gagarin,
wir hatten kein glück, abfahrt, zurück
in unsere dörfer…
Genügt das nicht, ein solch gelassenes Parlando, in das die Assonanzen wie kunstvoll improvisierte Verzierungen in eine ariose Melodie treten? Wenn das Vertrauen in die anschauliche Erfindungskraft da ist, überzeugt jedenfalls das Prosanahe vorbehaltlos:
sonntags dachte ich an gott, wenn wir
mit dem autobus die stadt bereisten.
Denn jetzt geht es vorbei an einem Ziegelsteinelektrizitätshäuschen am Teichrand und „dort / im trafo an der strasse wohnte gott. Ich sah / wie er in seinem riest aus kabel enden / hockte“, der „liebe gott; er war / unendlich klein & lachte oder schlief“. So ist vielleicht, neben den geglückten dithyrambischen Momenten, das Unauffälligste das Beste in diesem Buch. Etwa das kindliche Zwiegespräch „mit dem haarteil meiner mutter“ vor dem Schlafengehen. Oder das Liedchen von einer „prima ballerina“, das in der Art von Aufziehpüppchen einen kleinen Tanz nur für den Schnapstrinker allein aufführt. Auch die sinnreichen, dafür oft schlicht gegenrhythmischen Willkür-Enjambements, über die man ein wenig hinwegholpern muß, zerstören in diesen Fällen des temperierten Selbstvertrauens den Zauber nicht.
Sebastian Kiefer, neue deutsche literatur, Heft 534, November/Dezember 2000
„Wir hatten Gagarin, aber Gagarin hatte auch uns…“
– Der lyrische Königsweg des Lutz Seiler. –
Was ist das für ein Stoff, aus dem die Gedichte des Lyrikers Lutz Seiler geformt sind? Die Farbe seiner Poesie, so ergibt der rein physikalische Befund, ist schwarz. Diese Schwärze ist nicht gleich als melancholische Signatur seiner Dichtung zu interpretieren, sondern als Gestalteigenschaft der Dinge, die in ihr vergegenwärtigt werden. Denn der Stoff der Erinnerung, den der Dichter Lutz Seiler in seinen Texten poetisch verdichtet und komprimiert, ist buchstäblich kontaminiert mit einem Material, das man als zähflüssiges schwarzes Industrieprodukt kennt, pech & blende kündigt uns sein Gedichtband an – und man darf diesen Titel als Hinweis auf die hoch giftige Materie lesen, die die Kindheitslandschaft des Dichters geprägt hat. Lutz Seiler wurde 1963 in dem ostthüringischen Dorf Culmitzsch bei Selingstädt geboren, ein kleiner Provinzflecken, der 1968 dem Erdboden gleichgemacht wurde, als sich der Uranbergbau des grauen Industriestaates DDR durch die Landschaft fraß. Ein Abfallprodukt des Uranbergbaus ist aber das so genannte Uranpecherz, ein stark radioaktives, meist kristallines und schwarz glänzendes Material, das auch „Pechblende“ genannt wird, pech & blende: Dieser Titel verweist also auf die radioaktiv verseuchte Heimaterde des Dichters, wie auch in einer zweiten gegenläufigen Konnotation, auf gleißende Helligkeit. Denn mit einer Art „Blende“, jener Apparatur bei optischen Geräten, mit der die Bildeinstellung gesteuert wird, erzeugt Lutz Seiler seine suggestiven Bilder einer Kindheit zwischen Abraumhalden und archaischer Ländlichkeit.
So führt uns das Titelgedicht des Bandes den Weg vor, den diese Gedichte gehen: In sehr dicht gefügten Versen, die viel sinnliche Details aufnehmen und doch wie surrealistische Rätselbilder anmuten, nimmt uns Lutz Seiler mit auf die Reise in die Kindheit, jene Gegend zwischen Culmitzsch und Selingstädt, wo sich die Urszenen seines Lebens vollzogen haben. Im „pech & blende“-Gedicht versammelt Lutz Seiler jene Basiswörter und Leitmotive, die auch in den übrigen 46 Gedichten immer wieder auftauchen: Wörter wie „Knochen“, „Uhr“ oder „ticken“. Andere, fast magisch zu nennende Schlüsselwörter sind „Holz“ und „Schwere“, In gleich drei Gedichten benennt Lutz Seiler die öffentliche Heldenfigur, die seiner Generation, jenem „Jahrgang dreiundsechzig“, der in den Gedichten mehrfach apostrophiert wird, als eine Ikone des Sozialismus angepriesen wurde:
mein Jahrgang, dreiundsechzig, jene
endlose folge von kindern, geschraubt
in das echo gewölbe der flure, verkrochen
beim gehen gebeugt in die rasche
eines anderen, fremden mantels, sieben
voll wachs mit einer aus dielen geatmeten schwere, acht
mit einer aus piss-
becken zu kopf gestiegenen schwere, wir hatten
gagarin, aber gagarin
hatte auch uns…
Der Elementarzustand dieser Gedichte, auch des lyrischen Subjekts, das sich an die Bilder der Vergangenheit herantastet, ist also eine „Schwere“, die ebensosehr mit Melancholie wie mit der physikalischen Beschaffenheit der Dinge zu tun hat, die in den Texten aufgerufen werden. Lutz Seilers Gedichte haben etwas von der Art eines schweren Traums, in dem der Dichter die von Gewalt verheerten Schauplätze seiner versunkenen Kindheitslandschaft durchschreitet.
Mit dieser Lebenswelt aus radioaktiven Abraumhalden, düsteren Behausungen und Orten paramilitärischer Internierung scheinen auch die Akteure verschwunden zu sein, etwa jene „lisa rothe“ aus dem großartigen Gedicht, in dem nur noch „der abdruck eines schlafenden kopfes“ von der Spur des Subjekts kündet. All diese Orte der Unheimlichkeit, an denen das „haldenglühn“ einsetzt oder an denen in dunklen Kellern menschliche Halswirbel auseinander knacken, untersucht Lutz Seiler als lyrischer Archäologe des Ostens. Dabei ist die poetische Stimme dieses Dichters von außerordentlicher Suggestivität. Dieser suggestive Ton findet nun endlich, nach langer Begriffsstutzigkeit der professionellen Lyrik-Leser, die öffentliche Resonanz, die er verdient.
Seilers erster Gedichtband berührt/geführt, aus dem er nun einige Texte in den neuen Band übernommen hat, war ja 1995 fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit erschienen, weil sein damaliger Verlag das Buch wie eine Geheimsache behandelte. Mittlerweile kann der Dichter, der so lange auf öffentliche Anerkennung hat warten müssen, auf eine ungewöhnliche Erfolgsgeschichte verweisen. Viele bedeutende Lyrikpreise sind seit 1999 auf ihn herabgeregnet – und es sieht so aus, als könne Lutz Seiler traumwandlerisch sicher auf seinem poetischen Königsweg fortschreiten.
Michael Braun, aus Ortstermine. Wolfenbütteler Lehrstücke zum Zweiten Buch II. Herausgegeben von Hugo Dittberner in Zusammenarbeit mit Linda Anne Engelhardt und Andrea Ehlert, Wallstein Verlag, 2004
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Mischa Gayring: Persönlich-vergänglich & historisch-absurd
literaturkritik.de, August 2001
Joachim Sartorius: Das neue Gedicht: ,fin de siècle‘ von Lutz Seiler
Die Welt, 15.7.2000
Helmut Böttiger: Es kommen härtere Zeichen
Frankfurter Rundschau, 5.8.2000
Kathrin Hillgruber: Mein Jahrgang, dreiundsechzig
Süddeutsche Zeitung, 2./3.9.2000
Alexander von Bormann: Poesie gegen alle Lebensverkümmerungen
Die Welt, 9.9.2000
Bettina Schulte: Jeder hat nur ein Lied
Badische Zeitung, 12.9.2000
Michael Braun: „wir hatten / gagarin, aber gagarin / hatte auch uns…“
Basler Zeitung, 15.9.2000
Ursula Krechel: Chrysanthemen in Beton gegossen
Der Tagesspiegel, 18.10.2000
Martin Ahrends: Glockenschläge ans Nichtgelebte
Die Zeit, 16.11.2000
Angelika Overath: Poesie, radioaktiv
Neue Zürcher Zeitung, 28.12.2000
Jan Wenzel: „das ICH liest den eisernen zähler“
EDIT. Papier für neue Texte, Heft 23, 2000
Lutz Seiler liest u.a. aus pech & blende im Goethe-Institut Amsterdam am 24.10.2001. Moderation: Gregor Laschen.
Lesung Lutz Seiler aus pech & blende im Deutschen Literaturarchiv Marbach am 27.7.2005. Moderation Philip Ajouri.
Lagebesprechung
LATRINE
einmal, es hiess, die wurzel ihres hustens
leuchtete uns
die stiege herunter, schwächliche kinder
aaaaamit kalten
aaaaaurinen, fleischers enkel in der nacht, die
das licht im radio liebten & die botschaften
des uhrwerks, deckbettkinder, dampfende
aaaaavögel, das war
ihr haus gewesen, auch ihre müdigkeit, wenn
es regnete, war das der hof und das
der hund und
aaaaaes war der strick des fleischers als
mutter leis die wirbel auseinander
knackten, stand
ich noch immer in der küche
hinter ihrem schrank
und wusste nicht, ob ich da
wo ich war, noch jemals
gefunden werden konnte oder
ich selbst bereits gestorben war oder doch
die anderen, draussen gestorben waren
mutter, vater, gagarin & heike oder
mutter vorn nicht leis bereitstand
zu müde für die feuchtigkeit der luft &
die hand erhoben hielt, als
wollte jetzt das tier
aaaaavon ihr ein letztes
mal besänftigt sein, doch
auch das hatte sie vollbracht und
war noch einsamer gewesen
aaaaamit einer passstraße im rücken
aaaaaeinem brotwagen im hof, dem
aaaaaöffnen & schliessen der tränen…
Lutz Seiler
Über stinkendem Graben,
Papier voll Blut und Urin,
umschwirrt von funkelnden Fliegen,
hocke ich in den Knien…
so beginnt Günter Eich 1946 sein Gedicht „Latrine“, das zu den ersten lyrischen Äußerungen der deutschen Nachkriegszeit zählt. Diese körperliche Haltung, wie sie die Person des Gedichtes zur Verrichtung ihrer Notdurft eingenommen hat, ist metaphorisch insofern, als sie auch einen Zustand des Bewußtseins nach der Katastrophe beschreibt. Eine zerrüttete Moral, verlorene Ideale, gescheiterte Ideologien, und, daraus resultierend, unbrauchbar gewordene Sprache sind die kollektiven Entsprechungen zum „versteinten Kot“, der, nur eine Strophe weiter, „in den Schlamm der Verwesung / klatscht“. Und die Wolke als ein Topos der Sehnsucht wird lediglich noch im matten Spiegelbild einer Urinpfütze gesehen anstatt vor einem hohen, leuchtenden Himmel. Der Blick auf die Welt, er verfängt sich im Dreck ihrer Geschichte. Indem er aber aufs radikalste genau ist, wird aus den Scherben ein Archiv der Historie und aus der Traumatisierung eine Erinnerungsleistung. Am Ende triumphiert das Gedicht über jede Art von Geschichtsbuch, denn es hat im Inneren seiner Textur einen emotionalen Status, eine Gefühlswelt mit abgebildet, die auf andere Weise gar nicht vermittelbar ist. Gedichte können also, wenn sie sich in den Dienst von Geschichte stellen, zur gültigsten Form von Geschichtsschreibung werden, und das ohne jeden rhetorischen Anspruch auf Richtigkeit und Recht. Nichts weniger hat Lutz Seiler geleistet. Zumal zu einer Zeit, in der die DDR und der verendete Osten als Thema bereits wieder unmodern wurde und dazu literarisch auch schon einiges erbracht worden war. Die begeisterte Rezeption von Seilers Lyrik hingegen hat einmal mehr gezeigt, daß eine hysterische Zirkulation von Tendenzen und Moden vor wirklich überzeugenden Texten außer Kraft gesetzt ist und daß es demnach auch keinen falschen Moment für Sujets gibt. Außerdem kann sich ein Autor von dieser Ernsthaftigkeit ohnehin nicht aussuchen, was ihm ein Schreibanlaß wird, denn er folgt einer Option, die tiefer und weiter reicht als sein Bewußtsein. Es ist die Wiederkehr des Verdrängten, die eine Urszene im Gedächtnis auferstehen läßt und, bereits zum Symbol geworden, zur Bewältigung drängt. So auch werden menschliche Erschütterungen immer wieder den Hintergrund bilden für Literatur, da es keine Gegenwart ohne Vergangenheit gibt. Um im Bild zu bleiben: wie Günter Eich, so beschreibt auch Lutz Seiler die Hinterlassenschaft seines untergegangenen Landes als eine „Latrine“ und geht, stellvertretend für seine Generation der „schwächlichen kinder / mit kalten / urinen“, „die stiege herunter“, dorthin, wo alles einmal angefangen hat, mit „mutter, vater, gagarin & heike“, ehe sie starben. Nun ist diese Geschichte auch meine Geschichte, und vielleicht spüre ich deshalb die seelische Verstörung besonders hart nach, die sich durch diese Lyrik zieht und sie unabweislich werden läßt. Aber das ist auch nur untergeordnet interessant. Wichtig allein ist, daß sie eine fast schon vergessene Realität zur ästhetischen Form gebracht und damit auch für andere festgehalten hat. Und mehr kann man von Gedichten eigentlich gar nicht verlangen.
Kurt Drawert, Ostragehege, Heft 28, 2002
LUTZ SEILER
Hunger
es fielen uns
die Wölfe an
Wir trugen
stolz unsere
roten Kappen
von denen es hieß
es würde nie je
wer nach ihnen schnappen
wir standen unsere Frau
wir standen unseren Mann
wir zogen gute Kinder heran
und schufen Kind für Kind
Märchen, die keine sind.
Wir dachten, uns wird keiner fressen
wir haben den Hunger der Wölfe vergessen
Peter Wawerzinek
Peter Geist: „überdunkeltes atmen durch die umzäunung“. Über die Lyrik Lutz Seilers und ihre Wahrnehmung in der Literaturkritik.
Helmut Böttiger: Lyrik und Uran. Der Schriftsteller Lutz Seiler.
Michael Opitz: Irrwege zum Gedicht. Zur Lyrik von Michael Lentz und Lutz Seiler.
Michael Braun: Im Satzbau dieser Gegend. Ein Porträt des Christian-Wagner-Preisträgers Lutz Seiler.
Lutz Seiler: „Die dunkle Seite des Mondes“. Über Georg Trakl, Stefan George und Pink Floyd
Fakten und Vermutungen zum Autor + Schreibtisch +
DAS&D + KLG + IMDb + PIA +
Georg-Büchner-Preis 1, 2, 3, 4, 5, 6 +
Peter Huchel Preis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 +
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Dirk Skiba Autorenporträts +
Brigitte Friedrich Autorenfotos
shi 詩 yan 言 kou 口
Lutz Seiler zu Gast bei Erik Spiekermann in der Galerie P98A.


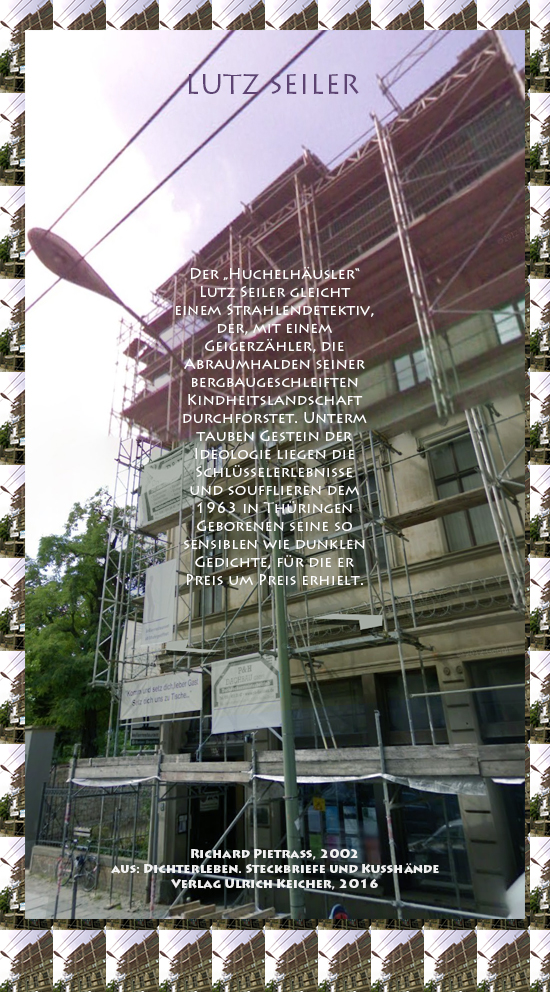












Schreibe einen Kommentar