Michael Buselmeier: Dante deutsch
DIE LÄUTERUNG (2)
Schmerzlust Fronlast sagst du, ihr seid das Feld,
der Gottesacker Welt; ihr seid des Lebens
zähe Kreisform Tod. Ich bin das Brot,
der Wein im hellen Kelch, das Wort aus Stein,
gegerbtes Fell, die Fahne weiß und rot,
das Lindenblühn im Park, die Birken locken,
der Weihrauchduft, die Vogelsprache, Glocken
so nah im Wind, als ich verschlafen, blind
den Laden aufstieß und die Kinder sah
auf Blütenblättern kniend, O und A.
Sind wir die Letzten, die Gott spüren,
im Baldachin durch unsre Gassen führen,
jasminbekränzt uns in die Lüfte schwingen,
mit Erdbeereis bekleckert Verse singen?
Am Schluß des Zugs die flackernde Monstranz.
Nachwort
Die Gedichte dieses Bandes habe ich zwischen 2006 und 2012 geschrieben, jeweils in mehreren Fassungen, mit der Hand, bevor ich sie dem Computer anvertraute. Ich beginne meist mit einem Klang, einem Satz oder Vers, den ich aufgeschnappt habe, einem Bild, einer Stimmung, einem frischen oder wieder aktivierten Schmerz. Idealerweise verschmelzen dann Fundstücke und Einfälle im Fortgang des Gedichts mit den dominanten (Kindheits-)Erinnerungen, indem sie sich aneinander reiben, wechselseitig befruchten und anspornen.
Ich bin kein sprachexperimenteller Autor im engeren Sinn, kein Wortzerstörer, kein „Labordichter“. Meine Texte entstehen zwar am Schreibtisch, im Sprachhaus und sind Ergebnis längerer Arbeit, ich montiere und collagiere, aber es dringt auch jede Menge Emotion in sie ein, inspirierende Energie, „Intuition“ könnte man sagen, doch das Wort ist verpönt, weil es angeblich an eine „Genie-Ästhetik“ erinnert, die es nicht mehr geben darf. Fast jedes meiner Gedichte hat einen realen Anlaß (eine Reise, eine Lektüre, der Tod eines Freundes oder der rüde Abriß des Theaters meiner Jugend), eine existentielle Erfahrung, mit der ich schreibend zurechtkommen muß. Dabei versuche ich das Nahe fremd zu machen und das Ferne nah erscheinen zu lassen.
Orte sind für mich die wichtigsten Inspirationsquellen, vertraute, immer wieder aufgesuchte Landschaften, die ich wie ein Archäologe grabend Schicht um Schicht erforsche, den Sprach-Wegen der Vorfahren folgend. Als später Romantiker gehe ich davon aus, daß zwischen Naturerscheinung und dichterischem Wort eine oftmals sogar innige Korrespondenz herrscht und daß sich Welt und Wirklichkeit, wie unvollkommen auch immer, sprachlich nachbilden lassen. Sie bestehen auch nicht nur aus Formeln, Klischees und Zitaten. Die Gegenstände sind ja noch da, die Menschen auch, ich kann sie sehen, riechen, anfassen, und die Erfahrungen, die ich mit ihnen mache, sind nicht in jedem Fall „medial vermittelt“.
Ich habe im Lauf der Jahre gelernt, daß Strophe und Metrum, Stab-, End-, Binnenreim und Assonanz hilfreich sein können. Sie festigen und konzentrieren das Gedicht durch Wiederholung, machen seine Struktur sichtbar und durchscheinend. Doch schematisch angewandt, können sie sich auch als eine Art Rüstung erweisen, die verhindert, daß das Gedicht, spontan dem Rhythmus folgend, andere und überraschende (Um-)Wege einschlägt. Meine Gedichte sind oft hart gefügt, Worte und Halbsätze verkeilt zu poetischer Dichte. Die „splitternde Sprache“ rührt vermutlich vom deutschen Expressionismus her, von Georg Heym, Georg Trakl, Jakob van Hoddis, Alfred Lichtenstein, deren Gedichte mich neben denen der Romantiker früh geprägt haben. Auch François Villons und Arthur Rimbauds Poeme (in Paul Zechs sehr freier Nachdichtung) habe ich damals verschlungen. Es ist Haß und Selbstvernichtung darin und zugleich Zukunft.
Ein Gedicht sollte auch etwas zu erzählen haben, also nicht nur den Augenblick umkreisen oder sich selbst reflektieren; und es sollte in seinen Bildern das Zeit- und Weltgefühl mitbedenken, das Grollen der Geschichte hörbar machen. Es sollte von Lärm und Lust der Gegenwart zeugen, freilich in einer ganz anderen Sprache als der des Konsums und der Politik. Ohne sein Geheimnis zu verraten, sollte das Gedicht jeden, der guten Willens ist, an etwas erinnern. Es sollte von der allgegenwärtigen Verrottung, der Natur- und Kulturvernichtung und vom Leiden des Einzelnen, von Einsamkeit, Tod berichten, aber auch vom hellen Licht der Poesie und vom Duft des Sommers – im Spiegel Dantes, Goethes, Schuberts und Büchners, im Spiegel einer Reise durch ein so verwahrlostes Land wie Nigeria, das einen manchmal durchaus an die Hölle der Göttlichen Komödie erinnert, wo die Sünder, Verräter und Mörder verdientermaßen im Kot versinken, im Feuer braten und im ewigen Eis feststecken.
Ich habe Dantes Commedia erst spät kennengelernt; die streng gereimten Terzinen von Karl Streckfuß, dessen Übersetzung bereits Goethe benutzt hat, haben mich lange von einer Lektüre abgeschreckt. Doch als meine Schwester Verena Buss im Sommer 2007 während der Heidelberger Schloßfestspiele die hundert Gesänge in Philalethes’ reimloser Übertragung an verschiedenen Plätzen in der grandiosen Ruine sowie im Schloßgarten mal morgens, mal bei Nacht rezitierte, fand ich – mehr über ihre Stimme, die Atmosphäre und die Geräusche der Altstadt, den Sommerhimmel, den Neckar und die umliegenden Berge – einen besonderen Zugang zu dieser Wanderung durch die drei Reiche des Jenseits (das auch ein Dieseits meint), ein Wissen, das sich wenig später ausbauen ließ, als ich Kurt Flaschs erhellenden Vorträgen zu Dante lauschte.
Michael Buselmeier, im Frühjahr 2012, Nachwort
Über dieses Buch
Ein zeitgenössischer Dichter beugt sich, in mehreren Zyklen, über Dantes fremde Welt wie über die eigene und verbindet dabei Nahes mit Fernem – eine Bewegung, die aus der Vergangenheit in die Gegenwart führt und umgekehrt.
Es wird selten wörtlich aus der Commedia zitiert, auch deren Strophenbau und Reimschema werden nicht nachgeahmt. Auf seiner Wanderung durch die drei Reiche des Jenseits (das schon bei Dante auch ein Diesseits ist) berichtet das lyrische Ich von der allgegenwärtigen Verrottung, der Natur- und Kulturvernichtung und dem Leiden des Einzelnen, Krankheit, Tod, aber auch vom Licht der Poesie und des Sommerglücks – im Spiegel Dantes, Goethes, Schuberts und Büchners, im Spiegel einer Reise durch ein so verwahrlostes Land wie Nigeria, das einen durchaus an die Hölle der Göttlichen Komödie erinnert, wo Sünder, Verräter und Mörder im Kot versinken, im Feuer braten und im ewigen Eis feststecken. Auch Ägypten wird aufgesucht („Götter zerbrochen Tempel am Rand der Wüste“), die Feuerinsel Stromboli, der Süden Frankreichs – magische Orte eines „nachtlosen“ paradiesischen Sommers. Landschaftsszenen, Kindheitserinnerungen und Künstlerporträts fügen sich ein.
Verlag Das Wunderhorn, Ankündigung
Höllenschritte in Himmelsgassen
– Wohin Gedichte gelangen können, wenn sie sich den richtigen Begleiter suchen: Michael Buselmeiers gewaltiger Geselle Dante deutsch. –
Plötzlich wieder ein – wie lange? seit Ewigkeiten! – vermisster Ton, zupfgeschmettert auf einer Harfe, die mit Saiten aus Menschenhaut bespannt scheint: „Laß uns wieder von der Folter Gebrauch machen, / Bischof – Schandrad und glühende Stiefel!“, bis die Dichter, zu Scharen getrieben, „zu Schiff!, ruft Charon, ruft Orpheus“, sich zur Rückseite der Erde bewegen, „über die Säulen des Herkules hinaus, / ihr Spitzel in Eis oder Feuer gebannt, in die / Wüsten der Meere, vom Hungertuch überspannt, / Brandgänse, Geier, wo Ugolino aufs Neue / das elende Fleisch seiner Söhne verschlingt / und sich den Mund mit den Locken auswischt“.
So gebildet beginnt „Die Hölle (I)“, der erste – wie soll man das anders und schöner nennen? – Gesang, den der vierundsiebzigjährige Wahl-Heidelberger und gebürtige Berliner Dichter Michael Buselmeier – wie soll man das anders und schöner nennen – anhebt? Die Geschichte des Grafen Ugolino della Gherardesca, den sein Gegenspieler, der Erzbischof Ruggiero Ubaldini, in einen Turm hat sperren lassen, wo er zusammen mit seinen Söhnen über der Giftleiche seiner Frau an den Delirien des Hungers und des Wahnsinns zugrunde geht (inklusive Kannibalismus), steht im 32. beziehungsweise 33. Gesang des „Inferno“ der Göttlichen Komödie von Dante Alighieri.
Wer einen Gedichtband so beginnen lässt und sich Dante, den uralten Wanderer durch Hölle, Fegefeuer und Himmel, zum Weggenossen wählt, mit ihm als Dante deutsch auch im Titel prunkt und ihm, vom „Inferno“ übers „Purgatorio“ bis hin zum „Paradiso“, zwölf von insgesamt dreiundsechzig Gedichten des Buches widmet – wohin gelangt er? Ins gymnasialpoetisch verstreberte Karteikartenreich eines poeta schmocktus? Ins wonnige Land Vorgestrien, über dem das Zitat-Gebirg’ seine schneebedeckten Gipfel erhebt?
Er gelangt unmittelbar ins geheimnis- und schreckenssatte Heute. Wenn seinem Dante „ein Faulfluß aufquellend / um geborstene Bäume / vollgesogen / mit Säure mit Salz“ entgegendünstet. Wenn das „blutgetünchte Wolkentheater / sich nährend / aus der Kloake / Afrika“ seine Schreckenskulissen entfaltet. Wenn in den „Baracken Workutas wo Raubmörder würfeln um Feuchtes“, sie „alle versinken / Ein kreisendes Floß brandvoll mit schreienden / Leibern“ und „mit zerfetzter Lunge schlafen wir nackt auf Beton“. Wenn das Zeilen-Ende das Ende aller Zeiten vom Kriegsgefangenenlager des Zweiten Weltkriegs in einem Enjambement-Wirbel hinüberzieht in die Höllenwüsten Nigerias, wo der Wind Plastiktüten „vor uns her rollt über das rote / rauchende Land“, in dem die Nächte widerklingen „von der Machete Klang an fremder Pforte“ und „Kein Schlaf nachts Schüsse / vorm lichtlosen Haus / Wörter wie Wunden / blaue Fetzen aus Blei“. So viel Gegenwart war lange nicht mehr in Gedichten.
Plötzlich wird eine Sprache, die nicht die Welt nur beschreibt, sondern durch sie hindurchschaut, wieder politisch. In dem Sinne, dass Lyrik sich einmischt – aber nun nicht „Müll, Ölplacken, Autowracks, Moscheen, verkohlte Felder, Vieh brüllend vor Durst auf deinen steinharten Weiden“ als Afrika- oder Nigeria-Schreckensstimmungsbild ausmalt. Auch verkneift sich der offenbar weitgereiste Dichter die Attitüde „Ich war da! Ich weiß Bescheid!“. Vielmehr kommen die Gesänge einer wahrhaft höllischen Komödie, die ein richtiges Paradies nicht mehr kennt, auf das „Ich sah“ als Pointe. Und schon auch mal auf ein „Ich fraß“ – nämlich „den Staub deiner Städte und Dörfer, flirrend im Mittag, Hundefleisch ledern“.
Buselmeier klagt nicht an. Aber er macht ungeniert die Augen auf, die eine ganze Welt voller eurozentrischer Reste-Gucker peinlich provinziell geschlossen hält. Selbst „die Kinder am Ziehbrunnen, Blut hustend im Bus neben mir“ werden ihm weder zu Vehikeln, denen man mal eben so ein paar lyrische Sonder-Sentiment-Spenden auflädt, noch zum ganz und gar Fremden, Unbegreiflichen. Im Gegenteil. Dass sie so begreiflich, so nah sind (nur ein paar Flugstunden entfernt), macht aus dem nüchternen Sichwundern des Weltläufers und Weltaufnehmers Buselmeier/Dante ein Wunder an lyrischer Ausnahme-Präzision. Betrachtet man die Kladden aktueller weltabgewandter lyrischer Produktion, die aus den Schubladen komparatistisch geschulter, ewig lang schon kurz vor der nie fertig werdenden Lebenspromotion stehender Selbstreferenzlinge zu quellen scheint, wirken Buselmeiers Gedichte wie ein Erfrischungsbad. An Wahrnehmung und Weltöffnung.
Gerade weil ihm das ganze Abend- und auch Morgenland, neben Dante noch die Bibel, die katholische Liturgie (Fronleichnam, Osternacht), Schuberts Impromptus, Heines Ironie, Rilkes Topographie, Benns Leichenschauhäuser und die Schreckensstürme des Expressionismus, ebenso leicht und virtuos in Kopf und Hirn und Herz sitzen und dort Assoziationen stiften, wie ihm Reim, Rhythmus und musikalische Kontrapunktik, kunstvoll harte Fügung und bildphantastisches Aquarellieren zu Gebote stehen, entsteht ein herrlicher, in allen Sprachdüsterfarben funkelnder Weltbogen. Und der ehemalige Dramaturg Buselmeier sieht den „Faust“ als „Reptil mit Kahlkopf / das alle Rollen spielt“. Hier dichtet einer mit der violetten Tinte eines realistischen Surrealisten.
Aber das Abgründige, das sich in den sprechenden Bildern und den wie herausgemeißelten Wörtern auftut, ist nur Knall oder Effekt. Gerade dort, wo Buselmeier im Kleinen, Nebensächlichen das Große, Wahnwitzige entdeckt, wenn er in eine Albtraumnacht seiner Kindheit zurücksinkt oder den Abriss des Theaters seiner Stadt in einem schmerzentzündeten Lamento aufflackern lässt („Engelsbrot. Eine Klage“), wird die sorgsam bedachte und herausmusizierte Überraschung zur Eintrittskarte in die phantastische Kehrseite der bewohnten Welt. Damit lässt sich gut reisen. Man muss nur auch was aushalten können. Nicht nur in Afrika. Heidelberg reicht schon.
Gerhard Stadelmaier, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1.12.2012
Michael Buselmeier stellte in Wiesloch
seinen Gedichtband Dante deutsch vor
An den Wänden hängen abstrakte Bilder. Sie zeigen Farbverläufe, Schattierungen und Brüche. Und während das Auge wandert, lässt man sich von der Stimme Michael Buselmeiers, von dieser unverwechselbaren Melodie seiner Dichterstimme, durch Worträume tragen, lauscht den Klängen, Rhythmen, versteckten Bedeutungen, entfaltet Assoziationsketten. Um Brüche und Verläufe ging es auch im Gespräch zwischen dem Heidelberger Dichter und seinem Interviewpartner, dem Literaturkritiker Michael Braun, das im Atelier Urlaß unter der Frage „Dantes Inferno – und die Gegenwart?“ zum Lyrik-Salon der Literaturtage gehörte.
Michael Buselmeier ist 1938 in Berlin geboren und in Heidelberg aufgewachsen. Er absolvierte zunächst eine Ausbildung als Schauspieler und Regieassistent, bevor er Germanistik und Kunstgeschichte in Heidelberg studierte und später an verschiedenen Hochschulen lehrte. Er hat zahlreiche Lyrik- und Prosabände veröffentlicht. Im September 2011 stand sein Theater-Roman Wunsiedel auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises 2011. Im vergangenen Jahr ist sein Gedichtband Dante deutsch erschienen, aus dem er im Lyrik-Salon las. Doch zuvor versuchte Michael Braun im Dialog mit dem Autor, seinen Lebenslinien nachzugehen, um darin Brüche, Aufbrüche, Motive und Stimmungen zu entdecken. In seinen jungen Jahren habe sich Michael Buselmeier zu Diskontinuität und dem Fragmentarischen in seinem Arbeiten bekannt, hat sich das jetzt geändert? Nein, sagt Buselmeier, noch immer bevorzuge er das assoziative Schreiben, bei dem ein Gedanke entstehe und dann komme der nächste dazu und dann wieder ein Gedanke, bis das Werk fertig sei.
Der Lieblingsplatz von Michael Buselmeier sei schon immer die Position am Rand gewesen, unversöhnt mit den Verhältnissen und eigensinnig auf die Konfrontation mit dem konformistischen Kulturbetrieb bedacht, sagt Michael Braun. In seinem ersten Gedichtband Nichts soll sich ändern zeige Buselmeier zwar noch Konservatismus, das habe sich dann aber schnell geändert, was später auch in dem provokativen Ausspruch „Was ist der Faschismus gegen meine Schmerzen“ anklinge.
Und dann erzählt Michael Buselmeier, wie er zu Dante gekommen ist. „Die deutschen Intellektuellen haben ja alle Dante nicht gelesen, obwohl sie ihn immer zitieren“, erklärt Buselmeier. Er selbst habe es schon in früheren Jahren einige Male mit dem italienischen Dichter und seiner Göttlichen Komödie probiert, aber die Übersetzungen, die er hatte, gefielen ihm nicht, waren in keinem schönen Deutsch, sodass er schon nach zwei Strophen wieder aufgab und das Buch ins Bücherregal zurückstellte. Erst als er eine Dante-Lesung seiner Schwester, die Schauspielerin ist, in Heidelberg besuchte, habe er einen anderen Dante – in der Übersetzung des Königs Johann von Sachsen – kennen- und schätzen gelernt. „Dante ist mir über die Freiluft-Veranstaltungen zugelaufen“, erzählt er schmunzelnd.
In seinem Gedichtband Dante deutsch knüpft er an die legendäre Dante-Übersetzung des großen Dichters Rudolf Borchardt an. Er sei ein großer Borchardt-Fan, bekennt Buselmeier. Mit Dante deutsch wolle er die deutsche Kultur verteidigen. „Das ist meine späte Altersobsession“, meint er augenzwinkernd. Im Gedichtband gehe es um das heutige Jahrhundert und um sein Leben. Dante sei nur das Sprungbrett gewesen. „Ich habe mehr Erfahrung mit der Hölle als Dante, was wusste der schon vor 700 Jahren von der Hölle.“
Buselmeier zitiert selten wörtlich aus der Divina Commedia, auch deren Strophenbau und Reimschema ahmt er nicht nach. Dante deutsch beschreibt die Wanderung durch die drei Reiche des Jenseits. Das lyrische Ich berichtet von der allgegenwärtigen Verrottung, der Natur- und Kulturvernichtung und dem Leiden des Einzelnen, Krankheit, Tod – das alles im Spiegel einer Reise durch ein Land wie Nigeria, das an die Hölle der Göttlichen Komödie von Dante erinnert. Es gibt natürlich auch die Momente im Licht der Poesie und des Sommerglücks. Bei allem spürt man die Lust des Dichters Michael Buselmeier am Worte-Einfangen, am Wort-Erkennens, Worte-Erleuchten und am Worte-Bemalen mit dem dicken Pinsel der Inspiration. Dazu bot dieser Literatur-Salon die schönste Leinwand.
pen, Rhein-Neckar-Zeitung, 25.10.2013
„Ich bin ein Spätzünder“
– Der Heidelberer Lyriker Michael Buselmeier im Portrait.
Aktuell ist der Heidelberger Lyriker und Chronist im Gespräch mit seinem neuen Band Dante deutsch. Dies war Anlass für einen Besuch, in dem er nicht nur aus seinem Leben, sondern vor allen Dingen auch zur Entstehungsgeschichte von Dante deutsch erzählt. Besonders schön: Seine souveräne Bescheidenheit. –
Michael Buselmeier wurde am 25. Oktober 1938 in Berlin geboren und lebt seit 1939 in Heidelberg. Aufgewachsen in der Nachkriegszeit, studierte er in Heidelberg Germanistik und Kunstgeschichte. Wie vor 17 Jahren, als der ruprecht ihn das letzte Mal sprach, wohnt er abgelegen in Rohrbach. Im Mittelpunkt stehen ist nicht seine Sache. Für seinen 75. Geburtstag lehnte Buselmeier eine große Feier ab, wie es die Stadt angeboten hatte. „Aber es wäre schön, wenn sie eine Neuauflage von Der Untergang von Heidelberg finanziert“, in dem er anschaulich den Zerfall der linken Bewegung in Heidelberg Anfang der 70er Jahre beschrieb.
Das Gespräch beginnt aber mit einer überraschenden Aussage Buselmeiers:
Machen und schreiben Sie, was Sie wollen. Was Sie schreiben, sagt in erster Linie etwas über Sie aus.
Damit hatte Buselmeier Recht, doch äußerte er dies mit Blick auf die Autorisierung von Zitaten, heutzutage eher ungewöhnlich. In Zeiten, in denen jeder verzweifelt versucht, seine Außendarstellung neurotisch zu steuern, ist das fast schon schockierend. Angesprochen darauf, ob er als nun anerkannter Heidelberger Autor, der von seiner linksradikalen Vergangenheit abgerückt ist, Parallelen zwischen sich und der Geschichte der Stadt Heidelberg selbst sieht, die heute ebenfalls ein eher gemütliches Pflaster ist, antwortet er lediglich:
Für Stadtgeschichte habe ich mich eigentlich nicht interessiert, das Interesse für Geschichte kam bei den Linken erst in den 80ern.
Hiermit deutet Buselmeier an, dass er einige Veränderungen durchgemacht hat und dementsprechend selbstkritisch äußert er sich auch über die Zeit, in der er in einem wesentlichen Kapitel der Heidelberger Stadtgeschichte mittendrin war: Die Studentenunruhen der 70er Jahre. Zentrum der Studenten war damals das sogenannte Collegium Academicum, das Gebäude der heutigen Universitätsverwaltung:
Wir waren linksradikal und in unseren Publikationen so abgehoben. Wir bestanden aus mehreren Sekten, die sich auch untereinander bekriegten. Ich war bei der Spontisekte und dann gab es noch fünf Mao-Sekten, Trotzkisten und so weiter. Es war völlig absurd.
1975 wurde das Gebäude der Universitätsverwaltung übertragen. Noch bis zum 6. März 1978 hielten 200 Studenten das Gebäude besetzt. Doch dann kam ein riesiges Polizeiaufgebot von 1.500 Einsatzkräften, um es zu räumen. Mit dabei war der spätere Grünen-Vorsitzende Reinhard Bütikofer, woran sich Buselmeier noch genau erinnert:
Reinhard stand in dieser Nacht auf dem Tisch und rief uns zu den Waffen. Es stand ein vergammelter VW herum, den haben wir vor das Tor geschoben, wir hatten der Polizei also nichts entgegenzusetzen.
Wie viele aus der damaligen Studentenbewegung, musste sich auch Buselmeier damals überlegen, wie es nun weiter geht.
In die Politik, zu den Grünen zum Beispiel, wollte ich nicht. Ich wollte wieder Gedichte und Prosa schreiben, das wollte ich aber nicht politisieren.
Seit 1976 schrieb er schon in der linksliberalen Heidelberger Rundschau, die ab 1983 Communale hieß.
Da waren anfangs die lieben Sozialdemokraten, die keinem weh tun wollten, mit denen ich erst nicht an einem Tisch sitzen wollte. 1976 ging das aber inzwischen.
Das Ende der linksradikalen Szene, aber auch wie er sich von ihr distanzierte, beschreibt Michael Buselmeier in Der Untergang von Heidelberg, 1981 im Suhrkamp-Verlag erschienen. Geprägt ist dieses Buch auch von den Erfahrungen bei der Erziehung seiner Tochter im linksalternativen Kinderhaus Neuenheim.
Ich musste den ganzen Tag durch die Stadt fahren, zum Elterndienst, zum Elternabend und da entstand so eine Aggression. Dieser ganze Hass in Der Untergang von Heidelberg hat auch damit zu tun. Die verfassten dort diese ganzen Solidaritätserklärungen mit der Roten-Armee-Fraktion, die nicht aus dem Kindergarten rauszuhalten waren. Wir sollten sie als arme Gefangene beweinen, aber ich weinte nicht.
Im Vordergrund stand im Buch nicht, sich politisch zu äußern, sondern seine eigenen Erlebnisse zu verarbeiten.
1986, anlässlich des 600-jährigen Jubiläums der Universität Heidelberg, gab Michael Buselmeier das Heidelberg-Lesebuch: Stadt-Bilder von 1800 bis heute heraus.
Ich habe hier provokativ auch Texte aus der Nazizeit aufgenommen, das war damals undenkbar, heute macht das ja jeder.
1988 wurde er daraufhin gefragt, ob er nicht Stadtführungen machen wolle. Buselmeier stand dem skeptisch gegenüber:
Meine Kenntnisse waren sehr minimal.
Er sei jedoch seinerzeit eine politische Figur gewesen, der Gegenspieler des damaligen Oberbürgermeisters Zundel. Und er konnte schon immer „gut darstellen“, sodass die Führungen sehr populär wurden. Anfang der 90er-Jahre kamen dann sogar 200 bis 300 Leute, „da brauchte ich dann das Megafon, das war mir fast peinlich“. 1996 erschien seine erste Auflage von Literarische Führungen durch Heidelberg. Eine Stadtgeschichte im Gehen, 2007 folgte die zweite. Hatte die erste Auflage 180 Seiten, sind es in der zweiten schon über 400. Buselmeier hierzu:
Die Stadtführungen sind in dem Zusammenhang entstanden, dass ich irgendwann keine politische Reizfigur mehr war. Ich musste das dann durch Kenntnisse kompensieren.
Mit Erfolg: Heute kommen keine 300 Leute mehr zu seinen Stadtführungen, aber immerhin noch stolze 60. Buselmeier möchte aber noch eine weitere Auflage herausbringen, diesmal sollen es 600 Seiten werden.
Im Alter von 70 Jahren zog er eine erste Bilanz.
Ich habe es zu einer regionalen, aber nicht zu einer nationalen Größe gebracht.
Dann folgte 2011 mit dem Theaterroman Wunsiedel die Nominierung für den Deutschen Buchpreis: „Das war unvorstellbar, ein über 70-jähriger Autor wird nominiert“, symptomatisch für einen „Spätzünder“. Eine Erklärung für diesen späten Erfolg hat er selber auch nicht:
Ich habe keine Beziehungen zur Jury und Wunsiedel ist auch nicht wesentlich besser als meine anderen Bücher. Dieses gegenläufige Moment zum Verlieren im Alter hat mich gefreut.
Aktuell ist Michael Buselmeier durch seinen 2012 erschienen Lyrikband Dante deutsch im Gespräch. Er trennt auch nicht zwischen sich und dem lyrischen Ich:
Das lyrische Ich, ist mein anderes Ich, indem ich Erinnerungen, schöne wie traurige literarisch verarbeite.
Ausgangspunkt für Dante deutsch war ein Ereignis: Eine Lesung Dantes von seiner Schwester auf dem Heidelberger Schloss, hat ihn so inspiriert, dass er als erstes Gedicht „Das Paradies (4)“ verfasst hat:
Die Reime waren sofort da, aber ich war damals naiv, ich habe Dante selbst vorher nie gelesen. Er war mir sehr fremd, er ist mir heute noch fremd.
Erst jetzt, nachdem er über ihn geschrieben hat, beschäftige er sich intensiver mit ihm.
Im ersten Gedicht des Bandes „Hölle (1)“ liegt im ersten Vers „Laß uns wieder von der Folter Gebrauch machen, / Bischof […] keine bewusste Anspielung auf einen Text Dantes vor, sondern eine einfache Alltagserfahrung: Bischof Huber, ein alter Sozialdemokrat, hatte gerade in einer Fernsehtalkshow selbstherrlich-rhetorisch „Sollen wir etwa die Folter wieder einführen?“ gesagt, dem sich Buselmeier auf diese Art einfach Luft machen musste.
Buselmeier abschließend selbstironisch:
Auch der Titel Dante deutsch ist eine Anmaßung, eine unheimliche Frechheit! Ich behaupte da ja nichts anderes als meine nationale Dante-Tradition zu begründen.
Ziad-Emanuel Farag, ruprecht.de, 29.1.2013
Ein Indianerleben im Verborgenen
– Laudatio auf Michael Buselmeier; anlässlich der Verleihung des Gustav Regler-Preises. –
„Jetzt bloß nichts Politisches bitte!“ Mit dieser strengen Selbstermahnung hat sich das lyrische Ich Michael Buselmeiers im Gedicht „Erzählte Geschichte“ eine Politik-Abstinenz verordnet – aber zu unserem Glück hat sich der Dichter an die eigene Maxime nicht gehalten. Im Gegenteil.
Das Politische war bei diesem Autor immer schon da – auch wenn er es zunächst vertreiben wollte, um überhaupt Gedichte schreiben zu können.
Ich schreibe… Poesie nicht primär aus politischen Gründen… Als ich nach Jahren ausschließlich politischer und theoretischer Anstrengung 1974/75 wieder anfing, Gedichte zu schreiben, so tat ich dies, weil sich meine Wahrnehmungen, Erinnerungen und Wünsche, das, was man den ,subjektiven Faktor‘ nennt, nicht länger ausblenden ließen… Poesie geht in… politischen Kategorien nicht auf, sie hat eine sinnliche, vor-begriffliche Qualität… ihre politische Wirkung kann somit auch nur eine sehr vermittelte, unterirdische sein.
Dieses Bekenntnis ist fast vierzig Jahre alt. Michael Buselmeier, unser Preisträger, hatte damals, im Sommer 1977, dieses Statement an die Herausgeber des sogenannten Lyrik-Katalogs Bundesrepublik geschickt, die kurz zuvor das „Erste bundesdeutsche Lyrik-Festival“ in Hamburg inszeniert hatten. Ich bin mir fast sicher, dass Michael Buselmeier heute von einem mittelschweren Unbehagen befallen wird, wenn er mit dieser Poetik seiner frühen Gedichte konfrontiert wird. Denn nicht nur seine politischen Positionen, auch seine ästhetischen Perspektiven haben sich mittlerweile grundlegend geändert. Allein schon der Hinweis auf den „subjektiven Faktor“ ist ja bezeichnend für die dogmatische Terminologie, in die sich seine linken Genossen von einst verbunkert hatten. Was von der linken Intelligenz zum „subjektiven Faktor“ verkleinert wurde, ist das Fundament jeder Literatur: die poetische Imagination des Dichters, das Phantasma der Tagträume, Visionen und Wünsche, die Offenbarungskraft der sinnlichen Wahrnehmungen. Im Jahr 1977 klang noch so, als würde sich der Dichter fast entschuldigen für seine lyrische Einbildungskraft.
Heute, fünf Romane, zehn Gedichtbände und viele Essays später, haben sich viele ästhetische Paradigmen des Schriftstellers Michael Buselmeier geändert, aber eines ist geblieben: der störrische Eigensinn des Autors, sein Einzelgängertum, die Entschlossenheit, auf politische Korrektheit keine Rücksichten zu nehmen und das sanfte Einvernehmen des linksliberalen Konsensus so häufig wie möglich zu durchbrechen.
Wie der Namensgeber dieses Preises, Gustav Regler, hat sich Michael Buselmeier im Zweifelsfall für die Häresie entschieden – und gegen die Orthodoxie.
Sein Lieblingsplatz war seit je die Position am Rand, unversöhnt mit den Verhältnissen und stets auf Konfrontation abonniert. Tatsächlich ist er im Literaturbetrieb viele Jahre ein Fremdling geblieben, vom Feuilleton nur mäßig beachtet, ein „Abseitssteher voller Verachtung“, wie es sein Alter Ego, der Romanheld Moritz Schoppe, formuliert. Jahrelang teilte der Autor das Schicksal seiner Lieblingsfiguren, all der Waldgänger, Außenseiter und zornigen Anarchen, die sich den Konventionen ihrer Gesellschaft entzogen haben. Dann holte ihn nach 35 Jahren plötzlich der große Erfolg ein, in Gestalt seines Theaterromans Wunsiedel, der 2011 überraschend auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises gelangte.
Aber all die Motive, die in Wunsiedel zu einem kleinen Bildungsroman verflochten werden, sind bereits in Buselmeiers früheren Büchern entwickelt: die naturromantische Verknüpfung von Literatur und Landschaft; die innige Verbindung von Gehen und Wahrnehmen; die Vereinzelung des Außenseiters und seine Auflehnung gegen die korrupte Welt.
Mit der Geschichte der „theatralischen Sendung“ des jungen Moritz Schoppe schließt sich im Roman Wunsiedel auch ein Kreis. Denn 1968 hat der literarische Lebensweg Buselmeiers mit einem polemisch ambitionierten Theater-Text begonnen, der im legendären Kursbuch 15 veröffentlicht wurde, in dem damals der „Tod der Literatur“ debattiert wurde.
Danach durchlief Buselmeier die Schule der Studentenrevolte. Als 1978 seine ersten Gedichte im Wunderhorn Verlag erschienen, wollte man in diesem Autor nur einen linksradikal motivierten Alltagslyriker erkennen, einen ungebärdigen Heidelberger Aktivisten der 68er-Bewegung. Aber bereits der Titel seines ersten Gedichtbuchs verwies in seinem Beharrungstrotz auf ein konservatives Weltgefühl: Nichts soll sich ändern, hatte Buselmeier sein Debütbuch genannt – und tatsächlich findet man darin Gedichte, in denen sich das Ich den leuchtenden Formen der Natur weit inniger verpflichtet fühlt als dem Spektakel der Revolution. Und auch in seinem 1981 veröffentlichten Bekenntnisroman Der Untergang von Heidelberg verbirgt sich hinter der Maske des schrillen Anarchisten ein romantischer Landschaftsmaler und Archäologe des Heimatgefühls. Seinen autobiografischen Helden Schoppe hat Buselmeier dann 1989 erfunden, in seinem gleichnamigen Roman. Ein einsamer Wanderer zieht hier traumverloren durch das Haardtgebirge im deutschen Südwesten, er sucht an „geweihten Orten“ nach den Spuren der Vorfahren, er verirrt sich im Wald, wo er die wispernden Stimmen der Toten hört.
Ich will mich heute mit einigen Gedichten beschäftigen, die verdeutlichen, wie weit sich Michael von den linksradikalen Urszenen der späten sechziger und frühen siebziger Jahre entfernt hat. Die Gedichte stehen in seinem Band Lichtaxt von 2006 und in seinem großen, leuchtkräftigen Gedichtbuch Dante deutsch von 2012.
Dante deutsch versammelt Visionen von Höllenwanderungen und Paradies-Phantasmagorien, abgeleitet aus realgeschichtlichen Szenarien des Schreckens. Der Titel des Bandes knüpft ganz bewusst an die große Dante-Übersetzung an, die der Kulturphilosoph und Dichter Rudolf Borchardt nach jahrzehntelanger Arbeit 1930 vorgelegt hatte. Mit lyrischen Schlaglichtern auf die faschistischen und stalinistischen Massaker im 20. Jahrhundert hebt dieses Buch an. Wie bei Dante wendet sich dann aber der Blick und nach dem Gang durchs „Fegefeuer“ betritt Buselmeiers lyrisches Ich das „Paradies“ – mit Versen, die in ihrer zarten Anrufung Gottes und in ihrer völlig unironischen Feierlichkeit bei diesem Autor überraschen. Eine überschwängliche Naturromantik verschmilzt hier mit dem Religiösen, „Vogelsprache“ mit „Weihrauchduft“.
In einem weiteren Kapitel folgt dann die aktuelle Erfahrung einer gesellschaftlichen „Hölle“. In einer ganzen Reihe von Gedichten über Nigeria, das von Terror zerrissene afrikanische Land, zeichnet der Dichter Landschaften des Verfalls, in denen die Regeln zivilen Zusammenlebens außer Kraft gesetzt sind. Aber es finden sich auch Sehnsuchtsbilder der Einsamkeit, emphatische Anrufungen eines exzentrischen Daseins. Der rhapsodische Hymnus im langen Gedicht „An Nigeria“ mündet am Ende in ein Bild vom Ausgesetztsein in der Savanne und artikuliert ein ekstatisches „Hochgefühl“ in der Verbundenheit mit archaischen Riten. Das lyrische Ich vergegenwärtigt fasziniert die „Fetisch-Schreine im Wald“, rätselhafte Kultstätten, die „mit Federn und Zauberzeichen versiegelt“ sind. Hier manifestiert sich eine Begeisterung an der geheimnisvollen Macht des Archaischen, die unserer kühlen Zweckrationalität verschlossen bleibt. In der letzten Strophe dann imaginiert sich das Subjekt als Einzelgänger in der Wildnis, der seinen Urahnen entgegengeht:
Sah eure Spuren im Lehm, den Anfang des aufrechten Gangs, ein Hochgefühl. Folgte dem Schlangengezisch roter Wege, schief sich verlierend im Schilf weggeduckter Hütten.
Der Einsame, der hier durch die Hochsavanne geht, ist weit weg von allen Kollektiven, ganz auf sich bezogen, ohne jede Aussicht auf Unterstützung von höherer Warte.
Es sind solche Randpositionen der Verlorenen, der Ausgestoßenen und von der politischen Macht Marginalisierten, die sich Buselmeier in seinen Gedichten anverwandelt. Es geht schon lange nicht mehr um kulturrevolutionäre Positionierungen, wie sie der Autor etwa 1976 in dem von ihm angestoßenen „Arbeitskreis Linker Germanisten“ bezog. Es sind Positionen der Ohnmacht, porträtiert werden Randfiguren, denen jede gesellschaftliche Anerkennung entzogen wurde. Als Beispiel mag hier das Gedicht „Bei weißen Farmern“ dienen, in dem der Autor eine im heutigen Afrika verfemte Gruppe, die frühere Herrschaftsklasse der weißen Farmer, ins Zentrum stellt und ihr eine Geste der Fraternisierung widmet. Das Gruppenbild der aus Zimbabwe vertriebenen Farmer, die im nigerianischen Hinterland auf die ihnen zugesagte Unterstützung warten, wird mit großer Empathie gezeichnet. Die letzten Zeilen des Gedichts lassen sich durchaus als Verbrüderungsgeste deuten:
Gemeinsam lutschen wir die süßen Kerne
des Affenbrotbaums, grüßen in der Ferne
die schwarze Vogelscheuche überm Graben.
Auch hier gilt also die Devise des Autors: Die Häresie ist allemal der Orthodoxie vorzuziehen – auch um den Preis, dass man den Beifall von der falschen Seite erhält.
Dieses Schreibprinzip gilt um so mehr für ein Gedicht, in dem sich Buselmeier 2006 gegen die wohlfeile antifaschistische Rhetorik seiner Generation wandte.
In seinem Gedicht „Nibelungen“, nachzulesen im Band Lichtaxt, setzte er sich mit einem eklatanten Fall von selbstgerechter Geschichtsdeutung auseinander. Aus der sicheren Distanz des Nachgeborenen hatte der Schriftsteller Uwe Timm in seiner Erzählung Am Beispiel meines Bruders das Leben seines Bruders rekonstruiert, der sich einst freiwillig und voller Begeisterung zur „SS-Totenkopfdivision“ gemeldet hatte. Timm bekam heftigen Beifall für sein Erfolgsbuch, weil er das Verhalten seines Bruders als Verblendung der „Tätergeneration“ zensierte.
Auf Timms moralische Entrüstung antwortet Buselmeiers Gedicht, das eine strenge musikalische Form wählt. Ich zitiere die erste und die letzte Strophe:
Und wieder in Reihen angetreten die toten Soldaten
getrocknete Uniformhosen über dem blutigen Brei
ein Junge knapp achtzehn vom eigenen Bruder verraten
vor Kursk ohne Beine ruckend auf Krücken vorbei…
Im Rücken faucht ständig das Feuer das uns beschwingt
– Bäume als Fackeln Flugzeuge trudeln vom Himmel –
das die Runen unterm Arm mit der Zunge verschlingt
den Knäuel aus Blei und Dreck die Augen voll Schimmel
Buselmeier zeigt den Schrecken in verstörenden Bildern, aber er moralisiert nicht.
Er zitiert das Schicksal von Uwe Timms Bruder, dem nach seiner schweren Verwundung beide Beine amputiert wurden, als Exempel für ein elendes Sterben, ohne den Zeigefinger zu heben. Auch in den übrigen Texten des Buches präsentiert sich der Autor als lyrischer Geschichtsarchäologe, der die Alpträume der Zerstörung so nah an den Leser heranrückt, dass einem der Atem stockt.
Häresie also, nicht Orthodoxie.
„Vielleicht war es doch günstig“, heißt es im Gedicht „Erzählte Geschichte“, „mein Indianerleben im Verborgenen / zu verbringen, kaum belästigt / und mit endlosen Sommerabenden.“ Zumindest heute dürfen wir ihn noch einmal belästigen, hier in Merzig, an diesem Vormittag im Mai, mit der Verleihung des Gustav-Regler-Preises, zu dem ich Dir sehr herzlich gratuliere, lieber Michael. Ganz am Ende soll das kleine Selbstporträt stehen, das sich Michael in seinem Band Dante deutsch gewidmet hat. Es ist ein Porträt des Dichters als einsamer „Schattenhund“:
Vor vielen Jahren schrieb ich einen Brief
so kurz die Sommer die am Teich ich schlief
so tief die Sumpfgerüche die ich rief
ein Schattenhund der durch die Wüste lief
Michael Braun, Manuskripte, Heft 205, September 2014
LASST UNS WENIGSTENS DIE EIGENE IDENTITÄT INS GEDICHT RETTEN ODER MICHAEL BUSELMEIER IN SELBSTZEUGNISSEN
Hier in der Weststadt bin ich aufgewachsen
auf dem Wilhelmsplatz
Hier bin ich zuhaus
auf dem schwarz-weiß-rot gemusterten Pflaster
vor der Kirche
Am Schlierbach
Als Schüler bin ich hier beinahe täglich
herumgestreunt
Abschied vom Handschuhsheimer Feld
Ich fahre gern diese geraden Feldwege entlang
Ich schreibe aus Schüchternheit
Ich wäre auch gern ein berühmter
Tennisspieler geworden
In Krisenzeiten häufen sich Schädelverletzungen
NICHTS SOLL SICH ÄNDERN
1968 habe ich den Frühling übersehen
vor lauter blau-roten Fahnen
und Begeisterung für die Revolution
Ein Jahr später wäre ich lieber
in der Baumblüte spazierengegangen
ich
dichte mir Stahlkugeln in die Hände
warum ists hier so finster am Tag
warum sind meine Füße so kalt
Ich bin mir selber unbehaglich geworden
manchmal unfähig, einfach Sachen allein auszuführen
Was ist ein Gedicht?
Bald werde ich Sonnen-
blumen zerschneiden
um Mitternacht, in Decken gehüllt
blättere ich in Tagebüchern
mein leben herunter, Seite um Seite
klüger, am Ende fertig?
Ich drehe am Radio, die Sender
rauschen, die Zähne fallen mir aus
Über den ruhig fließenden Bach gebeugt,
passe ich seinen Geräuschen und Farben
Wörter an.
Ein Gedicht um die ganze Welt herum
ließe sich auch zu Hause schreiben
Schaudernd am Fenster
erwarte ich
die Rückkehr der Schwäne
Warum immer das Vertraute beschreiben,
Heimat, was davon blieb?
Im Schurz der Dämmerung allein vor mich hingehend, sah ich eine andere Welt, eine andere Lebensform, nicht die des bürokratisch geordneten Tagwerks der Schulen, Büros und Fabriken.
Aber wohin, wenn ich sprechen muß? Von wem Geld borgen, ohne mich gedemütigt zu fühlen? Wo unterkriechen im Alter?
Was ist mit uns geschehen, wie sehen wir aus? Fettansatz, graue Bartstoppel.
Eine Familie, ein Auto, ein Beruf, eine Ferienreise.
War unser Haß zu schmal?
Sei doch vernünftig.
Das da im Spiegel soll mein Gesicht sein, fremd aus Angst?
Diese Kälte, die manchmal von mir ausgeht, meine verletzende Distanz.
Die Eigenschaft, abwesend zu sein, wenn Frauen mit spitzen
toten Gesichtern mich anreden
Ich will in Zukunft alle Menschen mit ihren Titeln und Amtsbezeichnungen anreden.
Nichts mehr hören und sehen.
Nur fehlts mir an Demut, ich habe nicht zu schweigen gelernt, will immer noch Mittelpunkt sein.
Diese Angst vor Eindringlingen. Jede Veränderung der mich umgebenden Dinge macht mich kopflos, und täglich werden es mehr.
Ich würde es nie wagen, mein Ordnungsgerüst durch Radikalisierung meiner Wünsche zu gefährden. Ein Bedürfnis nach Sicherheit, in der Kindheit produziert.
Ich wuchs nicht, wirkte verstockt und zurückgeblieben, mit fünfzehn Jahren ein dumpfes Kind noch. Ausgesperrt, eingefroren, ein Versager.
Ich bin nicht zuständig für die toten Blicke eurer Kinder. Mit mir hat auch niemand gespielt. Ich habe den Rotz runtergeschluckt und aus dem Alleinsein eine Lebensform gemacht.
Die Literatur zwang mich, genau und mutig zu denken.
Gegen Stumpfsinn und Sprachlosigkeit, in die mich Niederlagen versetzten, schreibend ankämpfen; hier bin ich in Sicherheit.
Ich wollte um jeden Preis auffallen, aber mit eigenen Texten, mit literarisch gebrochenen Gefühlen.
Ich bin nicht radikal, habe nur Radikalität vorzutäuschen verstanden, rebellische Gesten, Gefuchtel.
Nur wer sich ruhig verhält, hinterläßt keine Spuren.
Ich fände es schön, wenn alle Gedichte schrieben und sie auf farbigen Zeitungen an die Bäume hefteten, und die Leute liefen dazwischen herum. Wer hat mich erzogen, die Mutter, die Lehrer? Eher die Gegenstände, die Straße, die Literatur, das Theater, die Revolte.
Ich will eine Geschichte schreiben, in der Wahrnehmungen, Erinnerungen und Reflexionen durcheinanderfallen, die Bewegung eines Bewußtseins durch eine Stadt.
Das Bedürfnis zu schreiben ist immer dann am stärksten, wenn ich mich hilflos/verlassen oder verletzt/angegriffen fühle; eine Art Selbstrettung.
Programm gegen den Tod.
Ich verstehe den Tod nicht, keinen. Kann ihn mir nicht vorstellen.
Kein Körpergefühl.
Ich male mir aus, wie ich, den Hund auf meinem Schoß, in einem verkratzten hölzernen Rollstuhl herumgefahren werde, mit Baskenmütze und dunkler Brille, auf Parkwegen im Nieselregen.
Dann liege ich gelbhäutig, leicht grinsend im Kasten mit hochgebundenem Kinn, meine nackten Füße ragen zwischen Blumensträußen hervor.
Bevor jemand stirbt, rauscht es im Laub;
ist da ein Weg?
Woher kommt die Angst, daß die Welt plötzlich leer ist?
Was hält mich hier?
Was hält mich in dieser Stadt
das Leichenhaus
Im Augenblick ist die Erinnerung ohne Schrecken.
Johann Lippet
MÄRCHENHAFTE GESCHICHTE
für Michael Buselmeier und Peter Hamm
Buselmeier weiß alles über Heidelberg.
Buselmeier weiß alles über Nietzsche.
Buselmeier weiß alles über das großvaterdorf
des philosophen. querfeldein möcht er ausziehn,
Pobles zu finden, märchenhaft hört sich das an.
zwischen Weimar und Naumburg sehn wir
erdbilder, in rostgoldne oktobersonne getaucht,
das zaundürre waschbrettland, nicht fisch noch fleisch,
schmeckt nach braunkohle und vergammeltem Sozialismus,
am weingarten, wo er gewohnt hat mit schwester und mutter,
schütteln biedere bürger die köpfe:
nee, nee, e Nitsche wohnd hier ni.
vox populi aus offenen fenstern. sogar
die gedächtnislücken, die uns behende beispringen,
haben neuerdings ein wörtchen mitzureden.
aus den verwahrlosten wohnhäusern spielt sich
das fröhliche unwissen die bälle zu
leichter hand. ein wort gibt das andre, quer
über die holprichte gasse hinweg.
in der kirche zu Röcken schlägt Hamm die orgel,
versiert und vehement, auf daß sein choral uns erhebe
bis in die sparten, am grabmal des philosophen
vertreten wir uns verlegen die füße.
Buselmeier läßt sich nichts abhandeln.
unbeirrt hält er kurs auf sein ziel.
hartnäckig besteht er auf der suche
nach dem weltverlornen großvaterdorf
in der dunkelheit schwimmen dörfer,
die an faden lichtern glimmen.
Pobles entzieht sich, taucht ab ins nichts.
eine niemandsgemeinde, die der schwarze mann
geholt haben muß. wir tauchen in eine geschichte,
die uns immer märchenhafter umfängt.
in Pobles spielte Nietzsche räuber und schampampel.
mit bleisoldaten die belagerung von sewastopol
kriegsgetreu nachgestellt.
papierschiffe mit pechkugeln beschossen.
in der gelehrtenstube des großvaters gestöbert.
in den garten entwichen mit einem buch unterm arm.
im traum stürzt das pfarrhaus zusammen.
angstgekrümmt sieht er die großmutter sitzen
unter geborstenem holz, hier hat er wirklich gelebt
heißt es bei Janz. wo haben wir wirklich gelebt?
Buselmeier zeigt uns das Nietzschedorf.
es könnte von ihm erdacht sein, wie es so grabesstill
und gespenstisch zur nacht gebettet liegt.
das sprachlose Pobles, in sich versunken, erdwärts
zusammengerutscht in die schuttkegel
aller irdischen vergänglichkeit, längst
aus der welt herausgenommen. die wuchtige dorfkirche
nur mehr ein torso. abgetragen türm und dach.
ausgebrochen die fenster. ein denkmal
für wahrträume, in dem der mond
je nach belieben fratzen schneidet.
unter den schuhen knirschen die scherben.
die gruft der Edlen von Kleefeld geschändet
von grabräubern. die särge aufgebrochen,
die gebeine wahllos verstreut, der lichtkegel
einer taschenlampe lehrt uns das gruseln.
Wulf Kirsten
Auskünfte. Autoren im Dialog: Michael Buselmeier (1975)
Zum 80. Geburtstag des Autors:
Michael Buselmeier: Kurze Bilanz
Sinn und Form, Heft 2, März/April 2019
Volker Oesterreich im Gespräch mit Michael Buselmeier
Rhein-Neckar-Zeitung, 25.10.2018
Oleg Jurjew: Jugendlicher Buselmeier
Michael Braun und Ralph Schock (Hrsg.): Nichts soll sich ändern, Wunderhorn Verlag, 2018
Michael Zeller: „…eben noch ein Kind…“
Michael Braun und Ralph Schock (Hrsg.): Nichts soll sich ändern, Wunderhorn Verlag, 2018
Fakten und Vermutungen zum Autor + IMDb + KLG +
Kalliope
Porträtgalerie


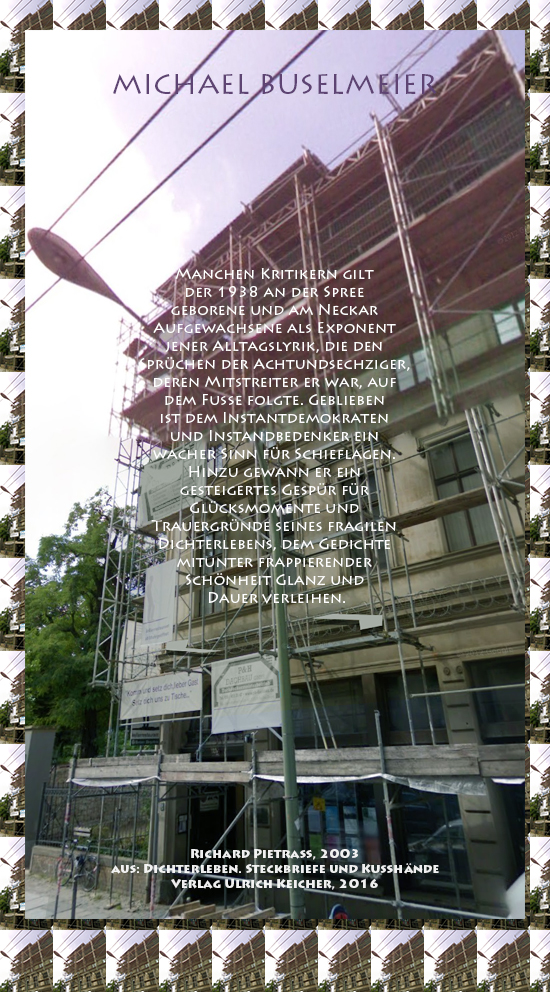












Schreibe einen Kommentar