Michael Krüger: Nachts, unter Bäumen
WIE SIE SCHREIBEN
für Paul Wühr
Einer hebt den Stein und schreibt
ein Gedicht über die Wahrheit,
die sich teilt und versteckt.
Einer sieht unter dem Stein
die Distel und findet nur Worte
für Trauer. Einem springen die Silben
aus der Faust. Ein anderer schreit.
Der Wissende sitzt im Archiv
und zerkratzt Wort für Wort
sein Gesicht. Und neben ihm einer,
der sich zusammensetzt aus Wörtern,
ihm fehlt noch ein Vers.
Einer geht durch die Städte
und sammelt verzweifelt Belege.
Einer tauscht Wörter ein,
bis sein Gedicht glänzt, innen
und außen. Einer findet einen Reim
und freut sich zu Tode
Michael Krügers Gedichte
wachsen auf dem Feld täglicher Erfahrungen. Sie leben von ihrer Fähigkeit, Haken zu schlagen und blitzschnell die Richtung zu wechseln. So kommen sie an ihr Ziel. Dies Ziel heißt Einsicht. Es sind Gedichte, in denen es sich leben läßt, gerade weil sie so viel von der Hinfälligkeit und dem Gerade-Noch wissen: eben das macht den Verstand und vor allem die Sinne wach, und aus zarten Gesten werden zärtliche.
Wohnen, Reden, Gehen, Fremdeln, Schreiben heißen die einzelnen Kapitel dieses Buches, aber in einem gewissen Sinn meinen die Wörter alle das gleiche: Hiersein; Hiersein und Hinschaun, auf der Hut sein und – sich heillos Hingeben.
Krüger ist auch ein Überraschungskünstler; von Zeile zu Zeile und mit kleinem Abstand geht der Leser hinter ihm her: es sind Gedichte, denen man auf den Versen bleibt.
Residenz Verlag, Klappentext, 1996
Das Privileg der Worte
− Michael Krügers neue Gedichte. −
Gott kommt vor in diesen Gedichten. Und die Wahrheit und die Gerechtigkeit und das Recht. Und das Gute kommt vor und das Schöne, allerdings mit der Einschränkung, dass „nicht die Schönheit“ ein Privileg sei, „sondern die Worte“ eines seien. Nachts, unter Bäumen, der neue Gedichtband des 1943 geborenen Michael Krüger, versammelt Verse von moralphilosophischem Ethos, altmodisch, romantisch und zugleich auf der Höhe sprachartistischer Modernität.
Die Worte sind das verpflichtende Privileg der Dichter. Sie erlauben eine spezifische Erfahrung des Schönen. Denn sehen können auch die anderen, aber „Arche“ sein für Worte, die „ungeduldig in einem hocken“ und entlassen werden wollen und sich dann wie vom Wind getragen ins Leben mischen, als seien sie Blätter oder Vögel, ein solches ausgesetztes Dasein, das das Wort rettet und hütet und im richtigen Augenblick wieder freigibt, ist nur wenigen aufgetragen:
Wir wählen unsere Sprache, nicht umgekehrt,
und auch das lautlose Prahlen der Augen
sucht sich die richtigen Worte, wenn die Zeit
dafür kommt. Aber manchmal, wenn man still
hinter dem Fenster steht und dem Lorbeer
zusieht, wie er kokett sich dem Wind überlässt,
fängt es von selbst an und sagt:
flatternde Wimpern
(„Blick in den Garten“).
So lebt der Dichter immer auf beiden Bewusstseinsebenen: dem Anblick der vom Wind belebten Lorbeerblätter und dem sprachlichen Bild der „flatternden Wimpern“, das daraus entspringt. Das Rätselhafte dieser Konstellation, die zugleich eine freie Wahl und das Vernehmen eines Diktats ist, umkreisen mehrere Gedichte.
Nichts hält den Tag besser zusammen
als dieser eine lange Blick aus dem Fenster.
Man lernt mit den Augen, wie Empfindungen
zu Worte kommen, wie die Wörter heilen
und wir mit den Wörtern
heisst es im Gedicht „Offenes Fenster“.
Durch das Fenster, den bevorzugten Ort romantischer Perspektive, geht der Blick nach draussen, sieht den Garten, sieht aber zugleich, wie Empfindungen Worte werden. Das „lautlose“ Auge er-schaut Sprache, und die Öffnung nach draussen wird dann zu einer heilsamen Schliessung: „Eine Wunde, die nicht mehr blutet“. Verse können den Arche-Poeten retten, bedürfen aber selbst der Rettung aus der Sintflut der Unaufmerksamkeit.
Was ist, fragt eines der schönsten Gedichte, mit all jenen „kleinen Versen“, die der poetische Blick nicht in langer Kontemplation, sondern zwischen zwei Lidschlägen schreibt? Zwar sind sie gleich auf einem unabsehbaren „Weg ins Dunkel“ verschwunden, wenn ein zweiter Augenblick sie aber wieder auftauchen lässt, erweisen sie sich vielleicht als lebendiger und haltbarer als die grossen Wörter, die der pathetische Verseschmied „im fiebrigen Prasseln“ zu Klang gemacht hat.
Nachts, unter Bäumen spricht von der geheimen Gemeinschaft derer, die in einem primär sprachlichen Weltbezug leben. Über dieser Nacht steht das Sternbild der lebenden und toten Dichter. In einer digitalisierten Zeit, in der Fragen nach dem Gespräch auf das Wie der Kommunikation, die technische Machbarkeit der Vernetzung zielen, kann die Frage danach, was wir uns denn eigentlich zu sagen haben, seltsam antiquiert und zugleich provozierend erscheinen, wie das leise Gespräch zweier Menschen in einem alten Haus:
Wir leben hier, um ein Gespräch
fortzuführen, wir sammeln Erinnerungen
zu einem bestimmten Zweck, unsere Augen
sind von dieser Welt, auch wenn wir sie
immer öfter schliessen, um etwas sehen zu können.
Die internationale Heimat in den Büchern der modernen Poesie kann das Internet deklassieren. Krügers Zeilen sprechen von Hingabe an das Anschauen und von Selbstversenkung. Natürlich werden Gedichte aus Wörtern gemacht und nicht aus Gefühlen, und doch muss dem Machen eine Empfindsamkeit und Empfänglichkeit vorausgehen, wie es das titelgebende Gedicht „Nachts, unter Bäumen“ sagt:
Ein Stern schon abgekauft
dem mächtigen Schädel der Nacht,
ihn brachte das Käuzchen.
Die Worte bleiben dir treu,
während es in dich einströmt,
keins verrät sich und dich.
Michael Krüger hat moderne Erlebnisgedichte geschrieben, in denen, was geschieht, immer auch ein Spracherlebnis ist. Die Kapitelüberschriften alternieren zwischen Raum- und Textbezügen: „Wohnen“, „Reden“, „Gehen“, „Schreiben“; ein Kapitel „Fremdeln“ ist zwischengeschoben. In ihm überraschen surreale Visionen, traumhafte Verstörungen und Rätsel:
Keiner weiss, wer ich bin
(und ich werde es nicht verraten).
Das ist mein Geheimnis.
Ich möchte Gott sehen im Asyl.
Ihm werde ich meinen Namen sagen.
Er wird mich sofort erkennen
und für mein Wohlergehen sorgen.
Angelika Overath, Neue Zürcher Zeitung
Subversive Stimmen – meteorologische Metaphern
− Über Michael Krügers Gedichtband Nachts, unter Bäumen. −
Von den 78 Gedichten des Bandes gehören elf zum Abschnitt WOHNEN, dreizehn zum Abschnitt REDEN, fünfundzwanzig zum Abschnitt GEHEN, einundzwanzig zum Abschnitt FREMDELN, acht zum Abschnitt SCHREIBEN.
Während der Lektüre wünschte ich mir, die Gedichte gleich vorzulesen und mit jemandem darüber zu sprechen. Ich nannte sie für mich „Kommunikations-Gedichte“ zum Unterschied von „Gedicht-Gedichten“. In die letzteren würde ich mich versenken wollen, während die Krüger-Gedichte mich dazu veranlassen, herausgehen zu wollen und zu fragen „hat er mit dem und dem Bild recht“, oder „gefällt dir dieser oder jener Gedanke auch so gut“: nicht allein nachts unter Bäumen, sondern in Auseinandersetzung.
Die fünf Themen des Wohnens, Redens, Gehens, Fremdelns, Schreibens berühren uns alle, jeder wohnt, redet, geht, fremdelt (entwicklungspsychologisch eine wichtige Phase im ersten Lebensjahr) und fast jeder schreibt. So aufgefaßt, gehen die Gedichte uns alle an und laden dazu ein, sie gemeinsam zu lesen.
Dieser grundsätzlichen Verbundenheit der Menschen, nicht nur der lesenden, steht die W e l t gegenüber; sie ist die „undurchdringliche Welt“, und was uns betrifft, so heißt es: „Jeder muß sich etwas ausdenken, das er für wahr hält: ausdrücklich oder verschwiegen“ („Erziehung“).
Krüger legt aber keinen Essayband vor, sondern Gedichte; und somit braucht es kein Begriff zu sein, der die Vermittlung herstellt zwischen uns und der Welt, sondern es sind Bilder, die vermitteln.
Zugespitzt gesagt: das Leichteste, der W i n d schafft es, dem Härtesten standzuhalten, Bäume zu biegen, ihnen „Haltungen aufzuzwingen“, („Brief vom 1. Februar 1995). Das Gedicht teilt mit, daß die Schwester, Begleiterin der Kindheit, gestorben ist und „man merkt, wie wenig einem gehört“.
Der Wind ist eine unsichtbare Kraft, der Wind ist beißend, die Menschen gehen schneller, „als würde ein Wind ihnen Beine machen“, heißt es in dem Gedicht „Wind“. Auch hier ist uns „die Welt“ gegenübergestellt, und das Werkzeug, die Zange, fehlt, diese Welt zu messen und Antworten zu finden auf solche Fragen, wie etwa daß ein Hund einen anderen Hund ankläfft, und daß der wiederum sich zitternd beschimpfen läßt: „Warum läuft er nicht weg?“
Die Bewegung des Windes nimmt „die Sätze“ mit. Sie verwandelt sie „in eine einfache, allgemeine Antwort“.
Insgeheim aber weiß der Leser – in unausgesprochener Kumpanei mit dem Dichter −: diese Antwort, einfach, allgemein, kann es gar nicht geben, die „das Sandkorn wie die Sterne, den Gott wie den Wurm urnfaßt…“.
Michael Krüger hat – was manuskripte-Leser vielleicht wissen – beruflich mit Literatur zu tun, er arbeitet in einem Literaturverlag. Wenn so ein Berufs-Literatur-Mensch Gedichte schreibt, ist niemand überrascht, daß dabei auch manche Gedichte sich Leute des Schreibens oder das Schreiben selbst zum Thema nehmen. Acht von ihnen sind unter diesem Tite zusammengefaßt, sind aber ihrerseits untereinander sehr verschieden.
„Wie sie schreiben“ ist dem Autor Paul Wühr gewidmet (der nun gerade, während dieser Bericht entsteht, im Literaturhaus Berlin aus einem neuen Text gelesen hat); Krügers Gedicht macht sich darüber Gedanken, wie andere schreiben:
Einer hebt den Stein und schreibt
ein Gedicht über die Wahrheit,
die sich teilt und versteckt.
Einer sieht unter dem Stein
die Distel und findet nur Worte
für Trauer. Einem springen die Silben
aus der Faust. Ein anderer schreit.
Der Wissende sitzt im Archiv
und zerkratzt Wort für Wort
sein Gesicht…
Einer findet einen Reim
und freut sich zu Tode.
Alle diese schreibenden Charaktere gibt es sicherlich. Krüger hat beobachtet. Ist er selber der, der „durch die Städte geht und verzweifelt Belege sammelt“? Das Sammeln mag für ihn zutreffen, die Verzweiflung doch sicher nicht; das Gedicht über die Schreiber entspringt einer liebevollen Ironie, die darauf schließen läßt, daß dem Autor die Stücke seiner Sammlung eher zufallen, daß er sie mit leichter Hand hält.
Im „Sommersturm“, zugedacht „für Karl Riha“ spielt der Wind in der Krone des Baumes, die Blätter lassen den Beobachter an lose Seiten der Bücher von Dichtem denken, das rauschende Laub und die Wörter vermischen sich im Bild und gehen mit dem Wind und werden mit ihm kommen – so wird Wind zum Symbol der Bewegung in der Z e i t .
Das Gedicht „An Zbigniew Herbert“, den polnischen Autor, drückt eine Befürchtung aus „vor dem schwindenden Vorrat der Träume“. Es weiß von virtuellen Bildern im Gehirn, wo ein Baum aussieht wie der andere, wo die Unterschiede verschwinden und Spiegelbilder uns verwirren mögen, weil wir Illusion der Realität „in unserem Land“ von der Realität selber nicht mehr zu trennen vermögen. Was ist zu folgern?
Bald, lieber Zbigniew, werden wir alle Spiegel im Lande
verhängen und die Bilder zur Wand kehren,
damit das Bild, das uns zeigt,
den nicht aufhält, der am Ende
unvorstellbaren Welten entgegenwandert.
Man merkt, die Gedichte gehen weit über den Umkreis eines individuellen „lyrischen Ich“ hinaus. Mit ihrem Atem oder Impuls erinnern sie an die „politische“ Lyrik griechischer Autoren der frühklassischen Zeit, denen die P o l i s am Herzen lag, „unser Land“. Ich erwähne Alkaios, Zeitgenosse der Sappho (6. Jahrhundert v. Chr., dessen Gedichte wie etwa „Das Staatschiff“ den Horaz noch inspirierten), oder auch Bakchylides (5. Jahrhundert v. Chr.) mit einem Gesang an den „Frieden“. Selbstverständlich ist Michael Krügers Lyrik in u n s e r e r Zeit zuhause, sie liegt ihm am Herzen. Auch formal ist er modern, er verwendet Versatzstücke, Montagen, Zitate, er schreibt u n s e r e Themen. Aber die Verwandtschaft mit diesen antiken Dichtern bleibt, sie liegt im überpersönlichen Engagement. Etwa im Gedicht über den „letzten Tag des Jahres“, wo es um die Welt geht, „die kommen wird“…, aber „im Grunde, und diese Lektion mußten wir nicht lernen, / fängt mit jedem Tag ein neues Jahr an: das Jahr des Krieges. / Und ist keine Allegorie wie der sich lümmelnde Engel / mit der Gasmaske in den lächelnden Galaxien“.
Apokalypse – Untergang: auch das Gedicht „Sehr früh am Morgen“ beschwört ein Unbehagen, das aus dem Gedanken daran ensteht: „Am Rande der Konferenz / für Zusammenarbeit am Untergang Europas“, während der Bildschirm diese Szene zeigt, fällt dem Dichter nur das verzweifelte Bild ein:
Der Himmel sieht aus wie ein Haufen
aufgeplatzter Matratzen, kein Wunder,
daß man, dem Bett entstiegen, froh ist,
wenn die Nacht endlich die Wohnung verläßt.
Meteorologie metaphorisch steht schon am Anfang dieses Gedichtes:
Das Barometer fällt, die Aktienkurse steigen,
und alles unklar, was man Leben nennt.
Deutschland, im Dauerregen, krampft sich
zusammen und wirft ein Sätzlein aus,
das sich nicht schämt der falschen Melodie.
Irgendwo hier muß die Vergangenheit enden,
wie eine Straße, die zu lange ansteigt.
Und dann? ein Steilhang und ein Blick aufs Meer?
Oder schmale Kehren in den Abgrund?…
Es ist nicht Galgenhumor, aber zartbitterer Witz, dessen feine Trauer unsere Vorstellung von dem großen Deutschland begleitet, welches nur ein kleines Sätzlein zustandebringt, und eine falsche Melodie noch dazu… Wir wissen schon, die Aktienkurse sind günstig für die Geschäfte, und darum geht es. Und solchem Treiben der Kurse setzt das Gedicht auch dadurch kein Ende, daß es das Bild von den aufgeplatzten Matratzen an den Himmel malt. Aber wir, mehr und mehr beklommen, spüren dank dieser meteorologischen Metapher, daß die Stimme des S u b v e r s i v e n uns den nebelhaften Schleier der Trauer auflöst, ja dankbar lauschen wir auf diese Zwischentöne, von denen doch am Ende das ganze Gedicht seine widerborstige Atmosphäre hat und seinen Sinn bekommt.
Wer zartbitteren Geschmack mag, wird das Gedicht „Der Friedhof“ mögen. Dichtergräber und ihre Einlieger werden dargestellt, aus einer ironischen Distanz, die plötzlich in Nähe umschlägt, als der Ich-Erzähler bzw. Friedhofsbesucher sich selbst betroffen erkennt: Kommt es überhaupt darauf an, zu dichten? oder reicht „Vogelflug, sich selbst löschende Schrift…“?
Diese Chiffre des Vogelflugs hat sich mir ins Herz geschrieben, sie ist sehr schön.
Mit großer Treffsicherheit und Bilderkraft verwandelt der Autor genau Beobachtetes zu sprachlicher Form. Das Gedicht „Offenes Fenster“ gibt den Blick auf eine Bühne frei, deren Figuren zunächst als Bäume erscheinen, Birken, auch Obstbäume, doch die Beschreibung der Gestalten mit Stamm und Blättern läßt aus ihnen andere, uns verwandtere, Lebewesen entstehen. Und auch das Unglück der Schwalben wird unser eigenes:
Sie haben ihr Talent zur Architektur
überschätzt, denn heute morgen lagen
drei junge noch nackte Tiere auf dem Kies
unter dem Fenster, von Mäusen schon ihrer Herzen
beraubt. Nichts hält den Tag besser zusammen
als dieser eine lange Blick aus dem Fenster.
Man lernt mit den Augen, wie Empfindungen
zu Worte kommen, wie die Wörter heilen
und wir mit den Wörtern…
Durch die Erfahrung – Blick aus dem Fenster – und ihre Besprechung werden wir sozusagen zu richtigen Menschen, und „Gott ist nur ein halber Mensch, immer dieselben, identischen Antworten: Erfahrung ist für ihn ein sinnloser Begriff“. Ja ein solch philosophischer Gott hat es wirklich langweilig, während wir Menschen immerhin Katastrophen kennen, etwa die „Ankündigung der Kündigung“ (Gedicht „Post“). Wir können teilhaben und es auch so formulieren. Die 13 Gedichte REDEN fasse ich unter dem Begriff der T e i l n a h m e zusammen. Die alte Frau hat in ihrer Rede Teil an denen, die im Krieg starben, indem sie von ihnen erzählt; der Narr in seiner Rede hat Teil an den Kleibern, Drosseln und Käuzen, deren Sprache er versteht; der Übersetzer hat in seiner Rede („für Friedhelm Kemp“) Teil an der ihn umkreisenden Sprache; der Archäologe erinnert in seiner Rede: „Auch wir sind Teil des Sandes, wenn es uns nicht gelingt, die Botschaft auszugraben“. Teilhaben oder unterscheiden, als zwei gegenläufige, aufeinander angewiesene Bewegungen.
In der „Rede des Verzweifelten“ findet das Scheitern der Teilhabe – in anderem Zusammenhang schon „Undurchdringlichkeit der Welt“ genannt – seinen Ausdruck:
Keine Zeit mehr, das Versäumte nachzuholen,
die Wege zu schlecht, die Karren zu klein,
nur das, was in die Manteltasche paßte,
ist noch bei uns… Kein Platz für Versäumtes.
In unserer neuen Wohnung
hält sich die Gegenwart auf…
Wenn wir sie nicht beobachten, schreibt die Gegenwart
mit unserem Stift Gedichte,
um sich am Wort zu halten. Für das Sonett
„Die Kälte ist die Zukunft“ – „alle Geschichte
ist eine Geschichte der Temperatur“ −
erhielt sie den Großen Preis der Akademie.
Die Natur ist ästhetisch unvollkommen,
heißt es darin, sie verarmt, nimmt zu,
vermischt sich, wie sie will…
Das Gedicht, im Ton der Bestandsaufnahme und nicht der Anklage verfaßt, endet mit der Zeile: „Kein Wunder, daß wir mit Liebe des Versäumten gedenken.“
Schon der Titel REDEN, der den Gedichten gegeben wird, deutet an, daß es sich dabei nicht um streng lyrische Werke handelt; auch die Form ist ganz offen, der Zeilenbruch fast beliebig oder zufällig. Ähnlich wie Günther Eich in seinen Maulwurf-Texten nähert sich Michael Krüger in den REDE-Gedichten der Prosaform. In verschiedene Rollen schlüpft er mit ihnen: es reden noch „Der Maler“,
„Der Ornithologe“, „Petrarca nach dem Abstieg vom Mont Ventoux“ (Bazon Brock gewidmet),
der „Unentschlossene“, der „Architekt“, der „Finanzbeamte“, der „Postbote“ und – im kürzesten und prägnantesten Text – der Museumswärter:
Ich habe die Welt gesehen
im Bild. (Mich selbst sah ich
im salzweißen Auge des Hasen,
das um Unsterblichkeit bittet
in der Sekunde des Todes.)
Und hatt’ an allen Toden teil.
Für diese zauberhaften (wegen der Sprache) und schrecklichen (wegen des Inbegriffes des Todes) Zeilen trifft zu, was der Klappentext vorschlägt: „Von Zeile zu Zeile und mit kleinem Abstand geht der Leser hinter ihm, dem Dichter, her“, der wiederum dem Museumswärter und der wiederum dem Hasen hinterhergeht…
Der Bogen spannt sich zwischen sogenannt ethischen (politischen) zu existentiellen Anlässen, wenn der Ausdruck erlaubt ist; überall ist Erfahrung zu gewinnen und für die Sprache produktiv zu machen, oder umgekehrt: Sprache ist überall für die Erfahrung produktiv zu machen, überall liegen die Themen herum, für Michael Krüger. Etwa „In Pescia, Ostern“ („für Gerhard Merz“), ein Italiengedicht mit Pinocchio und Heiligen und einer Prozession zwischen Lorbeergewächs, oder in „Wiepersdorf“, dem Dorf und Schlößchen, wo die romantischen Arnims hinflohen, um nicht in „der zerlesenen Stadt Berlin“ zu wohnen und wo heute Russenkasernen lyrik-würdig auffallen.
Sie gehören zu den GEHEN-Gedichten, wie etwa auch das Impressionen-Gedicht „Postkarte aus Budapest, April ’95“ oder „Betreten verboten“, die ausdruckstarke Aussicht hinab auf eine Sandgrube, wo die Loren ihre „aschige Fracht“ transportieren und auch der Sargtuch-ähnliche tiefe Grund an den Tod – der bekanntlich zum Leben gehört erinnert. Auch das sehr innige „Lebewohl“ („für Inge K.“) handelt vom Gehen aus dem Leben, und zum Abschluß singt „ein Chor, in dem ab heute eine Stimme fehlt.“
Wie in dieser Zeile, so versteht es der Autor immer wieder, durch eine sachliche Wendung oder Bemerkung erst Weinerlichkeit gar nicht aufkommen zu lassen, sondern eher den Ton des Chronisten anzustimmen.
Aus dem Fenster hinuntersehen, von der Galerie aufs Theaterpublikum oder vom Turm auf eine Stadt hinunter sehen, das schafft dem Chronisten Distanz; ich verstehe sie als Annahme einer Rolle, die im Unterschied zu den Teilnahme-Gedichten des Abschnitts REDEN vor allem im Abschnitt FREMDELN durchgespielt wird; einer artistischen Rolle, um Pathos erst gar nicht aufkommen zu lassen. Dies gilt, auch wenn der Anlaß zur lyrischen Reflexion katastrophal ist, wie etwa in „Postkarte, in winziger Schrift“, wo man schon an der Widmung „für Izet Saraljic“ erkennt, daß das besprochene Blutvergießen in Bosnien stattfindet; und im Text „Krieg“ – ja laßt uns Gedicht zu dem Text sagen, Arthur Rimbaud hat auch den Dreck schon der Lyrik für würdig befunden.
Nicht immer sind die Texte leicht durchschaubar: eine gewisse Verschlossenheit läßt das eine oder andere Geheimnis stehen, so etwa im Gedicht „Auf der Galerie, mit Hobbes“, wo ein Theaterbesuch Anlaß gibt, Schwermut zu beschreiben – darüber, daß es den Unterschied zwischen Kunst und Leben gibt? und darin Hoffnung? Die Widmung – „für Peter Horst Neumann“, den Lyriker – läßt einen ahnen, daß Fremdeln und Entfremdung auch mit dem Widerspruch zwischen Kunst und Leben zu tun haben könnte. Und für Augenblicke möchte das Geheimnis wohl im Übersteigen der Kunst liegen („Auf dem Turm“):
Als genügte es nicht, den Worten
zu lauschen, findet auch das Schweigen
Gehör.
Oder gibt es für den heutigen Menschen (vor einigen Jahrzehnten wurde er der „unbehauste“ benannt) – der meist im Flugzeug zuhause ist (im Gedicht „Episode“) −, ein neues Signal, Entfremdungs-Signal:
Kein Anschluß unter dieser Nummer…
Wer jedoch mit dem heiter-witzigen und nicht mit dem zart-bitteren Michael Krüger enden möchte, könnte aus dem Gedicht „Grille“ zitieren:
Den ganzen Tag lang hab ich
nichts getan, Papier bekritzelt,
in die Luft gestarrt, den Wörtern
nachgestellt…
Im Ohr das Wachs. Es dichtet.
Nämlich Kommunikationsgedichte!
Hedwig Winkler, manuskripte, Heft 133, 1996
Wädchen, Wald und Dschungel
(…)
Seit Jahrzehnten baut Michael Krüger mit an einem Haus der Poesie, das von Hecken umgeben ist, in denen Geschichten nisten und in dem, anders als bei Kunert, Menschen und Tiere wohnen, die sich einander von ihren Träumen erzählen. Die neuen Gedichte von Michael Krüger künden von einer Sehnsucht, mit etwas eins zu werden, das hinter den Dingen vermutet wird, ohne dabei an Grenzen denken zu müssen. Sie suchen den Blick nach außen, ins Fremde, um sich bezaubern zu lassen und dabei etwas von dem zu erhaschen, was so unzureichend immer mit Wahrheit umschrieben wird. Jedes noch so kleine Leben habe eine Stimme, die gehört werden könne, und wisse von einer geheimnisvollen Kraft, die sich allen Erklärungen entziehe. In dieser Rückbesinnung auf das Kreatürlich-Schöne liegt ein melancholischer Grundton der Gedichte, und, was ihn wieder mit Kunert verbindet, eine Ahnung, vielleicht auch schon ein Wissen um das Ende der Aufklärung in veränderten Zeiten. Michael Krüger liefert eine literarische Sehschule; immer wieder steht das Auge, der Blick im Zentrum seiner Texte. Wahrnehmung und Vorstellung avancieren so zu zentralen Kategorien in einer Wirklichkeit, in der bestehende Wertmaßstäbe als zunehmend unzureichend erfahren werden:
Man lernt mit den Augen, wie Empfindungen
zu Worte kommen, wie die Wörter heilen
und wir mit den Wörtern.
Im Wechsel der Gezeiten, im wilden Flug der Vögel, in Sommerstürmen und Gewittern spiegelt sich ein stetes Werden und Vergehen, an dem die Sprache des Dichters sich orientieren will, dabei jedoch nur mühsam die Welt der Erscheinungen und des Wortes zur Deckung bringt. Was ist wirklich, was lediglich Illusion, Sinnestäuschung oder gar Betrug? Der Vergänglichkeit des Lebens, das in fast archaischen Mustern nicht von der Gewalt lassen will, rückt ein sensibles Bewußtsein widerspenstig auf den knöchernen Leib und erzählt, mit einem skeptischen Augenzwinkern, von seinen prallen Seiten, seinen Vorräten und Lockungen. Keine weiße Fahne weht; unablässig scheint das Bemühen, trotz aller Ermattung in älteren Jahren, die Bilder am Leben zu erhalten. Man verspürt die Atmosphäre einer Zwischenzeit, eines eigentümlichen Stillstands, eines Wartens und Suchens. Vieles geht verloren: der Körper, das Wort, die Erinnerung, die einfache Antwort. Man scheint sich am Rande einer Gegenwart zu bewegen, die „gierig (ist) / nach Antworten. Das schwache Echo / einer einzigen kümmerlichen Antwort, / das mir ins Gesicht spränge und bliebe, / wäre genug“. Im Kreis der Dichterfreunde, denen der Autor einige Gedichte gewidmet hat, lebt noch das Gespräch, gründend auf ähnlichem Sehen und Erleben. Der Glaube an die Kraft der Poesie scheint zwar auch hier brüchiger geworden zu sein, doch die Vorstellung, einmal aus diesem Alptraum zu erwachen, ist allen noch eigen. Von dieser Welt des Vorläufigen, Flüchtigen und Verletzlichen erzählen Michael Krügers Gedichte, kleinen Bausteinen gleich, die nötig sind, um das Haus der Dichtung nicht einstürzen zu lassen.
Thomas Kraft, neue deutsche literatur, Heft 508, Juli/August 1996
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Sibylle Cramer: Aus dem Gästebuch der Natur
Süddeutsche Zeitung, 8./9.6.1996
Rüdiger Görner: Illusion der Realität
Die Presse, 22.6.1996
Heinrich Detering: In der Hecke lesen
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 8.8.1996
Der lange Blick aus dem Fenster
– Gespräch mit Michael Krüger. –
Piero Salabè: Herr Krüger, gab es in Ihrem dichterischen Werdegang so etwas wie eine Berufung?
Michael Krüger: Da man sich selbst am wenigsten kennt und ein ganzes Leben damit zu tun hat, das Innen mit dem Außen zu vermitteln, kommen sehr viele erst im hohen Alter dazu, eine Ahnung davon zu haben, wer sie sind. Es gibt Theorien über die Entstehung von Texten in der Moderne, die nicht mehr von einem Gott ausgehen, der aus einem spricht, oder von einer Instanz, die man preist, sondern vom Innenleben der Künstler. Dieser Grund – das hängt mit der modernen Seele zusammen – verschwindet jedoch, je näher man ihm kommt. Es gibt Leute, die sieben, acht Jahre brauchen, um erfolgreich eine Psychoanalyse abzuschließen, andere wiederum fangen als Sportler und Rennfahrer an, um zum Schluss ihres Lebens zu begreifen, das sie eigentlich jemand anderes sind.
Salabè: Kann es Ihnen auch passieren, dass sie eines Tages denken, kein Dichter gewesen zu sein?
Krüger: Das weiß man nicht. Gerade in meiner Generation gibt es viele, mit denen ich im Literarischen Colloquium in Berlin angefangen habe, die dann starke Zweifel hatten und keine Schriftsteller geworden sind. In meinem Werdegang kann man sicherlich einige Aspekte festmachen – ein sehr konkretes Verhältnis zur Natur, das Aufwachsen in Berlin und die Beschäftigung mit Literatur –, es sind aber nur nebelhafte Anhaltspunkte. Ich glaube, dass viele Menschen, die schreiben, erst zu einem Bewusstsein kommen, wenn sie das ganze Leben von sich abfallen lassen. Ich hatte mit Czesław Miłosz darüber geredet, der über neunzig Jahre alt geworden ist und sagte, er sei überhaupt nicht alt, im Gegenteil, er versuche gerade herauszufinden, wer er sei. Dieser Prozess ist ihm wegen politischer und biografischer Umstände das ganze Leben lang verwehrt geblieben – und auch ich könnte sagen, dass mir die Arbeit im Verlag kaum Zeit gelassen hat, tiefer über die Gründe meines Schreibens nachzudenken.
Salabè: Wenn dieser Prozess so komplex und langwierig ist, woran kann man dann einen Schriftsteller am ehesten ausmachen?
Krüger: An den Büchern, die er liest. Jeder Text, den man liebt, ist wie ein Schacht in die eigene Seele. Ich bin zum Beispiel ein Liebhaber der mittleren und späten Montale-Gedichte. Jenseits der Formen, der Sprachprobleme und Metaphern habe ich seine Melancholie sofort angenommen, jenen eigentümlichen Willen, die Welt eigentlich schön zu finden, und gleichzeitig die Angst davor, sie zu verlieren. Es gibt andere Autoren, von denen ich süchtig werden könnte, etwa der Schwede Tomas Tranströmer oder Fernando Pessoa mit seinen Exkursen in die verschiedensten Ausprägungen eines Ich. Wir haben zwar alle gelernt, in uns die verschiedensten Typen zu sehen, aber es gibt ein sozial bedingtes Verbot, diese Vielheit zum Erscheinen zu bringen, und so geben wir nur einer Person den Vorzug. Melancholie entsteht dann, wenn dieser einen Person die anderen immer reinreden. Wer schreibt, hat aber die Möglichkeit, einige dieses versteckten Figuren zur Sprache zu bringen, ihnen eine Rolle zuzuweisen – und das ist ein großer Vorteil.
Salabè: Die Melancholie, von der Sie sprechen, steht in Verbindung mit Ihrer skeptischen Grundhaltung. Im Gedicht „Archäologie“ aus Ihrem ersten Band Reginapoly schreiben Sie:
Es sollte ein Gedicht
werden über die sich ausbreitende Macht der Meteoro-
logie und ihre nachweislich falschen Prognosen
Mit Klarsicht distanzierten Sie sich in den sehr politisierten siebziger Jahren von ideologischen Diskursen und begegnen auch heute mit Skepsis den Versuchen, das Weltgeschehen auf eine Formel zu bringen – sei es Fukuyamas These vom „Ende der Geschichte“ oder Zižeks Theorien über den „Müll als repräsentativstes Produkt“ unserer Gesellschaft. Macht die poetische Beobachtung immun gegen Ideologien?
Krüger: Ich glaube schon. Es ist mir immer ein Rätsel gewesen, wie man ohne eine prinzipielle Skepsis leben kann. Alle unsere institutionellen Figuren, im Sozialen, im Religiösen, im Politischen, werden innerhalb eines Lebens über den Haufen geworfen. Ich bin in Berlin in der Zeit des Ost-West-Konflikts groß geworden und konnte nie verstehen, was viele Leute, mit denen ich bekannt war, unter anderen Rudi Dutschke, unter Utopie verstanden. Leute, die eine genaue Vorstellung hatten, wie unsere Welt aussehen sollte. Dieser prinzipielle Skeptizismus ist mir geblieben. Wer nicht skeptisch war, musste tief enttäuscht werden, weil die Welt sich nicht nach unseren Vorstellungen entwickelt.
Salabè: In Ihren Gedichten findet eine konstante Auseinandersetzung mit dem Zeitgeschehen statt, die sich in einer intensiven Beobachtung der Natur widerspiegelt. Was bedeutet Ihnen die Natur?
Krüger: Es ist merkwürdig, dass wir heute die Natur als etwas Gegebenes und Kontrollierbares hinnehmen, weil es Fotografie, Film und Untersuchungsmethoden gibt. Ich blicke auf die Natur mit staunenden Augen, wie auf etwas, das uns immer noch unendlich überlegen ist und worüber wir uns Gedanken machen müssen. Mittlerweile behaupten die Naturwissenschaften, in dreißig, vierzig Jahren unseren psychischen Apparat verändern zu können und Glückshormone und andere Mittel biochemischer Art zu finden, um uns zu konditionieren. Meine Methode, mich zu konditionieren, ist ein Spaziergang oder das Liegen auf einer Wiese, aber das ist nicht die Ablenkung, sondern die Hinwendung zur Welt.
Salabè: In einem Ihrer Gedichte aus Idyllen und Illusionen schreiben Sie: „Es geht um diesen Bach, um diese Schnecke, um ihren Bettelgang von Stein zu Stein.“ Gewährt in einer von Bildern dominierten Welt die poetische Betrachtung einen Mehrwert an Wahrnehmung?
Krüger: Wir leben in einer wahrnehmungsarmen Gesellschaft, in der achtzig Prozent der Menschen das Gleiche tun. Gerade beim Film merkt man diese Vereinheitlichung am stärksten; die komplizierten Filme, die mit Wahrnehmungen spielen, werden kaum gezeigt. Die Menschen schrecken heute vor allem Schwierigen und Komplizierten zurück, sie möchten vom Gewicht der Welt entlastet werden. In den nächsten fünfzig Jahren wird es eine Fülle von Philosophien der Leichtigkeit geben, Sloterdijk hat das vorgemacht. Die zentrale Frage wird sein, ob wir uns ein Leben vorstellen können, das leichter ist als das, was wir philosophisch führen. Keiner macht sich heute mehr die Mühe, über das Leben nachzudenken – das sollen die Philosophen, die Dichter und Melancholiker tun. Die Philosophie geht einen Weg und das normale Leben einen anderen. Es wird noch zu einem großen Krach kommen, wenn wir nicht anfangen, uns ein anderes Leben vorzustellen. Für Melancholiker ist das schwer, aber ich hoffe, dass es den zukünftigen Generationen gelingt.
Salabè: Gehen wir von der Betrachtung der natürlichen Wahrnehmung zur Betrachtung der Kunst über. Als Stipendiat der Villa Massimo haben Sie längere Zeit in Rom verbracht, eine Stadt, die in Ihrem Werk öfter vorkommt, so etwa im Zyklus „Römischer Winter“ in Die Dronte. Was bedeutet Ihnen Rom?
Krüger: Rom ist für mich die schönste aller Städte, weil sie das Älteste mit dem Neuesten verbindet. Ich habe dort vier kalte Winter verbracht, die schönste Zeit meines Lebens. Ich hatte ein Haus in diesem wunderbaren Park, um mich herum waren Maler, Musiker und Bildhauer, es lebten damals noch Calvino, die alte Frau Ginzburg und Enrico Filippini. Für mich kam in dieser Stadt plötzlich alles zusammen, sie hat mir einen leichten Schritt gegeben, den ich nicht in Paris oder New York habe, wo sich die Macht der Mode und Ideologie so penetrant zeigt. Ich habe lange überlegt, ob ich in Rom nicht eine Wohnung finden sollte, bin dann aber von dieser Idee abgekommen. Rom ist für mich zu sehr Utopie, und in einer Utopie kann man nicht leben. Ich fahre nur sehr selten hin, um mir mein Bild nicht zu zerstören.
Salabè: In Ihren Gedichten ist auch von „einer leeren Pracht der Denkmäler“ in Rom die Rede. Haben Sie den Reichtum an Kunstwerken auch als eine Last wahrgenommen, so wie es dem Protagonisten von Tarkowskis Nostalghia ergeht, der sich vor dem entleerenden Kunstkonsum flüchtet?
Krüger: Mit Tarkowski habe mich oft in Rom getroffen und die erstaunlichsten Gespräche geführt, da wir außer einem rudimentären Italienisch keine gemeinsame Sprache hatten. Gerade weil Kunst in Rom so selbstverständlich ist, war sie für mich nicht entfremdend. In der Piazza Paradiso, beispielsweise, gab es ein Lokal, in dessen Küche aus der Erde eine alte römische Säule kam, woran die signora ihr Messer wetzte. Von außen sah man gar nichts, wenn man aber in die Küche ging, stand man plötzlich vor dem Altertum. Anders als hier in Deutschland, geht man in Rom ständig über die Kultur der Toten: Man geht über sich, über die eigene Bildung, das, was uns vermittelt geformt hat, alle kulturellen Vorstellungen – Maße, Architektur, Plastik. All das ist in Rom vor meinen Augen, ich gehe auf Schichten, die noch keiner wieder gesehen hat. Das war für mich die schönste Erfahrung.
Salabè: In einem Ihrer letzten Gedichte aus dem Band Kurz vor dem Gewitter haben Sie Rom als „Die Stadt der reinen Poesie“ bezeichnet. Dort zitieren Sie eine Passage aus einem Brief Machiavellis an Francesco Vettori. Der große Denker stellt dar, wie er sich am Abend nach einem mühsamen Tag in die Gewänder der alten Schriftsteller kleidet und so – jenseits der erniedrigenden Realität des Alltags – die eigene Kulturtradition zelebriert. Hat im Laufe der Jahre Ihr Vertrauen in die Macht des Wortes sich ins Utopische verlagert?
Krüger: Nein, ich war nie der Überzeugung, dass in der Moderne die Poesie irgendeine Rolle spielt. Ich musste über Brodsky lachen, der immer sagte:
Hör mal, die Poesie ist älter als alles, Horaz und Homer und so weiter, das bleibt doch, Melancholie sollte verboten sein. Du siehst, alles bleibt, jedes Gedicht von Robert Frost bleibt.
Letzteres ist wahr: Ich glaube nicht an die Rolle der Poesie in der gegenwärtigen Gesellschaft, aber an ihren Bestand in unserer Zivilisationsgeschichte. Deswegen dieses Zitat von Machiavelli. Man kann und muss die Geschichte immer anders interpretieren, aber sie ist das einzig Solide, was wir haben. Und als Sonderposten in der Geschichte besteht die Literatur. Ob im Internet oder sonst wie angeboten, sie ist da und bereichert sich jedes Jahr um neue wunderbare Editionen. Es ist traurig, dass viele sie für überflüssig halten. Das ist ein Zeichen, dass unser Verhältnis zu den Beständen der Kultur abnimmt. Zwar findet eine unendliche Musealisierung statt, auf der anderen Seite rückt unsere Zivilisationsgeschichte in eine merkwürdige Ferne. Ich denke, dass diese Entmythologisierung nicht lange dauern kann. Wenn man sich eines Tages fragen wird, was Bestand hat, wird man auf einige gute Schriftsteller kommen. Wer sie gelesen hat, wird sie nicht vergessen.
Salabè: In Ihrem Gedicht „Offenes Fenster“ (1996) schreiben Sie:
Nichts hält den Tag besser zusammen
als dieser eine lange Blick aus dem Fenster.
Man lernt mit den Augen, wie Empfindungen
zu Worte kommen, wie die Wörter heilen
und wir mit den Wörtern.
Ist es wegen dieses Vertrauens in die Kraft der Wörter und der Natur, dass Sie als „glücklicher Dichter“ definiert wurden? Anderseits ist in Ihrem Werk eine starke Melancholie spürbar, im Gedicht „Leopardi und die Schnecke“ finden wir zum Beispiel den Satz „Nur als Unglückliche sind wir unsterblich.“
Krüger: Ja, das stimmt, dieser „Blick aus dem Fenster“ hat eine heilsame Kraft. Manchmal stehe ich hier, morgens und abends, und blicke zehn Minuten lang in diese Natur, diese merkwürdig riesigen Bäume, und denke, wenn ich das nicht hätte, würde ich vor Nervosität platzen. Dieser Blick erfrischt mich mehr als viele andere Blicke, auch Kunstblicke. Was Leopardi angeht – er wurde in Cioran wiedergeboren. Cioran brachte die Skepsis soweit, dass sie als Säure funktionierte. Er hat alles zersetzt, alle Religionen, alle Illusionen – und trotzdem konnte man mit ihm über das Weltganze reden. Ich glaube, dass Melancholiker, wenn sie nicht in den klinischen Zustand verfallen, die reichsten Menschen sind.
Salabè: Ein paar Fragen nun zu Ihrer Arbeit als Herausgeber von Lyrik: Worauf achten Sie, wenn Sie Gedichte auswählen für Publikationen, woran erkennen Sie, dass sie gut sind?
Krüger: Gedichte interessieren mich, wenn sie viel von der alten Sprache verstehen. Sie müssen vermitteln können. Das wird bei Brodsky sehr deutlich. Er hat sich der alten Formen bedient, hat sie liturgisch gelesen, und es kamen trotzdem immer Worte aus dem 20. Jahrhundert vor. Wenn man eine alte Form benutzt, muss man ein Vermittler sein, über Worte werden Formen aus sehr weiter Ferne ins Moderne getragen. Das sind die Dichter, die mich interessieren, von denen ich nur sehr wenige verlegt habe. Es gibt Gott sei Dank sehr viele Dichter auf der Welt, obwohl wenige Menschen sich wirklich dafür interessieren. Das ist mein ganzes Glück, immer wieder jemand zu entdecken. Auch wenn ich ihn nicht verlegen kann, denke ich: Das ist mein Bruder. Wo immer er auch leben mag – in Ecuador, Spanien oder Schweden –, er nimmt die Sprache ernst und übt diese merkwürdige Tätigkeit unter großen Entbehrungen aus. Das wird wie eine geheime Botschaft weitergegeben und man kann jeden Text über zweitausend Jahre zurückverfolgen. Es festigt unsere Zivilisation, wenn Menschen Gedichte lesen, sich daran erfreuen und diese Kettenbildung dabei bewusst wird.
Salabè: Würden Sie mit Borges einverstanden sein, dass man stolzer sein müsste auf die Bücher, die man gelesen hat, als auf die, die man geschrieben hat?
Krüger: Borges hatte keineswegs die gesamte Weltliteratur gelesen, obwohl es manchmal den Anschein machte. Was er aber las, das war für immer gefunden. Er ging überhaupt keiner Mode nach, er las isländische Sagas oder ganz merkwürdige Texte, auch aus der deutschen Literatur. Er hat sie geliebt, geradezu gefeiert, und es war wunderbar zu sehen, mit welch kindlicher Freude er über seine Funde sprach. Borges hatte nur eine kleine Spur der Weltliteratur gelesen, aber es war seine Spur. Aus dieser Spur konnte man die DNA von Jorge Luis Borges herausfinden.
Salabè: Sie haben die Möglichkeit einem jungen Dichter, so wie damals Rilke, einen Brief zu schreiben: Was würden Sie ihm empfehlen?
Krüger: Drei Sachen. Gehe lange spazieren, lies lange und verzweifle nicht, wenn du nicht veröffentlichst. Das Spazierengehen verhindert, dass man – was es heute sehr oft gibt – Schreibtischgedichte produziert. Das heißt, ich lese dreißig gute Gedichte, baue sie vor mir auf und schreibe ein einunddreißigstes hinzu, ein synthetisches Gedicht, das von keiner Erfahrung ausgeht. Das zweite: Lies die anderen, nur durch das Lesen der anderen machst du dich mit Formen vertraut, über die du später eine eigene findest. Und das dritte: Gerade weil diese Texte nicht wirklich gebraucht werden, ist es nicht so wichtig, dass man überall erscheint. Wichtiger ist es, dass die Dinge zu sich selber kommen, dass die Texte untereinander ein Gespräch führen. Nicht zuletzt durch das Internet gibt es heute für jeden die Möglichkeit, sich am Sprachfluss zu beteiligen. Aber ich denke, es ist gut, wenn man sich eine Weile zurückhält, die Sprache fließen lässt und vielleicht erst in drei Jahren ein Hölzchen wirft. Vielleicht kommt es irgendwo an, vielleicht sieht das jemand, vielleicht gelangt es aber auch durch bis zum Meer und keiner hat es bemerkt. Das gibt es auch, man sollte aber darüber nicht verzweifeln. Ich finde es schön, wenn man etwas von sich weggibt, ohne zu wissen, ob es ankommt. Diese kleinen Gedichte sind kaum mehr ein dionysisches Feuerwerk für die anderen, wie es sich Nietzsche vorstellte, sie sind eher eine Marginalie. Wenn ich sie aber finde, können sie für mich, den Leser, das Größte sein. Dieses Suchen und Finden, dieses Schnüffeln, Herumgehen und Stöbern in Zeitschriften ist Teil der Faszination von Poesie.
neue deutsche literatur, Heft 562, Dezember 2004
Welche Poeme haben das Leben und Schreiben von Karl Mickel und Volker Braun in der DDR und Michael Krüger in der BRD geprägt? Darüber diskutierten die drei Lyriker und Essayisten 1993.
Das Werk: Michael Krüger am 14.6.2004 im Literarischen Colloquium Berlin
Frank Wierke: Verabredungen mit einem Dichter – Michael Krüger
Zum 70. Geburtstag des Autors:
Gregor Dotzauer: Das unbändige Leben der Agaven
Der Tagesspiegel, 9.12.2013
Volker Isfort: Er wird noch gebraucht
Abendzeitung München, 8.12.2013
Thomas Steinfeld: Herr K. tritt ab
Süddeutsche Zeitung, 9.12.2013
Charles Simic: Der Regenmantelmann
Neue Zürcher Zeitung, 9.12.2013
Norbert Gstrein: Der leere Raum
Neue Zürcher Zeitung, 9.12.2013
Cees Nooteboom: Der andere Atem
Neue Zürcher Zeitung, 9.12.2013
Peter von Matt: Der Freund auf der Kommandobrücke
Neue Zürcher Zeitung, 9.12.2013
Hans-Dieter Schütt: Warum fallen Sterne nicht herab
neues deutschland, 9.12.2013
Mara Delius: Nach draußen, hinein ins Buch
Die Welt, 9.12.2013
Zum 75. Geburtstag des Autors:
Britta Schultejans: Michael Krüger wird 75
Abendzeitung, 7.12.2018
Georg Reuchlein: Michael Krüger (75)
BuchMarkt, 9.12.2018
Zum 80. Geburtstag des Autors:
Gerrit Bartels Interview mit Michael Krüger: „Gott ist ein Melancholiker“
Der Tagesspiegel, 7.12.2023
Willi Winkler Interview mit Michael Krüger: „Ich habe mich der Literatur höflich genähert“
Süddeutsche Zeitung, 7.12.2023
Arno Widmann: Der virtuose Gesang und der Schrei
Frankfurter Rundschau, 9.12.2023
Andrea Köhler: Kaum einer hat so viele Literaturnobelpreisträger in seinem Verlag versammelt wie Michael Krüger
Neue Zürcher Zeitung, 8.12.2023
Hannes Hintermeier: Schwimmer im Meer der Gedichte
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 8.12.2023
Hans-Dieter Schütt: Wie kommen Sterne an den Himmel?
nd, 8.12.2023
Leander Berger: Lesen als Lebensmittel
Badische Zeitung, 9.12.2023
Quh: Freund der Ziegen
quh-berg.de, 9.12.2023
Martin Schult: „Danke“
Börsenblatt, 8.12.2023
Volker Weidermann: Küsse, Nasenküsse, Ringkämpfe. Abschiedsfest für Michael Krüger.
Ein Abend für Michael Krüger. Michael Krüger ist eine Legende des Literaturbetriebs. Am 16.1.2014 sprach er in der Literaturwerkstatt Berlin mit Harald Hartung über seine Arbeit als Verleger, Herausgeber, Autor und Übersetzer.
Fakten und Vermutungen zum Autor + Archiv + KLG + IMDb + PIA
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Galerie Foto Gezett +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + Keystone-SDA +
deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Michael Krüger – Lebenselixier Literatur im Gespräch mit Norbert Bischofberger, SRF 22.9.2013.


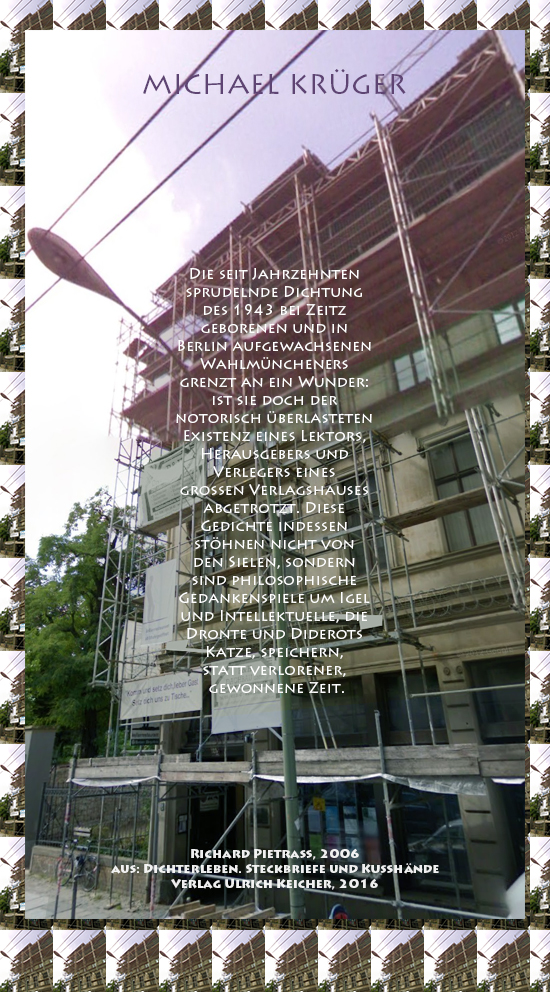












Schreibe einen Kommentar