Peter Hacks: Werke Band 1 – Die Gedichte
DIE BEGÜNSTIGTEN
Der Genien würdigste sind uns gewogen.
Kühnheit, uns floh sie nicht, Witz blieb nicht ferne.
Die Schönheit trat hinzu mit ihrem Sterne.
Kunst hat uns, und vergebens nicht, erzogen.
Und auch sie selbst, die Liebe, hat unendlich
Hoch uns bevorzugt. Im Vermögen gleichen
Wir uns zur Lust, und die geheimen Zeichen
Sind unsrer Sehnsüchte uns wohl verständlich.
So stehen sie gar huldreich oder fliegen
Um unser breit und königliches Bette.
(Weltklugheit aber hat uns diese Stätte
Und Wohlstand zugesprochen). Und wir liegen,
Zum Glück entschlossen, und verlangen mehr
Als Sterbliche. Und haben es sehr schwer.
Der Erdenwunder schönstes war die Mauer
− In seinen Gedichten ist für Peter Hacks die Liebe und die Sowjetmacht nur gemeinsam darstellbar. −
Man sollte nicht zögern, den Schriftsteller Peter Hacks, der seit 40 Jahren sein beträchtliches literarisches Talent in die klassizistische Denkmalspflege des Sozialismus investiert, als mittlerweile alleinigen Inhaber des Landesrekords in politischer und literarischer Dissidenz auszuzeichnen. Denn mit seinen Gelegenheitsgedichten des Zyklus Jetztzeit, die er von 1998 an in der Zeitschrift konkret, der unerschütterlichen Trutzburg für Sozialismus-Apologetik, veröffentlichte, ist es ihm gelungen, alle jene Positionen zu besetzen, die gemeinhin als indiskutabel und semi-kriminell gelten. Die Edition Nautilus hat nun die Jetztzeit-Gedichte zusammen mit dem älteren lyrischen Œuvre von Hacks: also den Liedern zu Stücken, den Balladen und Gesellschaftsversen im sechsten Band der Hacks-Werkausgabe gebündelt – und siehe da: die jüngsten poetischen Erzeugnisse von Hacks markieren nur die Radikalisierung einer älteren politischen Obsession.
In seinen polemischen Verslein, die ein hohes Maß an Reimschmiedekunst bezeugen, geriert sich Hacks ein bisschen als ein Stefan George von links, freilich unter Verzicht auf eine devote Jüngerschar, die zur Anbetung des Meisters bereit wäre, denn einen ehrfürchtigen Dichterkreis wird Hacks für seinen ästhetischen wie politischen Extremismus nicht mehr finden können. Was er in seinen leichthändigen Heinrich-Heine-Liedern und Volksliedstrophen an politischen Überzeugungen ausbreitet, wird man nur als Resultat einer selbst gewählten Verblendung wahrnehmen können. Und dennoch ist sein provozierender sozialistischer Eskapismus nicht ohne Reiz.
Kein deutschsprachiger Autor der Gegenwart hat mit ähnlicher Konsequenz und Halsstarrigkeit an einer politisch obsoleten Position festgehalten, keiner hat so sehr mit der Pose eines absoluten Nonkonformismus kokettiert wie eben Peter Hacks. Diese Brüskierung des politischen und literarischen Konsensus hat in seiner Werkgeschichte eine lange Tradition. Als in der DDR schon die erste Massenflucht einsetzte, entschloss sich der Münchner Jung-Dramatiker 1955 zur Übersiedlung in seinen sozialistischen Wunschstaat. Als in den 60er Jahren die Kulturpolitiker der DDR nach langen Krämpfen die literarische Moderne und den Expressionismus entdeckten, verschrieb sich Hacks der Klassik. Das Ende der DDR kommentierte er dann mit schrillen Sinnsprüchen, die in ihrem unvergleichlichen Misslingen fast schon wieder interessant klingen: Wer war der, der vom meisten Blute troff? / Wars Churchill, Hitler oder Gorbatschow? Was Hacks in seinen luziden Volksliedstrophen und boshaften Knittelversen aus jüngster Zeit zur Geltung bringt, ist ein linksaristokratischer, ästhetischer Fundamentalismus in Reinform.
Zehn Jahre nach dem Kollaps der DDR besingt Hacks die Berliner Mauer als „der Erdenwunder schönstes“ und träumt von den heroischen Zeiten, da Väterchen Stalin noch die Geschicke des real existierenden Sozialismus lenkte:
Wer kann die Pyramiden überstrahlen?
Den Kreml, Sanssouci, Versailles, den Tower?
Von allen Schlössern, Burgen, Kathedralen
Der Erdenwunder schönstes war die Mauer.
Mit ihren schmucken Türmen, festen Toren.
Ich glaub, ich hab mein Herz an sie verloren.
Den wütenden Aufschrei von allen politisch korrekten Zeitgenossen hat der sozialistische Elfenbeinturmbewohner natürlich schon einkalkuliert. Mit seinem fein entwickelten Sensorium für politisch unpopuläre Fundamentalopposition kultiviert Hacks sein Wunschbild vom sozialistischen Staat als verlorenem Paradiesgärtlein, das nach dem Sturz von Walter Ulbricht ins Verderben geriet. Für den „Rumor“ von Bürgerrechtlern und kritischen Sozialismusreformern hatte er schon immer seine poetisch wohl organisierte Verachtung parat. Schon in der über zwanzig Jahre alten Ballade Die dreißig Tyrannen, eine der zahlreichen historischen Maskeraden des Autors, trifft der grimmige Spott des Dichters die „trüben Emigranten“ und „Nörgler von zuhaus“.
Erzählt wird vom Schicksal Athens, das nach seiner Niederlage im Krieg gegen Sparta erleben musste, wie die beschützende Mauer(!) niedergewalzt und die „Nörgler“ und „Emigranten“ von den Besatzern mit den Regierungsgeschäften betraut wurden. Dass es mit den neuen „Tyrannen“ nichts werden kann, verraten schon die Eingangsverse der Ballade:
Leute gabs und gibt es heute,
Die im Dünkel abseits stehen.
Schwache Leute, eitle Leute
Gabs auch in der Stadt Athen.
Damals warens ihrer dreißig,
Die vom Ausland her gewühlt
Oder in der Heimat fleißig
Ihren Sonderwert gefühlt.
Man kann schon aus diesen ätzend ironischen Balladen-Tönen die ganze Hackssche Poetik heraus präparieren. Denn sie besteht zum einen aus der literarischen Selbstverpflichtung zur „sozialistischen Klassik“, zum anderen aber aus einer radikal hegelianischen Staatsvergötterung, die den Herrscher als Fürsten preist und alle Systemopponenten der Lächerlichkeit preisgibt.
Die Staatsvernunft ist bei Hacks stets das Wirkliche, das es gegen unvernünftiges Dreinreden von „im Dünkel abseits stehenden“ Eitelkeitssubjekten oder „Bürgerrechtlern“ zu verteidigen gilt. Zu den Erben jener dreißig Tyrannen-„Bösewichte“ in der Ballade gehören nach Hacks ästhetisch-politischer Vorstellung denn auch jene verdächtigen Existenzen von „Thierse, Schnur und Stolpe“ bis hin zu „Schröder, Ull- und Eppelmann“, die im viel später entstandenen Gedicht Appell zur Guillotine geführt werden. Der Entschluss zur hegelianisch eisernen, realsozialistischen Standhaftigkeit verwundert ein wenig, war doch Hacks selbst einst in Verdacht geraten, sich „eitler“ Abweichung schuldig gemacht zu haben. Als er 1960/61 seine geliebte Wunschheimat mit zwei kritischen und doch linientreuen Zeitstücken beglücken wollte, dankte ihm das die Obrigkeit wenig. Mit den Stücken Die Sorgen und die Macht (1960) und Moritz Tassow (1961) glaubte Hacks auf dem Weg zur Planerfüllung des „Bitterfelder Weges“ zu sein. Rasch sah er sich eines sozialistisch Besseren belehrt, als seine Stücke vom Spielplan abgesetzt wurden und er selbst seinen Dramaturgenposten am Deutschen Theater Berlin räumen musste.
Als er dann zur Apotheose der sozialistischen Klassik überging, geschah das auch, um seinen dramatischen Antipoden Heiner Müller in die Schranken zu weisen. Auch davon handelt einer seiner späteren Sinnsprüche: Alle abscheulichen Stücke / Schrieb Heiner Müller bereits, alle erhabenen ich. Im gleichen Zusammenhang dieser „Beiseite“-Sprüche findet sich auch ein überraschendes Selbstporträt, das den Dichter als eher unfreiwilligen Opponenten des Staates zeigt:
Herzlich schütz ich mein Land, das mich, und von Herzen missbilligt.
Das ist fad. Und doch: fader wärs andersherum.
Nach der kurzen atmosphärischen Verstimmung zwischen Staat und Dichter um 1960 entwickelte sich dann aber – zur nicht geringen Irritation der westdeutschen Kritik, die dem bis Mitte der 70er Jahre auf allen deutschen Bühnen omnipräsenten Dramatiker Hacks ihren Respekt zollte – ein Verhältnis von immer größerer „Herzlichkeit“. Hacks wurde in der DDR zur Instituion – ohne jedoch auf einschlägigen Schriftstellerkongressen als Bauchredner des Parteidogmas aufzutreten. Das überließ er minderen Geistern. Nur einmal, 1976, ließ sich Hacks aus der tagespolitischen Reserve locken, als er zur Biermann-Ausweisung anmerkte, aufgrund der schauderhaften Verse des „Liedermachers“ sei das Vorgehen der DDR-Behörden zu begrüßen. Das hat man ihm im Westen nie verziehen. Seither gefällt sich Hacks in seinem realsozialistischen Trotz und nutzt jede Gelegenheit, mit seiner ganz unironischen Affirmation des Stalinismus die linksliberale Intelligenz aufzuscheuchen.
In seiner Werkausgabe der Gedichte findet man zahlreiche Exempel eines ästhetischen Widerstands gegen die „finale Niedergangsepoche“, die nach dem Sturz Ulbrichts und erst recht nach der Wende seinem „Vaterland“ droht. Auch in seinem Formengebrauch präsentiert sich Hacks dabei als rigider Traditionalist. Den Versuchungen der „modernen Lyrik“ und ihrem Fragmentarismus der Formen hat er schon früh abgeschworen, zuletzt in seinen Belinde-Briefen von 1974. Wer nun den lyrischen Hacks mit dieser Werkausgabe kennenlernen will, dem wird 460 Seiten lang die Ansicht des Dichters demonstriert, dass sich ein gelungenes Gedicht vor allem in der „richtigen Handhabung des Versmaßes“ und der „Tüchtigkeit der Reime“ bewährt.
Nicht selten taucht in diesen durchweg reimgestützten Texten Stalin als idyllisierter Übervater auf, der das letzte Refugium vor dem kapitalistischen Elend bietet. In einem der groteskesten Texte des Bandes, den der Autor mit der ihm eigenen Chuzpe den Liebesgedichten zugeordnet hat, erleben wir dann Stalin in einer anakreontischen Szene gemeinsam mit Venus. Sie vergegenwärtigt die nackte Venus beim Bad, auf ihr ruht das wohlgefällige Auge Stalins. „Während die Göttin dem All in Sommerheiterkeit / Den Hintern und die weltberühmten Brüste“ zeigt, erledigt Stalin seine Schreibarbeit, prüft „Berichte“ und erlässt womöglich mehr oder minder tödliche Befehle. Auch diese Form einer stalinistischen Idyllik mit frivolem Witz hat Hacks bewusst bis zur Unerträglichkeit ausgereizt:
Gelegentlich läßt er das Auge ruhn,
Das väterliche, auf den prallen Lenden
Der Göttin, die, versunken in ihr Tun,
Ein Bein gewinkelt hebt mit beiden Händen.
Ein milder Glanz geht, eine stille Pracht
Unwiderstehlich aus von diesem Paar.
Die Liebe und die Sowjetmacht
Sind nur mitsammen darstellbar.
Selbst in der sozialismusseligen Konkret empfanden einige Leser dieses „Stück stalinistischer Seniorenerotik“ als Zumutung. Und tatsächlich sind diese alten und neuen Reimarbeiten des Peter Hacks nur als linksdandyistische Provokationen eines sozialistischen Eremiten goutierbar.
Michael Braun, der Freitag, 24.3.2000
Diese Rezension bezieht sich auf Peter Hacks: Die Gedichte. Edition Nautilus, 2000
Singe mir, Muse, den Sozialismus
− Abschied mittels Meisterschaft: Peter Hacks betrachtet die DDR als schöne Kunst. −
Als 1991 in Stuttgart eine repräsentative Anthologie deutscher Balladen von Gleim bis Ulla Hahn erschien, die kaum einen Kleinmeister der Gattung ausließ, bekamen es die Deutschen schriftlich aus der Klassiker-Zentrale Reclam, dass Peter Hacks nicht existierte. Keine der einunddreißig Balladen hatten die Herausgeber bemerkt, die nun unter dem Titel „Kunstformen der Geschichte“ eine eigene Abteilung seiner gesammelten Gedichte bilden – so wenig wie die angefügte Liste der Forschungsliteratur damals auf Hacks’ Versuch über die Ballade („Urpoesie, oder: das scheintote Kind“) einging, der sieben Jahre zuvor in Ostberlin erschienen war.
Man muss es für wahrscheinlich halten, dass die Auslassung nicht zufällig, sondern gewollt war. Und Hacks war nicht ohne eigenen Anteil zu einem so fragwürdigen Ansehen gelangt, dass er mancherorts Berührungsängste provozierte. Er hatte aus freien Stücken in der DDR gelebt und viel Unschönes und Verblendetes zu den dortigen Zuständen geäußert. Zugleich war er, auch für seine Gegner erkennbar, ein Virtuose der Form, der für die Vielfalt der Töne der deutschen Sprache einen Sinn hatte wie kein anderer. Sein Fall ist der ewig verdächtige: der des sittlich fragwürdigen, ästhetisch glanzvollen Künstlers. Wie bei Salvador Dali oder Richard Strauss ist es diese Kombination, die den meisten Hass auf sich zu ziehen pflegt. Völlig klar hat er es in einem Epigramm auf sich selbst gesehen:
Meiner Wiege zu Häupten: der Schutzengel, ferner die Muse.
Und sie stritten sich. Leider, die Muse gewann
(„Bestimmung“).
Hacks ist ein dichterischer Traditionalist, der es dem Leser nicht leicht macht. Auch der Wohlwollende muss durch den Figurenreigen der Belinden, Dorinden und Chloes, der Husaren und kühnen Ritter hindurchfinden, bis ihm die Schönheit unter den anachronistischen Gewändern aufgeht. Aber irgendwann kommt er darauf: Die Rettung der Tradition steht im Dienst der Differenziertheit – allein deshalb schon, weil der Formen vom Epigramm über das Lied bis zum Sonett so viele sind.
Hacks’ Politik, nie ganz frei vom Ruch des Zynismus, war nur die natürliche Verlängerung seiner Poetik. Schon seine frühe Beschäftigung mit dem Theater des Biedermeier war in eine Verfallsdiagnose der bürgerlichen Welt gemündet. Die Rettung der Kultur konnte folglich nur von oben besorgt werden: von der Erziehungsdiktatur der Partei und der Geschmacksdiktatur der schaffenden Künstler. Die Moderne war als ästhetisch-politische Verfallsepoche erkannt, künftig sollten Staat und Kunst wieder von den Kompetenten regiert werden. Das ist freilich die Künstler-Utopie des zwanzigsten Jahrhunderts überhaupt, nur hat sie Hacks bis zur Bizarrerie ausdrücklich gemacht.
Auch in den Gedichten sind geistesaristokratisch-kommunistische Legierungen eines seiner liebsten Gedankenspiele. Stalin trifft auf Venus; „Rote Sommer“ entwirft vor dem Hintergrund barbarischer Touristenströme ein abgeschiedenes preußisch-kommunistisches Traumreich:
Dann nehmen sie den Tee aus köstlichen Geschirren,
Plaudernd vom Klassenkampf, während ein Pfau, ein bunter,
Gekrönter Mohrenvogel, mit metallnem Flirren
Durch Heckenwege schreitet und zum See hinunter.
Wenn Oscar Wilde den Armen vorhielt, sie sollten sich doch wenigstens etwas geschmackvoller kleiden, heißt es bei Hacks in dem Epigramm „Sozialismus“:
Einen letzten Fehler hat er: es hängt ihm die Herkunft
Aus dem Arbeiterstand wunderlich immer noch an.
Die Sammlung, die mit Liedern zu Stücken einsetzt, ist nicht vollständig. So fehlt das „Lied der Kampfgruppen“, geschrieben nach dem 13. August 1961, das den Mauerbau feierte. Aber ein inhaltlicher Abstand kann damit nicht gemeint sein, denn auch jetzt heißt es:
Balkone haben Brüstungen. Es tut
An jedem Abgrund eine Mauer gut.
Der Kulturverfall, so die Behauptung nicht weniger Gedichte, ist seit 1989 nur deutlicher geworden. In der Abteilung „Jetztzeit“ ragt „Tamerlan in Berlin“ heraus, die Vision einer usbekischen Besetzung, die mit bösem Witz glossiert ist:
Bei Aufbau sitzt ein leitender Usbeke
Und druckt nun sein usbekisches Gequäke,
Bei Aufbau! dort, wo meine eignen Dramen
Erschienen, ehe die Usbeken kamen.
Amüsant zu lesen sind auch „Couplets“, Zweizeiler, in denen dieser und jener – besonders gern ehemalige Dissidenten – im Vorbeigehn, wie in einer Moritat, ironisch oder blutig erledigt wird. In Reflexionen über Alter und Tod klingen die Couplets aus:
Ich sah noch eine halbe Nacht lang fern,
Jeden Kanal, und starb dann äußerst gern.
Hacks ist ein Lyriker, der auch im Gedicht das Metier des Dramatikers und des Kinderbuchautors nicht verrät. Denn beim Drama wie beim Kinderbuch rächt sich jeder schwache, wirkungslose Moment sofort. Hier darf nichts Vages übrig bleiben: Theaterbesucher und Kinder sind nicht durch Appelle an die Introspektion zufrieden zu stellen. Seine szenische Meisterschaft zeigt Hacks in den Balladen, die historische Momente in höchster Spannung darstellen. Raffiniert werden die möglichen Irrtümer der Künstler angesichts der Macht durchgespielt: Bei David und Saul wie bei den Goebbels-Protegés. Allerdings: Auch hier bleibt manches, etwa eine Szene zwischen Nietzsche, seiner Schwester und Rudolf Steiner, im bloßen Witz stecken.
Zu den Gedichten aber, deren Rang sofort einleuchtet, gehört die Ballade „Der Fluch“. Schon der Titel ruft die eigentümliche Balladenstimmung wach. Der Vorgang ist schnell erzählt: Als Walter Ulbricht 1971 von Honecker entmachtet wurde, zeigte ihn das Fernsehen zu seinem Geburtstag im Schlafrock und in Pantoffeln – ein ohnmächtiger Mann. Das Bild war für DDR-Bürger ein Schock und ein Signal. Auch Hacks, dessen Jugendhoffnungen mit Ulbrichts Republik verbunden waren, hat es so verstanden. Plötzlich glaubte er zu sehen, dass der Niedergang nicht auf die bürgerliche Welt beschränkt war.
Das Gedicht, 1983 verfasst, legt dem greisen Ulbricht, der seiner Machtlosigkeit inne wird, eine grandiose Unheilsdrohung gegen den mediokren Nachfolger in den Mund:
Kein Begriff erhelle deine Welten,
Keine Gutschrift soll, kein Eid soll gelten
Und berichtet sei in ungelesnen
Zeitungen von Dingen, nie gewesnen.
Keine Straße soll dein Land verbinden,
Keine Post soll den Empfänger finden,
Und nichts soll in deinen Telefonen
Als ein Brausen und ein Grausen wohnen.
Rost wird ganze Industrieanlagen,
Weil ein Zahnrad mangelt, niedernagen,
Während ab die Blätter, die entfärbten,
Von den Bäumen gehn, den schmutzverderbten.
Gräßlich hören in den Meiereien
Wird das Volk das Vieh nach Futter schreien
Oder, unterm Dung verborgen, kleine
Ferkel finden, kleine tote Schweine.
Die Steigerung des politischen Zeitgedichts ins Unheimliche, Schöpfungswidrige gelingt in wenigen Zeilen. Und dabei klingt es, als habe der Genius der deutschen Ballade höchstpersönlich dem Dichter die Feder geführt.
Liebesgedichte beschließen den Band. Auch hier die dramatische Situation, in der sich Spieler und Gegenspielerin finden – im Bett. Diskretion und Frechheit halten sich die Waage, Reichtum der Töne und Differenziertheit der Formen herrschen bis in die physischen Stellungen hinein. Eine strenge Ökonomie der Blicke nach innen, die nur selten gestattet werden, ist das Gesetz dieser Gedichte: Ihre Wirkung erzielen sie über die pure Schönheit des Außen, der Kontur. Man muss Peter Hacks nicht in allem glauben, um den Genuss zu empfinden, den sein vollendetes dichterisches Können gewährt. Man entlastet sich von der Innerlichkeit. Man liest ihn, wie man früher Horaz gelesen hat.
Lorenz Jäger, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 20.3.2000
Diese Rezension bezieht sich auf Peter Hacks: Die Gedichte. Edition Nautilus, 2000
Aus neuer Wirklichkeit blühen kühnre Phantasien
− Peter Hacks legt seine gesammelten Gedichte vor. −
Ein irritierender Lebensweg, auf den ersten Blick: 1928 in München geboren; 1955, dem normalen Wirtschaftsflüchtling entgegen, die Übersiedlung nach Berlin: Ost. Für kurze Zeit dann unter Brechts Einfluss; nach Konflikten mit der Kulturpolitik ein scheinbares Ausweichen in einen „unverbindlichen Klassizismus“ – wie zumindest Wolfgang Emmerich in seiner verbreiteten Geschichte der DDR-Literatur behauptet. Trotz Zensur wird Hacks nach der Niederlage der DDR nicht als Widerstands- und Modeautor entdeckt. Aristokratisch postuliert er den vernünftigen, nicht den demokratischen Staat als Voraussetzung positiver Menschheitsentwicklung. Das bringt ihm Sympathien von Teilen der Restlinken ein, wohl auch vereinzelte Zuneigung von rechts, doch nicht den Applaus des Mainstreams, der die Zerstörung von Staat zugunsten einer vagen Bürgergesellschaft betreibt.
Seit einigen Monaten liegen Hacks’ Gedichte in einer erweiterten Sammlung vor. An ihnen den Wechsel der Zeiten abzulesen, ist schwierig. Nur ganz wenige Lieder aus den frühesten Stücken deuten songtextartig auf das einstige Vorbild Brecht hin. Ein paar frühe, agitatorische Gedichte fehlten schon im ungefähr um ein Viertel schmaleren Vorgängerband von 1988 – sie sind unwesentlich, überwiegend an der Vorlage haftende Nachdichtungen, die Hacks zu Recht ausschied. Sein Ton, seine Verfahrensweise sind seit vierzig Jahren ähnlich. Der Aufbau des Bandes ist geblieben: In drei großen Blöcken sind die „Lieder zu Stücken“, „Gesellschaftsverse“ und „Liebesgedichte“ angeordnet. Neues findet sich vor allem im mittleren Teil; die Liebesgedichte sind kaum vermehrt und die Theaterlieder nur durch die Gesangseinlagen aus „Orpheus in der Unterwelt“ ergänzt.
Allein die durchgängige Abwesenheit modischer Spielereien in einer Zeit, die flexible Anpassung ans je Neueste als intellektuelle Qualität glaubt werten zu müssen, verweist auf die außerordentliche Dichterpersönlichkeit Hacks. Bereits bei oberflächlichem Hinsehen wird deutlich, dass er sich an überkommenen Formen orientiert. Die Entwicklung der modernen Lyrik spätestens vom Expressionismus an ignoriert Hacks souverän. Scheinbar harmonisiert er damit die Wirklichkeit auf klassizistische Weise; doch betont er so die Eigengesetzlichkeit der Poesie, der er die Funktion eines produktiven Vorscheins, nicht lediglich einer Verdoppelung des Realen zuweist: „Aus Phantasie wird Wirklichkeit. Aus neuer / Wirklichkeit blühn kühnre Phantasien. / Und wenn die Kunst, um Kunst zu sein, die Erde / Verlassen muß, zur Erde kehrt sie wieder“ – so formuliert Hacks programmatisch in seinem Prolog zur Wiedereröffnung des Deutschen Theaters.
Nicht also ästhetische Kompensation, sondern ästhetische Produktivität; eine immer noch Brechtsche Kategorie, freilich mittels einer Brecht diametral entgegengesetzten Poetologie. Dabei haben Verklärung und Vertröstung keine Chance: Gerade im großen, an sinnlichem Genuss orientierten Block der Liebesgedichte ist das Bewusstsein des Materialisten, dass es nur dieses je eine Diesseits und sonst nichts gibt, dauernd präsent. Im Schlussgedicht 1988 wie 2000 figuriert der „alte Knochenmann“ als „Vater der Genüsse“:
Du sollst mir nichts verweigern.
Wir müssen lieben nun,
Bis einst aus freien Stücken,
Gesättigt mit Entzücken,
Wir unserer Füße Rücken
Still voneinander tun.
Mit dieser Glücksvorstellung eines erfüllten Lebens und freiwilligen Abschieds schließt der Band; und es ist solche freie Verfügung, die Hacks zur Wahl der strengen Formen veranlasst, die ihm ironische Kontrapunkte erlauben: „Dies, o einfallsreicher Daimler, war keine / Gute Idee. Vier Tage lang und Nächte / Hat mein Mädchen die Stadt verlassen“, heißt es in „Anläßlich ihrer Autoreise in die nördlichen Provinzen“. Ein anderes Gedicht stellt „Die Elbe“ in hohem Ton als Acheron vor, mit der Bundesrepublik als Totenreich. Hacks’ Totenfluss allerdings „wälzt sich zwischen / Dömitz und Boizenburg“ und seine „schwarzen Wasser säumt ein Hain von Rüben“: Fast stets entzieht Hacks dem Pathos, das seine geschichtlich tradierten Formen assoziieren lassen, den Boden und macht so deutlich, dass sein Morgen nicht einfach ein wiederbelebtes Gestern ist. „Rote Sommer“ ist ein Gedicht überschrieben, in dem „Preußens dünkelhafte Kommunisten“, während der „große Haufen“ sich aus „Deutschlands nördlich milden Breiten oder Längen / Hinquält zu seinen grauenhaften Urlaubsorten“, ein Bild ausgesuchter Kultur bieten. „In Linnen leichtgewandet, duftenden Batisten“ erholen sie sich in ihren „Sommerresidenzen“:
Dann nehmen sie den Tee aus köstlichen Geschirren,
Plaudernd vom Klassenkampf, während ein Pfau, ein bunter,
Gekrönter Mohrenvogel, mit metallnem Flirren
Durch Heckenwege schreitet und zum See hinunter.
Abwegig, hier eine Verklärung der Vergangenheit zu vermuten – als Propaganda wäre dies Gedicht untauglich, weil ohne Anknüpfungspunkt im historischen Gedächtnis. Gerade aber, indem Hacks formuliert, wie der Sozialismus offenkundig nicht war, wird deutlich, wie der Kommunismus hätte werden können. Dass die Kommunisten vom Klassenkampf plaudern, während die Massen, aus denen die Klasse besteht, sich freiwillig mit Pauschaltourismus begnügen, denunziert weder diese noch jene, sondern verweist aufs Uneingelöste einer kollektiven Befreiung. Der Anachronismus der sich bereits in den Süden wälzenden Masse einerseits, einer offensichtlich herrschenden Schicht von Kommunisten andererseits zeigt zudem, dass es sich um ein Nachwendegedicht handelt; dabei passt auch in diesem Nebeneinander realgeschichtlich wenig; Hacks’ Idyllen sind bei weitem nicht so simpel, wie sie beim flüchtigen Lesen scheinen.
Seit 1988 entstanden zumeist „Gesellschaftsverse“. „Kunstformen der Geschichte“ war schon in der früheren Sammlung einer der gewichtigsten Abschnitte überschrieben: eine Reihe von Balladen, die scheinbar wohl geordnet chronologisch eine Reihe von Ereignissen aus Mythologie und Geschichte wiedergeben. Doch schon die älteren Gedichte vermittelten exemplarisch der Gegenwart Beispiele für das gute oder schlechte Regieren. Manche der neueren Texte reagieren deutlich auf den Untergang der DDR: „Die Gallier in Rom“ etwa sind leicht mit den westlichen Siegern zu parallelisieren, und „Die dreißig Tyrannen“ – Unzufriedene, die von Gnaden Spartas eine Zeit lang Athen beherrschen durften – können als Oppositionelle aus der DDR, die nun Oberwasser haben, dechiffriert werden.
Der Niederlage des Sozialismus und seinen Folgen ist der einzige völlig neue Abschnitt gewidmet: „Jetztzeit“. „Jetztzeit“ heißt auch das Gedicht, das diesen Abschnitt einleitet:
Seit der großen Schreckenswende
Sieht des Dichters ernstes Haupt
Sich durch neue Zeitumstände
Aller Hoffnung jäh beraubt.
Das Leben scheint sein Ziel verloren zu haben:
Liebt den Sommer, haßt den Winter,
Tieferes steckt nicht dahinter.
Hin und wieder ein Gedicht
Schreibt er noch aus Dichterpflicht.
Das Understatement ist Pose; die Gedichte, die folgen, sind alles andere als bloße Pflichtübungen, sondern gehören zu Hacks‘ besten. Die Ablehnung des Neuen schärft noch seine Formulierungen. Gerade die Poetik der Vorwendezeit, die eine kommunistische Zukunft ästhetisch andeuten sollte, nützt paradox nun der Kritik der restaurierten Vergangenheit: sie bewahrt Hacks vor larmoyantem Selbstmitleid wie vor zornigen Tiraden, die nur in ungefähre Wut mündeten. Diese Qualität erweist sich besonders in den zahlreichen Couplets, formal disziplinierten Zweizeilern. In ihnen, wie überhaupt in Hacks’ Lyrik, hat ausschweifende Metaphorik wenig Raum; die Zweizeiler wirken simpel, weil sie präzise sind:
Die Bürgerrechtler machen viel Rumor.
Arbeiterrechtler kommen seltner vor.
Hacks’ klassische Haltung war nie harmonistisch, mochte sie auch im Vergleich etwa zum blutrünstigeren Heiner Müller zeitweise so scheinen. In der Nachwendezeit bleibt Hacks seiner Poetik und seiner Politik treu wie kaum jemand sonst. Spätestens im Rückblick wird die Konsequenz des Gesamtwerks deutlich: Ästhetisch wie politisch bleibt Hacks oppositionell. Seine Lyrik hat wenig Berührungspunkte mit der zeitgenössischen Literatur; nicht zu ihrem Nachteil. Die Lektüre seiner Gedichte ist ein Vergnügen auf höchstem intellektuellen Niveau. Vielleicht sollte sich nicht Hacks nach der Gegenwart richten, sondern die Gegenwart ein wenig mehr nach Hacks.
Kai Köhler, literaturkritik.de, 2.2.2001
Diese Rezension bezieht sich auf Peter Hacks: Die Gedichte. Edition Nautilus, 2000
Weitere Beiträge zu dieser Ausgabe:
Rüdiger Wartusch: Vom Held zum Invalid
die tageszeitung, 21.3.2000
Armin Stolper: Kein Zeitgenosse
Junge Welt, 16./17.9.2000
Robert Gernhard: Kein Beifall für den Mauerfall
Die Zeit, 28.9.2000
Weitere Beiträge zur Werkausgabe:
Christian Eger: Roter Preuße im Goethe-Rock
Mitteldeutsche Zeitung, 20.3.2003
Dietmar Dath: Ein linker Wunderwirker
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 22.3.2003
Horst Haase: Der Klassiker P. H.
Neues Deutschland, 20.–23.3.2003
Stephan Schlak: „Rings nur westkaschubische Gesichter“
Frankfurter Rundschau, 2.8.2003
Stephan Wackwitz: Hacks oder Verkenne dich selbst
Merkur, Heft 652, August 2003
Die Verteidigung der Insel
– Der Artist und sein Asyl. Über Peter Hacks. –
Peter Hacks, der Berliner Schriftsteller, der aus Breslau stammt und in München promovierte, beschenkt sich selbst und die literarische Welt mit einer Gesamtausgabe seiner Werke: ein Band Gedichte, ein Band Erzählungen, sieben Bände Theaterstücke und drei Bände Essays; drei weitere Bände enthalten Geschichten und Gedichte für Kinder. Die fünfzehnbändige Ausgabe, deren Texte als „kanonisch“ angezeigt werden, was immer das bedeutet, erscheint im vor einigen Jahren wiedererstandenen Eulenspiegel-Verlag in doppelter Gestalt: im Festeinband (das klingt besser als Hardcover, aber keineswegs schön) zu vierhundertfünfzig, kartoniert zu dreihundertsechzig Euro, jeweils gebunden und auf dem gleichen, leicht getönten Papier.
Die Ausgabe ist die am schönsten, am lesefreundlichsten gedruckte seit Hacks’ Suhrkamp-Bänden aus den sechziger und frühen siebziger Jahren, und die Broschur-Variante ist überdies erfreulich gewandet, in einen lindgrünen, schlicht bedruckten Karton; dagegen nimmt sich der bräunliche Festeinband, von einem unbestimmbaren Material umkleidet, wie die Warenhausvariante einer Klassikerausgabe von 1890 aus. Wer die Bände in fester Form haben will, sollte damit zum Buchbinder gehen, wie man es vor zweihundert Jahren tat; damals war es allerdings billiger. Jeder Band ist auch einzeln erhältlich, wobei man den fünfzehnten Band auf jeden Fall dazunehmen sollte; er allein enthält im Anhang Datierungen. Diese geben Erstveröffentlichungen und Erstdrucke, bei den Theaterstücken auch die Uraufführungen an und sind, nebst einem Namensregister zu den Essaybänden, die einzige editorische Zugabe zu den innerhalb der einzelnen Genres respektive Themenkomplexe chronologisch geordneten Texten.
Der in Berlin-Mitte, in der Rosa-Luxemburg-Straße, ansässige Eulenspiegel-Verlag hat in den letzten Jahren schon einige Kinderbücher und andere Einzelausgaben des Autors herausgebracht, der seine Beziehungen zu dem Hamburger Nautilus-Verlag gelöst hat. Dort waren, nachdem der Aufbau Verlag sich von seinem langjährigem Autor getrennt hatte, in den neunziger Jahren gesammelte Werke in Einzelbänden erschienen, bis hin zu den Theaterstücken der neunziger Jahre – darunter eine höchst amüsante Rückübereignungskomödie namens Fafner, die Bisam-Maus und drei ingrimmige Historienstücke aus der russischen Geschichte – und zu einer dickleibigen Gedichtsammlung, die auch die politische Lyrik der neunziger Jahre enthielt, Verse, die zuerst in der Hamburger Zeitschrift konkret erschienen waren und manchmal in einer Weise kolportiert wurden, die an die Verbreitung Biermannscher Verse in der DDR erinnerte. Es war – mutatis mutandis – fast wie ein Rollentausch.
Die Texte der Gesamtausgabe reichen bis in das Jahr 2000, also etwa fünf Jahre über die Nautilus-Ausgaben hinaus; auch „Zur Romantik“, der 2001 erschienene Großessay, ist – im fünfzehnten Band – zur Stelle sowie in Band 13 eine verdient-rabiate Abfertigung des amerikanischen Germanisten Wilson, eine Kurzdarstellung aller linken Parteien und Gruppierungen des 20. Jahrhunderts und eine Kritik an dem Geschichtsprognostiker Georg Fülberth, der dem Imperialismus noch fünfhundert Jahre gibt; Hacks mag ihm darin nicht folgen. Numa, das immer noch unaufgeführte Stück aus der ausgebliebenen Sozialistischen Republik Italien, erscheint in Band 4 in einer Neufassung.
II
Was zu der Hacks-Lektüre stimuliert, zu der uns Eulenspiegel auf so ausschweifende und zugleich gesammelte Weise instand setzt, ist die notorische Wohlgelauntheit dieses Dichters. Auch wenn er mit tiefem Unmut auf eine Welt blickt, deren Wandlungen und Komplikationen er den Genehmigungsstempel verweigert – er wird bei aller Mißbilligung niemals zum Miesepeter. Ist er selbst, von Ansicht und Gegenstand her, von deutlicher malcontentment erfüllt, so wirkt die Art und Weise, dies zu bekunden, doch irgendwie aufmunternd, und sei es durch den so induzierten Widerspruch. Auch wenn man sich über ihn ärgert (und das kommt vor, es ist seine Absicht), ist man – nicht immer, aber vielfach – amüsiert. Wenn er etwa in einem der Nach-Wende-Gedichte versucht, bei einer Huldigung an den von ihm aus einer Art Welttrotz hochgehaltenen Jossif Wissarionowitsch in J.R. Bechers lyrische Prunkgewänder zu schlüpfen (wer kennt nicht das berühmte Reh?) und eine Art von Pathos, jedenfalls von Nachdruck an den Tag zu legen, stellt sich heraus: Es ist ihm nicht gegeben. Es gelingt nicht, weil er ja keine Primärempfindung vorweist, den Überschwang des Herzens, sondern eine Haltung, die sich als Attitüde kenntlich macht, als etwas bewußt Entlehntes und stilgerecht Angeeignetes, dabei keineswegs Ironisiertes. Dieser Autor ist, wenn er die Dinge – und das ist seine poetische Natur, in der er sich ungern gestört sieht – auf die Spitze treibt, niemals ironisch, sondern zu einem Ernst entschlossen, der nur eben seine poetische Sache nicht ist; er verfehlt ihn nicht im Sinn des Mißlingens, sondern habitueller Unmöglichkeit.
Soll man diesen ästhetischen Tatbestand auf die abgewandelte Titel-Formel eines Autors bringen, mit dem Hacks mehr als nur der Sinn für die Vorzüge des Sozialismus verbindet (auch als Dramatiker und Märchendichter steht er ihm nahe), und von der „Impossibility of Being Earnest“ sprechen? Wenn er es unternimmt, dem greisen Alfred Neumann, einem Mann, der jahrzehntelang an in jeder Hinsicht hervorragender Stelle an jener ökonomischen Fehlsteuerung beteiligt war, die die DDR, im Verbund mit andern Ruderverstellungen, in den Untergang trieb, lyrisch zu huldigen, und eingangs mit verstechnisch vollendeter Emphase einen Blick auf die wundersamsten Bauwerke der Weltgeschichte, von den Pyramiden bis zu Versailles und vom Kreml bis zum Tower, wirft, um zu dem Schluß zu kommen: Das großartigste von allen sei doch die Mauer gewesen, dann ist das, kein Zweifel, tiefgefühlt, als Ausdruck der Trauer um die verlorene Heimat, das befestigte Asyl. Zugleich ist es von einer Komik, die weder eine unfreiwillige noch eine ironisch intendierte ist, sondern eine stilistisch implizite.
Das Groteske (oder sollte man besser von Exaltation sprechen, einer ohne jede Beimischung von Hitze?) als Äußerungsform der Trauer – es gibt auch Prosabeispiele dafür, so das herzzerreißende Märchen von der Gräfin Pappel, der mit magischen Fertigkeiten und unbegrenzten Ansprüchen ausgestatteten Repräsentantin des – pauschal gesagt – Westens, die Anspruch auf den Erzähler erhebt, der ihr immer wieder entrinnt, erst auf eine von dem Riesenkönig aus dem Meer gestampfte Insel, dann auf eine Intellektuellenoase in der Wüste Mondo, ohne daß jene von ihm abgelassen hätte. Noch im Teltow, wohin er sich, als in einen dritten hortus conclusus, schließlich vergräbt, holt sie ihn ein und zuletzt im Eismeer; dort sind es schmatzend-gräßliche Riesensalamander, die den auf einer Planke Treibenden vor dem Zugriff der liebenden Verfolgerin bewahren. Der allegorisch gespitzte Text von 1992 ist das Dokument einer Verzweiflung, deren Ausdrucksform der Witz, die Satire, die metaphorische Pointe ist; im Märchen, das die Gestalten wie mit SchmetterlingsflügeIn in die Lüfte hebt, lösen sich alle Widersprüche, indem sie sich auf den einzelnen beziehen.
Wenn das nicht romantisch ist, auf eine ganz eigene, durchaus luzide, keineswegs luziferische (da entschieden undämonische) Weise! Man sieht Philibert, den Erzähler, am Anfang der Geschichte auf der Flucht vor der furchtbaren Gräfin von einem schnellsegelnden Schiff ins Meer fallen, von jener Insel aufgefangen, die der Riesenkönig gerade mit seinesgleichen aus dem Meer stampft, und man irrt nicht, wenn man die Deutsche Demokratische Republik hinter ihr vermutet und den großen Gelehrten WU – Walter Ulbricht also – hinter dem gewaltig stampfenden Oberriesen. Schreckliche Vorstellung für den immer wieder nur provisorisch Geretteten, zuletzt doch noch in die Hände der Nachstellerin zu fallen – dann lieber die schmatzenden Salamander und die Planke im Nordmeer! Innerlichkeit ist diesem aristokratischen Temperament immer als konterrevolutionär erschienen, unverträglich mit dem Anspruch der Form, der Entäußerung in Form. Sie ist die Sache des Artisten, der sein Inneres nach außen kehrt, wo es als das Phantastisch-Objektive erscheint.
III
Hacks’ Schreiben ist ein unter sich wandelnden Verhältnissen, mit ebenso leichtfüßigem wie beharrlichem Trotz, erneuertes Angebot, anderes zu denken als das, was gerade im Schwange ist; das Weltauslegen dieses Autors ist Gegenwehr noch – und gerade – dort, wo es sich affirmativ gebärdet. Er insistierte auf Marx und Brecht und der DDR, als ein Westdeutschland, das reaktionär verstockt war in einer Weise, die sich spätere Generationen kaum noch vorstellen können, alle diese in den Orkus des kalten Krieges warf. In Jahren, da Enzensberger, der Autor, der ihm in seiner Generation nach Talent, Intellektualität und stilistischer Haltung am nächsten steht, so nahe, daß beide sich früh (Uwe Johnsons Weggang aus der DDR gab den Anlaß dazu) als Antipoden artikulierten, aus der BRD erst nach Norwegen, dann nach Italien emigrierte, zog Hacks in eine näher gelegene Gegend, den neuen deutschen Osten, ein Ortswechsel, zu dem Brecht, mit dem er in Verbindung getreten war, ihn keineswegs ermutigt hatte.
Als er dort angekommen war (oder vermeinte, angekommen zu sein), sprang er dem regierenden Staatssozialismus mit Theaterstücken bei, die dessen Widersprüche zu beheben suchten, indem sie sie auf den Punkt brachten. Die Strafe folgte auf dem Fuß und traf den Autor, der, freischaffend und Nicht-Parteimitglied, nur begrenzt belangbar war, weniger unmittelbar als die, welche sich für ihn stark gemacht hatten, wie der Intendant des Deutschen Theaters. Wolfgang Langhoff hatte damals jene Kräfte an sich gezogen, denen das nach Brechts Tod sich dogmatisch verengende Berliner Ensemble keinen Raum mehr bot: den Regisseur Besson, die Schauspielerinnen Käthe Reichel und Elsa Grube-Deister, Fred Düren und eben Peter Hacks, der dort allerdings nie so recht Fuß gefaßt hatte. Die Premiere seiner Bearbeitung der Aristophanes-Komödie Der Frieden war 1960 der Durchbruch einer neuen Generation, eines neuen Lebensgefühls; sie eröffnete am Deutschen Theater eine Ära, die diese Bühne zur führenden Berlins, wahrscheinlich ganz Deutschlands machte. Noch heute gibt der Schallplattenquerschnitt der Aufführung Auskunft über einen ästhetischen Zugriff, der lebenslustig in einem gleichsam weltanschaulichen Sinn war: rationalistisch, hedonistisch, sensualistisch. Was ihn beschwingte, war der überstandene Faschismus (die hier antraten, waren in jungen Jahren alle in seine Mühlen geraten) und das Gefühl, sich in den siegreichen Sozialismus wie in eine Montgolfiere einschiffen zu können.
Fand man den szenisch-poetischen Rhythmus dieser französisch inspirierten Luftschiffer eines neuen Deutschlands kurzatmig und sprunghaft, so bedeutete das jedenfalls das Gegenteil von langatmig und fußgängerisch; zwischen zwei Punkten suchten sie mit Verve und Hybris immer eine noch kürzere Verbindung als die Gerade. Was sie vollzogen, war eine Uminterpretation dessen, was bis dahin in einem kulturellen Sinn als „links“, als sozialistisch gegolten hatte, die althergebrachte Mischung aus Biedersinn und Gewaltanwendung, aus steifem Nacken und erhobener Faust. Diese Dreißigjährigen operierten aus dem Bewußtsein, daß ihnen die Zukunft gehöre, weil alle Irrtümer bereits durchexerziert seien; Hacks fand für die historische Lage, in die er sich begeben hatte, später die Formel „postrevolutionär“. Das ähnelte dem erst später aufkommenden „postmodern“ und klang jedenfalls besser als „real existierender Sozialismus“. Die frühen Sechziger waren, bei allen Anfechtungen, seine große Zeit; in der neuen Ausgabe bilden die Stücke dieser Periode den zweiten Theaterband. Ein weiteres Mal fiel der große Holzhammer nieder, als Walter Ulbrichts postmurale neue Wirtschafts- und Kulturpolitik nach Chruschtschows Sturz zum Opfer der von Honecker vertretenen Breshnewschtschina wurde und sich der Riesenkönig gegenüber dieser Operation damit behalf, daß er sich an deren Spitze setzte – ein Vorgang (er hat sich der Nachwelt vollständig erst in den neunziger Jahren enthüllt), wie aus einer Hacksschen Komödie genommen, dabei von einer Realdrastik, bei der in jenen alten Ländern, aus denen 1949 die Deutsche Demokratische Republik hervorging, noch heute niemandem komisch zumute werden will. In Die Gräfin Pappel ist Hacks dem Vorgang nahegetreten, dort, wo er seinen Philibert die rettende Stampfinsel zum Wohnort nehmen läßt. „Die Riesen“, erzählt dieser einem aufmerksamen Zuhörer, „zertrampelten viel mit ihren großen Füßen. Aber ihre Herzen waren von unbeschreiblicher Sanftmut. … Sie stellten sich auf eine Düne und sprachen zueinander: ,Hier war vorher gar nichts. Diese Düne haben wir gemacht.‘ Und dann stießen sie sich mit den Ellbogen in die Flanken und zertrampelten die Düne und freuten sich, und da sie nun einmal Riesen waren, freuten sie sich riesig.“
„Philibert“, heißt es weiter, „beobachtete das Treiben dieser Tölpel mit unaussprechlichem Vergnügen. Und jedesmal, wenn er an sein Land Ur zurückdachte, fühlte er das Glück des Entronnenseins und genoß sein Leben und fand nichts an ihm auszusetzen.“ Es ist das retrospektive Bild des triumphierenden Dulders – eines, der die Eingriffe der Macht in sein Wirken wie ein Naturereignis hinzunehmen sich entschlossen hatte. Das war Ende der sechziger Jahre noch anders gewesen. In Prexaspes, seiner die Mechanismen der Macht illusionslos vorführenden „Beamtentragödie“, hatte Hacks mit den Parteiideologen, die Ende 1965 den siegreichen Aufstand der Mediokrität gegen die Kreativität vollzogen hatten, ebenso rückhaltlos (es war nicht ohne Ohrabschneiden und Kopfabhacken abgegangen) wie intrikat abgerechnet, indem er das Konfliktfeld in das ferne Reich des Perserkönigs Kambyses verlegt hatte, wo der Orden der Magier, eine abergläubisch-verblendete Rotte, des Großkönigs Irrtümer und Fehlplanungen dazu ausnutzt, die Macht im Staat an sich zu reißen. „Solange du ihnen nicht gründlich das Handwerk legst“, war der Oberherr vor ihnen gewarnt worden, „wirst du aus Persien keinen Staat machen, den du vorzeigen kannst.“
Die Machterschleichung wird verhindert durch das Bündnis des Darios, eines von Kambyses begünstigten Offiziers (er ist die Identifikationsfigur des Autors), mit dem Geldhändler Otanes, der, als die Dinge sich zuspitzen, einen blutigen Volksaufstand gegen die Magier entfesselt. Darios, im Besitz der Macht und mit Kambyses’ Schwester und Gattin Atossa vermählt, gebietet dem Abschlachten der Magier Einhalt und verweist Otanes, den Anwalt der Freiheit und des Mittelstands, des Landes: Der neue König braucht den in die Schranken gewiesenen Orden, damit ihm die Produzenten nicht über den Kopf wachsen. „Der alte Wahnsinnsstaat wohl feiert Wiederkunft?“ fragt vor seinem Abgang der bestürzte Handelsmann in gereimten Alexandrinern, dem Versfuß des barocken Staatsdramas, und bekommt von Darios zu hören:
Auch der Vernunftstaat, Freund, bedarf der Staatsvernunft.
Dieser Vernunftstaat hat Sinn und Funktion in der Erhaltung der kunstreichen Bewässerungsanlagen, auf denen die Landwirtschaft des Reiches beruht. Darius hatte den Kambyses gewonnen, indem er ihm ebendies als Gund seiner Dienstbereitschaft auseinandersetzte, und auch seine Schlußansprache unterwirft das Königtum dem Nützlichkeitskriterium:
Solang die Frag, was nützt der König jedermann?,
In jedermanns Verstand noch Antwort finden kann,
Solang wird uns kein Schlag von keiner Seite fällen.
Lange vor andern hatte Hacks hier auf die Affinität des Monopolsozialismus zu der asiatischen Produktionsweise gedeutet, ohne auch in der Folge zu der Erkenntnis durchzudringen, daß es mit der Nützlichkeit der hydraulischen Gesellschaftsorganisation für die Gegenwart nicht eben weit her sei. Er hätte sonst fürchten müssen, daß seine Grundentscheidung, das Hinter-sich-Lassen eines nicht nur als verderblich, sondern als überholt diagnostizierten Kapitalismus, wankend geworden wäre. Von da an, und nachmals immer mehr, ist das Werk dieses Autors defensiv geworden, aber in stilistisch konsistenter, anhaltend offensiver Weise. Er bot mit der Zeit den paradoxen Anblick eines in Preußen verbliebenen Heinrich Heine, der sich für Friedrich Wilhelm IV. in die Bresche warf.
IV
Spielte Honecker die Rolle dieses ruinösen Königs in der Geschichte der kleinpreußischen DDR? Mit dem Ulbricht-Nachfolger (als Hofzwerg Otto beschreibt ihn das Philibert – Märchen, als Honigbäcker fungiert er in „Magister Knauerhase“, einem politischen Märchen von 1982) kam jene Mischung aus kulturpolitischer Lockerung, deutsch-deutscher Koexistenz, konsumtiver Verschuldung und ökonomischer Dogmatik in Geltung, die, aus einer wesentlich veränderten Gesamtsituation erwachsend, von seiten einer analyseunfähigen Staatslenkung bald nur noch geheimpolizeilich zu beherrschen, das heißt weiter zu verwirren war.
Hacks, inzwischen wie als Nachfolger Brechts zum in beiden deutschen Theaterländern meistgespielten lebenden Dramatiker avanciert, betrachtete alles dies mit gefühltem Mißfallen, man kann es in Gedichten der achtziger Jahre nachlesen; sie heißen „Der sieche Fisch“, „Die lächerlichen Unpreziösen“ oder „Der Nachfolger“. Die Hand, die ihn, nicht anders als Müller, Wolf, Braun, Biermann und viele andere, zusammengestaucht hatte, die breshnewistisch gesteuerte Parteihand der Ulbricht-Ära, erschien dem von der Gräfin Pappel Verfolgten nun als eine staatsmännisch-heilsame, beginnender Auflösung wehrend; der Oppositionsposten, den er dergestalt bezog, war von einer Splendid isolation, die vielleicht ein poetischer, mit Sicherheit kein politischer Ort war. Seine Wirklichkeitsferne machte sich nach der Biermann-Ausbürgerung des November 1976 in einer Weise öffentlich, die, wenn nicht das Schicksal, so doch die Wirkung dieses Autors mit zwei Leuten verknüpfte, die ihm inkongruent waren, einem Volkssänger, der sich von einer falschen Lageanalyse hatte irreführen lassen, und einem Politbürokraten, der mit einer Machtgebärde der eigenen Hilflosigkeit zu entkommen suchte. Der staatsbewußte Artist schmiedete sich an einen Felsen, von dem in einer a- und antiliterarischen Welt, die sich darin gefällt, den Dichter daran zu messen, ob und wie weit er zum Politiker taugt, nicht leicht wieder loszukommen war. So wählte er ihn, nicht ohne eine gewisse Polsterung, gleichsam zum Wohnsitz.
Die ganze Geschichte fiel in das Fach der prekären Huldigungen, das in der deutschen Literaturgeschichte vielfältig besetzt ist. Grillparzer nimmt eine hervorgehobene Stelle darin ein, der im Jahre 1833 der Genesung des Kronprinzen Ferdinand ein tiefempfundenes Gedicht widmete, das in immer neuen Wendungen auf der Güte als vorherrschender Eigenschaft des nicht als geistesstark bekannten Thronfolgers insistierte. Es wurde vom Publikum, dem es in Abschriften zugänglich wurde, ebenso wie vom Hof, dem es der Zensor übergeben hatte, als humoristisch mißdeutet, was dem Autor, der den Fehler begangen hatte, einer Staatsperson poetisch-individuell nahezutreten, anhaltend zu schaffen machte. Auch Goethe findet sich ein, der 1814 mit seinem von dem Berliner Intendanten Brühl aus aktuellem politischem Anlaß erbetenen „Epimenides“-Festspiel zu der neuen, von Napoleons Sturz bestimmten politischen Situation aufschließen wollte und erleben mußte, daß die darin von ihm vorgetragene Selbstkritik von dem preußischen König auf sich selbst bezogen wurde; „Eh, wie meenen Sie dees?“ fragte auch der Berliner Volksmund. Schließlich Hanns Eisler, der der rabiaten Klassenkampf-Politik der SED 1952 mit einem Operntext beisprang, in dem Faust vom Teufel geholt wird, weil er, statt dem Radikalismus der Bauernrevolution zu akklamieren, von Münzer zu Luther retiriert war. Der Komponist wurde für dieses literarische Akkompagnement einer liquidatorischen Politik von deren Verfechtern in Grund und Boden diskutiert, bis der Klassenkampf abgeblasen, genauer gesagt: auf die Arbeiterklasse konzentriert wurde und ein Aufstand ausbrach, der diesen Opern-Faust anders ad absurdum führte.
Glücklicherweise haben die jeweils ergehenden Beiträge die Œuvres dieser Meister immer nur partiell und vorübergehend verstellt. Grillparzer beschrieb die Kronprinzen-Geschichte in seiner eminenten Selbstbiographie und machte sie dadurch für sich und das Publikum unschädlich, Goethes Blick auf Napoleon präzisierte und verdichtete sich – zuerst im Divan, später im Schlußakt des Faust – jenseits von Festspielprojekten, und Eisler hörte auf, den Anschein zu erwecken, als wolle er eine Oper komponieren; er schrieb statt dessen den „Linken Marsch“ und die „Ernsten Gesänge“. Hacks hatte es schwerer als alle diese, der Gefangenschaft durch die prekäre Huldigung zu entgehen, und das hing mit der eigentümlichen Verbindung zusammen, die sein Werk inkorporiert, der des Artifiziellen mit dem Ideologischen dergestalt, daß das erstere dem letzteren nicht etwa dient, sondern sich dieses als eine Art Trampolin unterschiebt. Es ist ein federndes, aber kein dialektisches Verhältnis.
Der Autor beschrieb seine Lage später im Projektionsbild des Kollegen Ascher, eines Berliner Publizisten aus der Zeit Kleists und Hegels, der in der gespannten Situation des Jahres 1811 (und später noch einmal) gegen die nationaloppositionellen Romantiker die Partei Hardenbergs, des Staatskanzlers, genommen und es dadurch mit allen, auch dem Verteidigten, verdorben hatte. Hacks sah sich in diesem Bilde; als habe er die Obrigkeit, und nicht sein Publikum, enttäuscht, befand er selbstkritisch, daß in einer absoluten Monarchie die Äußerungen persönlicher, also unverordneter politischer Zustimmung fehl am Platze seien. „Der Staat“, schrieb er im Blick auf den als Alter ego eingeführten Ascher, „will die Werke des Augenblicks verfolgen und dabei nicht mit unveranlaßter Zustimmung behelligt sein. Wenn der Staat Lob braucht, lobt er sich selber.“ („Ascher gegen Jahn“, Band 14, S. 340) Kurz, er warf sich vor, in einer autokratisch strukturierten Ordnung, deren Ziele und Mittel er für vernünftig hielt, sich gleichsam demokratisch verhalten zu haben, als einer, der sich befugt geglaubt hatte, ihr polemisch (vgl. Band 13, S. 273–277) beispringen zu sollen.
In der Tat, hier lag ein Mißverständnis vor, und es war symptomatisch. Hacks hatte sich reflexhaft so verhalten, als befinde er sich in einem Land, in dem Politik sich als Resultante aus dem Stimmengewirr der öffentlichen Meinung bildet, und war dabei in eine Exaltation gefallen, für deren Äußerungsweise Marx als ein Lehrer eigener und nicht fruchtbarer Art gelten konnte. Solche Mißverständnisse haben ihn niemals losgelassen; dieser Autor, der die DDR erst als völlig Erwachsener kennengelernt und nur als Schriftsteller Fühlung mit der Wirklichkeit dieses Landes aufgenommen hatte, besaß ein zwangsläufig abstraktes Verhältnis zu dessen Gegebenheiten, er war ihrer nicht wirklich inne. Der Konflikt mit Biermann war insofern symptomatisch, als beide in kontrastierenden Spielarten die voluntaristisch ausschlagenden Illusionen des idealistischen Westimmigranten verkörperten und unter je eigenen Opfern auslebten, austrugen. „Hacks und Biermann“, entziffere ich eine vergilbende Notiz auf einer Leerseite der bei Nautilus erschienenen „Erzählungen“, – „Hacks und Biermann, die siamesischen Zwillinge der DDR-Literatur, zwei Einwanderer, die nach verschiedenen Seiten strampelten, die beiden großen Besserwessis.“ Also doch eine Art Kongruenz? „Woran erkennt man den Dichter?“ finde ich darübergeschrieben. „Daran, daß man Vergnügen an seinen Schilderungen hat, ohne seiner Meinung zu sein.“
V
„So bin ich durch und durch Opposition“ das Wort findet sich bei Byron, es trifft auch auf Hacks zu. Der wie instinktive, darum künstlerisch anhaltend produktive Drang zur Gegenposition um jeden Preis, nur nicht den artifiziellen, führte ihn in ein An-und-für-sich-Sein, dem er im Philibert-Märchen einen epischen Ausdruck gegeben hat („So sehr er die Menschen mied“, heißt es dort von dem Helden, „suchte er die Rüben“] und an anderer Stelle einen dramatischen: den der Genoveva-Höhle, aus der die Verbannte, als sich die Lage gewendet hat, zwar hervorkommt, aber incognito bleibt. Hacks’ Genovefa hat die tödliche Intrige auf sich gezogen, weil sie den Herzog, ihren Mann, dazu bewog, gegen aufsässige Partikulargewalten die Partei der Zentralgewalt zu nehmen, und am Ende des Stückes kommt es zu keiner Heimholung aus der Waldeinsamkeit, in der ein erweichbarer Mordbube sie ausgesetzt hat. Die Schuldlose beschließt ihr Leben in der Höhle, ihr Sohn aber, der so sehr ihr Ebenbild ist, daß die Genovefa-Darstellerin selbst ihn spielt, tritt, erwachsen geworden, wie selbstverständlich das Herrschaftserbe seines Vaters an. Die Verbannte wird zu dieser Zeit längst als eine Heilige verehrt; sie siegte, indem sie, verborgen bleibend, den Dingen ihren Lauf ließ. Genovefa (1993) ist das persönlichste aller Hacks-Stücke; gewiß kein Rührstück, ist es ein rührendes schon; es ist dies, indem es eine phantastisch verfahrene Situation futuristisch aufzulösen sucht.
Es ist bei diesem Autor nicht anders als bei andern Bühnendichtern, die den Namen verdienen, Brecht eingeschlossen: Ihre Stücke handeln, außer von der Welt, wie sie ihnen erscheint, von ihnen selbst, den Schwierigkeiten des Daseins. Die Dichter, wenn sie es denn sind, können gar nicht anders, als von sich reden, wenn sie bühnen-, stil- und kunstgerecht von der Welt sprechen, und wenn ihr Selbstempfinden mit dem des Publikums resoniert, bildet sich, was wir Wirkung nennen.
Es war, von eintretenden Unglücksfällen abgesehen, das Problem der späteren Hacksstücke, daß die Leute, das Publikum inzwischen andere Probleme hatten als der Autor oder, wenn sie die gleichen hatten, deren Lösung nicht mehr in der Präpotenz rationaler Superiorität erkennen mochten, von deren Fiktionen und Surrogaten sie sich alltäglich umstellt sahen. Hinzu kam, nicht zuletzt durch die Wirkung und Nachwirkung jenes plebejisch-subversiven Theaters, das Brecht zu Kunsthöhe gebracht hatte (Müller führte es weiter, Castorf zu Ende), der Verfall jenes bürgerlichen Theaters, dessen Tugenden und Fertigkeiten Hacks, der zu Shaw (und zu Moliere) ein zunehmend näheres Verhältnis als zu Brecht unterhielt, in den Sozialismus und durch diesen hatte retten wollen.
Die feingeschliffene, uhrwerksgleich austarierte Konversationskomödie war Hacks’ Teil auch dann, wenn er sich, mit Bevorzugung weit entlegener Bereiche, der Weltgeschichte dramatisch bemächtigte; Alt-Persien, Alt-Assyrien und Alt-Rom, aber auch das Reich der Merowinger, der Zaren, des Kaisers von China und mehr als einmal das Mittelalter dienen ihm von Fall zu Fall zur Folie seiner Welt- und Selbstauslegung. Auch in Westdeutschland, das, von anderem Ausgangspunkt her, den Prozeß der Verkleinbürgerlichung mit der DDR teilte (das machte den Konvergenzcharakter der deutschen Vereinigung aus), hatte dieser Stücktypus in den siebziger Jahren seine soziale und ästhetische Basis verloren; er überdauerte dort in der Trivialform des Boulevards, während das Subventions- qua Kunsttheater aus Verlust der gesellschaftlichen Perspektive einem Naturalismus verfiel, der bei dem späten Einar Schleef immerhin dazu kam, machtvolle Klagerufe über diese Einbuße anzustimmen. Auch auf dem Theater trat etwas ein, was der Wiener Soziologe Georg Franck jüngst im Merkur in die These gefaßt hat, „der kulturelle Überbau spiegele die ökonomische Basis nicht nur wider, sondern habe sie assimiliert“. Der Prozeß führte im subventionierten Theater oft genug zu Gesten einer Schein-Originalität, hinter denen kaum mehr als die Hoffnung auf das Zahlungsäquivalent der Medienaufmerksamkeit stand.
So in westlicher Sphäre; in DDR-eigener trat Hacks, dem Bühnenautor, eine in der jungen Generation um sich greifende und von der Sprachlosigkeit des Staates geschürte Depolitisierung in den Weg, die eine Form des Sich-Entziehens war. Beides, Verkleinbürgerlichung wie Depolitisierung, hing auch mit dem Verlust kulturell wie politisch zentrierender Mitten zusammen; die DDR hatte nur scheinbar eine. So blieb Hacks ein Moliere, der seinen Louis XIV. nicht finden konnte, obschon er sich Mühe gab, Walter Ulbricht postum dazu zu ernennen; immerhin war er auf Langhoff und Besson gestoßen. Die Sehnsucht des Dichters nach dem König, mit dem er gehen konnte, mußte unerfüllt bleiben:
Dies ist die Zeit der Könige nicht mehr.
Nichts ist ihm schwerer geworden zu begreifen als dies.
VI
Dies alles, Vers wie Prosa, Drama, Märchen und Essay, ist, mit Eulenspiegels Hilfe, nun auf einen Schlag in fünfzehn schöngedruckten Bänden zuhanden, eine Leseeinladung, dazu bestimmt, eine zum Übersehen geneigte Mitwelt in Verlegenheit zu setzen, insofern sie erkennen muß, ein wie erhebliches und wie einheitliches Œuvre hier vorliegt, in allen Phasen, allen Genres verknüpft durch eine früh feststehende Stilbestimmtheit, einen Formsinn, auch: eine Unterhaltsamkeit, die den Geschmack an Pointen und Volten, an Inventionen und Provokationen nie verliert. Sein literarischer Rang muß jene verwirren, die glauben, sich durch die Entrückung, die dem Autor zufiel und in der er sich zu gefallen lernte, der Befassung mit seinem Werk überhoben zu finden.
Er macht es ihnen manchmal leicht durch eine Haltung, die die insulare Position durch wohlberechnete Ausfälle immer wieder neu glaubt sicherstellen zu müssen, und bringt sich mit Fleiß in den Geruch, etwas zu sein, was er doch nur spielen kann: ein „Stalinist“. Es ist das Distinktionsmittel des Individualisten, der, um sich zu unterscheiden, den phantastischen Posten eines rigorosen Kollektivismus bezieht, also das, was ihm realiter am allerfernsten liegt. Doch auch die Asienleidenschaft, die in der Hoch-Zeit des Absolutismus die deutsche Kultur ergriff und so schöne Dinge wie Meißens Porzellane und Dresdens Japanisches Palais hervorbrachte, kam ja nicht aus dem Bedürfnis wirklicher Aneignung; die Verliebtheit in ein Fernliegendes, das zugleich ein Formvollendetes war, bildete ein Gegengewicht zu der unter der absoluten Fürstenherrschaft gedeihenden Verbürgerlichung des gesellschaftlichen Ganzen. Hacks hat es schwerer als Dinglinger und Kändler; wenn dieser Autor, statt in Vers und Reim, in Prosa, gar in publiker Briefprosa auf die Welt blickt, gebärdet er sich manchmal geradezu, als ob er Anspruch auf Amt und Titel eines Staatsdichters im Reiche Kim Jong-Ils erhöbe, dessen Vater sich mit Luise Rinser über das Dschutsche-Prinzip zu unterhalten pflegte. Es ist dann beruhigend, seinen Schreibtisch, statt in Pjöngjang, zwischen Panke und Zülow-Kanal aufgestellt zu wissen. Das seiner Produktion innewohnende Problem liegt in der fundamentalen Zugehörigkeit seiner literarischen Existenz zu einer Welt, nach deren Aufhebung er mit aller Anstrengung strebt: der bürgerlichen. Es ist das Problem der Selbstaufhebung unter der Voraussetzung unbedingter Beharrung, das jenes Parallelogramm der Kräfte, der Antriebe aufspannt, aus dem das Werk in seiner vibrierenden Äquilibristik hervorgeht.
In der Gegenwart immer weniger bewandert, geschweige denn zu Hause, spielt dieser Autor mit Lust und Verve noch einmal die Kämpfe der Goethe-Zeit durch, mit der Tendenz, sie aufs Politische und Geheimpolitische zu verschmälern. So in „Zur Romantik“, dem Hundert-Seiten-Essay, der uns über Kleists Führungsoffizier wie über Wielands Frühanzeige von Napoleons Staatsstreich unterrichtet. Akribisch im Historischen, wird der Exkurs fiktional, wo Bitterkeit über den verlorenen hortus conclusus den Autor dazu verführt, das Verhältnis von Basis und Überbau auf den Kopf zu stellen und die in der sozialistischen Ära wiederentdeckte Romantik für einen Ver- und Zerfall haftbar zu machen, der seine Quelle in der Übertreibung des Staates, und nicht in den Elixieren des Teufels, hatte. Da ist es schon amüsanter, Schlegel über seinem Drama Alarcos anzutreffen oder Goethe mit dem Freiherrn von Stein Kutsche fahren zu sehen. Im übrigen ist nicht zu übersehen, daß die zentrale Frage der Hacksschen Welt- und Literaturbeschreibung, das Problem der Staatsautorität als einer handlungsfähigen Instanz über der Eigensucht der Stände und wider die Ansprüche auswärtiger Imperialismen gerade wieder an die Tür der Geschichte klopft. Wenn sie sich öffnet, wird es nicht der Blanquist (Band 13, S. 551) und nicht der Nostalgiker sein, die mit Lösungen dahinter stehen.
Dieser Autor, der immer mit offenem Visier gekämpft hat, ist zugleich ein Meister des Maskenspiels. Die Pointe, aufs äußerste getrieben, verwandelt sich in die Finte, die Falle, und wer in sie tappt, statt sie auszukosten, ist, wie bei Nietzsche, dessen Prosa einen ähnlich imperativischen Glanz verbreitet, als Leser verloren. Von der detektivisch gerüsteten Aversion, die er der deutschen Romantik, und der ebenso leidenschaftlichen Sympathie, die er Goethe, der immer wieder angerufenen Vatergestalt, entgegenbringt, sollte man sich nicht täuschen lassen: Hacks, der enragierte Schattenspieler, ist der deutschen Romantik viel intensiver verknüpft, als er von sich wissen will. Auch durch den verfügend-apodiktischen Gestus dieses Schreibens muß sich der Leser nicht irremachen lassen; er ist die Form dieses Autors, Kontakt aufzunehmen, ein geselliger Modus noch dort, wo er sich in die Nische verbannt. Gerade, indem sie die Kunst der Übertreibung pflegt, erweist diese Schreibkunst ein wesentlich demokratisches Gepräge, dem Widerspruch offen, dem sie selbst entspringt – ausgepicht und überraschungssüchtig, finessenfreudig und selbstverliebt, zugleich narzißtisch und verführerisch und, falls man die Portionen nicht übertreibt (auch Omelettes surprise verzehrt man nicht in Massen), niemals – fast niemals – langweilig.
Friedrich Dieckmann, Sinn und Form, Heft 3, Mai/Juni 2003
BLANKER NEID AUF ROTE SOMMER
Eine Klage für Peter Hacks nach Motiven von Peter Hacks
Derweil im großen Haufen wir auf überfüllten,
Erhitzten Straßen schrittweis in den Süden fahren,
Erblüht in meinem Kopf, dem reichlich zugemüllten,
Ein jähes Bild vom Schönen, Guten, Wahren –:
Erstehn vor meinem Auge Preußens Kommunisten
Auf raschem Weg in ihre Sommerresidenzen,
In Linnen leichtgewandet, duftenden Batisten,
Und auf dem Rücksitz Phlox, die Freundin zu bekränzen.
So bremsen sie vor den Parterren mit Verbenen,
Und lichte Frauen treten aus Remiseschatten,
Und reichen hellen Wein, den sie gleich Pfauentränen
Der Traube schierer Schönheit abgewonnen hatten.
Dann schlendert man den Heckenweg zum See hinunter,
Vom Klassenkampfe plaudernd und von bessren Tagen –
Ich aber, noch im Stau, ein Spielball bunter
Erlesner Hacksscher Bilder, hebe an zu klagen:
Weh, daß ich Westler bin, ein Opfer der Geschichte,
Dazu verdammt, mit der Toscana anzubandeln,
Gegrillt von Hitze und gepfählt vom Lichte,
Statt deutscher Bäume tiefe Schatten zu durchwandeln!
Die aber sind Besitz betuchter Sozialisten.
Daß Hacks dazugehört, ist freilich zu begrüßen:
Dem dünkelhaftesten von Preußens Kommunisten
Solln rote Sommer noch so manches Jahr versüßen.
Robert Gernhardt
Zum 60. Geburtstag des Autors:
Gerhard Piens: Seine Liebe gilt den Freundlichen, den Verbreitern von Vernunft
Neues Deutschland, 19./20.3.1988
Walter Hinck: Mit Pomp
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 21.3.1988
Zum 65. Geburtstag des Autors:
Heidi Urbahn de Jauregui: Der verbotene Dichter
konkret, 1993, Heft 3
Werner Schulze-Reimpell: Der aus dem Westen kam
Stuttgarter Zeitung, 19.3.1993
Werner Liersch: Der Medienpoet wird gemacht, der Poet geboren
Berliner Zeitung, 20.3.1993
Reinhard Tschapke: Bequem zwischen allen Stühlen
Die Welt, 20.3.1993
Peter Mohr: Klassikadept mit revolutionärem Odem
Schwäbische Zeitung, 30.3.1993
Zum 70. Geburtstag des Autors:
Mark Siemons: Heilung vom Mißverständnis, verstanden zu sein
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 21.3.1998
Zum 75. Geburtstag des Autors:
Kerstin Decker: Klassiker live
Der Tagesspiegel, 21.3.2003
Matthias Oehme: Ein Dichter kühn
Neues Deutschland, 21.3.2003
Klaus Peymann: Gewehre auf den Haufen
Berliner Zeitung, 21.3.2003
Zum 80. Geburtstag des Autors:
Detlef Friedrich: Vom Holperstein
Berliner Zeitung, 17.3.2008
Christel Berger: Der Weltverbesserer
Neues Deutschland, 20.3.2008
Reinhard Wengierek: „Ach Volk, du obermieses, auf dich ist kein Verlass“
Die Welt, 20.3.2008
Jens Bisky: Also ist die Lösung nicht die Lösung
Süddeutsche Zeitung, 20./21.3.2008
Ursula Heukenkamp: „Eine Sache, die der Weltgeist vorgesehen hat, auf die kann man sich dann auch verlassen.“
Peter Hacks und die große Fehde in der DDR-Literatur. Zum 80. Geburtstag.
Zeitschrift für Germanistik, 2008, Heft 3
Georg Fülberth: Ein Dichter für alle
der Freitag, 19.12.2008
Zum 20. Todestag des Autors:
Ronald Pohl: Der Weltgeist aus der Ost-Zone
Der Standart, 28.8.2023
Geburtsstätte der sozialistischen Klassik
junge Welt, 29.8.2023
Fakten und Vermutungen zum Autor + IMDb + Facebook + Archiv +
KLG + Internet Archive + Kalliope und mehr
Porträtgalerie: deutsche FOTOTHEK
Nachrufe auf Peter Hacks: Der Tagesspiegel 1 + 2 ✝ Die Welt ✝ BZ ✝
Der Standart ✝ die taz ✝ NZZ ✝ der Freitag 1 + 2
Weitere Nachrufe:
Christian Eger: Rote Sommer, verweht
Mitteldeutsche Zeitung, 30.8.2003
Martin Halter: Der sozialistische Klassiker
Badische Zeitung, 30.8.2003
Hartmut Krug: Goethe und Stalin
Frankfurter Rundschau, 30.8.2003
Gerhard Stadelmaier: Der Marxist von Sanssouci
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 30.8.2003
Walter Beltz / Eberhard Esche / Hermann Kant / Matthias Oehme: Zum Tode von Peter Hacks
Neues Deutschland, 30./31.8.2003
Jens Bisky: Der saure und der faule Apfel
Süddeutsche Zeitung, 30./31.8.2003
Mario Scalla: Klassiker
der Freitag, 5.9.2003
Irene Bazinger: Wo die Muse wohnt
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 6.9.2003
Martin Linzer: Zum Tod von Peter Hacks
Theater der Zeit, Heft 10, 2003
Wiglaf Droste: Es gibt kein Recht auf Heiterkeitsverzicht
das Blättchen, 30.8.2010
Peter Hacks – MDR artourinfoclip vom 27.3.2008 zum 80. Geburtstag.


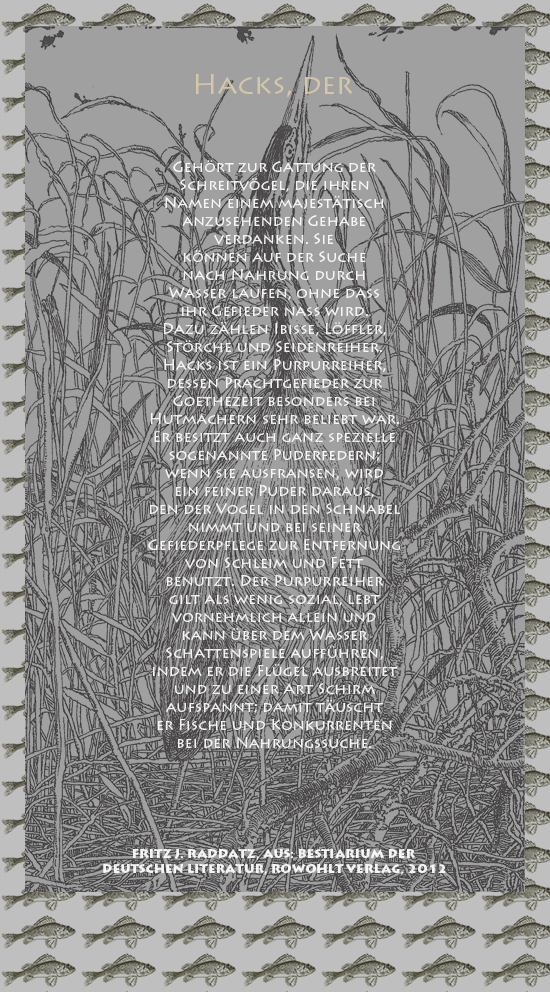












Schreibe einen Kommentar