Peter-Huchel-Preis 1994: Jürgen Becker
EINST, IM FEBRUAR
See-Wetter; aber die See nicht.
Diese Erinnerung an Küsten; Küsten
des Exils, die ich so nannte,
einst, als ich hierblieb.
„Baumeister einer poetischen Architektur der Erinnerung“
Jürgen Becker ist Baumeister, Baumeister einer poetischen Architektur der Erinnerung. Sein Gedächtniskunstwerk dokumentiert die deutsche Nachkriegsgeschichte aus der Perspektive des lebendigen Augenblicks. In Visionen erlebter Gegenwart, in großen Denkbildern, Zeitbildern, in chronikalischen Landschaftsgemälden wird die Geschichte des geteilten und wiedervereinigten Landes erzählt. Baumeister sind Entwurfskünstler mit genauen Formvorstellungen, planvoll arbeitende Strategen der Kunst, in jedem Fall aber Systematiker.
Jürgen Becker selbst plaziert und porträtiert sich auf seine beiläufige Weise in einem Gedächtnisgedicht für Günter Eich. Der Text bündelt seine Mitteilungen im Begriff „Abschied“. Abschied von Günter Eich, was heißt: Abschied vom Kunstabsolutismus der fünfziger Jahre, Abschied von einer Lyrik, die der Geschichtserfahrung in der magischen Welt des Naturgedichts zeitlosen Ausdruck zu verleihen suchte, Abschied vom autonomen Gedicht, das die empirische Welt zu überwinden trachtet.
Jürgen Becker überläßt in seinem Gedächtnistext das Wort dem Älteren. Eichs Stimme wird in direkten Zitaten quer durchs Gedicht geführt: „… nutzlos Gedichte wozu und frage nicht mehr danach… Sie denken ja doch anders die üblichen Katastrophen“, und dann: „in der Sprache, von welcher ich glaubte, niemand kenne sie außer mir“. Das sind Gesprächsfetzen, täuschend gewichtlos. Mit ihrer Hilfe kommt die akustische Aufzeichnung einer Begegnung zwischen dem alten Eich und dem jungen Jürgen Becker zustande, die aus heutiger Sicht ein Datum der Literaturgeschichte ist. Eichs Untergangsvisionen sind Versionen der eigenen Fremdheit in der Zeit, die schon dem Jüngeren gehört:
Sie denken ja anders.
Beckers Augenblicksbild ist eine Hommage an Günter Eich und ein Gegenprogrammgedicht. In charakteristischer Weise unterläuft der Text die Vorschriften des absoluten Gedichts. Gegen dessen materialauflösende Sublimierungstechniken setzt Becker die realistische Durchleuchtung einer Frühstückszene in der Westberliner Akademie der Künste. Eichs Sätze sind nicht zitatreif präpariert zu Ewigkeitsaussprüchen. Statt Andacht, statt Verklärung, statt Feierlichkeit: nackte Rede, hingeworfenes Gesprächszeug „zwischen Eigelb und gelber Frühstücksmarmelade“.
Beckers Gegenrede ist das Gedicht selbst, eine sinnliche Aufzeichnung des Gesprächsaugenblicks. Dazu gehören die Enten im Münchener Englischen Garten vor dem Abflug nach Berlin, die Akademie als „summendes Haus“ voller Leben, eine Stimme, die zur Abreise nach Tempelhof ruft, der Frühstückstisch, an dem eben noch Beckett saß. Das Bild wegstürzender Minuten ist voller Bewegung, Stimmen, Farben, Luft, Tieren, ein Reichtum der Erscheinungen, der Eichs Endzeitgefühl Lügen straft. Der lebendige Dialogton, die kunstvoll kreuzweise Verklammerung von äußerem und innerem Schauplatz und die Kraft der aufgerufenen Erinnerungsbilder, kurzum: die sinnliche Evidenz des Textes besiegt mühelos die trübe Botschaft Eichs. Das Abschiedsgedicht Beckers ist ein sachliches Triumphgedicht der jungen Kunst.
Eichs Name steht für die Lyrik, um deren Schleifung es ging, als Jürgen Becker zu schreiben begann. Gegen das poetische Bekenntnis zur Dichtung als freiem Wortgeist setzten die Jungen, Becker, Enzensberger, Rühmkorf, die Annäherung von Kunstsprache und Alltagssprache, von Lyrik und gesellschaftlicher Praxis, von lyrischem und empirischem Ich.
Damit ist es vorbei mit der Vorstellung eines frei schaltenden lyrischen Subjekts, das sein Material unabhängig von der Wirklichkeit organisiert. Vorbei sind die alten Rollenspiele des lyrischen Ich als Außenseiter der Gesellschaft, als Kind des Olymp, Exzentriker, Solipsist, Wahnsinniger oder als Taugenichts, der die Welt mit seinem Zauberstab zum Klingen bringt. Ausgedient hat das deutsche Kunsttempelritterwesen. Beckers Gedächtnis-Gedicht für Günter Eich ist ein respektvoller Nachruf und die Aufzeichnung des Platzwechsels zwischen der jungen wortrealistischen und der alten metaphysischen Kunst.
Wenn man den Text um seine Achse dreht, entsteht das Selbstbildnis Beckers als demokratischer Normalfall der Kunst und als Topograph des Alltags. Dessen Gedächtniskunst transzendiert die Dinge des alltäglichen Lebens ganz bewußt nicht. Vielmehr werden sie aufgenommen und sichtbar gemacht als Bausteine einer poetischen „Architektur der Erinnerung“. Sichtbar gemacht wird, was zu ihnen gehört, aber unsichtbar ist, ihr Kontext, ihre Zusammenhänge, ihre Geschichten und ihre Geschichte stiftende Wiederkehr, ihre Bedeutung innerhalb der Geschichte des Bewußtseins, ihre Topographie.
Längst wären hier die Namen der Amerikaner William Carlos Williams und Edward E. Cummings fällig gewesen, ohne die der Traditionsbruch der sechziger Jahren nicht denkbar ist. Ich habe sie nicht ins Spiel gebracht, denn wichtiger ist im Falle Beckers ein anderer. Das Stichwort „Topographie“ hat ihn angekündigt.
Uwe Johnson ist dabei, von Anfang an. 1964 erscheinen Beckers Felder, deren Sprache unüberhörbar den Tonfall des anderen in den eigenen schlaksigen Ton mischt. Hören Sie nur:
auf / zwei Beine zack und stehend inmitten von was und fragend nach Wetter und Tag voll Traum noch schabend waffenfarben das Kinn in Gewohnheit und Sorge um die Folgen lässiger Sorge der Haut der Pflege auf der Hut nein auf dem Kopf schon wieder diese herbstlichen Symptome ab heute nie nicht wieder punkt.
So, als verkatertes Individuum, inszeniert Becker seinen Auftritt im literarischen Debüt. Unerhört kunstvoll, wenn man sich vom saloppen Ton nicht täuschen läßt. Das Lotterleben des Menschen, der nicht mehr weiß, mit wem er die Nacht verbracht hat und wo er sich befindet, dieser Morgen, dieses bewußt anstandslose Aufstehen und Auftauchen des poetischen Ich war in Wahrheit ein literarischer Aufstand gegen alte Rollenverständnisse der Poesie.
In demselben Jahr 1964 schreibt Jürgen Becker den Essay „Gegen die Erhaltung des literarischen status quo“. Der Titel sagt alles. Der Text enthält das Programm einer jungen Avantgarde der deutschsprachigen Literatur, die in Austausch getreten ist mit der amerikanischen und der französischen. Beckers frontale Stichworte lauten „epische Selbstherrlichkeit“ und „Schwierigkeit, die Wirklichkeit in Worte zu fassen“. In der Wendung gegen innerdeutsche Traditionen und im Dialog namentlich mit dem französischen nouveau roman wird das Verhältnis von Sprache und Wirklichkeit skeptisch überprüft. In ebendiesem Zusammenhang nennt Becker Johnson. Johnsons Mutmaßungssprache, seine von Skrupel gesteuerte Schreibweise liest Becker als künstlerische Praxis, die Theorien des nouveau roman einlöst. „Eine Grenze zum Beispiel“, sagt Becker, „wirkt auf Uwe Johnson ‚wie eine literarische Kategorie. Sie verlangt die epische Technik und die Sprache zu verändern, bis sie der unerhörten Situation gerecht wird.‘“)
Über Johnson redend, redet Becker von sich selbst. Setzen Sie statt Grenzen „Felder“, „Ränder“, „Umgebungen“ ein und Sie sind bei Jürgen Becker. Beckers Felderwelt ist eine Gedächtnislandschaft zwischen Berlin und New York, zwischen Rom und England. Im Unterschied zu Johnsons literarischem Mecklenburg ist sie als heimatliche Provinz kein Erbstück. Sie wird vielmehr langsam in den Wiederholungsprozessen des Lebens erworben.
Wie alle poetischen Kartographen, Topographen, Landschafter ist Becker ein Gedächtniskünstler. Seine Räume sind Zeiträume. Gedächtnis besteht in seinem Fall aus der Kooperation von Wahrnehmung, Erinnerung und Imagination. Im Schreibakt werden sich überlagernde Gegenwarts- und Erinnerungsbilder geschichtet. Mit dem Bilderstapel entsteht eine chronologische Struktur, entsteht Zeit, entsteht Dauer. Geschichte wird zur räumlichen Konstruktion. Eine Architektur des Gedächtnisses kommt zustande, deren Fundament Landschaften sind, ländliche oder urbane. Ihr Gebäude wird von Buch zu Buch erweitert. In den Differenzen stecken seine Zeitmessungen. So entsteht Beckers Chronik der Dinge, Menschen, Landschaften. Seine Jahrestage sind mit der Uhr vermessene Weltkarten.
„Felder“, „Ränder“, „Umgebungen“, die ersten Bücher waren Grundsteinlegungen und die Errichtung des Rohbaus. Über Köln und die Kölner Bucht legte sich ein Raster immer vertrauterer Orte, Menschen und Dinge. Urbanes und ländliches Leben, wie sie ineinandergreifen zwischen Hohenzollernbrücke, Campis Espressobar in der Hohen Straße, Breslauer Platz, der Autobahnlandschaft am Rhein, den Forsten im Bergischen Land und seinen vom Strukturwandel rasend erfaßten Dörfern. Eine „vorläufige Topographie“ des Lebens wird ins Raster der Felderkarte eingefügt. Die inneren Korrespondenzen mit der Thüringer Kindheitslandschaft gehören dazu und, in „Ränder“, die systematische, räumlich existentielle Erkundung der Kategorie Grenze.
Aus den Feldern der Wahrnehmung, aus der Wahrnehmung ihrer Ränder und der Durchdringung ihrer Umgebungen ergibt sich eine Gedächtnislandschaft mit imagines und topoi. Das sind bei den antiken Autoren bestimmte Orte, die im fortschreitenden Erzählwerk zu Schnittpunkten von Raum- und Zeitachsen werden. Becker erweitert das Repertoire um Alltagsgegenstände, in seltenen Fällen auch um Menschen, das Bergische Odenthal, der Mielenforst, der Kirschbaum im Garten, die Scheune, das Kölner Funkhochhaus, vor allem aber die Pappeln und, immer wieder, der Maler Erich Schuchardt. Die topographischen Strukturen entsprechen den Strukturen des Gedächtnisses; der Horizont hier ist austauschbar mit dem Erinnerten.
Ein Bleistiftgebiet, das sich von Buch zu Buch verschiebt, dehnt und komplettiert entlang der Zeitgeschichte und in Korrespondenz mit der Thüringer Kindheitslandschaft, mit der Belgischen Küste, mit New York, England, mit Rom und Berlin, Orte, Länder, die bereist, von der Erinnerung besetzt und entlang der Zeitgeschichte einer Chronik integriert werden. Becker bezeichnet sie als poetisches Journal. Das ist, wie immer in seinem Fall, ein understatement. Neben Uwe Johnsons Jahrestage stellt Becker das lyrische Notat, neben Johnsons Moralistik den offenen Prozess der Wahrnehmung, neben Johnsons Geschichtskonstruktion die segmentierte Erlebensform des Zeitbildes.
Die analytische Schärfe des Urteils haben sie gemeinsam und die seismographische Genauigkeit der Geschichtsfühlung. Man lese nur Beckers „Berliner Programm-Gedicht; 1971“. Es zeigt die dogmatisch verkrüppelte Studentenrevolution und die von ihr erstickte geistigpoetische Stadt-Landschaft Berlins. 1988 veröffentlicht Becker das „Gedicht von der wiedervereinigten Landschaft“, das die spätere Geschichte vorwegnimmt. Im Januar 1988 während eines längeren Englandaufenthaltes beginnt er mit der Arbeit an „Das englische Fenster“. Nach dem Gedicht ist dies der Bericht über die wiedervereinigte Landschaft, in ihrem Zentrum als „vergessener Emigrant“ der nach England verschlagene Johnson
Becker und Johnson – hier, am Ende, rücken sie wieder zusammen. Über Becker reden heißt über die Felder seines künstlerischen Bezugssystems reden, auch, wie im Falle Günther Eichs über die Ränder dieses Systems, über seine Umgebung, über seinen literarischen Kontext. Kontext, dieses Schlüsselwort für seine Arbeit, platziert er ins schönste seiner Johnson-Porträts, in ein Werkstattbild. Ich setze es ans Ende meiner Werktopographie, denn ich möchte ihn selbst das Schlußwort überlassen und die fällige Erinnerung an den, der das heutige Gruppenbild um Becker erst wirklich komplettiert. Es handelt sich um einen Ausschnitt aus dem „Berliner Programm-Gedicht; 1971“:
Die ganze Umgebung
wird überschaubar in Friedenau
auf den Meßtischblättern von Johnson.
„Kommt jemand
dichten Sie sagt er
sehen Sie mich an
ein Context
Erfahrungen montiert
na gut“;
und ich betrachte die Gegend,
zusammenmontiert, an der Wand,
und lasse mir zeigen die Nähe
von Peter Huchel
– wie er da saß, suchte
Johnson genau auf der Karte die Gegend zusammen
aus seinen Erzählungen,
verwischtes Erinnern –.
Sibylle Cramer, Laudatio auf Jürgen Becker, 1994
Vom Dichten nebenbei
Vor ein paar Wochen, als mir Wolfgang Heidenreich die Einladung zu dieser Veranstaltung zuschickte, bekam ich auch den Titel der Laudatio von Sibylle Cramer zu lesen: „Baumeister einer poetischen Architektur der Erinnerung“. Ein schöner, vor allem passender Titel, dachte ich −: mein Großvater war ein Baumeister; von den Söhnen ist der eine Architekt und der andere Architekturphotograph; nur die eigene Neigung zur Baukunst blieb ohne berufliche Qualifikation – statt dessen das Herstellen dieser völlig immateriellen Gebilde, die man Gedichte nennt. Der Lyriker, oft genug um Auskunft gebeten, für wen und warum er seine Gedichte eigentlich schreibe, weiß dann nie so recht, wie der Zweck und der Nutzen seiner poetischen Installationen zu definieren sei; im Grunde handelt er ja im Auftrag von niemand und nichts – da gewinne er schon eher an Selbstbewußtsein, wenn er als Baumeister verstanden und seine monologische Beschäftigung mit einer seriösen, soliden Berufsbezeichnung versehen wird.
Architektur der Erinnerung – dahinein gehört dann auch, ganz konkret, das Zimmer in einer Wohnung in Berlin-Friedenau, das Wohnzimmer der Familie von Uwe Johnson. An der Wand eine riesige Landkarte, die zusammenmontierte Vergrößerung von Meßtischblättern der brandenburgischen Umgebung von Berlin. Unter der Karte auf einem schwarzen Ledersofa sitzt Peter Huchel, und er hört, nachdem er ein bißchen von seiner Herkunft erzählt hat, Uwe Johnson zu, der vor der Landkarte steht und die Topographie von Peter Huchels Leben und Schreiben zusammensucht und benennt: Michendorf, Langerwisch, Caputh, Saarmund, Wilhelmshorst. Erlauben Sie mir ein Zitat aus dem im Mai 1971 entstandenen „Berliner Programm-Gedicht“:
… und ich betrachte die Gegend,
zusammenmontiert, an der Wand,
und lasse mir zeigen die Nähe
von Peter Huchel – wie er da saß, suchte
Johnson genau auf der Karte die Gegend zusammen
aus seinen Erzählungen,
verwischtes Erinnern –
Die Erinnerung an den Nachmittag, als ich Peter Huchel kennenlernte, zu Hause bei Uwe Johnson, im Mai 1971. Er hatte endlich die DDR verlassen können – „die verbissene Ordnung des Landes“ … „nicht dafür geboren, unter den Fittichen der Gewalt zu leben“ (Huchel) −; nun ging es um die Schwierigkeiten und Möglichkeiten, mit Schreiben Geld zu verdienen. Mit Hörspielen könne man Geld verdienen; ob er schon einmal daran gedacht habe, ein Hörspiel zu schreiben … Ein Hörspiel, murrte Huchel, er habe nie gewußt, was ein Hörspiel eigentlich sei…
Wie ahnungslos und peinlich meine Frage damals war, es wurde mir erst viel später klar – Peter Huchel hatte ja seine Existenz jahrelang mit Hörspielen finanziert, in den dreißiger Jahren, wie Günter Eich; Brotarbeiten für den Reichssender Berlin. Damals wußte ich auch noch nicht, daß der Chefredakteur von Sinn und Form zuvor, von 1945 bis 1949, im sowjetisch lizenzierten Berliner Rundfunk als Sendeleiter, als künstlerischer Direktor fungiert hatte – für mich später, als der Zusammenhang von Literatur und Rundfunk mich selber einbezog, eine für die eigene Existenz hilfreiche und interessante Entdeckung.
Inzwischen klingt es wie eine Legende, aber es bleibt eine historische Tatsache, daß der deutsche Nachkriegsrundfunk das Entstehen und die Vermittlung, die Geschichte der deutschen Nachkriegsliteratur entscheidend mitbestimmt hat. Zu Gelegenheiten als Mäzen, wie es noch heute dieser vom Südwestfunk mitgetragene Preis beweist, sehr oft als Auftraggeber, darüber hinaus als ästhetische Herausforderung, in jedem Fall als Medium der Bewußtseinsbildung, der Erkenntnis und Aufklärung, der Kritik. Der deutsche Rundfunk hat sich mit seiner Offenheit gegenüber der Literatur, gegenüber den Künsten, mit seinem Engagement ans kulturelle Wort, eine Tradition herangebildet, aus der er nicht mehr herauskann. Eine im internationalen Vergleich einzigartige Tradition, die es gegenüber allen Tendenzen, die sie in Frage stellen, einsparen und auflösen möchten, zu verteidigen und für alle Zukunft zu bewahren und fortwährend zu erneuern gilt.
Diese Tradition ist wie eine Münze mit Köpfen und Namen geprägt, Namen von Schriftstellern, die dem kulturellen Programm des deutschen, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks den Inhalt und das Profil gegeben haben. Der Dichter Friedrich Bischoff als erster Intendant des Südwestfunks; Ernst Schnabel, Intendant des NWDR; Alfred Andersch und Axel Eggebrecht, Walter Dirks und Carl Linfert, Hans Magnus Enzensberger und Helmut Heissenbüttel, Martin Walser, Klaus Roehler, Ror Wolf, eine Spur von vielen anderen Namen mehr, die durch die Funkhäuser geht und bis heute reicht, bis zu Rolf Haufs und Friederike Roth, und die ihren Anfang genommen hat 1945, mit Peter Huchel, dem einsamen Piloten.
Die Vergegenwärtigung all dessen hat einen autobiographischen Hintergrund: meine zwei Jahrzehnte Hörspielredaktion im Deutschlandfunk – erwähnenswert allein deshalb, weil damit das Problem des Doppellebens erscheint. Die Vermittlung von Literatur in einem Radioprogramm ist die eine Verwirklichung einer Neigung, einer Passion, deren andere das Schreiben von Literatur ist. Und das sind dann zwei Arten von Kommunikation, die, indem die eine in die Öffentlichkeit zielt und die andere den Blick ins Innere richtet, einander oft genug widersprechen. Ein Radioprogramm, was immer darin passiert, ist bestimmt durch ein System von Regeln, Übereinkünften und Gewohnheiten, und kein Programmgestalter, der sie, bei aller eigenen Subjektivität, nicht akzeptierte. Dieselbe Person jedoch, wenn sie, nachts zu Hause am Schreibtisch, in den Sprachmustern der täglichen Kommunikation nach dem Material sucht, aus dem die Wortbilder, die Metaphern gemacht sind, sie vergißt dann alle diese Regeln, sie weiß nichts mehr von Ausgewogenheit, von Akzeptanz und Einschaltquote; sie befindet sich mit dem Rücken zur Öffentlichkeit und korrespondiert allein mit den Stimmen, die in ihrem Inneren nach Wörtern, nach Ausdruck verlangen; sie führt, wie Peter Huchel schrieb, Gespräche mit dem eigenen Schweigen.
Huchel sagte auch einmal: „Gedichte habe ich nur nebenbei geschrieben. Ich hatte ja immer (als Chefredakteur, als Rundfunkdirektor) einen anständigen Beruf“ Doppelleben, im Sinne auch von Gottfried Benn, der diese Existenzweise zum Prinzip erhoben hat, unter Ausschluß der so peinlichen wie lächerlichen Vorstellung vom Dichten im Nebenberuf. Dichter ist man rund um die Uhr sowieso nicht, und der Dichter als Person, als Zeitgenosse, als Nachbar, er kommt nur vor als Darsteller einer Rolle, die gesellschaftlich inszeniert und seinem Selbstverständnis reichlich fremd ist. Er personifiziert allenfalls, was man das lyrische Ich nennt, und das ist alles andere als ein identifizierbares Wesen; er weiß selber oft nicht, wo es sich gerade aufhält, irgendwo im Inneren des Kopfes, im riesigen Raum seines Bewußtseins, in dem die Schichten der Vergangenheit von Augenblick zu Augenblick wachsen, und manchmal muß er fürchten, es ist gar nicht mehr da.
Aber es ist immer da. Oft scheint es nur darauf zu warten, daß es vermißt wird; unmerklich war es an der Arbeit, hat die Linien für neue Konzepte und Entwürfe gezogen, hat aus dem Dunkel des Vergessens die Erinnerungen hervorgeholt; es bereitet die Imaginationen auf ihr Erscheinen vor. Ein vielleicht unaufhörliches, in jedem Fall unbewußtes Wirken, und wenn es dann spürbar und dem Dichter bewußt wird, sein lyrisches Ich, dann bekommt er es mit einer Vielzahl von Phänomenen zu tun, dann übersieht er sie alle nicht mehr, diese Generationen von Ichs, die alle in seinem Bewußtsein leben und von denen ein jedes erzählen kann von diesem Schmerz und jenem Verlust, von dieser Erfahrung und jenem Abenteuer, von diesem Augenblick heute und jenem Gestern vor fünfzig Jahren. Und so wird auch konkret die Gleichzeitigkeit, in der er sich aufzuhalten wähnt, wenn die Stimmen seines Ichs in einem plötzlichen Zusammenhang erscheinen, in einem einzigen Satz vielleicht, der die Kriegsgeschichten aus der Kindheit mit den Kriegsgeschichten auf dem Bildschirm verschmilzt. Und so versteht er sich dann selber als ein Medium, nicht im somnambulen Sinne, sondern in der Art von Kamera und Recorder, die in seinem Inneren alles wahrnehmen, aufnehmen und speichern, was mit ihren Vorgängen und Ereignissen, Gesprächen und Geräuschen, Dingen und Bildern die Wirklichkeit ist.
Dies alles Material für Gedichte nebenbei, das zu reflektieren und in sprachliche Vorgänge zu übersetzen die Arbeit am Text, der Schreibvorgang ist. Nur nimmt dieses Nebenbei dann eine Dimension an, die es schwer begrenzen und übersehen läßt. Wie immer Peter Huchel sein Nebenbei betrieben hat, genau besehen bezeichnet das Wort die Ränder der täglichen Kommunikationswege, diese den laufenden Verständigungsstrom umgebenden Sprachränder, die vom öffentlichen Leben oft unbemerkt und in langen Fristen sich ausdehnen zu riesigen Gefilden, nach allen Richtungen hin. Man kann sie, den Hauptweg verlassend, betreten, und man nähert sich langsam einer Landschaft, in der die Phantasie blüht und die Imaginationen leuchten. Eine Landschaft, die man bewundern kann, die einen erschrecken kann, die oft abweisend und kalt, mitunter langweilig, dann wieder aufregend, von monströser Häßlichkeit und berückender Schönheit, in jedem Fall vielfältig, voller Überraschungen und immer im Widerstand gegen ihren nie eintretenden Tod ist. Es ist unsere, die Landschaft der Wörter, der Poesie, der Literatur.
Jürgen Becker, Dankesrede, 1994
Mitschnitt der Preisverleihung vom 3.4.1994
Zum 60. Geburtstag des Autors:
Heinrich Vormweg: Ein Poet in seinen Umgebungen
NRW literarisch, Heft 5, 1992
Walter Hinck: Vielleicht das letzte Glänzen: Sinfonien, Radiostimmen
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 10.7.1992
Sabine Küchler: Die Entdeckung des „multiplen“ Ich
Der Tagesspiegel, 10.7.1992
Zum 65. Geburtstag des Autors:
Wolfgang Schirmacher: Geräusche, Gerüche und Signale
Rheinische Post, 8.7.1997
Zum 70. Geburtstag des Autors:
Armin Ayren: Die Wirklichkeit als Sprache
Stuttgarter Zeitung, 10.7.2002
Nico Bleutge: Erinnerungsreise
Süddeutsche Zeitung, 10.7.2002
Hannes Hintermeier: Der Landschaftsmaler
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 10.7.2002
Beatrix Langner: Selbstporträts mit dem Rücken zum Betrachter
Neue Zürcher Zeitung, 10.7.2002
Jochen Schimmang: Ockerfarben in Deutschland
Frankfurter Rundschau, 10.7.2002
Zum 80. Geburtstag des Autors:
Cornelia Geissler: Mit dem Rücken sieht man schlecht
Frankfurter Rundschau, 10.7.2012
Norbert Hummelt: Leise landen die Abendmaschinen
Neue Zürcher Zeitung, 10.7.2012
Lothar Schröder: Autor Jürgen Becker wird 80
Rheinische Post, 10.7.2012
Gisela Schwarz: Jürgen Becker wird 80 Jahre alt
Kölner Stadt-Anzeiger, 10.7.2012
Zum 85. Geburtstag des Autors:
Frank Olbert: In diesen neuen alten Gegenden
Kölner Stadt-Anzeiger, 10.7.2017
Zum 90. Geburtstag des Autors:
Peter Mohr: Prosa als fehlender Rest
literaturkritik.de, Juli 2022
Martin Oehlen: Jürgen Becker – zwei Bücher zum 90. Geburtstag: „Fast täglich hört eine Epoche auf“
Frankfurter Rundschau, 7.7.2022
Jens Kirsten: „eine Landschaft aus Erinnerungen und Imaginationen“
Palmbaum, Heft 75, 2022
„eine Landschaft aus Erinnerungen und Imaginationen“ – Der Dichter Jürgen Becker im Gespräch mit Wolfgang Haak und Jens Kirsten
Radio Lotte, 5.7.2022
Nico Bleutge: Der riesige Rest
Süddeutsche Zeitung, 8.7.2022
Michael Hametner: Jürgen Becker: „Ich habe nicht viel Phantasie“
der Freitag, 9.7.2022
Hans-Dieter Schütt: Das siehst du nie wieder!
nd, 8.7.2022
Michael Braun: Der große Lyriker Jürgen Becker wird 90 Jahre alt
Die Rheinpfalz, 8.7.2022
Gregor Dotzauer: Die Schatten des früher Gesagten
Der Tagesspiegel, 9.7.2022
Joachim Dicks: Jürgen Becker zum 90. Geburtstag
NDR, 10.7.2022
Thomas Geiger: Zeitmitschriften in Lyrik und manchmal auch Prosa
Berliner Zeitung, 8.7.2022
Herbert Wiesner: Von Altlasten und künftigen Katastrophen
Die Welt, 10.7.2022
Nicola Reyk, Christel Wester: Jürgen Becker zum 90. Geburtstag
WDR, 30.8.2022
Fakten und Vermutungen zum Autor + KLG + Kalliope +
DAS&D + Georg-Büchner-Preis 1 & 2
Porträtgalerie: Autorenarchiv Susanne Schleyer + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Dirk Skibas Autorenporträts +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Jürgen Becker: „Da wagt einer, mich zu verreißen? Das muss ich aber genauer wissen.“


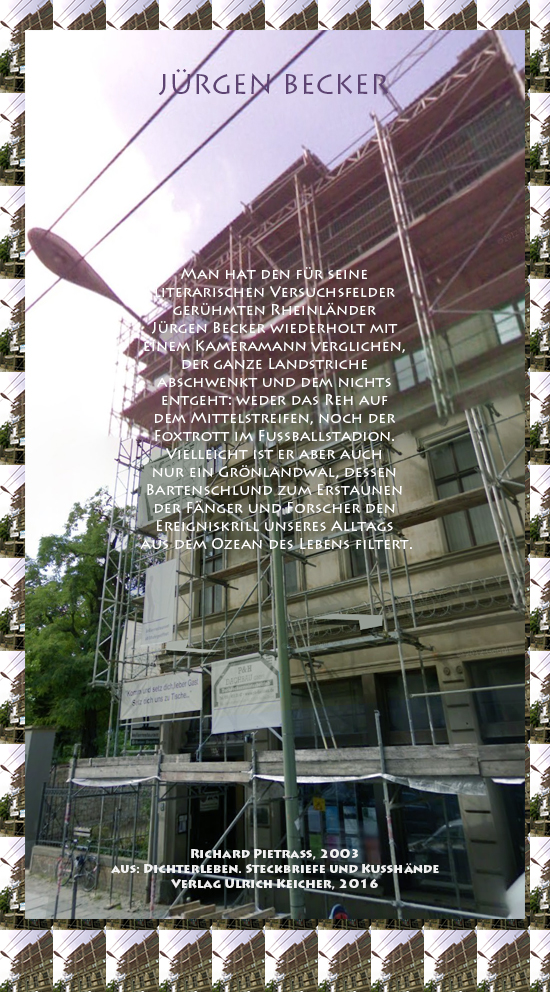












Schreibe einen Kommentar