Rainer Schedlinski: die rationen des ja und des nein
DER ALTE RUDI THIELE
sieben jahre war er an der ostfront
dann zog er sieben kinder gross
wenn er nicht im café sass
malte er urkunden und schiessbudenfronten
die kriegssplitter steckten ihm noch in den knochen
er war krank
doch er vertraute nicht den gesunden ärzten
seine wohnungstür schloss er nie ab
er legte zettel aus: Warne vor weiteren Einbrüchen
im regen stand er mit wehendem mantel
blieb er vor der wirklichkeit stehen
wie vor einem hohen dom
er hatte ein stottern in den fingerkuppen wenn er sprach
wuchs ihm ein stirnlatz aus ernster bewandtnis
er erfand zitate für klopstock
er sammelte heitere philosophien
das war seine philosophie die er vertrieb
als hätte er einen nachschlüssel zur wahrheit
die stummen zeichen
jeder weiß, wohl seitdem er spricht, daß ein unterschied besteht, zwischen dem, was einer hat sagen wollen, und dem, was er, ohne es zu wollen, gesagt hat, denn jede äußerung sagt insgeheim immer noch etwas anderes als das, was sie sagt. unter der sichtbaren formulierung kann eine andere herrschen, die die aussage bestimmt, sie beunruhigt oder sie umstößt. man kann diesen untertext, der wie dessen schatten zum text gehört, ignorieren. man kann aber auch, wie in einer art wette gegen sich selbst, über diesen seinen schatten spingen, indem man das meint, was man im gesagten ausdrücklich verschweigt. dann kommt es vor, man lächelt sich zu und glaubt einander kein wort.
wenn aber einer, der spricht, beharrlich und ernsthaft seinen untertext unterdrückt, daß die aussage in gefahr gerät, durch die stumme präsenz des nicht-gesagten heimgesucht zu werden, verliert er die fähigkeit, diese seine nachtseite zu rezipieren, und der sprechende fährt fort in seinem text, als müsse er unaufhörlich etwas in sich unterbrechen. er ist dann je mehr er selbst, je weniger er mit sich selbst vertraut zu sein scheint. dann ist der faden, dem er folgt, auch der schlauch, auf dem er steht, und er wirkt wie der wachsoldat, den die kinder so gern anfassen möchten, um zu sehen, ob er nicht doch mit der wimper zuckt. und wenn der sprechende sich noch so große mühe gibt, die dinge im denken erstarren zu lassen, sie führen ihr eigenleben durch jene andere wahrheit, die sie in sich tragen, und wer zuhört stellt nie die fragen dessen, der spricht…
Rainer Schedlinski, in einer essayistischen Betrachtung am Ende des Buches, 1988
Wenn Schiller Gedichte als Ausdruck
„einer interessanten Gemütslage eines interessanten vollendeten Geistes“ betrachtet, eines Geistes, „der sich von der Gegenwart loswickeln und frei und kühn in die Welt der Ideen emporschweben soll“ – so haben die Gedichte Rainer Schedlinskis auf den ersten Blick mit solchen klassischen Kunstauffassungen rein gar nicht zu tun.
Wohl aber mit dieser Gegenwart, in die sie verwickelt sind, die nun nicht über Metaphern in geprägten Bildern und Gleichnissen zu uns spricht, sondern durch die Stimme eines Autors, der zunächst wie reserviert hinter seine Wahrnehmungen und Mitteilungen zurücktritt, freilich nur, um sie selbst auf bestürzende Weise in ihrer gegenwärtigen Wirklichkeit Wort für Wort, Zeile für Zeile hervortreten zu lassen,
als gingen die bilder durch mich und
nicht ich durch das leben
Sorgsam und bedächtig, eher zögernd und stockend als beredt, versucht er den Worten wieder ihre eigene Bedeutung zukommen zu lassen, indem er ihnen in seinen Versen ihre Gültigkeit zurückgibt, geplagt von beunruhigtem Zweifel gegenüber aller Vollendung und Endgültigkeit.
Er hebt seine Stimme nicht an, er senkt sie. Übliche Lyrismen, gar Bekenntnisse sind von ihm nicht zu erwarten, aber was er um sich herum auf- und wahrnimmt, zeichnet er, nicht ohne behutsame Ironie, sorgsam auf und
die farbe
des tages kommt an den tag, der
die wirklichkeiten dinge vergibt…
Das brisante Thema aber, das sich so, wie ungerufen, einstellt, ist dann eben unsere verwickelte Gegenwart jenseits aller Verlautbarungen, Festlegungen, der sich widerstreitenden Verkündungen oder Kommentare.
Eine Landschaft der Kindheit gewinnt Umriß, abhold jedem falschen Gefühl oder Ressentiment, mit wenigen Zeichen, aber nicht ohne spürbare Teilnahme dessen, der ihr da Worte gibt.
Und diese Stadt Berlin zwischen deutschland & deutschland tritt in bemessenen Momenten, treffenden Szenen und bezeichneten Gesten ganz unaufdringlich unmittelbar in den Ablauf dieser Zeilen, die plötzlich zu guten Versen werden. Und ihr Sprecher bewegt sich nicht in der Welt der Ideen und Ideale, sondern unter denen, mit denen er lebt
alle die nicht reden können gehen
mit andern worten sozusagen
in der sprache unter
Rainer Schedlinski spricht die Sprache seiner unpathetischen Generation, nüchtern, illusionslos, zurückhaltend und auf diese seltsame Weise, eben als Dichter, unüberhörbar.
Gerhard Wolf, Aufbau Verlag, Klappentext, 1988
Wahn der Realität
Mit den wütenden Verbalattacken gegen die Unterdrückung seitens des Staates oder den subtil der Zensur entziehenden Wort- und Formspielen ist offensichtlich Schluß bei den jungen DDR-Lyrikern, nimmt man Lutz Rathenow einmal aus. Denn worin bestünde die latent „sozialkritische“ Aussage der Gedichte Rainer Schedlinkis oder bei hermetischeren Beispielen ihr tieferer Sinn? Offensichtlich geht es nicht mehr darum, daß ideologische doublebind zu denunzieren, dem man sich in einem totalitären System tagtäglich ausgesetzt sieht:
traurig
aber wahr streng aber
gerecht schmerzhaft
aber notwendig aber so
einfach relativiert sichs
nicht jeden tag erika
„unschärfe“
Das schizogene Potential solcher Herrschaftsformen liegt schon noch / auch unterhalb der Ebene manifester Repressalien, in der Sprache. Damit ist weniger die Aufspaltung des DDR-Deutschen in eine offizielle Amts- oder Kadersprache und einen Jargon gemeint, der ein „Sonderwissen“ codiert, sondern eine „Architektur des Wissens“, die den gesamtgesellschaftlichen Bereich betrifft und für Partialbereiche nur eine begrenzte Zahl von Diskursen zur Verfügung stellt. An einem treffenden Beispiel erklärt Schedlinski im Anhang seines Buches dieses Prinzip und er gibt deutlich zu verstehen, daß darin letztlich nichts DDR-Spezifisches liegt: „der fußballfan, der da im stadion gefragt wurde (warum er Alkohol mit zum Spiel brachte) kann gar nicht antworten, denn es gibt ihn in den ihm zur verfügung gestellten texten überhaupt nicht.“ Die Schlußverse eines Gedichtes bringen die Bedeutung, die neben der Verteilung und Verwaltung von Wissen der Sprache selbst zukommt, zum Ausdruck: „die zeilen sind gitter des menschen sprache ein offenes gefängnis dort gibt es kein draußen“.
Rainer Schedlinskis Gedichte bewegen sich aber bei weitem nicht nur auf der selbstreflexiven Ebene; zur Berliner Mauer heißt es.
mauern
& mauern
pressen die stadt in die augen
(…) nur der stein
bricht mit allem
woraus er entstand
„fraktur“
eine gewisse aktuelle Note gewinnen im Nachhinein die Schlußzeilen von „aussöhnung“:
dem dokumentarischen vater
über die zeit half der sohn &
dem sohn ein asyl in den söhnen.
Dreiviertel der Texte erwecken den Eindruck, daß sie ganz gut auch von bundesdeutschen Lyrikern stammen könnten, was nicht heißen soll, daß nicht DDR-Wirklichkeit in sie eingeflossen wäre:
zum schluss
schmalfilm aber auch das bißchen
realität wird immer weniger
„immerhin“.
Das zeigt nur, daß der sogenannte DDR-Bonus (Marke: ein unterdrückter Dichter hat es immer leichter, weil mehr Reibefläche da ist) nicht mehr zum Tragen kommt. Liegt das nun daran, daß das System nachgiebiger geworden wäre oder daran, daß sich womöglich die Reibeflächen verändert oder verschoben haben?
Ein bißchen von beidem, glaube ich: wer kürzlich den Artikel in der Weltwoche gelesen hat („Heute lesen wir vor 15 Muttis am Stadtrand“), erhielt doch wohl den Eindruck, daß es den jungen Lyrikern (auch materiell) gar nicht mehr so schlecht geht da drüben. Die meisten können frei rumreisen, veröffentlichen und gehen keiner geregelten Arbeit nach. Die Richtung, nach der hin sich die Reibeflächen verschoben haben, nähert sich mehr denn je der ihrer westlichen Kollegen an: nicht die unmittelbaren Zwänge stehen im Mittelpunkt, sondern die sich dahinter verbergenden Denksysteme, die rhetorischen Strategien zur Verbergung von „Wahrheiten“, der „krieg der bilder“, die einem angeboten werden, und die Hierarchie, nach der Diskurse funktionieren, mithin Macht.
Als ihre Handlanger hat der Lyriker die Familie und psychoanalytische wie –therapeutische Erklärungsmodelle ausgemacht:
auf der suche
nach den riegeln zu den instinkten
von der neurose zur ekstase und zurück
und dann das autogene training
„kleine polemik“
Ich wüßte nicht, daß irgendein westdeutscher Lyriker auch nur annähernd deutliche anödipale Kritik formuliert hätte, wie es das Gedicht „antiödipus“ tut:
stiefel um stiefe
l schreibt die Geschichte s
ich fort (…)
jetzt schlaf ein ich will
l dir deinen traum erzählen.
Noch an anderer Stelle verweist Schedlinski auf jenes Werk von Gilles Deleuze und Félix Guattari, dessen Titel er für obiges Gedicht entlehnte:
man tut was man kann
mit der möglichkeit des organlosen körpers
„tiergarten“
Als Refugium scheinen sich dann letztlich nur die Liebesgedichte anzubieten, von denen der in Magdeburg geborene, heute in Ostberlin lebende, 33-jährige Lyriker einige betörend schöne geschrieben hat, doch auch dort ist ungetrübtes Glück nicht mehr möglich. Manchmal hören sich diese Texte an, wie eine Klage darum, daß es kein autonomes Subjekt geben kann, auch nicht in der Liebe. Und so lauter schließlich Schedlinskis etwas resignierend klingendes Statement zur Kunst so:
ich denke die kunst existiert
weil noch immer sich die sonne
um die erde dreht
& das herz ein geduldiges
tonband spielt
Letztlich hat der Mensch, zumal in der heutigen Medienwelt, nur die Wahl unter verschiedenen Ich-Angeboten, die aber alle codiert sind und um so besser funktionieren, je mehr sie für Identitäten gehalten werden. Nur: wie herauskommen aus diesem Wahn an Realität? Schweigen? – „alle die nicht mehr reden können gehen sozusagen unter („sozusagen“). Anderseits weiß Schedlinski: „realität ist ohne ,dichtung‘ überhaupt nicht denkbar. ich meine. die kunst sollte der (…) vorstellung widersprechen, daß alles sofort diskursiv formulierbar sei.“ Er fordert Texte, „die den blick von der sache auf das zeichen wenden.“ Er glaubt fest daran, daß „die poetische sprache (…) die diskursive wahrnehmung (schädigt), die uns schädigt“ (Anhang). Insofern liegt in seiner Resignation auch Hoffnung auf die „Subversion des Wissens“ (Foucault) – des Wissens um die unendlichen Möglichkeiten der Sprache.
Manfred Ratzenböck, Konzepte, Heft 8, 1989
Von poetischer Weltaneignung
− Eine Reihe Außer der Reihe im Aufbau-Verlag. −
Es ist nun schon etliche Zeit her, seit die ersten beiden Bände der so gekennzeichneten neuen Editions-Reihe des Aufbau-Verlags, herausgegeben von Gerhard Wolf, erschienen sind: Bert Papenfuß-Gorek dreizehntanz und Rainer Schedlinski die rationen des ja und des nein. Sie fanden bereits literaturkritische Beachtung. Es handelt sich hier keineswegs um Außenseiter, sondern um ernst zu nehmende lyrische Erscheinungen, die das Bild der Literatur unseres Landes schon länger mitprägen. Vereinzelte Drucke von Papenfuß-Texten gibt es bereits seit den siebziger Jahren. Mit einer umfassenderen Publikation tat man sich aber schwer.
Und leicht machen es die beiden Autoren ihren Lesern wahrhaftig nicht. Es gehört ja zum Wesen des Experimentierens mit Sprache, daß Gewohntes verfremdet. Klischees durchbrochen und Vieldeutigkeiten der Alltagssprache provokant für neue Sinnzusammenhänge oder Bild-Assoziationen, genutzt werden. Das sind keine völlig neuen poetischen Konzepte. Sie können auf eine lange Tradition verweisen, die von DADA bis zu Jandl reicht.
(…)
Auch die Gedichte Rainer Schedlinskis (Jg. 1956) liegen jetzt erstmals gesammelt vor. die rationen des ja und des nein so der Band-Titel — kommen in ihrer Sprech- und Schreibweise behutsamer, zurückhaltender auf uns zu. Wortwitz und Sprachspiel sind nicht so sehr die Sache dieses Autors. Poetische Intensität sucht er durch eine Bildsprache, mit der erlebte Wirklichkeit so überhöht wird, daß sich neue Sichten auf die Welt eröffnen.
Das lyrische Ich vergewissert sich immer wieder seines Zugangs zur Wirklichkeit, indem es dessen ideelle Voraussetzungen problematisiert:
was ist ein gedanke? in wirklichkeit
gibt es nichts
was es nicht gibt, es wäre
unlogisch zu sagen ich lüge
(„ohne befund“)
Im abschließenden Essay „monolog aus einem gespräch“ lesen wir:
realität ist ohne ,dichtung‘ überhaupt nicht denkbar, ich meine, die kunst sollte der von den kommentatoren, psychologen, polizisten und ingenieuren in ihren betrachtungen, berichten und bauanleitungen verbreiteten, unsere erfahrungswelt kolonisierenden vorstellung widersprechen, daß alles sofort diskursiv formulierbar sei. wenn das so wäre, hätte längst jemand die ganze wahrheit auf den tisch gelegt.
Damit wird die Eigenständigkeit poetischer Weltaneignung hervorgehoben, zugleich aber das Mißtrauen gegenüber voreiligen Ansprüchen auf „Endgültiges“, auf absolute Wahrheiten. Dem entspricht die illusionslose Eigenbilanz in vielen Texten, der Hinweis auf die Begrenzungen des Ich, seiner Wahrnehmungs- und Ausdrucksmöglichkeiten „man sieht die dinge nicht wie sie sind / ich hab nur diese eine sprache. mark / in worten…“ („streng empirisch“). Das verbindet sich bisweilen mit einer fast schon romantischen Sehnsucht nach dem Einfachen und Ursprünglichen, etwa in der Liebe oder in den Landschaften („terra nova“, „epilog“, „wieder auf der erde“, „wuischke, winter 84“).
Poesie und elementare Natur werden in ein unmittelbares Verhältnis zueinander gesetzt:
ich denke die kunst existiert
weil noch immer sich die sonne
um die erde dreht
& das herz ein geduldiges
tonband spielt
(„das fenster ist geöffnet“).
Dr. Mathilde Dau, Berliner Zeitung, 14.10.1989
Ein gründlicher Denker
Als Zweiter in der Reihe Außer der Reihe rückt nun Rainer Schedlinski in den Vordergrund. So unumdeutbar, direkt wie der Titel des Bandes die rationen des ja und des nein ist nicht jeder Vers der vorgelegten Ausgabe. Der Lyriker Rainer Schedlinski ist kein verkrampfter Grübler, dem garstige, gespenstige, gefährdende Gedanken durch den Kopf kreisen. Er ist ein gründlicher Denker, dem das rationale Durchdringen seiner Gefühle wichtiger ist als die emotionale Durchdringung seiner Gedanken. Sprechen, Schreiben bedeutet für ihn, hinter den Sinn von Gesprochenem und Geschriebenem zu kommen, also den Hintersinn erdenkbar, ersichtlich zu machen oder das Sprechen, Schreiben als Sinn zu nehmen.
Die Gedichte des 1956 in Magdeburg Geborenen sind eher zupackend denn streichelnd, eher analytische Aus-Deutung denn metaphorische An-Deutung. Schedlinski, der eine Lehre als Wirtschaftskaufmann hinter sich hat, in so manchem Gewerbe befristet sein Geld erwarb, lebt seit gut einem halben Jahrzehnt als freiberuflicher Autor in Berlin.
Nicht die Gedichte, die Essays haben mich dazu gebracht, auf Schedlinski zu schauen. Verlag und Herausgeber Gerhard Wolf tragen dem Eifer und Engagement des Essayisten Rechnung und haben der Lyrik-Auswahl zwei Essays angegliedert. Die läßt man besser nicht aus und liest sie auch nicht im Nachhinein. Beide Arbeiten artikulieren die persönliche poetische Konfession des Lyrikers, die er unorthodox praktiziert. Schedlinski setzt seine Worte nicht, um „eine nutzlose wahrnehmung“ an die andere zu reihen, wie er direkt und indirekt wieder und wieder behauptet. Wie vieles nutzlose Wahrnehmung ist, weiß er sehr gut und sagt es eher unbesorgt denn besorgt.
Fließende Formen, fließende Gedanken, fließende Übergänge bestimmen Ausdruck und Aussage der Seiten der Schedlinski-Ausgabe. Um den Fluß nicht zu stoppen, wird sogar auf abschirmende Titel für die Gedichte verzichtet. Das Strömen, das Schedlinski auch nicht steuern, aber immer spüren will, gräbt das Gedankenbett der Gedichte tiefer und tiefer und macht den lyrischen Fluß mal breiter, mal schmaler.
Mit der Gedichtauswahl — aus wievielen Jahren ist nicht gesagt, überwiegend aber aus den achtzigern – leistet der Herausgeber Gerhard Wolf ein weiteres Mal „archäologische“ Arbeit. Neben der sehr stabilen Papenfuß-Gorek-Edition sieht die des Rainer Schedlinski ein wenig gestückelt aus. Die biographischen, dichterischen Spuren sind in den Gedichten des Bert Papenfuß-Gorek deutlicher als die des Rainer Schedlinski. Ohne sein Subjekt unwichtig zu machen, erscheint es doch allzu oft neutralisiert. Schnell ist der Eindruck geweckt, daß häufiger über die Dinge, nicht durch sie und mit ihnen gesprochen wird. Sprachverliebt, wie Schedlinski ist, schätzt er sich glücklich, wenn er die Sprache zum Sprechen bringt. Ihm gelingt es, das Wort über das Wort wichtig zu machen. Stehen Worte aber um ihrer selbst willen, bleibt der Leser ausgesperrt. So schlimm kommt es selten. Weniger selten ist Schedlinskis rationale Rigerosität, die dem Leser sicher schwere Minuten bereitet. Sachliches Kalkül macht Sinn und Sinnlichkeit der Gedichte von Schedlinski aus. Also hören sich seine Zeilen so an:
in der tinte saugt der dichter
aus den eisbergspitzen blut
wenn die farben wieder frei sind
ist der mensch auch wieder gut
Bernd Heimberger, Neue Zeit, 2.1.1990
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Gunhild Kübler: Mit stumpfer Sprache dichten
Neue Zürcher Zeitung, 28.9.1990
Helmut Böttiger: Gedichte, Ornamente. Ein Blick auf die Lyrik des Jahres 1990
Stuttgarter Zeitung, 14.12.1990
Michael Gratz: Umbau der Bühne bei laufender Probe. Gedanken zu Gedanken von Wenzel und Schedlinski
Weimarer Beiträge, Heft 6, 1989
vogel oder käfig sein
… darüberhinaus im nachhinein…
um es vorwegzunehmen, was als übung des miteinander umgehens gedacht war, ist über den dialog in einen diskurs „ausgeartet“, der seinen grund kaum wiedererkennen dürfte. aus knochen wurde hand und fuß, oder umgekehrt? dabei ging es um solche in frage gestellten extremitäten wie realität und dichtung, die auf wirklichkeit und wirklichkeitsempfinden hinauslaufen. sollte es nach wochen frappierender stagnation – das gesprächsmaterial außerhalb der sinne noch möglich sein, auf die beweggründe für diesen balanceakt und seine eindrücke hinzuweisen, dann nur mit der von schedlinski hergestellten distanz, quasi aus der position des allein betrachtenden lesers. was als wille zum handeln angetreten war, muß zurücktreten vor der blöße des geschehens, es gibt kein geheimnis, das sich aussprechen läßt; alles bleibt denkbar. selbst jenes gespräch, von dem hier nicht die rede sein kann, gerät wieder in erinnerung. „ja, die reihenfolge der fragen ist in einer art, wie ich einen diskurs, in dem ich über das schreiben sprechen könnte, auch führen würde“. was darüberhinaus im nachhinein auffällt, hervorgerufen durch den anspruch, übung des miteinander umgehens zu werden; wie das wirkliche gespräch, ohne tödliche wirkung der begriffe auf die dinge, von dem wir nicht wissen, wie es aussieht, auszusehen hat und das uns nur aufgrund einer ahnung die gewissheit seiner existenz mitteilt, wäre ein ort der entdeckung gemeinsamer kreuzwege eines unbedingten zu-sich-kommens. in diese richtung gesprochen hat das gespräch eine chance, gehört zu werden. so gesehen sind rainer schedlinskis monologe, aus der überarbeitung der ihm zur korrektur vorgelegten gesprächs aufzeichnungen entstanden, absicht, auch dann noch, wenn man ihm bereits anderes unterstellen mag. es genügt, um nicht schon auf zu oft versagtes hinzuweisen, die stellen, die zu finden lohnen, offenzuhalten. dieses gesprächsprinzip als angebot an den leser.
Egmont Hesse: ich möchte unser gespräch, das eine übung des miteinander umgehens werden könnte, mit einem wort beginnen, das in der vielzahl seiner bedeutungen und seiner verbindlichkeiten, für die es einsteht, dir suspekt erscheinen mag, laß es mich trotzdem „handeln“ nennen, oder anders gesagt, um eine frage zu provozieren; „dichten“. inwieweit kannst du diese beiden worte als ein gemeinsames etwas verstehen?
Rainer Schedlinski: im vorwort zu deinem ersten interview, dem mit andreas koziol, fragst du mit ingeborg bachmann „nach dem, was bereits seit dem urschrei (vorausgesetzt, daß es ihn gab) existiert, nach der angst des sprechenden vor dem verlust oder der wirkungslosigkeit des wortes“. in einer reaktion (die ja ein „handeln“ ist) auf diesen text, schrieb ich, deine jetzige frage vorwegnehmend, in einem noch unvollendeten aufsatz: „es gab keinen urschrei, außer unserem eigenen… die bezeichnung gottes war dessen tatsächliche erscheinung, wie gottes wort tatsächlich handelte. der gottgeweihte hatte keinen schatten und kein spiegelbild. doch was er dachte, war ding mit schatten und spiegelbild. das heißt, die welt dachte sich den menschen, dem geschah es, alles meinte ihn, begegnete ihm, stieß ihm zu. der schöpfer war die syntax der wirklichkeit. gott schuf den menschen, um lebendig mit sich selbst zu sprechen.“ ich will sagen, erst durch das bewußtsein der eigenen sprache geriet gott in eine exklusive, skandalöse beziehung zur wirklichkeit. seine sprachlosigkeit war gottes erste und höchste dialektik. der animistische lebenskreis, der gesamte mikro-und makrokosmos, war vordem syntaktisch durchwaltet. das lesen aus eingeweiden, aus wolkenbildern, aus sternkonjugationen, war das lesen der natürlichen sprache der sich selbst thematisierenden wirklichkeit. elke erb sagt: „alles ist text“. ich denke, die wirklichkeit ist eine gesamtheit vieler, selbstverständlich auch ungesprochener sprachen, von denen das handeln die höchste und wichtigste sprache ist, aus der auch geschichte entsteht. die geschichte zum beispiel wurde intelligibel stets nur durch ihre textualisierten, diskursiven, gesprochenen, nicht aber durch ihre ungesprochenen sprachen. die ungesprochenen, weil selbstverständlichen sprachen, sind auch die sprachen der kunst. ich denke, das animistische prinzip der wahrnehmung, die symbolische intelligenz, ist unter unseren kulturellen bedingungen das autistische prinzip der kunst geworden (und älter als die manieristische kunsttheorie ). in diesem, uns, wie ich meine, rudimentär erhaltenem animistischen sinne halte ich „dichten“ und „handeln“ für durchaus identisch, und in diesem sinne könnte dichtung, die selbst glaubt, oder auch nur glauben machen will, freiwillig objekt der rhetorischen wirklichkeit zu sein, sprache werden, in der selbstverständlich wirklichkeit „handelt“.
Hesse: obwohl sie durch ihren gestus von wirklichkeit besetzt ist bzw. darauf hinausläuft, ohne in formen des realismus erstarren zu müssen?
Schedlinski: realität ist ohne „dichtung“ überhaupt nicht denkbar. ich meine, die kunst sollte der von den kommentatoren, psychologen, polizisten und ingenieuren in ihren betrachtungen, berichten und bauanleitungen verbreiteten, unsere erfahrungswelt kolonisierenden vorstellung widersprechen, daß alles sofort diskursiv formulierbar sei. wenn das so wäre, hätte längst jemand die ganze wahrheit auf den tisch gelegt. aber jeder wahrheitsdiskurs funktioniert nur in diesem oder jenem sinngefüge. ich gebe dir mal ein beispiel: in der schule erklärte mir der lehrer, die häuser in new york würden so hoch gebaut, weil die grundstücke so teuer wären. das wirkt sehr schlüssig. ein anderer, eher empirisch einleuchtender diskurs lautet: die wolkenkratzerkultur sei glanzvolles zeichen des siegeswillens einer kultur, die die menschen in himmel erhebt oder in schluchten verbannt. jeder diskurs operiert im innern einer dimension, in der durch bündigkeit und schlüssigkeit jene hermetik erzeugt wird, die ihn der wirklichkeit entfremdet, denn die wirklichen dinge schließen sich ja überhaupt nicht aus. die diskurse dagegen widersprechen sich, weil sie textualisierte systeme sind, und nicht die wirklichkeit, in dieser, ihrer inneren dimension herrschenden soundness (widerspruchsfreiheit) und completness (vollständigkeit). die widersprechenden, nicht kausalen oder überzähligen wahrheiten kommen ihm nicht ins gehege. es gab zu allen zeiten die illusion, alles wesentliche sei aufgeklärt, die texte waren geschlossen in ihrem kreis, und in dieser form kann man nichts fehlendes entdecken. so entstehen durch passende reihung und lückenlosigkeit wahrheitswirkungen im innern von texten. oder ein anderes beispiel. in einer jugendsendung des ddr-fernsehens wurden fans interviewt, die alkohol mit ins fußballstadion gebracht hatten, der ihnen am einlaß abgenommen wurde. auf die frage, weshalb sie alkohol mitbrächten, antworteten manche überhaupt nicht, zuckten die schultern, senkten den blick. einer sagte mit komischer miene, er hätte vergessen, die flasche vorher aus der tasche zu nehmen, und ein anderer wurde aggressiv. im studio wurden dann eingeladene fdj-ler befragt, was sie davon hielten, wenn fußballfans alkohol mit ins stadion brächten oder sogar randalierten. „das hätte mit sport nichts mehr zu tun“, war die antwort. wie ist es möglich, daß der, der offenbar schwachsinn redet, einen text hat, und der, der lebendiges beispiel dafür ist, daß sport selbstverständlich etwas mit sauferei zu tun hat, nicht sinnvoll antworten kann, obwohl doch die wirklichkeit auf seiner seite steht? im diskurs über den „sinn des sports“ ist nur von körperertüchtigung, völkerverständigung und allenfalls von unterhaltung, nicht aber von gewalt und alkohol die rede. der fußballfan, der da im stadion gefragt wurde, kann gar nicht antworten, denn es gibt ihn in den ihm zur verfügung gestellten texten überhaupt nicht. er ist in einer gespaltenen, sprachlosen situation: er kennt die wahrheit, die jeder kennt, doch diese wahrheit kennt ihn nicht, denn die wirklichkeit des saufens und randalierens hat keinen eigenen sinnvoll argumentierenden text. was nicht heißt, daß nicht ebenfalls jeder wüßte, daß im stadion gesoffen und randaliert würde, – sonst wäre ja die frage gar nicht aufgetaucht, aber die disqualifikation des besagten fans aus den texten manifestiert seine paradoxe (nicht)existenz, und so kann er seine anwesenheit nur durch schulterzuckendes schweigen, durch humor oder durch aggression behaupten. sinnvoll formulieren kann er sie nicht. schon durch seine existenz bricht er mit dem text. der diskurs über den „sinn des sports“ wäre nicht sinnvoll und unschlüssig, würde er sowohl körperertüchtigung als auch sauferei, sowohl völkerverständigung als auch gewalt implizieren. völkerverständigung und körperertüchtigung stehen auf einem, saufen und randalieren stehen auf einem anderen blatt, womöglich dem eines juristischen diskurses, der wiederum wirklichkeit sprachlos macht, die über keinen eigenen ausgesprochenen sinn verfügt. über etwas sprechen bedeutet immer, aus seinem gegenteil sprechen. über den wahnsinn zum beispiel spricht die vernunft. jeder diskurs produziert eine außenwelt, der gegenüber er sich hygienisch verschließt. die diskurse der supermächte geben stets in sich selber antwort. jeder ihrer monologe besteht aus zwei, voneinander unabhängig operierenden, sich voreinander verschließenden monologen. daher wirkt alle nukleardiplomatie, wirken die kamingespräche so zynisch gegenüber den statements. sie machen einander sprachlos, indem sie sich auslöschen. sie drohen einander aufzubrechen, um zu wort zu kommen. ronald reagan sagte auf einer pressekonferenz anläßlich des libyenkonflikts: „gewalt ist die einzige sprache, die oberst gaddafi versteht.“ die diskurse, die man ideologisch nennt, müssen für jeden angesprochenen einzelnen intelligibel und von ihm wiederholbar sein. wären sie nicht stringent und hermetisiert in ihrem sinngefüge, verlören sie ihre intelligibilität und damit ihre wiederholbarkeit, ihre teleologie und damit ihre regierung über die individuen. der totalitäre diskurs der gesellschaft determiniert den einzelnen bis in seine geringsten und intimsten tätigkeiten, indem er für alles, was einer tut, einen gesellschaftlichen sinn formuliert. selbst der knigge, der jetzt erschienen ist, mußte im vorwort vom parteitag hergeleitet werden. außerhalb dieses „sinns“ herrscht sprachlosigkeit. auch der westeuropäische terrorismus der 70er jahre befand sich in gesellschaftlicher disartikulation. sein diskurs leuchtete, trotz seines extremen bewußtseinsgrades, allgemein nur empirisch und unausgesprochen ein. es gibt, wie für den fußballfan, keine sinnvolle artikulation außerhalb des jeweils herrschenden, verbindlichen sinngefüges. was ich sagen will ist, daß die diskursive macht so mächtig, weil schlüssig ist, und daß diese schlüssigkeit sie derart vor der wirklichkeit abdichtet, daß ihre hermetik nur durch humor gelüftet („was immer lustig ist, ist subversiv.“ (orwell)), durch individualität verwässert, durch aggressivität aufgebrochen, oder durch kunst verlassen werden kann. die sprache der kunst, die poetische sprache, bewegt sich außerhalb der dienst- und fachsprachen. sie entzieht uns ihrer aufsicht. sie schädigt die diskursive wahrnehmung, die uns schädigt. wie zum beispiel könnte die sprache des traumes, die – sonst würden sich träume anders ausdrücken – so präzise und ursprünglich ist, unlogisch oder irreal sein? sie scheint irreal, weil sie nicht völlig in die idealisierte sprachlogik realistischer diskurse dechiffrierbar ist, weil bei der übersetzung verluste entstehen und überformulierungen. die ganze wahrheit des traumes ist nur in der sprache des traumes selbst. was wir nicht verstehen, verstehen wir durch das milchglas der sprache oder durch die brille der diskurse nicht. die strukturen des sinngefüges und der sprache haben ein eigenes nervensystem, das die wirklichkeit überdeterminiert. ihre logischen vorurteile erfüllen sich selbst.
Hesse: hat diese einsame gemeinsamkeit, von der du so ausführlich gesprochen hast, tradition?
Schedlinski: ja, bis heute. die geschichte des denkens wurde von den griechen bis in unser jahrhundert in dialektischer negation ausschließlich an hand dessen, „was“ gedacht wurde, beschrieben, nicht dadurch, „wie“ gedacht wurde, nicht durch den denkstil, die bewußtseinsstrategie der jeweils herrschenden diskursiven praxis, die ein für jeden verbindliches epistem oder paradigma bereitstellen… die dialektik war ein determinationsmodell, das, durch die entdeckung der logik des widerspruchs, es erlaubte, nicht nur das, was der diskurs sagt, sondern auch das, was er antithetisch verschweigt, ins bewußtsein zu rücken. kant meinte: „denken heißt, mit sich selber sprechen, und sich selbst hören, zu einem gespräch gehören immer zwei.“ doch das problem der dialektik ist, daß die wahrheit nicht in der immer spaltbaren mitte liegt. die psychoanalyse entdeckte die logik des verwirrten, des unregelmäßigen, des fernerliegenden, das nur durch unsere sprache unlogisch erscheint. doch das problem der psychoanalyse ist, daß kein phänomen über alle ebenen des bewußtseins definiert werden kann. die strukturalisten begannen, die sprache ethnologisch, psychologisch und linguistisch zu relativieren und phänomene verschiedener ebenen miteinander ins gespräch zu bringen, was vorher gegen die akademische anständigkeit verstieß. alle neuen erkenntnisstrategien waren, außer daß sie einen konkreten gegenstand thematisierten, auch immer neue strategien, um das vorher ausgegrenzte, das diskursive randbewußtsein sinnvoll ins bewußtsein zu rücken. da das interpretierende bewußtsein die welt immer nur phänomenologisch überdeterminiert, nicht aber positiv, das heißt an hand ihrer eigenen zeichen deuten kann, wurden die determinationsmodelle inzwischen derart aufgeweicht, daß nicht das „was“, sondern das „wie“ der denkstil selbst in den blick rückt. deleuze und guattari entwarfen eine „rhizomatische“ struktur des diskurses, in der jeder punkt mit jedem verbunden werden kann. foucault spricht von einem text als denkwerkzeug, nicht als modell.
Hesse: siehst du versuche, diese verfahren in einer offenen oder öffnenden sprache des sprechens oder schreibens analog zu verwenden?
Schedlinski: ja, gerade in der ost-berliner lyrik der letzten jahre gibt es viele versuche, die dinge in anderer sprache neu zu denken, die welt zu denken, ohne sich in fest strukturierten erörterungen, narrationen oder theorien einzuschließen – gibt es allgemein eine aufgabe neurotischer fiktionen zugunsten der wirklichkeit. der verlust des klassischen intentionalen bogens, wie der form des großen zentralen romans, ist so ein bruch mit dem diskursiven. hier entstehen textuale formen, die den blick von der sache auf das zeichen wenden, die nicht ermitteln sondern vermitteln. die keine wahrheiten nahelegen, sondern mit wahrheitsgefügen brechen, die den blick verstellten, die nicht die dinge besprechen, sondern mit den dingen sprechen, und wo die kombination der eigentliche stil wird. papenfuß zerlegt die sprache in kleinste, monemische einheiten, die sich dann untereinander, vom text gereinigt, neu vermitteln lassen. bei döring finden digitalisierte, dialektische kettenreaktionen statt, bei denen ein wort das nächstliegende umbringt. koziol arbeitet mit der mechanik der floskeln. all diese gedichte sind produkte einer ariadnemaschine, die in der gegenwärtigen leere zu arbeiten beginnt. indem sie sich bewußt einer mechanisierten induktiven kombination bedienen, gewinnen sie die freiheit, den gegenstand zu bedenken, ohne seiner diskursiven befangenheit zu verfallen. jede sinnvoll organisierte sprache dagegen muß unentwegt ihre eigene, innere rhetorik unterbrechen und an die wirklichkeit immer wieder neu anknüpfen, um bei der wahrheit zu bleiben. nun gibt es nicht-signifikante, unbewußte sprachen, wie die der musik oder mathematik, oder auch die sprachen eines schach- oder fußballspiels, die sich selbst thematisieren und ununterbrochen nicht einer sinnstruktur, sondern ihrer inneren rhetorik folgend, mit sich selber sprechen und eine geschlossene, unableitbare ganzheit bilden. sie kopieren nicht, sie produzieren wirklichkeit. ihre logik ist nicht die diskursive logik des sinnvollen, sondern die logik ihrer morphologie, oder kosmologie, ihres phänotyps, ihres gestus oder ihrer kohärenz. es sind in wirklichkeit sprechende, aber ungesprochene sprachen, die unbewußt gewußte ordnungen bilden. „die idee der gleichheit ist in uns, bevor wir zwei dinge miteinander vergleichen“, läßt plato in seinen dialogen menon und phaidon sokrates äußern. die unbewußt gewußten ordnungen sind in uns, aber sie sind nicht gegenstandslos denkbar, nicht ohne uns etwas bestimmtes, und sei es nur eine ziffer, vorzustellen. der apfel, der newton auf das gravitationsgesetz brachte, oder die schlange, durch die kekule auf die strukturformel des benzols kam, waren freie, unbewußt gewußte ordnungen, die von verschiedenen, variablen signifikanten gegenständen besetzt wurden. man braucht einen, aber keinen bestimmten gegenstand, um diese ordnungen zu denken. du hast vorhin schon gut formuliert: „obwohl sie (die sprache) durch ihren gestus von wirklichkeit besetzt ist bzw. darauf hinausläuft, ohne in formen des realismus erstarren zu müssen“. aber da die verbale sprache ein grammatisches und lexikalisches bezugssystem sowie ein eigenes diskursives sinngefüge hat, kann sie nicht ununterbrochen einer unbewußten ordnung folgen. selbst wenn jemand nur faselt, folgt er sinnverwandt der ordnung eines, ich möchte sagen, subdiskurses. das, was im empfangssaal des sprachbewußtseins sich vorstellt, ist diskursiv, und das, was sich gleichzeitig im vorzimmer drängelt, ist subdiskursives randbewußtsein. bohr verglich den prozeß der messung im quantensystem mit der einwirkung des (diskursiven) ausdruckswillens auf das bewußtsein: das instrument ist immer größer als das zu messende objekt. oder laß es mich so sagen: die sinnvollen, orientierenden diskurse bewegen sich in interner folgerichtigkeit ausschließlich in einer bekannten, anvisierten richtung schrittweise auf einen vorher besetzten punkt B zu, obwohl der sprechende davon überzeugt ist, in einer richtung seiner freien wahl zu denken. er befindet sich auf einem drahtseil, bemüht sich lediglich, nicht abzustürzen, und glaubt aber ansonsten herr seiner entscheidung zu sein. die poetisch erneuerte sprache aber bewegt sich auf dem gerissenen, am boden verschlungenen seil. aber das ist natürlich keine konzeptart, sondern geschieht ganz selbstverständlich aus der logik unserer situation. diese zeitungen bringen ja auch einen mehlsack zum sprechen.
Hesse: mit dem wort ist aber auch eine gewisse macht verbunden. es fordert mehr als die von dir genannten sprachen der musik oder mathematik eine reaktion heraus. wenn man mit worten etwas ausspricht, denke ich, daß damit immer eine antwort gesucht wird, egal wo…
Schedlinski: ja, weil unsere sprache dialektisch mechanisiert ist. die rhetorik bleibt immer ein zweiklang, und ein zweiklang bleibt immer irgendwie eine fragefigur. erst der dreiklang, den die griechen übrigens als unharmonisch empfanden, schließt einen kreis. ein kind fragt immer, warum ist dies und warum ist das, und und und… der erwachsene meint, das kind suche eine antwort, aber es folgt nur einer rhetorik, weil der antwortende zweiklang den kreis immer offen läßt.
Hesse: es fällt mir auf, daß es von dir gedichte gibt, die ähnlich funktionieren, wo ständig sätze sich aneinanderreihen, wie z.b. „das fenster ist geöffnet / der hund bellt nicht / das wetter ist ernst / die menschen sind sterblich“ usf.
Schedlinski: dem liegt vielleicht die faszination kindlichen schauens zugrunde, in dem die dinge sind, wie sie sind, ungestört durch die vorstellung, wie sie sein sollen oder wo sie hingehören. oder aber es ist eine bäuerliche sicht – wie könnte einer dem winter widersprechen? auf jeden fall zeigen die dinge dann, daß sie selbständig über keinen sinn verfügen, und das beruhigt mich.
Hesse: diese existenz soll in den texten deutlich werden? oder warum holst du sie in ein medium, das festschreibt? hat sie sich damit nicht verflüchtigt?
Schedlinski: ich erlebe szenen, sätze, situationen, und die möchte ich aufschreiben, auch, oder vielleicht gerade, weil sie ohne zusammenhang, weil sie von texten vereinsamt sind. wenn sich nur ein direkter bezug zu mir herstellt, wird mit der zeit vieles sagbar, und oft stellt sich hinterher beim schreiben heraus, worin der fehlende zusammenhang bestand. das ergibt dann eine ruhige kondensation, keine verflüchtigung. oder ist sprache etwa nur in einem orientierenden, von vornherein sinnvoll geordneten text vor verflüchtigung zu bewahren?
Hesse: so prinzipiell gefragt sicherlich nicht, aber ist es vielleicht möglich, durch schreiben aus seiner eigenen befangenheit, die wiederum eine existentielle ist, herauszutreten, um nicht nur daneben zu stehen, sondern auch daneben bestehen zu können?
Schedlinski: ja, diese befangenheit ist in der tat eine existentielle. der schamane, der durch schneewüsten nomadisiert, sagt: „der mensch besteht aus einer seele, einem körper und einem namen“. was wir alles mit unserem namen unterschreiben. ist es nicht absurd, jemandem „beim wort zu nehmen“, als wäre sein wort etwas signifikanteres als seine frisur? stefan döring schreibt nur gedichte unter seinem namen, alles andere pseudonym. das ist eine einleuchtende konsequenz. vielleicht bin ich ein verkappter existenzialist, aber ich ziehe es vor, gerade in den theoretischen texten die illusion einer identität zu bewahren. beim gedicht dagegen gerate ich an einen punkt, wo es egal ist, ich zu sagen oder nicht, an dem ich das gefühl habe, selbst überhaupt nichts dafür getan zu haben, wo der text selbständig einen purzelbaum schlägt und ich mich zusehends freuen oder verblüffen lassen kann.
Hesse: das ist dann der punkt, wo du objekt deiner selbst bist?
Schedlinski: ja, das ist wie bei einem alchimistischen versuch, bei dem einer stoffe zueinander bringt und eine völlig unerwartete reaktion in gang kommt.
Hesse: die sich aber steuern läßt?
Schedlinski: ich habe eine ungefähre vorstellung von einem gedicht, die zunächst als freie, von konkreten inhalten unbestimmte figur existiert und die durch ein paar worte oder zeilen skizziert ist. die schreibe ich auf und lege den zettel in eine mappe. dann kommt aus den unterschiedlichsten realien sprache hinzu, die die figur, die mir vorschwebte, fixiert oder verwandelt, auf jeden fall aber klarer erscheinen läßt. meistens sind das worte oder sätze, die ich irgendwo aufschnappe, nur selten kommen mir selber worte in den sinn. die figur produziert induktiv kaum worte, die worte kommen von außen hinzu.
Hesse: setzt du dich, um die figur zu erreichen, bestimmten gegebenheiten aus?
Schedlinski: ich tue nichts, was ich ansonsten nicht auch tun würde. worte sind ja überall.
Hesse: ist es der zufall, der das gedicht formt?
Schedlinski: natürlich auch der zufall, wenn er sich verwenden läßt. vieles ergibt sich aus dem spiel mit dem sinn, den die worte aus ihrem zuhause in irgendwelchen allgemein bekannten texten mitbringen, weniger aus dem spiel mit ihrer zeichenhaftigkeit. aber nichts ergibt sich aus dem leeren blatt heraus, auch der zufall denkt sich was dabei. doch ich thematisiere auch, schreibe, wie du weißt, mitunter auch narrative, konstruierte gedichte, wenn nur irgendwie diese aufdringliche sinnverwandtschaft der wörter dabei draufgeht oder zumindest zerstritten wird.
Hesse: laß uns von hier aus noch einmal an den ausgangspunkt unseres gespräches zurückkehren. kann der dichter über seine dichtung, die wie so vieles nur durch ihr nicht sterben können existiert, noch verantwortung zum handeln übernehmen, obwohl es, wie du sagst: nur eine fiktion sein kann, etwas ändern zu wollen?
Schedlinski: da kehren wir in der tat zum ausgangspunkt zurück. ich sprach vorhin von der hermetik der diskurse, die ganze völkerstämme ausrotten kann, so mächtig ist ihre stringenz. jeder wahrheitsdiskurs avisiert eine richtung, eine lösung, ein ziel, einen archimedischen blickpunkt, oder einen kulminationspunkt, von dem aus er wiederum deduziert. um etwas zu ändern, muß ich mich, entgegen meiner erfahrung, an diesen punkt versetzen und mir etwas ausdenken, was es in wirklichkeit nicht gibt. in der wirklichkeit gibt es nur richtiges und gegenwärtig anwesendes. in der wirklichkeit gibt es nichts, was es nicht gibt. nur die fiktion von etwas unrichtigem oder abwesendem kann etwas in die welt setzen oder berichtigen wollen. das erfordert eine spaltung, weil die fiktive, antithetische form des diskurses nur in einer psychohygienischen trennung vom objekt ihres gegenstandes funktioniert, dem das subjekt seine identität opfert. das subjekt ist in psychischer negativität gespalten. dieser welle-korpuskeldualismus des fiktiven denkens durchzieht, schon lange bevor bohr ihn am licht entdeckt hat, das abendländische denken mit fataler unvermeidlichkeit. das leben ging einst durch den animistischen menschen, heute geht der mensch durchs leben. sein diskurs geht seiner wirklichkeit voraus. diese funktionalität ist dualistische identität. das abendland beginnt mit sokrates zu fragen, ob man überhaupt handeln könne, und alles was wir abendländisches denken nennen, ist selbstverständlichkeit und individualismus. die ausführende gewalt des individums ist in ihm der wille und außer ihm die macht. im willen wurde der körper bewußt, und in der macht die gesellschaft. gymnastik, militärischer drill, sport, nacktheit, sexualitätsaufwertung, waren effekte des willens gegenüber dem körper. inquisition, faschismus, terror, waren effekte der macht gegenüber der gesellschaft. willen und macht befinden sich stets im widerstand zu körper und gesellschaft. dieser widerstand ist, bewußt oder unbewußt, immer somatisch. die mittelalterlichen veitstänze oder die hysterieausbrüche des 19. jahrhunderts (kurz vor den großen manieristischen epochen) waren sprachlose, somatische widerstände des ausgegrenzten, ohne vom diskursiven bewußtsein der individuen übernommen zu werden. sie waren strategien ohne diskurs, deren intelligibilität in der kontinuität ihrer zeit natürlich außerhalb ihres bewußtseins blieb, und wären sie bewußt geworden, hätten sie nicht stattfinden können. die bewußten diskurse des widerstandes dagegen, z.b. die texte der revolutionen, verstehen sich selbst als diskontinuierlich, als antithetisch, als bruch mit den bestehenden, obwohl sie, die form verrät es, stets die bestehenden machtverhältnisse rekonstruieren. sie treten gegen eine bestimmte herrschaft an, nicht aber gegen bestehende herrschaftsmechanismen. sobald ein widerstand sich diskursiv bewußt wird, übernimmt er die strategien seiner zeit und wird blind gegenüber seinen eigenen ausgrenzungen. gödel spricht in einem seiner theoreme von der unmöglichkeit, alle zustände eines systems in der sprache dieses systems zu beschreiben. das wäre so, als wolle sich jemand an den eigenen haaren heraufziehen. was ich sagen will ist, es gibt keinen diskurs des widerstandes, der nicht die dialektische negation des bestehenden wäre, oder aber sprachlos im somatischen verbliebe. brigitte bardot z.b. verkörperte unbewußt eine antwort auf die sexuellen fragen der 60er jahre. alle wollten so aussehen. heute wäre sie als symbol- oder identifikationsfigur nicht mehr interessant. selbst der kleverste produzent kann keine bardot erfinden, wenn sie nicht an der zeit ist, denn es gibt keine wirkliche diskontinuität. vielmehr muß eine wahrheit, da sie nur im besitz ihrer gegenwahrheit, in dieser dialektischen negativität, sie selbst sein kann, alle außenwahrheiten assimilieren. es gibt keinen diskurs der veränderung, der nicht aufhörte, sich durch unmittelbare positivität definieren zu können. er verfremdet sich in seiner dialektischen zusammengehörigkeit. so ist es sklavisch und irreal, einem wahrheits diskurs seine gegenwahrheit an die seite zu stellen, die er selbst produziert. jede antipolitik ist selbstverständlich politisch, jede antikultur ist kultiviert, jede antiästhetik ist auch ästhetisch. der antithetische widerstandsdiskurs ist ein verhindertes gesetzgebungsorgan, das sich seinerseits hermetisiert und außenwelten schafft. produktiver ist es, nicht auf der seite des rechts oder der ordnung zu argumentieren, sondern der diskursiv ausgeübten macht das gegenwärtig ausgegrenzte, entwertete, verdrängte, ignorierte, nicht gebrauchte, sprachlose und disqualifizierte einzuwenden), dadurch, daß wir beharrlich wiederholen: „die dinge sind, wie sie sind!“ ich meine, die kunst hat eine verantwortung gegenüber dem sprachlosen, nicht dem sollenden, sondern dem bestehenden gegenüber. sie hat nicht den bruch zu formulieren, sondern die gebrochene sprache selbst, sie hat nicht mitzureden, sondern das schweigen zu artikulieren, etwa, wie der, der da flugblätter verteilte, und, den die polizei, als sie ihn festnahm und bemerkte, daß auf den blättern nichts geschrieben stand, fragte, wozu er denn leere blätter verteilte, antwortete: es wüßte doch sowieso jeder.
Hesse: das ist natürlich auch eine die situation des widerstands verdeutlichende provokation… probleme, die in deinen texten ebenfalls außerhalb einer lösung thematisiert werden, um ihre antwort zu erfahren, sind aber immer wieder von einer dialektischen „natur“ (sprache und denken – wahrheit und wirklichkeit) geprägt. ihrer realistischen darstellung begegnest du dabei mit den konsequenzen aus der feststellung „ich kann nicht dialektisch denken“, dem wiederum deine texte widersprechen. die unmöglichkeit, dialektisch zu denken, bzw. die unmöglichkeit, dialektisch zu denken, ist das die eingestandene aufgabe, worin das dialektische denken schreibend besteht, und werden so die geheimen gesetze des sagens transparent?
Schedlinski: ich weiß nicht, ob man von dialektischer „natur“ sprechen kann. das dialektische denken bringt ja dinge in ein lineares nacheinander, die eigentlich nebeneinander existieren, kann also unmöglich real sein.
Hesse: was wohl auch ein problem des schreibens ist. die dinge existieren nebeneinander, und du bist gezwungen, sie in ihrer literarischen form wort für wort aneinander zu reihen.
Schedlinski: ja, die verbale sprache ist einfach zu wenig kohärent, um im bewußtsein viele dinge in vielerlei beziehungen zueinander gleichzeitig vorzustellen, wie es z.b. in einem bild möglich ist. so entsteht auch der eindruck, die vielen sprachwahrheiten seien teil einer wahrheit, die man nur synoptisch lesen müsse, aber es gibt diese summe nicht, wie es keinen wald und keinen baum gibt, sondern nur eine fichte, eine birke usw. nur das bild kann dieses paradox lösen, indem es alles nennt, ohne es zu addieren. deshalb bedarf die sprache ganz einfacher logischer figuren, wie der dialektik, wenn-dann-beziehungen, logischen schleifen, usw. ihre schlußweise ist syntaktisch, das wissen aber ist semantisch.
Hesse: ist deine schreibweise ein ergebnis von konzeptionellen oder anders gearteten überlegungen?
Schedlinski: nein. wie brigitte bardot entstand sie nicht aus der logik eines produzenten, sondern aus der logik der situation in einer zeit.
Hesse: es läßt sich (leider) nicht leugnen, daß das schreiben u.a. an worte gebunden ist, und moderne dichtung z.t. versucht dieser „vollendung“ zu entgehen. hat dieser wahn sinn? und ist er, indem das verlangen der versuchung erliegt, letztendlich eine heilende, weil befreiende angelegenheit?
Schedlinski: das wort „vollendung“ bereitet mir ähnliche schwierigkeiten wie vorhin das wort „verflüchtigung“. wenn du damit auf die absurde identität mit dem geschriebenen anspielst, bin ich einverstanden. aber das ist ja schon oft genug gesagt worden, und ich halte die völlige absage an die aussage für ebenso mystisch wie den real existierenden realismus. ich denke schon, daß man bestimmte dinge beim namen nennen kann, ohne „vollendeten wahnsinn“ zu produzieren. ich will es so erklären: ich litt lange zeit unter der beängstigenden vorstellung, mir würde die wohnung abbrennen, oder meine texte würden auf irgend eine andere weise verschwinden. das wäre so, als hätte ich mein gedächtnis verloren. ich glaubte, ich müßte aufhören zu schreiben. schon in den ersten schuljahren schrieb ich in ein buch, das ich stets bei mir trug, alles was ich glaubte, mir unbedingt merken zu müssen. zum beispiel, daß 18% aller brücken der welt einsturzgefährdet sind, oder daß ploog für die grüne meerkatze 36 klar unterscheidbare laute nachweisen konnte. noch heute führe ich solche bücher, neulich schrieb ich mir auf, daß ein massenmörder in philadelphia sich durch den gleichen knoten verriet, den er um seine opfer und um seine weihnachtspäckchen schnürte. manchmal, nachdem ich gesoffen habe, fürchte ich am anderen tag, etwas wichtiges vergessen zu haben. dann zähle ich die kontinente auf. ich stellte fest, daß ich mir all diese zusammenhanglosen dinge, die ich mir doch merken wollte, nicht merken konnte, und dann fiel mir auf, daß ihr phänomenologischer, sachlicher zusammenhang ein ganz anderer ist, als der, nach dem mein gedächtnis und mein notizbuch sie zuordnet. ich hatte z.b. immer versucht, hygieneartikel, büro- und schreibutensilien und werkzeuge voneinander zu sortieren. es ärgerte mich, daß das unmöglich war. jetzt stört es mich nicht mehr. das heißt nicht, daß ich alles durcheinanderbringe, – eine bestimmte ordnung stellt sich immer her, doch die habe ich mir nicht ausgedacht. dir wird aufgefallen sein, daß ich sehr viel über fiktionen rede, über die „häuslichkeit der diskurse“. ich bin damit sehr beschäftigt, und dazu habe ich allen grund, denn ich bin jahrelang mit den abenteuerlichsten, skandalösesten und verrücktesten möblierungen im kopf herumgelaufen. ich bin darin aufgewachsen. das resultat war diese leere im kopf, die sich einstellt, wenn das system nur noch sich selbst wiederholt, wenn man auf dem schlauch steht, wenn einem nichts mehr einfällt. ähnlich wie kolbe beklagte ich meinen eigenen eklektizismus, bis ich begriff, daß nicht das wissen fragmentarisch ist, sondern die durchgliederung des wissens ist fragmentarisiert durch die totalität der texte. ich bemerkte, daß man einen, aber keinen bestimmten gegenstand braucht, um die wahrheit zu sagen. in diesem sinne hat die stilisierung der kombination, der „geheimen ordnung“, schon etwas mit dem klassischen begriff der „vollendung“ zu tun, denn die figur, die ich meine, ist sehr konkret und real, und das soll sie auch ausgesprochen bleiben. ich bin durchaus für verständlichkeit, sogar für gemeinverständlichkeit. mitunter höre ich den vorwurf, ich würde zu theoretisch denken. aber das ist nicht mein problem. für mich existieren diese kategorien nicht mehr. daß das theoretische und das poetische einander ausschließen, kann ja nur daran liegen, daß eines das andere produziert. nämlich dadurch, daß das theoretische immer etwas unerklärliches hinterläßt, das gemeinhin für dunkel gehalten wird. ich wähle die form des textes, die sich mir anbietet, mich auszudrücken. es geht um das problem, vogel oder käfig sein.
Hesse: versuchst du dabei auch, aus einer sprache das denken des denkens zu veranstalten und manchmal entstehen dabei gedichte?
Schedlinski: vorhin sprach ich von der aufgabe des sinns zugunsten des zeichens. der absolute phänotyp ist natürlich genauso illusorisch wie ein sinnerschöpfender determinismus. weder kann man einen gegenstand ganz mit sinn erfüllen, noch kann die sprache gänzlich sinnlos operieren. es gibt keine rhetorik im leerlauf und keine ganze wahrheit, keine induktion ohne deduktion und keine deduktion ohne induktion. der knecht der zeichen kann nicht herr der wahrheit sein, und der herr der wahrheit müsste zeichen knechten. ein „denken des denkens“ wäre in jedem fall künstliche intelligenz.
Hesse: um an die vorherige frage anzuknüpfen. du formulierst in einer vielzahl von gedichten poetische ansichten im sinne von meinungen, „auf der suche nach worten“, von verlangen zu verlangen, „bei der wahl einer tube zahnpasta“. ist das gedicht in besonderer weise geeignet, von diesen dingen zu sprechen?
Schedlinski: das liegt wohl daran, daß ich weniger mit den worten als mit den wörtern, weniger mit ihrer zeichenhaften natur, als mit ihren sinnfragmenten arbeite, die sie aus allen möglichen textualen zusammenhängen mitbringen. aber das sind ja nicht meine texte, und ich sage ja auch nicht meine meinung, sondern dies und jenes, was man so meinen könnte. ich sage alles, was einer hören will, der seinen text über meinen legt. meinungen, wie du es nennst, formuliere ich nur, um sie aneinander aufzureiben. auch dialektische formen benutze ich irreführend.
Hesse: es heißt bei dir: „mehr als wirklich ist / sprache die niemand sagt / sie ist nicht poetisch“. ist sie also keine begegnung mit dem imaginären, der phantasie, dem ort des verwandeins, oder dem heulen der sirenen?
Schedlinski: nicht die wirklichkeit ist unverständlich, sondern die sprache, mit der wir sie beschreiben. imaginäres kommt in unserer sprache nicht zum schein vor, sondern als übersetzungsfehler zum vorschein. imaginäres entsteht, weil die wahrheit die realität nicht bewältigt, weil die wahrheit imaginär ist, denn sie imaginiert, daß sie sie bewältigt, die wahrheitsdiskurse glauben, die wirklichkeit würde sinnvoller, wenn man sie gut durchgliedert. das wissen wird organisiert, damit kontinuität entsteht. das diskontinuierliche, unregelmäßige, widersprechende, unbrauchbare und nicht-organisierbare wird zum sonderwissen, ohne eigenen diskurs. der wahnsinn, die gewalt, das perverse und entartete z.b. hat keinen eigenen diskurs. die wirklichkeit aber besteht aus allem, was wir hören und sehen. die wahrheitsdiskurse aber bestehen aus dem, was sie sagen und, in ihrer dialektik aus dem, was sie verschweigen und ausgrenzen, daher imaginieren, phantasieren, mystifizieren oder disqualifizieren müssen. so entsteht die spaltung zwischen dem erklärbaren und dem unerklärlichem, zwischen dem verstand und jenem mystischen halbschatten des interpretators. ich glaube nicht, daß es in der kunst irgendein geheimnis gibt. setz das unverständliche in einen anderen zusammenhang als zur situation, und es verliert jede bedeutung. nicht alles hat einen sinn, aber alles hat eine form, und also ist alles verständlich (von abstrakter form zu sprechen ist schwachsinn, form ist immer konkret). wir leben in der illusion, sprache würde dinge klären, entschlüsseln, aber sie ist zeichensystem und sie chiffriert, verschlüsselt die dinge, wer interpretiert, geht von der irrigen voraussetzung aus, es läge schon eine verschlüsselung vor. er hat die garderobenmarke und sucht den mantel dazu, anstatt die marke für das ding zu nehmen.
Hesse: wenn ich nicht wüßte, warum dem so ist, ich würde das für eine sehr provokante these halten…
Schedlinski: ich meine, daß das, was wir denken, wenig ist im vergleich zu dem, was wir wissen, und daß das, was wir wissen, wenig ist im vergleich zu dem, was wir ahnen. auch das müßte kunst klarmachen.
Hesse: ist die spärlichkeit, mit der man metaphern und poetischen bildern in deinen gedichten begegnet, die reaktion auf eine alltägliche bilderflut, die so täuschend echt funktioniert, wo es darum geht, mehr oder weniger zu verdeutlichen, als wirklich ist? baust du an einer bilderflucht?
Schedlinski: nein. eher schätze ich andersons sprache, die sich der bildersucht zu bedienen versteht, eine bilderflucht gegen die bilderflut – das wäre sehr programmatisch, aber das ist es nicht. meine bilderarmut ist keine bildfeindlichkeit. ich kann es nicht anders sagen, als daß ich in figuren denke.
Hesse: figuren, die keine bildhafte darstellung besitzen?
Schedlinski: die figur, die ich meine, ist nicht bildhaft. sie ist vergleichbar etwa mit dem, was man unter musikalischen oder logischen figuren versteht. es fällt mir schwer, es mit einem wort zu bezeichnen. das ist ein ähnliches problem, wie es die strukturalisten mit dem verschwommenen begriff der struktur haben, der ebenso ein morphisches phänomen bezeichnen soll.
Hesse: überschriften bieten dem gedicht neben vielen anderen einen raum ihrer entfaltung an. du verzichtest grundsätzlich darauf. deine gedichte kommen und gehen. spricht sich darin die leere ihres unbestimmten, weil stimmlosen raumes aus, in dem sie existieren, dem sie sich womöglich zusprechen?
Schedlinski: das ist schön formuliert. ich möchte es so sagen, einen raum für einen raum, eine überschrift für eine schrift zu erfinden, fiele mir schwer. aus dem text würde ein subtext. gerade die thematisierungen sind es ja, die ich für problematisch, weil für einen enzyklopädischen aberglauben halte. wie kann etwas gleichzeitig rahmen und faden sein? das macht mich konfus. ich glaube, in unserem diskurs ist dieser punkt jetzt auch fast erreicht, und wir haben ein ende gefunden, ohne am ende zu sein.
Dieses Gespräch wurde im Mai 1986 geführt.
Erschienen in: Egmont Hesse (Hrsg.): Sprache & Antwort. Stimmen und Texte einer anderen Literatur aus der DDR, S. Fischer Verlag, 1988.
„Ist das Gaststättenwesen politisch?“
Mit Bert Papenfuß-Gorek und Rainer Schedlinski sprachen Jürgen Deppe und Stefan Sprang.
Papenfuß und Schedlinski gehören zu den wichtigen Avantgarde-Autoren des sogenannten „Prenzlauer Berg“: Konzepte führte im Juni ein Gespräch mit den beiden im Wiener Café, Schönhauser Allee, Ost-Berlin. Im Anschluß an das Interview findet sich im Magazinteil ein Beitrag „Zehn plus eins gleich Öffentlichkeit“, der Einblick gibt in die Szene und die aktuellen Entwicklungen, insbesondere das Verlagsprojekt „Galrev“.
Jürgen Deppe & Stefan Sprang: Wie hat Eure literarische Arbeit begonnen? Bert, von Dir habe ich gehört, daß Du schon sehr lange schreibst, Deine ersten Texte schon mit fünfzehn gemacht hast. Was hat sich Deiner Meinung nach seitdem verändert?
Bert Papenfuß: Ich werde heute mal eine andere Version liefern. Angefangen habe ich mit vierzehn, damals war ich T.Rex-Fan und habe dann Texte übersetzt und Hermann Hesse gelesen. Jedenfalls war das eine sehr hippieske Mischung aus Pop und kitschiger Hesse-Lyrik, die ich gemacht habe. Später habe ich eine bessere Freundin gefunden, die war ein bißchen verrückt und älter. Sie hat Marx und Hölderlin gelesen. Vor allem mir laut vorgelesen. Dann, als ich mich schon von der Frau trennen wollte, habe ich in einem Antiquariat aus irgendeinem Grunde Was ist Metaphysik? von Heidegger gefunden, wahrscheinlich auf der Suche nach Hesse. Ich habe dann Heidegger gelesen und hatte damit einen gleichgewichtigen Partner in Streitgesprächen meiner Freundin gegenüber. In ihr dialektisches Vorgehen zwischen Hölderlin und Marx konnte ich Heidegger einschieben. Dazu kam noch eine erstaunliche Politisierung – und zwar eine völlig andere, eine linksradikale, eine anarchistische. Ich will nicht sagen, daß ich Anarchist geworden bin. In der Auseinandersetzung mit Heidegger hat mich die Sprache, die Sprachbehandlung unheimlich interessiert. Ich habe dann auch ganz profan anarchistische Texte gelesen, besonders alte, 19. Jhd. und Anfang dieses Jahrhunderts: Landauer, Rudolf Rocker und wie sie alle heißen, die an sich eine sehr uninteressante Sprache haben. In diesem Spannungsfeld habe ich mich bewegt. Natürlich habe ich auch Schwitters und so ein Zeugs rezipiert, nicht die russischen Futuristen. Die waren damals noch nicht sehr populär in der DDR… Klar, Dada, Schwitters usw., viel Persiflage kam noch dazu auf politische Propaganda-Sprache, Zeitungssprache. Hatte ein gutes provokatives Element. Und daraus entstanden die ersten Texte.
Rainer Schedlinski: Ja, wie war das? Ich habe Wirtschaftskaufmann gelernt, und drum habe ich für meine Abschlußarbeit eine Schreibmaschine geschenkt bekommen, um die zu Hause zu schreiben. Also fiel mir nichts Besseres ein, immer auf dieser Maschine zu tippen, also habe ich eine Erzählung geschrieben. Ich hab die heute noch, aber die ist furchtbar schlecht. Dann hab ich’s wieder vergessen für ein paar Jahre. Ich war bei der Filmdirektion, habe Öffentlichkeitsarbeit gemacht und für Zeitungen Kritiken geschrieben. Hat mir sehr gut gefallen, weil man das sehr gut verklausulieren konnte. Es haben sowieso nur bestimmte Leute gelesen. Die haben alles gedruckt, wenn es nur ein bißchen nett geklungen hat. So habe ich eine Verliebtheit zum Schreiben gekriegt. Gerade durch die Auseinandersetzung mit diesem herkömmlichen Zeitungs-Deutsch: Die ganze Kulturkritik bestand nur aus Versatzstücken. Dazu hatte ich keine Lust. So bin ich immer mehr zu lyrischen Formulierungsweisen gekommen, kam zum Gedichte-Schreiben. Als ich mich mit den Zeitungen verkrachte, habe ich halt nur noch Gedichte geschrieben. Das war die Geschichte.
Papenfuß: Na, das war ja auch mal ne andere Version.
Deppe & Sprang: Es kursiert die These – vorausgesetzt, Eure Texte sind innovativ, sind avantgardistisch –, daß eine solche Literatur nur unter repressivem Druck entstehen kann. Haben die besonderen Bedingungen in der DDR eine wichtige Rolle gespielt?
Papenfuß: Ich habe vorhin schon einige Quellen beschrieben. Es kommt auch auf den Druck an, aber natürlich auch auf die Ingredienzien. Was ist drin im Gefäß? Wenn der Druck groß ist, dann passiert viel. Es kommt viel nach außen. Das ist ja der Begriff: „Emotion“. Wenn sich das dann auch noch formulieren kann, Sprache hat, dann könnte es interessant werden. Es wird ja gesagt, das es interessant geworden ist. Ich bin auch sehr überzeugt von meinen ersten Texten. Es ist wichtig weiterzumachen, aber im Prinzip geht es dann nur noch in die Breite, ins Filigrane, ins Ornament, wird untermauert. Man ummauert. Aber man gerät immer mehr in die Gefahr, sich selbst einzumauern. Es ist eine ständige Auseinandersetzung: Maure ich mich ein, komme ich wieder raus. Gibt es Ausflüchte, oder eventuell richtige Auswege, gar richtige Wege? Was ist wichtig in diesem Zusammenhang? Die ersten Sachen sind nicht so durchgestylt, aber die Pression ist stärker, die Intensität der Emotion.
Deppe & Sprang: Noch einmal: Wie stark spielt dort die DDR-Wirklichkeit mit?
Papenfuß: … als Druckausüber…
Schedlinski: … ja, das sind ganz komplexe Situationen. Wenn man sagt, man hat T.Rex gehört oder ne Schreibmaschine gekriegt, dann nennt man nur den Anlaß, beschreibt nicht den Grund. Diese Reaktion auf die DDR-Wirklichkeit zu beschreiben; da ist ein Autor selbst überfordert. Das ist eine andere Aufgabe, theoretisch zu reflektieren. Ich habe mir auch Mühe gegeben, das rauszukriegen, aber man kann es nicht erschöpfend beantworten.
Deppe & Sprang: Als einen Ansatzpunkt für Eure Arbeit habt Ihr beide Zeitungssprache genannt, die „offizielle“ Sprache wie im Neuen Deutschland. Man kannte die Formulierungen schon vorher…
Papenfuß: … das war durchaus witzig und spritzig, formuliert, wenn man es ironisch genommen hat, die entsprechende Lesehaltung dazu hatte. Frank-Wolf Matthies hat das mal als „surrealen“ Prozeß beschrieben, den DDR-Journalismus. Das reicht aber nicht. Es muß schon ein starker Druck auf die Persönlichkeit ausgeübt werden, damit die entsprechende Haltung entsteht, kreative Äußerungen zustande kommen. Insofern spielt die politische Pression in der DDR eine Rolle. Ich kann mir auch vorstellen, in einem anderen Land zu sein, Polen, es muß nicht der Ostblock sein, es kann auch West-Deutschland sein, daß auch da die Pressionen des Überbaus auf einem lasten. Und daraus könnte auch was entstehen. Das wäre bei mir sprachlich vielleicht anders geworden.
Deppe & Sprang: Und wie stark ist der Einfluß der „Szene“ Prenzlauer Berg einzuschätzen, in der sich so viele kreative Kräfte zusammengefunden haben? Ist es ein Ghetto der kreativen Kräfte? Adolf Endler spricht von einer „Prenzlauer Berg-Connection“.
Papenfuß: Wenn die Demontage begonnen hat, dann müßte der Prozeß der Ghettoisierung jetzt einsetzen, oder vor ein, zwei Jahren eingesetzt haben. Aber erst mal mußten alle Leute herkommen, um sich hier zu treffen, zu finden und gemeinsam zu arbeiten, um das entstehen zu lassen, was man dann ironisch behandeln kann als „Prenzlauer Berg-Connection“. Wenn das installiert ist, und die Demontage beginnt, dann setzt die Ghettoisierung ein. Das ist jetzt.
Schedlinski: Ich bin ja erst viel später gekommen aufgrund dieses Mythos, der vorhanden war, und der schon 1984 zuende ging. Klar, hat sich die Szene auf die Provinz ausgewirkt. Anderson und Papenfuß kamen natürlich auch nach Magdeburg, Leipzig, Halle. Wem es da zu eng wurde, der kam nach Berlin.
Papenfuß: Magdeburg? Ich weiß gar nicht, wie es da aussieht, ich war noch nie in meinem Leben in Magdeburg.
Schedlinski: Stimmt! Damals hat Sascha für dich mitgelesen.
Papenfuß: Gut, das zu hören.
Deppe & Sprang: Es gibt in einer wissenschaftlichen Arbeit über Euch ein Zitat: „die Risse in den Wänden der Hinterhofhäuser (Anm.: des Prenzlauer Berg) erscheinen nicht selten als die Korrelate für die ,Risse‘ und ,Nöte‘ des Ichs.“
Papenfuß: das bezieht sich aber auf Uwe Kolbe! Nicht auf uns. Die Autoren gehen von Kolbe aus, in einem seiner Gedichte spielt er auf die Risse an. Der hat so eine Art mythischen Prenzlauer Berg beschrieben, mit zerfallenen Häusern und schwarz gestrichenen Wohnungstüren. Wir waren da anders. Gut, man muß dran leiden. Ich habe nie daran gelitten. Ich habe nie an Deutschland gelitten. Dichtung hat nur ein Thema, aber das kann kein zerissenes Land sein oder die Stasi. Das übt Einfluß aus, bietet mit Sprachmaterial, ein Reservoir, aus dem man schöpfen kann. Und wenn man aus diesem Reservoir schöpft, dann sagt man im nachhinein: das ist politische Lyrik. Aber es ist nur ein Aspekt. Wer ihn nur nutzt, ist dann vielleicht Spezialist, aber auf die Dauer langweilig.
Deppe & Sprang: Sind Eure Texte politisch?
Papenfuß: Ja, in diesem Sinne sind sie politisch, wenn sie aus diesem Reservoir schöpfen. Es wird zunehmend uninteressanter, politische Texte zu schreiben, weil das Rohmaterial, das persiflierend bearbeitet wurde, zunehmend uninteressanter wird. Die Motivation sinkt.
Schedlinski: Die Frage ist falsch gestellt, Man könnte auch fragen: Ist das Gaststättenwesen politisch? Ist doch auch politisch, als Zusammenkunftsort, aber nicht von sich aus.
Deppe & Sprang: Wie sieht Euer Verhältnis zur Öffentlichkeit aus?
Schedlinski: Wir haben Veranstaltungen gemacht, in Kirchen gelesen. Natürlich haben wir auch an politischen Veranstaltungen teilgenommen, z.B. wenn welche im Knast saßen, bei Bittgottesdiensten gelesen. Es gab bei uns keine Verabschiedung aus gesellschaftlichen Zusammenhängen, man hat sie wahrgenommen, war nicht blind. Aber man kann sich darauf nicht reduzieren lassen, das ist dann ein Verarmung.
Papenfuß: Ich möchte auch noch was sagen zu diesem Polit-Zeugs da. Wenn man sich in den ständigen Clinch begibt mit dem Überbau, dann nimmt es so eine Form an von Haßliebe oder Verliebtheit. Es ist schwer, da wieder rauszukommen. Man beißt sich fest an der politischen Auseinandersetzung, mauert sich ein, wie ich sagte, beißt sich fest an der Persiflage, Entlarvung.
Schedlinski: Einen Tee bitte!
Papenfuß: Ich hätte gerne einen Whisky pur.
Schedlinski: … ach, dann bringen Sie mir auch einen Whisky. Und den Tee trotzdem.
Deppe & Sprang: Es gibt eine wunderbare Formel von Christa Wolf: „Tatenarm, aber gedankenvoll“. So war es bei Euch also nicht?
Schedlinski: Überhaupt nicht. Wir haben gerade sehr praktisch gearbeitet…
Papenfuß: … waren sehr umtriebig…
Schedlinski: … im Gegensatz zu anderen Autoren, die nur am Schreibtisch gearbeitet haben. Haben selbst gedruckt, hergestellt, die Buchbindearbeiten gemacht.
Papenfuß: Wir haben auch viel mit anderen Sparten zusammengearbeitet, Musikern, Malern, das war durchaus nicht tatenarm.
Schedlinski: Der Prenzlauer Berg bestand ja bloß zum geringsten Teil aus Dichtern. Das waren ganz andere Leute, mit denen wir zu tun hatten…
Papenfuß: … Trinker zumeist…
Schedlinski: … es war eine ganz vielseitige Mischung von Leuten, die eines verband, nämlich, daß sie irgendwie im Prenzlauer Berg eine Möglichkeit sahen, so unabhängig wie möglich zu leben.
Deppe & Sprang: Und wie hat das Publikum reagiert, Eure Texte, Lesungen, Aktionen aufgenommen?
Papenfuß: Es gab damals eine andere Haltung, zu dem was wir gemacht haben, eigentlich die klassische DDR-Haltung. Die Literaten wie Liedermacher oder andere Kritiker hatten die Aufgabe, Identifikationsmuster zu liefern, und das Publikum hat auf diese Identifikationsmuster gewartet. Selbst in meinen relativ abgefahrenen Gedichten, wie ich sie damals vorgelesen habe, war immer noch genügend Anhaltspunkt, daraus Identifikationsmuster zu destilieren. Und das ist eine weitere Mauer, die man sich selbst errichtet hat, nämlich indem man diese Erwartungshaltung erfüllt hat. Da muß man eben auch durch. Es fangt jetzt wirklich was anderes an, was ich schon im Westen kennengelernt habe, eine eher ästhetische Betrachtungsweise oder Hörensart der Texte, und nicht diese Verkrampftheit. Außerdem wird die politische Auseinandersetzung wie gesagt zunehmend uninteressanter, wobei ich immer mehrgleisig gefahren bin, ich habe ja nicht nur politische Texte geschrieben, wahrscheinlich eher weniger, eher mit Liebe oder so. Wobei es bei politischen Texten auch um Liebe geht.
Deppe & Sprang: Was fällt Dir zu Autoren wie Peter Waterhouse oder Thomas Kling ein?
Papenfuß: Das sind wunderbare Leute.
Deppe & Sprang: Wo liegt der Unterschied zu Euch? Uns fällt auf, daß Kling in seiner Sprache, in seinem Ansatz viel aggressiver, schärfer ist.
Papenfuß: In Bezug auf andere Sachen. Er reagiert, wie wir hier auf politische Muster reagiert haben, eher auf Konsummuster. In seinen Texten spielt die Reklame eine große Rolle, Konsumentensprache. Das ist in dem Sinne auch politisch. Er ist auf eine bestimmte Art aggressiver als wir. Er wird seine Gründe haben dafür.
Deppe & Sprang: Kling spricht vom „junkfood sprache“. Warum setzt ihr so radikal an der Sprache an, brecht sie auf, bis in die kleinsten Einheiten?
Papenfuß: (Schweigen) … Das kann ich jetzt komischerweise eher bei Thomas Kling erklären. Das war auch ein sehr schönes Zitat vom „junkfood sprache“. Die Errungenschaften der Konkreten Poesie sind in den Markt eingeflossen. Die Produkt- und Werbesprache geht ja sehr geschickt um mit den konkreten Techniken, die aus dieser Poesie kommen, dort geklaut wurden, meinetwegen auch pervertiert wurden. Schwitters hatte z.B. auch eine Werbeagentur. Bei uns war das wahrscheinlieh eher der Wunsch, die verordnete Sprache zu zerstückeln. Also eher analytisch an die Sache zu gehen, während der Prozeß bei Kling schon wieder synthetisch ist. Er nimmt Versatzstücke und kombiniert sie neu. Ich laß es als These stehen.
Deppe & Sprang: Rainer, Du hast auch sehr viel theoretisch gearbeitet. In Deinem Essay „Dilemma der Aufklärung“ setzt Du dem offiziellen, herrschenden Diskurs Alternativen entgegen: die literarische Sprache, den Ideolekt, die Körpersprache…
Schedlinski: Das ist alles nicht neu, ich habe nur verarbeitet, was in moderner Philosophie so rumgeistert. Gut, eigentlich aus einem Defizit heraus, das in der DDR herrscht. Es ist schon ein aufklärerischer Anspruch von mir gewesen. Damit befinde ich mich natürlich selbst in einem Dilemma, aber ich denke, daß ich das jetzt nicht mehr nötig habe, so eine Arbeit zu machen, sondern daß ich auf eine andere Art reflektieren kann. Es war tatsächlich als Erklärung nötig. Es gibt Germanisten hier in der DDR, die haben noch nie was gehört von der Postmoderne, vielleicht was gehört, aber nie was gelesen. Die fragen halt, ob der Strukturalismus dialektisch ist, oder sonen Quatsch. Da muß man von vorn anfangen, die einfachsten Sachen zu erklären.
Papenfuß: Na, das wäre ja ein schöner Titel für das Gespräch: Ob der Strukturalismus dialektisch ist, oder sonen Quatsch.
Deppe & Sprang: Gibt es denn bei Euch untereinander eine intensive theoretische Diskussion?
Schedlinski: Den eigentlichen Überbau, der das alles vereinigen würde, den gibt es bei uns nicht. Es gibt Berührungspunkte.
Papenfuß: Ich meine, wir sind ja irgendwie doch im Sozialismus aufgewachsen. Niemand von uns hat mit der Idee geliebäugelt, in der Opposition zu den Eltern, die das Ganze angerichtet haben, eine Diktatur zu errichten oder eine Sozialdemokratie. Alle Ideale gingen ja in Richtung besserer Sozialismus, Kommunismus, Anarchismus oder sowas. Ich glaube, was damit einhergeht ist eine ziemlich große Toleranz, und es gibt auch eine poetologische Diskussion bei uns wie es auch eine ideologische gibt, aber ich glaube, die basiert auf Toleranz. Um gegen eine Sache sein zu können, brauche ich einen Namen dafür, und das Ding gibt sich selbst keinen Namen. Wir müssen ihm einen Namen geben, um es ansprechbar und somit angreifbar zu machen, wenn man derartig veranlagt ist, um es beherrschbar zu machen. Ich glaube, diese Namensfindung, Namensgebung, Ansprechbarkeit ist, was in vielen Texten passiert, in den sogenannten politischen Texten. Und ich glaube, die Akzeptanz untereinander für die verschiedenen gefundenen Namen ist relativ groß. Das wird sich jetzt mehr dividieren und spezialisieren.
Schedlinski: Es ist aber mehr eine Gemeinsamkeit der Erklärungsmuster, nicht der Ideen. Diese Interpretationsgemeinsamkeit ist eine Ablehnung der herrschenden Kausalitäten. Diese sozialistische Gesellschaft ist eine deutsche Vernunftgesellschaft, die ja zurückgeht auf Fichte und solche Leute. Deshalb auch diese kulturelle Verarmung, Vulgarisierung der Geisteswissenschaften. Wenn die Wissenschaft es zugelassen hätte…
(eine Sirene) …
Papenfuß: … fünfzehn Uhr!…
Schedlinski: … wenn die Wissenschaft in der DDR auch spekulative Aspekte möglich gemacht hätte, dann wäre es vielleicht gar nicht aufs Schreiben gekommen. Die Literatur war die einzige Möglichkeit, diese sture Funktionalität zu durchbrechen, die Dinge anders zu beschreiben. Den kulturellen, symbolistischen Aspekt, den hat die einfache marxistische Ideologie nie erfaßt, genauso wie ihn die heutige Ökonomie nicht mehr erfaßt hat, die längst nicht mehr eine einfache Ökonomie des Nutzens ist oder Ökonomie des Image. Es ist ein bloßer Kalkulationsfaktor, eine kulturelle Ökonomie. Dazu waren alle rationalen, wissenschaftlichen Erklärungsmuster, die es hier gab, zu eng. Jeder, der über die Gesellschaft nachdenken wollte, ist zwangsläufig Literat geworden, denn es gab keine andere Rationalität, in der man hätte denken können.
Papenfuß: Also die westliche Gesellschaft, die medien ja alle zu. Es gibt ein breites Angebot an Konsumgütern, an kulturellen Ereignissen, wie man auch die Mauer bemalt hat. Es ist ein Phänomen, das man als horror vacui beschreiben kann. In der DDR war verboten, die Mauer zu bemalen. Es gab ein schmales Kulturangebot, also muß im Zentrum, im Individuum, etwas blühen. Vielleicht ist das der Unterschied. Wobei sie das hier auch alles zugemedient hätten, wenn sie die Möglichkeit dazu gehabt hätten. Dann wäre es schon lange so gewesen, wie es jetzt werden wird. Es hätte keine Brut gegeben, keine Blüte.
Deppe & Sprang: Die Frage: Wenn es im Individuum blüht, es aber an der Breite fehlt: Warum beschränkt ihr Euch dann nur auf die kleine literarische Form?
Papenfuß: Sagen wir so. Ich versuche es egozentrisch zu beantworten. Ich habe nie ein Interesse daran gehabt, einen Roman zu schreiben, aber wir haben sehr viele andere Sachen gemacht, die in Richtung Gesamtkunstwerk gingen, die auch nicht mehr mit kleiner Form zu beschreiben sind. Das bezieht sich auf Projekte, die wir mit Malern und Musikern zusammen gemacht haben, und nicht zu vergessen haben wir Theaterstücke geschrieben, die Überdimensionen haben, etwa die, die Sascha Anderson geschrieben hat, Opern und solche Sachen, die natürlich irgendwie eine Persiflage darstellten. Bezeichnenderweise waren das immer Zusammenarbeiten. Niemand hat sich allein, hingesetzt und so ein Ding geschrieben, das waren immer zwei, drei Leute. Stefan Döring, Sascha und ich haben z.B. ein Stück gemacht, das nicht mehr für die Bühne zu bewältigen ist, die Dimension sprengen sollte. Die Tendenz zum Roman ist relativ gering.
Deppe & Sprang: Ein Zitat von Rainer: „der verlust des klassischen intentionalen bogens, wie der form des großen zentralen romans, ist so ein bruch mit dem diskursiven.“ Steckt ein Konzept dahinter, sich in der Form zu beschränken?
Schedlinski: Konzept ist zuviel gesagt. Man hat sich nicht vorgenommen, keinen Roman zu schreiben. Die Situation gibt es nicht her. Gerade die älteren, Christa Wolf, Heiner Müller, die haben für alles eine Story. Die sagen: Der Krieg war zuende, dann waren die fuffziger Jahre und deshalb waren wir so. Das sind genau die Zusammenhänge, die Suspekt geworden sind. Das ist, was im Roman passiert. Die Figuren werden so hingequält, daß am Ende rauskommt, was rauskommt. Es wird konstruiert. Das funktioniert nicht mehr. Wenn die Zusammenhänge so einfach gewesen wären, hätte es die Revolution viel eher gegeben.
Papenfuß: Meiner Meinung nach ist ein Roman immer konstruktiv, auch im Sinne von reaktionär. Ein Roman ist viel näher am Überbau, viel mehr ein integrierbares Produkt für den Überbau als das Gedicht. So wie wir angefangen haben zu schreiben: das war, ich will nicht sagen destruktiv, aber subversiv. Und für diese Subversion gibt es nach der Wende nicht weniger Anlaß, sondern mehr, denn jetzt gibt es nicht nur dieses ganze traditionelle Zeug, mit dem wir uns in der DDR auseinandersetzen mußten, sondern auch noch diesen ganzen Konsumscheiß mit seiner perfiden Art von Politik. Insofern sehe ich bei mir nicht die Gefahr, daß ich einen Roman schreiben werde. Ich werde bei Gedichten bleiben. Kräftig sind sie vielleicht nicht, aber die Intensität ist höher. Anderson, Döring und ich planen das nächste Gesamtkunstwerk: „Faust III“. Es wird natürlich nicht „Faust III“ heißen. Ich bin dafür, es „Feist drauf“ zu nennen. Na, man merkt, welche Richtung das Ganze nehmen wird.
Deppe & Sprang: Das Stichwort Subversion: Sie untergräbt, stellt infrage. Hat das, was Ihr bisher gemacht hat, diese Kraft gehabt?
Schedlinski: Man könnte auch sagen Dekonstruktion. Es ist mehr eine analytische Arbeit, nicht einfach eine anarchische Arbeit.
Papenfuß: Ich hoffe, daß es gefruchtet hat. Wenn, dann wird es nicht fruchten, sondern es ist passiert. Irgendwo muß es eingedrungen sein. Sowas wirkt langsam. Wir werden nie wieder fünftausend Bücher von derartiger Literatur verkaufen, wie wir es bisher geschafft haben, sondern vielleicht knapp zweitausend. Aber dann für den gesamten deutschen Sprachraum.
Deppe & Sprang: Besteht aber nicht die Gefahr, daß die künftigen Käufer den ursprünglichen Ansatz vergessen und die Texte als intellektuelles Entertainment, schmackhaftes Design von Sprache konsumieren?
Schedlinski: Das ist die westliche Sicht.
Papenfuß: Was heißt westliche Sicht? Das ist die Sicht im Moment.
Schedlinski: Ja, dann muß man wirklich anders schreiben, wenn es Design wird.
Papenfuß: Irgendwie müssen wir diesen Gedanken der Subversion retten, laß mich überlegen… Das ist gepflanzt wie ein… Boogie-Trap. Vielleicht klappt es irgendwann und erschüttert eine weitere Grundfeste oder Mauer. Dann ist es gut. Wenn nicht, hat es uns selber geholfen.
Schedlinski: Wir sind auf diese Öffentlichkeit wie sie in der Bundesrepublik herrscht, nicht eingeschworen. Wir sind davon nicht abhängig. Wir haben es gelernt, anders zu existieren. Ich würde kaputtgehen unter dem Zwang, nur diese eine Öffentlichkeit meinen zu müssen, die da nunmal exisitiert und allmächtig ist.
Deppe & Sprang: In einem Interview für die Weltwoche hast Du gesagt, Rainer:
Sie haben eine Art Glasnost-Hätschelkinder aus uns gemacht, wir wurden ins offizielle Verlagsprogramm integriert, mit Privilegien ausgestattet, dürfen Reisen und Westgeld haben – und werden dadurch von den Leuten abgenabelt. Wenn wir früher in Wohnungen gelesen haben, war ganz selbstverständlich ein Publikum da. Heute fahr ich mit Bert Papenfuß zu einer vom Kulturbund organisierten Lesung an den Stadtrand und lese vor 15 Muttis vom Kulturbund. Dabei kommt natürlich nix raus. Die Wirkung von Literatur steigt nicht mit ihrer Offizialisierung. Eher im Gegenteil…
Schedlinski: … es ist einfach sinnlos geworden. Wenn ich mich auch noch um Leser kümmern muß, vielleicht auch noch um Subventionen kümmern muß, da sehe ich keinen Grund drin. Dann würde ich mich aus einem merkwürdigen Idealismus heraus engagieren. Das ist das, was ich im Westen nie verstanden habe: die machen noch ne Zeitschrift, noch nen Treffen, und es wird nicht gebraucht. Als wenn das nur ne Beschäftigung wäre um einer Sache willen. Da kriege ich dann ein ganz komisches Gefühl.
Deppe & Sprang: Konfrontation mit einem weiteren Zitat. In „Sichtbarkeit der Zeichen“ schreibst Du, Rainer:
es ist also ein frommer wunsch, schlechtin anzunehmen, durch konkretion und verringerung der bedeutungen, durch die poetik des fehlers und der brechung würde der überbau unterwandert oder gar hinfällig – er wird tatsächlich umso mehr beansprucht, denn es gibt natürlich im grunde keine eigensprache der dinge.
Verweist das nicht schon auf das Scheitern Deines Schreibens?
Schedlinski: Ne, überhaupt nicht. Ich habe da mit Bert schon immer Differenzen, worin der Sinn besteht, nach dem etymologischen Kern zu suchen. Selbst wenn der etymologisch richtig ist, ist der ja sozial nicht richtig. Man kann ihn anbieten als Deutungsmuster, aber da ist er ja nicht mehr wert als jedes andere Deutungsmuster. Die etymologische Wahrheit hat keine Berechtigung, jedenfalls keine gegenwärtige. Auch die phonetische Konkretion hat eigentlich keine Wahrheitsberechtigung. Wahrheitsberechtigung hat nur das, was unter bestimmten Menschen als Verabredung gilt. Das ist sehr variabel. Ich glaube nicht, daß man eine Sprache zu irgendeiner Wahrheit zurückführen kann, da gibt es kein Mittel, selbst die Konkretion nicht oder die Zergliederung. Man kommt der Verabredung nicht bei. Wenn man die Bedeutung noch so sehr einklagt, oder sich drüber beschwert. Sie bleibt bestehen. Da kann man nichts machen.
Deppe & Sprang: Bert, willst Du darauf was erwidern?
Papenfuß: Ja, ich seh’s natürlich völlig anders. Ich versuche schon herausfinden: will diese Tasse abgewaschen werden, was sagt der Tisch, was würde der Polizist dazu sagen. Das interessiert mich schon. Ich finde, daß alles eine Sprache hat. Es ist natürlich ein sehr subjektives Medium, aber ich versuche es zu artikulieren. Es muß jemand dasein, der das ab und zu zusammenfaßt. Sei es auch nur, um es in einen anderen Kontext zu stellen, um wiederum Zweifel zu erleben oder Zwiesprache.
Schedlinski: Ja, aber dieser andere Kontext ist gut gemeint, aber immer unwahr, selbst wenn er geschichtlich oder sonstwie noch so wahr ist. Wahr ist nur der Kontext, in dem ein Wort tatsächlich gebraucht wird. Nur der ist gültig. Wahr ist das falsche Wort: gültig. Gültig ist immer nur eine Variante.
Papenfuß: Gültig ist gar nichts. Nichts hat Wert.
Schedlinski: Aber sozial gesehen. Kannst Du nichts dagegen machen. Da kann für Dich „Vernunft“ tausendmal von „nehmen“ kommen von „vernommen“, das Wort wird nun mal anders gebraucht.
Papenfuß: Ich gebrauche es nunmal anders.
Schedlinski: Dieser Gebrauch wie er existiert ist der einzig gültige. Du kannst es nur anbieten. Alles andere ist Aberglaube.
Papenfuß: Natürlich. Lyrik ist ein Kommunikationsangebot. Es wird niemanden aufgezwungen. Du kannst es nehmen oder lassen.
Schedlinski: Ja, aber mehr nicht. Dieses Beharren auf einer anderen Gültigkeit, das ich bei Dir feststelle, finde ich irreal.
Papenfuß: Ich beharre nicht darauf. Ich biete es an.
Schedlinski: Gut, es ist Angebot, aber mehr nicht.
Papenfuß: Gedichte sind nicht beharrlich, sie bieten an. Und zweifeln halt. Und Zweifel ist eine produktive Kraft.
Deppe & Sprang: Rainer, wie umgehst Du das Dilemma Deiner eigenen Texte. Wie bewältigst Du es sprachlich?
Schedlinski: Na, man kann die Variabilität natürlich heraustellen, damit arbeiten, aber das ist nur ein Spiel. Es kommt aber sehr konkret aus der DDR-Situation, in der die Sprache durch ihre Verhärtung einfach zum Zerstückeln und Spielen und Variieren angeregt hat.
Papenfuß: Also ich möchte noch ergänzen, daß mich natürlich nicht nur die etymologische Bedeutung eines Wortes interessiert, sondern die etymologische Bedeutung im Zusammenhang im Kontext der „gültigen“ Bedeutungen. Mich interessiert, was sich im Spannungsfeld zwischen der etymologischen Bedeutung und der offiziellen abspielt.
Schedlinski: Aber wenn Du in Diskussionen argumentierst, das habe ich öfter erlebt, dann argumentierst Du mit der etymologischen Bedeutung, die aber kein Mensch wissen will. Du kannst nicht jemanden die Vernunft austreiben, in dem du ihm sagst, das kommt vom „Vernommenen“.
Deppe & Sprang: Wieder ein Zitat, diesmal von Bert aus dem „arianrhod von der überdosis“:
es war nicht meine die
unumstößlich klingt sie aus, die ära des aktiven wortspiels
es wurde zu ernst.
Das klingt nach Verabschiedung. Was wurde zu ernst?
Papenfuß: (Schweigen) … Ich habe die Konkrete Poesie eigentlich immer so im Dilemma erlebt. Ich hatte immer Schwierigkeiten, die Konkrete Poesie als Endprodukt anzusehen. Was mich daran interessierte, war die Methode der Sprachverwandlung. Diese Methode sollte in den Text mit einfließen, weil es eben eine weitere Methode ist. Und ich wollte eben immer verhindern, daß es sich verselbständigt und zu einer Art Sprachspiel wird wie Pastior und diese Leute. Und ich habe bei uns die Gefahr gesehen, zu dieser Verselbständigung. Ich meine, es ist nicht so ernst zu nehmen. Danach habe ich ja weiter Gedichte geschrieben und mich nicht auf Epik gestürzt, Romane oder sowas.
Konzepte: Nochmal Salz in die gleiche Wunde. Ein Vorwurf gegen Euch ist formuliert worden, formuliert oder mitgetragen auch von Uwe Kolbe: Verzicht auf Aussage, die Abwesenheit von Sinn und die Apostrophierung der Sprachstruktur wird zum alleinigen Inhalt eines poetischen Textes, so die Stichworte. L’art pour l’art?
Schedlinski: Das ist ein grundsätzliches Mißverständnis, zu dem man eigentlich nichts weiter sagen muß, Quatsch. Wenn die Form gesiegt hat…
Papenfuß: … meint der uns? Das kann nicht sein.
Schedlinski: Doch, ich kenne sowas von ihm. L’art pour l’art: Das kann man von dem xten Tschernobyl-Gedicht behaupten, das geschrieben wird.
Papenfuß: Wenn man bedenkt, daß es in Gedichten immer nur um das Gleiche geht, dann wäre es l’art pour l’art, irgendwelche politischen Gedichte oder gar ökologischen Prozesse in dem Sinne zu pervertieren, daß ich die so als ein Scheinthema hinstelle. Dann könnte ich mich insbesondere hinstellen und sagen, die politische Lyrik ist l’art pour l’art.
Deppe & Sprang: Wir haben immer wieder über das gesprochen, was sich in Zukunft ändern wird. Das sprachliche Reservoir, aus dem zu schöpfen ist, wird sich ändern. Wo geht es lang, inhaltlich, literarisch?
(Schweigen)
Schedlinski: Ja, wenn man sich das so vornehmen könnte, was man im nächsten Jahr schreibt… Kann man nicht erklären. Da kann ich nur das machen, was die Situation hergibt. Man kann es nicht planen. Wäre ja schlimm, wenn man es täte. Da würde man an den Bedürfnissen vorbei schreiben.
Papenfuß: Ich weiß es auch nicht, ich kann schlecht Ausblicke geben. Ich weiß nur, daß es in meinem Leben so funktioniert, daß ich mich verirre – und zwar permanent – und dann immer ein Stück zurückgehe, dann ein Stück gehe, mich wieder verirre, wieder ein Stück zurückgehe… Es gibt keinen Ausweg – und auch keinen Ausblick.
Deppe & Sprang: Jan Faktor spricht vom „Abtreten des Wortspiels an die Werbeagenturen“. Könnte die Medien-, Computer-, Werbewirklichkeit, die Sprache dort, ein Thema für Euch sein? War das für Euch nicht schon ohnehin ein Thema?
Schedlinski: Na, die Unbefangenheit, da völlig neu drauf zu reagieren, die muß eine andere Generation haben, das können wir nicht mehr…
Papenfuß: Ich habe bis heute keinen Fernseher. Also mich interessiert das nicht. Überhaupt nicht. Ich mache manchmal was für’s Fernsehen. Aber ich hab’s mir noch nie angesehen. Manchmal ist es sinnvoll: dann gibt’s ein paar hundert Mark dafür. Manchmal reden sie mir ein, das wäre gut für den Verkauf meiner Bücher. Und sie schicken auch immer Frauen zu mir. Wenn die Frauen nett sind, o.k., dann mach ich’s, wenn nicht, dann nicht. Es interessiert mich überhaupt nicht. Es interessiert mich vielmehr, wann ich meine Schreibmaschine wegschmeiße. Ich schreibe viel lieber mit der Hand, mache so kleine Zeichnungen…
Deppe & Sprang: Um noch einmal Uwe Kolbe zu strapazieren. Er hat für eure Generation das Wort „Hineingeborensein“ geprägt. Damit nochmals die Frage verbunden: Wie wird sich die Veränderung zu einer gesamtdeutschen Realtität auswirken? Seid ihr jetzt zu den „Herausgeborenen“ geworden?
Papenfuß: Gut, Kolbe hat diesen Begriff geprägt. Wenn er zu den Glücklichen gehört, die „hineingeboren“ sind, dann ist es o.k., ich kann es gut tolerieren. Ich muß jedenfalls ein Leben lang an meiner Individuation arbeiten. Gut, wenn er es hinter sich hat, dann ist es o.k.. Aber was will er da? Also ich arbeite nach wie vor an meiner „Gebärdung“.
Deppe & Sprang: Und die neue Realität?
Schedlinski: Gut, bei den „Feinden“ hat sich nicht viel geändert. Die sind immer noch die gleichen geblieben. Also von Dickel zu Diestel, diesem neuen Innenminister, ist kein großer Schritt. Also, was hat sich da geändert? Außer, daß die Mauer offen ist, aber die war für uns schon vorher offen. Man wird sich vielleicht mehr mit den Nazis beschäftigen.
Deppe & Sprang: Aber an eurer Umgebung wird sich allerhand ändern. Die neuen Supermarktketten…
Schedlinski: … Klebt nur bunte Pappe dran. War macht das für einen Unterschied?
Papenfuß: Ich glaube, wir bleiben sehr ungeschickte Konsumenten. Wir kennen ja den Laden seit ein paar Jahren, waren sehr oft drüben, haben längere Zeit dort gelebt… Bringt nichts.
Deppe & Sprang: Das Schlußwort soll Rolf Dieter Brinkmann haben:
Ich denke, daß das Gedicht die geeignetste Form ist, spontan erfaßte Vorgänge und Bewegungen, eine nur in einem Augenblick sich deutlich zeigende Empfindlichkeitkonkret als snap-shot festzuhalten.
Ein Schlußwort in Eurem Sinne?
Schedlinski: Na, gut, ja.
Papenfuß: Ja, nur das der snap-shot noch einen Drall haben müßte, einen Drang, damit er sich verselbständigt.
Konzepte, 9/1990
Heute Vormittag wurde der Dichter
Rainer Schedlinski zu Grabe getragen, er starb am 6. September im Alter von 62 Jahren. Dass seine Person nicht unumstritten sein kann, das ist klar. Doch ich sah ihn vor ungefähr einem dreiviertel Jahr ein letztes Mal in der Kulturkaschemme ex-Rumbalotte/WATT. Wir unterhielten uns und unvermittelt meinte Rainer, daß er über einen aktengestützten Vorwurf, den ich ihm einmal gemacht hätte, noch einmal nachgedacht hätte. Er würde mir im Nachhinein Recht geben.
Damit schob sich vor unser problematisches Verhältnis wieder die Integrationsfigur, die Rainer Schedlinski für mich in den 80er-Jahren war. Er hat mich als erster in der Ariadnefabrik veröffentlicht und dafür gesorgt, daß ich sie mit vervielfältigt habe, was mir auch ein Ein- bzw. Auskommen bescherte. Er hat mich unter anderem mit Detlef Opitz bekannt gemacht, ihm verdanke ich nicht zuletzt die Integration in eine Szene, die mich geprägt hat. In der Produktion meiner eigenen Samisdat-Editionen hat er mich unterstützt. Auf mich hat der Struktualismus in seiner Sachlichkeit nie denselben Sog ausgeübt wie auf ihn. Dennoch habe ich auch vom Struktualisten Rainer Schedlinski gelernt, die Dinge auf ihren Kern zurückzuführen und frei von tradierten Interpretationen zu betrachten. … so hoffe ich.
Während der Beisetzung verlas Joerg Waehner spontan an Rainers Sarg ein Gedicht aus dem Band die rationen des ja und des nein. Das war ein starkes Stück und eines Dichters würdig. Dank an Joerg und hier das Gedicht:
gestern traf ich einen der helden
der geschwiegenen sprache eines schwarzaufweissen
romans er sagt nur fakten zählen nur fakten nehmen sie
die hand aus der tasche wenn sie reden mit anderen worten
die dinge reagieren die menschen bevölkern die biographien
versagen täglich berichte deuten die sinne sieben die
psychologie treibt die seelen ins holz der heiligen
familien niemand weiss woher die zahlen kommen die
(eigenhändige unterschrift) unter gesagtes
erklärten die faustgrossen herzen
Henryk Gericke, facebook.de, 19.9.2019
Fakten und Vermutungen zum Autor + KLG + Kalliope
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
deutsche FOTOTHEK
Nachrufe auf Rainer Schedlinski: Abwärts! 1 & 2
Keine Antworten : Rainer Schedlinski: die rationen des ja und des nein”
Trackbacks/Pingbacks
- Rainer Schedlinski: die rationen des ja und des nein - […] Klick voraus […]


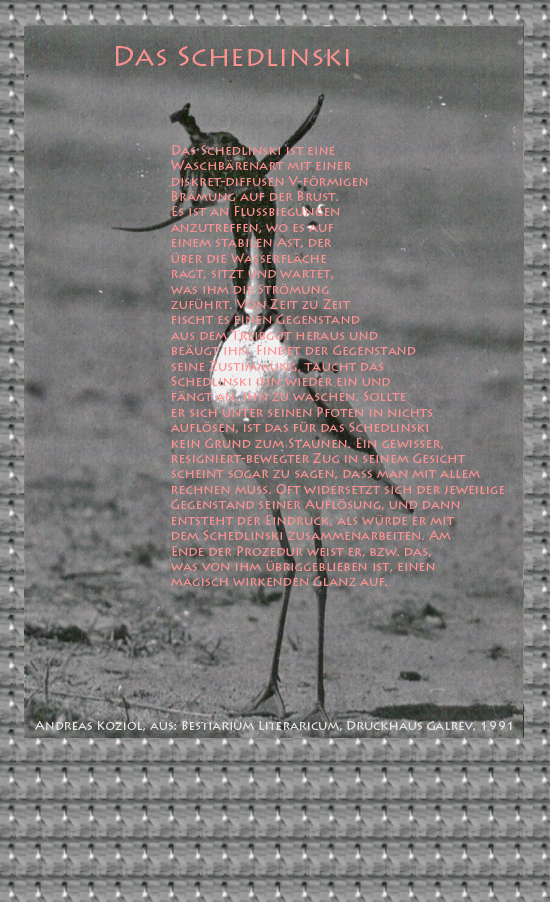












Schreibe einen Kommentar