Raja Lubinetzki: Der Tag ein Funke
ZYNISMUS, DER DU DAS PFLASTER
auf den Wunden verfaulen läßt,
um deine widersprüchlichen,
mißverstandenen Spiegel
nicht zu sehen,
du, der du im Dunkeln wohnst,
die Sinnflut erwartend
und das Kreuz deiner Sicherheit
kreuzt so beständig deinen Weg,
den du hättest einschlagen können,
hättest du dich nicht erwartet.
Wird es nicht Zeit, dich endlich
selbst auf den Arm zu nehmen?
Der Tag ein Funke
Um den äußeren und inneren Bedrängnissen zu entkommen, die ihr Leben kennzeichnen und brandmarken, sucht Raja Lubinetzki beharrlich nach dem befreienden Wort. Verse, die dem entsprechen sollen, was sie unmittelbar betrifft und empfindet auf der Suche, dafür die nur ihr eigene Sprache zu finden. Sprache, die sich den Konventionen verweigern will, mit ihnen bricht und sich doch zugleich ihrer bedienen muß.
Ein wahrhaft zerreißender Prozeß, der dieses Gedichte kennzeichnet und ihre widersetzliche poetische Brisanz ausmacht, die zu überraschenden Wort- und Versbildungen führt, wie sie schockierende Abstürze dabei in Kauf nimmt, sie geradezu vor unseren Augen in Szene setzt.
Raja Lubinetzkis Verse eines wie sich fortschreibenden Tagebuchs entziehen sich oft landläufiger Logik wohlkalkulierter Lyrik, sie erhalten aber durch diesen waghalsigen Umgang mit der Sprache – paradox – ihren poetischen Sinn für eine zwiespältige Wirklichkeit, die uns so noch nicht offenbart wurde.
Unerhörte Verse als Befreiungsversuche eines verstörten Lebens „fremd im eigenen Land“ –
wer nicht leidet, liebt nicht,
und wer nicht liebt, lacht nicht…
Janus Press, Klappentext, 2001
Rehkitz mit Zähnen
− „Ein Tag ein Funke“: Zu den Gedichten Raja Lubinetzkis. −
„Das Hauptproblem des 20. Jahrhunderts ist die Trennung der Menschen nach ihrer Hautfarbe.“ Als W.E.B. DuBois diesen Satz seines für die afro-amerikanische Bürgerbewegung grundlegenden Prosawerkes The Souls of Black Folk formulierte, das 1903 erschien, ahnte er womöglich, dass er auch im darauf folgenden Jahrhundert kaum an Gültigkeit verlieren würde. Der Zwiespalt, in dem sich DuBois befand – in Amerika und mit der amerikanischen Kultur aufgewachsen zu sein und zugleich aufgrund seiner Hautfarbe das Stigma des Fremden von der Gesellschaft aufgedrückt zu bekommen – existiert für viele Menschen noch immer, und das nicht nur in den Vereinigten Staaten.
So beschreibt sich die 1962 als Tochter einer deutschen Mutter und eines afrikanischen Vaters in Sachsen-Anhalt geborenen Lyrikerin Raja Lubinetzki in ihrem Gedicht Also sprach Mulatto als „Stiefkind des Blues / wie klassischer Hymnen / eisbeinfressend so deutsch / weißer Mutter verleugneter Rassenkomplex / wie Vaters plötzlich vergessne Zunft“. Ein Gutteil ihrer Texte sind denn auch Annäherungen an „das Zentrum / dieses traurigen Konflikts / zwischen Schwarz und Weiß“. Doch selbst die Gedichte, die sich nicht vordergründig mit dieser Thematik befassen, sind geprägt von innerer Zerrissenheit, vom oft genannten aufgewühlten „Ich“, das die Autorin umkreist.
Das Problem einer solchen intimen Lyrik ist es, den offensichtlich stark erfahrenen, schmerzvollen Konflikt so zu gestalten, dass er sich auch dem Leser mitteilt. Wie ist das anzustellen? Sicherlich weniger mit reflektierenden Passagen wie „Seltsam, dass gerade ich in der deutschen Sprache / stehe, grad ich, die alles andere als deutsch / zu sein sich bekennt. / So kranke ich als deutsche Existenz vor meinem Recht / undeutsch sein zu müssen“. Eher mit einem Satz, der sich im Anschluss an diese Zeilen findet und unmittelbar, weil lyrisch, beeindrucken kann: „Meine Jugend ist ein durchbrochner Mund.“ Solche Formulierungen wünscht man sich häufiger. Allzu oft wird der Konflikt mit entleerten Begriffen wie „Herz“, „Seele“, „Leiden“ und „Schmerz“ nur bis zur Unkenntlichkeit etikettiert, statt dass ihm Ausdruck verliehen würde.
Lubinetzkis Technik besteht dabei – neben dem Veräußern des Inneren und dem gleichzeitigen Verinnerlichen der äußeren Welt („Auf dem Weg / zum Stimmhaus / verhallen die Schritte“) – aus einem Spielen und Gegeneinander-Ausspielen von Stilen und Tonlagen, in denen einige Jahrhunderte deutschsprachiger Dichtungstradition anklingen. Storms Lied des Harfenmädchens („morgen ja morgen“) meint man ebenso herauszuhören wie die frühexpressionistische Lyrik eines Stramm („Mit dir Todschwarz / Träne heult Verlustangst“). Äußerst sentimentale, fast süßliche Verse treffen auf einen expressiv-zertrümmernden Duktus, archaisch anmutende Wendungen wie „verschmähtes Begehr“ auf Alltagssprachliches – gerne auch mit Fäkaleinschlag – und gewagte Neologismen wie „verlangwütend“, „Pisswehmütchen“ oder das schöne „ringsummer“. Nicht selten bewegt sich ein Gedicht von einer ersten Strophe, die mit Wendungen à la „endlich weinst du unter deinem Schweigen“ und „wie sollt ich Mohnlippen küssen“ schon fast hemmungslos nah am Kitsch ist, über einen gelungenen, ganz eigenen Mittelteil zum derb-furiosen Schluss mit „geschissenen Händen“ und einem „blühenden Kassettenhaftschädel“ – eine Mischung, die am besten mit Zeilen von Lubinetzki selbst zu beschreiben ist: „Ein Rehkitz schlägt dem Panther / die Zähne in den Nacken“.
Dieses Spiel gelingt nicht immer. Wenn aber doch, so macht man gerne mit und verzeiht alle „Silberblicke“, alle Genitivmetaphern, in denen Abstraktes mit Konkretem gekreuzt wird und das „Schiff der Fantasie“ zwangsläufig leckschlägt. In ihren besten Gedichten findet Raja Lubinetzki mit einer Spur Selbstironie, mit sprachlicher Finesse und gelungenen Bildern zu einer ganz eigenen lyrischen Sprache, und heraus kommen Texte wie Augustens kalter Sommer: „Augustens kalter Sommer hat den Kühlschrank satt. / Hat ihn satt, das weiß er pur. // Rot fallen den Türen die Gesichter aus der Angel. / Hände verblättern den weißen Atem der Bücher. // Erinnerungen schlafen in metallnen Särgen. / Dschungel sind gespannt wie die Erde in Lust. // Der Wind hält seine Finger in Blumenköpfe. / Träume vibrieren im leeren, im gähnenden Briefkasten. // Ein Mensch, streng wie beißender Tau am Morgen, / reißt sich endlich die Haare von der Stirn“.
Jan Wagner, Frankfurter Rundschau, 28.4.2001
Stilschiff auf hoher See
– Fremdsein und Sprachmut – Raja Lubinetzkis Gedichte. –
„Aller Anfang ist schön, nicht schwer“ – solchen Satz findet man erst, wenn der Anfang lange genug zurückliegt. Er steht in Raja Lubinetzkis Debütband Der Tag ein Funke, der – als Lohn für sein spätes Erscheinen – alle Phasen im Werk der Autorin umspannt, vom ersten glückhaften Aufleuchten der Welt in ihrer Formulierung bis zu deren Verweigerung, vom mühevollen Ringen um das Wort bis zum unerwarteten Geschenk. Daß sie dabei nie ihren Anspruch „Begönne die Sprache noch einmal von vorn“ aufgibt, macht die Intensität dieser Gedichte aus. Er bezeichnet den Unterschied zwischen einer dichterischen Sprache und bloßer Mitteilung, er treibt dazu, sich mit der Distanz zwischen den Worten und den Dingen weder abzufinden noch sie zu ignorieren, er versucht das Fremdsein im Leben durch Beschwörung zu mindern.
Raja Lubinetzki hat das Fremdsein auf besondere Weise erfahren. 1962 als Tochter eines Afrikaners und einer Deutschen im Anhaltinischen geboren und dort bei ihrer Pflegemutter aufgewachsen, ist es schwer, nicht Außenseiterin zu sein. Sie bleibt es ein Leben lang, ohne damit hausieren zu gehen.
Daß ich ein Neger ward mir lange eingebläut.
Ansonsten fühl ich mich häutefrei
Das Fremdsein begreift sie als eine der Bedingtheiten menschlichen Lebens, die zu überwinden eine Aufgabe der Sprache ist, der deutschen Sprache, dem wesentlichen Element, das sie mit ihrer Umgebung teilt.
Erstaunlich ist, wie sie von Beginn an diese Sprache prägt, wie sie einen eigenen poetischen Code für die Welt findet. Die Worte fügen sich ihr wie selbstverständlich zu neuen Gebilden zusammen, zu „Mutträumen“, „Zeitzähnen“ und „Fussrennflucht“. Mitunter erhalten sie durch eine Letter zu viel oder zu wenig – ein Verfahren, das viel Vertrauen in den von ihr erlernten Beruf des Schriftsetzers erfordert – eine doppelte Bedeutung: „Freudtränen“ werden geweint, „Sehsucht“ packt, die Kinder „schütteln“ und schütten nicht „den Wein weg“. Die seltenen Reime muten an, als habe ein ebensolches Kind spielerisch die richtigen oder fast richtigen Bauklötze aufeinandergesetzt.
Anfang der achtziger Jahre kommt die junge Autorin, wie viele ihrer Generationsgefährten, nach Berlin. Ihre Hoffnung, in der sich formierenden Szene des Prenzlauer Bergs Fuß zu fassen, erfüllt sich nur teilweise. Zwar werden ihre Gedichte in einigen Untergrundzeitschriften gedruckt, doch um mehr als einen Platz am Rande einzunehmen, ist ihr Außenseitertum zu existenziell, ist der Schmerz zu sehr zu spüren, wenn sie von sich behauptet: „Ich widme mich dem Zerreiß der Wörter“.
Als Raja Lubinetzki 1987 nach Westberlin übersiedelt, erwartet sie eine andere Variante des Fremdseins. Die Umarmungen der multikulturellen Gesellschaft finden, wie ihr Gegenteil, vor allem in den Medien statt. Der Alltag ist geprägt von sich selbst feiernder Indifferenz, von einer Form der Vereinzelung, die zu überwinden die Kraft der Sprache nicht ausreicht. Denn die Wörter scheinen in der neuen Umgebung eine andere Bedeutung zu haben, die Begleitmusik der Blicke und Gesten ist ungewohnt.
Hab Dank noch Scheuklappe
Ich lebe jetzt mit immer
schwereren Koffern
Die Angst um den Verlust der Sprache wird, neben der Selbstbefragung im „elenden / kleinen Hinterwaldzimmer“ und den Wechselspielen der Liebe, zum zentralen Thema ihrer Gedichte. Am Rande des Verstummens bleibt der Sprache nichts anderes als nochmals von vorn zu beginnen. Schlichter und nicht mehr so schwer befrachtet: „nun Stilschiffchen geh unter“. Die Worte wehren sich weniger gegeneinander, fügen sich in langen Sätzen zur poetisch verdichteten Erzählung oder im „Tagebuch eines Logik Verfalls“ zum großen Gesang.
„So ausgetrocknete Brunnen mehren sich um mich wie eine Oase“: Diesen Prozeß weiterverfolgen zu können, ohne zu lange auf den nächsten Band warten zu müssen, wünscht sich der Leser. Einen Prozeß, in dessen Verlauf die Zweifel über das Wie des Sprechens zurücktreten hinter seinen Möglichkeiten, die Welt in sich aufzunehmen.
Den Weg hat die Autorin selbst vorgezeichnet:
Am besten ist es seine Wiedergeburt
in einem noch nicht gefundenen Satz
zu erspähen,
Sprüche, Mundarten, Spiegelungen
der unterschiedlichsten Gewächse.
Ein Rehkitz schlägt dem Panther
die Zähne in den Nacken
Bernd Wagner, neue deutsche literatur, Heft 537, Mai/Juni 2001
Alles ist gegangen bevor
Raja Lubinetzki
Man nannte sie Mauerkinder und konnte ihnen beim Stottern zuhören, wie sie sich verhaspelten, ehe sie das Wort ich herausbrachten, wie sie sich an den Tischen der Eltern, die einmal Kriegskinder gewesen waren, einfanden und nicht mehr aus dem Staunen herauskamen, über deren zurechtgebosselte Karrieren, ihr eigentümliches Starrsein, die abstrusen Sprachmodi, mit denen sie über ihre vor sich hin rieselnde Welt hinweggingen, die ihnen selbst schon unverständlich geworden war. Die Rede ist von Uwe Kolbes „Hineingeborenen“, jener um 1960 geborenen, in einer „Stacheldrahtlandschaft“ aufgewachsenen Generation. Geht es um sie, fallen Worte wie Skepsis und Abwehr, Zerrissenheit und Träume, Pragmatismus und Unbehaustheit. Auch von verformten sprachlichen Innenwelten, Eingegrabenem und Selbstaggressionen ist die Rede. Eine Generation, die vielleicht wie keine vorher in die Welt musste und mit der Idee Sozialismus nichts mehr wirklich am Hut hatte. In dem Land, in dem sie groß wurden, hausten sie wie „fremde Vögel“, die nicht mal mehr fliegen wollten. Nur wenige noch hoben ab und rebellierten.
Wenn wir nun die Verse erbrächen
in uns und draußenweit
in Hände verwandelten
auf Papieren
so Mund und Augen und Ohren
dokumentarisch
Analyse verlorner Kindheit schon
Raja Lubinetzki wurde 1962 in Kropstädt in Sachsen-Anhalt geboren und wuchs bei ihrer Pflegemutter in Güsten, später in Stassfurt auf. Nach ihrem Zehnklassenabschluss begann sie 1979 eine Schriftsetzerlehre an der Magdeburger Volksstimme.
Die ersten Gedichte schrieb ich als Schülerin. Es waren Stimmungsaufnahmen, aber auch politisch angefärbte Gedichte über Rassendiskriminierung in den USA und Südafrika.
Eins davon gab sie einem Redakteur der Volksstimme. Ihm gelang es, den Text in der Zeitung zu platzieren. Dieses poetische Debüt brachte sie mit Ulrich Zieger, Lyriker, Maler und späterem Theatermann, zusammen, der zeitgleich mit ihr bei der Zeitung lernte. Das unwirtliche Magdeburg, mit seinem Dauerwind von Westen, der stinkenden Elbe, den riesigen Industrieflächen, dem vielen Alkohol in den Kneipen. Was konnte man sich unter den literarischen Inkubationsgesprächen der beiden vorstellen?
Die Achtzehnjährige las Hölderlin, die Günderrode, dann Hölderlin und die Günderrode, was dem Schreibinterieur des Anfangs eine leicht apokalyptische Färbung mitgab. Etwas Hochambitioniertes, sehr Ernstes lag den frühen Versuchen unter, was auch nicht sonderlich verwunderte. Da war die Vagheit ihrer Herkunft durch den Vater aus Kamerun und eine Mutter, die mit der Tochter offensichtlich nichts anzufangen wusste. Und da war die Existenz einer Farbigen in der DDR. Der Ausschluss also im Einschluss. Wie lebte sich das? Welche Situationen hatte eine farbige, junge Frau Ende der siebziger Jahre in einer ruppigen, völlig kriegszerstörten Industriestadt in der DDR-Provinz zu bewältigen? Wie war das mit dem Schreiben? Welchen Ort suchte sich die poetische Stimme? Von welcher Position aus konnte sie sich formen, kam sie doch aus der kategorischen Unverfügbarkeit? Wovon sprechen und auf welche Weise?
Als Raja Lubinetzki 1982 nach Ostberlin übersiedelte, suchte sie sich eine Arbeit in einer Druckerei, wohnte zunächst bei Fred Ludwig, einem alten Schauspieler, dann bei der kongolesischen Verwandtschaft ihres Vaters, der Ende der siebziger Jahre im Zusammenhang mit der Biermann-Ausbürgerung Schwierigkeiten bekommen hatte, aus der DDR ausgewiesen wurde und von da an in Westberlin wohnte. Über Ulrich Zieger, der Anfang der achtziger Jahre auch nach Berlin zog, bekam sie Verbindung zur Frauengruppe Prenzlauer Berg und zu Teilen der Friedensbewegung. Raja Lubinetzki zog in eine Wohnkommune über dem Wiener Cafe, lernte dort unentwegt Leute kennen und bekam intensivere Kontakte zur künstlerischen Szene. Diese Art Unterholz behagte ihr. Nervös, suchend, halbwegs überschaubar, in jedem Fall anregend. Das Ganze hatte etwas Speckiges und Exklusives zugleich. Man hatte Zeit, saß im Zentrum des Anderen, in den Abrisshäusern des Prenzlauer Bergs, in großen Wohnungen, die zu Kunstsalons oder Lesegalerien umfunktioniert worden waren, zeigte sich Kunst, las neue Texte, veranstaltete Happenings und Punkkonzerte, machte inoffizielle Zeitschriften und Kunstbücher. „Wir wollen immer artig sein, denn nur so hat man uns ge-her-ne“, grölten die Jungs der Punkband „Feeling B“. Bunter Widerstand: Irokesenschnitt, Lederjacken mit Sicherheitsnadeln, Hundeketten am Hals. Wut, Unangepasstheit, Spaß und Poesie als eine Art Mundpropaganda. Günstiges Klima auch für die eigenen Texte. Raja Lubinetzki veröffentlichte zuerst in Mikado, später in ariadnefabrik, schaden und verwendung. In welche Wohnung sie auch zog, überall lagen Texte herum – von Elke Erb, Bert Papenfuß-Gorek, Ulrich Zieger, Gabriele Stötzer, Andreas Koziol, Bernd Wagner. Man konnte sie mitnehmen und eigene dalassen.
Die täglichen Einträge in die Arbeitshefte. Ihre Gedichte, Poeme, kurze Prosa, Grafiken. Eine Art endloser Tagestext, ein ästhetisches Diarium. Die Frage nach dem Ort der Stimme blieb offen. „Alles ist gegangen bevor“: Vergangenheit und Zukunft zusammengebunden, ehe Gegenwart da sein konnte. Hörte sich nach etwas von innen Zusammengezogenem, nach poetischer Selbstverpuppung, an. Schillernder Reim, gliedernde Metren, ordnende Syntax, prächtige Metaphern blieben gleich mal außen vor. Nur nichts schön machen hier, nur keine herausposaunten Plausibilitäten, nichts Zug um Zug Nachvollziehbares, nichts vitalistisch Eindeutiges, Hochhinauswollendes. Eher fühlt man sich an Deleuze’ Faltenwerk, an irgendwelche Labyrinthe, abwegige Höhlenkammern oder verwirrende Schachtelsysteme erinnert. Ein Kokon, in den man abtauchte und aus dem man möglichst nie mehr herausfand.
Das Thema schien die unverfügbare Stimme geworden zu sein. Eine, die durch eine Splitterwelt musste und mit „sensibler Müdigkeit“ vom Sprachlosen, nicht Erinnerbaren oder zu heftig Erinnerten, vom Unverbundenen, Irrenden, Verhallenden, Verlorenen, Phantasmatischen faselte. Eine, die „in abgelegenen Zimmern“ rumlag, über „zerfallendes Laub“ stolperte, in sich hineinhörte, um den Moment auszuspüren, wenn die Worte grad daran dachten, sie zu verlassen. Eine, die sich irgendwie eingerichtet hatte in den „verbogenen Selbsten“, um letzten Endes zu verlautbaren:
Am meisten aber hatten wir Angst, uns zu verändern.
Viel Zeit, wenig Raum. Sprachwerdende Wahrnehmungsflicken, aber noch war die Sprache der Dichterin ganz, höchstens ein wenig verstellt und auf eigene Weise umsortiert, höchstens ein bisschen rundgelutscht, höchstens etwas aus der Facon geraten.
Alles ist gegangen bevor
ich mich niederlassen konnte
griff Sprachlosigkeit in Nächte
die warn wie Häute darin
zerrannen die Lieben
und schwimmende Zeiten
brachen müde Türen ein
und um herbstliche Betten
strichen die Hyänen der Erinnerung
und Schriften stürzten schlaflos
durchs Sieb der Augenspiegel
Poetische Existenzverunsicherung, die mit der realen korrespondierte. 1983 wurde Raja Lubinetzki zum ersten Mal direkt von der Arbeit weg zu Verhören der Staatssicherheit abgeholt. Sie sollte Auskunft geben – über die Frauengruppe Prenzlauer Berg, über ihre Wohnkommune, über die Literaturszene. Die Verhöre wiederholten sich. Die Dichterin schwieg. Daraufhin wurde die 21-Jährige verhaftet und für eine Woche in Untersuchungshaft gesteckt. Irgendwann war ihr das alles zu blöd und genug der Gängelei. Besser schien ihr, sich zu wappnen und in Dingen dieser Art klare Verhältnisse zu schaffen. Die Alternative? Sie schrieb an Erich Honecker und teilte ihm mit, „dass sie sich aufgrund der gesellschaftlichen Verhältnisse in der DDR nicht weiter entwickeln“ könne, und stellte Ende 1983 einen Antrag auf Ausreise aus der DDR.
Der Prenzlauer Berg in den achtziger Jahren als subversives Terrain, Kunstlabor und riesiger Bahnhof. Ein Leben im Abschied, eine unablässige Ausdünnung. Wann, wie, wohin, womit. Niemand wusste es. Immerzu Wohnungen, in denen man sich verabschiedete, überlegte, sich zu verabschieden, sich gestern grad verabschiedet hatte. Vielleicht hat die innere Erosion des Landes nichts so sehr beschleunigt wie dieses Bahnhofsleben, wo der Nächste grad noch da gewesen war, keiner einem sagen konnte, wo er steckte, noch wie lange man selbst bleiben würde.
O meine Schwester
Auch sie ging bevor
Ein Umarmen Schwere
ausatmen konnte in gärenden Adern
Zurückfiel langer Tag
alles Schweigen
Anfang 1985 eröffnete das MfS, Diensteinheit Prenzlauer Berg, den Operativen Vorgang „Trio“, der gegen Raja Lubinetzki und zwei ihrer Freundinnen wegen „des Verdachts des ungesetzlichen Verlassens der DDR“ ermittelte. „In der Begründung ihrer Übersiedlungsersuche brachten die Verdächtigen ihre negativ-feindliche Einstellung zu den gesellschaftlichen Verhältnissen in der DDR zum Ausdruck. Sie entziehen sich bewusst staatlichen Einflüssen, indem sie in keiner Weise organisiert sind und als Hilfskräfte arbeiten“, hieß es. Der Geheimdienst versuchte es mit den üblichen Zersetzungsmaßnahmen gegen die drei. Beispielsweise wurde den beiden Freundinnen der Personalausweis entzogen.
Um Unsicherheit und Misstrauen unter den drei Verdächtigen zu erzeugen, wurde der Lubinetzki der Personalausweis belassen. Die durch den IM „Ina“ erarbeitete Reaktion auf diese Maßnahme bestätigte den Verdacht und deren Richtigkeit.
Doch die drei ließen sich nicht beirren. Auf abgewiesene Ausreiseanträge reagierten sie beinah alle zwei Monate mit neuen. Die Staatssicherheit wurde allerdings auch nicht müde. Sie forstete nach „strafprozessualen Prüfungshandlungen“ und observierte umso hartnäckiger. Über Raja Lubinetzki hielt das MfS Mitte 1985 fest:
Inoffiziell wurde bekannt, dass die Lubinetzki geheime Lesungen organisiert und durchführen soll. Wo finden diese Lesungen statt, und wer nimmt daran teil? Welchen Inhalt haben diese Lesungen? Wer hat Kenntnis? Wo kann Beweismaterial liegen, was kann wo liegen? Welche IMs sind da, um Beziehungen zu Lubinetzki aufzubauen? Wo und bei wem hält sich die Lubinetzki gegenwärtig auf?
Da die Dichterin irgendwann eins ihrer Arbeitsbücher bei IM „Ina“ vergessen hatte, die nichts Dringlicheres zu tun hatte, als es komplett für den Geheimdienst abzufotografieren, hätte er eigentlich wissen können, wo sie sich aufhielt. Am ehesten doch wohl bei sich. Wo sollte sie sonst sein? Sie „sammelte Fußtränen“, „lächelte über U-Bahn-Hände“, „ließ den Januar aufstehen“, legte sich „in eine Erinnerungsschatulle“ und sann dort über „verbretterte Landschaften“ nach. Sie nahm Abschied. Und da der poetische Kokon vielfach verwickelt war und die Ausreise sich hinzog, jedenfalls kein Termin in Sichtnähe war, wurden etliche Arbeitsbücher gefüllt.
ABSCHIED
Es ist wie es ist. Es verabschiedet sich nie außen.
Es verabschiedet sich innen. Innen, wo ein Gesicht
ins andre übergeflossen ist. Und wie kann ich also
Heimweh nach einem Raum haben, wenn ich nie einen
besessen habe. Und können die Dinge etwa ein Heim sein
und die Erinnerungen.
Es ist wie es ist. Der Traum des Abschieds
lebt in den Dingen weiter, die mir begegnen
und wie ich sie verstehe und wie ich es verstehe,
diese Begegnungen zu überleben. So beginnt es
die Perlen des eigentlichen Widerstands, die, wie schwer
bestickte Kreuze in der Tasche hängen, so beginnt
es seine Gemeinsamkeit wie Konsum zu ordnen.
„Die Farben, durch die sie des Schreibens wegen gehen musste, werden immer bunter“, notierte sie Mitte 1985 in die Arbeitsbücher. Und das Bunte brauchte sie fürs „Grenzüberschreiten“, fürs „Hinüberschreiben“. Raja Lubinetzki war auf dem Absprung in ein neues Leben und die Dichterin dabei, den „Stil zu verlassen, der einen verlassen hat“. In der Tat hatte sich die weit ins Innere abgetauchte poetische Stimme aus den Falten und Unterkammern herausgeboxt und einiges an Oberwasser bekommen. Sie trieb sie vor sich her, fing an, in die Sprache hineinzureden, schob die unterschiedlichsten Sprachsysteme ineinander, assoziierte mit dem Ton der anderen, holte sich ein paar Querschläger ins Boot, stapelte sinnschräge Neologismen übereinander. Manchmal ließ die Dichterin die Stimme auch zerreißen. In jedem Fall war ihr poetisches Unternehmen gegenwärtiger geworden und in Bewegung gekommen, angegriffener und wacher zugleich. Ein eifriger Kulissenumbau war da im Gange. Eine Sprachwende.
1987 wurde ihr Ausreiseantrag endlich genehmigt. Das Leben im Wartezimmer hatte ausgedient.
In der Keibelstraße, wo ich meinen Ausweis abgeben musste und ein Visum für die Bundesrepublik bekam, versuchte, mich ein Offizier zu überreden, den Antrag zurückzuziehen. „Da haben Sie doch im Westen als Schwarze keine Chance, Arbeit und Wohnung zu bekommen“.
Das Leben in Westberlin unterspülte die im Osten vollzogene Sprachwende noch einmal. Die Stimme schien zwar organisiert, aber der Textraum chaotisch:
Dass man das Sprechen neu und andersartig, durch Beifügen der Silben, durch Stunden der Reklamebilder, geronnen auf Straßen, und all die neu und anders hinzugetretenen Dinge hierzu einüben müsse. Und sie fällt auf diesen Ton eines Stammelns zurück, als hätte sie als Kind keine Hausarbeit von keiner Verwandtschaft, erst recht von keinen Eltern bekommen, und sie spürt erneut diese Verzweiflung in sich brennen, diesen Spatenstich.
Der Spatenstich als Voraussetzung, um die Wirklichkeit nicht mit einem Wunschbild zu verwechseln. Raja Lubinetzki in Kreuzberg und ihre Alter-Ego-Arbeitsbücher. Sie sind Logbuch, Notizblock, Spielzeug, Erinnerungsstütze, Fahrplan, Schmierheft, Material, Album. Das Gebundensein ans Notat. Irritationen, Ausweichmanöver, Schweigen, Streichungen inbegriffen. Der Schrift zuschauen, wie sie entsteht, den Gedanken zuhören. Wenn sie vom Schreiben spricht, dann vom poetischen Prinzip des Eingreifens, Umcodierens, Erinnerns, Visionierens.
Mein Stil ist stämmiger geworden, konkreter, weiter.
Poesie, sagt sie, ist undefinierbar. Sie ist überall, findet immer statt.
Ines Geipel, aus Ines Geipel: Zensiert, verschwiegen, vergessen. Autorinnen in Ostdeutschland 1945–1989, Artemis & Winkler, 2009
Fakten und Vermutungen zur Autorin


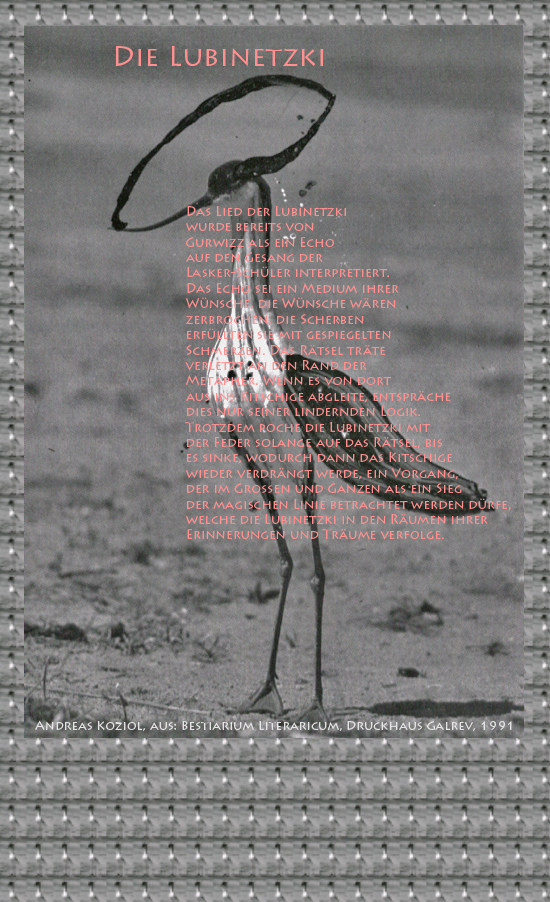












Schreibe einen Kommentar