Reiner Kunze: eines jeden einziges leben
TAGESORDNUNGSPUNKT: DER FRIEDEN
(akademiesitzung in B.)
Du reichst die hand
Zwei verweigern sie dir
Einer von dort
einer von hier
Und wir sind fast nur vier
nachwort
… während der Reifezeit eines meiner Gedichtbände (fast regelmäßig gingen fünf Jahre darüber hin)…
Oskar Loerke
1
Als wir zu beginn der sechziger jahre nach Greiz in Thüringen gezogen waren, sagte eines morgens die briefträgerin: „Was die leute so reden, herr Kunze.“
Sie wollte sich nicht nur der post entledigen, und ich ermutigte sie.
„Sie hätten eine so tüchtige frau“, sagte sie.
„Stimmt“, sagte ich.
„Jeden morgen halb sieben geht Ihre frau auf arbeit, und Sie bleiben zuhaus.“
„Stimmt auch“, sagte ich.
„Sie müßten doch von etwas leben!
Auch das stimmte.
Mit anderen worten: Mein ansehen bei den nachbarinnen war denkbar gering. (Es besserte sich mit den jahren, als ausnahmslos ich die fenster putzte.) Was die briefträgerin nicht wußte, und was heute noch gilt: Meine unabhängigkeit als schriftsteller verdanke ich der kameradschaft meiner frau.
2
Das gedicht ist ergebnis eines prozesses, der allen marktgegebenheiten hohnspricht.
Erst wenn das gedicht die absicht geäußert hat, geschrieben zu werden, kann der autor beabsichtigen, es zu schreiben.
Eines tages nahm mich A. zu höhergelegenen schlägen seines waldes mit und wies mich auf die kompensationstriebe vieler fichten hin. Dabei fiel das wort „angstnadeln“. Später einmal – jahre waren vergangen – berichtete er, daß er im wald von heftigem stechen in der herzgegend heimgesucht worden war und sich nur noch mit mühe hatte in die obhut eines arztes begeben können. Wiederum später stellte er in einem gespräch augenzwinkernd die these auf, seine seele habe ihren sitz in der nähe des herzens. Als ich am abend nach diesem gespräch nachhausfuhr, spielte das unbewußte dem bewußtsein eine verknüpfung zu, in der etwas von der inneren beziehung A.s zum wald aufschien: Seine seele treibt angstnadeln…
Über der au, mit der A.s besitzungen an die Donau angrenzen, nistet der graureiher. Vor wenigen jahren noch zählte die kolonie fünfundfünfzig horste, im letzten waren es dreizehn. Die menschen dringen mit autos in die au ein, vernichten in bestimmten bereichen die pflanzenwelt und hinterlassen ihren zum teil nicht verrottenden müll. Scharen von anglern reduzieren den fischbestand und stören vom frühen morgen an die reiher beim fischen. Die folge: Die vögel fliegen über land, holen die fischteiche der bauern aus und werden geschossen. Seit einem halben jahrzehnt zieht A. von instanz zu instanz und streitet vor den schranken des gesetzes für sein recht, schranken vor die au zu legen. Hat sich auf dem fluß eine geschlossene eisdecke gebildet, fährt A. jeden morgen in die stadt, kauft fischabfälle und legt sie für die nicht nach süden gezogenen reiher und eisvögel aus.
Ich weiß nicht mehr, wo und unter welchen umständen mir das bild in den sinn kam: An den wald steckt er sich / reihersilber…
Schließlich, bei einer morgenerkundung in der au über den tümpeln lag nebel, und es hatte den anschein, als seien sie noch, aber schon nicht mehr von dieser welt –, stellte sich das bild ein: echos gewesener landschaft…
Gibt es etwas, das sich weniger festhalten läßt als ein echo? Und was wäre unwiederbringlicher als ein echo, dessen ursache selbst schon vergangen ist? Dieses bild ließ sich nicht „wegstecken“, die gedanken kehrten immer wieder zu ihm zurück.
Ist der bildeinfall – die absichtserklärung des gedichts, geschrieben zu werden – nachhaltig genug gegeben, beginnt die arbeit. Ihr beginn kann vertagt werden, aber auch in dieser entscheidung ist der autor nicht völlig frei. Der bildeinfall hat seine ursache in ihm – etwas in ihm verlangt danach, daß er sich dem einfall stellt.
Die arbeit an einem gedicht kann tage dauern (die halben nächte eingeschlossen), wochen und – mit langen unterbrechungen – auch jahre.
Seine Seele treibt angstnadeln … Nicht nur einmal habe ich A., nachdem er mich auf einen mehr oder weniger nadellosen wipfel aufmerksam gemacht hatte, wie: aus kindesseele seufzen hören. Mit jedem baum, der abstirbt, scheint auch in ihm etwas zugrundezugehen, und das elektrokardiogramm, das nach jenem stechenden schmerz in der herzgegend geschrieben worden ist, dürfte diesen eindruck stützen. – Mit jedem baum … Welcher anfang wäre für ein gedicht, das von A. spricht, zwingender? Mit jedem baum, der abstirbt… Absterben: Die tanne zeigt andere symptome als die fichte oder der nußbaum. Allen gemein ist, daß die dichte ihrer nadeln und blätter rapide abnimmt. Sie dünnen aus… Ausdünnen (das aus für den baum… Es ist aus mit ihm) … Mit jedem baum, dessen wipfel / ausdünnt…
Die seele treibt angstnadeln… Die assoziation „stechen in der herzgegend“ kann sich allerdings nur dann einstellen, wenn man – wie A. – die seele in die nähe des herzens denkt.
An den wald steckt er sich / reihersilber… Durch dieses bild schimmert die geste hindurch, mit der man sich eine blume oder nadel ans revers steckt. Unter den gegebenen umständen kann A. die reiher am wald tatsächlich wie eine auszeichnung tragen. Die freude aber ist getrübt, denn das silber schwindet ihm unter den händen, und er weiß, auch der reiher ist in gefahr, von uns aus der welt hinausgestoßen zu werden.
Sich reihersilber an den wald stecken. … Der mann bedient sich des linken revers… Platz in der nähe des herzens.
Man könnte unterstellen, daß es A. nicht um den wald geht, wenn seine seele angstnadeln treibt, sondern um seinen wald (und A. wäre ein schlechter verwalter seines besitzes, ginge es ihm nicht auch um den forstwirtschaftlichen ertrag!). Die au aber wirft nicht viel mehr ab als im zeitigen frühjahr weiden für maschinen und zur jagdzeit ein paar wildenten. A.s innere aufschreie über die beeinträchtigung des lebens in der au beweisen, daß das, was ihn umtreibt, verantwortung gegenüber der natur ist…
Sind die schärfen und unschärfen des bildes (der bilder) erkannt, ist man wiederum auf einfälle angewiesen. Nicht immer kann man sagen, worin die ungenauigkeit eines bildes besteht, sondern man spürt sie nur und tastet sich dann wie blind voran. Kennt man sie, kann man sich an den einfall heranarbeiten, ihm eine falle stellen.
An den wald steckt er sich / reihersilber… Wie A.s wissen um die nichtidylle, seine illusionslosigkeit, seine trauer ins bild einbringen, ohne es zu beschädigen, ohne an die einfachheit der geste zu rühren…Ich verwarf variante um variante, bis der gedanke, daß es sich bei dieser geste auch um eine geste des abschiednehmens handelt, das wort freisetzte, dessen es allein bedarf: An den wald steckt er sich / letztes reihersilber.
Doch auch sehend geht man bei jedem text von neuem in richtungen, aus denen man mit leeren händen zurückkommt – oder mit einem einfall, von dem man sich wieder trennen muß.
Als A. von einer brasilienreise zurückkehrte, brachte er mammutbaumsamen mit. Was, wenn der mammutbaum widerstandsfähiger sei als tanne und fichte? Bei Linz – A.s besitzungen liegen eine autostunde von Linz entfernt – habe es früher riesige mammutbaumwälder gegeben! In langen kästen, die er im winter in seine wohnräume stellte, zog A. hunderte von mammutbaumsetzlingen. Nach seiner herzattacke konnten ihn die ärzte nur für eine einzige nacht im krankenhaus festhalten. Selbst wenn er dabeistünde, würden seine mitarbeiter noch versuchen, ihn zu täuschen, weil sie es für eine sünde hielten, bäume in so großen abständen zu pflanzen … Auf eigene verantwortung und allen beschwörungen zum trotz stand er am morgen wieder im wald… Schonung! Betreten verboten!… Die verszeilen entstanden: Schonung ist ihm ein begriff / nur der forstwirtschaft…
Für das gedicht erwiesen sie sich jedoch als nicht von belang, und es hätte sie auch als artfremd (tonartfremd) abgestoßen.
Der entstehungsprozeß eines gedichts läßt sich nicht nur nicht willentlich auslösen, er läßt sich auch nicht planmäßig auf ein geplantes hinlenken.
Alle gegebenen bilder korrespondieren direkt oder indirekt mit A.s these, seine seele habe ihren sitz in der nähe des herzens, und in nuancen bedürfen sie des augenzwinkerns, mit dem sie aufgestellt wurde, als vorzeichen. (Die „innere korrespondenz“ hat gründe: Die bilder sind entweder direkt oder indirekt durch die these hervorgerufen worden oder in zeitlicher und geistiger nähe zu jenem abendgespräch entstanden.) Die these muß dem gedicht also vorangestellt und – in erwiderung des augenzwinkerns – als these apostrophiert werden. Diese notwendigkeit ergibt sich jedoch einzig aus dem bildmaterial und hat nicht im vorhinein bedacht werden können.
Ehe das letzte wort nicht geschrieben ist, weiß der autor weder, wie es heißt, noch, ob er je bis zu ihm gelangen wird.
KLEINES RUHMESBLATT FÜR
ALEXANDER GRAF VON FABER-CASTELL
aaaaaDie seele hat ihren sitz
aaaaain der nähe des herzens
aaaaaaaaaaaaaaaaaaa(these)
Mit jedem baum, dessen wipfel
ausdünnt, treibt in der seele er
angstnadeln
In der nähe des herzens verschanzt er
die tümpel seiner uferau, echos
gewesene, landschaft,
und steckt an den wald sich
letztes reihersilber
Das ergelbnis des prozesses, der allen marktgegebenheiten hohnspricht, spricht allen marktgegebenheiten hohn: eine druckseite mit viel luft.
Für einem gedichtband bedarf es hundert und mehr poetischer einfälle, hundert originärer, mehr oder weniger entdeckerischer verknüpfungen von welt auch für einen zeitraum von vier, fünf jahren eine zahl, die staunen machen sollte –, und jener allen marktgegebenheiten hohnsprechende prozeß muß sechzig-, siebzig-, achtzigmal wochen- und monatelang über den tag und durch die halbe nacht gebracht werden und gelingen. Dennoch ist ein gedichtband schmal („der schmale Band“, „das schmale Bändchen“), und auf einem markt, den das wort „viel“ regiert, ist das Wort „wenig“ auch in keiner seiner abwandlungen eine empfehlung. Hinzu kommt: Ein gedichtband ist teuer, denn nach gedichten verlangt es nur wenige, und in einem volk, dessen geistestradition von abstrahierendem denken bestimmt wird, sind es noch weniger. – Der autor selbst kann seinem buch auf dem markt aber kaum helfen. In dem augenblick, in dem es erschienen ist, wird er vor allem gefragt: Und was schreiben Sie neues?, und da die gesellschaft nicht daran denkt, diese frage zu ächten, bleibt ihm nichts anderes, als, beschämt, ein autor zu sein, der nur gedichte schreibt, verlegen zu schweigen.
Der verlag jedoch ist den zwängen des marktes auf gedeih und verderb ausgesetzt.
3
Ich nehme das jahr 1986, in dem dieser gedichtband erscheinen soll, zum anlaß, meiner verlegerin, Monika Schoeller, und meiner frau zu danken. 1986 werden es fünfundzwanzig jahre, daß ich mit dieser verheiratet bin, und der S. Fischer Verlag wird hundert jahre alt.
Reiner Kunze, Nachwort, Oktober 1985
Reiner Kunze
ist ein Dichter des Menschen, nicht der Menschheit. Unnachgiebig stellt er eines jeden einziges leben in den Mittelpunkt seiner Lyrik. Seine Verse sind ein Bekenntnis zum Individuum und seinem Recht auf Entfaltung – und gerade damit ist Kunze, obwohl seine Gedichte stets einen zarten und behutsamen, ja innigen Ton anschlagen, zum Ärgernis der Ideologen in Ost und West geworden, die den Einzelnen so gerne irgendeiner vermeintlich bedeutenden Sache unterordnen wollen. Seine 1986 veröffentlichte Lyriksammlung eines jeden einziges leben gibt diesem Engagement für die Würde des unersetzlichen, unverwechselbaren individuellen Menschen besonders eindringlich Sprachgestalt. Zugleich findet Kunze, der die hier publizierten Gedichte nach seiner Übersiedlung aus der DDR in den Westen schrieb, in diesem Band zu einer in seiner Poesie bis zu diesem Zeitpunkt unerreichten gelassenen Heiterkeit und anmutigen Lebensfreude: Mit der sozialistischen Diktatur, die Kunze wie wenigen anderen zugesetzt hatte, schüttelte er einen Alpdruck ab. der auf seinem Leben lastete. Dem nachfolgenden „Durchatmen“, wie Kunze selbst es nannte, verdanken einige seiner betörendsten Gedichte ihre Entstehung.
S. Fischer Verlag, Ankündigung
eines jeden einziges Leben
Wer von Reiner Kunzes Texten nur jene engen Gebilde aus erstickter Wut liebte, die er gegen betonierte Verhältnisse in seiner alten Heimat anschrieb, wer in seinen Gedichten nur nach DDR-kritischen Hintergedanken gesucht hat, war rasch mit der Prophezeiung zur Hand, diese Stimme werde verstummen in einem andern Land. Kunze ist nicht verstummt seit er im Westen ist, mehr noch, er hat die poetischen Inhalte wiedergefunden, die ihm in der DDR abhanden zu kommen drohten. Wenn er seine poetische Unschuld in politischer Gegnerschaft verloren hat, so liefert sein neuester Gedichtband den Beweis, daß man so etwas wie poetische Unschuld auch zurückgewinnen kann.
Nachdem er erfahren mußte, wie sein „Fall“, seine Vertreibung aus der DDR 1976, rechten wie linken Medienkämpfern Munition lieferte, und man ihn wiederum hinter eine Barrikade zerren wollte, hat er sich mit einem erasmischen nulli concedo in einen stillen Winkel des bayerischen Waldes zurückgezogen. Und hat seither an seinen Gedichten gearbeitet in einer Weise, die, wie er selbst bekennt, allen Mediengegebenheiten hohnspricht. Im fünften Jahr nach Erscheinen des Gedichtbandes auf eigene hoffnung ist eine neue Lyriksammlung erschienen.
„Erst, wenn das Gedicht die Absicht geäußert hat, geschrieben zu werden, kann der Autor die Absicht äußern, es zu schreiben.“ Im Nachwort beschreibt Kunze das Entstehen eines Gedichts als geduldiges Warten des Autors, als eine Reihe eher zufälliger Erlebnisse und Gedankenverknüpfungen. – Nichts eben Neues, und es scheint, als wolle Kunze sich dafür entschuldigen, daß er „nur“ Gedichte schreibt, als müsse die Mühsal des Dichters den Wert des Gedichts erst erweisen.
Für einen Gedichtband bedarf es hundert und mehr poetischer Einfälle, hundert originärer, mehr oder weniger entdeckerischer Verknüpfungen von Welt – auch für einen Zeitraum von vier, fünf Jahren eine Zahl, die staunen machen sollte…
Diese Art von Leserpädagogik befremdet, und seine Gedichte haben sie gar nicht nötig.
Der Titel eines jeden einziges leben deutet auf die Ankunft bei Themen aus dem Innenbereich hin, denselben, mit denen Kunzes Dichtung in den fünfziger Jahren begann. Nach all den überlauten Ehrungen und Beschimpfungen, die ihm hier wie dort, in der DDR, zuteil wurden, ist etwas in ihm heil geworden. Die typische Verletztheit seines Ausdrucks, der bittere Ton der „wunderbaren Jahre“, der auch seine kritischen DDR-Gedichte eng machte, taucht nur noch als blasses Erinnern auf. Die alte Heimat ist in den Traum gesunken, nur noch im Traum ist ihm die neue Heimat Exil.
TRAUM IM EXIL
Der mutter beine wuchsen ein
ins zimmer
Ich will den sohn sehn, sagte sie
zum zimmer, geh!
Die mutter will den sohn sehn, sagte das zimmer
zum haus, geh!
Und das haus sagte geh! zur Stadt
und geh! die Stadt zum land, die mutter
will den sohn sehn
Wenn seine Träume ihn dahin versetzen, wo er „nie wieder hatte sein müssen wollen“, übe er, schreibt Kunze in einem Gedicht, „die hohe schule / des entkommens: zu träumen, daß ich / träume“. Nurmehr lakonisches Achselzucken gewinnt er der Feindseligkeit ab, mit der ihm auf der „akademiesitzung in B.“ Dichter aus Ost und West gleichermaßen begegnen. Daß Kunze sich nun nicht mehr genötigt sieht, sich poetisch auf Tagespolitisches einzulassen, kommt seinen neuen Poemen und Epigrammen sehr zugute.
Gelassener, freier ist sein Tonfall, wenn er Reise- oder Kunsterlebnisse formelhaft resümiert. Kräftiger sind die Farben seiner Naturbetrachtungen, vor allem aber: sie sollen nichts mehr beweisen. In intensiven Bildern feiert Kunze seinen Alltag, dessen Verläßlichkeit und Normalität.
„Dichter sein“ bedeutet ihm nun, „von niemandem gezwungen sein, im brot / andres zu loben / als das brot“.
Die ersten Gedichte des neuen Bandes erzählen von Beobachtungen beim Hausbau, die des Erzählens nicht wert wären, wenn sie nicht solche Lust machten, dem Gewöhnlichen genauer zuzuschauen. Die Zeit hat offenbar für den Autor gearbeitet; nachdem er ein Zuviel an Außenwelt klug von sich fernhielt, erscheint seine Sensibilität nun weniger als erhöhte Verletzlichkeit, denn als das Vermögen, sein zurückgezogenes Dasein mit einer Intensität und in Einzelheiten zu genießen, wie es überfütterten Sinnen nicht mehr gelingen kann:
Und das gedicht ist verzicht
im leben wie in der sprache
Doch im leben zuerst
und in beidem gleichviel
Nicht mehr an welt,
als du an einsamkeit entbehren kannst…
Es scheint, als erwachse ihm aus diesem Verzicht ein Lebensgenuß, der auch den Tod vertraut macht wie das tägliche Nachtlager.
Nachts
Unhörbar lehnt der hang am haus
noch liegen wir
diesseits
Noch können wir die stille unter dem kopf
aufschütteln
Martin Ahrends, Die Zeit, 26.9.1986
Versöhnung im Verzicht
Politik wäre, auch literarisch, sein Fall nicht gewesen, hätte nicht die Teilung Deutschlands ihn zum Fall gemacht. Seit neun Jahren lebt Reiner Kunze in der Bundesrepublik. Nach einer kurzen Orientierungszeit in München zog er nach Obernzell-Erlau am östlichen Donauufer, unweit Passau. Kunze lebt bewußt abgeschieden vom publizistischen und literarischen Lärm. Er hat nie jemandem nach dem Mund geredet.
Der Mann der Stille ist auch ein Mann der Geduld. Fünf Jahre hat er seit seinem letzten Gedichtband gewartet. Dessen Titel auf eigene hoffnung zeigte an, daß sich der Mensch und Autor Kunze auf eine ideologisch oder kollektiv angebotene Hoffnung nicht einlassen will, daß er aber dennoch – entgegen Nihilismusrede und No-future-Kommentaren – auf Hoffnung lebt. Der Titel des neues Bandes eines jeden einziges leben betont erneut die Individualität des Menschen, den unverzichtbaren Anspruch auf persönliche Identität.
Jeder von uns besteht darauf, daß er
er selbst sein darf.
Kunzes Versarbeit weiß sich höchster persönlicher Wahrhaftigkeit verpflichtet. Nicht nur in der Politik, auch in der Literatur klaffen das rhetorische Wort und das zu lebende Leben mitunter bedenklich auseinander. „Ich mag den Menschen nicht, dessen Leben mit seinen Werken nicht im Einklang steht“, heißt einer von Kunzes neun Vorsprüchen, die er den Gedichtgruppen voranstellt. Der Satz stammt von dem Europa-Politiker Robert Schumann. In den Versen und Sinnsprüchen anderer Autoren führt der Autor nicht nur imaginäre Gespräche mit Dichter-Kollegen. Er begegnet Eigenem, gültig formuliert, wenn er mit Georg Trakl fragt: „Wer bist du Ruhendes unter hohen Bäumen?“, wenn er den Morgendlandfahrer Hermann Hesse anstimmen läßt „Und weiter und zur Welt hinaus“. Im Hierbleiben erscheint immer schon der Abschied.
Aus Wahrnehmungen und Begegnungen formt Kunze sprachliche Bilder. Er sucht die strenge und zugleich intime Beziehung des Schauenden mit dem Angeschauten. Seine Sprach-Bilder gipfeln oft in der überraschenden Pointe oder in einer unerwartet sichtbar gemachten Beziehung zwischen den Dingen und Menschen. Hauptausdrucksmittel ist die Metapher, der abgekürzte Vergleich. Das Gedicht, das einen „Abschied“ am Zug beschreibt, schließt:
Immer ferner die hand mit dem taschentuch
der vogel mit nur einem flügel.
Der absterbende Baum „treibt in der seele / angstnadeln“. Den „Vorfrühling“ vergegenwärtigt der Vers „Das ufer wäscht seine weiden“. Schwieriger wird es, weil metaphorisch überanstrengt, wenn der um seine Bäume besorgte Graf „an den wald sich steckt / letztes reihersilber“.
Durch Beschreibung und Bild läßt Kunze die Dinge zu sich selber kommen. Er zeigt auf seine ruhig eindringliche Weise die von Menschen verursachte Störung des ökonomischen und politischen Hausfriedens an. Zahlenmäßig überwiegen die Gedichte, in denen Orte, Zeiten, Haus- und Naturbilder betrachtet werden. Den Abschied von bösen Verhältnissen und das wiederkehrende Verlangen nach friedvoller Gegenwart hält das Gedicht „Salzburg“ fest:
Heimat haben und weit
und nie mehr der lüge
den ring küssen müssen.
Unter den poetologischen Texten fallen die Zeugnisse persönlicher Bedrängung auf. In seiner „Nocturne auf der höhe des lebens“ führt Kunze in einer Kontrafaktur ein Kränkungsmotiv von Ilse Aichinger weiter:
Kämen die kränkungen
nur mit der post
und am morgen wenn wir
an uns glauben.
Die politischen Unverhältnisse schlagen dem Dichter auch dort ins Gesicht, wo er sie nicht erwartet. Von einer Akademiesitzung unter Kollegen in B(erlin) mit dem „Tagesordnungspunkt Frieden“ muß er notieren:
Du reichst die hand
Zwei verweigern sie dir
Einer von dort
einer von hier
und wir sind fast nur vier.
Manche Vorgänge sind prägnant ins lyrische Notizheft eingetragen. Andere erscheinen in der Form wie in Sprache gemeißelt. Sie wirken statuarisch, Kleinplastiken eines unbestechlichen Liebhabers. Das leichte Lied, das lange Erzählgedicht, der experimentelle Text, das lockere Parlando-Gebilde, die gesellschaftskritische Zornrede in Versen, gehörten nie zu Kunzes Gattungen. Seine Verse drängen zum Spruch, zum Epigramm, zum Gedankenbild, das sich unter starker Binnenspannung dehnt und rundet. Im Sprechgedicht, im rhythmisierten Bild, gerinnt der Augenblick. Betrachtetes und Betrachter werden eins. Das monologische Gedicht ist intensivste Kommunikation, auch mit dem Leser. Dieser spürt, daß der Sprecher ein friedvoll gegenwärtiges Leben in dieser Welt sucht. Aber die meisten Gedichte sprechen von Gefährdung, Bedrängnis, Störung, von angestrengter Selbstbehauptung.
Das imaginistische Bild schließt moralische Absicht, die behutsame oder auch entschieden pädagogische Lehre nicht aus. Gegen formlose Spontaneität drängen Kunzes Gedichte zur strengen Prägung, gegen unbedachtes Dahinleben zum poetischen Andenken, gegen ideologisierende Behauptungen zum einsamen Gespräch. Versöhnung im Gedicht geschieht um den Preis des Verzichts.
Paul Konrad Kurz, Bayerischer Rundfunk, 31.12.1986
Reiner Kunze: eines jeden einziges leben
Reiner Kunze, der in seiner Jugend zu bedingungsloser Parteilichkeit verführt worden war, hatte in den sechziger Jahren – nicht zuletzt durch die Begegnung mit der tschechischen und slowakischen Poesie – als Dichter zu sich selbst gefunden. Je stärker er es dann aber ablehnte, einem politisch-ideologischen Dogma literarisch dienstbar zu sein, desto mehr kam er in Konflikt mit den Anforderungen der Kulturbürokratie in der DDR. 1977 sah er sich schließlich gezwungen, die DDR zu verlassen. Seine entschiedene Haltung jedoch – sie ist kein Rückzug aus der Welt, sondern Bescheidung auf das persönlich Verantwortbare – hat ihm auch bei uns im Westen Unverständnis, ja Feindschaft eingetragen. Daß er den Erwartungen weder der Rechten noch der Linken nachkam, daß er sich vom Literaturbetrieb weithin fernhielt, daß er bei seiner Entschlossenheit blieb, unabhängig zu leben, zu denken und zu schreiben, wurde ihm als Eskapismus angekreidet. Dabei geht es ihm ausschließlich darum, als Schriftsteller nur das zu sagen, was er aus eigener Erfahrung vertreten kann – auf eigene hoffnung, wie der Titel seines 1981 veröffentlichten Gedichtbandes lautet.
Seine nun fünf Jahre danach erschienene Sammlung zeigt in aller Deutlichkeit, daß Kunze kein primär politischer Dichter ist (– was seinerzeit bei der Medienhektik um den „Fall Kunze“ meist übersehen wurde). Kunze ist vielmehr ein Autor, der – so hat er selbst einmal gesagt – schreibt, um innere Situationen zu bewältigen, die er anders nicht bewältigen könne; um Haltungen zu gewinnen; um Flüchtigem ein wenig Dauer zu verleihen:
Ich schreibe, um mein Leben zu intensivieren und… um innere Entfernungen zu Menschen zu verringern, die ich nicht kenne (indem ich versuche, so ehrlich wie möglich zu sein).
Reiner Kunze ist kein Schriftsteller, der Theorien und Philosopheme in Lyrik umsetzt, vielmehr reagiert er mit seiner Poesie auf Erfahrenes, Gesehenes, Erlebtes. Freilich ist die Umsetzung dieses Materials ins Wort ein höchst mühevoller und komplizierter Prozeß, und es bedeutet harte Arbeit, bis das Gedicht als „zur ruhe gekommene unruhe“ vollendet ist –
Und das gedicht ist verzicht
im leben wie in der sprache
Doch im leben zuerst,
und in beidem gleichviel
Nicht mehr an welt,
als du an einsamkeit entbehren kannst
Nicht einmal mehr
an liebe
Wenn dichterische Inspiration und artistisches Kalkül in der rechten Weise zusammenwirken, gelingt es, Lebenswirklichkeit in Sprachwirklichkeit umzusetzen. Dann „stimmen“ die Bilder, die Metaphern muten – so überraschend sie auf den ersten Blick auch erscheinen mögen – wie selbstverständlich an. Die Mühe, die es gekostet haben mag, den „rohen“ Einfall als Inspiration aufzugreifen und zu bearbeiten, ist dann dem gelungenen Gedicht so wenig anzumerken wie einem Diamanten die Mühe anzusehen ist, die es gekostet hat, ihn zu schleifen.
Poetische Kostbarkeiten, Pretiosen ohne Preziosität finden sich in Reiner Kunzes jüngstem Gedichtband in erstaunlich großer Zahl. Wenn er, beispielsweise, die beim abfahrenden Zug winkende Hand mit dem Taschentuch den „vogel mit nur einem flügel“ nennt, wenn es in einem Marseille-Gedicht heißt „und wenn die frauen lange brote / wie fahnenstangen durch die straße tragen an denen / der warme duft weht“, oder wenn ein Gedicht beginnt: „Der wind, der plötzlich aufkam, streicht der kirche / eine strähne tauben aus der stirn“ – dann könnte man solche Bilder vielleicht als glückliche Einfälle verstehen. Daß sie meist viel mehr sind zeigt sich daran, daß der einmal gewählte (gefundene) Bildeinfall stark genug ist, das ganze Gedicht zu bestimmen – etwa:
NACH DEM GROSSEN REGEN
Der haushang, gejätet bis ins schwarze, ist
ein emirat, voll
von des schachtelhalms minaretten
Die steinmispelsträucher
liegen auf den knien, die stirn
am boden
Oder:
DER HIMMEL VON JERUSALEM
Mittags, schlag zwölf, hoben die moscheen
aus steinernen hälsen zu rufen an,
und die kirchtürme fielen ins wort
mit schwerem geläut
Die synagoge, schien’s, zog ihren schwarzen mantel
enger, das wort
nach innen genäht
Dies sind kleine Gedichte, gewiß – aber große. (Der polnische Satiriker Lee soll einmal, auf seine kurzen Aphorismen angesprochen und auf die Frage, ob er auch „größere Sachen“ schreibe, geantwortet haben: Nein, nur große.)
Reiner Kunze schreibt von dem, was ihn angeht: Von Menschen, die ihm nahestehen, von Natur und Jahreszeiten, von Reisen, von Musik, Kunst, Dichtung und auch von seinen Verletzungen, die ihm hier und drüben zugefügt werden. Spürbar, noch immer, ist die Dankbarkeit, frei atmen zu können – „Heimat haben und welt, / und nie mehr der lüge / den ring küssen müssen“ –, spürbar auch noch die Bitterkeit darüber, daß Gespräche und Begegnungen behindert werden, spürbar auch die Furcht davor, daß hierzulande die Kräfte an Einfluß gewinnen könnten, die ihn früher bedrängt haben. Da werden dann – wenn etwa Steinwerfer bei uns als „Vortrupps hier“ erscheinen – irrationale Ängste frei, die dann auch das Gedicht selbst beschädigen; so ist es sicher kein gelungenes Bild, wenn Pflastersteine in den Händen von Demonstranten „die schweren samen / der finsternis“ genannt werden.
Doch solche Fehler fallen kaum ins Gewicht angesichts der Fülle gelungener Gedichte in Reiner Kunzes neuem Lyrikband. Dieses Buch, das die lyrische Ernte aus fünf Jahren einbringt, zeigt die Kontinuität im Werk eines Dichters, der zwar stets von eigenen Erfahrungen ausgeht, mit seinem Gedicht aber immer auf die Menschen zugeht. Sein Gedicht „Der Leser“ lautet:
Wo, wo bliebe das wort, abgeschwiegen
dem tod, wäre, hochgesetzt,
der hallraum nicht
eines herzens
Jürgen P. Wallmann, Neue Deutsche Hefte, Heft 194, 2/1987
eines jeden einziges Leben
Ein Vergleich der Titel und Motti der Gedichtbände auf eigene hoffnung und eines jeden einzelnes leben läßt bereits erste wichtige Unterschiede erkennen. Im Titel auf eigene hoffnung wird die individuelle Sphäre noch gesellschaftlichen Perspektiven gegenübergestellt. weil er – wenngleich adversativ – auf die konkrete Utopie des „Prinzips Hoffnung“ oder auf die heilsgeschichtliche Dimension einer „Theologie der Hoffnung“ Bezug nimmt. Der Buchtitel eines jeden einziges leben beschränkt sich dagegen auf das Individuelle und Existentielle, ohne es länger in Beziehung zu setzen zu einem politisch und theologisch stark konnotierten Begriff wie dem der Hoffnung.
Seinem Gedichtband auf eigene hoffnung hat Reiner Kunze folgenden Satz aus Gottfried Benns Marginalien zu einem geplanten Essay mit dem Titel „Nihilistisch oder positiv?“ vorangestellt:
… Resignation ist kein Nihilismus; Resignation führt ihre Perspektiven bis an den Rand des Dunkels, aber sie bewahrt Haltung auch vor diesem Dunkel.
Das aus dem Zusammenhang gerissene Zitat ist vor allem deswegen als Motto eines Gedichtbandes verfänglich, weil Kunze sich dadurch in eine Tradition monologischer, artistischer Kunst zu stellen scheint, in die er mit seinen dialogischen, kommunikativen Gedichten nicht gehört. Und der Begriff der „Resignation“, auch wenn er von Benn umgedeutet wird zu einer Haltung des Dennoch, verfehlt Kunzes Dichtung, die sich in ihrer Daseinsbejahung ausdrücklich gegen jede bloße Verneinung wendet. Für den Band eines jeden einziges leben hingegen hat Kunze einen Satz aus Achim von Arnims Die Majoratsherren gewählt, der mit dem Titel des Bandes und mit dessen Einzeltexten aufs genauste korrespondiert:
Jeder Mensch fängt die Welt an, und jeder endet sie.
Die Defensivposition vieler Gedichte des Bandes auf eigene hoffnung hat Kunze in seinem zweiten Gedichtband nach der Übersiedlung aufgegeben, so daß in den Texten von eines jeden einziges leben größeres Selbstvertrauen sichtbar wird.
Kunze widmet sich zwar weiterhin mit den von ihm bevorzugten und kontinuierlich angewandten ästhetischen Mitteln (Reduktion, Metaphorik, epigrammatische Zuspitzung und Wortspiel) den Themenkreisen Politik und Poesie, Natur und Landschaft, Religion und Ethik, aber gerade in thematischer Hinsicht sind doch deutliche Veränderungen auszumachen. Nicht mehr das große Thema Individuum und Gesellschaft ist vorherrschend, nicht der Mensch als Zoon politikon, sondern der Mensch als Individuum ineffabile steht nunmehr im Mittelpunkt der meisten Gedichte, in denen Worte wie „Leben“ oder „Tod“ leitmotivische Qualität haben.
In Reiner Kunzes Buch Das Kätzchen, dessen Verse für Kinder bereits in der DDR geschrieben, aber erst 1979 in der Bundesrepublik veröffentlicht worden sind, finden sich folgende, ebenso einfache wie bekenntnishafte Verse:
Das größte Wunder selbst auf Erden
muß aus dem Leib geboren werden:
Verwundert steht das Menschenkind
vor all den Wundern, die da sind.
Das Staunen – eine wichtige Kategorie der Philosophie Ernst Blochs – ist für Reiner Kunze ein Schlüssel der Apperzeption. Das verwunderte Entdecken des noch immer unerschöpflich anmutenden Reichtums und der unermeßlichen Vielfalt der Natur ist ein entscheidender Zugang zur Welt. Wenige Tage nach seiner Übersiedlung im April 1977 sprach Kunze in einem Interview mit einer Emphase, die den außerordentlichen Leidensdruck, dem er jahrelang in der DDR ausgesetzt war, spüren ließ, von den Wundern dieser Welt:
Wir sind so reich an Wundern, die uns die Menschen, die vor uns lebten, hinterlassen haben – in der Musik zum Beispiel und in der Malerei, und auch an Wundern der Natur. Man muß einander helfen, die Augen zu öffnen und von diesen Wundern zu sehen, was die Wimper hält.
In einigen Gedichten des Bandes eines jeden einziges leben zeigt sich dieser staunende Zugang zur Natur ungebrochen und von den Zeitläuften unbeeinträchtigt. Gerade die Tages- und Jahreszeitengedichte halten Gegebenheiten fest, die als Bestandteil zyklischer Prozesse der Gewöhnung und Nichtbeachtung unterliegen, die aber in der Sprache der Poesie neu und anders wahrgenommen werden können. Die Gedichte zeigen, daß es die ,alte Welt‘ noch gibt und daß man sie mit neuen Augen sehen kann:
VORFRÜHLING
Die wiese, in der tiefe noch gefroren,
blüht vor möwen
Das ufer wäscht seine weiden
Die schleife, die der fluß zieht, bindet
mit jedem morgen fester
Hier ist Natur – im Sinne Norbert Mecklenburgs – zum „Reflexionsmedium“ geworden. Kunzes naturlyrische Gedichte waren allenfalls in seinen Anfängen noch „lyrischer Fluchtort für den weltfremden Idylliker, der sich aus der Realität der Städte, des Verkehrs und der Industrie absetzt, weil er die besinnliche und beschauliche ,Ruhe‘ sucht.“ Schon Ende der fünfziger Jahre aber waren sie Reflexionsmedium, Inspirationsquell und Metaphernfundus für gesellschaftskritische und allegorische Texte wie „Der Hochwald“ oder „Sensible Wege“. Die Landschaft, also Natur in der Handschrift des Menschen, wurde mehr und mehr zu einem Terrain, in dem historische und politische Prozesse Spuren hinterlassen haben. Kunzes Gedichte über die Natur sind fortan immer auch Gedichte über den Menschen und sein Verhältnis zur Natur. Die Landschaft, die Kunze ebenfalls zu den Wundern zählt, sieht er am Beginn der achtziger Jahre durch die wachsende Instrumentalisierung (in der politischen Diskussion) noch stärker bedroht und gefährdet:
TAGBUCHBLATT
Die klelterrosen blühn, als verblute die landschaft
Als habe sie sich die adern geöffnet
Als wisse sie, was kommt
Auch die landschaft, werden sie behaupten, dürfe
nicht mehr nur sein, auch sie
müsse dafür sein oder dagegen
Aber nicht nur die Instrumentalisierung, auch die Zerstörung von Natur und Landschaft ist zu einem wichtigen Thema in der Lyrik Kunzes geworden. Einige Gedichte des Bandes eines jeden einziges leben sind, weil sie Naturgedichte sind, auch Zeitgedichte und, wie es im Gedicht „Kleines Ruhmesblatt für Alexander Graf von Faber-Castell“ heißt „echos gewesener landschaft“. Die naturlyrischen Gedichte Kunzes meiden jedoch das Vokabular tagespolitischer Diskussionen um die Erhaltung der Umwelt und den Agitprop einer sogenannten Ökolyrik. Beispielhaft hierfür ist folgendes Gedicht. über das Hilde Domin in ihren Frankfurter Poetik-Vorlesungen voller Anerkennung sagt:
Sicher aber kann unser Kummer, der ja die Liebe zu dem, was gefährdet ist, noch steigert, nicht bewegender ausgedrückt werden als in diesen Zeilen Reiner Kunzes:
UNTER STERBENDEN BÄUMEN
Wir haben die erde gekränkt, sie nimmt
ihre wunder zurück
Wir, der wunder
eines
Der Titel weist das 1983 entstandene Gedicht als einen literarischen Text unserer Zeit aus, als ein Zeitgedicht. Nur in der Überschrift des dreiteiligen emblematischen Gedichts wird Natur sichtbar, und zwar als sterbende Natur. Von diesem Tatbestand ausgehend, folgt in vier Versen eine epigrammatisch zugespitzte Reflexion. Sie wird vorgetragen im Ton „konstatierender Trauer“ und nicht mit „trauernder Wut“. Es ist ein Gespräch über (sterbende) Bäume – wiederum in der Nachfolge von Brechts Gedicht „An die Nachgeborenen“. Dabei zielt das Gedicht Kunzes nicht auf eine Parteinahme in der tagespolitischen Debatte, sondern auf Grundsätzliches. Appellativ ist allenfalls die Wir-Apostrophe, die nicht nur den Autor und den Leser, sondern generell den Menschen meint. Kunze will Überindividuelles, Fundamentales zur Sprache bringen. Die Erde – ebenso wie der Himmel eines der Schlüsselwörter der Naturgedichte Kunzes nach der Übersiedlung – wird zum Partner des Menschen, der, innerlich tief verletzt, den kreatürlichen Reichtum verweigert. Der Mensch, selbst Natur und von ihr abhängig, wird im Gedicht „Unter sterbenden Bäumen“ nicht als Krone der Schöpfung oder als Ebenbild des Schöpfers gesehen. Im Gegenteil: in den elliptischen, inversiven Schlußzeilen, die den konstatierenden Aussagesätzen des ersten Gedichtteils folgen, wird er nur als eines unter vielen Wundern der Erde angesprochen, als eines allerdings, das Zerstörung und Selbstzerstörung auslösen kann und auch auslöst. Formal wird dies durch die Einwortzeile „eines“ am Schluß des Gedichts realisiert.
Kunzes Gedicht ist in seinem ernüchternden Realismus ganz auf die Gegenwart bezogen, intendiert aber eine zeitenthobene, existentiell begründete Einsicht der Kreatur Mensch. Der Leser wird nicht mit zeittypischen apokalyptischen Bildern und Endzeitvisionen konfrontiert und schockiert, ihm wird vielmehr eine Erkenntnis zugemutet und abverlangt, die Bundespräsident Richard von Weizsäcker am 18. Oktober 1986 in seiner Ansprache bei der Kundgebung der Umweltbewegung „Initiative Schwarzwald“ auf dem Hohen Thurner bei St. Märgen, nachdem er Kunzes Gedicht „Unter sterbenden Bäumen“ zitiert hatte, so formulierte:
Die Erde ist älter als die Menschen, die Erde wird die Menschen auch überdauern. Sie wird uns Menschen beherbergen, solange wir unseren angemessenen Teil von ihren Kräften für uns in Anspruch nehmen, aber eben nur den angemessenen Teil und nicht mehr. Wir werden allen unseren Fähigkeiten zum Trotz nie die Natur beherrschen; wir sind und bleiben vielmehr ein Teil des Leben erhaltenden Kreislaufs. Dieses wollen wir bleiben, und das können wir, wenn wir den Kreislauf nicht zerstören, sondern achten lernen.
Das Gedicht „Unter sterbenden Bäumen“ ist ein konstatierender und kontemplativer, nicht aber ein gesellschaftskritisch auftrumpfender Text. Den weitverbreiteten resignativen Texten der Gegenwartsliteratur, die Spiegel einer menschheitsgeschichtlichen ,Spätzeit‘ (vor dem Weltende) sind, steht Kunzes Gedicht insofern entgegen, als es Einsicht in die Fehlentwicklung und eine Korrektur der Naturzerstörung noch für möglich hält. Es setzt gleichsam die letzte Hoffnung auf den Menschen als einem der Wunder dieser Natur.
Daß auf dasselbe Problem mit poetischen Mitteln anders und künstlerisch ebenso originär wie anspruchsvoll geantwortet werden kann, zeigt ein Gedicht aus Sarah Kirschs 1984 erschienenem Gedichtband Katzenleben:
BÄUME
Früher sollen sie
Wälder gebildet haben und Vögel
Auch Libellen genannt kleine
Huhnähnliche Wesen die zu
Singen vermochten schauten herab.
Die fünf syntaktisch dicht gefügten Verse wollen zwar auch Nachdenklichkeit und Betroffenheit auslösen über die zerstörte Natur, aber sie tun dies mit anderen Mitteln als das motivverwandte Gedicht Kunzes. Sarah Kirsch spricht von der Gegenwart, indem sie die Zeitperspektive verfremdet und eine Zukunft vergegenwärtigt, von der aus unsere Zeit nur noch als erinnerte („früher“) existiert. Bäume gibt es nur noch im schon getrübten Gedächtnis („sollen sie“) menschenähnlicher Wesen von morgen. Die Verfremdung durch die Zeitverschiebung wird noch gesteigert durch die spekulierende Rede von Vögeln, die es nicht nur nicht mehr gibt in der (zukünftigen) Welt, sondern die selbst in der Erinnerung nur noch vage präsent sind. Die Appositionen, im grammatikalischen Sinn nachgestellte genauere Bestimmungen, werden in ihrer Fehlerhaftigkeit und Ungenauigkeit zu irritierenden Aussagen. Auch der märchenhafte Ton des Gedichts wirkt, wie Karl Riha festgestellt hat, „so schockierend, weil er unsere Gegenwart in die Ferne einer längst vergangenen und nicht mehr restituierbaren Zeit rückt.“ Bäume und Vögel sind tot. Sie existieren nur noch im gestörten Gedächtnis des lyrischen Rollensprechers oder als Worte in einem lyrischen Antimärchen. Wegen seiner Verfremdungstechnik und Irritation scheint Sarah Kirschs Gedicht „Bäume“ weit weniger prädestiniert zu sein, von Politikern zitiert und gedeutet zu werden als Kunzes „Unter sterbenden Bäumen“. Zudem manifestiert sich in ihm viel deutlicher als im Gedicht Kunzes, daß die Zerstörung der Natur auch Folgen hat für die Sprache des Naturgedichts, die „Annäherung an Ereignisse und Dinge der Natur ist kein einfacher Vorgang der Gegenüberstellung von Ich und Objekt, sondern ein mühsamer Vorgang der Suche und des skrupulösen Wählens und Abtastens.“
Mit den Bäumen sind auch die Vögel und deren Gesang aus der Welt und nur noch durch Erinnerung zurückzuholen. Dies hat Konsequenzen auch für den ,Gesang‘ des Dichters. Sarah Kirsch gelingt es, diesen Verlust unmittelbarer Naturlyrik angesichts einer zerstörten, nicht nur kranken Natur bewußt zu machen und sprachlich überzeugend darzustellen. Unüberhörbar ist dabei das Versmaß des elegischen Distichons, insbesondere des Pentameters, in den Schlußversen ihres Gedichts.
Auch Reiner Kunzes Gedicht „Moment absurde“, Mitte der achtziger Jahre entstanden, spricht nicht mehr nur von einer Kränkung der Erde durch den Menschen, sondern es faßt ihre möglich gewordene totale Vernichtung durch den Homo sapiens ins Auge. Unmöglich geworden scheint ihm eine Eloge auf die Natur wie in Mörikes Frühlingshymnus „Er ist’s“.
MOMENT ABSURDE
Die erde ein scharf berechneter
scheiterhaufen
Frühling läßt sein blaues Band…
Niederbrennbar nun
alle himmel
Durch Kunzes Gedicht verläuft das Mörike-Zitat wie ein Riß, der die Fremdheit und Distanz zwischen Mensch und Natur unüberbrückbar erscheinen läßt. Die Absurdität einer Existenz, die einerseits die Erde als Scheiterhaufen erkennen muß und die andererseits Harmonie mit der Natur ersehnt, wird vor Augen geführt. Das Gedicht „Moment absurde“ ist aber auch ein Text über das Ende traditioneller Naturlyrik. Das poetische Sprechen von der Natur als heiler Natur scheint nur noch im Zitat möglich. Im „Naturgedicht 7“ von Gregor Laschen wird diese Ernüchterung mit (postmoderner) Ironie zum Ausdruck gebracht:
[…] Das Naturgedicht
ist der letzte Text über die
Naturgedichte lange vor uns, hölzerne Suche
nach Bäumen in Gedichten
über was man
für ein Verbrechen hielt, als
es
noch
Bäume
gab.
Reiner Kunzes poetische Dialoge mit der Natur thematisieren die Bewohnbarkeit der Erde, bestaunen einerseits deren Natur-Wunder, erkennen aber in ihr auch den potentiellen Scheiterhaufen. Daseinsbejahung und das Bewußtsein individueller und globaler Gefährdung stehen in einem Spannungsverhältnis, das Skepsis, nicht jedoch Resignation zur Folge hat:
Wenn ich sehe, welcher Baum nächstes Jahr wahrscheinlich fällig ist, dann heißt das doch nicht, daß ich nun ab heute nicht mehr durch den Wald gehen kann, und nicht noch das, was an Großartigem über Jahrhunderte auf uns gekommen ist, in meine Lungen, in meinen Blick aufnehmen soll. Das nimmt die Trauer über die mögliche Berechtigung meiner Skepsis für übermorgen nicht aus meinem Leben heraus.
Solche auf Vermittlung und Versöhnung zielende Haltung (zwischen Carpe diem und Memento mori) führt auch in Kunzes Gedichten immer wieder zu Bildern der Annäherung und zu metaphorischen Brückenschlägen:
ABENDS
Der berg legt den wald
in den nacken, sein schwarzes
geweih
Der himmel, der fegebaum, wirft
sterne ab, und an milchigem geäst
weht ein rest von bast
Nicht das mythologische Vereinigungsmotiv aus Eichendorffs Gedicht „Mondnacht“ wird hier evoziert oder repetiert, sondern die abendliche ,Schwellenzeit‘ wird in außergewöhnlicher Metaphorik zu einem Bild der Verbindung von Himmel und Erde. Der Berg repräsentiert metonymisch die Erde und wird in einer kühnen Metapher identifiziert mit einem Tier des Waldes (Reh oder Hirsch), das von seinem Geweih die junge Haut, den Bast, abstreift oder fegt, indem es dieses gegen den Himmel, den Baum, schlägt oder reibt. Für einen Augenblick scheint die kosmische Verlorenheit der Erde – wenigstens im Gedicht – überwunden zu sein. Doch selbst diesem Naturgedicht Kunzes ist trotz seiner Evokation einer entgrenzenden Abendstimmung das Wissen um die Vergänglichkeit und um das existentielle Dunkel inhärent.
Neben den naturlyrischen Texten sind die poetologischen Gedichte im Gedichtband eines jeden einziges leben das dominierende lyrische Genre. Im Gegensatz zu Kunzes früheren Gedichten gelten sie kaum noch der (offensiven) Verteidigung der Poesie gegen eine restriktive Kulturpolitik und gegen den Warenhauscharakter des Literaturbetriebs. Mit großem Ernst und Pathos, aber auch mit leiser Ironie widmen sich die Gedichte zum Gedicht der Inspiration, Produktion, Profession, Rezeption und Interpretation, wobei „Dichter“, „Wort“ und „schweigen“ zu Schlüsselwörtern werden. Diese Poesie der Poesie wird noch gesteigert durch ein dichtes Netz von Zitaten und Namen aus Literatur, Musik, Malerei und bildender Kunst. Allein in eines jeden einziges leben findet sich eine Galerie großer Namen: Ilse Aichinger, Jean Améry, Achim von Arnim, Konstantin Biebl, Constantin Brâncusi, Albert Camus, Hans Carossa, Friedrich Hebbel, Hermann Hesse, Wolfgang Hilbig, Vladimír Holan, Peter Huchel, Sergej Jessenin, Marie Luise Kaschnitz, Alfred Kubin, Milan Kundera, Oskar Loerke, Edvard Munch, Fernando Pessoa, Robert Schumann, Jan Skácel und Georg Trakl. Eine so vielstimmige poetische Vernetzung ist offenkundig nicht als Standortbestimmung oder bewußte Traditionseinbindung zu verstehen, sondern Kunze sieht in ihr ein Mittel zur Potenzierung der poetischen Wirkung und führt so einen selbstbewußten Dialog der Poesie mit der Poesie.
Eine spezifische Form des poetologischen Gedichts ist das Bildgedicht oder auch ikonozentrische Gedicht. Mit dem Band eines jeden einziges leben knüpft Kunze wieder an seine Bildgedichte aus den sechziger Jahren an. Die Verringerung der Bedrängnis infolge veränderter kultur- und gesellschaftspolitischer Bedingungen hat den ästhetischen Spielraum für das poetologische Gedicht erweitert. Harald Hartung beachtet zu wenig die poetische Originalität und werkgeschichtliche Bedeutung der ikonozentrischen Gedichte Kunzes, wenn er schreibt:
In solchen poetischen Reaktionen ist der eigene Lebensstoff nicht stark genug, um sich gegen das Abgeleitete, Vermittelte zu behaupten.
Dem ist entgegenzuhalten, was Anneliese Senger als die spezifische Rezeptionsmöglichkeit von Bildgedichten bezeichnet hat, daß nämlich „der reale Gegenstand, der ,Stoff‘, die ,Quelle‘, eines literarischen Werks unzweifelhaft feststeht, meist noch vorhanden und mit dem Text vergleichbar ist. Ein weiteres Faktum macht das Bildgedicht interessant: der Gegenstand des Bildgedichts ist wirklich, aber er ist nicht ein Stück unmittelbarer, sondern bereits künstlerisch gestalteter Wirklichkeit.“ Neben diesen prinzipiellen Rezeptionsmöglichkeiten sind Kunzes Bildgedichte aber auch für dessen Ästhetik, Poetik und Ethik von großer Aussagekraft.
Sein bedeutendes Bildgedicht „Brâncusi: Der Kuß, Grabskulptur auf dem Friedhof Montparnasse“ ist 1982 entstanden. Fünfzehn Jahre zuvor hatte bereits Ernst Jandl zur gleichen Skulptur des rumänischen Bildhauers ein konkretes Gedicht geschrieben:
ja ja
ja ja
ja ja
ja ja
aaja
ja ja
ja ja
ja ja
ja ja
Jandl findet mit diesem visuellen Text eine wohl kongenial zu nennende Entsprechung zur Reduktionskunst von Constantin Brâncusi. Das Gedicht bildet dabei Wirklichkeit nicht ab, es erzählt auch nicht von künstlerisch gestalteter Wirklichkeit, sondern es ist selbst Bild, figürliche Darstellung mit Hilfe von zwei Buchstaben. Jandl antwortet dem Bildwerk aus Stein mit einem Bildwerk aus Sprache. Durch diese „semiotische Äquivalenz“ unterscheidet es sich von traditionellen Bildgedichten, die nicht homogene, sondern heteronome Formen der Rezeption sind. Jandl beschränkt sich auf nur ein einsilbiges Wort aus dem deutschen Wörterbuch, auf das Urwort der Zustimmung und Zuwendung, wiederholt es siebzehnmal und bringt es in eine räumliche Anordnung. Die senkrechten Reihen repräsentieren das Liebespaar, das aus der Reihe tanzende „ja“ figuriert als Körpermitte oder Mund. Wie Brâncusis Bildwerk so wird auch Jandls Bildgedicht zu einem Sinnbild der Lebensbejahung, zur Hommage an die Liebe, wobei es „entmaterialisiert, was vom Stein des Bildhauers etwa noch zu abstrahieren gewesen war“.
Von der Bildhauerkunst Brâncusis fühlte sich Reiner Kunze schon in den sechziger Jahren angezogen. In dem Gedicht „Kleine Reisesonate“ aus dem Jahre 1966 formuliert er sein leicht verschlüsseltes Bekenntnis zu dem in seiner Heimat lange umstrittenen, ihm künstlerisch wahlverwandten Rumänen, dessen Skulpturen „Endlose Säule“, „Tisch des Schweigens“ und „Tor des Kusses“ in Tirgu Jiu, dem Geburtsort Brâncusis, im Freien aufgestellt sind.
Nein, keinen bruder habe ich in Bukarest, nur
brüder
Brâncusi aber zählt nicht
Auf dem Friedhof Montparnasse steht Kunze Anfang der achtziger Jahre, als er sich während einer Lesereise in Paris aufhält, einer der bekanntesten Plastiken dieses Künstlers gegenüber:
BRANCUSI: DER KUSS, GRABSKULPTUR
AUF DEM FRIEDHOF MONTPARNASSE
Als hätten sie sich verirrt
zwischen diesen festungen von gräbern
und der friedhof habe unter aufbietung der letzten mauer
sie auf der flucht gestellt,
um endlich zwei zu haben
die leben
Im Gegensatz zu Jandl hat Kunze, worauf bereits die genaue Standortbestimmung des Bildgedichttitels hindeutet, vor allem die Tatsache beschäftigt, daß die Kuß-Skulptur an diesem Ort zu finden ist. Das Ambiente, der Kontext lassen das Kunstwerk in neuem Licht erscheinen. Der Lebenszusammenhang, in dem es hier inmitten von Gräbern, unweit des Großstadtverkehrs, steht, inspiriert den Autor des Bildgedichts zu einer originären poetischen Rezeption.
Als hätten sie sich verirrt
zwischen diesen festungen von gräbern
Kunze zeigt an einer Repräsentation oder poetischen Reproduktion des Kunstwerks kein Interesse und setzt beim Leser des Gedichts die Kenntnis des Künstlers und seiner Skulptur voraus. Das Mimetische beschränkt sich allein auf die Welt des Friedhofs mit ihren typischen Erscheinungsformen. Die Suppletion, das heißt: die Ergänzung des Lebenszusammenhangs, schafft die Kulisse eines Irrgartens aus Mauern, zahllosen Wegen und einer Unzahl von Gräbern. Das „Als-ob“ schöpferisch-spielerischer Phantasie, mit dem das Gedicht einsetzt, versetzt Skulptur und Leser in die Möglichkeitswelt der Poesie. Das anaphorische Personalpronomen „sie“ knüpft gleichsam am Vorwissen des Rezipienten an, an seine Kenntnis des Standbildes, wodurch die Küssenden mit dem Pronomen zu identifizieren sind. Das Statische der Grabskulptur verwandelt Kunze, der Laokoon-Thesen Lessings eingedenk, im Gedicht in eine Geschichte von Verirrung und Verfolgung.
und der friedhof habe unter aufbietung der letzten mauer
sie auf der flucht gestellt
Der assoziative Bildeinfall des Gedichtanfangs wird fortgeführt und durch die Personifikation des Friedhofs als Verfolger des Liebespaares gesteigert. Die Inversionen der dritten und vierten Zeile werden dabei zu syntaktischen Abbildern der Verfolgung und Gefangennahme. Die Antagonisten erhalten mythologische Qualität: Thanatos und Eros treffen – wie in Conrad Ferdinand Meyers Gedicht „Der Marmorknabe“ – unmittelbar aufeinander. Die Erotik wird aber, wie in den neueren Liebesgedichten Kunzes obligatorisch, in eine ideelle Aussage überführt. Auch Brâncusi wollte, wie der Kunsthistoriker Pontus Hulten resümiert, „daß sein Werk nach Form und Inhalt universal sei. Es sollte für immer und überall sein und für jedermann verständlich. Seine Themen betrafen jedes menschliche Sein: Mann, Frau, Leben, Tod, Liebe, Ewigkeit.“ All diese existentiellen Themen werden auch im Bildgedicht Kunzes angesprochen. Als Friedhofsgedicht handelt es von Leben, Tod und Ewigkeit, als Liebesgedicht von der Liebe zwischen Mann und Frau. Gerade in dieser bei Kunze oft anzutreffenden Verknüpfung von Liebes- und Todesmotiv liegt auch eine entscheidende Qualität dieses Bildgedichts. Durch Suppletion und Assoziation gelangt Kunze zu einer Interpretation der Skulptur, die dem konkreten Bildgedicht Jandls durchaus an die Seite zu stellen ist.
um endlich zwei zu haben
die leben
Mit der Paradoxität dieses Finalsatzes, der das Motiv des Verfolgers (Friedhof, Thanotos) nennt, endet das Gedicht. Der Lebensverneiner und -verächter ist der Totenwelt des Friedhofs überdrüssig. Das letzte Wort des Gedichts heißt „leben“. Auf dieses infinite Verb bewegen sich alle anderen Worte des Gedichts zu. In ihm liegt wie in Jandls ,Ja-Wort‘ die eigentliche Interpretation der Skulptur begründet. Das letzte Wort wird zum Schlüsselwort. Bildwerk und Bildgedicht werden angesichts des Todes zu einem Hymnus auf das Leben, zu einem Hohenlied der Liebe. Bedenkt man überdies, daß Brâncusi selbst größten Wert auf den Standort seiner Plastik legte und daß von Kunsthistorikern in der raumbestimmenden Plastik Brâncusis entscheidende künstlerische Leistung, die „Quintessenz seines Lebens“ besehen wird, dann ist Kunzes ikonozentrisches Gedicht nicht nur eine gelungene Interpretation eines Einzelwerks, sondern eine Auseinandersetzung mit dem Kunstideal des rumänischen Bildhauers überhaupt. Hinzu kommt, daß Brâncusi selbst es war, der den Friedhof als idealen Standort für die Kuß-Skulptur eingestuft und sie dort, wo sie nicht zu einem dekorativen Accessoire verkommen, sondern ihre Symbolkraft entfalten konnte, eigenhändig aufgestellt hat.
Daß nicht das traditionelle Friedhofsmotiv des Grabkreuzes oder Grabengels; sondern die ,profane‘ Kuß-Skulptur Kunze zu einem Bild- und Liebesgedicht inspiriert hat, stellt es in einen thematischen und werkgeschichtlichen Zusammenhang mit einem anderen Friedhofsgedicht, das noch in der DDR entstanden und in der Tradition von Brechts „Ich benötige keinen Grabstein“ zu sehen ist:
AUCH EINE HOFFNUNG
Ein grab in der erde
Hoffnung aufzuerstehen
in einem halm
(Grabplatte keine
Nicht noch im tod
scheitern an stein)
Von einer Auferstehungshoffnung im christlichen Sinn wird auch hier nicht gesprochen. Hoffnung auf ein Weiterleben besteht allenfalls in einem immanenten, vegetabilen Sinn. Der tote Stein ist es, der – wie im Brâncusi-Gedicht die Mauern – am Leben hindert, am Leben vor und nach dem Tode. Der künstlerisch gestaltete Stein, das Kunstwerk aber kann zum Inbegriff des Lebens werden und der künstlerischen Idee ein Weiterleben ermöglichen. So gesehen ist Kunzes Gedicht auf die Kuß-Skulptur Ausdrucks eines Glauben an die Lebens- und Überlebenskraft der Kunst. Im Kunstwerk Brancusis und im Bildgedicht Kunzes aber ist es die Liebe, die, wie es im Hohenlied des Alten Testaments heißt, „stark ist wie der Tod“. Und der Kuß, nicht Kreuz oder Engel, wird – im doppelten Sinn – zum Symbol des Lebens.
Das Motiv des Todes ist im Band eines jeden einziges leben zu einem Leitmotiv geworden, und es dominiert auch die wenigen Liebesgedichte. Aber schon im Band auf eigene hoffnung war diese Eigentümlichkeit der Liebesgedichte Kunzes, die dadurch an eine Motivkombination der deutschen Romantik anknüpfen, offenkundig.
AUF DEM FRIEDHOF VON O.
(für Elisabeth)
Eine enge, als neideten die gräber
einander die erde
Keine bank, deren lehne dann dir oder mir
ein flügel werden könnte
Seit den Widmungen haben die Liebesgedichte Kunzes einen Prozeß der Entsinnlichung durchlaufen und sich immer stärker der Sinnfrage zugewandt. In der deutschsprachigen Lyrik der siebziger und achtziger Jahre nehmen sie eine Sonderstellung ein, indem sie sich ausschließlich und hymnisch einer Partnerschaft voller Positivität und Einverständnis widmen. Das Unzeitgemäße dieser Liebesgedichte, die immer auch als Ehe-Gedichte zu lesen sind, stellt Hiltrud Gnüg heraus, wenn sie die Beobachtung macht, „daß die Lyrik der letzten Jahrzehnte eher die Schwierigkeiten einer harmonischen Liebesbeziehung thematisiert, die Vergänglichkeit der Gefühle reflektiert, eher Momente erotischer Erfüllung darstellt als eine als glücklich oder wenigstens befriedigend erfahrene dauerhafte Beziehung.“ Der Rückhalt im Privaten und die sinnstiftende Kraft erfüllter Partnerschaft wird bei Kunze zur Antwort auf die Frage nach dem Sinn menschlicher Existenz in einer von ihm als absurd erfahrenen Welt. Als Motto für Kunzes Liebesgedichte kann folgender Satz von Albert Camus gelten: „Es herrscht das Absurde, und die Liebe errettet davor.“ Auf Kunzes dichterisches Werk bezogen, müßte der Satz modifiziert werden: Es herrscht das Absurde, und Kunst und Liebe erretten davor.
Heiner Feldkamp: Poesie als Dialog. Grundlinien im Werk Reiner Kunzes, S. Roderer Verlag, 1994
Pathos des Herzens
Reiner Kunze hat fünf Jahre gewartet, bevor er seinem ersten in der Bundesrepublik entstandenen Lyrikband, Auf eigene Hoffnung, nun ein neues Buch mit Versen folgen ließ. Seine Geduld hat sich gelohnt. Die auf neun Zyklen verteilten Texte von Eines jeden einziges Leben sind ausgereifte Verlautbarungen in einer ernsten, ruhigen, sehr eigenen Sprache.
Wiederum bekundet Kunze eine Vorliebe für das kurze Poem, dem er Erfahrungen seines Lebens anvertraut, nicht selten mit einem didaktischen Unterton. Typologisch handelt es sich teils um Epigramme, teils um Bildgedichte imagistischer Prägung:
Ihre fahnen schlagen unsre ideale in den wind
und wir heißen fahnenflüchtig weil wir
den idealen treu geblieben sind
Solchen lakonischen Äußerungen von umrißscharfer Begrifflichkeit, in denen pointiert Meinungen vorgetragen werden, stehen Stücke entgegen, in denen keine gedankliche Befunderhebung stattfindet, sondern seelisches Erleben mitgeteilt wird, in der changierenden Sprache des Metaphorischen:
NACH DEM GROSSEN REGEN
Der haushang, gejätet bis ins schwarze, ist
ein emirat, voll
von des schachtelhalms minaretten
Die steinmispelsträucher
liegen auf den knien, die stirn
am boden
Dieses kleine Gedicht lebt ganz aus seiner visuellen Plausibilität. Ein Stück beobachteter Gartenwelt wird präzise ins Verbale transponiert. Die sinnliche Wahrnehmung reicht in den Bereich des Geistigen hinein: Die Phantasie verwandelt das miniaturhafte Sujet in etwas anderes, Bedeutsameres. Das Wort „emirate“, raffiniert vorgeschaltet, bereitet das Bild von den Schachtelhalmen, die die Anmutung von Minaretten vermitteln, vor; und durch eine strikte Beschränkung der Assoziation auf das, was dem Text dienlich ist, wird in der zweiten Strophe die klassische islamische Gebetssituation evoziert, durch die Gleichsetzung der Steinmispelsträucher mit Gläubigen, die kniend mit der Stirn den Boden berühren.
Kunze ist ein Meister des Leisen, Zarten, Behutsamen. Seine Verse sind antirhetorisch, wenn es bei ihm andererseits auch ein Pathos des Herzens gibt, wie in dem Gedicht, in dem er auf die ökologischen Wunden zu sprechen kommt, die der homo novus der Natur geschlagen hat:
Wir haben die erde gekränkt, sie nimmt
ihre wunder zurück
Wir, der wunder
eines
Bei Kunze, wie bei jedem echten Poeten, entwickelt sich das essentiell und sprachlich Verobjektivierte aus – zunächst – subjektiven Momenten. „Das Kunstwerk“, sagt der Autor in seiner Rede, die er zur Eröffnung der Kulturwochen in Hauzenberg 1986 hielt, „führt hin zum einzelnen Menschen, zu dem, was in ihm vorgeht, zu seiner – zu unserer Mitte.“
Dieser Lyriker, traumatisiert durch seine Erfahrungen in der DDR und später irritiert und verletzt durch Vorkommnisse hier in der Bundesrepublik, ist gegen eine parteipolitische oder konfessionell verpflichtete Kunst, und er erklärt sich auch gegen eine Kunst, die allen oktroyiert werden soll, „wie viele Plätze auch leer bleiben mögen“.
Im Nachwort von Eines jeden einziges Leben ist davon die Rede, daß es hundert und mehr poetischer Einfälle bedürfe, um einen Lyrikband zusammenzubekommen, in dem die Erscheinungen der Welt schöpferisch oder, wie Kunze es ausdrückt, entdeckerisch miteinander verknüpft werden.
Das Engagement des Dichters, sein Verstricktsein in die Zeitumstände, ist geblieben. Aber das Maß an Freiheit – an Abstand zu dem, was von außen herangetragen und innerlich abgelehnt wird – hat zugenommen. Diese größere seelisch-geistige Unabhängigkeit bekommt den Poemen, die, weil sie nun weniger reaktiv sind, verstärkt Phantasie entwickeln und mehr sinnliche Details aufnehmen können, als das in den letzten beiden Bänden der Fall war.
Gewiß, ein Stück des Stacheldrahts der deutschen Teilung wird wohl für immer durch die Brust und das Bewußtsein dieses Lyrikers gehen. Doch, zu Hause und auf Reisen, findet Kunze wieder zusehends Spaß an den einfachen Erscheinungen des Lebens, die ihm zu einem psychischen Gesundbad und zu Anlässen eines gelösteren poetischen Sprechens verhelfen, wie in dem Gedicht „Orientierung in Marseille“.
Morgens wenn die nacht aus-
und der tag noch nicht eingekuppelt ist
wenn zwischen gasgeben und gasgeben
die kurven aufatmen
und wenn die frauen lange brote
wie fahnenstangen durch die straße tragen an denen
der warme duft weht
findest du plötzlich im süden
die mitte
Hans-Jürgen Heise, Süddeutsche Zeitung, 6./7.9.1986
Unter der Überschrift Meister des Leisen, Zarten, Behutsamen in Kieler Nachrichte, 13.9.1986
Und das Gedicht ist Verzicht
Vielleicht wäre Reiner Kunze in anderen Zeitläuften einer der Stillen im Lande geworden. Man könnte sich das vorstellen, nachdem der Fall Kunze, der nichts anderes war als der Fall einer realexistierenden Literaturbürokratie, Geschichte geworden ist. Verrauscht ist auch die westliche Medienaufregung, die noch einmal durch die Verfilmung von Reiner Kunzes Die wunderbaren Jahre Nahrung erhalten hatte.
Man kann nachrechnen, doch der Autor lebt wirklich schon seit mehr als neun Jahren in der Bundesrepublik – Zeit genug, sollte man meinen, um das Etikett „DDR-Dissident“ von ihm zu tun. Mit seiner Frau, einer tschechischen Ärztin, wohnt er in einem abgelegenen niederbayerischen Ort, schreibt an seinen Gedichten und hält sich vom Literaturbetrieb fern. Ein Stiller im Lande? Wir halten uns an seine Gedichte.
Kunzes Lyrik hatte nie etwas Spektakuläres, sie war immer eher knapp und verhalten. Sie überschritt nie die Zimmerlautstärke und provozierte durch das leise Gesagte. Das hatte auch mit Inhalten zu tun, mit Kunzes Bekenntnis zum Individuum und seinem Recht auf Ausdruck und Entfaltung, aber auch mit dem Ton, in dem gesprochen wurde. Der verhaltene Ton erregte Irritation, ja Wut. Merkwürdigerweise irritierte auch der in den Westen übergesiedelte Kunze. Und das nicht bloß politisch, indem er weder die Erwartungen der Linken noch der Rechten erfüllte. Wieder war es der Ton, der irritierte. Den Wechsel in die Bundesrepublik hatte Kunze als ein „Durchatmen“ erlebt und von der „Heiterkeit“ gesprochen, die auf seiner Palette bisher gefehlt habe. Es war die „Heiterkeit“, die zum Bilde des Dissidenten nicht passen wollte. Kunze war dem verordneten Boykott entkommen, doch in einen Bereich subtilerer Annexionsansprüche geraten. Man erwartete Kritik von links, Affirmation nach rechts:
Könnten Sie, sagte die stimme,
nicht auch etwas schreiben
in unserem sinn?
Kunze jedoch schrieb im eigenen Sinn und Auf eigene Hoffnung, wie es der Gedichtband von 1981 formulierte. Mit Texten der Jahre 1973 bis 1980 überspannte der Dichter den Bruch in seiner Biographie. Neben Gedichten, die „im Nacken die Vergangenheit“ spüren ließen, standen solche, die das Durchatmen und die neue Heiterkeit versuchten. Begreiflich, daß das öffentliche Interesse an Reiner Kunzes Lyrik überwiegend ihren politischen und aktuellen Aspekten galt. Ästhetische Scheidungen waren selten. Peter Demetz etwa sah in Kunzes Sammlung einen Autor von mutiger Empfindungskraft und zugleich einen Sonntagsdichter zu Worte kommen.
Für seinen neuen Gedichtband Eines jeden einziges Leben hat Reiner Kunze sich fünf Jahre Zeit genommen. Er beruft sich ausdrücklich auf Oskar Loerke, der von der „Reifezeit“ seiner Gedichtbücher sprach, und betont den Aspekt des Entstehens und Wachsens auch in einem dem Band beigegebenen „nachwort“. „Das gedicht“, heißt es dort, „ist das ergebnis eines prozesses, der allen marktgegebenheiten hohn spricht.“
Das ist die schlichte Wahrheit, und nur daß ein Mann wie Reiner Kunze sie ausspricht, sichert den Satz gegen Ironie. Nur der in die literarische Marktwirtschaft Verschlagene kann so ungebrochen sein Gedicht gegen die Marktlage ausspielen – vielleicht daß der Markt doch vor dem Dichter kapituliert.
„Für einen gedichtband“ – macht Kunze uns die Rechnung auf – „bedarf es hundert oder mehr poetischer einfälle, hundert originärer, mehr oder weniger entdeckerischer verknüpfungen von welt – auch für einen zeitraum von vier, fünf jahren eine zahl, die staunen machen sollte –, und jener den marktgegebenheiten hohnsprechende prozeß muß sechzig-, siebzig-, achtzigmal wochen- und monatelang über den tag und durch die halbe nacht gebracht werden und gelingen.“ Übertönt der Autor da die eigenen Zweifel, oder will er uns imponieren? Gemeinhin betonen die Dichter den Preis nicht, den das Gedicht fordert. Kunze tut es dennoch, um seiner emphatischen Auffassung vom Dichteramt willen:
Und das gedicht ist verzicht
im leben wie in der sprache
Doch im leben zuerst
und in beidem gleichviel
Am Ende freilich zählt das Resultat, die Summe der gelungenen Gedichte.
Kunzes neuer Band bietet weder formale noch stoffliche Überraschungen, sondern bezeugt Kontinuität, maßvolle Fortentwicklung. Wieder findet sich der Typus des kurzen, kurzzeiligen lakonischen Gedichts, die konzentrierte und leise Sprechweise, die vieles der Ausdeutung und Assoziation des Lesers überläßt. Wieder arbeitet Kunze gern mit ausführlichen Titeln und Motti, und manchmal ist dieser Kopf länger als das nachfolgende Gedicht. Wieder wird so manches Gedicht zu einem lyrisch-spruchhaften Kommentar, überwiegt das Lehrhafte oft das Leben des Bildes.
Das zeigt sich besonders deutlich, wenn der Ausgangspunkt bereits ein Gedicht ist – etwa wenn Kunze Versen Ilse Aichingers, in denen von der nächtlichen Post die Rede ist und vom Mond, der die Kränkungen unter die Tür schöbe, folgende Kontrafaktur entgegensetzt:
Kämen die kränkungen
nur mit der post
und am morgen wenn wir
an uns glauben
Das ist ein Seufzer und noch kein Gedicht. In solchen poetischen Reaktionen ist der eigene Lebensstoff nicht stark genug, um sich gegen das Abgeleitete, Vermittelte zu behaupten. Die schwächste Abteilung seines Bandes ist darum jene, darin der Dichter eine Vorliebe für Teppiche, Farbholzschnitte, Torsi oder Cembalokonzerte bekundet und das Stilisierte noch einmal stilisiert. Was er vom „cembalokonzert“ sagt, ist wirklich bloß „feingesponnen“:
Im gehör
feingesponnenes silber, das mit der zeit
schwarz werden wird
Diesem Gespinst nun wird existentieller Ernst zugemutet, wenn daraus der Schluß gezogen wird:
Eines tages aber wird die seele
an schütterer stelle
nicht reißen
Dieser Schriftsteller hat Lebenskräftigeres zu bieten, Gewichtigeres, das durchaus leicht daherkommen, leise gesagt sein kann. Man kann fast darauf wetten: überall, wo er von Menschen spricht, die ihm nahestehen, von Sympathien, die ihm wichtig sind, stimmen Ton und Sprache, hält das Gewebe des Gedichts.
Reiner Kunze ist kein Phantasiedichter, der seine Visionen niederschreibt, kein Artist, dessen Kunst einen beliebigen Gegenstand verzehren kann. Er ist angewiesen auf das, was ihm seine Biographie zuträgt. Bei allem Kunstbemühen entscheidet das Leben über die Kunst. Damit muß er als Dichter leben, und ich meine, er kann es auch.
Zu den besten Gedichten gehören – wie schon in früheren Bänden – jene, in denen Kunze über Menschen spricht, die ihm nahestehen. Hier sind es Verse über den Vater und das Gedicht über einen Freund („Besuch aus Mähren“), mit dem Schluß:
Doch beharrte er darauf daß nirgendwo sonst
erde erde sei,
aaaaaaaaaaaund durch die haut seiner worte
schimmerte das knöchelweiß der faust die auch er
in der jugend geballt hatte
Hier ist er wirklich engagiert – engagiert nämlich ins Menschlich-Konkrete, was politische Sympathien nahelegt. In solchen Texten legitimiert er seine Sympathie für die polnische Sache oder für jene in der DDR, „die ihr gespräche dort pflanzt / wo sie befahlen, die wurzeln zu roden“. Wo Kunze mit seiner Biographie für das Gesagte eintritt, überzeugen auch seine gnomischen Zusammenfassungen als Wahrsprüche:
Heimat haben und welt,
und nie mehr der lüge
den ring küssen müssen
Was dem neuen Gedichtband ein besonderes Interesse sichert, sind einige Gedichte, in denen Kunze von Pathos und Moralität völlig absieht und nur dem vertraut, was er wahrnimmt und erlebt. Es sind Gedichte über süddeutsche Landschaften, sinnenhaft und konkret wie von Georg Britting, nur zarter, sensibler. „Hoher Sommer“ beginnt:
Eine trockenheit,
daß nachts in der ohrmuschel plötzlich
der regen rauscht
Innen- und Außenwelt sind gleichermaßen präsent, und solche Erfahrung ist sich selbst genug.
Hier schreibt sich ein Lyriker frei. Auch diesem entspannteren Reiner Kunze, der sein Dichteramt nicht betonen muß, wird man weder Marktgängigkeit noch Opportunismus nachsagen. Er sei uns willkommen.
Harald Hartung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 6.9.1986
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Heinz Ludwig Arnold: Kunst der Fassung
Nürnberger Nachrichten, 2.10.1986
Heiner Feldkamp: Nichts unter den Teppich kehren
Stuttgarter Zeitung, 16.8.1986
Gertrud Fussenegger: Schattenwelt mit Oberlicht
(zu dem Gedicht „Literaturarchiv in M“)
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 17.1.1987
Charitas Jenny-Ebeling: „Heimat trotz wenn und aber“
Neue Zürcher Zeitung, 10.10.1986
Wolfgang Kopplin: Dichten im Westen
Bayernkurier, 6.9.1986
Paul Konrad Kurz: Versöhnung im Verzicht
Bayerische Staatszeitung, 24.10.1986
Rainer Moritz: Inniger Kuß inmitten der Gräber
Rheinischer Merkur, 3.10.1986
Hardy Ruoss: Reiner Kunze: eines jeden einziges leben
DRS Zürich / Literatur, 1.10.1986
Michael Santak: Dichten zwischen Desastern
Frankfurter Rundschau, 1.10.1986
Hand Dieter Schmidt: Vom ersten bis zum letzten Wort sich treu
Deutsche Tagespost, 30.10.1986
Lothar Schmidt-Mühlisch: Reiner Kunze, der seine Gedichte wie Granit meißelt
Die Welt, 30.9.1986
Johannes Schwarzbauer: Poetisches Netz aus Reden und Zitaten
Hannoversche Allgemeine Zeitung vom 4./5.10.1986
Jürgen P. Wallmann: Lyrische Diamanten
Der Tagesspiegel, 19.10.1986
Erika Tunner: Zwei deutsche Literaturen? Kontroversen zu Reiner Kunze und seinem Werk
Albrecht Schöne (Hrsg.): Akten des VII. internationalen Germanisten-Kongresses Göttingen 1985. Bd. 10, Niemeyer Verlag, 1986
Jürgen P. Wallmann: eines jeden einziges leben
Literatur und Kritik, Heft 211/212, 1987
Gespräch mit Reiner Kunze
Zum Wesen des Kunstwerks gehört, daß es wohl Sinn hat, aber keinen Zweck. Es ist weder um eines technischen Nutzens noch eines ökonomischen Vorteils noch einer didaktisch-pädagogischen Unterweisung und Besserung, sondern um der offenbarenden Gestalt willen da. Es beabsichtigt nicht, sondern „bedeutet“; es „will“ nichts, sondern „ist“.
Romano Guardini
Wenn mein Werk von allein entstünde, ohne Anstrengung von mir, hätte ich recht wenig Gefallen daran; wenn ich allein es machen würde, ohne seinen Willen, würde es mir noch weniger gefallen.
Juan Ramón Jiménez
Irene Krawehl: Kann ein Gedicht die Welt verändern? Ihr Leben, denke ich, ist durch Liebesgedichte tiefgreifend verändert worden.
Reiner Kunze: Ein Gedicht kann nicht die Welt verändern, aber für das Leben des Autors kann es Folgen haben.
Krawehl: Eine Rundfunksendung mit Ihren Gedichten hat zum Abbruch Ihrer Universitätslaufbahn geführt.
Kunze: Ja. Nachdem sich andere Anklagepunkte als haltlos erwiesen hatten, nahm man eine Sendung mit Liebesgedichten zum Anlaß, mir vor allen Studenten den Prozeß zu machen. Man muß aber hinzufügen: Das war Ende der fünfziger Jahre… Wer solche Gedichte schreibt, lautete die Anklage, sei nicht in der Lage, sozialistische Studenten zu erziehen. Mit diesen Gedichten würde ich die Studenten „entpolitisieren“. In meinen Liebesgedichten fehle der Klassenstandpunkt. Zur Belehrung hielt man mir Liebesgedichte von Mao Tse-tung vor. Da ich zu keiner Selbstkritik zu bewegen war, wurde ich Hilfsschlosser im Schwermaschinenbau.
Krawehl: Aber diese Liebesgedichte haben auch Positives bewirkt.
Kunze: Ein Dreivierteljahr nach der Sendung dieser Gedichte erhielt ich eine Karte aus der Tschechoslowakei. Sie war an den Sender Dresden gerichtet gewesen und auf Umwegen an mich gelangt. Eine Hörerin erbat eines der Gedichte. Die Karte war in tadellosem Deutsch geschrieben, und ich dachte: wahrscheinlich eine ältere Deutsche, vielleicht eine pensionierte Germanistin. Ich schickte ihr das Gedicht und erhielt eine Vierseitenantwort. Es entspann sich ein Briefwechsel, der auf über vierhundert Briefe anwachsen sollte, darunter Briefe bis zu fünfundzwanzig Seiten. Die Dame war so alt wie ich, Medizinerin, zweisprachig aufgewachsen – der Vater war Deutscher, die Mutter eine in Wien geborene Tschechin. Sie werden fragen, warum wir einander so viele Briefe geschrieben haben – damals war die Tschechoslowakei für einen DDR-Bürger unerreichbares Ausland (und umgekehrt war es nicht anders). Wir schickten einander auch ein Foto, und auf dem Bild, das ich von meiner Briefpartnerin bekam, war sie siebzehn (sie hatte kein anderes), und es war alles andere als vorteilhaft. Aber ich sagte mir: Diese Frau kann aussehen, wie sie will – so einen Menschen findest du nicht wieder, und obwohl wir einander in Wirklichkeit nie gesehen hatten, fragte ich sie, ob sie meine Frau werden wolle, und da ich die schriftliche Antwort nicht erwarten konnte, entschloß ich mich, sie anzurufen. Das war damals nicht so einfach. Jedes Telefongespräch wurde handvermittelt – und manches überhaupt nicht. Nach der Arbeit, gegen 14.30 Uhr, meldete ich vom Apparat eines befreundeten Ehepaares das Gespräch an. Gegen zehn Uhr abends ging die Frau des Freundes schlafen, nach Mitternacht er. Gegen halb drei Uhr morgens klingelte das Telefon tatsächlich, und am anderen Ende der Leitung war die Stimme der Frau, die ich gefragt hatte, ob sie meine Frau werden wolle. Und sie sagte: Ja.
Krawehl: Und wie ging das dann weiter?
Kunze: Später gelang es mir, mit einer offiziellen Reisegruppe für zwei Tage nach Prag zu fahren, und meine künftige Frau sagte, sie habe mich an dem altmodischen Mantel erkannt, den ich auf dem Foto getragen hatte. Sie aber sah in Wirklichkeit durchaus nicht „unvorteilhaft“ aus. Nur durften wir nicht heiraten. Jeder tschechoslowakische Staatsbürger, der damals einen Ausländer heiraten wollte, brauchte die persönliche Genehmigung des Innenministers, und an die war nicht heranzukommen. In Prag lernten wir den Landvermesser aus Kafkas Schloß verstehen. Im Erdgeschoß des Innenministeriums gab es Telefone, weiter durfte man sich den Funktionären nicht nähern. Und wir konnten es uns nicht leisten, oft von Aussig, wo meine Frau arbeitete, nach Prag zu fahren. Damals verdienten in der Tschechoslowakei die Ärzte weniger als ein Hilfsarbeiter (den Ärzten war es auch untersagt, den Doktortitel zu führen). Die Frau, die ich heiraten wollte, war Kreiskieferorthopädin, stellvertretende Bezirkskieferorthopädin und operierte im Krankenhaus, aber Gardinen konnte sie sich nicht leisten. Sie hatte Verbandmull an den Fenstern.
Inzwischen hatte ich tschechische Schriftsteller kennengelernt und begann, mittels Interlinearübersetzungen tschechische Poesie ins Deutsche zu übertragen, und als in Berlin eine erste Auswahl dieser Übersetzungen erschienen war, schickte ich das Bändchen an den Tschechoslowakischen Schriftstellerverband und schrieb den Kollegen, daß man uns nicht erlaube zu heiraten … Das Büchlein in der Hand, intervenierten sie beim Kulturminister, und eines Tages kam mit unscheinbarer Post die Heiratserlaubnis. So wurde meine Frau mein erster und kostbarster Literaturpreis.
Krawehl: Ihre Frau ist Ihnen in die DDR gefolgt?
Kunze: Wir haben dann in Thüringen gewohnt, in Greiz. Als Schriftsteller wollte ich dort leben, wo meine Sprache gesprochen wird – und sie ist ja auch eine der beiden Muttersprachen meiner Frau.
Krawehl: Wenn ich richtig rechne, haben Sie mit Ihrer Frau fünfzehn Jahre in der DDR gelebt … Gab es einen konkreten Anlaß für Sie, im Frühjahr 1977 die DDR zu verlassen?
Kunze: Die meisten meiner (wenigen) Bücher hatten zwar nur in der Bundesrepublik erscheinen können, aber wir hatten nie mit dem Gedanken gespielt, von den Menschen wegzugehen, denen wir uns zugehörig fühlten. Doch dann erschien das Buch Die wunderbaren Jahre, ich wurde aus dem Schriftstellerverband ausgeschlossen, und der Druck auf uns – insbesondere auf unsere Tochter – wurde unerträglich. Auch bin ich kein Kämpfer. Das heißt, ich kämpfe schon, wenn ich dazu gezwungen werde, aber ich suche den Kampf nicht. Und ich habe auch nicht die Konstitution für einen Märtyrer; zuletzt aber war es gefährlich.
Krawehl: Sie haben sich den Zorn der Behörden zugezogen, weil Ihre Gedichte nicht den sozialistischen Zielvorstellungen entsprachen. Kann ein Dichter überhaupt etwas bewirken? Durch sein Werk, meine ich.
Kunze: Dort, wo Gedicht und Macht, Kunst und Macht zusammenstoßen, ist das Gedicht, ist Kunst machtlos. Wenn ein Gedicht überhaupt etwas verändern kann, dann nur etwas in uns, im einzelnen Menschen.
Krawehl: Aber hat der Dichter nicht eine Botschaft?
Kunze: Die Botschaft des Dichters – wenn er schon eine haben muß ist das Gedicht. Und das läßt sich nicht zerlegen. Das heißt, es läßt sich schon zerlegen – aber dann wird es nicht mehr als Gedicht wirken, als Bild, das in jedem von uns andere Assoziationen hervorruft (weil es nur das in uns aktivieren kann, was in uns ist, was wir erlebt, erlitten, durchdacht oder verdrängt haben). Dann wird es uns nicht empfindsamer, nicht feinfühliger, nicht um ein Unmeßbares „besser“ machen können. Ja, dann wird es uns nicht einmal in eine Stimmung versetzen oder aus einer beklemmenden Stimmung erlösen können. Wenn ich ein Gedicht zerlege, um einen Gedanken – die vermeintliche „Botschaft“ – zu finden, dann verfehle ich die Botschaft des Gedichts.
Krawehl: Also gibt es für Sie kein politisches Gedicht?
Kunze: Ein dichterischer Einfall geht immer auf Erschütterung zurück, auf Betroffensein (auch ein Glücksmoment ist ein Moment der Betroffenheit). Dabei kann Wirklichkeit in das Gedicht eingehen, die politische Zusammenhänge widerspiegelt, und es entsteht ein politisches Gedicht.
Krawehl: Braucht man eine Vorbildung, um ein Gedicht zu verstehen?
Kunze: „Verstehen“ könnte wieder als ein rein gedankliches Erfassen mißdeutet werden. Ich würde lieber sagen: Bedarf es einer Vorbildung, damit mir ein Gedicht etwas bedeuten kann, damit es mich erschüttern, beglücken, mitreißen kann, damit ich es lieben kann? Und Lieben ist erst einmal keine Frage der Vorbildung. Etwas ganz anderes ist es, daß der, der liebt, den Umgang mit dem suchen wird, was er liebt (oder den er liebt). Auf diesen Umgang kommt es dann allerdings sehr an, auf dieses Zusammenleben – auch von Leser und Gedicht. Anders gesagt: „Das Bildwerk hat im Grunde nur der verstanden, der es nicht entbehren kann.“ (Hans Wimmer)
Krawehl: Aber man kann doch Bedürfnisse wecken?
Kunze: Gewiß. Dennoch wird nicht jeder zu allem, was es auf der Welt gibt, einen Zugang finden. Warum sollte er auch. Es kommt darauf an, daß jeder intellektuell und emotional so reich wie ihm möglich lebt.
Krawehl: Welche Gefahren für einen Dichter und seine Werke in einem totalitären System bestehen, haben Sie selbst erlebt? Was erscheint Ihnen im Westen als „literaturfeindlich“?
Kunze: U.a. das Ersetzen der literarischen Maßstäbe durch ideologische … Auch hier. Der Osten wirft seinen Schatten nach. Oder er wirft ihn voraus.
Krawehl: Sie haben einmal gesagt, daß man in den Schulen von der Literatur geradezu wegerzieht, u.a. durch die Frage: Was wollte uns der Dichter damit sagen?
Kunze: Unsere Geistestradition ist dermaßen vom abstrahierenden Denken geprägt, daß wir alles und jedes nach einer Idee durchforsten – und den Wald gar nicht mehr wahrnehmen. Und wenn wir die Idee nicht finden, denken wir sie in den Wald hinein. Die Idee vom Wald ist uns wichtiger als der lebende Baum, als eine Vogelkehle.
Krawehl: Woher nehmen Sie die Erlebnisse zu einem Gedicht?
Kunze: Ich nehme sie nicht, ich habe sie.
Krawehl: Und Sie suchen sie nicht?
Kunze: Nein. Das geht auch gar nicht. In welcher Richtung wollen Sie denn suchen? Der Einfall zu einem Gedicht kommt – wann und wodurch, das weiß vorher niemand. Sie können ihn nicht herbeiwollen.
Krawehl: Sie nehmen sich also nie vor, ein – sagen wir – Liebesgedicht zu schreiben?
Kunze: Ohne einen Einfall gehabt zu haben? Nie.
Krawehl: Das heißt, Sie müssen als Dichter warten, bis das Gedicht kommt?
Kunze: Nicht das Gedicht – der Einfall. Das Gedicht ist Arbeit, oft quälende Arbeit, die Tage und Wochen, mitunter Monate dauert. Aber wenn Sie zu jenen gehören, die nur dadurch mit bestimmten Erlebnissen fertig werden, daß Ihnen solche Einfälle kommen, müssen Sie nicht warten – dann haben Sie mehr Einfälle, als Sie Kraft und Lebenszeit haben, sie zu verarbeiten. Was nicht heißt, daß es nicht Zeiten gibt, in denen Ihnen überhaupt kein solcher Einfall kommt. Warum das so ist, weiß ich nicht.
Krawehl: Werden Sie manchmal als Ratgeber angesehen?
Kunze: Wenn Sie Gedichte veröffentlichen, gewähren Sie einen ziemlichen Einblick in sich selbst. Sie entblößen sich, verringern die innere Entfernung zum anderen, und das kann dazu führen, daß auch er die innere Entfernung zu verringern sucht…
Madame, 1987
REINER KUNZE
er ist nicht kranführer
versteht nichts von schweißverfahren
auch hält er in der hand
keine kelle
und doch
die baustellen sind ihm
nicht fremd
und doch
was er baut baut er nur langsam
er baut auf vertrauen
er hilft mit
von der gegenseite des lichts:
wo im schatten der
gerüste
zuweilen noch hochschießt
zählebiges unkraut
mit viel geschrei
dort
geht er umher
geht zu jäten
mit zweischneidigem wort
Franz Hodjak
KATHEDRALE, TOLEDO
Für Reiner Kunze
Ocker und grau springt der hügel aus der ebene:
die strebepfeiler
wie rippen schiffbrüchiger karavellen, beladen
mit der gier katholischer könige
nach der habe einer neuen welt.
Doch – balancierend
auf schlanken schäften, die im zwielicht
aufstrebender spitzbögen einander berühren –
etwas mehr als sucht
nach silber und segen, der heiligspricht:
fast die regung eines glaubens.
Des glaubens –
ich begreife ihn nicht –
aus Pietà und daumenschraube.
Edwald Osers
übersetzt von Reiner Kunze
Michael Wolffsohn: REINER KUNZE – der stille Deutsche
In Lesung und Gespräch: Reiner Kunze (Autor, Obernzell-Erlau), Moderation: Christian Eger (Kulturredakteur der Mitteldeutschen Zeitung, Halle). Aufnahme vom 17.01.2012, Literaturwerkstatt Berlin. Klassiker der Gegenwartslyrik: Reiner Kunze. Wenn die post hinters fenster fährt blühn die eisblumen gelb.
Zum 60. Geburtstag des Autors:
Harald Hartung: Auf eigene Hoffnung
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 16.8.1993
Zum 70. Geburtstag des Autors:
Katrin Hillgruber: Im Herzen barfuß
Der Tagesspiegel, Berlin, 16.8.2003
Lothar Schmidt-Mühlisch: Eine Stille, die den Kopf oben trägt
Die Welt, 16.8.2003
Beatrix Langner: Verbrüderung mit den Fischen
Neue Zürcher Zeitung, 16./17.8.2003
Sabine Rohlf: Am Rande des Schweigens
Berliner Zeitung, 16./17.8.2003
Hans-Dieter Schütt: So leis so stark
Neues Deutschland, 16./17.8.2003
Cornelius Hell: Risse des Glaubens
Die Furche, 14.8.2003
Zum 75. Geburtstag des Autors:
Michael Braun: Poesie mit großen Kinderaugen
Badische Zeitung, 16.8.2008
Christian Eger: Der Dichter errichtet ein Haus der Politik und Poesie
Mitteldeutsche Zeitung, 16.8.2008
Jörg Magenau: Deckname Lyrik
Der Tagesspiegel, 16.8.2008
Hans-Dieter Schütt: Blühen, abseits jedes Blicks
Neues Deutschland, 16./17.8.2008
Zum 80. Geburtstag des Autors:
Jörg Bernhard Bilke: Der Mann mit dem klaren Blick: Begegnungen mit Reiner Kunze: Zum 80. Geburtstag am 16. August
Tabularasa, 18.7.2013
artour: Reiner Kunze wird 80
MDR Fernsehen, 8.8.2013
André Jahnke: Reiner Kunze wird 80 – Bespitzelter Lyriker sieht sich als Weltbürger
Osterländer Volkszeitung, 10.8.2013
Josef Bichler: Nachmittag am Sonnenhang
der standart, 9.8.2013
Thomas Bickelhaupt: Auf sensiblen Wegen
Sonntagsblatt, 11.8.2013
Günter Kunert: Dichter lesen hören ein Erlebnis
Nordwest Zeitung, 13.8.2013
Marko Martin: In Zimmerlautstärke
Die Welt, 15.8.2013
Peter Mohr: Die Aura der Wörter
lokalkompass.de, 15.8.2013
Arnold Vaatz: Der Einzelne und das Kartell
Der Tagesspiegel, 15.8.2013
Cornelia Geissler: Das Gedicht ist der Blindenstock des Dichters
Berliner Zeitung, 15.8.2013
Johannes Loy und André Jahnke: Eine Lebensader führt nach Münster
Westfälische Nachrichten, 15.8.2013
Michael Braun: Süchtig nach Schönem
Badische Zeitung, 16.8.2013
Jochen Kürten: Ein mutiger Dichter: Reiner Kunze
Deutsche Welle, 15.8.2013
Marcel Hilbert: Greiz: Ehrenbürger Reiner Kunze feiert heute 80. Geburtstag
Ostthüringer Zeitung, 16.8.13
Hans-Dieter Schütt: Rot in Weiß, Weiß in Rot
neues deutschland, 16.8.2013
Jörg Magenau: Der Blindenstock als Wünschelrute
Süddeutsche Zeitung, 16.8.2013
Friedrich Schorlemmer: Zimmerlautstärke
europäische ideen, Heft 155, 2013
Zum 85. Geburtstag des Autors:
LN: Sensible Zeitzeugenschaft
Lübecker Nachrichten, 15.8.2018
Barbara Stühlmeyer: Die Aura der Worte wahrnehmen
Die Tagespost, 14.8.2018
Peter Mohr: Die Erlösung des Planeten
titel-kulturmagazin.de, 16.8.2018
Udo Scheer: Reiner Kunze wird 85
Thüringer Allgemeine, 16.8.2018
Jochen Kürten: Sich mit Worten wehren: Der Dichter Reiner Kunze wird 85
dw.com, 16.8.2018
Zum 90. Geburtstag des Autors:
Lothar Müller: Widerstand in Jeans
Süddeutsche Zeitung, 15.8.2023
Cornelia Geißler: Dichterfreund und Sprachverteidiger
Berliner Zeitung, 15.8.2023
Antje-Gesine Marsch: Greizer Ehrenbürger Reiner Kunze feiert 90. Geburtstag
Ostthüringische Zeitung, 16.8.2023
Ines Geipel: Nachwort. Zum 90. Geburtstag von Reiner Kunze
S. Fischer Verlag
Ines Geipel: Mit dem Wort am Leben hängen
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 16.8.2023
Gregor Dotzauer: Mit den Lippen Wörter schälen
Der Tagesspiegel, 15.8.2023
Hans-Dieter Schütt: Das feingesponnene Silber
nd, 15.8.2023
Stefan Stirnemann: Ausgerechnet eine Sendung über Liebesgedichte brachte Reiner Kunze in der DDR in Nöte – und mit seiner späteren Frau zusammen
Neue Zürcher Zeitung, 15.8.2023
Christian Eger: Herz und Gedächtnis
Mitteldeutsche Zeitung, 15.8.2023
Matthias Zwarg: Im Herzen barfuß
Freie Presse, 15.8.2023
Marko Martin: Nie mehr der Lüge den Ring küssen
Die Welt, 16.8.2023
Josef Kraus: Mutiger Lyriker, Essayist, Sprachschützer, DDR-Dissident, Patriot – Reiner Kunze zum 90. Geburtstag
tichyseinblick.de, 16.8.2023
Erich Garhammer: Das Gedicht hat einen Wohnort: entlang dem Staunen
feinschwarz.net, 16.8.2023
Volker Strebel: Ein deutsch-deutscher Dichter
faustkultur.de, 29.8.2023
Fakten und Vermutungen zum Autor + KLG + IMDb + Archiv +
Kalliope + DAS&D + Georg-Büchner-Preis 1 & 2 +
Rede + Interview 1, 2 & 3
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Dirk Skiba Autorenporträts +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Reiner Kunze – Befragt von Peter Voss am 15.7.2013.


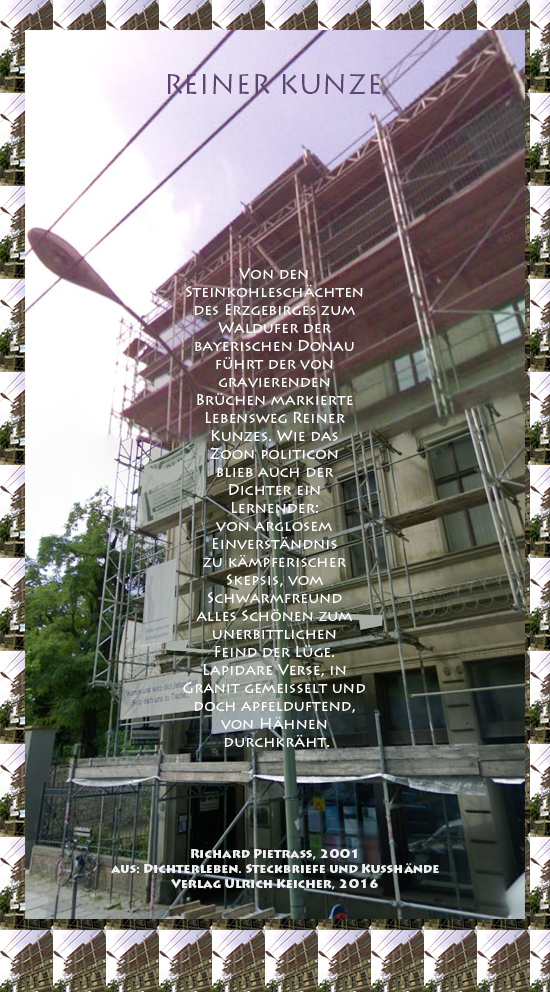












Schreibe einen Kommentar