Reiner Kunze: Sensible Wege
DÜSSELDORFER IMPROMPTU
Der himmel zieht die erde an
wie geld geld
Bäume aus
glas und stahl, morgens
voll glühender früchte
Der mensch
ist dem menschen
ein ellenbogen
Die unter den Überschriften
„und es war schön finster“ und „eine kleine deutsche stadt“ vereinigten Gedichte reflektieren die Basis, die das Kommunikationsverlagen des Autors dialektisch begründet und bestimmt: eine abgegrenzte Wirklichkeit mit dem ihr Eingewohnten, ihrem bedrängten und solidarischen Eigenleben.
Die Gedichtgruppe „hunger nach der welt“ variiert konsequent die Wege und Ergebnisse beharrlichen Suchens nach neuer Außenwelt-Erfahrung. Anspruchsvoll und gefährdet sind diese Wege, klärend und bewegend die Funde, die auf solchen Wegen zu gewinnen sind. Sprachliche Formungen, deren nuancierte Klarheit die Intensität des Erlebens und die Fruchtbarkeit des Erlebten weiterwirken läßt, legen Zeugnis ab von der befreienden und versöhnenden Kraft der Weltoffenheit. Sie geben zu erkennen, wie ausschlaggebend die Begegnung mit der Doppelnation der Tschechen und Slowaken den Autor beeindruckt hat. Sie erproben die große Chance der Sprache, Fremdes und Fernes vertraut und verständlich zu machen. Doch zugleich sind sie skeptisch geschärft durch das Wissen, daß diese Chance stets bedroht ist. Sie sind Diagnosen einer notwendigen, aber oft verwehrten Wirklichkeit. Der Gedicht-Zyklus über die Post schließlich diskutiert die Leistungsfähigkeit und Anfälligkeit des Informationsaustausches über trennende Entfernungen hinweg. Die Diagnose eines bestehenden Kommunikationsverfahrens macht unverkennbar: Monologe, die dort das Geld beherrschen, wo Gespräche abgebrochen oder unterbrochen werden, sind eine katastrophale Alternative jener vermittelnden Diskussion, die allein fortschreitendes Leben verbürgt.
Rowohlt Taschenbuch Verlag, Klappentext, November 1976
Inhalt
Reiner Kunzes Lyrik vertraut den sensiblen Wegen, auch wenn das oft die unbequemen sind. Sein Ton ist zurückgenommen, aber präzise, ist leise, aber nicht zu überhören. Politisches schwingt unterschwellig mit, selbst in seinen Liebesgedichten, die – wie das Gedicht „die liebe“, das er mit zwanzig schrieb – zu den schönsten der deutschen Sprache zählen.
Bereits in seinen „frühen gedichten“, entstanden in den fünfziger und frühen sechziger Jahren, zeigt sich Reiner Kunze als Dichter, der scharf hinsieht und leise spricht. Hinter lyrischen Wendungen von bildlicher Leuchtkraft und zartem Reiz bezieht er unmißverständlich Stellung: Indem er das Poetische gegenüber dem bloß Inhaltlichen verteidigt, nimmt er das Individuelle in Schutz – kein leichtes in einem sozialistischen Staat, der die Rechte des einzelnen geringgeschätzt hat.
Deutlicher ist Kunze in seiner Sammlung sensible wege, die ihm 1969 im Westen zum literarischen Durchbruch verhalf. Gewidmet dem tschechischen und slowakischen Volk und vielen verfolgten Dichtern, zeugen diese behutsamen, ja verschwiegenen Gedichte von Kunzes Solidarisierung mit dem Prager Frühling, von seinem Protest gegen den Einmarsch der russischen Armee. In poetischen Bildern von überraschender Prägnanz übt er Kritik, ohne das Lyrische aus den Augen zu verlieren. Seine Gedichte sind empfindsame, in weite Tiefen vordringende Gebilde, deren gesellschaftliche Dimension im Poetischen gleichsam verborgen ist.
S. Fischer Verlag, Ankündigung einer anderen Ausgabe
Reiner Kunze „Partituren-Gedichte aus fünfzehn Jahren“
– Verlagsgutachten. –
In seinem Verlagsgutachten (1967) bezieht Rühmkorf sich auf ein frühes Manuskript Kunzes, aus dem der Band Sensible Wege hervorgegangen ist.
Die Gedichte sind in einem spezifischen Sinn DDR-Produkt, was Thematik und Schreibweise angeht. Verklausuliert und chiffriert, durchs Sinnbild oder durch die Blume werden Ausbruchsgelüste geäußert, Fluchtsituationen beschrieben, Furcht vor der Denunziation und Angst vor Entdeckung angedeutet, die öde Sinnlosigkeit herrschender und bedrückender Reglements dargestellt und die Lust am Alleingang besungen, kurz, die Verhältnisse in jener besonderen gesellschaftlichen Druckkammer angezeigt, die DDR heißt. Entgegen der Überfütterung mit politischen Pflichtinhalten bricht sich in Kunzes Gedichten noch mal das Private seine schmale Bahn, sei es in Lobliedern auf die Liebe, die Freundschaft, die Blumen und die schönen Künste oder vielleicht in einem erkenntnistiefen Blick in einen „brunnen im süden Mährens, / der einschläft, / das moos unterm arm“.
Eine Antwort des Dichters auf Gemeinschaftsplanung und soziale Betriebsamkeit ist zumal in den allenthalben zutage tretenden Freundschaftsbekundungen zu erkennen. Schon die zahlreichen Widmungen, Dedikationen und Anschreiben zeigen uns, daß Kommunikation sich nicht im Hinblick auf die amtlich und von Staats wegen empfohlenen Vorder-, Hinter- und Nebenmänner anläßt, sondern im Schwingungskreis von gleichgesinnten Außenstehenden. Weib und Kind oder Freund und Freundin rücken hier zu Hauptpersonen gegenläufiger Gesellungsprozesse auf, wobei sich das eindrucksvolle Schlußkapitel „Einunddreißig Variationen auf das Thema: ,Die Post‘“ wie eine philatelistisch verschlüsselte Gebrauchsanweisung für freien und geheimen Kassiberverkehr liest.
Der Versuch, die Verkehrsformen einer unter beengten Lebensumständen dahinschleichenden Subjektivität gesellschaftskundlich zu objektivieren, darf uns allerdings nicht dazu verleiten, die Grenzen solcher Privatpoesie zu übersehen. Wer hier nicht zu den direkt Angesprochenen gehört, muß sich zwangsläufig von den tieferen Geheimnissen der Verschlußsachen ausgesperrt fühlen. Vertrauliches Gewisper unter Eingeweihten entschlüsselt sich dem Nichtdazugehörigen eben gerade nur als dies, das heißt, als eine Pss-Sprache. Die Anmahnung gemeinsamer Erinnerungen, persönliche Erkennungssignale und Zitatanspielungen erwecken den Eindruck eines beinah familiären Codes, der ohne Zugang zu den intim biographischen Anspielungsinhalten nicht mehr lesbar ist. Ganz anders als bei Hardekopfs „Privatgedichten“, die einen Typus von Privatheit formulieren, in dem sensible Einzelgänger sich – mit Maßen – massenhaft erkennen können, bleiben bei Kunze Sender und Empfänger häufig unter sich und das Subjekt so hoffnungslos praeter propter wie seine zufälligen und einmalig unverbindlichen Assoziationsanlässe.
Vor die Frage gestellt, wohin sich, bei Applaus und Abstrich, die Waage schließlich neigt, möchte ich allerdings dann doch für eine Veröffentlichung plädieren. Worauf es aufmerksam zu machen gilt, ist eine unter bestimmten gesellschaftlichen Voraussetzungen ausgebildete Flüsterkunst, die selbst wo sie ein bißchen wolkig bleibt, als ein ästhetisches Gebilde, das heißt als hübsche Wolkenformation ihren Eindruck macht. Um die politische Plausibilität des Gesamt zu vernachdrücklichen, wäre allerdings dringend erforderlich, die flau familiären Stücke auszusortieren – anders Gelegenheitspoesie bloß als Verlegenheitslyrik aufgefaßt werden könnte. Außerdem schlage ich vor, dem Verfasser mit dem geschmäcklerischen Gesamttitel auch die musikologischen Satzbezeichnungen auszureden.
Peter Rühmkorf, aus Peter Rühmkorf: Strömungslehre I, Rowohl Taschenbuch Verlag, 1978
Hunger nach der Welt
Zwischen 1950 und 1960 herrschte hierzulande die Meinung, in der anderen Hälfte Deutschlands sei die Poesie völlig verstummt. Von den wenigen Talenten jenseits der Grenze hätten die Besten mehr oder weniger freiwillig in der Bundesrepublik Zuflucht gesucht. Was sich drüben weiter lyrisch zu Wort melde, habe nichts anderes auszudrücken als seine Linientreue. Das war nun durchaus nicht nur die Meinung kalter Krieger. In jenem Zeitraum ist in der Bundesrepublik – wenn man einmal von Peter Huchel absieht – nicht ein einziger Gedichtband eines DDR-Lyrikers erschienen; sogar einzelne Gedichte ostdeutscher Autoren waren in hiesigen Zeitschriften oder Zeitungen so gut wie gar nicht aufzustöbern. Kein Wunder also, daß selbst unser aufgeschlossenes Publikum der Ansicht vom Ende der Poesie jenseits der Elbe Glauben schenkte.
Erst zu Beginn der sechziger Jahre, das heißt, mit dem Druck der Gedichte von Johannes Bobrowski in einem westdeutschen Verlag, änderte sich die Situation. Aber schon kurz vor dem Erscheinen der Sarmatischen Zeit – wenn wir es chronologisch ganz genau nehmen wollen – kam eine Anthologie auf den Markt, die den Titel Deutsche Lyrik auf der anderen Seite führte. Sehr bezeichnend, daß sie von einem Holländer zusammengestellt worden war. Durch diese Anthologie konnten wir uns hier zum ersten Mal ein Bild machen von einer keineswegs nur sozialistisch strammen, sondern eher weit aufgefächerten Lyrik verschiedenster Begabungen und Temperamente, älterer und jüngerer Verfasser, die erstaunlicherweise alle den Paß der DDR besaßen. Das Eis war gebrochen. Nun veröffentlichte Suhrkamp den jungen Volker Braun, Hanser seinen Günter Kunert, S. Fischer einen neuen Band von Huchel, Rowohlt Karl Mickel, Bechtle Stephan Hermlin, Wagenbach den Chansonier Biermann sowie den gesamten Nachlaß Bobrowskis. Der bisher letzte in der Reihe ist Reiner Kunze. Übrigens machte ausgerechnet dieser Kunze den Schlußmann in der oben genannten Anthologie. Damals war er noch der Jüngste unter den aufgenommenen DDR-Lyrikern.
Heute hat derjenige, der sich mit Kunze gründlicher beschäftigen will, eine respektable Bibliographie durchzusehen. Der Autor fing früh an zu publizieren und ist seitdem nicht faul gewesen. Die meisten seiner Bücher jedoch sind für die Leser in Ost und West gleichermaßen schwer zu beschaffen. Einiges ist über Nacht verschwunden und eingestampft worden (zum Beispiel Der Wind mit Namen Jaromir 1962), anderes hat man nicht mehr aufgelegt. In der Bundesrepublik gehört Glück dazu, das in einem unbekannten Verlag vor vielen Jahren gewissermaßen als Versuchsballon erschienene Gedichtheft Widmungen aufzutreiben. Sensible Wege, Kunzes repräsentativer Lyrikband im Rowohlt Verlag, ist wiederum für die Leserschaft in der DDR unerreichbar. So kann es gehen, wenn man heute Verse in deutscher Sprache schreibt.
Reiner Kunze ist Jahrgang 1933 und kommt aus Oelsnitz im Erzgebirge, aus einer Bergarbeiterfamilie. Nach dem Abitur entschied er sich für das Studium der Publizistik, schloß es mit dem Diplom ab und wurde wissenschaftlicher Assistent mit Lehrauftrag an der Universität Leipzig. Unmittelbar vor der Promotion gab Kunze seine Tätigkeit auf, die Bedingungen erschienen ihm nicht länger akzeptabel. Eine schwere Krankheit folgte. Er wurde Hilfsarbeiter in einem VEB. 1961/62 hielt er sich in der Tschechoslowakei auf und heiratete dort eine tschechische Zahnärztin. Seit 1962 lebt er als freier Schriftsteller zurückgezogen in der kleinen Stadt Greiz in Thüringen. Das zur Person. Kunzes Bibliographie umfaßt fünf Lyrikbände, dazu Anthologien, Herausgaben, Bearbeitungen und Übersetzungen (aus dem Tschechischen), sie weist Texte und Lieder zu Kantaten, Filmen auf und verzeichnet eine Reihe literarischer Vorlagen für den Leipziger Komponisten Heinz Krause-Graumnitz, die zu Kunzes größten Erfolgen zählen.
Ein Lyriker reinsten Wassers. Das ist bitte wörtlich zu nehmen. Von Anfang an zeichnet sich seine Begabung durch Klarheit des Impulses und die unbedingte Lauterkeit ihrer Absichten aus – auch dort, wo ihm die politische Einsicht noch fehlte. Doch Kunze ist nicht als Meister vom Himmel gefallen. Er brauchte mindestens vier, fünf Jahre, ehe er den Freibrief des Lyrikers von eigenen Gnaden errang. Brecht war sein bedeutendster Lehrer; Kunze hat das nie zu verheimlichen versucht. Bis heute, da es über seine dichterische Selbständigkeit keine Debatte gibt, ist die Nähe Brechts spürbar geblieben.
Daß der große arme B. B. vielen jungen Gedichteschreibern die Zunge gelöst hat, gehört zu den bekannten Tatsachen. Von Enzensberger über Christa Reinig bis zu Karl Alfred Wolken läßt sich sein Einfluß deutlich verfolgen. Noch stärker fällt das Vorbild Brecht in den neuen Gedichten des anderen Deutschland ins Auge. Biermann ist ohne den genialen Bänkelsänger und Bürgerschreck der Hauspostille undenkbar, auch Volker Braun hält sich an die kaltschnäuzige Saloppheit des frühen Brecht. Karl Mickel dagegen knüpft vor allem an die scharfsinnig verzwickten, satirisch unerreichten Sonette aus der mittleren Zeit an, während etwa Kunert dem gewiegten Dialektiker und Fintenschläger der politischen Lyrik nacheifert. Dem jungen Kunze war der listige und weise Lakoniker der letzten Berliner Jahre lieber, zu ihm ging er in die Lehre. Dafür ein Beispiel aus seinem ersten Band Vögel über dem Tau:
ANTWORT
Mein vater, sagt ihr,
mein vater im schacht
habe risse im rücken,
narben,
grindige spuren niedergegangenen gesteins,
ich aber, ich
sänge die liebe.
Ich sage:
eben, deshalb.
Bereits diese Verse schlagen ein Grundthema der Kunzeschen Dichtung an, doch darauf wollen wir später eingehen. Vorerst ist zu sagen, daß die Gedichte aus Vögel über dem Tau (1959) und Aber die Nachtigall jubelt (1962) durchaus nicht immer diesen kargen und strengen Ton anstimmen, es gibt in den Bänden noch gereimte, stark liedhafte Stücke, die sich an klassische oder romantische Muster anlehnen, überschwenglich, auch unbeholfen sind, aber stets durch einzelne urtümliche, selbstgefundene Bilder und mutige Gedanken beeindrucken. Die besseren Gedichte aus jener Zeit verraten die Beschäftigung ihres Verfassers mit Volksliedern. Sie heißen etwa „Gedichte, die mein Mädchen schwieg“ oder „Das „Märchen vom Fliedermädchen“ oder „Aber das Gras unter den Füßen“: vielversige Gebilde, in denen der Lehrmeister zurücktritt, ein zartes, aber ungestümes Gefühl sich Bahn bricht und die Liebe mit den alten Zeichen von Pfeil, Rose, Vogel und Brunnen beschworen wird:
Die liebe
ist eine wilde rose in uns,
unerforschbar vom verstand
und ihm nicht untertan.
Aber der verstand
ist ein messer in uns.
Der verstand
ist ein messer in uns,
zu schneiden der rose
durch tausend zweige
einen himmel.
Die musikalischen, doch für unsere westlichen Ohren nahezu harmlos klingenden Verse müssen östlichen Ideologen sauer aufgestoßen sein. Sie enthalten, wie das Gedicht über den Vater, eine Kampfansage. Hier ist ein Poet, der sich nicht gängeln lassen will. Dem marxistischen Axiom vom Primat des Verstandes, der alles durchschauen und klären kann, wird in einem schlichten Liebesgedicht unüberhörbar widersprochen. Nicht, daß der Dichter das rationale Denken verbannt wissen möchte, nein, er besteht nur innerhalb seines Gedichts auf der Freiheit poetischer Wahrheitsfindung und schreibt dem Verstand im Bereich der Poesie eine besondere, allein von ihm, dem Dichter, zu bestimmende Funktion zu.
Im Motto des Prologs (1959) formuliert Kunze seine Überzeugungen deutlicher:
„Ich habe mut und kraft.“
(„Leonore“)
Leonore hat Florestan gerettet, und „des
besten königs wink und wille“ kamen
ihr zu hilfe.
Wir werden die kunst retten, und wink
und wille des besten königs, wink und
wille der zeit, werden uns zu hilfe kommen.
Diese Fidelio-Anspielung – man sagt Kunze nach, er sei ein großer Musikkenner und -enthusiast – ist an die Adresse derer gerichtet, die das Fortbestehen der Kunst dort, wo Kunze zu Hause ist, durch Richtlinien und Einschüchterungsversuche in lebensgefährlicher Weise bedrohen. Noch scheint kein Grund für Verzweiflung vorzuliegen: An „wink und wille des besten königs“ kann appelliert werden. Von allen jüngeren Lyrikern der DDR hat Kunze die strengste Auffassung von dem, was Kunst ist oder zu sein hat. Hierin gibt es für ihn keine Zugeständnisse. Von Brecht stammt das Wort:
Es wird sich herausstellen, daß wir ohne den Begriff Schönheit nicht auskommen.
Für diese Schönheit, das heißt, für die Leuchtkraft und Triftigkeit von Worten, die sich allein vor der Instanz des künstlerischen Bewußtseins zu verantworten haben und die sowohl Rationales wie Irrationales nach eigener Maßgabe ausdrücken, für sie werden wir von nun an Kunze kompromißlos kämpfen sehen.
Der Aufenthalt in der Tschechoslowakei bringt den Dichter zu sich selbst. Wärme und Humor eines ihm wesensverwandten Volkes, die Landschaft (vor allem Mähren), Dichter und ihre Gesellen, die er zu Freunden gewinnt: das alles tut ihm außerordentlich gut. Die eigene Handschrift kräftigt sich, seine Haltung bekommt etwas gelassen Männliches, der unbedingte Ernst der Kunstübung wird von einer leichten Heiterkeit „aufgehoben“. Kunze vertieft sich in die Literatur des Nachbarlandes, findet auch gerade in der Musik der Tschechen vieles, was ihm aus der Seele spricht, rasch entstehen seine Nachdichtungen, die er 1961 unter dem Titel Der Wind mit Namen Jaromir veröffentlicht. Vertreten sind: Vit Obrtel, Ludvík Kundera, Ivo Fleischmann, Jan Skácel, Miroslav Holub, Milan Kundera, Luboš Příhoda, Jana Štroblová. Kunze überträgt ihre Gedichte so, daß sie ihr volles Karat behalten. Nehmen wir Kunderas „Grummetwunsch“:
Von Kindheit an verbinde mit dem Heu ich
das Wort Traum.
Nie schlief, nie träumte ich im Heu.
Doch Jahr für Jahr
erregt es mich.
Beständig mehr, ohne Schwermut, ohne Fürsprachen und Zusprüche.
Eine Unruhe, die ich liebe.
Und eine Vielfalt der Fragen,
die ich vergöttere.
Wenn man zum zweiten Male erntet,
bebe ich fast vor Wonne
und rufe nach der dritten Mahd.
Für das selige Heu der Träume
(das niesend selige,
selig schmeichelnde)
ist der Sommer zu kurz,
reicht nicht das Jahr.
Für die heimlichen Schläfchen in den Schobern der Heuträumerei,
für den schönen Aufflug,
für das Taukonzert des Morgens:
eine gute Heuernte,
einen unbarmherzigen Traum.
Gerade Kunderas leichte Hand, das Herzhafte und doch Schwebende seiner Bilder müssen Kunzes Vorstellungen sehr entgegengekommen sein. Man könnte sich denken, daß besonders jene Gedichte, die Kunze später an Sohn und Tochter richtet, hier ihren Ursprung haben. Zu den schönsten Nachdichtungen gehören der „Versuch, Charlie Chaplin zu loben“ (L. Kundera), die der Skácelschen Verse, von denen sich der Übersetzer den Titel für seinen Band lieh (Jaromir ist ein tschechischer Vorname; Jaro = Frühling, Mir = Frieden), und schließlich die Verdeutschungen der Texte Miroslav Holubs. Dessen schon berühmt gewordene „Knochen“ lauten bei Kunze so:
Beiseite legen wir
aaaüberflüssige Knochen,
aaaRippen von Reptilien,
aaaRaubtierkiefer,
aaaden Lendenknochen des Sturmes,
aaaden irrenden Knochen des Schicksals,
aaaFür den wachsenden Kopf
aaades Menschen
suchen wir
aaaein Rückgrat, das
aaagerade
aaableiben möge.
In dem bei Rowohlt erschienenen Band Sensible Wege hat Kunze seine gewichtigsten Arbeiten aus den letzten Jahren zusammengestellt, dazu das, was er aus seinen früheren Schaffensphasen bewahrt wissen will. Noch mehr als bisher sind die Gedichte jetzt Gelegenheitsgedichte, im Sinne Goethes und Brechts, aber auch Ungarettis, der einmal erklärte, die Aufgabe eines Poeten bestehe darin, „eine eigene schöne Biographie zu hinterlassen“. Dieses „schön“ ist schon bei Ungaretti cum grano salis zu verstehen. Wenn Kunzes Biographie, wie sie sich hier abzeichnet, das Wort verdient, dann als Beispiel eines Lebensganges, der Klarheit, Heiterkeit, Beherztheit und Solidarität in ein und derselben Person sinnfällig macht.
Radikaler als je zuvor, jedoch ohne Zähneknirschen, stößt Kunze in das Innere seines Grundthemas vor. „Macht und Geist“. Die Gedichtüberschriften lassen genügend ahnen: „Das Ende der Kunst“, „Lied vom Biermann“ oder „Von der Notwendigkeit der Zensur“, „Hymnus auf eine Frau beim Verhör“. Da ist zunächst seine Frage: Wie kann ich mich verständlich machen unter den besonderen Umständen in meinem Land? Wir wissen, daß zum Beispiel die Form der Fabel von den Dichtern aller sozialistischen Staaten immer dann gern benutzt wurde, wenn sie etwas Politisches zur Sprache bringen wollten, das mit der augenblicklich herrschenden Parteimeinung nicht übereinstimmte oder einem der Machthaber den Spiegel vorhielt. Günter Kunert hat einige Kabinettstücke dieser Art geschaffen: Etwa:
Als unnötigen Luxus
Herzustellen verbot was die Leute
Lampen nennen
König Tharsos von Xantos der
Von Geburt
Blinde.
Kunze geht einen Schritt weiter. Er sieht das Ende der Fabeln gekommen, schreibt aber noch einmal – mit vollkommener Einfachheit, aber glänzend dialektisch – eine Fabel über „Das Ende der Fabeln“.
Es war einmal ein fuchs…
beginnt der hahn
eine fabel zu dichten
Da merkt er
so geht’s nicht
denn hört der fuchs die fabel
wird er ihn holen
Es war einmal ein bauer…
beginnt der hahn
eine fabel zu dichten
Da merkt er
so geht’s nicht
denn hört der Bauer die Fabel
wird er ihn schlachten
Es war einmal…
Schau hin schau her
Nun gibt’s keine fabeln mehr
Anstelle der Fabeln bedient sich Kunze nun einer direkteren Form. Wir möchten sie entlarvendes Zitieren nennen. Es ist das überführen von Sprachmißbrauch allein durch Wiederholung des Mißbrauchs auf augenfällige Weise. Seit Beckett ist die Methode bei der sogenannten Avantgarde des Westens außerordentlich beliebt. Aber nur selten bringt sie es hierzulande zu Ergebnissen von grundlegender Erhellung, zumeist bleibt sie im Sprachspielerischen, Pseudowissenschaftlichen oder faul Kabarettistischen befangen. Kunze sondiert das Wortmaterial aus seiner Sphäre und zitiert die gestanzten Thesen und Schlagworte mit so trockner Kunst, daß ihre Fragwürdigkeit zum Greifen scheint. Seine Ironie hat nichts Unverbindliches, hinter ihr spürt man eine gesammelte Aufmerksamkeit, der das Wort „Veränderung“ zu gut ist zum Phrasendreschen. Für sie geht es um Sein oder Nichtsein. Das dreiteilige Gedicht „Kurzer Lehrgang“ trifft ins Schwarze:
DIALEKTIK
Unwissende damit ihr
unwissend bleibt
werden wir euch
schulen
ÄSTHETIK
Bis zur entmachtung des
imperialismus ist
als verbündeter zu betrachten
Picasso
ETHIK
Im mittelpunkt steht
der mensch
Nicht
der einzelne
Aber stärker als Gedichte sind solche Texte, die die Bedrohung des Menschen durch ein Machtwort der Macht dadurch demonstrieren, daß sie eine Zeit momentaner Windstille, Augenblicke der Zuversicht poetisch heraufrufen, dabei aber die jederzeit mögliche Umkehrung der Verhältnisse, den potentiellen Umschlag von Verschontsein in Verfolgtwerden mit imaginieren. Sie bilden die Höhepunkte von Kunzes feingeschliffener Dialektik und verlangen hellhörige, über den Wortlaut hinausdenkende Leser. Exemplarische Stücke dieser Art sind die „21 Variationen über das Thema Die ,Post‘“, dann der „Dezember“, insbesondere das „Zweite Gedicht über das Fensterputzen“:
Den rahmen säubern
von der möglichkeit des gitters, den wirbel
von der möglichkeit des galgens, den sims
von der möglichkeit des letzten schritts
Die scheiben putzen, nichts
trübe den blick
Atmen
den frieden der fenster die
nachts nicht verschweigen müssen
ihr licht
Die in den Sensiblen Wegen vorgebrachten Einwände sind mit der Kunertschen oder Biermannschen Kritik nur scheinbar verwandt. Beide Autoren geben immer wieder zu erkennen, daß sie in Fragen der Ideologie keine Fragen haben; was sie stört, ist die unvollkommene Anwendung der Ideologie. Sie reiben sich an den Apparatschiks, ihrer sträflichen Instinktlosigkeit, ihrem Bonzentum. Ein Lied wie die „Tischrede des Dichters im zweiten mageren Jahr“ von Biermann hat bei aller Härte des Tons, in dem hier den „fetten Ochsen“ der Revolution die Leviten gelesen werden, nicht die fundamentale, wenn auch geheimere Stoßkraft der Kritik Kunzescher Verse. Selbst in Biermanns messerscharfem „Porträt eines alten Mannes“ bleibt es bei Personenkritik.
Seht, Genossen, diesen Weltveränderer: Die Welt
Er hat sie verändert, nicht aber sich selbst
Seine Werke, sie sind am Ziel, er aber ist am Ende
Was von Kunze angefochten wird, sind keine Äußerlichkeiten. Er sieht, daß Versuche unternommen werden, „die Wurzeln zu roden“ – um es mit einem Vers Huchels zu sagen. Er ist sicherlich ein besserer Sozialist als die meisten von denen, die ihn einen schlechten nennen. Ausdrücklich bekennt er sich zu diesem den sozialistischen Weg gehenden Land:
ausgesperrt aus büchern
ausgesperrt aus zeitungen
ausgesperrt aus sälen
eingesperrt in dieses land
das ich wieder und wieder wählen würde
hoffe ich
mit deinem grün
Aber er ist nicht gewillt, um keinen Preis, die Bevormundung und Maßregelung der Kunst stumm hinzunehmen. Wer ihn genau liest, wird zugeben müssen, daß seine Lyrik – kommunistisch gesprochen – keine konterrevolutionären Argumente verwendet, im Gegenteil: der Dichter protestiert gegen die Stagnation der Revolution, er möchte, daß sie sich im durchaus revolutionären Sinn von überholten, zeitbedingten Wahrheiten befreit, scharf Inventur macht, daß sie sich offen hält. Warum, so fragt er sich, müssen wir uns in unserer Republik päpstlicher gebärden als die Päpste in Moskau? Konkret: Warum darf ein Buch Solschenizyns in Rußland erscheinen, nicht aber hier? Und er schreibt ein Gedicht („Deutschland Deutschland“) und widmet es Alexander Solschenizyn. Dieser große Name fällt nicht zufällig. Viel von Solschenizyns Reinheit und Unbeugsamkeit spiegelt sich in Kunze wieder.
Fast alle Gedichte des Bandes sind politisch. Nichtsdestoweniger sind sie – und das macht ihren Rang aus – primär poetisch. Das Politische geht vollkommen in Figur und Schicksal, genauer: in der Singularität der Person des Dichters auf und diese wiederum rein in verbaler Transparenz. Kunzes Poesie ist propagandistisch nicht auszuschlachten. Sie ist kämpferisch, aber untauglich als Waffe für Ideologen. In gleichviel welcher Faust kehrt sie sich gegen den, der mit ihr zuschlagen will. Obwohl Kunze nur vor der eigenen Tür kehrt – und das ehrt ihn –, zeigen seine Verse spiegelverkehrt auch die Mißstände und Machenschaften auf unserer Seite. Dennoch gäben wir viel darum, wenn wir mit einer bei uns gewachsenen Begabung von diesem Kaliber direkt konfrontiert würden.
Die, wenn man so steigern darf: poetischsten Gedichte stehen im dritten Teil des Bandes unter dem Zwischentitel „Hunger nach der Welt“. Die Formulierung meint dreierlei. Erstens: das simple Verlangen von Menschen, denen der Staat Reisen oder Nichtreisen vorschreibt, sich überallhin frei bewegen zu dürfen. Zweitens: die Suche nach Kontakten, Freundschaften, Solidarität – denn der Dichter ist, der Natur seiner Arbeit entsprechend, ein Einzelner, Einsamer. Drittens: den Hunger der Poesie nach Außenwelt, sichtbaren, greifbaren, schmeckbaren Dingen. Kunze konkretisiert diesen Hunger in Reise- und Landschaftsgedichten. Wie weit entfernt sind sie etwa von unserer Landschaftslyrik der fünfziger Jahre! Schade, daß wir seine „Kleine Reisesonate“ wegen ihres Umfanges nicht zitieren können, um das bruchlose Ineinander von sinnenhafter Anschauung, gedanklicher Dichte, politischer Anspielung, zärtlichem Humor und großartig einfacher Metaphorik anschaulich zu machen. Doch die Tibor Déry dedizierte „Ungarische Rhapsodie 66“ kann uns davon auch einen Begriff geben:
Der schaffner kam in der uniform
eines Postillions
In der schwarzen ledertasche auf der hüfte hatte er
die Donau diesen schweren
doppelbrief, versiegelt
mit einem mohnfeld wie
mit einem blutfleck
Budapest schimmerte durch den umschlag
wie vor dem gewitter
Ich durfte nicht öffnen, doch
lange las ich auf der pußta nachts
die steile schrift der blitze
In dieser reinen, hellen, heiteren Luft der Sprache erreicht Kunzes Poesie den Wirklichkeitsgrad einer Schönheit jenseits des Ästhetischen, jenseits der Diskussion. Unsere westlich spitzfindigen Theorien von inhaltsfreier, sogenannter konkreter Poesie und von ihrem Gegenteil, dem engagierten, das heißt, parteilich festgelegten, zum Klassenkampf brauchbaren Gedicht werden von der Lyrik der Sensiblen Wege ohne großes Aufheben ihrer Engbrüstigkeit und Bleichsucht überführt. Man lese „Besuch in Mähren bis Mitternacht“ oder „Bei E. in Vřesice: oder „Puschkins Michailowskoje“, und man wird von neuem einen Begriff von Poesie bekommen. Poesie als einem Element. Unerschöpflich, unwiderleglich.
Kunzes Sprache will in erster Linie Verständigungsmittel sein, nicht im Sinn von Information, sondern von Mitmenschlichkeit. Das erste sozialistische Gebot: Du sollst nichts für dich allein behalten – es gilt auch für die Güter der Poesie. Mitteilen heißt bei Kunze: dividieren. Alles, was der Autor auf der Kruste dieser Erde erfährt, will er mit den Lesern brüderlich teilen. Anmut, Güte, Tapferkeit, Furcht und Schrecken. Das schließt die Absage an jede Esoterik ein. Kunze weiß aber auch, daß die Sprache ihrem Wesen nach relativ ist, daß sie immer etwas anderes meint: etwas Sprachloses, im lebendigen Wort nie ganz Formalisierbares. Die zwar mit Macht angestrebte, doch immer um einige Grade schwankende Eindeutigkeit der Sprache garantiert jedoch das Im-Fluß-Bleiben des Verstehens zwischen Mensch und Mensch. Was du mir bedeutest, was ich dir bedeute: in Formeln gefaßt, müßte es uns in Salzsäulen verwandeln. Die unreine Sprache, an der wir leiden, bürgt für das Humane zwischen uns.
Der Gedichtzyklus über die Post diskutiere, heißt es, „die Leistungsfähigkeit und Anfälligkeit des Informationsaustausches über trennende Entfernungen hinweg“. Diese leisetreterische Klappentext-Definition übersetzen wir schlicht in: Hunger nach Briefen, unzensierten. Die Bedeutung der Post für den Schriftsteller, ob er nun in der sozialistischen oder kapitalistischen Welt lebt, ist eminent. Und sie hat etwas Gleichnishaftes. Vor Kunze hat das scheinbar simple Thema niemand angepackt. Er, der im Guten wie Schlechten buchstäblich von der täglichen Post abhängt, zeigt uns, was in diesem Thema steckt. Knapp, bildstark sind seine „ Variationen“:
Wenn die post
hinters fenster fährt blühn
die eisblumen gelb
Oder
Brief du
zweimillimeteröffnung
der tür zur welt du
geöffnete öffnung du
lichtschein,
durchleuchtet, du
bist angekommen
Kunze kann ein Gedicht in zahlen schreiben und ihm in drei Schlußzeieln beinahe etwas Musikalisches mitgeben
Eilzustellung / Exprès
Berlin (west) 20.1. – 13 uhr
Greiz 26.1. – 21 uhr
Brief
Berlin (west) 1.2. – 17 uhr
Greiz 9.2.
Was
der tochter sagen im
postmuseum?
Gerade dieser Zyklus ist ein Musterbeispiel für die Kunst des Autors, Sachliches mit einer fast spielerischen Phantasie vorzutragen, menschliche Überlegenheit über finstere Zustände durch Humor glaubwürdig zu machen. Wir können nicht genau sagen, wieso uns der Humor slawisch angehaucht vorkommt. Vielleicht ist es seine verschmitzte Güte. Vielleicht – frei von Galgenhumor – jene Heiterkeit des gebrannten Kindes, das an die Feindseligkeit des Feuers einfach nicht glauben kann. Oder seine ungekünstelte Bescheidenheit? Dem Dichter Jan Skácel hat Kunze die folgende „Variation“ gewidmet:
Briefträger, freunde, wenn
mir’s nicht mehr reichen wird für
briefmarken, gebt mir
eine mütze
eine tasche
eine straße und
viel post
Ich werde
keinen brief verlieren, die ecken
nicht umknicken (VORSICHT
BEI DEN GROSSEN ANSICHTSKARTEN – ich
weiß)
Trauerschreiben
halte ich zurück bis
alle briefe ausgetragen sind
Stets
trag ich mit mir einen brief für
entmutigte
(Nur überlaßt mir keinen brief aus
Mähren, ich
begänne zu dichten)
Wenn es wahr ist, daß Kunzes Dichtung dem Geist der Musik nicht wenig zu verdanken hat, und wir möchten dies keineswegs in Abrede stellen: dann wohl nicht so sehr dem Geist Beethovens, obgleich Kunze diese Musik wie keine andere künstlerische Leistung auf unserem Stern zu verehren scheint. Viel eher hören wir in den Versen etwas Mozartisches mit. Heiterkeit und Trauer engumschlungen, ein helles Dunkel, Festigkeit, mit Zartheit ausgedrückt, das Natürliche als Leichtigkeit im Flug, der Schatten des Endes über allem:
Eines morgens
wird er läuten als
briefträger verkleidet
Ich werde ihn
durchschauen
Ich werde sagen: warte bis
der briefträger vorüber ist
Ich habe hier und da erklärt, die reinrassigen Poeten seien heute, mindestens in Deutschland, so gut wie ausgestorben. Ich habe zu schwarz gesehen.
Während diese Zeilen entstanden, wurde Reiner Kunze auf dem VI. Schriftstellerkongreß in Ostberlin für seinen Band Sensible Wege gemaßregelt.
Heinz Piontzek, aus Heinz Piontek: Männer die Gedichte machen, Hoffmann und Campe Verlag, 1970
Sensible Wege (1969)
Die Publikationsgeschichte des Gedichtbandes Sensible Wege kann man als eine Gratwanderung bezeichnen. 1967 legte Reiner Kunze ein umfangreiches Manuskript mit neuen Gedichten dem Aufbau Verlag vor. Nach der Ablehnung des Manuskripts und nachdem eine Veröffentlichung in der DDR ausgeschlossen schien, nahm Kunze Kontakt mit dem Hamburger Rowohlt Verlag auf. Der Schriftsteller Peter Rühmkorf, langjähriger Lektor des Verlages, verfaßte ein Gutachten, in dem er sich trotz der „Grenzen solcher Privatpoesie“ für eine Veröffentlichung ausspricht. Bernt Richter, Cheflektor des Rowohlt Verlages, zeigte sich überzeugt von der Qualität der Gedichte, deren Kommunikationsthematik kein spezifisches Problem der DDR-Gesellschaft darstelle, sondern von allgemeinem Interesse sei.
Die Veröffentlichung wurde begünstigt von einem wachsenden Interesse führender Verlage in der Bundesrepublik (Luchterhand, Suhrkamp, Rowohlt, S. Fischer, Wagenbach) an der DDR-Literatur und von einer veränderten Ostpolitik der Bundesrepublik, die 1972 zur Unterzeichnung des Grundlagenvertrages führte.
Kurz nach dem von der Literaturkritik in Ost und West gleichermaßen stark beachteten Roman Nachdenken über Christa T. von Christa Wolf erschien im Frühjahr 1969 Kunzes Gedichtband Sensible Wege. Der Autor hatte den ursprünglich geplanten Titel Partituren geändert und das Manuskript kurzfristig um einige 1968 entstandene Gedichte ergänzt. Das Büro für Urheberrechte, das seit Februar 1966 in der DDR darüber wachte, daß Autoren und Verlage nicht ohne Genehmigung Verträge über Nutzungsrechte und Lizenzen mit Partnern außerhalb der DDR abschlossen, verurteilte Kunze deswegen zu einer Ordnungsstrafe von 300 Mark. Daß Kunzes Gedichtband nicht wie Christa Wolfs Roman gleichzeitig in einem Verlag der DDR (Mitteldeutscher Verlag) und einem bundesdeutschen Verlag (Luchterhand) erschienen war, sondern wie die Bücher Biermanns oder Huchels ausschließlich in einem Verlag des Westens, führte zu weiteren Publikationserschwernissen für den DDR-Autor. Zum Beispiel wurde ein Übersetzungsauftrag für einen Gedichtband des Ungarn Gyula Illyés durch den Verlag Volk und Welt mit dem ausdrücklichen Hinweis auf die Veröffentlichung des Bandes Sensible Wege im Rowohlt Verlag zurückgenommen. So geriet Reiner Kunze Ende der sechziger Jahre in eine deutsch-deutsche Rezeptionssituation, die über die literarische Auseinandersetzung hinaus stark von ideologischen Motiven bestimmt war.
Die 48 Gedichte und 21 Post-Variationen des Bandes Sensible Wege sind vor dem 21. August 1968 entstanden, einem Datum politischer Desillusionierung, dessen Bedeutung für Kunzes Biographie und Werk kaum zu überschätzen ist. Wenige Gedichte des Bandes stammen aus der Zeit vor 1965, der weitaus größte Teil ist, wie es die Datierungen des Autors ausweisen, in den Jahren 1965 bis 1968 entstanden. Allein im Jahre 1966, dem Jahr der Lyrik-Diskussion in der DDR, wurden neunzehn der Gedichte geschrieben. Die genaue Datierung der Texte, die Kunze im Band Sensible Wege erstmals vornimmt, ist mehr als ein chronologisch-kalendarischer Appendix. Die Gedichte werden dadurch vom Autor in einen lebens-, werk- und zeitgeschichtlichen Zusammenhang gestellt, und sie werden ausgewiesen als „Gelegenheitsgedichte“ im Sinne Goethes und als „Zeitgedichte“ im Sinne Heines.
Im Vergleich mit dem Band Widmungen ist der Band Sensible Wege formal und thematisch geschlossener und stärker strukturiert. In die erste der vier Gedichtgruppen, die „und es war schön finster“ überschrieben ist, hat Reiner Kunze vier Gedichte aufgenommen, die bereits im Gedichtband Věnování, der tschechischen Ausgabe der Widmungen, veröffentlicht wurden und die sich – wenn auch noch verschlüsselt und abstrakt – mit der Funktionalisierung der Poesie und mit der Nivellierung des Individuellen auseinandersetzen. Im zweiten Kapitel, „eine kleine deutsche stadt“ betitelt, nimmt der Anteil des Biographischen zu, und die Verteidigung der Poesie wird offensiver, direkter und angreifbarer. Die Erfahrung provinzieller Enge, zensorischer Maßnahmen und existentieller Bedrängnis führt zu Gedichten der Introspektion, nicht aber zu Eskapismus und Innerlichkeit.
Die Welt der Begrenzungen, Ausgrenzungen und Grenzerfahrungen läßt geradezu zwangsläufig einen „hunger nach der welt“ entstehen, dem die dritte Gedichtgruppe des Bandes gewidmet ist. Die hier versammelten Reise- und Landschaftsgedichte haben zwar die topographische und historische Genauigkeit der „tschechoslowakischen Widmungen“ beibehalten, aber deren Entgrenzungsmotivik hat sich entscheidend verändert. Die Reisegedichte konfrontieren das lyrische Subjekt jetzt mit einer kaum zu überwindenden Staatsgrenze. Exemplarisch hierfür ist das Gedicht „Kleine Reisesonate“, das mit folgenden Versen beginnt:
Wie der hahn durchs zaunloch,
geduckt, den schnabel fast
am boden, die flügel
angelegt, so
zwängte ich mich
unter dem schlagbaum hindurch
Ich hatte nichts bei mir außer
meinem hunger nach der welt
Mit der vierten Gedichtgruppe des Bandes, den „einundzwanzig variationen über das thema: ,die post‘“, widmet sich Kunze auf originelle und originäre Weise einem Thema, das in der deutschen Lyrik – sieht man einmal vom Posthorn der Romantik ab – seinesgleichen sucht. Er gewinnt dem Post-Thema derart viele Facetten und Nuancen ab, daß sich viele wesentliche Themen seiner Lyrik darin wiederfinden: Macht und Geist, Individuum und Gesellschaft, Sprache und Sprachregelung, Poesie und Politik. Dem Brief als Metapher des Personalen, Individuellen und Poetischen steht die Post gegenüber, die mit institutioneller Macht in die Sphäre des Einzelnen eingreift, Kommunikation erlaubt oder verhindert. Die Post-Variationen werden zu Explikationen eines Poesieverständnisses, wie es Paul Celan mit seinem Wort vom Gedicht als „Flaschenpost“ auf metaphorische Weise bestimmt hat. Wie der Brief ist auch das Gedicht unterwegs, unterwegs zu einem anderen.
Beide suchen das Gespräch mit dem Leser. Kunzes Option für eine dialogische Poesie hat Konsequenzen für die Sprache und Struktur der Gedichte. Insbesondere die Variationen über das Post-Thema sind dialogisch aufgebaut, sind Anrede an ein Gegenüber, sind Frage und Antwort. Einige der Variationen aus diesem Zyklus sind im Vorgriff auf den Band Zimmerlautstärke (1972) und dessen erste Gedichtgruppe bereits als „monologe mit der tochter“ zu verstehen, in denen paradoxerweise die Option für den Dialog unüberhörbar ist.
Um den Bereich des Poetischen auf poetische Weise zu bestimmen, hat Kunze in den Widmungen auf das klassische Motiv des Vogels zurückgegriffen, der in den Zweigen sitzt und singt. In Sensible Wege wählt er nun das Motiv des Briefes, um das Kommunikative und Dialogische der Poesie zu kennzeichnen. In Anspielung auf Milan Kunderas Gedicht „Dichter sein“ vergleicht er in der 17. Variation des Post-Zyklus’ die Tätigkeit des Dichters mit der des Briefträgers:
BRIEFTRÄGER SEIN
Tag für tag
erwartet werden, eine
hoffnung sein, das unüberbrückbare
überbrücken mit
jedem schritt
Briefträger sein
Tag für tag
bis vor die türen der menschen gehen,
nicht eintreten dürfen
Der Gedichtband Sensible Wege ist konsequente Fortsetzung und Weiterführung des Bandes Widmungen. Die dreisprachige Widmung des Bandes – „dem tschechischen Volk, dem slowakischen Volk“ – ist in ihrer politischen Aussagekraft nur vor dem Hintergrund der Ereignisse des 21. August 1968 zu erfassen. Kunzes Solidarität mit diesem Land und seinen Poeten drückt sich darüber hinaus in Zueignungen einzelner Gedichte für Ludvík und Milan Kundera und für Jan Skácel aus. Drei Reisegedichte führen nach Mähren, das schon in den Widmungen zu einem Parnaß für den jungen DDR-Schriftsteller geworden war. Das heiter-ironische Gedicht über den Besuch beim Töpfermeister Emil Ebr in Vřesice, einem kleinen Dorf auf dem böhmisch-mährischen Höhenzug, erinnert in seiner assoziativen Bildlichkeit an den tschechischen Poetismus und weiß noch nichts vom politischen Desaster des folgenden Jahres in Prag. Es spielt an auf Skácels und Kunzes Bild vom „Brunnen im Süden Mährens“ und deutet voraus auf das spätere Gedicht „Wie die Dinge aus Ton“, das von der Zerschlagung einer politischen und poetischen Utopie handelt:
BEI E. IN VŘESICE
Er nahm uns auf die töpferscheibe
und formte krüge aus uns
Skácel fiel barock aus
wie der zwiebelturm von Sulikov
Kundera geriet auf eigenen wunsch
dreieckig (kunststück)
Unterm sanften druck der hände wurde ich
ein krug aus Mähren
Dann füllte uns der meister
mit löwenzahnwein
Als wir gingen, schwer
wie steingut, schlug mir der apfel am baum
gegen die stirn
Viele Gedichte aus Sensible Wege setzen sich entschiedener und direkter mit der gesellschaftlichen und kulturellen Realität in der DDR auseinander. Nicht mehr Mělník, Znaim, Aussig, Sulíkov oder Vřesice, sondern Greiz in Thüringen wird zum Ausgangspunkt von Gedichten, die eine entscheidende Veränderung in der Lebens- und Werkgeschichte des Autors erkennen lassen. Skulpturen der thüringischen Bildhauerin Elly-Viola Nahmmacher sind nun, wie es in den Widmungen die Bilder des Tschechen František Peterka waren, Anlaß zu Bildgedichten, in denen Kunze sich von einer streng realistischen Kunstauffassung distanziert. Der familiäre Bereich ist im Gedichtband Sensible Wege ein thematischer Schwerpunkt, wobei Politik und Poesie gerade hier aufeinandertreffen. Mit den wie absichtslos gefundenen poetischen Antworten der Kinder auf familiäre Konflikte, die einigen Gedichten in Form eines Mottos vorangestellt sind, führt Kunze einen lyrischen Dialog, der die private Perspektive ins Existentielle und Gesellschaftliche weitet:
DER TABAKDRACHE
aaaaaaaaaWenn du rauchst
aaaaaaaaabist du ein drache
aaaaaaaaa(die tochter)
Ich bin ein drache
Jetzt begreifst du
den wald um uns
Jetzt begreifst du
das tal unter uns
Die Wahrnehmungsweise der Kinder und ihre Sprachbilder werden für Reiner Kunze zum Quell poetischer Welterfahrung. Das Gedicht „Das Plakat“ beispielsweise ist als Bildgedicht auf eine Zeichnung der Tochter Fortsetzung des Gedichts „Kinderzeichnung“ aus den Widmungen und Vorwegnahme der Titelgeschichte des Kinderbuches Der Löwe Leopold, das 1970 erschienen ist und mit dem Kunze als Autor von Kinderbüchern debütierte. Auch andere Autoren der Generation Volker Brauns haben Bücher für Kinder geschrieben, und Rainer Kirsch sieht einen Grund hierfür in der Wesensverwandtschaft zwischen Kindern und Dichtern:
Dichter ähneln bekanntlich, soweit sie ihren Beruf ausüben, Kindern: sie sind extrem verletzlich, sie sind neugierig, sie sind spiellustig und können nicht ernsthaft lügen.
Ein anderes Wort für Verletzlichkeit ist Sensibilität. Die Gedichte des Bandes Sensible Wege ergreifen Partei für die Freiheit der Poesie und des Individuums und verteidigen beide gegen jede Form von Verletzung durch politische Sanktionen und Übergriffe.
SENSIBLE WEGE
Sensibel
ist die erde über den quellen: kein baum darf
gefällt, keine wurzel
gerodet werden
Die quellen könnten
versiegen
Wie viele bäume werden
gefällt, wie viele wurzeln
gerodet
in uns
Das Titelgedicht des Bandes könnte, ließe man das Entstehungsjahr 1966 und den Kontext DDR-Literatur außer acht, jener namentlich als „Neue Subjektivität“ oder „Neue Sensibilität“ bezeichneten Renaissance bewußt kunstloser, leicht verständlicher, der Alltagswelt zugewandter Lyrik zugeordnet werden, die ab Mitte der siebziger Jahre in der Bundesrepublik eine Lyrik-Welle und eine Lyrik-Diskussion auslöste. So sieht Gérard Raulet in Kunzes Gedichtband Sensible Wege wegen des Rückgriffs auf die Alltagssprache, wegen des familiären Tons und der gezielten Kommunikativität eine Antizipation dieser Lyrik für Leser, übersieht dabei jedoch, daß Kunze sich von Herburger, Brinkmann oder Theobaldy, den Repräsentanten der Neuen Subjektivität, durch sein Poesieverständnis, seine Ästhetik der Reduktion und Aussparung stark unterscheidet. Schließlich verkennt er auch den gravierenden Unterschied zwischen der politisch irrelevanten Subjektivität in der Literatur der Bundesrepublik und der „Subjektivität als politische(r) Kategorie“ in der DDR.
Auch mit einer modisch als „Ökolyrik“ apostrophierten umweltbewußten Naturdichtung der siebziger und achtziger Jahre hat Kunzes häufig zitiertes Titelgedicht nur vordergründig zu tun, wenngleich es zwanzig Jahre nach seiner Entstehung und im Sinne der hermeneutischen Differenz auch als Gedicht über die Zerstörung der Natur zu deuten ist. Vornehmlich aber spricht es in unspezifischen Naturbildern vom Menschen, von dessen Verletzlichkeit und Verletztheit. Seine sprachliche Einfachheit basiert auf Wiederholungen und Parallelisierungen. Seine Naturbildlichkeit ist unkompliziert, zielt auf Existentielles und bereitet einer identifikatorischen Rezeption den Weg. Komplexität indes kommt dem Gedicht „Sensible Wege“ durch seine Intertextualität zu, denn es ist Zwiegespräch über die Poesie und ein Dialog mit Poeten.
Zehn Jahre nach Bertolt Brechts Tod rekurriert das Gedicht „Sensible Wege“ auf dessen Gedicht „An die Nachgeborenen“, welches allgemein als lyrisches Vermächtnis dieses engagierten Schriftstellers gilt. „Kein anderes Gedicht aus der ersten Jahrhunderthälfte“, schreiben Birgit Lermen und Matthias Loewen, „hat ein vergleichbares Echo gefunden.“ Allein schon die große Zahl der Folge- und Antwortgedichte, die es hervorgerufen habe, sei ein Beweis dafür. Neben Wolf Biermanns Song „Brecht, deine Nachgeborenen“, Horst Bieneks Gedicht „Die Zeit danach“ oder Paul Celans „EIN BLATT, baumlos“ ist auch Reiner Kunzes Gedicht „Sensible Wege“ zu den Folge- und Antwortgedichten auf Brechts Zeitgedicht aus dem dänischen Exil zu zählen. Brecht schrieb es zwischen 1934 und 1938, stellte es ans Ende seiner Gedichtsammlung Svendborger Gedichte und formulierte darin die nachgerade sprichwörtlich gewordene Absage an ein von gesellschaftlichen Mißständen und von politischem Unrecht ablenkendes „Gespräch über Bäume“:
Was sind das für Zeiten, wo
Ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist,
Weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschließt!
Diese Zeilen beklagen aber ebenso eine historisch genau zu bestimmende Zeit, in der Konversation außerhalb gesellschaftspolitischer Belange unverantwortlich ist. Daß Kunzes Gedicht „Sensible Wege“ ausdrücklich Gespräch über Bäume sein will, ist zum einen zurückzuführen auf veränderte, verbesserte politische Verhältnisse und zum andern Resultat eines modifizierten Naturverständnisses in der Nachkriegsliteratur. Kunzes Naturbilder und seine Baummetaphorik sind Medium der Kritik an einem sogenannten „entwickelten sozialistischen Gesellschaftssystem“, in dem die Utopie Brechts, „daß der Mensch dem Menschen ein Helfer ist“, noch keineswegs verwirklicht ist. Schon Kunzes 1962 entstandenes Gedicht „Der Hochwald“, das den Gedichtband Sensible Wege eröffnet, beklagt das Mißverhältnis von individueller Freiheit und gesellschaftlicher Gleichheit, und es warnt vor jeder Gleichschaltung und Entpersönlichung zugunsten gesellschaftlicher Interessen, indem es gerade das von Brecht diskreditierte Gespräch über Bäume pflegt:
Die fähigkeit,
mit allen zweigen zu atmen,
das talent,
äste zu haben nur so aus freude,
verkümmern
Den Widerspruch zwischen solcher Verkümmerung der Fähigkeiten und Talente des einzelnen und dem obersten Bildungsprinzip der ehemaligen DDR von „allseitig und harmonisch entwickelten sozialistischen Persönlichkeiten“ bekräftigt und verstärkt das Gedicht „Sensible Wege“, wenn es von inneren Verletzungen spricht, die durch die Schlußformel der Introspektion „in uns“, durch die Antithese von Anspruch („kein baum“, „keine wurzel“) und Realität („wie viele bäume“, „wie viele wurzeln“) und durch Verben wie „fällen“ und „roden“, die Verfügbarkeit und Bemächtigung konnotieren, besonders akzentuiert sind. Eine weiteres Gedicht Kunzes, eine der drei 1966 entstandenen „Bildhaueretüden“, wählt ebenfalls die metaphorische Verknüpfung von Baum und Mensch, um vor inneren Verletzungen und Zerstörungen zu warnen oder um diese sichtbar zu machen:
Auch nach dem sturz
stirbt der baum im baum
nur langsam
Wie im menschen der mensch
Ihm den
kern nehmen,
aushöhlen ihn
Das
macht brauchbar
Neben der gesellschaftskritischen Dimension des auf Brecht antwortenden Titelgedichts „Sensible Wege“ ist eine weitere und gleichermaßen bedeutsame intertextuelle Ebene hervorzuheben. Der lyrische Dialog Kunzes mit dem tschechischen Dichter Jan Skácel wird darin im Bild vom Roden der Wurzeln fortgesetztlos, aber gleichzeitig eröffnet dasselbe Bild ein poetisches Zwiegespräch mit dem damals in der DDR verfemten Dichter Peter Huchel. Dessen Gedicht „Der Garten des Theophrast“, das Ende 1962 in der letzten von Huchel redigierten Ausgabe der Zeitschrift Sinn und Form erschienen ist und dem wie dem Gedicht „An die Nachgeborenen“ infolge der Widmung „Meinem Sohn“ Vermächtnischarakter zukommt, zählt auch zu den Folge- und Antwortgedichten auf Brechts lyrisches Testament. In metaphorisch dicht gefügten Bildern einer südlichen Landschaft verknüpft Huchel die Tätigkeit des griechischen Botanikers Theophrast mit der des Dichters. Seine naturlyrischen Verse dringen vor in existentielle, politische und poetologische Schichten. Botaniker und Dichter, „die einst Gespräche wie Bäume gepflanzt“ haben, sehen sich einer lebens- und poesiefeindlichen gesellschaftlichen Realität ausgesetzt:
Sie gaben Befehl, die Wurzel zu roden.
Es sinkt dein Licht, schutzloses Laub.
Kunze greift dieses Bild der Hoffnungslosigkeit, mit dem Huchels Gedicht endet, in seinem Gedicht „Sensible Wege“ auf und solidarisiert sich durch das kryptische Zitat mit einem DDR-Dichter, der zu einem Opfer des Regimes geworden und Mitte der sechziger Jahre in entmutigenden Verhältnissen zu leben gezwungen war. Bei Axel Vieregg finden sich über die schikanösen Maßnahmen gegen Huchel detaillierte Informationen:
Peter Huchel wurde 1962 zwangsweise als Chefredakteur der ostdeutschen literarischen Monatsschrift Sinn und Form abgesetzt und in Wilhelmshorst bei Potsdam, bis zu seiner Ausreise im Mai 1971, praktisch unter Hausarrest gestellt. Briefe aus dem Westen durfte er nicht erhalten und den damals letzten Band seiner Gedichte, Chausseen Chausseen; in der DDR nicht veröffentlichen. Zwischen 1963, dem Jahr seines Erscheinens im S. Fischer Verlag Frankfurt, und Mai 1971 sind noch einmal vierzehn Gedichte in verschiedene westdeutsche Zeitungen und Zeitschriften gelangt, und zwar auf abenteuerlichen Wegen, die für Huchel wie für die Verbindungsmänner, die beim ,Herüberschmuggeln‘ der Manuskripte halfen, gleich gefährlich waren.
Vor dem Hintergrund dieser Lebensumstände Huchels in der DDR bekommt Kunzes traditionell anmutendes Gespräch über Bäume durch die Verteidigung eines Poeten eine unverkennbar politische Dimension. Auch in dem Gedicht „Puschkins Michailowskoje“ setzt Kunze die Solidarisierung mit Huchel fort, wenn er darin den „Garten des Theophrast“, der identisch ist mit dem Lebensraum der Poesie, emphatisch verteidigt:
Wer immer
die angreifer wären hier jetzt zum gegner hätten sie
mich
Wer immer einfallen wird
in die offenen gärten der dichter
Kunzes engagierte Verteidigung der Poesie vollzieht sich jedoch nicht nur in Anspielungen und kryptischen Zitaten, was Peter Rühmkorf von „vertraulichem Gewisper unter Eingeweihten“ und von „Pss-Sprache“ sprechen ließ, sondern auch in der direkten Benennung und im Nennen von Namen. So ist das 1967 entstandene Gedicht „Dorf in Mähren“, das in die Heimat Jan Skácels entführt, ausdrücklich Peter Huchel gewidmet, dessen Name Mitte der sechziger Jahre aus der Literaturgeschichte der DDR eliminiert war und der seit 1962 in der Abgeschiedenheit des Dorfes Wilhelmshorst ausharren mußte. Diesen Zeitraum von fünf Jahren benennt das vermeintlich naturlyrische Gedicht gleich zu Beginn und bekundet dadurch sein Engagement.
DORF IN MÄHREN
(für Peter Huchel)
Fünf jahre heiratete niemand
in Touboř keiner
starb kein kind
wurde geboren
Lautlos blüht am hang
die wegwarte
Die Abgeschiedenheit und Lebensferne des mährischen Dorfes Touboř wird zur Evokation existentieller Isolation. Mähren, Kunzes Chiffre für den Lebensraum und die Lebenskraft der Poesie, und das Schlußbild von der stummen Beharrlichkeit der Wegwarte sind Indikatoren einer metapoetischen Dimension. Der blauen Blume der deutschen Romantik vergleichbar, diesem Symbol für die Apotheose der Poesie, wird die Wegwarte in der Lyrik Kunzes zu einem „strukturierenden Symbol“ für die Sensibilität und Widerstandskraft der Poesie, und sie tritt an die Stelle der Rose, einem Grundsymbol in der frühen Lyrik Kunzes. (Die Wegwarte wächst häufig an Wegen, Rainen und Zäunen, benötigt nur einen kargen Boden, öffnet vorwiegend am Vormittag ihre gegen die Sonne gerichteten Blüten und wird deswegen auch „Sonnenbraut“ genannt. Bei Berührung schließt sie ihre Blüten mimosenhaft, pflückt man sie, verwelkt sie rasch.) Im Gedicht „Feldweg bei Kunstat“ vergleicht Kunze sie bezeichnenderweise mit einem Sensiblen. In Sage und Zauberglauben spielt die Wegwarte eine große Rolle, vor allem auch in Böhmen. Der poetische Name der Blume lädt dazu ein, wie Helga Anania-Hess auf die wörtliche Bedeutung zurückzugreifen und in ihr eine Wächterin des Weges zu erkennen. Ein solches Verständnis legt auch das Titelgedicht des Bandes Sensible Wege nahe, und es stellt unter Beweis, wie sprachbewußt Reiner Kunze in seinen Gedichten ein Netz von Beziehungen knüpft und wie sehr seine Gedichte miteinander korrespondieren.
Berücksichtigt man bei der Deutung des Gedichts „Sensible Wege“ die Intertextualität (mit der Dichtung Brechts, Huchels und Skácels) und seine werkimmanente Repräsentanz, dann ist es als naturlyrisches Gedicht ein Dokument des Widerstands gegen die Poesiefeindlichkeit politischer Macht, gegen jede Form dogmatischer Unterdrückung und gegen das Lebensfeindliche schlechthin.
Viele Gedichte des Bandes Sensible Wege sind „Dennochlieder“ und als solche Bekenntnisse zu jenem Dichter, der wie Huchel, Biermann oder Alexander Solschenizyn „dennoch schreibt“, das heißt: der trotz Zensur, Verbot und Überwachung weiterschreibt.
VON DER NOTWENDIGKEIT DER ZENSUR
Retuschierbar ist
alles
Nur
das negativ nicht
in uns
Schon die Überschrift dieses epigrammatischen Gedichts nennt eines der Tabuwörter in der sich als Literaturgesellschaft verstehenden DDR: Zensur. Die Innenwelt wird in antithetischer Fügung zur Gegenwelt einer von Positivität und Euphemismen beherrschten Weltanschauung. Das Gedicht beharrt dagegen auf einem Weltbild, das die existentielle Dimension des Scheiterns, des Todes, des Leidens und der Trauer nicht ausklammert, und es bezieht Stellung im „Konflikt zwischen dem Grundanspruch der marxistischen Persönlichkeits- und Bildungsidee auf ein ganzheitliches Menschsein und einer sozialistischen Realität, die im Zusammenhang mit ihrer Entwicklung zu einer hoch komplexen Industriegesellschaft ab Mitte der sechziger Jahre zunehmend ihre Schattenseiten enthüllt“.
Die Praxis des Verschweigens , des Retuschierens und Zensierens veranschaulicht auf exemplarische Weise ein anderes Gedicht Kunzes, das auf den 28.10.1966 datiert ist und das in seinem kritischen Engagement innerhalb der Generation Volker Brauns singulär zu nennen ist:
LESUNG
Da war auch einer der
schrieb mit
wortumwort
versumvers
schrieb
Am morgen verschwiegen
die zeitungen
Am abend zeigte der bildschirm
bilder
von der festigkeit
In dem Ende der fünfziger Jahre entstandenen Feuilleton „Das Tütendiktat“ hatte Kunze die Mitschrift eines Gedichts während einer Dichterlesung durch eine alte Genossenschaftsbäuerin zum Paradigma erwünschter Rezeption in einer Literaturgesellschaft stilisiert, in der die spätbürgerliche Entfremdung zwischen Literatur und Arbeitswelt überwunden wurde. Das Gedicht „Lesung“ ist eine Zurücknahme dieses Feuilletons, und es zeigt ein Beispiel verhinderter Rezeption und praktizierter Zensur. In der Verknappung und Komprimierung der Sprache wird die Zuspitzung des Konflikts zwischen Poesie und Politik in der DDR sichtbar, und in Makrolexemen wie „wortumwort“ und „versumvers“ findet Kunze eine sprachliche Form für die Totalität der Kontrolle und des Mißtrauens.
Eine vergleichbare poetische Verdichtung gelingt Kunze in einigen „Variationen über das Thema: Die Post“. In der zweiten Variation werden ebenso unmißverständlich wie sprachspielerisch Übergriffe des Staates in die persönliche Sphäre des einzelnen aufgedeckt und beklagt:
Brief du
zweimillimeteröffnung
der tür zur welt du
geöffnete öffnung du
lichtschein,
durchleuchtet, du
bist angekommen
Die vierfache Apostrophe des Briefes, untermauert durch die Epipherstellung des Personalpronomens, gesteigert durch das Enjambement in der Form des contrerejet, das als sprachlich-metrische Gebärde die Atemlosigkeit der ersten sechs Zeilen evident werden läßt, die emphatische und kühne Metaphorik, die den Brief zur „zweimillimeteröffnung / der tür zur welt“ werden läßt, und der gestaute Rhythmus, der sich erst nach der das Aufatmen kennzeichnenden Leerzeile löst und den durch wiederholte Anreden unterbrochenen Satz zum Abschluß bringt, all diese poetischen und rhetorischen Determinierungen der nur sechzehn Wörter führen zu einer Qualifizierung des Briefes als Inbegriff des Dialoges und der Kommunikation. Durch die Paronomasie („lichtschein“ – „durchleuchtet“) und durch deren Sonderform, die Figura etymologica („geöffnete öffnung“), erreicht Kunze fast beiläufig und spielerisch einen konzessiven und adversativen Nebensinn, der die Emphase des Gedichts besonders plausibel erscheinen läßt. Der syntaktische Einschub zwischen der Anrede in der ersten Zeile und dem Ausruf der Schlußzeile wird zum sprachlichen Abbild der Verletzung des Briefgeheimnisses. Briefe, die ankommen, auch nachdem sie geöffnet, gelesen und registriert wurden, ermöglichen noch Kommunikation zwischen Absender und Empfänger. Die Erfahrung der Briefzensur aber wird nicht ohne Folgen für Sprache und Inhalt der Briefe bleiben, vergleichbar den Auswirkungen der Zensur auf die Literatur, die sich durch den sprichwörtlichen „längeren Arm“ der Macht zu Selbstzensur und „Sklavensprache“ zwingen läßt.
Die Post war für Reiner Kunze schon Ende der fünfziger Jahre eine Möglichkeit, im Gedicht das Klima von Angst und Verdächtigung darzustellen, ohne allerdings mit diesem ebenso originären wie brisanten Thema an die DDR-Öffentlichkeit zu gehen. Das 1959 entstandene Gedicht „Am Briefkasten“ veröffentlichte er zehn Jahre später in der Bundesrepublik:
AM BRIEFKASTEN
Die marke steht kopf
Der kopf steht kopf
Aus versehen
Aus versehen?
…
Am besten
ein neuer umschlag
Die Hypertrophie politischer Macht, die in der verkehrt aufgeklebten Briefmarke, auf der eine führende politische Persönlichkeit abgebildet ist, ein schweres politisches Fehlverhalten zu erkennen müssen glaubt, wird hier in wenigen Zeilen und mit sparsamsten sprachlichen Mitteln entlarvt.
Die Gedichte des Bandes Sensible Wege setzen sich zwar vordringlich mit der gesellschaftlichen Realität in der DDR der sechziger Jahre auseinander, sie sind aber auch unübersehbar Texte eines Schriftstellers im geteilten Deutschland. Kunzes Verhältnis zur DDR ist am Ende der sechziger Jahre dem Wolf Biermanns vergleichbar, in dessen Lied „Es senkt das deutsche Dunkel“ aus dem 1968 erschienenen Buch Mit Marx- und Engelszungen die Teilung Deutschlands zur schmerzlichen Gewißheit wird:
[…] weil ich mein Deutschland
So tief zerrissen seh
Ich lieg in der bessren Hälfte
Und habe doppelt Weh
Kunze legt in mehreren Gedichten des Bandes Sensible Wege auch ein Bekenntnis zur DDR ab, verschweigt aber nicht die andere Hälfte und qualifiziert die Bundesrepublik nicht ab. „Deutschland“ wird zum Inbegriff für das Fremde, Ausgegrenzte, Fragmentarische. In der vierten Variation über das Post-Thema wird die Aposiopese zur stummen Klage über die deutsche Teilung. Die Grenze, die Deutschland teilt(e), geht sichtbar durch das Gedicht selbst hindurch:
O aus
einem fremden land, sieh
die marken … Wie
heißt das land?
…
Deutschland, tochter
Verglichen mit dem Band Widmungen hat die politische Dimension der Gedichte Kunzes im Band Sensible Wege unverkennbar zugenommen. Auch wenn Kunze sich – wie in den Widmungen – darin vieler Möglichkeiten des metaphorischen Sprechens bedient, gewinnen Techniken der Aussparung und epigrammatischen Zuspitzung an Bedeutung. Das Nennen von Namen (Biermann, Huchel, Solschenizyn) und das Benennen von Mißständen (Postzensur, Pressezensur, Reisebeschränkungen) macht Kunzes Lyrik verbindlicher und angreifbarer. Das poetische Engagement für die Autonomie der Poesie ist fortan nicht mehr zu trennen vom Plädoyer für die Rechte und Freiheiten des einzelnen. Die künstlerische Entwicklung, die der Band Sensible Wege darstellt, wurde in der offiziellen literaturgeschichte der ehemaligen DDR erwartungsgemäß negativ beurteilt:
Seine Dichtung wurde immer mehr von einer subjektiv eingeengten Betrachtungsweise bestimmt, so daß sie trotz einzelner interessanter Momente ein verzerrtes Bild der sozialistischen Gesellschaft und ihrer komplizierten Entwicklungsprobleme entwarf. Die Kritik in den kapitalistischen Ländern wertete gerade diese Aspekte im Schaffen Reiner Kunzes besonders hoch und spielte sie gegen den realen Sozialismus in der DDR aus.
Es ist sicher zutreffend, daß der Gedichtband Sensible Wege von der Literaturkritik in der Bundesrepublik stark beachtet und positiv aufgenommen wurde. Bereits kurz nach seiner Veröffentlichung wählte ihn die Darmstädter Akademie für Sprache und Dichtung zum Buch des Monats (Mai 1969). Aber die meisten Rezensenten stellten die poetische Qualität der Gedichte heraus und verzichteten auf politisch-ideologische Denkmuster. Hans Dieter Schäfer etwa warnte in der Tageszeitung Die Welt ausdrücklich davor, Kunze als Widerstandskämpfer mißzuverstehen, und plädierte dafür, seine Lyrik nicht in Opposition zu einem bestimmten gesellschaftlichen System zu sehen, sondern ihr Engagement für die Rechte des einzelnen, die in Ost und West gleichermaßen bedroht seien, wahrzunehmen. Auch Heinz Piontek versucht, die Gedichte Kunzes gegen eine ausschließlich politische Rezeption in Schutz zu nehmen:
Kunzes Poesie ist propagandistisch nicht auszuschlachten. Sie ist kämpferisch, aber untauglich als Waffe für Ideologen. In gleichviel welcher Faust kehrt sie sich gegen den, der mit ihr zuschlagen will. Obwohl Kunze nur vor der eigenen Tür kehrt – das ehrt ihn –, zeigen seine Verse spiegelverkehrt auch Mißstände und Machenschaften auf unserer Seite.
Auf dem VI. Schriftstellerkongreß der DDR wählte der Vizepräsident des DDR-Schriftsteller Verbandes Max Walter Schulz in seinem Hauptreferat „Das Neue und das Bleibende in unserer Literatur“, das obligatorisch am 29. Mai 1969 im Neuen Deutschland veröffentlicht wurde, den Roman Nachdenken über Christa T. von Christa Wolf und den Gedichtband Sensible Wege von Reiner Kunze aus, um an ihnen Fehlentwicklungen in der DDR-Literatur aufzuzeigen und die kritisierten Autoren wieder auf die Methode des sozialistischen Realismus und auf politische Linientreue zu verpflichten. Die polemische Philippika von Schulz gegen Kunzes Gedichtband ist beachtenswert, weil gerade sie auf die feuilletonistische Rezeption in der Bundesrepublik einen politisierenden Einfluß hatte und weil sie einen Schriftsteller in den Mittelpunkt der Kritik stellte, der seit vielen Jahren in der DDR von Verlagen, Literaturkritikern und Kulturpolitikern systematisch gemieden worden war. Gegen Ende der Ära Ulbricht, auch das wird in Schulz’ Referat deutlich, und nach den Ereignissen in Prag im Sommer 1968 galt es, den Emanzipationsbestrebungen in der DDR-Literatur durch neue Drohungen und Repressionen zu begegnen. Dies bestätigt auch die Akte Deckname Lyrik, die der Staatssicherheitsdienst der DDR am 16.9.1968 über Reiner Kunze anlegen ließ und die erst mit dem Ende der DDR im November 1989 geschlossen wurde. Ähnlich wie die Mitarbeiter der Staatssicherheit verfährt Max Walter Schulz mit den Gedichten Kunzes:
Im Rowohlt Verlag Hamburg erschien im März dieses Jahres ein Lyrikband von Reiner Kunze, Sensible Wege, achtundvierzig Gedichte und ein Zyklus. Wenn man die ausgerechnet achtundvierzig Gedichte liest, erscheint einem der fatale lyrische Ort zwischen Innenweltschau und Antikommunismus in gestochener Schärfe.
Und Reiner Kunze lebt unter uns. War er nicht auch 1965 mit uns in Weimar? Erging der Ruf aus Weimar nicht auch von ihm? Aber ein Jahr später schreibt er für die Rowohlt-Schublade: „Weimar totenglöckchen / an der deutschen eiche // Du läutest / zur Fürstengruft // Du läutest / zum Ettersberg // Du / läutest // Wo aber bleiben / die vögel“. Welche Vögel, wenn man fragen darf? Möglicherweise ist der ,Kurze Lehrgang‘, der in dem Bändchen u.a. über ,Dialektik‘ veranstaltet wird, wo es heißt: „Unwissende damit ihr / unwissend bleibt // werden wir euch / schulen“, möglicherweise ist diese ,Dialektik‘ eine innerlyrische Einrichtung, dergleichen Leute mit dergleichen konkreten Fragen in Unwissenheit zu belassen.
Ersparen wir uns weitere Kostproben. Es ist alles in allem, trotz zwei Feigenblättern, der nackte, vergnatzte, bei aller Sensibilität aktionslüsterne Individualismus, der aus dieser Innenwelt herausschaut und schon mit dem Antikommunismus, mit der böswilligen Verzerrung des DDR-Bildes kollaboriert – auch wenn das Reiner Kunze, wie anzunehmen, nicht wahrhaben will.
Umfangreicher, politisch maßgeblicher und zugleich unsachlicher ist zwischen 1962 und 1977 in der DDR über den Schriftsteller Reiner Kunze nie geschrieben worden. Max Walter Schulz, seit 1964 Leiter des Literaturinstituts Johannes R. Becher in Leipzig und in den achtziger Jahren Chefredakteur von Sinn und Form, zeigt kein Interesse an einer argumentativen Auseinandersetzung mit den Gedichten Kunzes. Er will offensichtlich ein Exempel der Abschreckung statuieren, indem er die ideologische Verbindlichkeit der Kunstdoktrin des sozialistischen Realismus einklagt, Kunze durch die Verwendung pejorativer Schlagworte wie „Innenweltschau“ und „Individualismus“ als DDR-Schriftsteller diskreditiert und ihn als Kollaborateur des Antikommunismus diffamiert. Die Gründe für die polemische Schärfe bleiben dabei im wesentlichen ungenannt. Vor allem die Widmung des Gedichtbandes für das tschechische und slowakische Volk und Kunzes offene Sympathie für den Prager Frühling sowie sein Partei austritt im August dürften Schulz zu seiner Strafrede veranlaßt haben, denn an einer früheren Stelle seiner Rede behauptet er, die Solidaritätslesung vieler DDR-Schriftsteller (unter ihnen auch Kunze) am 13. Februar 1969 im Haus der Tschechoslowakischen Kultur in Ost-Berlin unterschlagend:
In einer der schwierigsten, auch international schwierigsten politischen Situationen der jüngsten Zeit, um die Tage des 21. August 1968, standen die Schriftsteller der DDR mit überwältigender Mehrheit fest an der Seite von Partei und Regierung.
Auch die Veröffentlichung des Bandes Sensible Wege in einem renommierten westdeutschen Verlag veranlaßt Schulz zu der Unterstellung, Kunze schreibe absichtlich „für die Rowohlt-Schublade“, grenze sich also bewußt aus der Literaturgesellschaft DDR aus. Dabei verschweigt Schulz, daß noch im August 1968 eine kleine Gedichtauswahl Kunzes in der von Bernd Jentzsch betreuten Reihe Poesiealbum erschienen war. Mit dem Vorwurf des „Individualismus“ versucht er, Kunze als ,bürgerlichen‘ Künstler zu brandmarken. Die Definition des Begriffs „Individualismus“ im Kulturpolitischen Wörterbuch der DDR unterstreicht die Relevanz dieses Schlagworts in der ideologischen Auseinandersetzung:
Seiner sozialen Grundlage nach ist der Individualismus ein Produkt des kapitalistischen Privateigentums an den Produktionsmitteln, seinem Klasseninhalt nach eine bürgerliche Denk- und Verhaltensweise, seiner ideologischen Funktion nach eine Rechtfertigung der Ausbeutung, des Profitstrebens und des Egoismus. Der Individualismus richtet sich insbesondere gegen den organisierten Zusammenschluß und Kampf der Werktätigen. Er ist ein charakteristischer Zug der modernen bürgerlichen Ideologie, Sozialpsychologie und der bürgerlichen Kunst.
Dem Vorwurf des „Antikommunismus“ kommt gemäß der Definition im Kulturpolitischen Wörterbuch ebenfalls eine wichtige kulturpolitische Bedeutung zu: Sein „Hauptstoß richtet sich auf die Verleumdung der Kulturpolitik der marxistisch-leninistischen Parteien und der sozialistischen Staaten mit dem Ziel, das enge Vertrauensverhältnis zwischen Partei und Künstlern zu zerstören. Die Angriffe auf das künstlerische Schaffen konzentrieren sich auf die grundlegenden Prinzipien der Parteilichkeit, Volksverbundenheit und des sozialistischen Ideengehaltes mit dem Ziel, die Kunstschaffenden vom sozialistischen Realismus abzudrängen.“
Unverkennbar ist es Kunzes Poesieverständnis, das Schulz zu stärkster ideologischer Ablehnung veranlaßt. Er attackiert Kunze als einen Repräsentanten jener dritten deutschen Literatur, „die sich weder mit dem einen noch mit dem anderen [Staat; Anmerkung des Verf.] identisch erklärt, die sich autonom erklärt, die keiner Sache dienen will als der eigenen.“ Die Zurückweisung der von Kunze und anderen „Literaten des dritten Weges“ vertretenen Autonomieästhetik ist zugleich, wie Manfred Behn mit Recht feststellt, auch eine Zurückweisung jener tschechischen Literatur der sechziger Jahre, die sich vom ästhetischen Diktat des sozialistischen Realismus emanzipiert, die einen Sozialismus mit menschlichem Antlitz unterstützt und die auch Kunzes Poesieverständnis entscheidend beeinflußt hatte.
Gegen Kunzes Verteidigung der Poesie wendet sich Schulz mit dogmatischer Schärfe: „Wir sprechen von der Größe des realen Gesellschaftswertes unserer schriftstellerischen Arbeit. Denn sozialistische Literatur mißt sich weder an sich selbst, noch verteidigt sie sich mit sich selbst.“ Mit der beabsichtigten Ausgrenzung Reiner Kunzes aus der offiziell goutierten Literatur und aus der Gesellschaft der DDR will Schulz die Autoren der Generation Volker Brauns vor diesem dritten Weg warnen und sie auf den Bitterfelder Weg zurückführen. Wegen Kunzes Außenseiterposition innerhalb dieser Generation konnte er davon ausgehen, daß es zu keinen Solidarisierungen mit Kunze kommen würde, wie sie in dieser Lyrikergruppe sonst üblich waren und für die die Verteidigung Sarah Kirschs durch Endler und Fühmann beispielhaft ist.
Vergleichsweise zurückhaltend ist die Kritik von Schulz an Christa Wolf und ihrem Roman Nachdenken über Christa T., denn er wollte nicht – wie im Fall Kunze – die Person treffen und ausgrenzen, sondern den verdächtigen „Individualismus“ eines ihrer Bücher zurückweisen:
Wir kennen Christa Wolf als eine talentierte Mitstreiterin unserer Sache. Gerade deshalb dürfen wir unsere Enttäuschung über ihr neues Buch nicht verbergen. Wie auch immer parteilich die subjektiv ehrliche Absicht des Buches auch gemeint sein mag: So wie die Geschichte nun einmal ist, ist sie angetan, unsere Lebensbewußtheit zu bezweifeln, bewältigte Vergangenheit zu erschüttern, ein gebrochenes Verhältnis zum Hier und Heute und Morgen zu erzeugen.
Insbesondere die feuilletonistische Rezeption von Christa Wolfs Roman in der Bundesrepublik ist für Schulz entscheidender Impuls, vor der Gefahr des Beifalls von der falschen Seite für eine sich zunehmend der „Innerlichkeitsproblematik“ widmenden DDR-Literatur zu warnen, und er zitiert ausdrücklich aus Marcel Reich-Ranickis Rezension in der Wochenzeitung Die Zeit folgendes, die ideologische Debatte forcierende Fazit: „Sagen wir klar: Christa T. stirbt an Leukämie, aber sie leidet an der DDR.“ Wollte Schulz mit seinen Anschuldigungen und Verdächtigungen Reiner Kunze als DDR-Schriftsteller diskreditieren, so ist er bei Christa Wolf sichtlich bemüht, seine Kritik als „prinzipiell kameradschaftlich“ erscheinen zu lassen: „Besinn dich“, appelliert er, „auf dein Herkommen, besinn dich auf unser Fortkommen, wenn du mit deiner klugen Feder der deutschen Arbeiterklasse, ihrer Partei und der Sache des Sozialismus dienen willst.“
Dadurch, daß der kaum bekannte Lyriker Reiner Kunze und die durch ihren Roman Der geteilte Himmel über die DDR-Grenzen hinaus bekannte Erzählerin Christa Wolf im Hauptreferat auf dem Schriftstellerkongreß Ende Mai 1969 öffentlich zur Rechenschaft gezogen wurden, sah sich die westdeutsche Literaturkritik, so auf Kunze aufmerksam geworden, dazu veranlaßt, den Autor gegen die Attacken von Schulz zu verteidigen. Und damit setzte in der Bundesrepublik eine Rezeption der Werke Kunzes ein, die bis zu dessen Übersiedlung in die Bundesrepublik im April 1977 stark von ideologischen Aspekten bestimmt war. Yaak Karsunke, politisch engagierter Schriftsteller in der Studentenbewegung Ende der sechziger Jahre, konzipiert seine Rezension des Gedichtbandes Sensible Wege in der linksorientierten Zeitschrift konkret als direkte Entgegnung auf die Philippika von Schulz, als Kritik an der gesellschaftlichen Entwicklung in der DDR und als Verteidigung des kritisierten Lyrikers:
Für Max Walter Schulz ist Kunzes Position „der fatale lyrische Ort zwischen Innenweltschau und Antikommunismus in gestochener Schärfe“ – de facto ist sie die Position eines Menschen, der in einem Land lebt, in dem der Sozialismus auf Leute wie Herrn Schulz gekommen ist. „Und Reiner Kunze lebt unter uns.“ Eben, Genosse Schulz. Und wenn ihr wirklich Sozialisten wäret, müßtet ihr euch auch für Reiner Kunze verantwortlich fühlen, dessen Innenwelt eine Reaktion ist auf die Außenwelt, die ihr ihm zugerichtet habt mit Anstandsregeln wie „Echte Naivität weiß, was sich gehört.“ Innerlichkeit […] ist die andre Seite der Medaille Öffentlichkeit – und wer Falschgeld unter die Leute bringt, soll nicht schreien, wenn ihm mit barer Münze heimgezahlt wird.
Vor allem der Literaturkritiker Jürgen P. Wallmann war lange Zeit tonangebend bei der feuilletonistischen Rezeption Kunzes in der Bundesrepublik. Von 1969 bis 1977 setzte sich Wallmann durch Rundfunkbeiträge, Fernsehsendungen und in zahlreichen Zeitungs- und Zeitschriftenartikeln für Reiner Kunze, mit dem er seit Ende der sechziger Jahre freundschaftlich verbunden ist, ein. Anfang der siebziger Jahre veröffentlichte er eine umfangreichere porträtierende Arbeit mit dem Titel „Der Fall Reiner Kunze“ und dem Untertitel „Ein Beispiel Literaturpolitik der DDR“, die zu einer Hauptquelle für Journalisten und Literaturkritiker in der Bundesrepublik wurde und die die westdeutsche Rezeption ebenso nachhaltig wie einseitig beeinflußte. So verdienstvoll Wallmanns Artikel über Kunze dadurch waren, daß sie dem in der DDR heftig kritisierten und isolierten Lyriker in der Bundesrepublik eine ihn schützende Öffentlichkeit verschafften, so einseitig waren sie doch in ihrer Fixierung auf den politischen beziehungsweise kulturpolitischen Fall und in ihrer biographistischen, ästhetische Qualitäten kaum erwägenden Deutung des Werkes. Dabei wurden Wallmann von Kunze immer wieder persönliche Informationen und Dokumente zur Verfügung gestellt, die einer Rezeption Vorschub leisteten, in Kunze – entgegen seinem vielfach geäußerten Selbstverständnis – mehr den Oppositionellen als den Schriftsteller zu sehen. Die Redundanz und thematische Fixierung der Kunze-Rezeption Wallmanns wird besonders augenfällig, wenn man beim Vergleich seines Artikels „Der Fall Reiner Kunze“ von 1972 mit seiner 1979 auf dem ersten Lyrikertreffen in Münster gehaltenen und 1981 veröffentlichten Rede „Sensible Wege. Ein Porträt des Schriftstellers Reiner Kunze“ feststellt, daß Wallmann stets dieselben politischen Gedichte zitiert und daraus stets dieselben (ideologischen) Folgerungen zieht, ohne Kunzes Übersiedlung in die Bundesrepublik im Frühjahr 1977 zu berücksichtigen. So führte die Verhinderung einer literaturkritischen Rezeption in der DDR einerseits und eine sich wiederholende, vornehmlich politisch interessierte Rezeption in der Bundesrepublik andererseits dazu, daß Reiner Kunze in der Bundesrepublik auf die, wie Hans-Jürgen Schmitt formuliert, „gleiche politische Fallhöhe“ gebracht wurde wie Wolf Biermann, mit dem er zwar freundschaftlich verbunden war, von dem er sich ideologisch und künstlerisch aber stark unterschied und heute noch unterscheidet.
Wolf Biermann und Reiner Kunze seit Beginn der siebziger Jahre, wie von Wallmann praktiziert, zum „Prüfstein für die Kulturpolitik in der DDR“ zu erklären, kommt einer Entscheidung für eine primär politisch motivierte Darstellung der DDR-Literatur und einer Fixierung auf den Konflikt zwischen Poeten und Politikern gleich. Einen anderen Weg der Rezeption von DDR-Literatur wählt der Literaturwissenschaftler Jürgen Scharfschwerdt, wenn er den „exemplarischen Weg Christa Wolfs“ und Volker Brauns und deren literarische Konzeption einer sozialistischen Literatur ohne ideologische Scheuklappen nachzuvollziehen sich bemüht.
Ausgangspunkt beider Autoren sei, so Scharfschwerdt, „das dialektische Grundverhältnis von Individuum und Gesellschaft“, das es einzuklagen gelte, „indem die sozialistische Gesellschaft sich dem ursprünglichen Anspruch permanent zu stellen hat, wie er in den Quellen des Marxismus vorliegt, dem entwickelten ,reichen‘ Menschen in seiner ganzen, ihm möglichen Lebensproduktivität einen gesellschaftlichen Raum der Selbstverwirklichung zu garantieren, um auf diesem Wege auch die Gesellschaft selber erst in ihr Ziel gelangen zu lassen. Diese Vorstellung aber schließt unabdingbar eine tabufreie, radikal offene Selbsterkundung und Selbstwahrnehmung des Menschen ein, zu der wiederum eine uneingeschränkte Freiheit der Selbst- und Mitbestimmung eigenen und gesellschaftlichen Lebens notwendig gehören muß.“
Heiner Feldkamp: Poesie als Dialog. Grundlinien im Werk Reiner Kunzes, S. Roderer Verlag, 1994
Unliebsame Verse
Im Vorspruch zu einer schmalen Anthologie, in der er vor dem Prager Frühling tschechische Gedichte vorstellte, sagte Reiner Kunze:
Wer die tschechische Poesie sucht, muß eine Wiese suchen. Sie ist immer eine Wiese. Sie grünt zwischen den Schornsteinen und unter dem Schmerz aller Zeiten. Sie grünt durch die Gegenwart. Sie hat es nahe zur Erde.
Kunzes Nachdichtungen erregten nicht viel Aufsehen, und als die Literatur der ČSSR in aller Munde war, waren sie so gut wie vergessen. Dabei hätten die Verse wichtige Hilfe leisten können zum Verständnis dessen, was in Prag geschah – nicht nur die Strophen, in denen Milan Kundera von den Dichtern verlangte, sie sollten bis ans Ende gehen, ans Ende der Zweifel, des Hoffens, der Leidenschaft und des Verzweifelns, weil sonst das Leben nur eine lächerlich kleine Summe abwerfe.
Reiner Kunzes Satz über die Wiese widerspricht Versen wie denen Kunderas nicht. Kunze wußte, was er sagte. Er hatte in der Tschechoslowakei gelebt, nachdem er sein Philosophie- und Journalistikstudium in Leipzig abgebrochen und einige Zeit im Schwermaschinenbau und in der Landwirtschaft gearbeitet hatte. In seinen eigenen Versen stattete er dann den Dank für die Freundschaft ab, die er in Prag gefunden hatte, zum Beispiel in seinem Gedicht „Bei E. in Vřesice“:
Er nahm uns auf die töpferscheibe
und formte krüge aus uns
Skácel fiel barock aus
wie der zwiebelturm von Sulíkov
Kundera geriet auf eigenen wunsch
dreieckig (kunststück)
Unterm sanften druck der hände wurde ich
ein krug aus Mähren
Dann füllte uns der meister
mit löwenzahnwein…
In einer Anmerkung teilte Kunze mit, daß er in diesem Gedicht von dem Töpfermeister Emil Ebr, von den tschechischen Schriftstellern Jan Skácel und Ludvík Kundera und von den Dörfern Vřesice und Sulíkov rede. Außerdem gebe es den Löwenzahnwein wirklich. Im übrigen sprechen die Verse für sich selbst: Beschrieben wird eine Laune, und diese Laune hat mit Alkohol zu tun. Zugleich aber schlugen sich sehr persönliche Sehnsüchte in den Strophen nieder: Niemand wird aus Zufall ein barocker, ein dreieckiger oder ein mährischer Krug, wenn er schon Gelegenheit hat, ein Krug zu werden. Darüber hinaus: Wer sich mit Löwenzahnwein füllen läßt, neigt zu besonderen Genüssen. Es läßt sich denken, daß dieser Wein „erdig“ schmeckt – in jenem Sinn, in dem es die tschechische Poesie nach Kunzes Zeugnis „nahe zur Erde“ hat; ohne peinlichen Mythos; aus Selbstverständlichkeit; weil Erde etwas Wirkliches ist.
Reiner Kunze hat Sinn für Wirklichkeit. Er verzichtet auf Zierat, wenn er sie beschreibt. Er sucht keinen Zauber. Er ist nicht auf irgendein soziales oder allgemein-menschliches Pathos aus. Er sagt, was er sieht, und mit viel Ehrlichkeit, mit Melancholie, aber auch mit Humor geht er „ans Ende“.
„Und es war schön finster“ ist die erste Abteilung seiner Gedichte überschrieben. Die ersten Strophen heißen „Der hochwald erzieht seine bäume“. Darin zwingt der Wald die Bäume, ihre Kronen in die Höhe zu schicken, indem er sie des Lichtes entwöhnt, und es lohnt, darüber nachzudenken, was Kunze ausspart: die Frage, wer denn wohl der Wald sei. Er muß etwas anderes sein als die Summe aller Bäume, denn sonst würden sich die Bäume in lächerlicher Torheit selbst zwingen. Da anderseits der Wald aus nichts als Bäumen besteht, geht die Zwangslage auf die Natur der Bäume zurück: Sie sind beim besten Willen nicht freizusprechen, wenn es am Ende heißt:
Er läßt die bäume größer werden
wipfel an wipfel:
Keiner sieht mehr als der andere,
dem wind sagen alle das gleiche
Holz
Das sind andere Bäume als jene, die Hölderlin als herrliches Volk von Titanen feierte, die nur sich selbst und dem Himmel gehörten, die sich frei aus kräftiger Wurzel „unter einander herauf“ drängten und den Raum „wie der Adler die Beute“ ergriffen. Im Abstand zu Hölderlins „Eichbäumen“ wird deutlich, wie hart Kunze über den Hochwald urteilt. Der Wald „erzieht“ seine Bäume, er läßt „das talent, äste zu haben nur so aus freude, verkümmern“ und beugt „der leidenschaft des durstes“ vor, indem er den Regen siebt. So zwingt der Wald die Bäume zum Konformismus, und damit, daß „alle das gleiche“ sagen, ist es noch nicht getan: Die Natur ist zum Zweck denaturiert, die Bäume sind nichts als Holz.
Doch nicht nur die Konsequenz, mit der Reiner Kunze über den Hochwald Gericht hält, auch seine ganz und gar unaufwenclige Sprache verblüfft. Da sagt einer, was ist, ohne die Stimme anzuheben, in gründlichen, nüchternen Sätzen: Kunze ist sich über „das ende der fabeln“ im klaren, weil der Bauer, über den der Hahn eine Fabel dichten will, diesen schlachtet, und er sieht „das ende der kunst“ kommen, weil die Eule dem Auerhahn verbietet, die Sonne zu besingen. Die Sonne, sagt die Eule, sei nicht wichtig, und es heißt: „Der auerhahn nahm / die sonne aus seinem gedicht // Du bist ein künstler, / sagte die sonne zum auerhahn // Und es war schön finster“ Nicht nur das Verbot, das die Eule verhängt, auch das Lob, das sie erteilt, reglementiert den Künstler und seine Kunst, und nicht nur Künstler und Kunst tragen die Folgen, sondern auch die Welt, die fortan „schön finster“ ist.
Löckte der DDR-Bürger Reiner Kunze gegen den Stachel? Die Hüter der Parteilichkeit vermuteten es und legten ihm das Handwerk. Sie wollten nicht verstehen, was er ihnen im „lied vom biermann“ sagte:
Wo wäre das bier ohne biermann?
Im faß
Helles bier dunkles bier
ausgeschenkt nach dort und hier
Ihr wolltet nicht trinken
Wer trinkt nun das bier dieses biermann?
Der Grass
Starkes bier dünnes bier
ausgeschenkt nach dort und hier
Ihr wolltet nicht trinken
Biermann sei ihrmann?
Achwas!
Mann ist mann bier ist bier
Biermann kam von dort nach hier
Ihr wolltet nicht trinken
Dieses Gedicht liefert den Schlüssel zu Kunzes politischer Haltung. Sein Plädoyer für den verfemten Kollegen ist auf Wort- und Namenswitz angelegt, aber auch diese Verse enthalten eine nüchterne Rechnung, und die Rückschlüsse auf Reiner Kunze bieten sich von selber an: So wenig wie Biermann, der Sänger, der von Westen nach Osten kam, „ihrmann“ ist und rechtens als Mann des Westens in Verruf gebracht werden darf, ist es Reiner Kunze. Auch er will dunkles und helles Bier nach „dort und hier“ ausschenken, auch er will dorthin gehören und dort gelesen werden, wo er lebt. Er will wirken, sich nützlich machen: Seine Grübeleien werben für eine bessere sozialistische Gesellschaft, und er erteilt sogar „kurze Lehrgänge“ über Dialektik, Ästhetik und Ethik. Ironisch sagte er in jeweils vier Zeilen, daß die Unwissenden geschult werden, damit sie unwissend bleiben; daß Picasso bis zur Entmachtung des Imperialismus als verbündet zu betrachten sei; daß wohl der Mensch im Mittelpunkt stehe, aber nicht der einzelne. Und weil er für eine bessere sozialistische Gesellschaft ist, rühmt er, diesmal ohne jede Ironie, die Standhaftigkeit Solschenizyns, die nicht die Standhaftigkeit des Batteriechefs oder des Siegers sei, sondern die Standhaftigkeit des Dichters, der „dennoch schreibt“. Kunze stellt sich zu Solschenizyn, und er stellt sich zu Huchel.
Auf Huchel spielt das Gedicht „Sensible Wege“ an, dem der Titel des Bandes entliehen ist: auf die Verse über den Garten des Theophrast. Kunze nennt die Erde über den Quellen „sensibel“. Er warnt davor, die Wurzeln zu roden, weil die Quellen versiegen können. Er sagt: „Wie viele bäume werden / gefällt, wie viele wurzeln / gerodet // in uns“
Versiegende Quellen, verbotene Sonnen, Bäume, die „alle das gleiche“ sagen – Kunze warnt unermüdlich davor, das Land auszudörren, den Tag zu verdunkeln und die Sprache unter Reglement zu stellen. Auch seine Gedichte sind verletzlich, auch sie zerstört, wer sie mit dem Büchsenöffner aufreißen will, um den aktuellen Inhalt zu finden. Auch ohne dies aber sind sie deutlich genug. Mißverstehen kann sie nur, wer sie mißverstehen will. In der DDR will man Reiner Kunze falsch verstehen.
Jost Nolte, aus Jost Nolte: Grenzgänge. Berichte über Literatur, Europaverlag, 1972
Reiner Kunze: Sensible Wege
Reiner Kunze lebt in Greiz. Greiz ist mehr als eine kleine deutsche Stadt: von hier kommen Gedichte und Briefe mit sorgfältig gewählten Marken; sie ersetzen Gespräche und den Hunger nach Welt. Hier ist ein abgeschnittener Ort; und es gibt eine Grenze, die läuft seit diesem Gedichtband mitten durch Greiz. Greiz – Fluchtpunkt der Isolierung, gibt Legenden her vom poetischen Bewußtsein eines isolierten Lebens, das alle vertritt, die es nicht aussprechen können oder nicht aussprechen wollen. Man wußte wenig davon. Man konnte sich bisher auch kaum vorstellen, daß sich Verlassenheit in stiller Weise in Welt verwandeln kann, Einsamkeit in Weltoffenheit und das Schweigen durch die List der Metapher in Kommunikation. Reiner Kunze trägt uns neue Erfahrungen ein, weil er unsere eignen über den Zustand mangelnder Information in genaue Bilder bringt – und er trägt zugleich diese Erfahrungen in die Welt hinaus, so werden vielleicht von jetzt an mehr Menschen im Bild sein – und Bilder sind die besten Mittel gegen Angst. Man kommt auf den seltsamen Gedanken, daß Lyrik Information ersetzen kann. Wer diese Gedichte liest, ist nicht mehr allein. Wenn es monologische Lyrik gibt, dann ist diese dialogisch, ja brüderlich.
Wer gehört dazu? Der mit gleichen Erfahrungen; die andern sind weitgehend ausgeschlossen. Für jene anderer Erfahrungen öffnen sich die Erkenntnisse dieser Lyrik nur auf großen Umwegen und intuitiv, denn diese Gedichte sind nicht einfache Gedichte, weil es nicht einfach Gedichte sind. Sie sind mehr. Sie sind der Atem eines Mannes, der mit uns die gleiche Luft atmet.
Den rahmen säubern
von der möglichkeit des gitters…
Atmen
den frieden der fenster die
nachts nicht verschweigen müssen
ihr licht.
In Bildern atmen zu müssen, in Symbolen zu handeln – es gibt vielleicht Situationen, wo dieser Zwang zur Poesie wird. Die alltäglichsten Dinge erhalten für jemanden, der nur wenig zu sehen bekommt, der fast unbeweglich vor den Dingen sitzen muß, Bedeutung. Engbegrenztes fördert das Gefühl, die Aufmerksamkeit, Brief, Antenne, Zeitung – alles beginnt zu sprechen über die Lage des R. K. in Greiz, doch nicht in raunender, tiefsinniger Weise, sondern gegenständlich:
Am schloßturm
fahnen, ausgehängt nach
ost und west, zwei
taube ohren …
Von der Kunst andeutend die Wahrheit zu sagen? Wer wird sie deuten? Wer hat den Schlüssel? Vielleicht jeder, der vom halben Mund Schweigen etwas weiß. Hier ist das Ende der Parabeln, der Metaphern noch nicht gekommen. Und das Ende der Fabeln? Der Hahn dichtete eine Fabel, doch „hört der fuchs die fabel / wird er ihn holen“. Welche Umwege mußte Kunze gehn bis zur Möglichkeit seiner Fabeln, seiner notwendigen Fabeln, seiner lebensnotwendigen Fabeln?
Dieter Schlesak, Neue Literatur, Heft 7, Juli 1969
Innerlichkeit und Öffentlichkeit
Über Reiner Kunzes Sensible Wege sprach Max Walter Schulz im Hauptreferat auf dem VI. Deutschen Schriftstellerkongreß der DDR folgendes Urteil:
Es ist alles in allem, trotz zwei Feigenblättern, der nackte, vergnatzte, bei aller Sensibilität aktionslüsterne Individualismus, der aus dieser Innenwelt herausschaut und schon mit dem Antikommunismus, mit der böswilligen Verzerrung des DDR-Bildes kollaboriert – auch wenn das Reiner Kunze, wie anzunehmen, nicht wahrhaben will. Innerlichkeit im sozialistischen Menschenbild ist ein Wesensteil des ganzen Menschen, Innerlichkeit befindet sich mit dem ,äußeren‘ Wesen, dem Denken, Fühlen und Handeln, das sich unter den Augen der Öffentlichkeit, der Gesellschaft vollzieht, im ständigen Stoffwechsel.
Da das ND, dem das Zitat entnommen ist, diesen Absatz mit „Unterscheidung echter und falscher Innerlichkeit“ überschreibt“ scheint Kunzes Lyrik also stoffwechselkrank zu sein.
Wenn man nun nicht, wie DDR-Bürger, bloß auf Herrn Schulz angewiesen ist, sondern Kunzes Buch lesen kann, kommt einem eher der Verdacht, daß den Bürokraten, die ihre Bürokratie mit Kommunismus verwechseln, im Gegenteil der „Stoffwechsel“ auf den „Sensiblen Wegen“ zu deutlich, zu offensichtlich vonstatten geht. Das erstaunliche und neue an diesen Gedichten ist nämlich, wie sich ein Autor aus alten poetologischen Vorstellungen langsam zu einem zeitgenössischen, d.h. politischen Lyriker vorarbeitet.
Frühere Arbeiten von Kunze waren mir zu angestrengt kunstvoll, zu hochstilisiert metaforisch (so etwa das Ende eines Asthma-Anfalles in „asthma bronchiale“: „Bis die bittere hostie zergeht und ins blut tritt die stille der kirchen / frühmorgens“), auch der neue Band enthält noch Proben dieser Kunstlyrik, aber der vorherrschende Ton ist anders. Kunze weicht den Deformationen seiner Umwelt jetzt nicht mehr in Metafern aus – sondern er reflektiert sie, beschreibt sie, beschreibt seine Reaktionen auf sie.
Auf diese Weise verlaufen die „Sensiblen Wege“ nun freilich abseits jener „Hauptstraße der neuen deutschen Literatur, die von Goethe und Hölderlin zu Becher und durch ihn weiterführt“ (Walter Ulbricht an der Bahre Johannes R. Bechers). Den sozialistisch-realistischen Mainstreet-Babbitts sind schönfärberische Klassiker und affirmative Arien natürlich angenehmer als etwa die im Frühjahr 1968 geschriebene „Rückkehr aus Prag“:
Eine lehre liegt mir auf der zunge, doch
zwischen den zähnen sucht der zoll
Oder die präzise Beschreibung ihrer inhumanen „Ethik“:
Im mittelpunkt steht
der mensch
Nicht
der einzelne
Für Max Walter Schulz ist Kunzes Position „der fatale lyrische Ort zwischen Innenweltschau und Antikommunismus in gestochener Schärfe“ – de facto ist sie die Position eines Menschen, der in einem Land lebt, in dem der Sozialismus auf Leute wie Herrn Schulz gekommen ist. „Und Reiner Kunze lebt unter uns.“ Eben, Genosse Schulz. Und wenn ihr wirklich Sozialisten wäret, müßtet ihr euch auch für Reiner Kunze verantwortlich fühlen, dessen Innenwelt eine Reaktion ist auf die Außenwelt, die ihr ihm zugerichtet habt mit Anstandsregeln wie: „Echte Naivität weiß, was sich gehört.“ (M. W. Schulz auf dem Schriftstellerkongreß.)
Innerlichkeit, um mal den Stoff zu wechseln, ist die andre Seite der Medaille Öffentlichkeit – und wer Falschgeld unter die Leute bringt, soll nicht schreien, wenn ihm mit barer Münze heimgezahlt wird. In seiner Erklärung an das ZK der SED deklamierte der Schriftstellerkongreß: „Unsere sozialistische Gesellschaft hat der Literatur einen zuvor nicht gekannten Einfluß auf das Leben des Volkes ermöglicht.“ Will sagen: die Parteibürokraten haben sich einen zuvor kaum gekannten Einfluß auf die Literatur verschafft. Und dann schreibt ein Mann wie Kunze „Von der Notwendigkeit der Zensur“:
Retuschierbar ist
alles
Nur
das negativ nicht
in uns
Das kränkt die Zensur natürlich. Also rächt sie sich. Kunzes Manuskript lag DDR-Verlagen vor, wurde abgelehnt. Dann genehmigten die zuständigen DDR-Behörden die Publikation bei Rowohlt. (Und wenn mit dieser Publikation tatsächlich mit dem Antikommunismus kollaboriert würde, dann gehörte doch wohl das DDR-Büro für Urheberrechte auf die Anklagebank?) Dann verabredet der Verlag Volk und Welt mit Kunze und Stephan Hermlin, daß beide einen Band des ungarischen Lyrikers Gyula Illyés übertragen sollen. Dann erscheinen die Sensiblen Wege bei Rowohlt. Dann entzieht man Kunze den Übersetzungsauftrag – natürlich nicht öffentlich, sondern mit falscher Innerlichkeit, der Betroffene erfährt’s hintenrum. Und dann ist endlich unser aller Axel am Zuge, und in der Welt steht: „Schreibverbot für Reiner Kunze“ – was eine glatte Lüge ist. Denn schreiben darf er – er bekommt bloß keine Aufträge. Wie man sieht, geht es in der DDR ebenso freiheitlich-demokratisch zu wie bei uns. Daß Leute, die sich so repressiv-kapitalistischer Methoden bedienen, jetzt den Vorwurf des Antikommunismus erheben, ist grotesk. Die Sensiblen Wege führen nicht in Richtung Bundesrepublik, das „Düsseldorfer Impromptu“ endet mit den Zeilen:
Der mensch
ist dem menschen
ein ellenbogen
Und als die Tochter des Lyrikers aus einer bundesdeutschen Wohlfahrtsmarke mit dem Wolf und den sieben Geißlein den Schluß zieht, der Brief sei von den sieben Geißlein, weil der Wolf doch tot ist, heißt es:
Im märchen, tochter, nur
im märchen
Aber der Band ist gewidmet „dem tschechischen volk, dem slowakischen volk“, und auf der „anschlagtafel / Prag Frühjahr 1968“ steht:
Ihr recht
plakatieren die farben: zu wissen
woher und nicht
wohin
Und das bedeutet – Klaus Rainer Röhl möge mir verzeihen – nicht Rückkehr zum Kapitalismus, der ja auch nur ein bereits gewußtes Woher ist – das sucht nach einem sensiblen Weg in einen Sozialismus, in dem Innerlichkeit und Öffentlichkeit solidarisch sein könnten, anstatt Stoffe wie Schüsse zu wechseln.
Yaak Karsunke, Konkret, Heft 14, 30.6.1969
Aktionslüsterner Individualismus
(…) Der sozialistische Schriftsteller hat absolut keinen Grund, sich in die Scham oder Faszination über den Kulturverfall und über den fortschreitenden Schwund humaner Lebenswerte in der hochkapitalistischen Gesellschaft zu teilen. Wir haben absolut keinen Grund, uns nachträglich noch zu Teilhabern des Entfremdungsmonopols für einstige Progressivität zu machen. In dieser Sache hat sich das Bürgertum mit dem Kapitalismus verstrickt, nicht mit uns. Wenn wir in dieser Sache Entfremdung aus irgendwelchen über den Klassen stehenden nationalen oder weltliterarischen Sentimentalitäten mithielten, würden wir auch das Leichenbegängnis eines humanen deutschen Nationalbewußtseins, eines humanen deutschen Vaterlandsgedankens aufs allerschönste mitfeiern. Es gibt nun einmal heute in Deutschland zwei deutsche Staaten, die sich antagonistisch gegenüberstehen. Unser sozialistischer Staat ist es nicht, der den anderen mit Gewaltmitteln okkupieren möchte. Die Identifikation der heute in Deutschland lebenden Schriftsteller mit dem einen oder dem anderen Staat, der sozialistischen Gesellschaftlichkeit oder der kapitalistischen Ungesellschaftlichkeit, erzeugt mithin auch zwei deutsche Literaturen. Eine dritte deutsche Literatur, die sich weder mit dem einen noch mit dem anderen identisch erklärt, die sich autonom erklärt, die keiner Sache dienen will als der eigenen, die ihre Gesellschaftlichkeit in einem nur in einigen Köpfen vorhandenen intellektualistischen Pseudo-Internationalismus sucht, ist nach aller geschichtlichen Erfahrung von vornherein zur gesellschaftlichen Wirkungslosigkeit verurteilt. Sie kann Mode machen, das kann sie. Sie kann wie die Eule der Minerva in der Dämmerung auffliegen und die Klassenlage besichtigen, das kann sie auch. Aber – um im Hegelschen Bild zu bleiben – es ist Dämmerung und Eulenaugen, die Augen des objektiven Geistes erkennen in der objektiven Realität nur das, was sie in ihr zu erkennen belieben. Der bürgerliche deutsche Schriftsteller, der seiner Gesellschaft noch den dunklen Spiegel alter bürgerlich-humanistischer und demokratischer Ideale vorhält, steht unserer sozialistischen deutschen Literatur immer noch weit näher als die Literaten des dritten Weges. Diese entfernen sich mit zunehmendem Wirklichkeitsverlust aus dem Sichtbereich humanistischer Literatur. Ihr sogenannter dritter Weg entpuppt sich mehr und mehr als eine dienstwillige literarische Haltung zwischen „Innenwelt“ und Antikommunismus.
Im Rowohlt Verlag Hamburg erschien im März dieses Jahres ein Lyrikband von Reiner Kunze, Sensible Wege, achtundvierzig Gedichte und ein Zyklus. Wenn man die ausgerechnet achtundvierzig Gedichte liest, erscheint einem der fatale lyrische Ort zwischen Innenweltschau und Antikommunismus in gestochener Schärfe.
Und Reiner Kunze lebt unter uns. War er nicht auch 1965 mit uns in Weimar? Erging der Ruf aus Weimar nicht auch von ihm?
Aber ein Jahr später schreibt er für die Rowohlt-Schublade:
Weimar totenglöckchen
an der deutschen eiche
Du läutest
zur Fürstengruft
Du läutest
zum Ettersberg
Du
läutest
wo aber bleiben
die vögel
Welche Vögel, wenn man da fragen darf?
Möglicherweise ist der „Kurze Lehrgang“, der in dem Bändchen u.a. über „Dialektik“ veranstaltet wird, wo es heißt:
Unwissende damit ihr
unwissend bleibt
werden wir euch
schulen
Möglicherweise ist diese „Dialektik“ eine innerlyrische Einrichtung, dergleichen Leute mit dergleichen konkreten Fragen in Unwissenheit zu belassen.
Ersparen wir uns weitere Kostproben. Es ist alles in allem, trotz zwei Feigenblätttern, der nackte, vergnatzte, bei aller Sensibilität aktionslüsterne Individualismus, der aus dieser Innenwelt herausschaut und schon mit dem Antikommunismus, mit der böswilligen Verzerrung des DDR-Bildes kollaboriert – auch wenn das Reiner Kunze, wie anzunehnnen, nicht wahrhaben will…
Max Walter Schulz, Das Neue und das Bleibende in unserer Literatur. In: VI. Deutscher Schriftstellerkongreß vom 28. bis 30. Mai 1969 in Berlin. Protokoll, Berlin/DDR 1969
Ein DDR-Autor muß schweigen
Der 1933 in Oelsnitz geborene Reiner Kunze ist, obwohl noch verhältnismäßig unbekannt, doch längst kein erzgebirgischer Lokalfall mehr. Spätestens nach seinen Übersetzungen aus dem Tschechischen, für die er 1968 einen Preis des Tschechoslowakischen Schriftstellerverbandes erhielt, gewann er internationale Anerkennung in Kreisen literarischer Kenner. Auch für seine eigenen Arbeiten bedeutete die Freundschaft mit Autoren aus Böhmen, Mähren und der Slowakei sehr viel. Ohne sie hätte er womöglich keinen Weg aus seinen schweren politischen und persönlichen Krisen gefunden, schien der Sohn eines Bergarbeiters doch in den fünfziger Jahren alle Voraussetzungen dafür mitzubringen, ein Lieblingskind des Regimes zu werden. In jenen Tagen schrieb er Kinderlieder auf tapfere Soldaten, die das Glück der Republik erkämpfen, und versuchte, den Ärger mit manchen Funktionären optimistisch zuzudecken: Die Nachtigall jubelt, auch wenn die Uhus den Gesang mißbilligen. Seit Kunze sich den kollektiven Ansprüchen jeder Art verweigert, versagt er sich auch laute Jubeltöne. Je persönlicher und bitterer er formulierte, desto schwerer wurde es für ihn, in der DDR Publikationsmöglichkeiten zu finden.
Allmählich schien man bereit zu werden, auf den törichten Boykott zu verzichten: 1968 brachte der Aufbau-Verlag in dem Taschenbuch Saison für Lyrik acht Gedichte von Kunze, und die Reihe Poesiealbum widmete ihm ein Heftchen. Seit der im März 1969 erschienene Band Sensible Wege des Rowohlt–Verlags vorliegt, kann der westdeutsche Leser ermessen, wieviel von Kunzes Lyrik der Zensur zum Opfer fiel. Der Band, gewidmet dem tschechischen und dem slowakischen Volk, enthält u.a. Gedichte für Biermann, Huchel und Solschenizyn.
Die DDR-Kulturfunktionäre wollen den Band nun offenbar zum Anlaß nehmen, Kunze wie diese poetischen Weggefährten zu behandeln. Aus dem Verlagshaus Volk und Welt – Kultur und Fortschritt verlautet, daß man sich dort mit dem Band beschäftigt habe und nunmehr den Autor nicht mehr für würdig halte, an Übersetzungen mitzuarbeiten. Der Verlag hat daher den Auftrag, Gedichte des ungarischen Lyrikers Gyula Illyés zu übertragen, zurückgezogen.
Treten Sie ein, legen Sie Ihre
traurigkeit ab, hier
dürfen Sie schweigen
heißt ein Dreizeiler von Kunze.
Die Funktionäre scheinen ihn jetzt zynisch festlegen zu wollen: in der DDR soll und muß er schweigen.
Manfred Jäger, Deutsche Allgemeines Sonntagsblatt, 11.5.1969
„Treten Sie ein, hier dürfen Sie schweigen“
In einem neuen Gedicht des heute 36jährigen, in Greiz (Thüringen) lebenden Reiner Kunze – es trägt den Titel „Fahrschüler für Lastkraftwagen“ – heißt es ironisch-doppeldeutig:
… Der doch der
sich nicht findet in simplem viervierteltakt kann
unter die räder geraten
mit seinen gedanken
Ein requiem üb ich für sie und
werde gelobt für
richtiges einordnen
Viele DDR-Autoren haben begriffen, daß es auf richtiges Einordnen ankommt, wenn sie nicht unter die Räder der Kulturpolitik geraten wollen. Sie haben resigniert oder sich angepaßt; es sei nur an die jüngsten Bücher von Fritz RudoIf Fries, RoIf Schneider oder Erwin Strittmatter erinnert.
Die wenigen, die sich nicht einordnen lassen wollen, die sich weigern, Literatur bloß als Nachschrift von Vorschriften zu verstehen, werden mundtot gemacht: etwa Peter Huchel, von dem seit Jahren kein neues Gedicht mehr in der DDR gedruckt werden konnte, der vereinsamt und verbittert in Potsdam lebt und dem die Behörden, obwohl Huchel jetzt im „Rentenalter“ ist, jede Besuchsreise in den Westen verwehren.
Im Augenblick ist man nun dabei, Reiner Kunze zur „Unperson“ zu machen. Seit Kunze im Frühjahr 1969 im Westen bei Rowohlt seinen Gedichtband Sensible Wege veröffentlichte, hat sich der Druck auf diesen Dichter verstärkt, der, vereinfachend gesagt, mit seiner Lyrik für einen Sozialismus mit menschlichem Gesicht plädiert. Im Frühjahr 1968 war Kunze für seine hervorragenden Übertragungen aus dem Tschechischen mit dem Preis des Schriftstellerverbandes der ČSSR ausgezeichnet worden; Mitte August 1968 hatte Kunze, der mit einer tschechischen Ärztin verheiratet ist, in der Reihe Poesiealbum des Ostberliner Verlages Neues Leben ein Bändchen publiziert, in dem folgendes Kurzgedicht enthalten ist, das sich auf einen Besuch in der Tschechoslowakei bezieht; es heißt „einladung zu einer tasse jasmintee“:
Treten Sie ein, legen Sie Ihre
traurigkeit ab, hier
dürfen Sie schweigen
Wenige Tage nach dem Erscheinen dieses Bändchens wurde die ČSSR von den Truppen des Warschauer Paktes besetzt. Seitdem muß Kunze schweigen. Seit 1968 kann dieser Lyriker, der aus Protest gegen die Okkupation der Tschechoslowakei aus der SED austrat, in der DDR kein Buch mehr veröffentlichen.
Auf dem VI. Deutschen Schriftstellerkongreß im Mai 1969 in Ostberlin wurde Kunze im Hauptreferat von Max Walter Schulz wegen seines Buches Sensible Wege aufs schärfste angegriffen: „Es ist“, so sagte Schulz über Kunzes individualistische Lyrik, „der nackte, vergnatzte Individualismus, der aus dieser Innenwelt herausschaut und schon mit dem Antikommunismus, mit der böswilligen Verzerrung des DDR-Bildes kollaboriert.“
Damit war das Signal zum Angriff gegen Kunze gegeben. Nicht nur die Publikation eigener Werke wurde Kunze fortan unmöglich gemacht, selbst die Veröffentlichung seiner Lyrik-Übersetzungen wird verhindert. Der Name Kunze wird jetzt aus Nachschlagewerken und Literaturkalendern ausgemerzt, es soll diesen Dichter nicht mehr geben, soll ihn nie gegeben haben.
Augenblicklich bereitet der Aufbau-Verlag eine zweibändige repräsentative Anthologie deutscher Lyrik vor, die als Lyrik-Standardwerk der DDR konzipiert und auch für den Literaturunterricht an den Schulen gedacht ist. Und in dieser Anthologie wird Reiner Kunze, der ganz ohne Zweifel zu den stärksten Lyrikbegabungen gehört, mit keinem einzigen Gedicht vertreten sein.
Das ist kein Zufall: DDR-Verlage haben Anweisung, keine Texte von Kunze mehr zu drucken, auch nicht solche, die in früheren Jahren bereits in der DDR publiziert worden waren. Diese Anweisung geht auf das sogenannte „Aktiv Lyrik“ des DDR-Schriftstellerverbandes zurück, vor das Kunze schon mehrfach zitiert wurde, um sich für seine Gedichte zu verantworten. Vorsitzender dieses Lyrikaktivs ist übrigens der ehemalige U-Boot-Offizier und heutige Funktionär der Nationaldemokratischen Partei der DDR (NDPD) Günther Deicke, Lektor im Verlag der Nation und selbst ein unbedeutender epigonaler Verseschmied.
Freilich gelingt es den Kulturfunktionären nicht, mit ihren Maßnahmen – die allerdings Kunzes wirtschaftliche Existenzgrundlage zu vernichten drohen – den Namen dieses Dichters vollständig aus dem Bewußtsein der Leser zu tilgen –, im Gegenteil: je mehr offiziell die öde Polit-Poesie propagiert wird, desto stärker wenden sich die Leser jenen Autore zu, die sich ihr kritisches Gewissen nicht durch allerlei Privilegien haben abkaufen lassen. So zirkulieren, wie von den Liedern Wolf Biermanns, in der DDR ungezählte maschinenschriftliche und handschriftliche Kopien von Kunzes nur im Westen erschienenen Gedichtband Sensible Wege, in dem es heißt:
Greiz grüne
zuflucht ich
hoffe
Ausgesperrt aus büchern
ausgesperrt aus zeitungen
ausgesperrt aus sälen…
Noch aber ist auch die über diesen Dichter verhängte Quarantäne nicht total wirksam. So konnte Kunze im April und Mai dieses Jahres in der Kunsthochschule auf Burg Giebigstein und in der Universität Halle vor Studenten lesen. Diese Veranstaltungen, bei denen Kunze neben Gedichten auch Prosa aus seinem im September bei S. Fischer erscheinenden Band Der Löwe Leopold las, waren überfüllt und oft von spontanem Zwischenbeifall der Hörer unterbrochen.
Die Publikumsreaktionen bei diesen Lesungen, zu denen die Gäste teilweise von weither angereist waren, beweisen recht deutlich, welch ein Widerspruch besteht zwischen dem, was in der DDR offiziell als Literatur gefordert und gefördert wird, und dem, was die Leser wirklich betrifft. Jedenfalls ist der Schluß erlaubt, daß weit eher die Gedichte Reiner Kunzes als die Poeme der staatlich protegierten Autoren das Bewußtsein zumindest der Intellektuellen in der DDR repräsentieren.
Einer dieser offiziellen DDR-Lyriker ist Helmut Preißler, den das Neue Deutschland beim Erscheinen seines Bandes Sommertexte (Verlag Neues Leben, 1968) als einen „produktiven Lyriker unserer Republik“ rühmte. Preißler, Vorstandsmitglied im Schriftstellerverband und Redakteur für Lyrik bei der Zeitschrift Neue Deutsche Literatur, erfreut sich des Wohlwollens der Kulturbürokraten und ist bestrebt, sich dieses Wohlwollen auch zu erhalten. So veröffentlichte er jüngst in der Reihe Poesiealbum unter dem Titel Wer – wenn nicht wir! ein ganzes, 64 Seiten umfassendes Heft ausschließlich mit Gedichten auf Lenin, termingerecht zur Jubelfeier von Lenins 100. Geburtstag. Und dieses Bändchen ist soeben mit dem Literaturpreis der DDR-Gewerkschaft, des FDGB, ausgezeichnet worden.
In diesen Gedichten benutzt Preißler Worte Lenins, die als Motti den einzelnen Texten vorangestellt sind, dazu, die derzeitige Politik der DDR zu verteidigen und nachträglich und noch einmal die Intervention in der ČSSR vom August 1968 zu rechtfertigen. Da wird gepoltert gegen den „Revisionismus in Reinkultur“, da wird polemisiert gegen Schriftsteller von der Art Reiner Kunzes, wobei Preißler auch vor nachweisbar falschen Anschuldigungen nicht zurückscheut:
Ob in Seelennöten
sie sich zu den Feinden schleichen
oder ob sie, uns zu töten,
ihnen Munition zureichen…
Und da wird dann auch offen und brutal gedroht – und bei Drohungen soll es nicht bleiben:
Solange in der Welt noch Schreihälse schrein
nach Konterrevolution,
wird dir, stimmst du hier in den Chor mit ein,
die Staatsmacht nicht nur drohn.
Helmut Preißler schreckt nicht davor zurück, nackte Gewalt gegen Andersdenkende zu empfehlen, und seine literarisch völlig belanglosen Holperverse erinnern peinlich an jenes rüde Schlägerlied, das ein Chor der Nationalen Volksarmee kurz nach dem 21. August 1968 im Deutschlandsender zum besten gab und in dem es heißt:
Der Klassenfeind, der wurde frech:
In Prag wollt’ er kassieren,
doch das war Spekulantenpech,
weil wir die Waffen führen.
Weil unsre Köpfe klüger sind,
ziehn wir ihm einen drüber.
Da weht ganz schnell ein frischer Wind
von Ost nach West hinüber.
Helmut Preißler – und sein Name steht hier nur als Beispiel für die Tendenzen der offiziell erwünschten DDR-Literatur – macht sich ganz offen zum Anwalt der Inhumanität. Zwar schreibt er: „Wer ungern menschlich ist, ist auch nicht gut.“ Aber: „Nur darf man Menschlichkeit nicht übertreiben.“ Eben dies jedoch ist die Geisteshaltung, gegen die Reiner Kunze sich zur Wehr setzt. Seine Hörer und Leser verstehen die bittere Ironie, mit der er seinen lyrischen „Kurzen Lehrgang“ über Dialektik, Ästhetik und Ethik beschließt:
Im mittelpunkt steht
der mensch
Nicht
der einzelne
Peter von Borcke, Die Welt, 3.7.1970
Des Regenbogens angeklagt
– Bemerkungen zur Lyrik Reiner Kunzes. –
Die Poesie Reiner Kunzes, in der DDR nur auszugsweise bekannt gemacht (ausser frühen Etüdenbänden erschien erstmals 1968, und zwar in der Poesiealbum-Reihe beim Verlag Neues Leben, eine kleine Selektion der gültigen Texte), hat auch in Westdeutschland eine eher zögernde Rezeption erfahren. Obwohl der Hohwacht-Verlag in Bad Godesberg bereits 1963 mit der Sammlung widmungen einen Band originärer Qualität vorstellte, zeigten sich die Kritiker und Manager unserer literarischen Szene wenig geneigt, in Kunze einen wichtigen Repräsentanten deutscher Nachkriegsdichtung zu erblicken. So verzichtete beispielsweise Peter Hamm darauf, Kunze in seine Anthologie aussichten aufzunehmen oder ihn auch nur im Nachwort in den Kontext der Namen Huchel, Maurer, Hermlin, Reinig, Bobrowski, Fühmann und Kunert zu stellen.
Kunzes Werk ist differenziert, sein Sprachstil ist von kreativer Metaphorik. Deshalb passen seine Gedichte weder in das ausschliesslich von einer politischen Ratio geprägte kulturelle Milieu seines Landes, noch in das intellektualistische Ambiente der Bundesrepublik, in dem man sich bekanntlich einen Ruf als Lyriker dann am leichtesten erwirbt, wenn man einem modisch-verspielten Anarchismus (Engagement genannt) huldigt oder aber wenn man – gleichermassen frustriert von der kommerzialisierten Gesellschaft und dem gegen das lyrische Ich gerichteten Terror der Neo-Positivisten – auf jede sinnfällige Verlautbarung verzichtet und verbalen Infantilismus (Dada, Pop) oder sterile Sprachpermutation betreibt.
Reiner Kunze hat sich die im Osten wie im Westen schwer zu erringende und noch schwerer zu bewahrende Freiheit genommen, die Poesie gerade dadurch gesellschaftlich relevant zu machen, dass er in ihr den desorientierten und verplanten Einzelnen einen Platz schafft, ein Reservat bewahrt:
ANTWORT
Mein vater, sagt ihr,
mein vater im schacht
habe risse im rücken,
narben,
grindige spuren niedergegangenen gesteins,
ich aber, ich
sänge die liebe.
Ich sage:
eben, deshalb.
Bereits in diesem frühen Gedicht setzt sich Kunze, der 1933 im Erzgebirge geborene Bergarbeitersohn, gegen das Reglement der Kulturfunktionäre zur Wehr, die Dichtung in kapitalistischen Ländern stets nur als klassenkämpferische Agitation, in der sozialistischen Welt aber als produktionsstimulierende Propaganda verstanden wissen wollen. Kunze, dessen Auffassung vom Humanismus nicht ausschliesslich ökonomisch-politisch geartet ist, tritt für das Individuum und seine privaten Verwirklichungsmöglichkeiten ein. Er räumt: (nicht etwa, weil er die Vernunft verwirft, sondern gerade wegen seiner vernunftsmässigen Beurteilung der menschlichen Situation) dem Irrationalen und Emotionalen ein notwendiges Mass von Bedeutung ein:
Die liebe
ist eine wilde rose in uns,
unerforschbar vom verstand
und ihm nicht untertan…
Diese Haltung kam einige Jahre später noch deutlicher zum Ausdruck. Zunächst aber hatte Kunze seine Assistentenstelle an der Universität Leipzig aufzugeben. Er musste eine schwere Krankheit durchstehen. Und er war gezwungen, als Hilfsschlosser zu arbeiten. Dann, 1961 und 1962, als Kunze sich zur Heilung in der Tschechoslowakei aufhielt und als er dort eine tschechoslowakische Staatsbürgerin heiratete („An der Thaya, sagst du, überkomme dich / undefinierbare Sehnsucht // Gehn wir in den fluss / die Sehnsucht definieren“), reflektierte er auf sein bisheriges Leben. Er legte, sich an Deutschland erinnernd, den Finger auf eine persönliche Wunde:
immer die tür, die zuschlägt vor der bitte,
…
die tür ist nicht von augen zugeschlagen worden,
eine hand war’s eine
schmale…
Und dieser – noch mit Sentimentalität vorgetragenen persönlichen Reminiszenz gesellte sich eine zweite, eine öffentliche hinzu:
Seht ihr’s nicht? Eine rose!
Wir aber sind nicht für rosen.
Wir sind für die ordnung.
Wer für die rose ist,
ist gegen die ordnung.
Ist nicht jedes blatt der rose anders? Seht nur!
Und wie viele sie hat!
Sie ist das chaos.
Er will das chaos.
Oder, in einem einzigen sprachlichen Blitz zusammengefasst:
Ich bin des regenbogens angeklagt…
Kunze, während seines Aufenthalts in der Tschechoslowakei, regenerierte auch poetisch. Seine Lyrik, die ihre ungewöhnlichen Einsichten und Impulse bisher noch in einer relativ deskriptiven und neuromantisch getönten Sprache zum Ausdruck gebracht hatte, entdeckte nun die Möglichkeiten eines metaphorischen Gestaltens, bei dem die Bilder den Empfindungen nicht länger als Dekorationen aufgelegt wurden, sondern bei dem die Metaphern als materielle Auskristallisierungen gleichzeitig mit den Emotionsanlässen hervortraten:
NACH EINEM REGEN IN MELNIK
(für Elisabeth)
Bei Melnik lädt die Moldau
ihr stück himmel in die Elbe ab,
die es in schnellem bogen auffängt
(hin und wieder nur bricht eine, ecke blau
am weinberg aus,
der die splitter den weinstöcken gibt).
Die Elbe, erdbraun von den bergen kommend
klärt sich in der scherbe himmel,
die in ihr versinkt!
Dann sind die flüsse einen augenblick lang
nichts als strömende wasser
und tragen das blau,
wie es sich auf ihrer tiefe spiegelt
und ihr spiegel es fasst
Du weisst nun, was ich denke,
während wir roten Ludmila trinken
Ein solches Gedicht führt durch seine blosse Existenz alle Thesen ad absurdum, die vorzuschreiben versuchen, wie ein lyrischer Text heute sein und was er zum Gegenstand haben soll.
Bei Melnik lädt die Moldau
ihr stück himmel in die Elbe ab…
Die Natur, die man als literarisches Sujet bei uns in Westdeutschland seit geraumer Zeit zu tabuieren versucht (um nämlich eine seelische Projektion und somit eine unkontrollierte Ich-Manifestation zu verhindern): die Natur ist für die besten Lyriker Ostdeutschlands – für Huchel, Bobrowski und Kunze – zu einem Ort der Selbstbewahrung, der Emigration geworden. Nur während bei Huchel die bukolische Zone in der persönlichen Vergangenheit, in der märkisch-agraischen Kindheit liegt und während sie bei Bobrowski in der archaisch aufgemachten Historie eines zeitdunklen Sarmatien bestand, ist das Arkadien Kunzes ein Gefilde, das sich in einer konkreten Gegenwart lokalisieren lässt.
Kunze, indem er sich neben der Sphäre des Geschichtlichen die Dimension des existentiell erlebten reinen Seins erschliesst, kann eine Poesie schaffen, in der subjektive Ereignisse und private Gefühle zu etwas Exemplarischem, Archetypischem werden. Die Liebe, um den Aspekt des Todes vertieft, gewinnt in dem Gedicht „Der schädel“ eine grössere Intensität und Wahrhaftigkeit als sie aus einer nur positiven Sicht erlangen könnte. Und indem Kunze nicht etwa „die Menschheit“ anredet oder „unser aller gemeinsame Zukunft“ besingt, sondern (widmungen ist ein programmatischer Titel) sich an ganz bestimmte einzelne Personen wendet – an tschechische Künstler, an seine Frau, an seine Kinder – gelingen ihm direkte Zugriffe von grosser Anschaulichkeit:
Du standest hinter einem grossen braunen bart
… Kühn hattest du ihn
von einer verlegenheit zur andern
ums kinn geworfen…
Dieses Porträt des Zeichners F. P., in dem gerade aus Aufmachungs-Ingredienzen auf die verborgene Psychologie geschlossen wird, ist ein ebenso grosser lyrischer (und erkenntnismässiger) Fund wie das Poem „Kinderzeichnung“:
Du hattest ein viereck gemalt,
darüber ein dreieck
darauf an die (seite) zwei striche mit rauch –
fertig war
DAS HAUS
Man glaubt gar nicht,
was man alles
nicht braucht
Kunze, der in widmungen hauptsächlich mittels der Metapher das Immanente transzendierte („Der druck des flusses / hebt den druck auf über dem herzen…“ oder „Ich gehe durch die nähe / der gebadeten haut einer jungen frau…“), verwendet in sensible wege zusätzlich die Methoden der didaktisch-dialektischen Poesie. Freilich zeigt sich auch in den Gedichten mit demonstrativen Inhalten ein Mass von emotionaler Spontanität, wie man es bei Kunert und den anderen Brecht-Schülern selten antrifft. Kunze, wenn er zur Parabel, zum Gleichnis ansetzt, geht von keiner Kalkulation, sondern von einem Impuls, einer Spannung aus. Ihn interessieren nicht programmierte Ziele und, damit in Zusammenhang stehend, ideologische Kurs- und Normabweichungen, sondern Beschädigungen des Essentiellen:
Auch nach dem sturz
stirbt, der baum im baum
nur langsam
Wie im menschen der mensch
Ihm den
kern nehmen,
aushöhlen ihn
Das
macht brauchbar
Dieses Gedicht, das erste von „drei bildhaueretüden“, ist eine neuerliche Parteinahme für das Individuum. Der Mensch, wenn man ihn auch manipulierend aus der Achse seiner Persönlichkeit wirft, verendet dennoch nur sehr langsam. Die Analogie, mit der Kunze den humanen „kern“ den seinshaften Kräften eines Baums gleichsetzt, deutet auf die weiterhin bestehende Reserviertheit denen gegenüber, die stets nur die geschichtlich-soziale Komponente im Auge haben. Das wird besonders an den drei Epigrammen „kurzer lehrgang“ deutlich, von denen hier nur eines – das Gedicht „dialektik“ – stehen soll:
Unwissende damit ihr
unwissend bleibt.
werden wir euch
schulen
Mutig verzichtet Kunze auf jegliche symbolische Verkleidung. Und so gibt er, der eines seiner Stücke Alexander Solschenizyn gewidmet hat, ein Beispiel für seine engagierte Literatur, die überzeugender ist als die neue westdeutsche Dichtung, die, als sie Ende der fünfziger Jahre aus allgemeiner Massstablosigkeit und aus speziellem Mangel an künstlerischer Disposition kreiert wurde, sofort die Anerkennung jener Oeffentlichkeit fand, die die kraftlosen Attacken als Identitätsbeweise genoss. Kunze – das macht jeder einzelne seiner Verse deutlich – würde gern seinen mühsam ertrotzten Raum erweitern, denn im Gegensatz zu den an Profilneurose erkrankten Bürgersöhnen der Neuen Linken kennt er noch den Wert dessen, was gemeinhin als Psychogramm diffamiert und als obsoleter Restbestand an Innerlichkeit ausgeschaltet wird:
DORF IN MÄHREN
Fünf jahre heiratete niemand
in Toubor keiner
starb kein kind
wurde geboren
Lautlos blüht am hang
die wegwarte
Kunze macht durch die Existenz seiner Person und seines Werks deutlich, das es auch in unserer Zeit der Aussenleitung möglich ist, die bedingte psychische Autonomie gegen Auflagen und Programme, die aus technokratischen oder sonstwie funktionalistischen Bereichen kommen, zu verteidigen. Das lyrische Ich dieses Dichters verschafft – und zwar gerade in seinen wortkargsten Kryptogrammen – dem menschlichen Ego eine beredte Zuflucht:
EINLADUNG ZU EINER TASSE JASMINTEE
Treten Sie ein, legen sie Ihre
traurigkeit ab, hier
dürfen Sie schweigen
Zur Gruppe der subtilen Gedichte gehört auch der Zyklus „einundzwanzig variationen über das thema ,die post‘“, in dem neben einigen zeitkritischen Episteln so sensitive Artikulationen stehen wie das folgende Gebilde, das nach den heute geltenden Massstäben zwar nur ein Stückchen Bekenntnislyrik aus den eigenen vier Wänden ist, das für mich aber zu den beglückendsten Poesieerlebnissen unserer erstarrten Epoche gehört:
Tochter, briefträgerin vom
briefkasten bis zum
tisch, deine stimme ist
das posthorn
Hans-Jürgen Heise, Die Tat, 26.4.1969
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Lothar Baier: Zollhinterziehung
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 17.7.1969
Gunhild Bohm: Hunger nach der Welt
Deutschland Archiv, Heft 7, 1969
Rolf Eigenwald: Talent und Gesinnung. Anmerkungen zur Poetik des politischen Gedichts
(zu dem Gedicht „Das Ende der Kunst“)
Bodo Lecke (Hrsg.) in Verbindung mit dem Bremer Kollektiv: Projekt Deutschunterricht 8, 1974
Walter Helmut Fritz: Eule und Auerhahn über die Kunst
Stuttgarter Zeitung, 14.6.1969
Mireille Gansel: Reiner Kunze – Sensible Wege
Allemagnes d’Aujourd’hui, Heft 23, (1970)
Thomas Gey: Erfahrungen mit Reiner Kunze in der gymnasialen Oberstufe
(zu dem Gedicht „Der Hochwald erzieht seine Bäume“)
Mitteilungen des Deutschen Germanistentverbandes, Heft 2, 1979
Hans-Jürgen Heise: Des Regenbogens angeklagt
Die Tat (Zürich), 26.7.1969
Walter Heise: Nachschriften. Zu einem Gedicht Reiner Kunzes.
(zu dem Gedicht „Die Bringer Beethovens“).
Zeitschrift für Musikpädagogik, Heft 8, 1979
Später in: Rudolf Wolff (Hrsg.): Reiner Kunze. Werk und Wirkung. Bouvier, 1983
Raymond Heitz: Entlarvte Phrasen
(zu dem Gedicht „Kurzer Lehrgang“)
Nouveaux Cahiers d’Allemand, Heft 2, 1984
Manfred Jäger: Weltoffene Einsamkeit
Kritisches Studium, Heft 1, 1970
Hans-Peter Klausenitzer: Greiz – grüne Zuflucht
(zu den Gedichten: „Dreiblick“, „Erinnerung an Greiz“ und „Dezember“)
Stätten deutscher Literatur. Ein Kalender des Gesamtdeutschen Instituts. 1982. Monat Oktober
Später in: Rudolf Wolff (Hrsg.): Reiner Kunze. Werk und Wirkung. Bouvier, 1983
Gregor Laschen: Worte in Handschellen
General-Anzeiger (Bonn), 20.6.1969
Nikolaus Marggraf: Wer da mitreisen könnte…
Frankfurter Rundschau, 14.6.1969
Edgar Neis: Städte und Landschaften im deutschen Gedicht
(zu dem Gedicht „Düsseldorfer Impromptu“)
Interpretationen motivgleicher Gedichte in Themengruppen. Bd. 10, Hollfeld, 1978
Peter Por: Eine Kunze-Lektüre
(zu dem Gedicht „Elegie“)
Germanisch-Romanische Monatsschrift, Heft 4, 1985
Hans Dieter Schäfer: Meine Worte haben Handschellen
Die Welt, 27.3.1969
Erika Tunner: Reiner Kunze: ELEGIE
(zu dem Gedicht „Elegie“)
Nouveaux Cahiers d’Allemand, Heft 2, 1984
Jürgen P. Wallmann: Reiner Kunze: Sensible Wege
Neue deutsche Hefte, Heft 122, 1969
Unter dem Pseudonym Peter W. Gerhard: Ausgesperrt – eingesperrt
Der Tagesspiegel, 11.5.1969
Jerry Glenn:
Books Abroad, Juli 1970
Erlösende Botschaft
– Das Wunder des Authentischen bei Reiner Kunze. –
Das Thema enthält eine doppelte, genau besehen sogar eine dreifache Behauptung, einmal, daß Authentizität in der Literatur unter bestimmten Umständen, nämlich in Zeiten, die Authentizität bei Menschen verhindern, etwas Wunderbares und als solches ein Wunder ist, weil selten und kostbar oder auch gefährlich, zum anderen, daß dieses Wunderbare bei dem Dichter Reiner Kunze zu finden ist, und schließlich als Drittes implizit, daß die erlösende Botschaft, die Dichtung vermitteln kann, somit die Erlösung, die sie verschafft, mit dem Authentischen ursächlich zusammenhängt. Dennoch will ich der Emphase des Themas, die mir unversehens unterlaufen ist, durch einen möglichst nüchternen Diskurs begegnen.
In den siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts erfuhren Reiner Kunze und sein Werk vor allem in der damaligen DDR eine Wirkung, wie sie in der Literaturgeschichte nur wenigen Autoren zuteil geworden ist, und die weit über das Literarische hinausreicht. Dem dichterischen Wort erwuchs ein Charisma mit einer Tiefenwirkung, wie sie sonst allenfalls der sakrale Text erreicht. In der Rückschau mutet dieses Geschehen, das auch eine geheimnisvolle Seite hat, als Phänomen hochinteressant und kostbar zugleich an. Seine ganze Tragweite, auch seine mentalitätsgeschichtliche Dimension, wäre im Nachhinein allenfalls aus einzelnen Erlebnisberichten von Zeitzeugen zu erschließen – das entzieht sich jedoch jetzt schon dem historiographischen Zugriff. Insofern will ich meinen Versuch, eine seltene und unerhörte Erscheinung zu erklären und durch Beschreibung vor ihrem Verschwinden im Strom des Geschichtsprozesses zu bewahren, auch aus meiner eigenen Erfahrung als Zeitzeuge bestreiten.
Kein anderer Autor der siebziger Jahre vermochte für solche Bewohner der DDR, die täglich mit ihrer dezidierten Abneigung gegen dieses Zwangsregime, ja ihrer Abscheu fertig zu werden hatten, eine derartige, der Ermutigung zugute kommende geistige Leuchtkraft zu entfalten. Ein Glücksfall also, der auch verborgene Geheimnisse der subversiven Seele zu enthüllen verspricht. Koinzidenz von Leben und Werk eines Autors fördert in Not-Zeiten rezeptive Nähe und Affinität. Der Dichter wird zum Mitstreiter, Ratgeber, Tröster, Nothelfer, zum Vertrauten. Werk und Autor, besser sein Leben und seine poetische Kompetenz, wirken in seltener Weise zusammen und entbinden eine unerhörte rezeptive Leuchtkraft. Das SED-Regime war Anfang der siebziger Jahre, ganz sicher 1974 und später, im Begriff, durch zermürbende Repressalien gegen Reiner Kunze und seine Familie, im Stasi-Jargon „Zersetzung“, einen Märtyrer der kritischen Meinungsäußerung und Wahrhaftigkeit aufzubauen, ohne ausgerechnet dies beabsichtigt zu haben. Hauptursache waren die kritische und die poetische Kraft einer Gruppe von Gedichten aus Sensible Wege und Zimmerlautstärke, jenen Gedichtbänden, die vor der Sammlung Brief mit blauem Siegel (1973) in der Bundesrepublik Deutschland (1969 und 1972) erschienen waren. Einigen dieser Gedichte möchte ich mich widmen, auch mit der Absicht, etwas zu ihrer meines Erachtens immer noch fragmentarischen Kommentierung beizutragen.
Der Lakonismus, die aphoristische Knappheit und epigrammhafte Luzidität in Reiner Kunzes Lyrik eröffnen gerade dann, wenn Gedichte existenzielle Grundfragen der Diktatur betreffen, mit erschreckendem Innewerden Abgründe ideologischer Verschleierung und existenzieller Not. Durch die Aussparungen werden im Rezeptionsvorgang gedankliche Ergänzungs- oder Entschlüsselungsleistungen erzwungen, die – nach nur minimalem Stutzen – mit der Blitzartigkeit von Aha-Erlebnissen gelingen. Die Andeutung verschafft den Texten den Reiz des Vielsagenden und suggeriert konspiratives Einverständnis, insgeheime Komplizenschaft, von der Gerard Raulet schreibt. Das war Konterbande, wie geschaffen fürs Weitersagen und Weitergeben, aber eben noch viel mehr als das. Ein Augenblick genügte, um dem Lesenden oder Hörenden den bleibenden Gedächtnisbesitz des dichterischen Textes zu sichern, im blitzschnellen Gewahrwerden zu wissen, dies dürfe er nicht vergessen, nicht verloren gehen lassen, und es könne auch seiner Kürze wegen mit Erfolg bewahrt werden. Die Knappheit der meisten Texte ermöglichte sofortige innersprachliche Rekapitulation, das Kurzzeitgedächtnis war dem Textumfang, oft nur ein Satz, gewachsen. Die behaltenen Texte standen somit zitierbar zur Verfügung, damit auch als schlagende Argumentationshilfe. Halten wir uns ein vielzitiertes Beispiel vor Augen:
ETHIK
Im mittelpunkt steht
der mensch
Nicht
der einzelne
– der dritte und letzte Aphorismus im Triptychon „Kurzer Lehrgang“ besteht lediglich aus den fünf Wörtern eines plakativen Zitats, einer propagandistischen Sentenz, die jeder kannte („Im mittelpunkt steht / der mensch“), und aus einem sich harmlos ausnehmenden, einschränkenden, dennoch nach logischer Erschließung dekuvrierenden Nachtrag im Umfang von drei Wörtern: „Nicht / der einzelne“. Dieser scheinbar unprätentiöse Lakonismus ist in seiner logischen Schlüssigkeit schlagend. Er exekutiert ein menschenverachtendes Prinzip des Kollektivismus-Ideals, nämlich das Besondere, Individuelle, Einmalige, jederzeit für ein (fiktives oder inszeniertes) Allgemeines und seine Uniformierung zu opfern. Hier findet verbale Hinrichtung durch ein die plakative Herrschaftssprache (Im Mittelpunkt steht der Mensch.) entlarvendes Understatement statt: ein Triumph des erhellenden Wortes, dessen Pointe auf einem Spiel mit der Vieldeutigkeit der Vokabel Mensch beruht; sie bedeutet ja sowohl menschliches Einzelwesen als auch die Gattung (Art). Die Urheber dieser politischen Phrase meinten, sollte man unterstellen dürfen, ganz sicher auch den Einzelmenschen, jedoch nur deklarativ, nicht in praxi.
Solche Entlarvungspointen boten im unselig-düsteren zeitgeschichtlichen Ambiente ein geistiges Aufleuchten, das auf dem dunklen Hintergrund des historischen Existenzraumes im sozialistischen Lager mit umso größerer Helligkeit wirkte. Dem Autor gelingt die Verdammung der Macht, und er spendet, mit Worten Thomas Manns, „der Wehrlosigkeit die tiefe Wohltat und Genugtuung des Wortes“. Jedenfalls erkenne ich rückblickend in solchen Entlarvungsmomenten eine geistige Illumination von höchster Klarheit mit großer Tiefenwirkung. Dies brannte sich ein.
Seit dem Erscheinen von Sensible Wege (1969) und Zimmerlautstärke (1972) im Westen erhielt der Samisdat von Gedichten Reiner Kunzes Auftrieb, auch außerhalb des engeren Kreises um den Autor, zu dem, wie Udo Scheer beschrieben hat, mit anderen Jürgen Fuchs, Lutz Rathenow, Günter Ullmann, Arnold Vaatz gehörten. Das Erscheinen der Gedichtauswahl Brief mit blauem Siegel im Osten (1973) mit einer Anzahl von Gedichten aus beiden Sammlungen – aber natürlich ohne die politisch hochbrisanten – steigerte den Rezeptionssog in der DDR noch einmal. Der Prosaband Die wunderbaren Jahre erschien kurze Zeit danach nur im Westen, und zwar – wir erinnern uns – im Schicksalsjahr 1976, dem Jahr der Selbstverbrennung des Pfarrers Oskar Brüsewitz im August in Zeitz und der Ausbürgerung Wolf Biermanns im November. „Seine Texte bestätigen Pfarrer Brüsewitz“, schrieb Karl Corino am 10. Sept. 1976 in der Deutschen Zeitung in seiner Rezension über Die wunderbaren Jahre unter dem Titel „Die Zeit der stummen Begräbnisse“. Die Texte dieses Buches boten, wie wir wissen, eine erschütternde Symptomatologie des realen Sozialismus in der DDR, die Heinrich Böll mit „wachsendem Gruseln“ las. Des öfteren priesen Rezensenten den hohen Grad der Authentizität der Texte sowie der Sachverhalte.
Ich darf einige allgemeine Vorüberlegungen nicht übergehen. In der Wirkung des literarischen Textes kann sich im besten Falle das Erhellende, Klärende, durchschaubar Machende mit dem Befreienden, Erlösenden verbinden. Erlösung – hier mit einigem Abstand vom theologischen Begriff gebraucht, doch ihm nicht ganz fremd – als das Befreiende, Klärende, Kathartische in jenem unspezifischen Sinn verstanden, wie es der umgangssprachlichen Bedeutung zu eigen ist, etwa von einer Ungewißheit oder von einem Schmerz, einer Plage erlöst zu werden. Vielleicht verhilft die Erlösung sogar zum befreienden Lachen oder Lächeln, oder auch zur sarkastischen Äußerung. Zunächst befreit Katharsis vom quälenden, beklemmenden Affekt, er wird aufgehoben oder gewandelt – Gefühlsumwandlung wird gelegentlich als der eigentliche kathartische Vorgang gesehen (so bei Wygotski) –, doch muß man wohl zugleich den Gewinn kognitiver Spielräume damit verbinden. Die befreiende Wirkung entsteht durch geistig-seelischen Raumgewinn, die klaustrophobische, würgende Umklammerung durch den Affekt wird aufgehoben. Diese sehr komplexe Wirkung, ein Zusammenwirken unterschiedlicher, vielleicht sogar konträrer psychischer Zustände, geht über das hinaus, was üblicherweise Katharsis genannt wird, weil nicht nur das „Reinigende“, Neutralisierende, die Befreiung von der Spannung des quälenden Affektes gemeint ist, sondern auch das Erhobensein im Erlebnis psychischen Raumgewinns und kognitiver Bewegungsfähigkeit. Die Freude der geistigen Souveränität, die daraus erwächst, kommt dem Erlebnis der eigenen Autonomie und damit dem Gewahrwerden des Authentischen zugute. Authentizität meint hier den in der Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit des Menschen begründeten Gehorsam gegenüber dem Ureigensten, den persönlichen Grundüberzeugungen und Haltungen. Das Unverstellte, die äußerste, kompromißlose Ehrlichkeit gegenüber dem Ureigensten, die Unmöglichkeit, es zu verleugnen, sondern dafür einzustehen, schließt Wahrhaftigkeit, also Unbestechlichkeit gegenüber der wahrzunehmenden Wirklichkeit ein: Dies darf als eine allgemeine Voraussetzung kritischer Kompetenz gelten. Kritisches Vermögen als Inbegriff europäischer Aufklärung fordert vom authentischen Menschen die kritische Betrachtung aller seiner existentiellen Umstände – also auch den politischen. Dies sei Kriterium seiner Mündigkeit als autonome Person oder Persönlichkeit. (Siehe Michaud anläßlich seiner Untersuchung über Lou Andreas-Salome.) Dementsprechend kommt für den aus intellektuellen oder anderen Gründen Kritikunfähigen, aber auch für den Verblendeten oder den politisch Verlogenen, den entmündigten (selbstentmündigten) Opportunisten also, die Frage nach seiner eventuellen Authentizität gar nicht in Betracht. Er ist gewissermaßen apriori nicht authentizitätsfähig. Authentizität ist nicht oder nur eingeschränkt zu verwirklichen, wenn im Fall verlorener Meinungsfreiheit – sprich politischer Entmündigung – das Äußern der Wahrheit in autoritären oder totalitären Staaten unter Strafe gestellt oder sonstwie mißbilligt wird, wenn also Menschen sich aus Angst vor Bestrafung dazu genötigt fühlen, wahres Wissen, eigene Meinung und Überzeugung wider bessere Kenntnis und Einsicht zu verschweigen oder zu verhehlen oder als Unwahrheit Erkanntes zu reproduzieren. Die Verpflichtung zum Verschweigen der ganzen Wahrheit, also zur Äußerung von halben oder sonstwie geteilten Wahrheiten oder Unwahrheiten erhebt Verlogenheit zum Lebenselement. Das Elend verhinderter authentischer Existenz betraf die Mehrheit der in der DDR Lebenden, sobald sie die dem europäischen zivilisatorischen Status angemessenen geistigen Ansprüche auf kritische Autonomie erhoben. Freilich kommt man an dieser Stelle in Grenzbereiche und Grauzonen: Wenn nämlich Authentizität nur demjenigen zugeschrieben werden kann, aus dessen kritischer Kompetenz und kompromißloser Aufrichtigkeit (Wahrhaftigkeit) die bedingungslose Verurteilung der Diktatur folgt, dann wäre letztlich erst Rebellion, also offener Widerstand oder die getarnte Untergrundaktion der Nachweis authentischen Handelns. Authentizität schließt also in Zeiten hochgradiger politischer Unterdrückung, die alle Lebensbereiche durchdringt, eine angemessene Form des Widerstandes oder doch des ausdrücklichen Widerstrebens ein. Wenn nun die Sujets der Schriftsteller die Gegenwart und den Tatort ihres Lebens betreffen, müssen sie es sich gefallen lassen, daran gemessen zu werden, ob und wie sie politisch und damit im existenziellen Zentrum präsent sind. Legt man an Schriftsteller der DDR in den sechziger und siebziger Jahren diesen Maßstab an, so ergeben sich aufschlußreiche Differenzierungen.
Auf der Suche nach geistigen Weggefährten und Gesprächspartnern kann unter ungünstigen Zeitumständen Persönlichkeiten aus der Geschichte der Vorrang vor Zeitgenossen gegeben werden. Von Goethe, Schiller, Hölderlin kommend, deren Nähe mir niemals verloren ging, gesellten sich für mich manche Autorengestalten aus der Literatur des 19. Jahrhunderts hinzu, aus der deutschsprachigen Literatur zum Beispiel Storm und Keller, im 20. Jahrhundert neben Thomas Mann vielleicht Kafka und Rilke, aber mit der Suche nach vertrauenswürdigen, verläßlichen, veritablen Autoren der näheren Mitwelt (unter dem Dach der sozialistischen Diktatur) tat man sch schwer. Es standen zunächst alle rezenten Autoren der DDR unter verschiedengradigem politischen Anpassungsverdacht, zu dem sich der Verdacht auf literarische Unzulänglichkeit gesellte. Hiesige Autoren wurden zuvorderst am Abstand von der Tyrannei oder an ihrer Bereitschaft zum tätigen Widerstand gemessen. Es gab also einen Maßstab, der – auch im Alltag – für politische Konsequenz und Abneigung galt. Ist jemand „anti“ oder nicht, das galt für viele als ein Kriterium beim Schließen von Bekanntschaften.
Gewiß war man gerade bei Künstlern und Autoren darauf vorbereitet, unterscheiden und auswählen zu müssen. Schließlich war eine gewisse Fähigkeit zur Toleranz der Ambiguität verfügbar, also das Abwägen und das Zurechtkommen mit Ambivalenzen im Urteil. Man wußte um das Zwar und Aber. Brecht war solch ein Fall: Man konnte am Schwejk im zweiten Weltkrieg sein Vergnügen haben oder sich an der Dreigroschenoper erfreuen, ohne die Zwielichtigkeit eines politisch durchaus suspekten Autors, von dem ein Lob der Partei oder Lob des Kommunismus und eine Menge anderer schwer erträglicher Agitprop-Texte stammten, aus den Augen zu verlieren oder seine Anbiederungen und Zustimmungserklärungen bei der verhaßten usurpatorischen Staatsmacht zu vergessen. Brecht war zudem nicht mehr unter den Lebenden. Wolf Biermann, um an eine faszinierende Erscheinung von eminenter Öffentlichkeitswirkung zu erinnern, war spätestens nach seinem ersten Verbot 1965/66 politisch höchst vertrauenswürdig, seine sozialistische Gesinnung nahm man um seiner hinreißenden Wirkung und kritischen Frechheit willen hin. Viele ergötzten sich an seiner pointenreichen ironischen Schärfe, seiner Unverfrorenheit, Heftigkeit, ja Unflätigkeit, seiner tollkühnen Respektlosigkeit als Rebell. Eine Vertrauensperson für prinzipielle Kritiker des Systems hätte er dennoch schwerlich abgegeben. (Die Kluft zwischen Reiner Kunze und Wolf Biermann, wie Biermann sie selbst in Köln 1976 vor dem Vortrag seines Kunzeliedes erklärt hatte, war die zwischen dem sich für unbeirrbar haltenden, irgendwie utopischen Kommunisten oder Sozialisten Biermann einerseits, der – trotz der Kenntnis von gräßlichen Zuständen in der DDR – im Sozialismus die große Hoffnung für die Menschheitszukunft sah, und anderseits dem hochsensiblen und deshalb gnadenlosen Kritiker Reiner Kunze, dem Biermann vorwirft, Hoffnung zu zerstören, mit der Wahrheit zu lügen, nur weil er barbarische Tatbestände als Symptome der Unheilbarkeit eines Systems erkennt und beim Namen nennt.)
Günter Kunert war schon viel näher daran, höhergradiger Authentizität zu genügen, seine literarische Form und die indirekte Art seines Wirklichkeitsbezuges machten es ihm leichter, denn er war ein Dichter der gleichnishaften Andeutung, zum Beispiel in der Parabel – er mied den unmittelbaren Clinch mit den Realien. In dem Gedicht „Wie ich ein Fisch“ wurde spielt er zwar auf deformierende Anpassungsprozesse an, wie sie höhere (politische) Gewalt, Überschwemmung qua Diktatur erzwingt, welche Menschen in andere Wesen verwandelt, also enthumanisiert. Aber es ist nicht zwingend, dies auch auf die Diktatur des Proletariats zu beziehen, obwohl Studenten im Seminar gerade das durchaus so verstanden wissen wollten und somit den Lehrenden, der sie ja letztlich damit provoziert hatte, in Verlegenheit brachten. Johannes Bobrowski mied die hautnahen gegenwärtigen Realien, Raum und Zeit seiner Werke befanden sich weitab von der sozialistischen Alltäglichkeit, er hatte es bei dieser Sachlage entfernter Sujets – nicht nur als Erzähler – leicht mit der Authentizität und ließ sich mittels seiner Texte nicht auf die Probe stellen. Auch Sarah Kirsch, auf thematischen Terrains tätig, die für die Schatten der politischen Repression nicht erreichbar waren, stand beinahe jenseits der akuten Affektionen.
Christa Wolf lavierte politisch als zeitweilige Kandidatin des ZK der SED, trotz des baldigen Endes dieser Karriere im Zusammenhang mit ihrem ersten Biermann-Protest Mitte der sechziger Jahre. Der geteilte Himmel war ein Buch, das der barbarischen Dimension der Berliner Mauer und ihren lähmenden Folgen nicht gerecht wurde. (Der literarische Erfolg des Buches lag offenbar darin begründet, daß halbe Wahrheit angesichts der Alternative Tabu gegenüber voller Wahrheit damals schon viel galt.) Kindheitsmuster strotzte gleicherweise von Halbwahrheiten, die viele erbosten, von vielen aber auch nicht bemerkt wurden. Zuvor hatte Nachdenken über Christa T. aufmerken lassen, war jedoch weit entfernt davon, das wirkliche Ausmaß der paralytischen Milieuschäden des Regimes dingfest zu machen. Der Glaubwürdigkeitsvorbehalt gegenüber Christa Wolf war für sehr viele evident, somit auch ihr Authentizitätsdefizit. Texte, bei denen die (zeitliche, räumliche) Entfernung vom sozialistischen Alltag und der Tagespolitik groß genug war, so in Kassandra und Kein Ort. Nirgends, unterlagen anderem Maßstab. Reiner Kunze stand in diesem Kontext und in dieser Gesellschaft als Autor allein auf weiter Flur.
Mit einem Minimum an sprachlichem Aufwand ein Maximum an Denk- und Vorstellungsmöglichkeit, Assoziationsweite und -vielfalt zu erzielen, ist eine wunderbare Möglichkeit sprachlicher Texte, insbesondere der lyrischen Gattung, sozusagen ein kreativer geistiger Effekt, der mit dem blitzartigen Öffnen kognitiver Weite eintritt, und der im Idealfall den Charakter einer rezeptiven Erleuchtung hat. Hier manifestiert sich, was Immanuel Kant mit der ästhetischen Idee meint, nämlich, daß „viel Unnennbares zu einem Begriffe hinzugedacht wird“.
Dieser kognitive Mikroprozeß sei am Einzelbeispiel noch weiterverdeutlicht. Wer als renitenter Untertan der Diktatur des Proletariats in der DDR aus dem Gedicht „Kurzer Lehrgang“ unter der Überschrift „Dialektik“ den ersten Satz des Triptychons zu hören bekam: „Unwissende damit ihr / unwissend bleibt / werden wir euch / schulen“, dem öffneten sich unverzüglich als Assoziationsraum alle möglichen Umstände der ideologischen, politischen Indoktrination oder Konditionierung in der Erziehungsdiktatur. (Der Gesamttitel dieses dreigliedrigen Gedichtes „Kurzer Lehrgang“, der als Teil des Textes wesentlich zu seinem Verständnis beiträgt, verweist mit den Teilen „Dialektik – Ästhetik – Ethik“ auf die marxistische Lehre, die – von Staatswegen zur „allmächtigen“ und „wahren“ erklärt – mit unablässig aufoktroyierter Aneignungsverpflichtung infiltriert wurde. Hinter „Kurzer Lehrgang“ steht für den Älteren als Assoziation der Untertitel eines grundlegenden Werkes des marxistisch-leninistischen Grundstudiums mit dem Titel „Geschichte der KPdSU (Bolschewiki) – Kurzer Lehrgang“, dessen kapitelweises Studium keinem Studenten vor 1956 erspart blieb. (Grüning allerdings bezieht den Titel auf ein von Stalin verfasstes Kompendium über dialektischen und historischen Materialismus.) Das Syllogistisch-Paradoxe des Sachverhaltes ist es, Unwissende zu belehren, damit sie unwissend bleiben, was bedeutet, daß ideologisches Wissen als Filter gegen alles andere Wissen installiert wird oder daß alles andere Wissen als falsches Wissen oder Irrlehre geächtet und somit von jeglicher Aneignung ausgeschlossen ist. Es wird also belehrt oder vielmehr geschult, um alles Wissen außer dem gebilligten zu entwerten oder zu tabuisieren. Das leuchtet sofort ein, ist aber nur die erste Stufe der Entschlüsselung. Um den vollen rezeptiven Erleuchtungs- und Erlösungseffekt zu erreichen, ist das Wissen um die zentrale Bedeutung der Dialektik als Methode des dialektischen Materialismus vorauszusetzen, zugleich die ungute Erfahrung mit ihrem Mißbrauch, weil sie dazu diente, auch logische Widersprüche spitzfindig zu rechtfertigen. Die Einheit des Vorenthaltens von (vorwiegend politischem) Wissen einerseits mit dem Aufoktroyieren von fragwürdigem (unwahrem, ideologischem) Wissen andererseits betrifft der im Text enthaltene logische Widerspruch, daß „Schulen“ sich zunächst auf eine Situation seriöser Wissensvermittlung bezieht. Im Verb „schulen“ dominiert aber – deutlicher noch bei dem Substantiv „Schulung“ – das Zwangsmoment, die „Schulpflicht“ der Wissensvermittlung.
Auf der nächsten Stufe, bei der Erstrezeption möglicherweise noch nicht in voller Schärfe deutlich, offenbart sich eine infame Abgründigkeit: Die ideologische Volksverdummung wird als zynisches Spiel dekuvriert, sobald evident ist, daß es sich offenbar um die unverhohlene Rede der Herrschenden, Belehrenden („wir“) gegenüber den Beherrschten („euch“) handelt („werden wir euch / schulen“). Die die Belehrung menschenverachtend betreiben, offenbaren sich als die wissenden Manipulatoren, die souverän und ohne die geringsten Skrupel auf geistige Entmündigung abzielen, indem sie bestimmen, welches Wissen vorzuenthalten ist, und die es nicht einmal für nötig halten, ihre Intention zu kaschieren. An diesem Punkt findet freilich der Übertritt in den Raum des Absurden statt, in die Extrapolation des Gegebenen, die die Realien überbietet, denn dergleichen zynische Selbstoffenbarung ereignete sich wohl in solch lakonischer Ehrlichkeit allenfalls ausnahmsweise. Der Text erzielt gerade damit einen befreienden Einsichtseffekt. Hier wird schlagartig entlarvt und zugleich die groteske, in die Radikalität des Absurden gehobene Überbietung inszeniert. Solche rezeptiven Wirkungen treten in voller Reichweite natürlich nur auf dem Hintergrund umfassender Zeiterfahrung ein. Dann bleibt kein Rest von Vagheit. (Anders dürfte es für die nicht mehr über die Zeiterfahrung verfügende Nachwelt sein.) Diese Vieldimensionalität aufscheinen zu lassen, setzt aber neben der gestalterischen Souveränität die volle Authentizität eines Autors voraus. Um solche Verdichtung zu erzielen, bedarf es der Authentizität des gnadenlosen, kompromißlosen Diagnostikers, der über eine elaborierte, von keiner Opportunitätserwägung beeinträchtigte kritische Kompetenz verfügt. Die geistige Sprengkraft dieser – mit den Überschriften – insgesamt elf Wörter ist groß, die schlagartige Entlarvung hat etwas Vernichtendes, und dieses Erlebnis geht mit in den sehr komplexen, ebenfalls wie ein Blitzschlag wirkenden Einsichten in den rezeptiven Effekt ein. Im Text tritt die Authentizität eines mutigen, ja tollkühnen kritischen Geistes zutage, der nicht aus dem Hinterhalt, sondern in aller Öffentlichkeit als David auf Goliath zielt und vor aller Augen voll trifft. Damit ist eine rezeptive Orientierungsreaktion von beträchtlicher Intensität erreicht, ich meine, ein rezeptives Nonplusultra. Der minimale Aufwand verbalen Materials ermöglicht ein Maximum an hinzugedachtem Inhalt, oder, um es noch einmal mit Immanuel Kants Kennzeichnung der ästhetischen Idee zu sagen: sie läßt „viel Unnennbares zu einem Begriffe hinzudenken, dessen Gefühl die Erkenntnisvermögen belebt und mit der Sprache […] Geist verbindet“, sprich: Gedanken über die semantisch im Text enthaltene Information hinaus zu akkumulieren vermag. Dennoch ist Assoziationsreichtum nur eine Episode im Verstehensprozess. Es kommt zu einem Beschleunigungsschub, dem die akkumulative Verzögerung nur vorangeht, wie eine Stauphase, eben ein Stutzen, als sollte die Plötzlichkeit des Innewerdens umso vehementer sein, damit desto größere Energie zu entbinden ist. Dann bildet sich als Pointe der semantische „Knalleffekt“, das dekodierte Fazit in der Art einer explosiven semantischen (Ketten-)Reaktion.
Da wir uns immer noch bei dem Gedicht „Kurzer Lehrgang“ aufhalten, sei auch des Mittelteils des Triptychons gedacht:
AESTHETIK
Bis zur entmachtung des
imperialismus ist
als verbündet zu betrachten
Picasso
Der tiefe Dissens, der zwischen Picasso als Künstler der sog. bürgerlichen Dekadenz und den ideologischen Apologeten des Sozialistischen Realismus liegt, wird aus taktischen Erwägungen ignoriert, vorläufig. Nur solange Picassos Friedenstaube als öffentliches Friedenssymbol im Sinne der pax sovietica gebraucht wird, bleibt ihr Schöpfer als Verbündeter der anderen Seite willkommen. Dieser Satz scheint eher an die Funktionäre zur beruhigenden Erklärung einer ideologischen Inkonsequenz gerichtet zu sein, als eine Art politisches Dekret. Somit verändern sich die Adressatenbeziehungen in interessanter Weise: Bei „Dialektik“ spricht der Belehrende (zynisch) zu den Indoktrinierten; bei „Aesthetik“ spricht der Belehrende als dekretierender Funktionär zu Gleichgesinnten, und erst in „Ethik“ tritt ein über der Situation stehendes lyrisches Ich als kritisches Subjekt in Erscheinung, das alles durchschaut.
Ein anderes, ebenbürtiges Beispiel, ebenfalls aus Sensible Wege, ist „Einladung zu einer Tasse Jasmintee“, ein Gedicht von 1967 – es könnte in seiner barmherzigen Zuwendung ein Motto über dem Œuvre der sechziger und siebziger Jahre sein – aber allemal ist es das Paradigma eines authentischen Textes von erheblicher politischer Brisanz:
EINLADUNG ZU EINER TASSE JASMINTEE
Treten Sie ein, legen Sie Ihre
traurigkeit ab, hier
dürfen Sie schweigen
Der Eingeladene, Hereingebetene, ist nicht einfach nur ein Gast, sondern der Hilfebedürftige, dessen Befinden genau wahrgenommen wird, und zwar von einem wissenden und einfühlsamen Gastgeber, der ihn, den vielleicht sogar Fremden, willkommen heißt und ihm seine Traurigkeit auf den ersten Blick ansieht, sie versteht, aufgrund gemeinsamer Erfahrung ihre Ursache kennt, so daß es keiner Erklärung bedarf. Der Gastgeber weiß also nur zu gut um jene Situationen, in denen Schweigen politischen Verdacht weckt. Er hat vielleicht selbst unter der politischen Nötigung gelitten, sich zustimmend, Konformität mit offizieller politischer Meinung heuchelnd, äußern zu müssen, auch dann, wenn er verneinen möchte also zur Selbstverleugnung gezwungen zu sein. Schweigen galt nämlich als stumme Verneinung, politische Ergebenheitsäußerung und verbale Zustimmung waren Element der staatsbürgerlichen Pflicht und ein Beweis dafür, daß man nicht der vom „Klassenfeind“ unterstellten schweigenden Mehrheit angehörte. Schweigen als ein den politischen Vorbehalt offenbarendes Signal und somit als Indikator feindlicher Einstellung interpretierbar, war ein brisantes Politikum. (Wer nicht ausdrücklich für uns ist, ist gegen uns – so die politische Devise aus der Frühzeit der Diktatur. Später hieß es dann, mit der etwas vergrößerten politischen Toleranz der achtziger Jahre: Wer nicht ausdrücklich gegen uns ist, ist für uns. Beides von Paranoia geprägte Annahmen.) Somit ist das ausdrückliche Anerbieten, schweigen zu dürfen, ein erlösendes Verhaltensangebot für den, der anderweitig nicht schweigen darf, sondern zu verbaler Zustimmung genötigt wird – und der nichts erklären muß, weil der Gastgeber alles versteht und nichts will, als bei depressiver Seelenlage helfen.
Die durch den politischen Kontext der Diktatur gegebene Abgründigkeit dieses Gedichtes läßt, wie man sieht, ein assoziatives Umfeld von erheblichem Radius aufleuchten und ist in seiner Tiefe nur auf dem autochthonen Erfahrungshintergrund eines potentiellen Dissidenten erschließbar. Erstaunlicherweise hatte dieses Gedicht dennoch, nachdem es zuerst in Sensible Wege erschienen war, in Brief mit blauem Siegel als DDR-Publikation von 1973 Eingang gefunden. Gleiches erfuhr das Gedicht „auf dich im blauen mantel“, wiederum zuerst in der Bundesrepublik in dem Gedichtband Zimmerlautstärke 1972 erschienen, 1970 verfaßt:
Von neuem lese ich von vorn
die häuserzeile suche
dich das blaue komma das
sinn gibt
Wegen dieses einen Satzes mußte sich der nach Berlin beorderte Autor von einem maßgebenden Funktionär den Vorwurf anhören, dieses Gedicht sei „schlimmer als Biermann“, der längst verfemte, es erweise sich die „Ablehnung des Sozialismus“, weil es „der einzelne sei, der Sinn gibt“ – und eben nicht die Gesellschaft. Führt hier Klassenfeind-Paranoia und konterrevolutionärer Verfolgungswahn zu einer Überreaktion – oder ist die politische Feindphobie erklärlich? Gewiß, die gesteigerte Empfindlichkeit, das Manische in der Suche nach dem feindlichen Denken, sind offenkundig und grotesk, heute eher der reinste Hohn und somit eher kurios, damals eigentlich auch, dennoch aber Indiz für das Ausmaß einer politischen Repression, die mit tödlichem Ernst verwirklicht wurde und dazu angetan war, einen Autor in Gefahr für Leib und Leben zu bringen.
„einladung zu einer tasse jasmintee“ kursierte schon vorher, zum Beispiel hier in Jena, von Studenten weiter gereicht, sogar handschriftlich, auch mir übergeben, von ungarischen Germanistikstudenten übrigens, für die die Entdeckung von nicht in der DDR publizierten oder für publizierbar gehaltenen Gedichten Reiner Kunzes aus Sensible Wege offensichtlich das prägende Erlebnis ihres Jenaer Studienaufenthaltes war. Aus ihren Händen erhielt ich einige Blätter des handschriftlichen Samisdats, die ich bis heute aufbewahrt habe. Darunter waren übrigens neben „Kurzer Lehrgang“, der sich bei den Studenten besonderer Beliebtheit erfreute, auch „der hochwald erzieht seine bäume“, „die bringer Beethovens“, „das ende der fabeln“, „das ende der kunst“, alle später, 1973, überraschenderweise in der DDR erschienen, daneben aber auch andere Gedichte, („von der notwendigkeit der zensur“; „die antenne“; „rückkehr aus Prag“; „am briefkasten“; „dezember“; „deutschland, deutschland“), die keine Aussicht hatten, im Osten publiziert zu werden. Das Gedicht „von der notwendigkeit der zensur“ („Retuschierbar ist / alles // Nur / das negativ nicht / in uns“) bietet ein elektrisierendes aphoristisches Statement der vermeintlichen Unantastbarkeit unseres Innersten, des Kerns unseres Wesens, unerreichbar für die manipulatorischen Einflußnahmen der Konditionierung oder der ideologischen Gehirnwäsche, die doch Standardmethoden der totalitären Erziehungsdiktaturen sind, und von denen man sehr wohl weiß, daß sie Wirkung tun. Also ein Wunschdenken, dem man als Hoffender um der Ermutigung willen gern zustimmt – wohl ahnend, daß es schrecklicherweise auch die inneren Retuschen gibt.
Die lauernde politische Entlarvung erreichte zuweilen – bei aller Simplizität der sicherheitspolitischen Analyse – erstaunliche Resultate. Zu dem Gedichtband Sensible Wege hatte der Redakteur der Jenaer Universitätszeitung (Sozialistische Universität), Wolfgang Jähnig, am 25.5.1971 für die Staatssicherheit ein Gutachten von dreieinhalb Seiten Umfang angefertigt. Über das Gedicht „Der Hochwald“ bzw. „der hochwald erzieht seine bäume“ schreibt der mit der politischen Exekution des Autors beauftragte Gutachter:
Als Hochwald wird eine Gesellschaft gemeint, die sich entwickelt (sozialistische) und die zugleich nivelliert. Solche Wendungen wie „Sie (die Bäume – W. J.) des Lichts entwöhnend, zwingt er sie, – der Hochwald – [all ihr grün in die kronen zu schicken] Fähigkeit und Talent […] verkümmern zu lassen. Der Hochwald siebt; keiner sieht mehr als der andere, alle sagen das gleiche u.s.w. Die Gesellschaft des Sozialismus negiert nach R. K. die Entfaltung des Individuums im Kollektiv. […] Das Naturbild entpuppt sich als eine weitgefaßte Metapher, die gesellschaftliche Verhältnisse assoziiert und in dieser generalisierenden Form einer Kritik an dieser gegenwärtigen Ordnung gleichkommt. Der Autor lebt zwar in ihr, stellt sich aber außerhalb dieser Ordnung.
Dieses Verständnis des Gedichtes trifft bei aller Schlichtheit des Denkens und trotz der Erbarmungswürdigkeit der sprachlichen Formulierung den politisch-kritischen Impetus des Textes. „Keiner sieht mehr als der andere, / dem wind sagen alle das gleiche“ – so lauten die letzten Zeilen, das Resultat eines Egalitarismus, wie er sozialistischer Normgebung innewohnt. Immerhin erscheint auch dieses Gedicht von 1962, 1969 in Sensible Wege erstmals publiziert, 1973 bei Reclam Leipzig. Der ideologisch-politische Beziehungswahn erreicht seinen klarsten Ausdruck in der Bemerkung des Gutachters zu dem Gedicht „der apfelesser“ (1967), ein Lob der Falläpfel, die süßer, weil reifer sind. Der Autor postuliere, heißt es da, „daß derjenige eine ,saure‘ Erfahrung macht, der nur dem Apfel am Ast glaubt und nicht die abgefallenen Äpfel aufhebt, die doch die reifsten seien. Wer also ,linientreu‘, d.h. parteilich und konsequent für diesen Staat – die DDR – eintritt und am ihm festhält, hat weniger Säfte und Reife als jener, der abgefallen ist – wie Biermann, Kunze u.a.“
Groteskes Mißverstehen einer Metapher betrifft die Bemerkung zu dem Gedicht „namensänderung“ (1966), wo es heißt: „Vergiß, mein sohn. Ich bin / dein vater nicht, bin nur / ein igel der // blüht“: „R. K. ist ein Igel“, so der Gutachter, „der sich eingerollt hat und seine literarischen Stacheln zeigt und wartet, bis die Gefahr vorüber ist.“
Wenig später wird Reiner Kunze eine antisozialistische Position vorgeworfen, dazu Verzerrung der Wirklichkeit, die „DDR-unkonkret und teils DDR-feindlich widergespiegelt wird“, er gäbe den „Feinden des Friedens und der Entspannung politische Schützenhilfe“. Als ich mit dem Verfasser dieses denunziatorischen Gutachtentextes 1991 über seine mutmaßliche Urheberschaft sprechen wollte – er war damals sogar noch Redakteur der Universitätszeitung Alma mater Jenensis – beteuerte er, nie eine Zeile von Kunze gelesen zu haben. Erst als er kurze Zeit später seine Unterschrift unter dem Text gezeigt bekam, gab er das Leugnen auf. Daß diese politisch ihm höchst suspekten Gedichte dennoch in der DDR publiziert wurden, müßte ihm eigentlich schon 1973 ein schlechtes Gewissen bereitet haben.
Die Interpretationsbemühung des militanten Ideologen endet also in dem Versuch, einen vermeintlich sklavensprachlichen Text in Klartext zu übertragen. Aber damit verfällt er, der Simplizität seiner Denkweise und der Denkweise seiner Partei, der SED, entsprechend, auf Paraphrasen in der sprachlichen Form des ideologischen Kampf- und Propagandajargons. Somit kommt es in der politischen Überinterpretation zur hermeneutischen Verkürzung, die den assoziativen Reichtum des poetischen Textes auf das reduziert, was dem Beweis der ideologischen Feindseligkeit dient. (Solcher Reduktionismus wurde in der politischen Propaganda immer dann angewandt, wenn es das Ziel war, einen Autor oder einen sich Äußernden schlechthin, z.B. auch einen Witze-Erzähler, zum politischen Feind oder zu einem mit dem Feind Paktierenden zu stempeln, letztlich, um ihn zu inkriminieren.)
In manchen Fällen bietet sich – wie in der simulierten Fabel („das ende der fabeln oder das ende der kunst“) mit Tiergestalten, die verkleidete Menschen sind – die Übersetzung in Klartext eher an, und dies kann ohne exegetischen Aufwand von jedem ohne weiteres geleistet werden. Zwar weist bekanntlich der Autor selbst auf das Kassiberhafte seiner Texte hin, dennoch verhüllen sie nicht und erschweren damit auch nicht die Dekodierung, die Verhüllung ist eher Schein, ihre Form dient dem blitzartigen Zutagetreten einer Wahrheit, und die wird nach kurzem Stutzen unverzüglich erkannt. Die enthymemartige Aussparung, deren augenblickliche Lösung erhellend, schlagend, explosiv wirkt, hat mittels der funkelnden Entschlüsselungseffekte eine energiereiche Entladung zur Folge, die gerade deshalb im inneren Geschehen des Rezipienten nachhaltige Wirkung erzielt, gewissermaßen als ein penetrierendes kognitives Erlebnis. Die Stärke des Eindrucks bewirkt zudem innere Gesprächssequenzen, innere Dialoge mit fiktiven Gleichgesinnten, deren mentale Präsenz dazu nötigt, die Suche nach realen Gleichgesinnten zu betreiben. In diesen innersprachlichen Vorgängen sind die Texte partiell, zuweilen sogar komplett enthalten.
Mit Gerard Raulet (a.a.O.) ist für die besondere Rezeptionstiefe der Gedichte Kunzes eine Komplizenschaft zwischen Autor und Rezipient vorauszusetzen, jedenfalls ein geheimes, tiefes politisches Einverständnis mit einem konspirativen Zug. Einfachheit und familiärer Ton, so Raulet, stellten Kontakt und Komplizenschaft her – besser wohl: sie aktualisierten die potenzielle Komplizenschaft, und durch den zündenden kommunikativen Vollzug wird sie bekräftigt.
Sklavensprache, die direkt in Klartext übersetzbar ist, war eigentlich nur für denjenigen gegeben, der in den Texten das sucht, was den Autor überführt, um ihn bezichtigen zu können: Der dichterische Text als für den Urheber verhängnisvolle politische Verbalinjurie, vergleichbar mit dem politischen Witz, der bekanntlich mit hohen Freiheitsstrafen geahndet werden konnte. Bei solcher Mentalitätsstruktur kommt der auf Inkriminierung abzielende Textprüfer, der das Verleumderische, die politisch feindliche Verunglimpfung aus dem poetischen Text herauspräparieren will, freilich zu einer Eindeutigkeit, die der poetische Text nur selten hat, das Gedicht vom Hochwald schon gar nicht. (Eindeutigkeit liegt freilich bei dem aphoristisch-lyrischen Triptychon von „Kurzer Lehrgang“ vor; hier bleibt kein nicht dekodierbarer „Rest“.) Für den zitierten Textprüfer meint „Hochwald“ die sozialistische Gesellschaft: ihr wirft nach seinem Verständnis der Autor vor, daß sie Nivellierung und Konformität erzeugt, also gegen das principium individuationis verstößt, kollektivistisch, wie sie war. Oder es ist – wie im Gedicht „das ende der kunst“ – der Einspruch besserwisserischer Ideologen, ihr verbindlicher Ratschlag, der das Kunstwerk ruiniert. (Die Eule macht dem dichtenden Auerhahn weis, daß die Sonne in seinem Gedicht nicht wichtig ist. Er nimmt sie also heraus – „und es war schön finster“.) In „das ende der fabeln“ wird schon der Schreibprozeß blockiert. Es geht nicht, bei Lebensgefahr, daß der Hahn bestimmte Figuren in seiner Fabel überhaupt in Erscheinung treten läßt, z.B. den Fuchs oder den Bauern, weil der Hahn vom einen gefressen und vom anderen geschlachtet wird. Die Konsequenz: „Nun gibt’s keine fabeln mehr.“
Der Hochwald und seine Bäume stehen aber nicht nur für etwas und werden als Gegebenheiten durch die metaphorische Entschlüsselungsmöglichkeit nicht aufgehoben, sondern sie behalten ihren Bezug auf die Realien, als Teil der Landschaft, einer Kulturlandschaft zugegeben. Es ist ein Forst, ein angepflanzter Wald ganz offenbar, und der Egalitarismus der Bäume beruht auf der Gleichzeitigkeit ihrer Anpflanzung. Zugleich und erst darüber hinaus dient sie als Analogiequelle für die menschliche Gesellschaft, nach Raulet eine „Chiffre für die Gesellschaft“. Damit ist freilich die metaphorische Situation im Sinne der Zeichenkonstellation gegeben: Etwas steht (auch) für etwas (anderes). Dies sei die metaphorische Doppelung genannt, die in einer (kurzfristig) über das semantische Gegebene hinausgehenden Informationsmehrung besteht, nämlich einer Akkumulation von assoziativem Wissen über den semantischen Bestand des im Text präsenten Wortmaterials hinaus.
Nach dem Erscheinen des Buches Die wunderbaren Jahre blieb es dem Jenaer Slawisten Prof Dr. Michael Wegner vorbehalten, dem Ministerium für Staatssicherheit zu bestätigen, der Autor verwirkliche ein „Konzept mit einer eindeutigen ideologischen Stoßrichtung gegen den realen Sozialismus in der DDR“ und kritisiere das ganze sozialistische System, nicht nur mehr einzelne Erscheinungen wie zuvor. Was ist dies bei aller Infamie anderes, als der ehrenvolle Authentizitätsbeweis für einen kompromißlosen, politisch aufrechten Menschen, den man nicht zu Unrecht fürchtet! Zermürbung und Nötigung zur Ausbürgerung entsprachen der grobschlächtigen Verfahrensweise eines totalitären Regimes, das grundsätzlich außerstande war, mit Kritikern zu kommunizieren. In dieser Situation gewann das dichterische Wort eine Macht, die dazu angetan war, eine übermächtig erscheinende Diktatur zutiefst zu verunsichern und zu treffen.
Gottfried Meinhold, aus Ulrich Zwiener und Edwin Kratschmer (Hrsg.): Das blaue Komma. Zu Reiner Kunzes Leben und Werk, Verlag und Datenbank für Geisteswissenschaften, 2003
Sensible Wege
– Ein Porträt des Schriftstellers Reiner Kunze. –
I.
Am 21. Oktober 1977 erhielt Reiner Kunze in Darmstadt den Georg-Büchner-Preis der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Die Laudatio hielt Heinrich Böll, der u.a. erklärte, stets habe er sich dem Ansinnen von Freunden und Kollegen widersetzt, die ihn immer dann, wenn ein Autor aus einem sozialistischen Land hinausgeworfen oder hinauskomplimentiert werde, darum bäten, diesen Autor „zu warnen vor den Fleisch- und Werwölfen des nackten Antikommunismus, vor falschen Freunden und Spekulanten, vor der Vermarktung, vor den Gefahren, die seiner hier lauern“. Er gehe davon aus, daß ein Autor, der diese Bezeichnung verdiene, wahrnehmungs- und ausdrucksfähig genug sei, Gefahren selbst zu erkennen, und daß die Gefahr, der er entronnen sei, ihn nicht unempfindlich mache für die Gefahr, in die er gerate. Dem Autor der Wunderbaren Jahre und der Zimmerlautstärke habe er nichts beizubringen. Böll fuhr fort:
Es gibt ein uraltes, nicht nur deutsches Mißverständnis zwischen Autoren und Politikern; letztere bilden sich einfach zu viel ein, wenn sie durch Romane, Gedichte, Erzählungen, Dramen sich beleidigt fühlen, weil die Welt, die sie geschaffen haben, in Wirklichkeit doch schöner sei, als oft dargeboten. Der Streit darüber, was nun wirklich sei, ist sinnlos, zeitraubend und langweilig; nicht nur die deutsche, die internationale Literatur macht den Streit überflüssig. Was wirklich ist, bestimmt der Autor, der Maler, der Bildhauer, der Tänzer, der da seine Wirklichkeit schafft. Entgegenkommen gibt es nicht, Zumutung ist die Parole – und auf alle Rückwärtsangriffe gibt’s nur eine Antwort: Vorwärtsverteidigung. Hölderlin hat seine Wirklichkeit, Erich Kästner, Reiner Kunze und viele andere, fast unzählige, und vielleicht ergeben alle ihre Wirklichkeiten die eine: man muß schon lesen, viel lesen und genau. In keinem Land der Erde – nicht hier, nicht in der DDR, nicht in der Sowjetunion oder Frankreich – hat die Literatur die Aufgabe, Werbung für irgendeine politische und ökonomische Wirklichkeit zu liefern. Dazu gibt es Presseämter, Ministerien, Verlautbarungsapparate, und wenn einer Tristesse mit Tristheit verwechselt, so entspricht das der Verwechslung von Untröstlichkeit mit Trostlosigkeit.
Anspielend auf den schlechten Ruf, unter dem die Deutschen derzeit wieder leiden, sagte Böll, dieser schlechte Ruf tue weh, auch den Autoren:
Es tut weh, denke ich, weil wir, indem wir deutsch schreiben, ein Bekenntnis ablegen oder ausüben, das mit Vaterlandsliebe weit unter Wert bezeichnet wäre; diese tiefe, ausdrucksreiche, die deutsche Sprache, die eben Wirklichkeiten zwischen Hölderlin und Kästner und Kunze zuläßt, viele andere Wirklichkeiten noch, etwa zwischen Kleist und Kroetz – suchen wir nicht in ihr, was Hölderlin die ,eigene Seele‘ genannt hat? – und finden sie nicht in Glücksmomenten, und wissen, daß die, die diese Sprache sprechen, so häßlich nicht sein können? Die Haaresbreite sensibler Wege – die hat ein Deutscher gefunden, ist ein Deutscher gegangen; auf dieser Haaresbreite hat er gelebt und gewohnt, kein Seiltänzer, kein Akrobat, standfest, weil sensibel, abhold den Grobheiten seiner Zeit, von ihnen getroffen und doch nicht schwankend, weil die Sprache ihn hielt, eine Sprache, die nicht vereinfacht, die man Zeile für Zeile sich entfalten lassen muß, Welten aufbauend auf einer Zeile, Welten, die beben; bebende Kreatur im Gebrüll des Schreckens, in der mörderischen Mechanik bloßen Funktionierens. Das nenne ich wirklich und deutsch, und soll sich keiner einbilden, kein Bürger, kein Staatsmann, er wäre nicht betroffen. Kategorien der Herablassung nennen das wohl ein ,schmales Werk‘. Lieber Reiner Kunze – ja, schmal ist es wie eben die Haaresbreite, auf der es Türme baut, Welten errichtet, Verse anstimmt, die lautstarke Mächte, muskelprotzende Armeen in Zorn versetzen. Vor Davids Schleuder wird Goliath immer noch lächerlich; schmales Werk, ja, deutsch und schmal: sensible Wege, suchen und finden die ,eigne Seele‘, die Propaganda scheut, Lautstärke meidet – im sanften Schwirren des Pfeils mehr Kraft, Zielsicherheit und Mut verbirgt als das tägliche, nächtliche Propagandagetöse. Ein Einbaum mit Einmannbesatzung zwischen ganzen Flotten in ihrer lächerlichen martialischen Selbstsicherheit. Ein Deutscher, ein Dichter, Reiner Kunze, Sie, mit einem schmalen Werk, in dem sich Welten entfalten, dieses Preises würdig, und höherer Ehren: verliehen für die Standfestigkeit der Poesie, in Ihrem Falle der deutschen Poesie in deutscher Wirklichkeit.
Soweit Heinrich Böll.
II.
Bis zum 13. April 1977 hat Reiner Kunze als freier – besser: freiberuflicher – Schriftsteller in der DDR gelebt. Und über Jahre ist der ,Fall Reiner Kunze‘ ein Prüfstein der kulturpolitischen Entwicklung in der DDR gewesen. Insbesondere seit Erich Honecker im Frühjahr 1971 Walter Ulbricht im Amt des Ersten Sekretärs der SED abgelöst hat, hofften die Künstler und Schriftsteller in der DDR auf eine Änderung der bis dahin harten und dogmatisch-sterilen Kulturpolitik. Eine leichte Kurskorrektur schien sich anzudeuten, als Honecker auf der 16. Tagung des SED-Zentralkomitees Anfang Mai 1971 in seinem Bericht über den XXIV. Parteitag der Kommunistischen Partei der Sowjetunion die Passagen referierte, in denen Breschnew in Moskau um Verständnis für die Probleme der Künstler geworben hatte. Honecker sagte u.a.:
Der Parteitag der KPdSU sprach sich für eine feinfühlige Einstellung zum künstlerischen Suchen, für die volle Entwicklung der individuellen Begabungen und Talente, für Mannigfaltigkeit und Reichtum der Formen und Stile aus, die durch die Methode des sozialistischen Realismus erarbeitet werden.
Auf dem SED-Parteitag im Juni 1971 versprach Honecker, die Partei werde den Künstlern vertrauensvoll zur Seite stehen; es war die Rede von einem „offenherzigen, sachlichen, schöpferischen Meinungsstreit“, von „vollem Verständnis“ für die „schöpferische Suche nach neuen Formen“.
Waren dies nur schöne Worte, oder würde in der DDR in Zukunft wirklich eine offene Auseinandersetzung über künstlerische und kulturpolitische Fragen möglich sein, eine Auseinandersetzung, wie sie seit 1968 unmöglich war? Würden, so muß man kritisch fragen, diesmal wieder die Kräfte siegen, die mit Zensur und Verboten arbeiten und ein kritisches Gespräch scheuen? Den Vertreter dieser Haltung visierte Reiner Kunze in einem Gedicht 1971 so an:
Auf einen Vertreter der Macht
oder
Gespräch über das Gedichteschreiben
Sie vergessen, sagte er, wir haben
den längeren arm
Dabei ging es
um den kopf
Wer ist Reiner Kunze, was macht ihn und seine Dichtung so bedeutsam und symptomatisch?
Das Leipziger Lexikon deutschsprachiger Schriftsteller nennt Kunze noch in seiner Ausgabe von 1972 einen Autor, der versuche, „das Lebensgefühl seiner am Aufbau des Sozialismus teilhabenden Generation auszudrücken“; gerühmt wurde Kunzes Talent, „in gedanklich prägnanten, volkstümlich einfachen Versen seine Umwelt im Individuellen zu erfassen“, gelobt seine „hintergründige Ironie und logisch argumentierende Treffsicherheit“ und die „satirische Abrechnung mit fortschrittshemmenden Kunstauffassungen und unkünstlerischen Praktiken“. Abschließend wird erwähnt, daß sich Kunze „als Nachdichter aus dem Tschechischen einen Namen gemacht“ habe.
Reiner Kunze wurde 1933 in Oelsnitz im Erzgebirge als Sohn eines Bergarbeiters geboren. Von 1951 bis zum Staatsexamen 1955 studierte er in Leipzig Philosophie und Journalistik. Von 1955 an war er wissenschaftlicher Assistent mit Lehrauftrag an der Karl-Marx-Universität Leipzig, mußte diese Tätigkeit jedoch kurz vor der Promotion aufgeben, da er sich fortgesetzt schweren politischen Angriffen ausgesetzt sah. Kunze wurde dann Hilfsarbeiter im Schwermaschinenbau und in der Landwirtschaft; später war er zeitweilig freier wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Deutschen Akademie der Künste in Ost-Berlin. Eine schwere Erkrankung zwang ihn zu längeren Erholungsaufenthalten in der Tschechoslowakei. 1962 zog Kunze, der seit 1961 mit einer tschechischen Ärztin verheiratet ist, nach Greiz in Thüringen, wo er bis April 1977 als freischaffender Autor lebte. In der DDR hatte Kunze mehrere Lyriksammlungen, Liedtexte, Essays und Nachdichtungen veröffentlicht, nicht selten hochgelobte, aber doch unzulängliche, klischeehaft-vordergründige Arbeiten, die eine Orientierung des jungen Dichters an den damals offiziellen erwünschten Reimereien erkennen lassen. Erst seit der Begegnung mit der geistigen und menschlichen Welt der Tschechen und Slowaken, seit dem Beginn der sechziger Jahre begann Kunze nach eigener Aussage zu begreifen, was Poesie ist. Seine früheren Publikationen betrachtet er heute als „Werke ohne Opuszahl“: Opus 1 ist für ihn der Band Widmungen, der 1963 in Bad Godesberg erschien und in den einige Gedichte aus vergangenen Büchern übernommen wurden; Opus 2 ist die im Frühjahr 1969 bei Rowohlt erschienene Sammlung Sensible Wege, der in der DDR ein Lyrikheft in der Reihe Poesiealbum vorangegangen war. Dieses Bändchen war Mitte August 1968 ausgeliefert worden; eine Woche später, nach dem Einmarsch der Truppen des Warschauer Paktes in die ČSSR, gegen den Kunze sofort mit seinem Austritt aus der SED protestierte, hätte dieses Heft gewiß nicht mehr erscheinen dürfen.
III.
Der Band Sensible Wege, der Reiner Kunze im Westen bekannt gemacht hat, zeigt den Lyriker in der Position eines Mannes, der gegen die Stagnation der Revolution kämpft, der die Rechte des einzelnen verteidigt und der sich gegen das Schablonendenken in den Kategorien Schwarz und Weiß wehrt. Hier artikuliert sich ein engagierter Sozialist, der sich um eine Klärung der Situation, um Selbstfindung müht und dem dabei Bilder von überraschender Prägnanz gelingen; ein verletzlicher und sensibler Dichter, der in knappen Worten seine Lage skizziert
Ausgesperrt aus büchern
ausgesperrt aus zeitungen
ausgesperrt aus sälen
eingesperrt in dieses land
das ich wieder und wieder wählen würde
der sich in kritischer Liebe zu seinem Land bekennt, es aber verbessern, das Leben in ihm menschlicher für die Menschen machen möchte. Aber man hat in der DDR nicht sehen können oder wollen, daß solche Bekenntnisse kritischer Individualisten, zwischen zusammengepreßten Zähnen hervorgestoßen, mehr Gewicht haben als alle wohlfeilen und lautstarken Loyalitätsbekundungen ergebener Polit-Poeten. Gerade Kunze, der wie kaum ein anderer Lyriker die Kommunikation, das Gespräch mit dem Leser sucht und braucht, hat man immer wieder die Möglichkeit des Kontakts und des Gesprächs abgeschnitten.
Auf dem VI. Kongreß des Schriftstellerverbandes der DDR, der vom 28. bis 30. Mai 1969 in Ost-Berlin stattfand, nahm Vizepräsident Max Walter Schulz die Gelegenheit wahr, Kunze in aller Öffentlichkeit anzugreifen. Bei der Lektüre des im Westen erschienenen Gedichtbandes Sensible Wege – er war übrigens gerade von der Jury der Darmstädter Akademie zum „Buch des Monats“ gewählt worden – erscheine einem „der fatale lyrische Ort zwischen Innenweltschau und Antikommunismus in gestochener Schärfe“. Es sei, so sagte Schulz (und das SED-Zentralorgan Neues Deutschland druckte es am folgenden Tag),
der nackte, vergnatzte, bei aller Sensibilität aktionslüsterne Individualismus, der aus dieser Innenwelt herausschaut und schon mit dem Antikommunismus, mit der böswilligen Verzerrung des DDR-Bildes kollaboriert – auch wenn das Reiner Kunze, wie anzunehmen, nicht wahrhaben will.
Und ganz ausdrücklich zitierte Schulz eines von den drei Kurzgedichten, die Kunze unter dem Titel „Kurzer Lehrgang“ veröffentlicht hatte.
DIALEKTIK
Unwissende damit ihr
unwissend bleibt
werden wir euch
schulen
Sollte Schulz nicht bemerkt haben, daß Kunze damit – durchaus im Sinne der Entstalinisierung – auf den Kurzen Lehrgang anspielte, die in Millionenauflage verbreitete, stalinistisch verfälschte Geschichte der KPdSU? Seit jenem Angriff von Max Walter Schulz begann man in der DDR, Reiner Kunze zur ,Unperson‘ zu machen, seine Arbeit zu behindern, ihm Publikationen unmöglich zu machen, seinen Namen im Bewußtsein der Öffentlichkeit auszulöschen und intern diffamierende Behauptungen gegen ihn auszustreuen.
Zunächst nahm man Kunze die Möglichkeit, in der DDR zu veröffentlichen. Selbst Übersetzungen konnte er nicht mehr publizieren. So zog etwa der Verlag Volk und Welt den Übersetzungsauftrag für einen Band mit Gedichten des Ungarn Guyula Illyés zurück mit einem ausdrücklichen Hinweis auf den mißliebigen Band Sensible Wege. Auch in Sammelwerken durfte sein Name nicht mehr auftauchen: 1970 erschien im Aufbau Verlag (Ost-Berlin und Weimar) die als repräsentativ angelegte Anthologie Lyrik der DDR – es fehlten darin die Gedichte Kunzes (wie übrigens auch die von Peter Huchel und Wolf Biermann).
Im Herbst 1970 druckte die Münchener Literaturzeitschrift Akzente vier neue Gedichte Kunzes, darunter dieses:
Nach dem ersten verlorengegangenen Brief im neuen Jahr
(für Heinz Piontek)
Wie das mißtrauen überfliegen?
Brieftauben?
Man würde den himmel mit netzen bespannen
Man würde den himmel mit leim bestreichen
Man würde die sonne löschen im meer
Für die sicherung der macht
auch ewige finsternis!
In diesem Gedicht reflektiert Kunze die betrübliche Erfahrung, daß im Briefverkehr zwischen West und Ost, Ost und West unverhältnismäßig viele Briefe verlorengehen, und er kommt zu der resignierenden Erkenntnis, daß Macht, die nur darauf bedacht ist, sich selbst zu sichern, selbst zu den absurdesten Mitteln greifen würde, um unerwünschte Kontakte zwischen den Menschen zu unterbinden.
Kurz nach der Veröffentlichung dieses Gedichts wurde Reiner Kunze vom Verlag Neues Leben (Ost-Berlin) mitgeteilt, seine Übertragungen von Gedichten des Ungarn Lászlo Nagy für ein Heft der Reihe Poesiealbum seien aus dem Manuskript entfernt worden; der Nachdichtervertrag sei „gegenstandslos“, weil das in den Akzenten veröffentlichte Gedicht zeige, daß Kunze nicht mehr mit den „kulturpolitischen Zielen“ des Verlages übereinstimme. Eine juristische Handhabe gegen diese Vertragsauflösung, die allein aus politischer Opportunität erfolgte, hatte Kunze nicht. Übersetzungen von ihm sind zwar dann noch im Westen erschienen – außer verschiedenen Beiträgen in Anthologien Einzelpublikationen mit Dichtungen der Tschechen Vladimir Holan und Antonin Brousek –; in der DDR dagegen durfte der früher dort gerühmte Nachdichter Kunze längere Zeit nicht mehr veröffentlichen.
In literarischen Nachschlagewerken, Zeitschriften, Dokumentationen, Jahrbüchern, Kalendern und Anthologien, die in der DDR erscheinen, wurde der Name Reiner Kunze systematisch ausgespart. Diese Art von Zensur führt zu geradezu grotesken Ergebnissen:
1965 hatte Volker Braun im Mitteldeutschen Verlag (Halle) den Lyrikband Provokation für mich veröffentlicht, in dem ein Gedicht mit dem Titel „R.“ enthalten war. Darin ist die Rede von einem Mann, der „kein Krieger, kein Lohnsklave, kein Konzernschreiber“ sei, „und doch kennt er Kampf und Not und Qual“. In den Anmerkungen hieß es: „R. ist meinem Freund Reiner Kunze, gebürtig zu Oelsnitz im Erzgebirge, gewidmet.“ Nun wollte Volker Braun dieses Gedicht – das übrigens auf dem Schutzumschlag von Kunzes Band Sensible Wege nachgedruckt wurde – auch in seinen bei Reclam (Leipzig) erschienenen Auswahlband Gedichte aufnehmen. Das für die Erteilung der Druckererlaubnis zuständige Gremium jedoch erhob Einspruch, weil das Gedicht an Reiner Kunze erinnere. Daraufhin änderte Braun den Titel von R. in das neutralere Einer; und in dieser Version ist der Text nun in dem 1972 erschienenen Bändchen zu lesen. Der Hinweis auf Reiner Kunze wurde gestrichen.
IV.
Reiner Kunze hat auf die verschiedenen Zensurmaßnahmen, denen er unterworfen wurde, nun nicht mit Resignation und Verbitterung reagiert, sich nicht in den kleinbürgerlichen Schmollwinkel der Innerlichkeit zurückgezogen, sondern in seinem Werk selbst diese Maßnahmen dargestellt und sie kritisch reflektiert – beispielsweise in dem Titelgedicht seines Buches Zimmerlautstärke (1968):
ZIMMERLAUTSTÄRKE
Dann die
zwölf jahre
durfte ich nicht publizieren sagt
der mann im radio
Ich denke an X
und beginne zu zählen
Freilich war es Kunze möglich, die Zensur wenigstens insoweit zu durchbrechen, als er seine Texte im Westen veröffentlichen und dann zurückwirken konnte in die DDR, wo seine Gedichte handschriftlich und maschinenschriftlich von interessierten Lesern vervielfältigt und weitergegeben werden. Allerdings wurde dann auch diese Möglichkeit stark eingeschränkt: zum einen – wovon noch zu reden sein wird – durch Pressionen der Behörden, zum andern aber auch von westdeutschen Verlagen. Inzwischen bemühen sich ja mehr und mehr Verlage und Redaktionen im Westen um eine sachliche Information über die DDR, und dabei kommt es dann gelegentlich neuerdings zu dem fatalen Faktum, daß man in der DDR mißliebige Autoren auch im Westen nicht drucken mag, um sich, nicht der Gefahr auszusetzen, einer antisozialistischen Propaganda Material zu liefern und Beifall von der falschen Seite zu bekommen. Darunter haben nun groteskerweise auch kritische Sozialisten zu leiden, Autoren, die gerade den möglichen Rang einer sozialistischen Literatur verdeutlichen können. (Daß einige Verlage womöglich auch die Veröffentlichung solcher Literatur aus einem Geschäftsinteresse scheuen könnten, also um nicht die ihnen von DDR-Verlagen gegebenen Lizenzen für andere auflagenstarke und gewinnbringende Bücher zu gefährden, ist eine Vermutung, für die einiges spricht.)
Die DDR-Behörden selbst hatten allerlei bürokratische Möglichkeiten, Reiner Kunze die Veröffentlichung im Westen zu erschweren. Ein DDR-Autor, der ein Manuskript außerhalb seines Landes publizieren will, muß dieses Manuskript zuvor einem Verlag oder einer Institution der DDR angeboten haben und außerdem eine Genehmigung vom Büro für Urheberrechte einholen. Erfüllt er diese Vorschriften nicht, kann er mit einer Ordnungsstrafe bis zur Höhe von 300 Mark belegt werden.
Nach der Veröffentlichung des Bandes Sensible Wege wurde Reiner Kunze zum erstenmal mit dieser Höchststrafe belegt: Zwar war die Veröffentlichung genehmigt worden, aber der Autor hatte das Manuskript noch nachträglich um acht neue, aktuelle Gedichte ergänzt. Das wurde ihm als ein Verstoß gegen die „sozialistische Gesetzlichkeit“ ausgelegt. Kunze wurde – und gegen die Entscheidung gibt es das Rechtsmittel des Einspruchs nicht – zur Höchststrafe verurteilt, ganz so, als ob er das gesamte Buchmanuskript nicht hätte genehmigen lassen. Diese Strafe traf ihn um so härter, als ihm in der DDR jede Möglichkeit, literarisch oder publizistisch zu arbeiten und damit Geld zu verdienen, genommen worden war.
Eine Zeitlang dann wurde Kunze für nahezu jede Veröffentlichung im Westen, selbst wenn es sich lediglich um einen kurzen Beitrag zu einer Anthologie handelte, mit der Höchststrafe von 300 Mark belegt – etwa für seine Prosa „Was ist aus Schneewittchens Stiefmutter geworden“ in der von Peter Härtling herausgegebenen Anthologie Leporello fällt aus der Rolle. Außerdem wurde seine Korrespondenz mit westdeutschen Verlagen behindert: Verträge, Korrekturfahnen werden erst mit wochenlanger Verzögerung zugestellt, Belegexemplare erreichen ihn nicht. Sein Kinderbuch Der Löwe Leopold etwa wurde vom Zoll beschlagnahmt, als es ihm der Verlag S. Fischer aus Frankfurt schickte. Von diesem Buch, dem 1971 in der Bundesrepublik der Deutsche Jugendbuchpreis zuerkannt wurde, hatte der Verlag dem Autor vier Belegexemplare geschickt. Auf Kunzes Beschwerde gegen ihre Beschlagnahme antwortete die Zollverwaltung der DDR in Ost-Berlin am 14. September 1970:
Entsprechend der Fünften Durchführungsverordnung zur Verordnung über den Geschenkpaket- und Päckchenverkehr vom 30.11.1961 ist die Einfuhr von Literatur u.a. nur zulässig, wenn der Inhalt nicht im Gegensatz zu den Interessen unseres sozialistischen Staates und seiner Bürger steht. Wir konnten uns davon überzeugen, daß das von Ihnen verfaßte Buch Der Löwe Leopold diesem Grundsatz nicht entspricht, so daß einer Einfuhr nicht zugestimmt werden konnte (…)
Es wundert bei dieser Lage der Dinge schon kaum mehr, daß man in der DDR das Echo, das Reiner Kunze im Westen und auch im westlichen Ausland fand, nur mit großem Unbehagen zur Kenntnis nahm und im eigenen Lande verschwieg. (Kunzes Gedichte waren in den USA, England und Frankreich in repräsentativen Zeitschriften und Anthologien erschienen.)
Ging es in vielen Gedichten des Bandes Sensible Wege, etwa in dem Zyklus der „einundzwanzig variationen über das thema ,die post‘“ um die Kontrolle von Briefen – dies ist geradezu ein Leitmotiv bei Kunze: der Brief als letzte Möglichkeit der Kommunikation mit der Welt –, so ging es später auch um die Kontrolle der Menschen, die zu ihm wollen. So plante ein Universitätsdozent aus einer westeuropäischen Hauptstadt eine Vorlesungsreihe über deutsche Gegenwartslyrik und äußerte in Ost-Berlin im Kulturministerium, er wolle gern einige Dichter aufsuchen, über die er lesen werde, beispielsweise Huchel, Biermann und Kunze. Daraufhin wurde ihm lapidar erklärt: Huchel sei senil und empfange keine Besuche; Biermann sei einfach schlecht; und Kunze sei ein pathologischer Fall. Man müsse ihm dringend abraten, diese Leute zu besuchen.
V.
Würde man versuchen, Reiner Kunze, nachdem er 1972 den Gedichtband Zimmerlautstärke im Westen veröffentlicht hatte, wieder als pathologischen Fall hinzustellen oder würde man merken, daß hier nicht ein verbitterter Querkopf spricht, kein – um mit Max Walter Schulz zu sprechen – „vergnatzter, bei aller Sensibilität aktionslüsterner“ Individualist sondern ein Mann, der vom Standpunkt sozialistischer Humanität aus Anspruch und Wirklichkeit in seinem Lande kritisch miteinander vergleicht? Man möchte Kunzes Widersacher in der DDR auffordern, doch einmal zu überdenken, was Martin Walser, wahrlich kein politisch rechts stehender Autor, im Mai 1972 in Frankfurt in einer Rede sagte, die in einer der DKP nahestehenden Zeitschrift abgedruckt wurde:
Man kann Literatur nicht in Dienst nehmen. Literatur ist von Anfang an Befreiungsenergie, als solche dient sie von selbst zum Herrschaftsabbau. Und noch ist nirgends eine Gesellschaft entstanden, wo diese Funktion überflüssig geworden wäre.
Eines der Gedichte Reiner Kunzes aus Zimmerlautstärke trägt den Titel „Gebildete Nation“ und spielt damit an auf den lange Zeit in der DDR propagierten kulturpolitischen Slogan „Auf dem Wege zur gebildeten Nation“:
GEBILDETE NATION
aaaaaaaaaaPeter Huchel verließ die
aaaaaaaaaaDeutsche Demokratische Republik
aaaaaaaaaa(nachricht aus Frankreich)
Er ging
Die zeitungen meldeten
keinen verlust
Der im Jahre 1903 geborene Peter Huchel, den das Leipziger Schriftstellerlexikon noch 1967 „in die erste Reihe der deutschen Lyriker des 20. Jahrhundert“ gestellt hatte und dessen Zeitschrift Sinn und Form unter seiner Leitung Weltniveau hatte, lebte jahrelang in geistiger und physischer Quarantäne in Wilhelmshorst bei Potsdam, als „Staatsfeind“ geächtet und überwacht. 1971 endlich hatte er, nach Intervention des PEN und durch die persönliche Initiative Heinrich Bölls, in den Westen ausreisen können. Der Weggang des mit Reiner Kunze befreundeten Dichters war von der Presse in der DDR weder gemeldet noch kommentiert worden. Der Name Peter Huchel wurde seit Jahren in der DDR totgeschwiegen – mit dem Erfolg, daß sein Werk unter Schülern und Studenten in der DDR nahezu unbekannt ist. Dieses skandalöse Faktum – daß es sich nämlich eine auf Bildung erpichte Nation leistet, einen ihrer bedeutendsten Schriftsteller zu verschweigen und seinen Weggang nicht zu diskutieren –, behandelt Kunze in seinem Gedicht, das in seiner Aussage unangreifbar und in seiner Konfrontation von Anspruch und Realität nicht zu widerlegen ist. Derartige Gedichte machen deutlich, daß die Dinge, die Kunze bedrücken, keine Ausflüsse privater Neurosen sind, sondern konkrete Realität. Die diffamierende Behauptung, Kunze sei ein überängstlicher Psychopath, wurde von interessierter Seite in der DDR verbreitet und ist bedauerlicherweise auch gelegentlich schon in der Bundesrepublik nachgeplappert worden. So wurde etwa am 26. September 1970 in der Frankfurter Rundschau unwidersprochen Max Walter Schulz mit seiner Behauptung zitiert, Kunze habe sich „als pathologischer Fall angstpsychologisch mit lyrischem und persönlichem Stacheldraht umgeben“. In Wirklichkeit aber trifft auch für Reiner Kunze zu, was Jean Améry so formulierte:
Ich weiß, was mich bedrängt, ist keine Neurose, sondern die genau reflektierte Realität […].
Hier noch ein weiteres Gedicht Reiner Kunzes von 1968, das zeigt, welche Wirklichkeit ihn bedrängt und von ihm reflektiert wird:
FAHRSCHÜLER FÜR LASTKRAFTWAGEN
(für J. P. W.)
Ich spiele es das
dreipedalige Klavier ihn den
dreitonnenflügel sie die
sechsregistrige orgel (jeder
ein solist an der kreuzung der’s kann, noch
lächelt der dirigent)
Ich spiele, leicht
blaß (nicht
leichenblaß frau, noch
verreckt nur der motor)
Der doch der
sich nicht findet in simplem viervierteltakt kann
unter die räder geraten
mit seinen gedanken
Ein requiem üb ich für sie und
werde gelobt für
richtiges einordnen
Es war nachweisbar unsinnig, das Bild eines verbitterten und psychopathischen Reiner Kunze zu lancieren. Kunze hatte die heiter-freundlichen Kindergeschichten des Löwen Leopold und das Kinderbuch Der Dichter und die Löwenzahnwiese veröffentlicht. Seine bitteren – nicht verbitterten! – Gedichte stehen also in einem biographisch-literarischen Kontext, dessen Tenor Freundlichkeit und Humor ist. Und übrigens finden sich auch in dem Band Zimmerlautstärke leichte, gelöste Gedichte, die durchaus keine Verbitterung zeigen.
Ferner: Verbitterung frustriert. Kunze aber hat in den zurückliegenden Jahren mehrere Bücher mit Lyrik und Übertragungen im Westen veröffentlicht, in westdeutschen Zeitschriften, Almanachen und Anthologien publiziert, hat Hunderte von Versen der Lyriker Illyés und Novomeský übersetzt; und er hat in der DDR auf zahlreichen Veranstaltungen vor Tausenden von Menschen, Studenten vor allem, gesprochen und aus seinen Arbeiten gelesen – freilich unter äußerst schwierigen Bedingungen für diejenigen, die Kunze einluden. All dies sprach für eine ungebrochene schöpferische Aktivität und strafte all jene Lügen, die das Märchen von dem verbittert und resigniert im thüringischen Greiz hockenden Dichter Reiner Kunze kolportierten.
VI.
Ein weiteres zentrales Thema neben der DDR-Wirklichkeit ist in Reiner Kunzes bislang letztem Gedichtband die Tschechoslowakei. Ein ganzer Zyklus unter dem Titel „wie die dinge aus ton“ ist ihr gewidmet.
Diesen Gedichten ist ein Zitat von Jean Améry vorangestellt:
Ohne das Gefühl der Zugehörigkeit zu den Bedrohten wäre ich ein sich selbst aufgebender Flüchtling vor der Wirklichkeit.
Die Bedrohten sind für Kunze all die Freunde in der ČSSR, die sich seit dem 21. August 1968, der Okkupation der Tschechoslowakei, immer stärkeren Repressionen unter dem Vorwand der Normalisierung ausgesetzt sehen. Kunzes Gedichte über die ČSSR sind nicht lyrische Argumentationen und Aggressionen eines Revisionisten, sondern Seismogramme der Erschütterung über das, was 1968 jenem Land angetan wurde, zu dem er besonders enge Beziehungen hat und dem er viel verdankt.
In den sechziger Jahren, als er in der DDR nur wenige Publikationsmöglichkeiten hatte, war Kunze ständiger Mitarbeiter tschechischer Zeitungen; viele seiner Gedichte erschienen zuerst auf tschechisch im Druck. Kunze war häufig Gast von Kongressen in der ČSSR, konnte in Heimen des tschechoslowakischen Schriftstellerverbandes zu Arbeits- und Erholungsaufenthalten sein und erhielt mehrmals medizinische Heilbehandlungen auf Kosten des ČSSR-Schriftstellerverbandes. 1965 wurde er mit einem hohen staatlichen Orden ausgezeichnet; und im Frühjahr 1968 erhielt er den Preis für Nachdichtungen des Tschechoslowakischen Schriftstellerverbandes. Zahlreiche Rundfunksendungen und abendfüllende Veranstaltungen im Theater der Poesie stellten Kunzes Werk dem Publikum in der ČSSR vor.
In Literárni Noviny, der Wochenzeitung des Tschechoslowakischen Schriftstellerverbandes, schrieb Milan Kundera 1964:
Böhmen ist für Kunze kein touristisches, sondern wirklich schicksalhaftes Erlebnis, das in der Mythologie seines Lebens Trost, Harmonie, Stärkung und Verständnis symbolisiert. Vor allem aber inspiriert die Tschechoslowakei Kunze zu eigenem Schaffen und bedeutet in seiner Entwicklung einen außerordentlichen Schritt nach vorn.
Kunze hat, mit Erfolg, versucht, das Vertrauen der Tschechen für die jüngere deutsche Generation zu gewinnen – durch die eigene Lyrik, durch Nachdichtungen von Lyrik, Dramen und Hörspielen. Seine Mittlerrolle ist oft anerkannt worden, nicht nur offiziell, sondern auch von den Lesern und Kritikern. Das hat sich niedergeschlagen etwa in Reiner Kunze gewidmeten Gedichten tschechischer Lyriker, auch in Rezensionen.
Reiner Kunze, einem subtilen Kenner der Verhältnisse, war es also möglich, die Entwicklung in der ČSSR zu verfolgen. In seinen Gedichten spricht er als unmittelbar Betroffener – als ein Deutscher aus der DDR, deren Panzer 1968 in das Land seiner Freunde einrückten, als einer, der mitgeholfen hat, ein Vertrauen aufzubauen, das dann so jäh zerstört wurde. Dies erklärt die Intensität der Reflexion der Ereignisse im Jahre 1968 in Kunzes Dichtung, erklärt die Tiefe der Emotion. Das Gedicht „wie die dinge aus ton“ beispielsweise spricht davon, wie der Glaube und das Vertrauen einer ganzen Generation endgültig zerbrochen worden sind:
WIE DIE DINGE AUS TON
Aber ich klebe meine hälften zusammen
wie ein zerschlagener topf aus ton.
(Jan Skácel, brief vom februar 1970)
1
Wir wollten sein wie die dinge aus ton
Dasein für jene,
die morgens um fünf ihren kaffee trinken
in der küche
Zu den einfachen tischen gehören
Wir wollten sein wie die dinge aus ton, gemacht
aus erde vom acker
Auch, daß niemand mit uns töten kann
Wir wollten sein wie die dinge aus ton
Inmitten
aaaaaaasoviel
aaaaaaaaaaaarollenden
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaastahls
2
Wir werden sein wie die scherben
der dinge aus ton: nie mehr
ein ganzes, vielleicht
ein aufleuchten
im wind
VII.
Schließlich noch zu einem weiteren Themenkomplex in der jüngeren Lyrik Reiner Kunzes: der Sowjetunion und dem Schicksal des damals noch in der UdSSR lebenden Schriftstellers Alexander Solschenizyn. Ihm gilt das Gedicht „8. Oktober 1970“, das sich bezieht auf das Datum, an dem Solschenizyn der Nobelpreis für Literatur zuerkannt wurde.
8. OKTOBER 1970
(verleihung des Nobelpreises an
Alexander Solschenizyn)
Ein tag durchsichtig bis
Rjasan
Nicht verbannbar nach Sibirien
Die zensur kann ihn
nicht streichen
(In der ecke glänzt
das gesprungene böhmische glas)
Ein tag der die finsternis
lichtet
Der ans mögliche erinnert:
Immer wieder einen morgen
auf sein gewissen nehmen
In der DDR ist das Werk Alexander Solschenizyns niemals publiziert worden, und als dem russischen Romancier der Nobelpreis zuerkannt wurde, da verstand man das in der DDR nicht als eine hohe Auszeichnung für die sozialistische Literatur der Sowjetunion. Am 29. Oktober 1970 veröffentlichte das Neue Deutschland eine Erklärung des DDR-Schriftstellerverbandes, in der es heißt:
Wenn Wir unseren guten Willen sehr bemühen, können wir die diesjährige Entscheidung der Schwedischen Akademie einen groben Irrtum nennen; was dann immer noch bleibt, ist die Wirkung ihres Schrittes: Er hat einer weitgespannten antisowjetischen und antisozialistischen Kampagne Vorschub gegeben; der Entspannung – und damit auch der Literatur, denn die eine gedeiht durch die andere – wurde ein übler Dienst erwiesen.
Zu dieser Stellungnahme des Schriftstellerverbandes sagte Reiner Kunze damals in einem Gespräch:
Wenn Literatur durch Entspannung und Entspannung durch Literatur gedeiht, und ich wende mich gegen die Entscheidung, durch die humanistische Literatur geehrt wird, kann nur ich es sein, der der Entspannung und der Literatur einen üblen Dienst erweist… Und „weitgespannte antisowjetische und antisozialistische Kampagne“? Dagegen wüßte ich ein besseres Mittel, als Solschenizyn den Nobelpreis nicht zu verleihen. Ich würde seine Werke drucken. Allerdings nicht aus diesem Grund. Sondern der Wahrheit wegen. Denn Entspannung gibt es nicht ohne Wahrheit. Ohne Wahrheit gibt es höchstens Schein-Entspannung. Und Schein-Literatur.
Im Zusammenhang mit der Nobelpreis-Verleihung an Solschenizyn hatte es am 19. Oktober im Neuen Deutschland geheißen:
Die Grundlagen des Sozialismus sind so fest, daß sie weit ernstere ideologische und nicht nur ideologische Diversionsakte, die gegen die Sowjetunion gerichtet waren, nicht erschüttern konnten.
Dazu sagte Kunze:
Laut Neues Deutschland ist kein Grund zur Sorge um die Existenz der Grundlagen des Sozialismus gegeben. Daß Grund zur Sorge um Alexander Solschenizyn gegeben sein könnte, weil ein Mensch im Laufe seines Lebens nur bis zu einer bestimmten Grenze physisch und psychisch belastbar ist, liegt offenbar weder im Blickfeld des Neuen Deutschland noch im Blickfeld der Schriftsteller, die für diese Stellungnahme verantwortlich sind.
In der Nobelpreis-Verleihung an Solschenizyn – und davon spricht u.a. sein Gedicht „8. Oktober 1970“ sieht Reiner Kunze ein Ereignis, das „die finsternis lichtet“, das hilft, die Wahrheit über Solschenizyn und seinesgleichen sichtbar zu machen und damit die Barrieren einer sonst allmächtigen Zensur zu überwinden. Diese Preisverleihung signalisiert für Reiner Kunze eine Hoffnung – die Hoffnung, daß eine unheilvolle Vergangenheit bewältigt wird und es auch keine Zukunft mehr gibt für diese Vergangenheit, von der Kunze in seinem als Gespräch mit der Tochter angelegten Gedicht „nach der geschichtsstunde“ (1969) spricht:
NACH DER GESCHICHTSSTUNDE
Die damals, der
Tamerlan war der
grausam: zehntausende seiner gefangenen ließ er
binden an pfähle, mit mörtel und lehm
übergießen lebendig
vermauern
Tochter·, die teilweise ausgrabung
jüngster fundamente
wird bereits
bereut
In einer der drei kurzen Nachbemerkungen zu seinem Gedichtband Zimmerlautstärke nennt Reiner Kunze das Gedicht einen „stabilisator“, einen „orientierungspunkt des ich“, das Gedicht ist für ihn ein „akt der gewinnung von freiheitsgraden nach innen und außen“. Und er bezieht sich damit auf ein Zitat von Alexander und Margarete Mitscherlich, die schreiben, daß es „nicht leicht ist, Anweisungen des Kollektivs zu widerstehen, die bald Strafdrohungen sind, bald primitive Triebbefriedigungen enthemmen“:
Hier in kritischer Distanz zu bleiben setzt Kaltblütigkeit, also einen hohen Grad stabiler Ich-Organisation voraus; noch schwerer ist es, die durch Kritik gewonnenen Einsichten dann auch als Richtlinien des Verhaltens beizubehalten.
Und zu seiner Bemerkung, daß Gedichte ebenso mißbrauchbar seien wie die Macht mißbrauchbar ist, zitiert Reiner Kunze Heinrich Böll:
Es gibt Künstler, Meister, die zu bloßen Routiniers geworden sind, aber sie haben – ohne es sich und den anderen einzugestehen – aufgehört, Künstler zu sein. Man hört nicht dadurch, daß man etwas Schlechtes macht, auf, ein Künstler zu sein, sondern in dem Augenblick, in dem man anfängt, alle Risiken zu scheuen.
Reiner Kunze gehört nicht zu den Künstlern, die das Risiko scheuen. Mit seinem Werk und mit seiner Existenz steht er ein für seine Überzeugungen und Erkenntnisse. Seinem Gedichtband Zimmerlautstärke hat er ein Wort von Seneca vorangestellt:
(…) bleibe auf deinem Posten und hilf durch deinen Zuruf; und wenn man dir die Kehle zudrückt, bleibe auf deinem Posten und hilf durch dein Schweigen.
VIII.
In den ersten Jahren seit dem Erscheinen des Bandes Zimmerlautstärke schien es so, als trete in der DDR eine kulturpolitische Klimaverbesserung ein, von der auch Reiner Kunze profitierte.
Immerhin konnte er im Juli 1973 nach München reisen, um dort den Literaturpreis der Bayerischen Akademie der Schönen Künste entgegenzunehmen. Und im Herbst desselben Jahres konnte er dann, im Leipziger Reclam Verlag, nach fünfjährigem erzwungenen Schweigen, erstmals wieder in der DDR eine Auswahl seiner Gedichte unter dem Titel Brief mit blauem Siegel publizieren. Der Band, der in einer Auflage von 15.000 Exemplaren erschien, war schon wenige Tage nach Erscheinen vergriffen. Allerdings wurde er in den Zeitungen und Zeitschriften der DDR kaum rezensiert. Auch zum VII. DDR-Schriftstellerkongreß im November 1973 in Ost-Berlin wurde Kunze nicht delegiert. Den Preis, den ihm im schwedischen Mölle die Zweite Internationale Schriftstellerkonferenz zuerkannt hatte, durfte er nicht in Schweden in Empfang nehmen; Jahre später wurde er ihm in der schwedischen Botschaft in Ost-Berlin ausgehändigt. Reiner Kunze hat dann noch einige Male in den Westen reisen können, u.a. nach England und Holland. Andere Reisen wiederum wurden ihm verboten, so daß er etwa die Mitgliedschaft der Bayerischen Akademie im Juli 1974 nicht in München annehmen durfte; sie wurde ihm einige Monate später in der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland in Ost-Berlin verliehen.
Im März 1974 hatte Reiner Kunze während der Leipziger Messe, erstmals wieder seit fünfzehn Jahren, in einer halb-öffentlichen Veranstaltung aus seinen Werken lesen können. Nach der Messe gab er dem Hessischen Rundfunk ein Interview. Dabei wich er auch der heiklen Frage nach Wolf Biermann nicht aus und sagte abschließend zu der vom Interviewer geäußerten Hoffnung, „daß Ihr Eintreten für Biermann richtig verstanden wird, so daß das Erscheinen der 2. Auflage Ihres Buches Brief mit blauem Siegel dadurch nicht gefährdet ist“:
Wenn sie nur unter der Voraussetzung möglich wäre, daß ich mich auf einem Auge blind stelle, würden auch vielleicht die Leser, auf die es mir ankommt, das Buch lieber abschreiben, als es in dem Bewußtsein käuflich zu erwerben, daß sein Autor käuflich ist.
IX.
Überraschend für die Öffentlichkeit legte Reiner Kunze Ende August 1976 im Frankfurter Verlag S. Fischer den Prosaband Die wunderbaren Jahre vor. Niemand bedauerte es mehr als Kunze, daß dieses Buch, an dem er mehrere Jahre gearbeitet hatte, nicht in einem Verlag der DDR erscheinen konnte, zumal es ein Buch über die DDR ist und die Leser dort ganz unmittelbar angeht. Doch die Konzessionen, die man drüben von Kunze gefordert hat – man verlangte von ihm, zur Lage seiner bedrängten Kollegen und Freunde in der Tschechoslowakei zu schweigen und sich auch im ,Fall Biermann‘ nicht zu äußern –, schienen ihm nicht vertretbar zu sein. „Für mich gibt es in der Kunst, im Kunstwerk, keine Kompromisse“, hatte er 1973 in München bei der Entgegennahme des Literaturpreises der Bayerischen Akademie der Schönen Künste gesagt, und dieser Maxime ist er weiter treu geblieben.
Der Titel des Buches ist Truman Capotes Grasharfe entlehnt, wo es heißt:
Ich war elf, und später wurde ich sechzehn. Verdienste erwarb ich mir keine, aber das waren die wunderbaren Jahre.
Allerdings verkehrt sich das Zitat in bittere Ironie in dieser Prosa, die Christa Wolfs Devise folgt, derzufolge erzählen heißt „wahrheitsgetreu zu erfinden auf Grund eigener Erfahrung“. In alle Texte des Buches ist Wirklichkeit eingegangen, und doch ist dies kein Stück Dokumentarliteratur im engeren Sinne: das Dokumentarische wurde weitgehend eliminiert, alle Vorkommnisse sind auf ihre Strukturen und auf Allgemeingültiges reduziert worden. Denn Kunze zeigt nicht das Extrem, sondern das System.
Das Buch, komponiert aus kurzen, selbständigen Einzelstücken, setzt ein mit einigen Texten, die unter dem Titel „Friedenskinder“ zusammengefaßt sind. Dies sind gleichsam in literarischen Blitzlichtaufnahmen Beispiele für die in der DDR vom Kindergartenalter an forcierte Militarisierung der Jugend, für die systematische Erziehung zum Haß auf den Klassenfeind und für eine erschreckende Deformation von Kindern, denen Schießen und Töten als selbstverständliche Pflicht im Klassenkampf anerzogen wird.
Die Wirklichkeit der Jugend in der DDR – dies ist ein Hauptthema des Prosabandes, so wie es früher ein zentrales Thema der Gedichte Kunzes war.
Gerade in der Schule herrscht Psycho-Terror, der sich gegen jene richtet, die nicht-konforme Meinungen zu äußern wagen. Ein ausgeklügeltes Spitzelsystem in den Klassen unterdrückt jede Regung der Kritik, es dominiert die Strammsteh-Mentalität, Drill geht vor Denken. Da gibt es den Bericht eines Jungen, der mit Biermann und Havemann Kontakt hatte und der nun von einem jungen Mädchen ausspioniert wird, die ihrerseits zur Arbeit für die „Firma“, den Staatssicherheitsdienst, gepreßt worden ist. Oder da ist die Geschichte eines Jungen, der im Lehrlingsheim eine Bibel auf seinem Bücherbrett hatte, deswegen als „unsicheres Element“ gilt und nun während der Weltfestspiele in Berlin von den Behörden schikaniert wird, die auf jede Weise verhindern wollen, daß der Lehrling die Hauptstadt betritt. Dabei ergeben sich geradezu kafkaeske Situationen in einer Welt, in der jeder Schritt von Polizeiorganen überwacht wird. Wie wenig die offizielle Darstellung vom Leben der jungen Leute mit der Wirklichkeit übereinstimmt, zeigt in nuce ein kleines Originalzitat, das Kunze einem seiner Texte vorangestellt hat:
Hier wird nicht gespielt! Eure Zeit ist vorbei, geht nach Hause! sagte eine Polizeistreife zu Jugendlichen, die am 8.August 1973, drei Tage nach dem Abschluß der Weltfestspiele, auf dem Alexanderplatz in Berlin Gitarre spielten.
Reiner Kunze schreibt – darauf sollte allerdings deutlich hingewiesen werden – nicht als einer, der politische Propaganda und Opposition um der Opposition willen treibt. Ihn bewegt die Sorge um Menschen, denen ihre Verachtung von Halbheiten und faulen Kompromissen systematisch ausgetrieben wird, denen man ein verzerrtes Weltbild vermittelt und die damit in Resignation und Verbitterung getrieben werden. Seine Befürchtung ist wohl, daß da eine Generation herangezogen wird, die unfähig zu kritischem Denken und Entscheiden und deswegen mißbrauchbar ist. Politisch sind diese Texte nur insofern, als das Leben dieser Jugendlichen politisch bestimmt ist; ihr Thema sind nicht politische Ideen und Überzeugungen, ihr Thema ist die menschliche Existenz unter den heutigen Bedingungen in der DDR. Worum es Reiner Kunze geht, kommt in den von ihm zitierten Worten Goethes zum Ausdruck, der zu Eckermann über die jungen Engländer und die jungen Deutschen sagte:
Das Glück der persönlichen Freiheit, das Bewußtsein des englischen Namens und welche Bedeutung ihm bei anderen Nationen beiwohnt, kommt schon den Kindern zugute, so daß sie sowohl in der Familie als in den Unterrichtsanstalten mit weit größerer Achtung behandelt werden und eine weit glücklich-freiere Entwicklung genießen als bei uns Deutschen […]. Es geht bei uns alles dahin, die liebe Jugend frühzeitig zahm zu machen und alle Natur, alle Originalität und alle Wildheit auszutreiben, so daß am Ende nichts übrig bleibt als der Philister.
Der Prosaband Die wunderbaren Jahre von Reiner Kunze ist ein Mosaik aus Einzeltexten, die selten mehr als eine oder zwei Seiten umfassen. Neben Mischformen, die nur schwer einem bestimmten literarischen Genre zuzuordnen sind, finden sich da das Prosagedicht neben dem Prosapoem, Kurzszenen neben stichwortartigen Rapporten, Flugblättern, Erzählungen, Kurzgeschichten, Dialogen. Die Texte sind atmosphärisch außerordentlich dicht, gelegentlich auf eine überraschende Pointe hin gearbeitet; die Sprache ist einfach, klar und präzise, eher karg als weitschweifig, auf Ausschmückungen wurde völlig verzichtet. So unterstreicht auch die Struktur der Texte den quasi-dokumentarischen und exemplarischen Charakter dieses Buches und vermittelt den Eindruck der Authentizität.
Das so oft mißbrauchte und inzwischen beinahe verschlissene Wort ,Solidarität‘ hat für Kunze einen hohen Wert. Und Solidarität heißt für ihn Solidarität mit den Verfolgten und Bedrängten, mit dem Volk und den Schriftstellern der Tschechoslowakei. So hat er an den Schluß seines Buches unter dem Titel „Café Slavia“ Texte gesetzt, in denen er die Lage in der ČSSR 1968, nach der Okkupation des Landes durch die Truppen des Warschauer Paktes, und 1975, sieben Jahre nach der gewaltsam erzwungenen ,Normalisierung‘ darstellt und reflektiert.
Wenn Kunze hier zeigt, mit welcher Reserve man in Prag Vertretern eines Landes begegnet, die an der Gewalttat von 1968 beteiligt waren, so spricht aus seinen Worten die bis heute andauernde Betroffenheit eines Mannes, der sich ganz und gar mit den Tschechen identifiziert hatte. Kunze spricht als ein Deutscher aus der DDR, deren Panzer in das Land seiner Freunde, in die Heimat seiner Frau einrückten; als einer, der mitgeholfen hatte, Vertrauen zwischen Deutschen und Tschechen aufzubauen, das dann so jäh zerstört worden ist.
Der Blick auf Prag im Jahre 1975 zeigt, welchen Schaden sich ein Land durch Berufsverbote für hochqualifizierte Wissenschaftler und durch den Boykott gegen kritische Intellektuelle und Schriftsteller selbst zufügt. Und er zeigt den Zusammenhalt der Unterdrückten, die sich auch durch Druck und Bespitzelung nicht gefügig machen lassen. In seinem mutigen und wahrhaftigen Buch, das frei ist von aller Schönfärberei, plädiert Reiner Kunze für den Einzelnen und dafür, „daß wir […] unser kostbares Gut, die jungen Menschen, überhaupt unsere Menschen, vor den Beschädigungen des gesellschaftlichen Apparates schützen“, wie Arnold Zweig 1954 in Dresden sagte, wobei er fortfuhr:
Es muß also, glaube ich, … eine Warnung ausgesprochen werden vor der zu großen Inanspruchnahme des einzelnen und vor dem Ausradieren der Freiheit, der Muße im Zusammenleben unserer Landsleute… Humanismus und stramme Organisation haben sich immer widersprochen.
X.
Etwa zwei Monate nach der Veröffentlichung des Buches Die wunderbaren Jahre erschien am 30./31. Oktober 1976 im Neuen Deutschland eine unscheinbare Meldung:
Weimar (ND). Die Mitglieder des Bezirksverbandes Erfurt/Gera des Schriftstellerverbandes der DDR konnten bei ihrer Wahlberichtsversammlung am Freitag auf zahlreiche neue literarische Arbeiten verweisen, die sie in den zurückliegenden drei Jahren veröffentlichten und die bei den Lesern lebhafte Aufnahme fanden. Es gelte auch weiterhin, so hob der Vorsitzende des Bezirksvorstandes, Harry Thürk, hervor, den Erbauern des Sozialismus einen Ehrenplatz in der Literatur unseres Landes einzuräumen. Entschieden wandten sich die 38 Mitglieder und acht Kandidaten des Bezirksverbandes gegen Versuche von Vertretern der imperialistischen Ideologie, den Sozialismus in der DDR zu verleumden. In seinem Schlußwort bezeichnete der 1. Sekretär des Schriftstellerverbandes der DDR, Gerhard Henniger, die Weimarer Wahlberichtsversammlung als beispielhaft für den schöpferischen Geist, mit dem die Schriftsteller die vom IX. Parteitag der SED gestellten Aufgaben in Angriff nehmen.
Eine Woche später folgte, wiederum im Neuen Deutschland, der Klartext:
Berlin (ADN). Das Präsidium des Schriftstellerverbandes der DDR bestätigte in seiner Sitzung am 3. November 1976 den Beschluß der Mitgliederversammlung des Bezirksvorstandes Erfurt/Gera vom 29. Oktober 1976, Reiner Kunze wegen mehrfachen gröblichen Verstoßes gegen das Statut des Verbandes aus dem Schriftstellerverband der DDR auszuschließen.
Im Westen protestierten zahlreiche Personen und Institutionen gegen dieses Berufsverbot für Reiner Kunze. Von den DDR-Autoren solidarisierten sich öffentlich mit ihm Jurek Becker und Wolf Biermann (der dann kurz nach seinem Auftritt in Köln am 16. November 1976 aus der DDR ausgebürgert wurde); Bernd Jentzsch, der aus der Schweiz einen Offenen Brief an Erich Honecker schrieb (und der daraufhin nicht nach Ost-Berlin zurückkehren konnte); und Robert Havemann, der im Westen folgende Erklärung veröffentlichen ließ:
Es gibt keinen Fall Reiner Kunze. Es gibt nur den Fall des Schriftstellerverbandes der DDR. Es ist nicht einmal ein Kniefall vor der Obrigkeit. Es ist ein Fall, mit dem wir nicht mehr rechneten. Es gibt eine ganze Reihe von bedeutenden Autoren, die Mitglieder des Verbandes sind – noch sind. Ich denke, sie sollten ernsthaft erwägen, ob sie weiterhin Mitglieder bleiben können, ohne sich der Gefahr auszusetzen, daß ihr Schweigen das allgemeine Mundtotmachen erst ermöglichen wird. Lao Tse sagte: Man muß auf die Dinge einwirken, die noch nicht da sind. Gehört Solidarität zu diesen Dingen? Ich frage, um wen es hier geht. Nicht um Reiner Kunze. Es geht um Euch, um uns, um alle, die das Schreiben für eine Sache halten, die allein zeigen kann, wie wir überleben können. Ich hatte Gespräche mit einigen angesehenen guten Schriftstellern der DDR, die entschlossen sind, gegen Kunzes Ausschluß zu protestieren. Ich will ihre Namen nicht nennen. Aber in ihren Händen liegt jetzt entscheidende Verantwortung für die Freiheit des Denkens in der Deutschen Demokratischen Republik.
Im Februar 1977 konnte Reiner Kunze überraschend nach Salzburg reisen, um den ihm verliehenen Georg-Trakl-Preis entgegenzunehmen, und er durfte in Wien lesen. Einen Monat später, während der Buchmesse im März 1977, sagte er mir in einem Interview in Leipzig:
Wenn bestimmte Kräfte, die in der DDR in der Überzahl sind, die Übermacht gewinnen, blüht uns eine Eisblume, hinter der einige von uns erfrieren werden. Ich habe in Österreich versucht, dagegenzuhauchen.
Wiederum einen Monat später, am 13. April 1977, verließ Reiner Kunze mit seiner Familie die DDR und kam in die Bundesrepublik. Daß Kunze, wie gemeldet wurde, ,freiwillig‘ die DDR verließ, ist nur bedingt richtig. Gewiß, Kunze hatte einen Ausreiseantrag für sich und seine Familie gestellt, der dann innerhalb von drei Tagen vom DDR-Staatsrat genehmigt worden war. Aber kann man von einem freiwilligen Weggang sprechen, wenn man einen Autor viele Jahre lang schikaniert, seine Familie drangsaliert, seine Freunde bedroht und ihm selbst schließlich mit dem Ausschluß aus dem Schriftstellerverband Berufsverbot erteilt hat?
In den Wochen und Monaten vor der Ausreise hatten sich die Angriffe auf Reiner Kunze in der DDR zu einer wahren Hetzkampagne gesteigert, bei der sich auch namhafte Schriftsteller unrühmlich hervortaten. Kunze hatte nur die Möglichkeit, in der westlichen Presse auf solche Attacken und Verleumdungen zu reagieren, was ihm dann wiederum als Verrat angelastet wurde. Nun zog er selbst den Schlußstrich und kehrte dem Staat den Rücken, von dem er lange geglaubt hatte, er sei durch solidarische Kritik zu verbessern.
Der Entschluß, sich von seiner thüringischen Heimat und von den zahlreichen Freunden zu trennen, die in ihm ein Symbol der Hoffnung gesehen hatten, ist Reiner Kunze sehr schwergefallen. Sein Abschied besiegelt das Scheitern der Hoffnung auf Freiheit, Menschlichkeit und Redlichkeit in der DDR, das Scheitern der Hoffnung auch auf eine liberale, verständige Kulturpolitik, wie sie Erich Honecker den Künstlern und Schriftstellern einst versprochen hatte.
Reiner Kunze lebt nun seit knapp zwei Jahren in der Bundesrepublik.
Im Juni 1977 wurde ihm in Düsseldorf, zusammen mit der Lyrikerin Rose Ausländer, der Andreas-Gryphius-Preis verliehen; und im Oktober 1977 erhielt er in Darmstadt die wichtigste literarische Auszeichnung, den Büchner-Preis. Aus diesem Anlaß fragte ich Kunze in einem Interview:
Auf seinem Weg in die Emigration hat Georg Büchner geschrieben: „Ich habe mich seit einem halben Jahr vollkommen überzeugt, daß nichts zu tun ist und daß jeder, der im Augenblick sich aufopfert, seine Haut wie ein Narr zu Markte trägt.“ Seit einem halben Jahr leben Sie, Reiner Kunze, nun in der Bundesrepublik. Was ist nach Ihrer Meinung für Sie hier zu tun? Und was sagen Sie zu denjenigen Ihrer Kollegen, die drüben ihre Haut zu Markte tragen?
Kunze antwortete: „Um sagen zu können, was für mich hier zu tun sein wird, ist es noch zu früh. Und zum zweiten Teil Ihrer Frage: Eines Tages, als in der Reparaturgrube meiner Garage Wasser stand, sagte eine hereinblickende Bäuerin: „Wasser hat einen kleinen Kopf, das kommt überall durch.“ Geist auch. Der Kopf, dem er entspringt, aber nicht. Dessen sollte sich jeder, der wirken will, bewußt sein. Und er sollte sich noch eines vor Augen halten: In Dantons Tod sagt Danton, als er gewarnt wird: „… sie werden’s nicht wagen.“ Die Geschichte hat ihn widerlegt. Büchner erhebt diese Widerlegung ins Exemplarische, und die Geschichte hat ihn darin bestätigt.
Reiner Kunzes oft doch sehr leise, verhaltene Gedichte, die man kaum aggressiv wird nennen können, haben schon früh immer wieder heftige politische Angriffe ausgelöst. Andererseits aber wird gelegentlich gesagt und geschrieben, Kunze sei eigentlich ein unpolitischer Autor. Lassen Sie mich zum Schluß zitieren, was Reiner Kunze mir dazu am 17. Mai 1977 in einem Fernseh-Interview gesagt hat:
Ich schreibe, weil ich schreibend am intensivsten lebe, und weil ich so vielleicht einigen wenigen Menschen helfen kann, intensiver zu leben, was wiederum für meine eigene Lebensintensität wichtig ist. Ich schreibe, um einem freudigen Moment vielleicht für eine kurze Spanne Dauer zu geben, oder um innere Not zu wenden. Das Schreiben ist für mich also eine innere Notwendigkeit. Der Grund zu schreiben, dieser Urgrund diese Urmotivation, ist also keine primär politische, sondern eine rein existentielle Motivation. Das ist das eine. Das andere: Dichtung ist nie Illustration vorgegebener Ideen, ist nie ein Ins-Bild-Setzen von vorgegebenen Meinungen, von Ideologien, sondern Dichtung ist immer – und ich betone immer, sonst ist es eben keine Dichtung – Selbstentdeckung, die uns etwas über das menschliche Leben aussagt. Das ist das andere. Aber wenn ich etwas über das menschliche Leben aussage, wenn ich etwas aufdecke, was in uns ist, was im Menschen ist, dann decke ich natürlich auch indirekt die Umstände auf, unter denen wir leben, unter denen der Mensch lebt, unter denen sich das menschliche Leben in einer bestimmten Zeit entwickelt. Und damit decke ich natürlich auch politische Umstände auf. Und außerdem kann es geschehen, daß solche Entdeckungen, die über das menschliche Leben aussagen, eine Ideologie in Frage stellen, einer Ideologie widersprechen. Aber das steht nicht in der Macht des Autors, des Dichters, sondern es liegt einfach an der Diskrepanz zwischen den Vorstellungen, die zum einen die Ideologie vermittelt und zum anderen die Realität selbst. Der Autor muß nur den Kopf dafür hinhalten, und insofern gibt es keine unpolitische Dichtung und keinen unpolitischen Autor.
Jürgen P. Wallmann, in Lothar Jordan, Axel Marquardt, Winfried Woesler (Hrsg.): Lyrik – Von allen Seiten. Gedichte und Aufsätze des ersten Lyrikertreffens in Münster, S. Fischer Verlag, 1981
Darf ein Schriftsteller vernünftig werden wollen?
– Verleihung des Georg-Büchner-Preises am 21. Oktober 1977 in Darmstadt. –
Vor zwanzig Jahren, ich war damals wissenschaftlicher Assistent, ließ mich mein Chef zu sich rufen und sagte: „So, Sie schreiben Gedichte!“ Er hatte sie gedruckt vor sich liegen. Und nach einer Pause, die ich als sehr lang in Erinnerung habe, sagte er: „Naja, auch Sie werden noch vernünftig werden.“ Damit war ich wieder entlassen.
Als ich über die heute hier zu haltende Rede nachzudenken begann, wurde mir bewußt, daß bei jener Audienz erstmals ein Leitmotiv erklungen war – noch unter Ausschluß der Öffentlichkeit, piano, ein Solo für Posaune. Die Staatsorchester sollten folgen. Vernünftig werden. Im Selbstverständnis meines damals wie heute verehrten Chefs hatte das geheißen: Nur die Gedichte nicht schreiben, die ich schrieb.
Mangelte es mir an Willen zur Einsicht? Ich war so willig gewesen einzusehen, daß ich mich dabei – wie ich später mit Entsetzen begriff – nicht einmal der eigenen Augen bedient hatte.
Woran also hatte es gelegen?
Die Stadt unter Ihnen ist plötzlich ein Fisch. Jeder Dachschiefer, rauhreifbedeckt, ist eine Schuppe. Der Schloßberg ist der Kopf, die Tunneleinfahrt das linke Auge. Sie haben sich nicht vorgenommen, die Stadt als Fisch zu sehen. Ihr Unterbewußtsein hat die Realität Stadt und die Realität Fisch miteinander verknüpft und die Verknüpfung dem Bewußtsein signalisiert. Noch nie sahen Sie die Stadt als Fisch. Und wie oft sind Sie diesen Weg zu Ihrer Wohnung schon gegangen. – Dieses diffuse Licht – wie durch eine Eisdecke… Lautlos, die Stadt. Der Fisch. Der Fisch im Winter: Reglos. Scheinbar. – Ihr Unterbewußtsein ist besser, als Sie denken. Als Sie denken. Über Ähnlichkeiten der äußeren Erscheinung führt es Sie hin zu Wesenszusammenhängen zwischen dieser Stadt in der Tiefe und dem Fisch in der Tiefe. Zumindest beginnen Sie sie zu ahnen.
Sie stehen – ob Sie wollen oder nicht – am Beginn eines Prozesses, an dessen Ende Ihr Gedicht steht:
DEZEMBER
Stadt, fisch, reglos
stehst du in der tiefe
Zugefroren
der himmel über uns
– – –
Überwintern, das
maul am grund
Maul am Grund. Das Maul halten, sagen die Leute. Und: Grund ist nicht nur der Erd-Grund. Grund bedeutet auch: Antwort auf das Warum, Ursache. Das Maul am Grund. (Dieses Gedicht entstand 1966. Anderthalb Jahre später, hundert Kilometer südlich dieser Stadt, offenbarte ein kurzer gesellschaftlicher Frühling, welche Lippenfühlung ein Volk, das fünfzehn Jahre überwinterte, mit dem Grund – der Erde und den Gründen – haben kann.)
Man wird Ihnen entgegenhalten: Von dem Einfall, die Stadt als einen in der Tiefe stehenden Fisch zu sehen, werden Sie gestellt. Dann aber müssen Sie sich dem Einfall stellen. Der Prozeß, ihn solange Sprache werden zu lassen, bis er in den drei Wörtern „maul am grund“ aufgeht, unterliegt ihrem Willen.
Was an diesem Prozeß unterliegt Ihrem Willen?
Sie werden die Bild-Inspiration abklopfen, wie Geigenbauer früher das Holz abgeklopft haben, bevor es gefällt wurde. Entscheiden werden die Qualität des Holzes und die Qualifikation Ihres Gehörs.
Der Bildeinfall wird sich mit dem auffüllen, was in Ihnen auf ihn hingearbeitet hat: mit Erlebtem, das Sie anders nicht bewältigen konnten. Es wird sich in dem Bild ausformen, und Sie werden dabei eine Haltung zu dem Erlebten gewinnen (Überwintern, das / maul am grund). Sollten Sie sich von einem Bildeinfall abwenden, weil Sie seine entdeckerische Potenz nicht erkannt haben, wird sich dieser Prozeß auch gegen Ihren Willen vollziehen, und das Bild wird sich wieder und wieder in Ihr Bewußtsein drängen.
Das Gedicht ist für Sie kein Luxus.
Das dichterische Bild, die originäre Verknüpfung weit auseinanderliegender Realitäten, die scheinbar paradox ist (Stadt/Fisch), die aber über die Brücke äußerer Ähnlichkeiten zur Entdeckung einer Wahrheit über eine der Realitäten führt, ist die Ihnen einzig gemäße Art, sich bestimmte Bereiche der Wirklichkeit anzueignen.
Ein Schriftsteller kann nicht vernünftiger werden, als er dabei Schriftsteller sein kann.
Fünfzehn Jahre nach der Audienz bei meinem Chef, der lediglich der Meinung gewesen war, Gedichte seien ein Ausdruck von Infantilität, sagte mir ein Herr in Berlin, eine Mappe mit Rezensionen aus westdeutschen Zeitungen vor sich: „In den Kritiken steht, daß das, was Sie machen, Literatur ist. Einverstanden. Wenn dem aber so ist, dann können wir zwanzig Jahre ohne Literatur leben. Und dann können wir auch vierzig Jahre ohne Literatur leben.“ Er gehörte zu jenen Machtausübenden, die die Literatur ausklammern, weil andere sich an sie klammern, ein großer Teil derer nämlich, über die jene Macht ausüben.
Darf ein Schriftsteller überhaupt vernünftig werden wollen?
Auch für manchen Leser ist das Gedicht kein Luxus. Nicht nur in Staaten, in denen Gedichte mitunter wie Kassiber weitergegeben werden. Das poetische Bild leistet überall das Gleiche. Über das Staunen, über die Lust an der Neuartigkeit der Verknüpfung – einem Lustgefühl, in dem ein Stachel von Unlust steckt, weil Gewohnt-Bewährtes plötzlich in Frage gestellt zu sein scheint –, lockt und drängt es den Leser, früher oder später das zu entdecken, was es an Entdeckenswertem bereithält; und das kann bedeuten, daß er in sich selbst zu Entdeckungen gelangt, die ihm ohne das Kunsterlebnis versagt geblieben wären. (Um einer gängigen Meinung zu widersprechen: Kunst braucht, um zu entstehen, nicht immer ein Gegen, auch ein Gegenüber kann inspirieren. Und deshalb vermag sie auch alle Saiten anzureißen, die im Betrachter, Hörer oder Leser gespannt und gestimmt sind.)
Ich höre den Einwand: Die Tatsache, daß Gedichte wie Kassiber weitergegeben werden, beweist aber doch, daß sie unter den Bedingungen einer politischen Diktatur notwendiger sind als in einer Gesellschaft, in der jeder potentielle Leser eines Gedichts dessen wirklicher Leser werden kann.
Doch ist das Gedicht deshalb weniger notwendig? Und wenn ja, wäre es dann Luxus?
Nach einer Lesung in London, einer Lesung von Gedichten, sagte mir eine Dame: „Ich kann es nicht glauben, und ich will es auch nicht glauben, denn alle meine Erfahrungen sprechen dagegen. Aber nach diesem Abend habe ich das Gefühl, es gibt noch menschliches Glück.“ Je betäubender der materielle Luxus, desto notwendiger die Besinnung auf die Substanz Mensch.
Um den Begriff der staatsbürgerlichen Verantwortung anzustrengen: Sie besteht für den Schriftsteller darin, auf der Unvernunft zu bestehen, Schriftsteller zu sein und als Staatsbürger die Folgen zu tragen.
Jene Londoner Lesung fand im Mai 1975 statt. Ich war damals noch Bürger des anderen deutschen Staates, und was dieser Reise an dreijährigen Bemühungen der Universität Cambridge und dann monatelangen Belastungen bis unmittelbar vor Start des Flugzeugs voranging, wäre wohl der Rede, nicht aber einer Rede wert. Nur soviel: Um die Reise zuletzt überhaupt noch antreten zu können, mußte ich von abends siebzehn Uhr bis morgens drei Uhr durch Injektionen buchstäblich auf die Beine gestellt werden. Die Folge war, daß ich, als die Wirkung der Medikamente nachließ, in London lebensgefährlich erkrankte. Die von meinem Gastgeber benachrichtigten Ärzte rieten bereits am Telefon: King’s Hospital – das war das nächstgelegene Krankenhaus. Eine Besucherin, die den zweiten Botschafter der DDR in London kannte und mit seiner Familie befreundet war, erbot sich jedoch, diesen zu informieren. „Ihre Botschaft wird sich sofort für Sie einsetzen“, sagte sie. Als sie vom Telefon zurückkam, war sie blaß und verstört. Der Botschafter habe zurückgefragt: „This writer?“, und als sie, erfreut, daß er wußte, von wem sie sprach, bestätigt habe, ja, es handle sich um den Schriftsteller Reiner Kunze, sei die Stimme des Herrn „vereist“, er sei ungehalten geworden und habe es abgelehnt, daß sich die Botschaft für mich verwende.
Für die Verleihung des Georg-Büchner-Preises zu danken bedeutet für mich mehr, als nur dem Anstand zu genügen.
Habe ich an Büchner vorbeigesprochen?
Reiner Kunze, in: Darf ein Schriftsteller überhaupt vernünftig werden wollen? Reden von Heinrich Böll und Reiner Kunze. Anläßlich der Preisverleihung, S. Fischer Verlag, 1977
STUFEN
für E. u. R. K.
die stufen hinaufgehn
zur stadt über der stadt
über einen schweigenden herbst
aus stein,
der zu fliegen beginnt,
wenn der wind
die bäume ihre laubkugeln abrollen heißt.
mit abschüssigen worten
bestreun unsre kehlen
schrittlings den berg.
jede stufe, die sich ausschweigt,
heben wir auf
in die gemeinsame sprache.
Wulf Kirsten
Michael Wolffsohn: REINER KUNZE – der stille Deutsche
In Lesung und Gespräch: Reiner Kunze (Autor, Obernzell-Erlau), Moderation: Christian Eger (Kulturredakteur der Mitteldeutschen Zeitung, Halle). Aufnahme vom 17.01.2012, Literaturwerkstatt Berlin. Klassiker der Gegenwartslyrik: Reiner Kunze. Wenn die post hinters fenster fährt blühn die eisblumen gelb.
Zum 60. Geburtstag des Autors:
Harald Hartung: Auf eigene Hoffnung
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 16.8.1993
Zum 70. Geburtstag des Autors:
Katrin Hillgruber: Im Herzen barfuß
Der Tagesspiegel, Berlin, 16.8.2003
Lothar Schmidt-Mühlisch: Eine Stille, die den Kopf oben trägt
Die Welt, 16.8.2003
Beatrix Langner: Verbrüderung mit den Fischen
Neue Zürcher Zeitung, 16./17.8.2003
Sabine Rohlf: Am Rande des Schweigens
Berliner Zeitung, 16./17.8.2003
Hans-Dieter Schütt: So leis so stark
Neues Deutschland, 16./17.8.2003
Cornelius Hell: Risse des Glaubens
Die Furche, 14.8.2003
Zum 75. Geburtstag des Autors:
Michael Braun: Poesie mit großen Kinderaugen
Badische Zeitung, 16.8.2008
Christian Eger: Der Dichter errichtet ein Haus der Politik und Poesie
Mitteldeutsche Zeitung, 16.8.2008
Jörg Magenau: Deckname Lyrik
Der Tagesspiegel, 16.8.2008
Hans-Dieter Schütt: Blühen, abseits jedes Blicks
Neues Deutschland, 16./17.8.2008
Zum 80. Geburtstag des Autors:
Jörg Bernhard Bilke: Der Mann mit dem klaren Blick: Begegnungen mit Reiner Kunze: Zum 80. Geburtstag am 16. August
Tabularasa, 18.7.2013
artour: Reiner Kunze wird 80
MDR Fernsehen, 8.8.2013
André Jahnke: Reiner Kunze wird 80 – Bespitzelter Lyriker sieht sich als Weltbürger
Osterländer Volkszeitung, 10.8.2013
Josef Bichler: Nachmittag am Sonnenhang
der standart, 9.8.2013
Thomas Bickelhaupt: Auf sensiblen Wegen
Sonntagsblatt, 11.8.2013
Günter Kunert: Dichter lesen hören ein Erlebnis
Nordwest Zeitung, 13.8.2013
Marko Martin: In Zimmerlautstärke
Die Welt, 15.8.2013
Peter Mohr: Die Aura der Wörter
lokalkompass.de, 15.8.2013
Arnold Vaatz: Der Einzelne und das Kartell
Der Tagesspiegel, 15.8.2013
Cornelia Geissler: Das Gedicht ist der Blindenstock des Dichters
Berliner Zeitung, 15.8.2013
Johannes Loy und André Jahnke: Eine Lebensader führt nach Münster
Westfälische Nachrichten, 15.8.2013
Michael Braun: Süchtig nach Schönem
Badische Zeitung, 16.8.2013
Jochen Kürten: Ein mutiger Dichter: Reiner Kunze
Deutsche Welle, 15.8.2013
Marcel Hilbert: Greiz: Ehrenbürger Reiner Kunze feiert heute 80. Geburtstag
Ostthüringer Zeitung, 16.8.13
Hans-Dieter Schütt: Rot in Weiß, Weiß in Rot
neues deutschland, 16.8.2013
Jörg Magenau: Der Blindenstock als Wünschelrute
Süddeutsche Zeitung, 16.8.2013
Friedrich Schorlemmer: Zimmerlautstärke
europäische ideen, Heft 155, 2013
Zum 85. Geburtstag des Autors:
LN: Sensible Zeitzeugenschaft
Lübecker Nachrichten, 15.8.2018
Barbara Stühlmeyer: Die Aura der Worte wahrnehmen
Die Tagespost, 14.8.2018
Peter Mohr: Die Erlösung des Planeten
titel-kulturmagazin.de, 16.8.2018
Udo Scheer: Reiner Kunze wird 85
Thüringer Allgemeine, 16.8.2018
Jochen Kürten: Sich mit Worten wehren: Der Dichter Reiner Kunze wird 85
dw.com, 16.8.2018
Zum 90. Geburtstag des Autors:
Lothar Müller: Widerstand in Jeans
Süddeutsche Zeitung, 15.8.2023
Cornelia Geißler: Dichterfreund und Sprachverteidiger
Berliner Zeitung, 15.8.2023
Antje-Gesine Marsch: Greizer Ehrenbürger Reiner Kunze feiert 90. Geburtstag
Ostthüringische Zeitung, 16.8.2023
Ines Geipel: Nachwort. Zum 90. Geburtstag von Reiner Kunze
S. Fischer Verlag
Ines Geipel: Mit dem Wort am Leben hängen
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 16.8.2023
Gregor Dotzauer: Mit den Lippen Wörter schälen
Der Tagesspiegel, 15.8.2023
Hans-Dieter Schütt: Das feingesponnene Silber
nd, 15.8.2023
Stefan Stirnemann: Ausgerechnet eine Sendung über Liebesgedichte brachte Reiner Kunze in der DDR in Nöte – und mit seiner späteren Frau zusammen
Neue Zürcher Zeitung, 15.8.2023
Christian Eger: Herz und Gedächtnis
Mitteldeutsche Zeitung, 15.8.2023
Matthias Zwarg: Im Herzen barfuß
Freie Presse, 15.8.2023
Marko Martin: Nie mehr der Lüge den Ring küssen
Die Welt, 16.8.2023
Josef Kraus: Mutiger Lyriker, Essayist, Sprachschützer, DDR-Dissident, Patriot – Reiner Kunze zum 90. Geburtstag
tichyseinblick.de, 16.8.2023
Erich Garhammer: Das Gedicht hat einen Wohnort: entlang dem Staunen
feinschwarz.net, 16.8.2023
Volker Strebel: Ein deutsch-deutscher Dichter
faustkultur.de, 29.8.2023
Fakten und Vermutungen zum Autor + KLG + IMDb + Archiv +
Kalliope + DAS&D + Georg-Büchner-Preis 1 & 2 +
Rede + Interview 1, 2 & 3
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Dirk Skiba Autorenporträts +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Reiner Kunze – Befragt von Peter Voss am 15.7.2013.


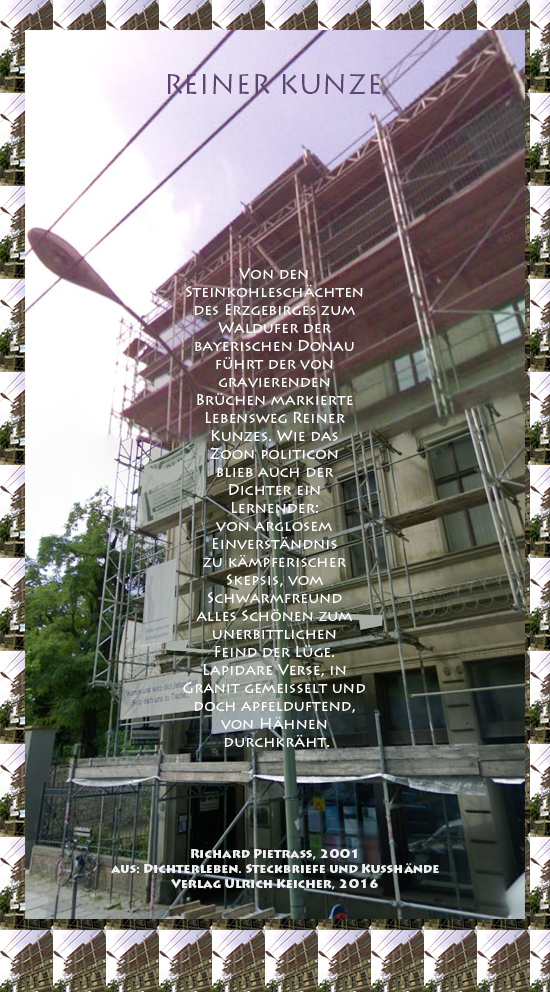












Schreibe einen Kommentar