Sarah Kirsch: Die Flut
KRÄHENGESCHWÄTZ
Mein Richtstern ist ein faust-
Großer Planet und mein Kompaß
Liegt auf dem Grund der See
Aber die Hoffnung will tanzen
Nur der Sperber über der Ebene
Liest die Gedanken.
Erde und Menschen sind
Gänzlich verwildert hilft
Kein Besinnen der Klotz
Ist unterwegs im freien Fall
Und ich selbst
Entstamme einer Familie von Wölfen.
Im Hier-Sein immer ein Anderswo
Über ein Jahrzehnt ist es her, da erschien in der DDR zum letztenmal ein Band von Sarah Kirsch. Und nun endlich – nach einem Zwischenspiel 1989 bei Reclam wieder eine Sammlung ihrer Gedichte im Aufbau-Verlag — veröffentlicht im wahrscheinlich letzten Jahr der DDR. Diesem Staatswesen blieb keine Zeit, sich zu versöhnen mit der verstoßenen Dichterin, die selbst darauf auch keinen Wert mehr legte:
So halten sie mir
Heute und morgen den Schlagbaum geschlossen
Ich Bedenke nicht an Heimweh zu sterben.
Unauslöschlich hab ich die Bilder im Kopf
Die hellen, die dunklen. Ich kann in Palermo sitzen
Und doch durch Mecklenburgs Felder gehen…
Trotz? Oder doch vielleicht ein wenig, Heimweh? Wieso suche ich die Spuren von Heimweh in diesem Band? Weil Gleichgültigkeit unerträglich wäre. Weil mir dennoch vieles, was hier war, einen Wert bedeutet und ich das Bleibende erkennen möchte. Irgendwie ist Sarah Kirsch doch einen Weg gegangen, den wir nun alle gehen müssen und der mir noch fremd ist. Ich wünschte mir für die Ausgabe, daß Herausgeber Gerhard Wolf ein Nachwort beigefügt hätte oder, besser noch ein Interview mit der Dichterin. Denn es scheint doch so, als ob jemand vermitteln muß. Wir sind getrennt voneinander durch verschiedene Erfahrungen. Die Grenze ist weg. Wie lange wird sie bestehen bleiben? So lang vielleicht, bis jeder sie auch von der anderen Seite kennt? Bis der eine wirklich nachfühlen kann, wie miserabel sich der andere auf der Transitstrecke vorkam („Reisezehrung“). Und dieser wiederum auch die Normalität eines Lebens akzeptiert, in dem Konflikte lösbar waren und Kompromisse nicht unbedingt Schuld bedeuten mußten.
Aber letzteres ist wohl am schwersten. Ich kann verstehen, daß Sarah Kirsch momentan voller Groll auf diejenigen ist, bei denen sie in der DDR pure Anpassung vermutet an ein politisches Regime, das ihr Gewalt antat. Sie wurde zur Renegatin gestempelt, weil sie nicht bereit war, ihren Protest gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns zurückzunehmen. Und sie ging dann schließlich selbst. Wie sah sie uns aus der Ferne? Vielleicht werde ich sie einmal fragen können.
Ich habe Viel wissen wollen, als ich dieses Buch zur Hand genommen habe, und deshalb zunächst in Gedichten die Mitteilung gesucht. Besonders der erste Teil „Erdreich“, entnommen dem gleichnamigen Band, der 1982 in der BRD erschien, wirkt auch durchaus erzählerisch, bekenntnishaft. Die Dichterin scheut nicht das einfache Sagen. Die Inhalte der Verse lassen sich bei allem Doppel- und Hintersinn leicht nachvollziehen. Das ändert sich.
Im Band Katzenleben (1984) er bildet hier den zweiten Teil — zieht sie sich scheinbar zurück auf sich selbst und ihre unmittelbare Umgebung.
Die Welt bestand aus Einzelheiten
Es war genau zu unterscheiden
Welches übriggebliebene Blatt
Um ein wenig vor oder hinter
Anderem leis sich bewegte
schreibt sie und nennt das Gedicht „Sanfter Schrecken“. Ja, die winzigen Beobachtungen können in ihrer Unbestreitbarkeit Halt geben. Manchmal hat Natur aber auch etwas Gleichgültiges, denn sie ist ewig, hat mit menschlichen Erschütterungen nichts zu tun. Was man in diesen Versen miterlebt, sind Verwurzelungsversuche, die sogar glücken für eine Weile. Eine Frau aus der Stadt hat sich in einem Bauernhof eingerichtet. Und weil sie eine Dichterin ist, kann sie in banalsten Verrichtungen noch etwas anderes entdecken: eine zeitliche Vertiefung, weil Generationen vor ihr gleiches taten, und eine mythische Erhöhung, wenn sich in besonderen Augenblicken Natur als Schöpfung offenbart.
Eine Romantikerin? Ja, gewiß ist da ein Widerhall älterer Poesie. Sarah Kirsch hat viel Sinn für die blaue Ferne, das Sehnen, das Staunen und zugleich die Ironie, die vor Enttäuschungen bewahrt. Vielleicht war das Glück. Ganz unpathetisch schrieb sie an gegen Emotionsattrappen, wie sie ja überall aufgestellt sind in der Gesellschaft, in die wir kommen. Und doch spürte sie wohl, wie es in der Naturlyrik wimmelt von Klischees. War dies der Grund, sich in Irrstern (1986) dem Prosagedicht zuzuwenden ? Jedenfalls wurden die Bilder gewagter, die unmittelbare optische Erfahrung des Lesers versagt mitunter, Vorstellungskraft ist gefragt, auch Akzeptanz von Verschlüsselung.
Die Gedichte aus Schneewärme (1989), die den letzten Teil des Bandes bilden, entstammen jenem Milieu, das man beim Lesen inzwischen ziemlich gut kennengelernt hat. Es finden sich wieder der Bauernhof in Schleswig-Holstein, die Schafe, die Wellen, das Moor, der Nebel. Aber alles ist düsterer als ehedem, und manchmal scheinen in der gottverlassenen Welt die Teufel zu tanzen. Man weiß nicht so recht, ob der hellgrüne Stern am Horizont eine Hoffnungsfarbe hat oder ob er als Zeichen des Unheils zu deuten ist. Das Gespenst des Schimmelreiters taucht auf, Spiegel färben sich schwarz. Eine seltsame Atemlosigkeit geht der Erstarrung voraus. Einsamkeit und Angst — kann man sich über sie erheben, wenn man sie ästhetisiert?
Ich glaube, daß Sarah Kirschs Gedichte solche Art Beschwörungen sind, schön und traurig. „Wintermusik“. Sie macht sich nichts vor. Doch eigentlich müßte die Bitternis wieder umschlagen können. Ich bin neugierig auf ihre nächste Lyriksammlung.
Dieses Buch werde ich dann ganz lesen und nicht nur in Teilen, wie hier die vorangegangenen. Wobei Gerhard Wolf bei der Auswahl ganz gewiß eine gute Hand gehabt hat. Aber es ist dies dennoch ein allzu schmales Bändchen aus einer langen Zwischenzeit, die eingehendes Verstehen brauchen würde.
Irmtraud Gutschke, Neues Deutschland, 20.7.1990
Abhängige Liebe nur noch zu Bäumen
Alles hat sich verändert
Nur die Wolken
Sind noch wie früher
Ich weiß nicht ob ich
Wie früher bin.
Ein Gedicht aus Sarah Kirschs Gedichtzyklus Schneewärme von 1989.
Im Jahre 1977 ist sie gegangen, dann kamen keine Gedichte mehr von ihr herüber, jedenfalls nicht öffentlich. Man wußte, sie lebt in Tielenhemme in Schleswig-Holstein, anders als die meisten anderen Menschen, viel in der Natur, zusammen mit ihren Freunden, züchtet Schafe, hat Katzen, einen Hund, und schreibt, schreibt vor allem Gedichte. Da gab es das Gegenstück zu Christa Wolfs Sommerstück Allerlei – Rauh … Irgendeinmal bekam man einen Gedichtband von ihr geschenkt.
Sarah Kirsch war fern, blieb fern, und doch gab es auf einmal wieder nach zwölf Jahren in „2. berechtigter und erweiterter Auflage“ ihr Reclambändchen mit dem Titel Musik auf dem Wasser, dem ersten zum Verwechseln ähnlich, nur etwas dicker, erweitert um Späteres, um eine Auswahl aus „Drachensteigen“, „La Pagerie“, „Erdreich“, „Katzenleben“, „Irrstern“, „Schneewärme“. Elke Erb, die ihr näher geblieben ist, gab Hinweise:
Tielenhemme in Schleswig-Holstein, die zweite Ankunft. Der äußere Wechsel half dem inneren: Umzupolen, zu verrücken, Subjekte, Symbole. Geltungen neu zu verbinden, bis ein neuer Boden erreicht war, kein Idyll.
Gerhard Wolf ist auch einer von denen, die ihr nahe blieben. Er hat ausgewählt aus dem, was seit 1982 entstand. Subjektiv, kommentarlos. Der Leser, der die letzten Arbeiten nicht kennt, folgt ihm auf der Suche nach Sarah Kirsch – einer neuen oder der sich Gleichgebliebenen? eben in der Jetzt-Zeit, von der sie sagt:
Alles hat sich verändert
Nur die Wolken…
Nein, so verändert hat sich Sarah Kirsch nicht. Ihre Gedichte sind noch immer „Zaubersprüche“. Sie könne hexen, sagt Eckart Krumbholz und meint wohl dies: Die Sprache, die Worte, die so selbstverständlich erscheinen, sind es doch nicht. Sarah Kirsch sieht alles wie wir und sieht alles auch immer ganz anders, sieht mehr:
Die Wege im Garten sind untergegangen
Alle Pflanzen verstrickt und verknotet…
oder
Die abgeschlagenen Köpfe der Kühe
Schweben im Nebel über den Wiesen…
Es gilt Abschied zu nehmen von allen
Vertrauten Blumen und Blättern
Geblieben ist sie Zauberin, die weiß, wie und aus welchen Kräutern der Trank bereitet wird, die die Rezepte kennt – auch die Dosen, damit der Liebestrunk heile, nicht tödlich sei. Denn in allem ist die Gefahr und die Verlockung. „Anziehung“ heißt ein „Zauberspruch“:
Nebel zieht auf, das Wetter schlägt um. Der Mond versammelt Wolken im Kreis. Das Eis auf dem See hat Risse und reibt sich. Komm über den See.
Ist dieser Ruf nun verstummt?
„Der Pfad der Trennung windet sich durchs Land / Und Februarnebel fliegt durchlöchert ums Haus“ – „und / Abhängige Liebe nur noch zu Bäumen…“
Noch immer der Stein und Musik, der Wind und die Wolken, der Traum und der Mond, das Erdreich, aber Wärme ist Schneewärme.
Die vier Enden der Welt
Sind voller Leid.
Schwerer, gewichtiger ist Vieles geworden. Sehnsucht hinweggehoben über Nächstes oder den Nächsten, Geliebten, in die Weite. „Ich mußte eine Menge Zaubersprüche lernen“ sagt sie, aber auch:
Ich gedenke nicht an Heimweh zu sterben.
Wieder hat sich alles verändert. Auch für Sarah Kirsch? Es gibt Abschiede, die für immer sind. Dies bedenkend, werden wir sie wieder haben. Sarah Kirsch kann auch so:
Und obgleich es mir abartig vorkommt, manch unbegreifliche Unsinne mitanzusehn, auch nicht gerne die Blumen meiner Feder hin vor die Säue kippe, hoffe ich noch auf Gärtner für Gärtner. Weil ich sonst weiter nach Norden drifte wien x-beliebiger Eisberg.
neu, Neue Zeit, 22.10.1990
Mittag und zunehmende Kälte
Das war vor 250 Jahren: jener Winter, der ans Leben griff und alles erstarren ließ. Es kündet eine Gedenkmünze von ihm. Sie trägt die Aufschrift:
Weil Lieb vnd Andacht sich in Kelt vnd Eys verkehrt hat hart vnd langer Frost das arme Land beschwert.
Vor allem aber wissen wir von diesem Jahrhundertwinter durch Barthold Hinrich Brockes. Es ist eines seiner großen Deskriptionsgedichte, das ihn ebenso exakt wie eindringlich beschreibt:
Viel Hühner, Enten, ja das Vieh, wovon sonst Keiner was gewußt,
hat hie und dort, selbst in den Ställen, das Leben durch den Frost verlohren.
Die Bäume borsten von einander. Nicht nur das Bier, so gar der Wein,
fror, selber in gewölbten Kellern. Tief ausgegrabne Brunnen deckte
ein starr, fast undurchdringlichs, Eis. Wir haben aus der Luft die Krähen,
nebst andern Vögeln, selbst im Flug erstarrt, herunterfallen sehen…
Sarah Kirsch nun: „Zunehmende Kälte“. Den Brockes-Text hat dieses Gedicht im Gedächtnis – wobei indessen die neueren Verse kein verfügendes Spiel mit dem Tradierten treiben, sondern sich ihm zuordnen:
… Jetzt verendete Vieh in so großer Anzahl
Daß die Abdecker und Knochenmühlen
Ihrer Arbeit nicht nachkommen konnten
Die steifgewordenen Kadaver im freien Feld
Täglich aufgetürmt werden mußten
Von Brettern und Steinen gehalten
Und mit Schaudern dachten die Bauern
An plötzliche mildere Tage.
Als ich eingewickelt in doppelte Tücher
Mit Fellstiefeln Pelzhandschuhn
Brennspiritus holen ging sah ich
Eine Katze aufrecht erfroren
Tot wie sie ging und stand
Die grünen Augen funkelten noch
Über den Feldweg zum Dorf.
Da steht die Gedichtfraktur im Zeichen einer Rückbesinnung, die dem alten Text etwas sehr Verbindliches beimißt. Und also von postmoderner Verspielung keine Spur. Das Gegenteil ist der Fall: Hinsichtlich der alten Beschreibungsweise macht sich Affinität geltend; diese Weise wird unüberheblich und doch in eigener Art an- und aufgenommen; gegen tödliche Kälte wehrt sich ein sprechendes Ich, welches gerade dadurch standzuhalten weiß, daß es sich in eine verbindliche Beziehung zu setzen vermag. (Die sehr enge Beziehung zu Brockes bezeugt sich übrigens nicht nur in diesem einen Gedicht; man begegnet ihr allenthalben im Band. Es wäre reizvoll, ihr im einzelnen nachzuforschen.)
Der aus acht Einzeltexten bestehende Gedichtzyklus „Reisezehrung“ gibt ein Ähnliches zu erkennen. Unter gleichem Titel hatte Goethe jenes Sonett geschrieben, das wohl am bündigsten sein – so viel diskutiertes – Entsagungsverständnis aussprach. Und es war, Ende der sechziger Jahre, Karl Mickel, der sich mit diesem Sonett in einem eindringenden Essay befaßte („Die Entsagung. Vier Studien zu Goethe“). Und Sarah Kirsch wiederum, sie schließt an beide Texte an. Wie man mit arger Entbehrung und dennoch reichlich versöhnt leben könne?: Die Exilantin gewinnt sich aus ihrer Situation heraus eben die Möglichkeit unverzweifelt-gelösten Daseins, die, jeder auf seine Art, bereits Goethe und Mickel akzentuiert hatten. Es heißt:
Ich gedenke nicht an Heimweh zu sterben.
Unauslöschlich hab ich die Bilder im Kopf
Die hellen die dunklen. Ich kann in Palermo sitzen
Und doch durch Mecklenburgs Felder gehn
Auf gelben Stoppeln schwenkt mir der Bauer den Hut.
Die Schwalben stürzen und steigen vorm Fenster
Vertraute Schatten, sie finden mich
Wo ich auch bin und ohne Verzweiflung.
Diese in schöner Gefaßtheit gesprochenen Verse haben nichts Angespanntes, geschweige denn etwas Polemisierendes; und es wird ja auch keine „Haltung“ ausgestellt, zu der sich das Ich strikt hinerzogen hätte. Statt dessen tritt ein Ich hervor, das ganz es selbst und mit sich einig ist. Und ist es noch und gerade, indem es sich als fähig erweist, im Überkommen ein verbindlich Zusprechendes wahrzunehmen und dem sich anzuschließen.
Gewiß, es ist viel Trauer, viel Erfahrungsbitternis in Sarah Kirschs Gedichten. Und der Weltzustand verbietet es ihr, nur im Innern des Kreises, den ihre auf innigen Zusammenhang bedachte Subjektivität sich zieht, zu verbleiben. Aber dieser Kreis, er findet sich dennoch gezogen! So auch gibt es unverspielt Märchenhaftes, es gibt Idyllisches in den Texten; und man begegnet der Beschreibung eines (mit der Wahlheimat Tielenhemme sich verbindenden) Landlebens, das mitunter als in sich geschlossene, dabei heiter bewegte Daseinswelt aufscheint.
Die wilden Rosen und schwarzen Beeren
Rollen die zärtlichen Ranken aus…
so beginnt das Gedicht „Der Mittag“; und es endet:
Laut lacht die Elster sie fällt
Auf meine Schulter sie bettelt
Mirn Ohrring ab Anfang des Waldes.
Da ist es nun die Beziehung zwischen Mensch und Tier, die als entspannte, als eine nichtaggressive sich mitteilt. Und auch hier eine bewahrende Zu- und Hinwendung, die von Zerstörung Bedrohtem gilt. In etlichen Gedichten reflektiert sich dieses Wissen vom unrettbaren Verlorensein des Wahrgenommenen sehr deutlich – die Wahrnehmung intensiviert sich dadurch, bekommt etwas Demonstratives, sentimentalisch Gesteigertes. Dementsprechend Gedichte auch, und nicht wenige, in denen dann die ländlich dörfliche Welt aller idyllischen Züge beraubt erscheint.
Kaum zufällig so viele Wintergedichte. (Welch beeindruckender Eigensinn: Da ist nicht die Spur eines Zweifels gegenüber dem Jahreszeitengedicht; für Sarah Kirsch hat es ganz und gar nicht ausgedient!) Und die bereits zitierten Verse lassen ja keineswegs nur jenes Anvertrauen bemerklich werden, von dem die Rede war, sondern zugleich auch ein atemverschlagendes Erschrecken: Im Bild der „Katze aufrecht erfroren“ konfrontiert sich dem Ich, in einem winterlichen Moment, plötzlich eine Selbstvision! Oder es wird ein solcher Landwinter beschrieben, der abschnürende Einsamkeit schlechthin bedeutet („Die Gänse folgen landeinwärts“), eine „Wintermusik“ auch, deren Weise von drückender Trostlosigkeit ist:
Bin einmal eine rote Füchsin ge-
Wesen mit hohen Sprüngen
Holte ich mir was ich wollte.
Grau bin ich jetzt grauer Regen.
Ich kam bis nach Grönland
In meinem Herzen.
An der Küste leuchtet ein Stein
Darauf steht: Keiner kehrt wieder.
Der Stein verkürzt mir das Leben.
Die vier Enden der Welt
Sind voller Leid. Liebe
Ist wie das Brechen des Rückgrats.
Und gespenstisch Unheimliches bricht ein; was als verläßlich scheinen mochte, kehrt sich ins leblos Befremdliche; „Geröll“ mit einemmal die Landschaft:
Mühlsteine Schleifsteine aufgerissene
Schern spitze Messer wohin ich auch
Blicke leere Himmel abgestorbne
Felder…
Die böse Vision auch von „platzenden / Vogelschwärmen mörderischen tieffliegenden / Festungen aufspritzenden Erdfontänen“ („Die Verwandlung“). Und die Wahrnehmung von alles überflutenden Wassern, durch die sich das Ich auf einem Knüppeldamm vorwärtsbewegt:
Es ist als würde
Nichts existieren obgleich die Haare sich sträuben
Ich weiß nicht ob ich lebendig bin schwarze
Verlorenheit seltsames verzögertes Knistern
Während die Nägel flink wachsen als wär ich
Ein Leichnam.
(„Die Flut“)
Der alte biblische Mythos scheint durch. Wohl in Erinnerung an ihn auch jener überraschend lichte Ausblick sodann, am Ende des Gedichts:
Eine hellgrüne Kugel geht ferne
Und schön am Horizont auf ich sehe ein neues
Gestirn über steigenden Wassern.
Überragend das Gedicht „Weltrand“. Hier gibt sich Nähe zu Jakob van Hoddis („Weltende“) zu erkennen – wiederum jedoch: Es handelt sich um eine sympathetisch angedenkende Beziehung, die völlig frei ist von Zwang und jeglicher Fixation. Und das Gedicht fügt sich aus einer Reihe von irren Einzelwahrnehmungen, die allesamt der ländlich-dörflichen Erfahrungswelt unmittelbar verpflichtet bleiben, ja gegründet sind sie fast durchweg in ausgesprochen Empirischem. Um so eindringlicher indessen stellt sich damit jenes beklemmend Ver-Rückte her, das ein Ende nachdrücklich signalisiert, es als definitiv gekommen erscheinen läßt:
Die abgeschlagenen Köpfe der Kühe
Schweben im Nebel über den Wiesen
Wenn der gehörnte Pfarrer am Abend
Mit roten Augen im Torfstich umherirrt.
Die letzten Vögel des Sommers reden
Mit vernünftigen menschlichen Stimmen
Es gilt Abschied zu nehmen von allen
Vertrauten Blumen und Blättern.
Halb steht die Sonne über dem
Wald halb ist sie unter.
Nein, die Insel, die dem Ich Lebensort ist, gewährt mitnichten eine Existenz, welche im Zeichen heiteren Friedens stünde. Und die Gefahr, auch auf ihr alle Gefaßtheit zu verlieren, bleibt gegenwärtig. Aber die steigende Flut, „nur“ im Traumbild das Land überschwemmend, trifft noch immer auf „Standhafte Deiche“ („Die Insel“). Da ist ein Ich, das sich nicht fortreißen läßt und Identität zu behaupten weiß, ein Ich, dessen Sprache irritationsfrei als eigene sich fügt. Als eine eigene dabei, die sich ihrer selbst sicher genug sein kann, um auch und gerade Affinität nicht beargwöhnen zu müssen: Die Souveränität von Sarah Kirschs Gedichten wird maßgeblich dadurch zu einer schönen, daß sie sich unaggressiv, sich nicht als eine reibungssüchtige, trotzig polemische darbietet.
Kein Niederschlag von Haß findet sich in diesen Gedichten. Und noch die Anzeichen für eine Haß-Unterdrückung fehlen. Zwar gibt es den Reflex von entschiedener Abwendung, auch von einem Angewidertsein. Doch keinerlei ingrimmige Aktivität wächst daraus hervor. Und sollte er nicht etwas sehr Entwaffnendes haben, dieser Gedichtschluß?:
Wenn ich einen
Wunsch sagen darf
So hätte ich gern
Noch einen Schafstall.
(„Die Insel“)
Bernd Leistner, neue deutsche literatur, Heft 454, Oktober 1990
Weiblicher Noah und Meeresbraut
– Wasser- und Flutbilder bei Sarah Kirsch. –
Ist Sarah Kirsch wirklich die Landfrau, als die sie sich gerne gibt? Eine Frau, die sich auf „geringfügigem Bauernhof“ im schleswig-holsteinischen Tielenhemme eingerichtet hat, immer in Augenhöhe mit Flora und Fauna? Liest man ihre Gedichte, aber auch ihre Kurzprosa, so erscheint sie mehr als mit dem Land mit dem Wasser verbunden.
Unstet schweifend kam ich
Hierhin und dorthin stets noch
Fand ich Wasser
heißt es im Gedicht „Faden“. Wasser als das zum Leben Notwendigste ist der Dichterin ein schier unerschöpflicher Gegenstand der Phantasie, ob nun Seen und Flüsse beschrieben werden oder das Meer, der Regen oder der Sumpf, Bäche, Brunnen, Pfützen oder Teiche. Auf den ersten Blick leben ihre Texte von den sich im Sprachklang spiegelnden Oberflächeneindrücken, auf den zweiten Blick aber gehen sie unter die spiegelnden Wasserflächen, in die Tiefen des Elementaren. Da scheint das Doppelgesicht der Natur auf. Sturm, Kälte und Nebel an der Küste Schleswig-Holsteins fordern menschliches Beharren und Phantasie auf vielfache Weise heraus. Stets sprechen die Biologin und die Dichterin in ihr zugleich. Die Naturwissenschaftlerin seziert die einzelnen Erscheinungen bis in die klaren Grundmuster ihres Aufbaus hinein; die Phantasie der Dichterin fügt sie in neuen Zusammenhängen zu neuen Strukturen.
Vom Doppelsinn der Worte und Redewendungen um das nasse Element leben bereits etliche der frühen Kirschschen „Zaubersprüche“:
Der Droste würde ich gern Wasser reichen.
Umwerfend einleuchtend sind Verse wie „Dies Leben schafft keiner allein zuviel Niederschlag“ in „Schneehütte“. Oder wenn sie bekennt:
Meine Erkundungen waren ein Schlag ins Wasser
(„Bäume“).
Nicht nur die Lyrik, auch die Prosa ist randvoll mit Wasserbildern, von den „Ungeheuren bergehohen Wellen auf See“ bis zu „Ein schwarzer Regen ist mein Herz“ („Postludium“). Wasserphantasien durchziehen Sarah Kirschs Werk, und Zäsuren ihres Lebensweges sucht sie vor allem über Wasserbilder zu definieren. So spricht „Der Rest des Fadens“, das erste Gedicht, das Sarah Kirsch nach dem Verlassen der DDR in Westberlin schrieb, von der schmerzhaft empfundenen Leere der „großen Ebenen ohne Baum und Wasser“ – eine Wüste letztlich oder seelische Ödnis, aus der die Flucht ohne Wiederkehr lebensrettend gewesen sein muß. Hier ist Wasser schon ganz Metapher für Lebensgrundlage oder Lebenselixier. Diesem metaphorischen Gebrauch ging ein variantenreicher Gebrauch von Wasserbildern voraus, die ganz konkret waren.
Der See
Meingott ich hab in diesem Jahr, dacht ich
reichlich Verse vom See geschrieben der dort
im Brandenburgischen liegt
beginnt das Gedicht „Angeln“ in Landaufenthalt. In den frühen Versen geben brandenburgische und mecklenburgische Seen den Hintergrund für die ersten Auftritte eines Ich her, das sich selbst im Verhältnis zur Welt zu definieren beginnt. Diese Welt ist Provinz, eine begrenzte Landschaft um den See bei Petzow, Kreis Werder, und um den Weißen See in Berlin. Noch ist die Natur und mit ihr der See nur Kulisse für allerlei menschliche Betätigungen wie Angeln, Baden und Spazierengehen. Nichts Besonderes also. In „Angeln“ ist gar zu lesen:
… der See
wurde zur Produktion der Kahn Gebrauchsgegenstand.
Diese Wendung wurde damals wohl als halb gehorsame, halb ironische Geste in Richtung einer Kulturpolitik gedeutet, die im Zuge des „Bitterfelder Weges“ die Schriftsteller gerne in den Fabriken sah. Das späte Gedicht „Die Verwünschung“ in Schneewärme antwortet auf jenes frühe Angel-Gedicht und bekundet Widerwillen gegen das rein nützliche Verhältnis zum See, wünscht das Gewässer befreit von Booten und Anglern.
Dennoch ist in den frühen See-Gedichten schon all das im Keim angelegt, was sich später reich entfaltet. In „Malen eines Sonnenuntergangs“ taucht das Ich die Hand in den See und malt mit den imaginierten Farben ein ganz eigenes Abbild der Realität. Im Mittelpunkt steht hier das Optische, die bewegliche Wasserspiegelung – ein Motiv, das Sarah Kirsch weiterentwickeln wird. In Schneewärme ist das gefrorene Wasser für die Dichterin „ein schöner / Glatter gottergebener Spiegel für schwarze Bilder“ („Schwarzer Spiegel“). Das Motiv des Wasserspiegels wird immer wieder neu variiert durch alle Jahres- und Tageszeiten. Selbst nachts erscheint ihr „Der Teller des Monds auf dem Wasser“ („Die Ebene“). Auffällig ist in den frühen Gedichten, daß Sarah Kirsch mit den Provinzseen Enge und Begrenztheit verband, die sie als schwer erträglich beschrieb:
… das dreht mir den Magen warum ist dieser Vogel
nicht auf den großen Havelseen
wo er weit fliegen und böse
sein kann
an welchem Ort man gerade geboren wird knarrt das der Kahn
er steht halb voll Wasser.
Im Gegensatz zum See bedeutet der Fluß für Sarah Kirsch Fortbewegung und damit Freiheit. Vielleicht aber war es gerade die Enge, die die Sehnsucht nach Weite und mit ihr die Phantasie beflügelte. Der See verwandelt sich in ein Tier „mit blauschwarzem Buckel“, in ein märchenhaftes Wesen, das spricht:
Ich bin der See von Anbeginn
(„Im Baum“).
Das ist archaische Natur, aus der noch alles werden und kommen kann, wie jener ans Ufer gespülte Knabe in „Morgens hatte ich Wein getrunken weil die Sonne so brannte“ oder der anscheinend auferstandene Baron, der mit der Flinte am See entlanggeistert in „Petzow Kreis Werder“. Gleichzeitig ist der See bei Sarah Kirsch in der Lage, ausgeworfenes Leben wieder zurückzuholen:
… der See kochte, stand auf reckte sich groß nahm ihn zurück („Morgens hatte ich Wein getrunken“). Auch das Bild der Arche und mit ihm das Flut- und Sintflutmotiv tauchen schon in Landaufenthalt auf, denn die „Musik auf dem Wasser“ im gleichnamigen Gedicht kommt aus einem „großen schwimmenden Haus“, der „Arche“.
Das Thema der Unberechenbarkeit und Bedrohlichkeit des Sees – so im plötzlich heraufziehenden Unwetter im Ohrid-See-Gedicht – wird in den folgenden Büchern in Motivketten entfaltet: im Ophelia-Motiv; im Unter-Wasser-Motiv und im Flutmotiv. Kennzeichnend ist bei aller Ernsthaftigkeit der Themen eine spielerische Grundhaltung, auch ein bewußtes Spiel mit der Gefahr:
Wir laufen dem See über die erstarrte Haut, und das
Ist sehr gefährlich
(„Der Winter“).
Verwandlung des Wassers
Sarah Kirschs Schreiben orientiert sich an den steten Veränderungen der Natur durch die Jahreszeiten. Aus dem akkuraten Registrieren dieser Veränderungen resultiert jener „sanfte Schrecken“, der das Gedicht oder die poetische Tagebuchprosa erst ermöglicht. Nichts aber ist so verwandlungsfähig wie das Wasser. Es ist daher der ideale Stoff für ihre Gedichte.
„In dem die Kristalle sich wandeln“, heißt es programmatisch in dem (Gedicht „Ort und Stelle“ in Schneewärme. Schnee, Eis und Wasser ergeben ein verwandlungsfähiges Beziehungs- und Metapherngeflecht zwischen den Gedichten. In allen Formen gibt Wasser die Folie für Reales und Irreales. In diesem Irrealen liegt die phantastische Komponente des Kirschschen Schreibens, die das eigentlich Poetische ausmacht. „Einem Wasser den Faden abbrennen“ kann eben nur Sarah Kirsch. Das war dann schon in den Zaubersprüchen, in denen der Begriff Riß eine Rolle zu spielen beginnt. „Das Eis auf dem See hat Risse und reibt sich. Komm über den See“, heißt es in „Anziehung“ – eine Art tödliche Verlockung. Aber erst in dem Band Schneewärme bedeutet Ins-Wasser-Schauen dann den (Welten-)Riß sehen, und zwar zweifach:
Ich sah einen Riß
Im dunklen Himmel
Und einen im offenen Wasser
(„Im Winter“).
In der Tradition Peter Huchels und Johannes Bobrowskis arbeitet Sarah Kirsch hier mit der Zeichenhaftigkeit der Natur.
Die Folgen schuldhaften menschlichen Handelns an der Natur werden im Band Rückenwind zum Thema:
Warum die wilde sich bäumende Musik
am Ohrid-See plötzlich schweigt.
Da kippt der See hoch, wird zur Bedrohung angesichts einer rasenden Lebensfeier von Menschen, die den See unbekümmert ausbeuten. Natur rächt den Frevel – Sarah Kirsch schlägt hier erstmals das ökologische Thema an. Der „hochkippende See“ als Warnung.
So ernst ging es im folgenden Band im und am Wasser vorläufig nicht mehr zu. Im ersten jenseits der DDR-Grenzen geschriebenen Buch Drachensteigen plätschert es zunächst erleichtert, aber auch recht beliebig. Da gelangt Sarah Kirsch bald zu den römischen Männern, die „hübsche Wasserstrahlen“ spucken („Dankbillett“). Traditionell löst Italien deutschen Dichtern die Zunge. Das waren aber alles nur flüchtige Zwischenstationen, wie auch die Straßen mit den Wasserwerfern („Steine“). Da wollte sie schon wissen, „An welcher Stelle das Wasser / Hin in den Untergrund ging“ („Landwege“). Das ging nicht nur in die Tiefe, sondern auch ins Globale. In „Der Eislauf“ „läuft die Menschheit in Stahlschuhn auf brüchigem Eis“. Darunter weiß man das bedrohliche Wasser. „Im See da unten / Wohnet der Drach“, sagt sie in „Alversund“, und um „fauchende Wasser“ der Geysire geht es in „Kapitulation II“.
Ophelia und Unter-Wasser-Motiv
Unter der Personnage sowohl der Lyrik als auch der Prosa kommt den Ertrunkenen ein besonderer Rang zu. In der Tagebuch-Prosa Spreu ist folgende aufschlußreiche Notiz zu finden:
31. Dezember 1989: Kam auf dem Friedhof der Namenlosen wieder hernieder. Mein Lieblingsort auf der Insel.
Das Schicksal der Namenlosen, der unbekannten Ertrunkenen, übt eine besondere Anziehungskraft auf die Dichterin aus, beflügelt ihre Vorstellungskraft. Mit den Namenlosen empfindet Sarah Kirsch Solidarität, vor allem mit den ertrunkenen Frauen, die den Freitod aus unerfüllter Liebe wählten. Schon in Landaufenthalt findet sich das Ophelia-Motiv in dem Gedicht „Das grüne Meer mit den Muschelkämmen“. Mit der Frau des Leuchtturmwärters, die „übers Wasser“ ging, wird neben Wahnsinn und Mord vor allem Selbstmord assoziiert:
Einfach so, vor dem Neuen Jahr
ging seine Frau übers Wasser
keine Fische wollte sie schuppen…
Das euphemistische „übers Wasser gehen“, das eigentlich ins Wasser gehen heißen müßte, deutet das Wahrnehmen einer legitimen Wahlmöglichkeit an, also eine freie Willensentscheidung: das Sich-Erheben über unakzeptable Lebensumstände.
Auch in „Angeln mit Sascha“ wird die Angleridylle durch eine Ophelia aufgestört:
Die haben ein Mädchen im Netz das stundenlang tot ist.
Das lyrische Ich vergleicht sich indirekt mit der Ertrunkenen, erkennt in der Selbstmörderin die eigene Möglichkeit, die sie am Ende verwirft: Der Weg Ophelias ist nicht ihr Weg, und doch bleibt eine Faszination. Das Ophelia-Motiv wird immer wieder aufgegriffen. In Drachensteigen findet sich in dem Prosastück „Nebel“ die Behauptung:
… gehe ich im November ertrunken umher.
Das kommt dem Bei-lebendigem-Leibe-tot-Sein nahe. Auch in „Flaute“ sieht das lyrische Ich die Welt „wie unter Wasser“. Es hat die Beziehung zur Außenwelt, die sie verneint, längst verloren. Das Wie-unter-Wasser-Leben wird zum unerträglichen Zustand. Die sprechende Figur ist eine Ertrunkene, lebendig tot, sich selbst entfremdet. Doch auch später, als Sarah Kirsch eine ihr gemäße Lebensweise im schleswig-holsteinischen Tielenhemme längst gefunden hat, greift sie das Motiv wieder auf, so in dem Gedicht „Ertrunken“:
Mein Schatten stürzt
Die Steintreppe hinab
Bis in den Fluß.
Ertrunkensein ist Synonym äußerster Einsamkeit in dem Buch Erlkönigs Tochter:
Ich liege unter dem Eis ausgestreckt
In einer Haut durchsichtigen Lichts.
Da „herrscht schwarze polternde windige Nacht“, und das Meer „lastet schwer“ („Wintergarten I“). Das Ophelia- und das Unter-Wasser-Motiv geben eine Befindlichkeit des lyrischen Subjekts wieder, die man als äußerste Entfremdung bezeichnen kann.
Das Unter-Wasser-Motiv enthält eine ästhetische Komponente, die die Dichtung Sarah Kirschs wesentlich strukturiert. Indem die gewohnten räumlichen Dimensionen verschoben werden, erscheint die Sicht auf die Welt verändert. Oben und unten sind vertauscht:
Wie ein Pirol lebe ich
In den Kronen der Bäume
(„Schneewärme“).
Eine gänzlich andere und ungewohnte Sicht auf die Dinge stellt sich ein: Das lyrische Ich schlüpft in andere Identitäten, die von Naturwesen etwa, die nicht immer so eindeutig auszumachen sind wie die des Vogels im zitierten Pirol-Gedicht. Oft bleibt offen, ob es sich dabei um einen Fisch oder ein Fabelwesen der Wasserwelt handelt:
Wohnst im Mond auf der
Kleinen Seite ich am
Boden des Sees…
(„Trinken“).
Assoziiert wird immer auch Ophelia, was dem Unter-Wasser-Motiv meistens einen tragischen Ton gibt, der jedoch selten rein auftritt. So werden das Tragische, das Komisch-Ironische und das Phantastisch-Spielerische in der Schwebe gehalten:
War mir
Locker zumute hätte gern
Meinen Schuh auf dem Grund der Salzach gehabt
(„Mozartsteg“).
Das Unter-Wasser-Motiv ist – wie übrigens auch das der Schaukel – zwischen Übermut und Todesahnung (bzw. -verlockung) angesiedelt.
Eine ästhetische Verlockung scheint für die Autorin das Chaos der Naturkatastrophe zu sein.
Ästhetik und Transzendenz der Überschwemmung
Vor allem die Überschwemmung bietet Gelegenheit, die gewohnte Ordnung der Dinge gehörig durcheinanderzubringen und andere Sehweisen zu erproben. Der Text „Was bei einer Überschwemmung im Fluß schwimmt“ aus dem Prosaband Schwingrasen zählt minutiös die durcheinandergeratenen Lebewesen und Dinge auf, gruppiert sie – nicht ohne heiteres Mitgefühl – neu. Dabei wird das Tragische ins Komische gewendet, ohne daß der Ton dabei zynisch würde:
Hüte schwimmen gut und lange, ebenso kleine Hunde, wenn die Strömung sie nicht ans Ufer entläßt. Es kann geschehen, daß ein ganzer Wurf im Wasser treibt. Sie winseln, aber sie sehen sich noch, bleiben eine Zeitlang zusammen wie eine Insel. Obgleich ein Hundewurf zahlreich ist werden es sichtbar weniger dann. Der letzte kleine Hund fürchtet sich sehr. Auch ein Sarg kann derart bewegt werden und man kann nicht sagen ist er leer oder auch nicht, leichter fällt das Urteil bei diesem Kinderwagen, alles Schiffsähnliche kommt gut voran.
Die betont nüchterne Beschreibung kippt mit raffinierten kleinen Drehungen der Sprache ins Sarkastische um. Beschrieben wird nicht nur die Auflösung räumlicher Zugehörigkeiten, sondern auch die sozialer Gruppierungen und Bindungen. Die Katastrophe ändert die Wertkategorien – es zählt nur der Aspekt der Schwimmtauglichkeit. So treibt der Text ein ironisches Spiel, ahmt in der Wortfolge den Auflösungsprozeß der Naturkatastrophe nach und mischt die Verhältnisse neu:
Alles schwimmt in mehreren Schichten und reibt sich.
Scheinbar unbeteiligt, emotional „unterkühlt“ registriert die Prosaminiatur in Schwingrasen Bilder ungewöhnlicher Zustände, deren ästhetischer Reiz fasziniert:
Die Bäume stehen im Erdreich noch fest, das der Fluß überschwemmt hat. Ob Fische durch die Zweige schwimmen ist nicht zu erkennen…
(„Das blaue Haus in Mtkwari“).
Der Prozeß der Auflösung und des Untergangs der Einzelbilder wird beschrieben wie ein Kunstvorgang, der sich verselbständigt hat. Die Emotion ist zurückgenommen, wenn nicht ganz ausgespart. Das Ich steht außerhalb der Ereignisse und spielt keine Rolle außer der des Beobachters. Aufgelöst wird hier die traditionelle Wertigkeit des Haus-Motivs in der Bedeutung als Wohnstatt des Menschen, als Ort der Geborgenheit und der Zuflucht. Damit bekommt hier auch das in der modernen Lyrik häufig verwendete Motiv des Unbehaustseins eine andere Dimension. Der Mensch ist nicht mehr aus seiner Heimstatt ausgewandert oder vertrieben, sondern das Haus ist zerstört, löst sich in Nichts auf. Eine Wiederkehr/Rückkehr ist damit unmöglich geworden. Die Überschwemmung, besonders in „Was bei einer Überschwemmung im Fluß schwimmt“, wird schließlich beschrieben wie ein Weltuntergang, in dem Anfang und Ende (symbolisiert durch Kinderwagen und Sarg) aufgehoben sind.
Das Meer
Nach den Provinzseen mit ihren Untiefen, nach den über die Ufer tretenden Flüssen ist das Meer mit seinen Gezeiten zum bevorzugten Sujet der Dichterin geworden. In den frühen Gedichtbänden verwendet Sarah Kirsch den Begriff Meer nur in einer stark reduzierten Signalfunktion. Das Meer oder die See bezeichnet noch kein komplexes Erlebnisfeld der Sinne, sondern dient als Synonym für Abgrund, Tiefe und Gefahr. So in dem Gedicht „Seestück“ aus Landaufenthalt. „Ich tanze Seil überm Meer von Felsen zu Felsen.“ Aus dem Meer zieht sie per „Ruf- und Fluchformel“ in den Zaubersprüchen eine „bodenlose Brut“ samt „Hagelschlangen“. Die Untiefe als dunkle Heimat der Untiere, mit der auch Sexuelles assoziiert wird.
Abgesehen vom Begriff „Häusermeer“ im Gedicht „Der Flug“ ist das Meer in den frühen Gedichten etwas Fernes, von dem sie abgeschnitten ist und zu dem sie keinen Zugang hat. Die nahegelegene Ostsee interessiert sie poetisch in keiner Weise, sie kommt nicht vor. Dagegen kreisen ihre Gedanken in den Zaubersprüchen ums Mittelmeer. Von ihm hört sie nur in den Erzählungen des alten Dichters („Mittelmeer“). In Rückenwind finden sich dann die aufschlußreichen Verse:
SCHÖNAUG HOFFNUNG SIND DEINE NAMEN
Schon wieder mein Meer weg das ferne
Erhabene Land setz doch den Fuß raus
Grenzpapiere ach was hier bin ich.
Hier wird das Meer zu ihrem Meer und zum Ziel der Sehnsucht, das in der Ferne lockt. Hier ist es die Verlockung zur politischen Grenzüberschreitung, während in „Seestück“ beim Seiltanz die Grenzen des Ichs ertastet wurden, in der „Ruf- und Fluchformel“ die Möglichkeiten und Grenzen des Geschlechts.
Schon in den Gedichten Mitte der sechziger und Anfang der siebziger Jahre hat das Meer bei Sarah Kirsch etwas mit Grenzerfahrung und Grenzüberschreitung zu tun – was bei der Entwicklung des Flutmotivs noch von Bedeutung sein wird. Nach der Ausreise Sarah Kirschs steht dann das Meer in seiner großen räumlichen Ausdehnung als Signal für Entfernung und Abstand:
Es ist nicht so schlimm, wenn man Länder zwischen sich legt. Am besten Meere.
(„Italienische Amseln“).
In „Eremitage“ heißt es dann:
Eine Abtrünnige lebe ich
Zwischen den Meeren.
In den Gedichtbänden, die Sarah Kirsch an der Nordseeküste schrieb (Erdreich, Katzenleben, Schneewärme, Erlkönigs Tochter und Bodenlos), wird das Meer zum optischen, akustischen und sogar zum Geschmackserlebnis:
Über dem Meer geht jetzt der
Abendstern auf
(„Freyas Katzen“),
Aus dem teerschwarzen Meer steigt der
Mond auf
(„Kalt“),
Baltische Elegien und diesz
Schöne türkisgrüne Meer
(„Malmöer Segen“),
… ich höre
Das Meer an die Küste schlagen. Wer seid ihr brüchige Stimmen was geht ihr…
(„Stimmen“),
… und durch die Türen
Ruft das bittere Meer
(„Dunkle Stadt“).
Neben dem schönen, leichten Erlebnis des Meeres, wie etwa in dem Gedicht „In den Wellen“:
Das Meer so
Grün und so offen
Habe die Füße im Wasser…
kommt in den späteren Gedichten der lebensbedrohende Aspekt des Meeres zur Sprache:
Unser Land ist vom Meer ganz um-
Kerkert …
(„Eisland“)
„Schwarzes Wissen beugt mir den Hals“ – Zivilisationskritik und Flut
Das Meererlebnis in seinen vielfältigen Erscheinungsformen könnte ganz zeitlos wirken, brächte Sarah Kirsch nicht gerade in seinem Umfeld Zivilisationskritik ein. In „Watt III“ sieht sich das lyrische Ich als Erlkönigs Tochter, die eine Verabredung mit zwei apokalyptischen Reitern hat. Das Thema taucht hier nicht zum ersten Mal auf. Die Apokalypse gehört seit den frühen Warngedichten zu Sarah Kirschs Bilderschatz. Wie ein Seismograph halten die Texte der Dichterin die globalen Erschütterungen fest. Ihre Zeitrechnung zählt nach den Katastrophen und Gefahren, die die Erde und die Existenz des Menschen bedrohen. „Es ist der dritte Sommer nach dem Supergau in der fernen Sowjetunion“, beginnt das „Lob der Vergeßlichkeit und der Langeweile“. In die Sorglosigkeit der Naturerlebnisse brechen die Umweltkatastrophen ein.
Schwarzes
Wissen beugt mir den Hals
Diese Sentenz aus dem Gedicht „Ferne“ meint auch das Wissen um die Unumkehrbarkeit der weltweiten Prozesse der Zerstörung von Natur, die auch das Meer betrifft. Das Gedicht „Früher und heute“ stellt im historischen Vergleich eine Veränderung im Verhältnis von Mensch und Meer fest. Während es früher hell und herrlich erschien, den Fischern auf hoher See Beute im Überfluß bot, hat es heute seinen Fischreichtum eingebüßt. Damit ist auch das Tun des Menschen banal geworden:
Spielbuden stehen heute am Strand
Und die erwachsenen Söhne
Gießen sich Korn in die Kehle.
Das schöne Meeresthema mit seinen Licht- und Akustikeffekten wird durch nüchtern registrierte Wahrheiten von jeglichem idyllischem Flair befreit:
… da tauchten niegesehene
unbeschriebene einzellige Algen auf welche die Fische
erstickten, beide Meere waren krank von chemischen
Abfällen, Überschüttungen von Dünger und Gülle aus
der nahen entarteten Landwirtschaft, sie schäumten
und ganze Populationen von Seehunden starben…
(„Lob der Vergeßlichkeit und Langeweile“).
Keine Lobpreisung der schönen Naturdetails à la Barthold Hinrich Brockes mehr. Grausig und trostlos sind so manche Meeres- und Seelenbilder der Sarah Kirsch geworden. Vom mythischen Weltenbaum fällt kein Blatt mehr, nur noch schwarze tote Krähen ins Watt.
Das Motiv der Flut nimmt in diesem Zusammenhang eine zentrale Stellung ein. Anders als in den Prosastücken zur Überschwemmung bleibt es im Gedicht „Die Flut“ nicht bei der Beobachterposition des Ich. Kaum ein anderes Gedicht Sarah Kirschs zeigt so auf einen Schlag das Wesen ihrer Dichtung: die ganz unmittelbare, enge Beziehung eines Ichs zur Natur, deren genaue, auf Einzelheiten erpichte Beschreibung, die unvermutet ins Zeichenhafte, in symbolische Überhöhung und ins Phantastische übergeht, und das Balancieren in Grenzsituationen, in denen das Spiel leicht ins Gegenteil umschlagen und einen tödlichen Ausgang nehmen kann. Es geht um Existentielles, wenn Sarah Kirsch ihre lyrischen Figuren in die Wirkungsfelder der Elemente stellt, um Leben und Tod, wenn die lyrische Ich-Figur durchs Wattenmeer wandert, um vor der Flut eine Insel zu erreichen; ein Spiel gegen den Tod. Das Motiv ist bei Sarah Kirsch seit dem ersten Buch Landaufenthalt präsent, wird erst später als Flutmotiv weiterentwickelt und variiert, ebenso wie das Ophelia-Motiv, der Liebestod durch Ertrinken. Beim Flutmotiv stehen zwei Aspekte im Mittelpunkt: das Archaische, der ewige Kampf zwischen Mensch und Natur, und das Zivilisatorische, Augenblickliche und Zeitbezogene, das mit den Umweltkatastrophen eine drohende Apokalypse beschwört. „Wir sind unter Wasser, wenn die Polkappen abtaun“, heißt es in „Grund und Boden“. Ganz lapidar und sarkastisch kommt die Prophezeihung daher:
Vorher brauchen wir noch Fenster und Türen und Tore. Auch schönes Pflaster anstelle der Betonplatten auf dem Hof. Man hat nicht oft die Möglichkeit, den Meeresboden zu pflastern.
„Ich bewege mich auf dem Knüppeldamm vorwärts“ – mit dieser Behauptung beginnt das Gedicht „Die Flut“, doch am Schluß weiß der Leser, daß hier eine Selbsttäuschung vorliegt. Die Ironie der Sarah Kirsch ist in einen einzigen Satz geschlüpft, zusammengezogen in dieser ersten Zeile. Da behauptet ein Ich, es bewege sich vorwärts auf einem Knüppeldamm, jenem von Menschen gebauten Bollwerk aus allerlei Hölzern gegen die Unbilden der Natur. Der auf unsicherem Grund errichtete Weg markiert ein Stück Zivilisation, der Natur abgerungen, und es ist zugleich eine künstlich errichtete Grenze, der das Ich vertraut. Es glaubt, seine Richtung der Bewegung zu kennen. Doch am Ende wird die vermeintliche Vorwärtsbewegung des Menschen durch die elementare Naturgewalt durchkreuzt und damit aufgehoben. Das führt die Aussage des ersten Satzes ad absurdum. Das Gedicht ist klüger als die lyrische Figur, die in ihm agiert.
Indem die Figur Natur vermeintlich hinter sich läßt, begibt sie sich um so tiefer in deren elementare zerstörerische Gewalt. „Untergegangen“, „zerborsten“ und „zerschmettert“ heißen die Adjektive, die das Wirken von Natur beschreiben. Nicht das Ich, sondern dessen Spiegelbild, vielleicht die naturhafte Seite seines Wesens, begibt sich auf den Grund des Meeres, während oben Gespenstisches und ebenso unwirklich Anmutendes geschieht. Es folgen Leere und scheinbare Nichtexistenz. „Ich weiß nicht, ob ich lebendig bin…“ – Hier spricht jene Ophelia, die liebend Ertrunkene aus den frühen Gedichten, aber nun im Kontext einer sich selbst zurücknehmenden Zivilisation: „Die Dörfer sind ausgestorben seit langer Zeit.“ Zugleich scheint die Evolution, ja die Erdenwelt samt Erde, Luft und Wasser an ihren Ursprung zurückzukehren:
Es ist als würde
Nichts existieren…
Aus diesem Nichts wiederum entsteht ein „neues Gestirn“. Das Verschieben von zeitlichen und räumlichen Dimensionen, das Sarah Kirsch in „Was bei einer Überschwemmung alles im Fluß schwimmt“ und „Das blaue Haus in Mtkwari“ übte, führt in „Die Flut“ zur Vision einer ganz anderen, neuen Welt. „Die Flut“ ist als Naturgedicht gelesen ein phantastisches Schauspiel, als Liebesgedicht voller erotischer Bildabläufe, dazu zivilisationskritisch und philosophisch: ein Gebilde mit mehreren Böden, unter denen immer neue Assoziationsschichten zu finden sind.
Eine Landfrau ist Sarah Kirsch schon lange nicht mehr. Sie erscheint spielerisch zugleich als Ophelia, Meeresbraut und weiblicher Noah, der unermüdlich an einer dichterischen Arche baut, die Tiere und Pflanzen durch minutiöses Benennen vor der nächsten Sintflut retten soll. Der mitlaufende Untertext von der drohenden Weltkatastrophe führt im Verbund mit den alten Motiven zu neuen ästhetischen Möglichkeiten, deren Wirkung es noch zu entdecken gilt.
Dorothea von Törne, neue deutsche literatur, Heft 511, Januar/Februar 1997
Der Aufbruch in den sechziger Jahren
(…) Es wäre vorstellbar, daß Sarah Kirsch (*1935) ihren „Traurigen Tag“ just an jenem Tag des Jahres 1965 geschrieben hat, da Partei und Schriftstellerverband Biermann u.a. als Parteifeinde gebrandmarkt haben:
Ich bin ein Tiger im Regen…
Ich hau mich durch die Autos bei Rot…
Ich brülle am Alex den Regen scharf…
Aber es regnet den siebten Tag
Da bin ich bös bis in die Wimpern
Ich fauche mir die Straße leer
und setz mich unter die ehrlichen Möwen
Da sehen alle nach links in die Spree
Und wenn ich gewaltiger Tiger heule
Verstehn sie: ich meine es müßte hier
noch andere Tiger geben1
Ich hau mich durch – bin bös – ich brülle – ich fauche – ich heule. Die Sprache vital, impulsiv, affektiv, aktionistisch (es müßte hier / noch andere Tiger geben).
Als sie 1962/63 zu den großen Lyrikabenden aufgetreten war, waren ihre Texte noch voller Phantastik und Verspieltheit gewesen. Freilich, der Saurier, das böse Tier, war bereits eine sklavensprachliche Metapher, und in „Vom Brotbacken“ erklomm man Ministersessel, indem man die Würde in die Asche warf Und
Die Zeit hat ein Sieb
ein großes Sieb…
Laßt uns am Siebe schütteln…2 (468/52 ff.)
Und hatte sie nicht gestanden, ohne politische Interessen könnte sie keinen Vers schreiben? So subjektiv, intim, egozentrisch, eigenwillig, spröde, manisch, depressiv, verspielt ihre Texte auf dem ersten Blick auch sein mochten, wie sehr sie auch mit Tieren, Pflanzen, Flüssen, Gestirnen sprach oder Märchenfiguren herbeizitierte, es ging ihr immer um Darstellung einer momentanen Befindlichkeit, sie zeigte sich empfindsam, empfindlich, dünnhäutig.
Bereits in ihrem ersten Gedichtband aus den Mittsechzigern (Landaufenthalt) fand sich Bekenntnishaftes neben elegisch dargebotener Enttäuschung am real Existierenden: Das ist meine Erde, aber sie trug die Male von Schlächterei Ungleichheit Dummheit; das ist mein kleines wärmendes Land, aber in ihm die Schrankenwärter, und ritzender Draht zieht sich durch den Wald. Und immer wieder Klagen übers Eingesperrtsein:
Ich weiß und seh
keinen Weg…
durch den Draht.
Und der alten Weide klagte sie: Viele Dinge hindern uns Menschen; und dem Schnee klagte sie:
Ach Schnee… hier siehst du Eine vor dir
die kalte Füße hat und es satt.
In scheinbaren Liebesgedichten irrlichterte die Du-Anrede zuweilen zwischen Intimpartner und Partner Staat/Partei hin und her, verwischte die Kontur, und zwischen Enttäuschung und harten Vorwürfen wucherten Dennoch-Bekenntnisse:
Wenn du mich verläßt Verleumdung
ausstreust, in deiner Zeitung verkündest
du seist betrogen deiner Enttäuschung
Ausdruck verleihst, schwarzgeränderte Karten
an Alle verschickst meine purpurnen Schuhe
ins Feuer wirfst Briefe verschweigst
dann will ich dich längst nicht lassen
Wenn du deinem Spott mich aussetzt
mir Klugheit und Dummheit verkehrst
aus meinem Rot
Teer machst, meine Begeistrung
zu Eis fälschst so will ich
dir nachgehn verkünden du lügst…3
Am Ende wars doch eindeutig ein politischer Text. Und im Landaufenthalt gabs viel Winter und Eiszeit ringsum, und Schnee reimte sich auf Weh. Oder:
Der Schnee liegt schwarz in meiner Stadt.
Oder:
Die Erde ist in unserer Gegend übel dran…
nur Schwertlilien im Bahnwärtergarten
schlagen sich unbeirrt aus der Erde
die Blattspitzen zerreißen dabei
die ersten haben es am schwersten4
Und sie hob an: ich geh schwanger mit Nachtigalln Liebster, um sofort zu dementieren: und liege zerschunden auf meinem Ufer, gierig auf Schiff und Meer, aber wir werden hier nicht rauskommen, hinter mir die Geschwister mit Minen und Phosphor. Sie liebte ihr kleines Land, da sie kein anderes kannte. Die Genossin Lyrikerin litt unter ihren Zweifeln, tat sich schwer mit ihrer Haßliebe, doch trotzig vermeldete sie ihren eigenständigen Standort, und die Idyllen gerieten ihr dabei immer schwärzer.
In rascher Folge dann weitere Gedichtbände: 1973 Zaubersprüche, 1976 Rückenwind, 1977 Musik auf dem Wasser. Es gab Tendenzen, die Autorin in das Schubfach Frauenlyrik runterzustapeln, die Texte als impressionistische Irritationen abzutun. Doch die ernstzunehmende Literaturkritik in Ost und West war sich einig: Die Zaubersprüche waren ein literarisches Ereignis. In ihnen, die Fluchtformel:
Frost Regen und Schlamm über die Füße dir
Zarthäutiger, Eis dir zwischen die Zehen mit denen ich
Einstmals die Finger verflocht, du schiebst sie
Nicht mir untern Tisch
Deine Poren
Sind völlig verstopft und verkommen: vernehmen
Die einfachsten Dinge nicht mehr.5
Zu den letzten in der DDR geschriebenen Gedichten, nachdem sie sich ostentativ gegen die Ausbürgerung Biermanns bekannt und ihren Ausreiseantrag geschrieben hatte, gehörte „Im Sommer“:
Dünn besiedelt das Land.
Trotz riesiger Felder und Maschinen
Liegen die Dörfer schläfrig
In Buchsbaumgärten; die Katzen
Trifft selten ein Steinwurf.
Im August fallen Sterne.
Im September bläst man die Jagd an.
Noch fliegt die Graugans, spaziert der Storch
Durch vergiftete Wiesen. Ach, die Wolken
Wie Berge fliegen sie über die Wälder.
Wenn man hier keine Zeitung hält
Ist die Welt in Ordnung.
In Pflaumenmuskesseln
Spiegelt sich schön das eigene Gesicht und
Feuerrot leuchten die Felder…
Ein Anti-Idyll in seiner Friedhofsruhe. Doch die Grabesstille täuscht: Man lese nur die Zeitung!
Die DDR-Oberen waren froh, als sie 1977 endlich außer Landes ging. Von jenseits der Mauer bekannte sie dann zur Friedhofsruh:
Nein, in der DDR hätte ich nicht leben können. In der DDR war ich wie gelähmt. Ich glaube nicht, daß dort in den nächsten fünfzig Jahren etwas passiert, eine wesentliche Veränderung. Ein Leben lang diese Abhängigkeit von einer Politik, die sich nicht traut, den Menschen Mensch sein zu lassen in aller Unberechenbarkeit…
Da hatte mit ihr die DDR-Literatur die vielleicht wichtigste poetische Stimme verloren. Doch wird 1989, wenige Wochen vor dem Fall der Mauer, in der DDR noch eine Gedichtauswahl erscheinen dürfen: Die Flut. In ihr ist zu lesen:
Die Geheimpolizisten bewachen Geheimpolizisten.
Wir schließen das Fenster mit dem Sprung in der Scheibe…
Und sie bekennt:
Ich selbst
Entstamme einer Familie von Wölfen.
Für M. Reich-Ranicki ist S. Kirsch die bedeutendste lebende deutsche Dichterin, eine Erzpoetin, der Droste jüngere Schwester und eine Panerotikerin:
Erotisch ist nicht nur ihr Verhältnis zu den Menschen, sondern auch zur Heimat und zur Natur, zum Geist und zur Literatur, ja, sogar zur Politik.6
Und gemeint ist damit gewiß auch ihre Zuwendungsintensität zur Welt. Die Kirsch indes:
Der Droste würde ich gern das Wasser reichen!7
Die DDR-Literatur hat sich selber arg amputiert, als man sie 1977 ziehen ließ. Doch die damals das Sagen hatten, waren zu blind und zu borniert, um den großen Verlust, der dadurch der DDR-Poesie passiert war, überhaupt ermessen zu können.
(…)
Edwin Kratschmer: Dichter · Diener · Dissidenten. Sündenfall der DDR-Lyrik, Universitätsverlag – Druckhaus Mayer GmbH Jena, 1995
VOGELFREI
nach Sarah Kirsch
Komm mir entgegen silberner Sänger
Breite die Flügel aus Krächz mir was
Zu aus scharfem Schnabel ku-ku-ru-ku. Fliegt
Ewig ihr weißblaugefiederten Tauben, ihr
Spechte schlagt zu mit ku-ku-ku-ru
Mit dem fliederfarbenen Schwanz auch du
Adlergroßes furchtbares Tier äugst mit dem
Brennenden Stecher nach mir Ich fühle dich
Tief in der Mitte des Leibs Sommerweiches
Singvögelchen Armdicker Ast aus schwellendem
Holz und blätternden Fingern Blast in unser
Von Vögeln gesträubtes Haar bis die Schwärme
Der Nachtigalln schreien: Ku-ku-ru-ku.
Manfred Bieler
Fakten und Vermutungen zum Herausgeber + Reclam + IMDb +
Kalliope
Porträtgalerie: Autorenarchiv Susanne Schleyer + Keystone-SDA +
deutsche FOTOTHEK
Andrea Marggraf: Ein Besuch bei Sarah Kirsch
Versprengte Engel – Wolfgang Hilbig und Sarah Kirsch ein Briefwechsel
Lesung in der Quichotte-Buchhandlung in Tübingen am 8.12.2023 mit Wilhelm Bartsch und Nancy Hünger sowie Marit Heuß im Studio Gezett in Berlin.
Begrüßung: Wolfgang Zwierzynski, Buchhandlung Quichotte
Einleitung: Katrin Hanisch, Wolfgang-Hilbig-Gesellschaft e.V.
Zum 60. Geburtstag der Autorin:
Jens Jessen: Versteckte Aggressivität
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 15.4.1995
Zum 65. Geburtstag der Autorin:
Jürgen P. Wallmann: Verspielte Vision
Rheinische Post, 14.4.2000
Heinz Ludwig Arnold: Ein paar Abgründe überwinden
Frankfurter Rundschau, 15.4.2000
Peter Mohr: Meine schönsten Akwareller sint weck
General-Anzeiger, Bonn, 15./16.4.2000
Jürgen Israel: Das Herz hat einen Riss
Unsere Kirche, 16.4.2000
Horst H. Lehmann: Bibliophile Werkausgabe auf Büttenpapier
Neues Deutschland, 17.4.2000
Hans Joachim Schädlich: Sarah. Ein Geburtstagsgruß
Neue Rundschau, Heft 3, 2000
Zum 70. Geburtstag der Autorin:
Marion Poschmann/ Iris Radisch: Man muss demütig und einfach sein. Gespräch
Die Zeit, 14.4.2005
Michael Braun: Landschaften mit Endzeit-Boten
Basler Zeitung, 15.4.2005
Unter dem Titel Idyllische Apokalypse
Stuttgarter Zeitung, 15.4.2005
Helmut Böttiger: Hier ist das Versmaß elegisch
Badische Zeitung, 16.4.2005
Michael Braun: Die Schmerzzeitlose
Der Tagesspiegel, 16.4.2005
Johann Holzner: Das Leben verlängern
Die Furche, 14.4.2005
Christian Eger: Unter dem Flug des Bussards
Mitteldeutsche Zeitung, 16.4.2005
Alexander Kluy: Den Himmel vergleichen
Frankfurter Rundschau, 16.4.2005
Dorothea von Törne: Schütteln und weiterleben
Literarische Welt, 16.4.2005
Gunnar Decker: Fisch, der am Grund lebt
Neues Deutschland, 16./17.4.2005
Samuel Moser: Verse vom Rand der Welt
Neue Zürcher Zeitung, 16./17.4.2005
Hans-Herbert Räkel: Ein Elefant muss über die Alpen
Süddeutsche Zeitung, 16./17.4.2005
Sabine Rohlf: Läuse bei Mäusen in der Umgebung von Halle
Berliner Zeitung, 16./17.4.2005
Zum 75. Geburtstag der Autorin:
Andrea Marggraf: „Bevor ich stürze, bin ich weiter“
Deutschlandradio Kultur, 13.4.2010
Erich Malezke: Natürliche Distanz zur Außenwelt
SHZ, 15.4.2010
Jürgen Verdofsky: Remmidemmi in Tielenhemmi
Frankfurter Rundschau, 15.4.2010
Wilfried F. Schoeller: Hier bin ich gern und immerdar
Der Tagesspiegel, 15.4.2010
Sarah Kirsch zum 75. Geburtstag
Thüringer Allgemeine, 16.4.2010
Rebekka Haubold: Sarah Kirsch feiert 75. Geburtstag
Radio für Kopfhörer, 16.4.2010
Gunnar Decker: Pirol unter Krähen
Neues Deutschland, 16.4.2010
Brita Janssen: Sarah Kirsch zum 75. Geburtstag
BZ, 16.4.2010
Peter Mohr: Meine Naivität war mein Glück
literaturkritik.de, Mai 2010
Michael Braun: „Alles ist auffindbar in meinen Spuren“
Konrad Adenauer Stiftung, April 2010
Zum 5. Todestag der Autorin:
Heidelore Kneffel: 1997 bei Sarah Kirsch in Tielenhemme
nnz, 5.5.2018
Zum 10. Todestag der Autorin:
Karin Kisker: Zum zehnten Todestag der Dichterin Sarah Kirsch
Neue Nordhäuser Zeitung, 5.5.2023
Wulf Kirsten: Rede auf Sarah Kirsch zur Verleihung der Ehrengabe der Heine-Gesellschaft 1992.
Fakten und Vermutungen zur Autorin + Archiv + Internet Archive +
Kalliope + KLG + DAS&D + Georg-Büchner-Preis 1 & 2 und weiteres
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Brigitte Friedrich Autorenfotos +
deutsche FOTOTHEK
Nachrufe auf Sarah Kirsch: Spiegel ✝ FAZ ✝ FR ✝ Tagesspiegel ✝
Die Zeit ✝ Focus ✝ Die Welt ✝ SZ ✝ NZZ ✝ WAZ ✝ MZ ✝
KAS ✝ junge Welt ✝ Tagesschau ✝ titelblog


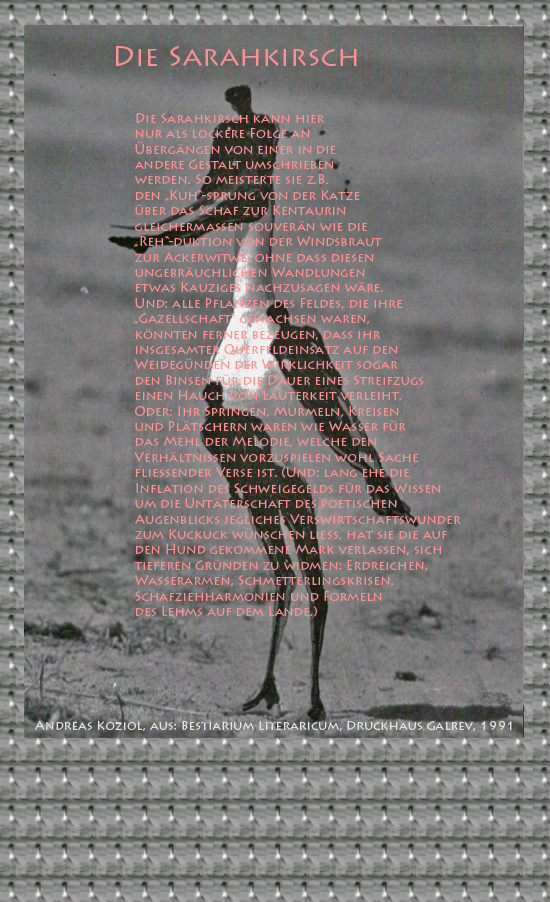













Schreibe einen Kommentar