Sarah Kirsch: Erlkönigs Tochter
MAUER
Bunt war sie hier Fenster und Türen
Aufmüpfige Leitern Ikarus-
Flügel schimärenhaft hingemalt an einer
Bestimmten Stelle auch ich nebst meinem
Unerschrockenen Kind wie wir eines Tages
Durch sie gekommen sind mit einem
Spielzeugkoffer woraus russische
Schwerter mongolische Kesselchen fielen
Einer Schreibmaschine die halbferigen
Liebesgeschichten klemmten noch in der
Walze und ein paar freundliche
Karten von Elis und Franz er war es der mich
Noch zweimal besuchte vor er in Märkisch
Buchholz unter den Rasen geriet – ich schaute
Wohl nicht zurück übte weiter den
Kopf ordentlich schütteln sprang zu
Marina und Edith in den krachenden
Wagen unsere Schwestern gehen in
Bunten Kleidern zeigten mir einen
Papierweißen Garten zwischen Norden und
nacht da lagen am Boden die
Königsmützen.
Siebenmeilenstiefelchen
Auf dem Buchumschlag steht die Dichterin in Gummistiefeln. Steht nicht, läuft, die Hände in den Manteltaschen, auf den Betrachter zu. Das Bild ist grau, der Mantel, der Schal, die Gummistiefel sind grau. In roter Schrift steht darüber: „Erlkönigs Tochter“. Das ist der Titel einer dänischen Volksballade, von Herder übersetzt, von Goethe verwandelt. Der „Erlkönig“, das weiß man, ist mit „Kron und Schweif“ in Wahrheit nur ein „Nebelstreif“, ein Naturgeist, lebendig einzig in den fiebernden Träumen der Menschen.
Bei Goethe erkennt der sterbende Knabe in seinem letzten Alptraum auch die Töchter des Erlkönigs am „düsteren Ort“, wo der Vater, der die Welt genau sieht, nichts entdeckt als die „alten Weiden so grau“. Die Töchter „wiegen und tanzen und singen“ ihr Opfer „ein“. Sie morden und singen und dichten – für die einen. Für die anderen sind sie „grau“.
Die Dichterin in den grauen Stiefeln auf dem grauen Feldweg will auf unserem üblen „Krätzeplaneten“ nicht bleiben. Sie hat „Zahnweh“, mag die „Reisekleider“ nicht mehr ablegen und ist wieder einen Gedichtband lang unterwegs – diesmal „zwischen Norden und Nacht“. Sie reist durch eine verwunschene nordische Landschaft, ans Meer, zu den Schafen und Leuchttürmen, den Schiffen und Trollen. „Die Stiefelchen“, die sie auf dem Umschlagphoto ins Bild hält, werden in Mälmö mit Meerestropfen bekleckert. Später am Mumbles-Bay trinkt die Reisende „außerirdisches Bier“ und noch später auf Snorri Sturluson schottischen Whisky.
Der Aufbruch in den hohen Norden ist eine Flucht, eine empfindsame Reise und eine wütende Befreiung. Zu Hause, „im Wintergarten“, ist alles gleich. Die Welt scheint unterzugehen, ist erstarrt und vernagelt, in grundlosem Unglück. Warum klopft noch das Herz? Aus Angst? Aus Sehnsucht? Egal. Keiner weiß, warum. „Ach, wie unglücklich wir alle sind“, wissen nicht, worauf wir warten, auf den Tod oder etwas Besseres? Eine Jammertal-Stimmung legt sich drückend aufs schöne weiße Papier.
Selten genug hat das Unglück einen Straßennamen. Normannenstraße zum Beispiel. Hier residierte die Staatssicherheit, und man kann „den Leuten beim / Reinemachen fürs neue Jahr“ zusehen. Erlkönigs Tochter muß ihr Einkommen für Kopien „preußischer Akten“ drangeben. Das alles geht, versichert sie, „großartig zu“. Manchmal hat die große Welttrauer kleine schmutzige Ursachen.
Die Abrechnung mit dem „verkommenen Staat“ ist frostig, aber nicht larmoyant. Die Dichterin verzaubert und verwandelt, was ihr begegnet, in Eis. „Ich kann“, sagt sie, „solange ich hier bin nicht sagen / Daß ich den Sommer erwarte.“ Die erstarrte Natur ist der Spiegel der verbitterten Seele, Naturlyrik im letzten Stadium.
Auf dem Weg nach Norden verliert sich der kalte Zorn –
je weiter man nach Norden gerät desto
Aufregender wachsen die Pelze. In Tromsø
dinierte ich mit einem
Bären und konnte
Kleiderlos gehn.
Mit kindlichen Augen staunt sie Schiff und Meer an, „sieben Stockwerke rauf sieben / Runter“, mit kindlicher Einfalt bedichtet sie Gräser und Schafe („Der Sommer ist kurz / der Sommer ist / Schön wenn wir im Schafspelz / Spazierengehen“) und will ihre Reisegefährten, die verblüfften Stewardessen, umarmen. Die frostige Leichtigkeit des Nordens treibt die Reisende weiter, vertreibt die dumpfen Gedanken, befördert durch den leichtmütigen Gesang, die spröde Melodie der Verse.
Die Ostberliner Endzeitstimmung, der apokalyptische Kammerton der ersten Gedichte des Bandes verschwinden. Es gibt stärkere Mächte: das Meer, der Wind, die Wolken, die Möwen, Ebbe und Flut. Die nordländischen Elementarkräfte wehen Intrigen und Aktenlage einfach davon. Unter ihrem befreienden Einfluß, der „gefeit macht gegen Verrat und / Samtige Sprüche“, entstehen vollkommen schlichte und beiläufige, manchmal blödsinnig schöne Gedichte, die nichts beweisen wollen:
Ich sah in Lohme
Eine weiße Katze mit
Blauen Augen in Lisel und
Eine rote grünäugige
Katze und konnte mich
Lange gar nicht
Entscheiden welche ich
Vorzog.
Die höhere Absichtslosigkeit solcher Idyllen, der wunschlose Frieden in der „zaubrischen Abstellkammer im Freien“, blüht nicht in altjüngferlicher Weltabgeschiedenheit. Sarah Kirsch ist keine Priesterin des Wortschönen, keine begeistert-benebelte Nordlanddichterin. Der Alltag, seine Motorpannen und Tiergeburten, seine Biersorten und Berufssoldaten sind eine natürliche Schmutzschicht, die ihre Gedichte vor der leeren Reinheit der Hochleistungslyrik bewahrt.
Der Weltuntergang, besungen in einem kunstvoll familiären Slang und in einfachen Rhythmen, zwischen Milchkühen, Gänsegeschrei und Mistwagenlenkern, hat ein faßliches, manchmal etwas zu zierliches Format. Die Apokalypse lauert im Kinderreim, springt der naiven Reisenden in die blauen Augen:
Ich sehe eine Erde die mir
Gar nicht gefällt Sommer
Vogellos Kühe
Milchlos Männer
Mutlos werde mich
Lieber! empfehlen.
Sarah Kirschs Gedichte aus den letzten Tagen des vergifteten Planeten sind freundliche Todesbotschaften, die das Tragische leicht und das Leichte tragisch machen. Sie sind Analyse und Bannspruch zugleich. Arme, glückliche „Dinger“. Aber solange man solche Kinderworte noch versteht, so lange ist nichts verloren. So lange gilt noch die Kraft des Gedichtes, seine magische Fähigkeit, jeden aufzuschrecken mit der tröstlichen Trostlosigkeit seiner Verse.
Iris Radisch, Die Zeit, 4.12.1992
An der Grenze des Sagbaren
– Neue Gedichte der Sarah Kirsch: Zwischen schmerzlicher Klarheit und Verzweiflung. –
Wider Erwarten ist sie nun doch betroffen.
Für Sarah Kirsch schien ihre einstige Heimat Ostdeutschland weit weg zu sein. Die Novemberereignisse des Jahres 1989 erreichten sie kaum, in ihrem Reisetagebuch Spreu, das 1991 veröffentlicht wurde, suchte man sie vergeblich. Im schleswig-holsteinischen Tielenhemme erinnerte sich die Autorin nur aus großer Distanz heraus an die Kindheit, an die vergiftete Saale bei Halle, die Stadt ihrer Studienzeit, an die Betonhochhäuser auf der Fischerinsel in Berlin, wo sie in den siebziger Jahren lebte und an Aufenthalte im ländlichen Mecklenburg. Erinnerungen auch an die Freunde, an Elke Erb und Adolf Endler. Was sie aber über das vergangene Staatengebilde dachte, formulierte sie salopp und drastisch: „Die Arbeitswelt als Strafkolonie – wassen komplizierter Gedankengang fürn Arbeiterstaat“.
Beim Studium ihrer Stasi-Akten ist ihr der Witz vergangen. „Meine Heimat / sieht erbärmlich aus“, konstatiert sie in ihrem soeben erschienenen Lyrikband Erlkönigs Tochter in dem Gedicht „Aus dem Haiku-Gebiet“. Da tauchen sogar die ominöse Figur Schalck-Golodkowski und die Stasi-Gebäude in der Normannenstraße im Gedicht auf. Beide erzeugen Horrorträume mit Werwölfen. Adjektive und Verben der Zerstörung deuten auf eine schlimme Befindlichkeit der Autorin: „durchlöchert“, „ertränkt“, „zerrissen“ heißt es in „Winterfeld“. In dem Gedicht „Mauer“ zieht sie Bilanz ihrer Vita, in der das Verlassen der DDR nach der Biermann-Affäre zentralen Stellenwert hat. Den „verkommenen Staat ihrer Heimat“ bedenkt sie mit bitterer Ironie. Das Vergessen der erlittenen Verletzungen scheint Voraussetzung ihres Schreibens gewesen zu sein:
… Ver
Giß! Und mache dich
Hart. So kannst du
Von Erde berichten. Den
Schwerbeschreiblichen
Bäumen Anfang des
Sommers.
In Erlkönigs Tochter berichtet die Dichterin kaum noch vom Sommer. Dunkelheit und Kälte bestimmen die Bildwelt. Hätte sie nie ihre Stasi-Akten studiert, wir könnten weiter vom schönen Landleben in Schleswig-Holstein lesen, vom Schneiden der Weidenhecken, dem Pflanzen von Büschen, dem detailversessenen, liebevollen Beschwören der Pflanzen.
Nun legt sich über das alles eine beklemmende Dunkelheit. In „Watt III“ sieht sich das Ich als Erlkönigs Tochter, die eine Verabredung mit zwei apokalyptischen Reitern hat. Das Thema ist nicht neu bei Sarah Kirsch. Die Apokalypse gehört seit ihren frühen Warngedichten zu ihrem Bildarsenal. Wie ein Seismograph halten ihre Texte die globalen Erschütterungen fest. Ihre Zeitrechnung zählt nach den Katastrophen und Gefahren, die die Erde und die Existenz des Menschen bedrohen. „Es ist der dritte Sommer nach dem Supergau in der fernen Sowjetunion“ begann das „Lob der Vergeßlichkeit und der Langeweile“. In die Sorglosigkeit der Naturerlebnisse brachen schon in dem Buch „Schwingrasen“ die Umweltkatastrophen ein. Die Verletzungen aus der Stasi-Akten-Lektüre allein sind es nicht, die diese Gedichte so bitter machen.
„Schwarzes / Wissen beugt mir den Hals“: Diese Sentenz aus dem Gedicht „Ferne“ meint auch das Wissen um die Unumkehrbarkeit des weltweiten Prozesses der Zerstörung von Natur. Gleich dem Chronisten des gleichnamigen Gedichts ist die Autorin von Grauen über den Zustand der Welt ergriffen: „Zu preisen gibt es heute nicht mehr viel.“ In „Keltisch“ sagt sie es noch deutlicher: Sie sieht eine Erde, die ihr gar nicht gefällt: „Sommer / Vogellos Kühe / Milchlos Männer / Mutlos…“ Grausig und trostlos sind die Landschafts- und Seelenbilder, wobei die Metaphern, die Sarah Kirsch erfindet, an Originalität nichts eingebüßt haben. Vom Mythischen Weltenbaum fällt kein Blatt mehr, nur noch schwarze tote Krähen („Watt III“).
Sarah Kirsch ist – wie auch immer – mit ihren Gedichten an die Grenze des Sagbaren gekommen. Die Bilder sprechen von äußerstem Schmerz und äußerster Einsamkeit:
Dein Haus steht am
Weltrand ich gehe
Durch seinen leeren Garten.
Das Fenster brennt rot
Ich bin totenblaß wie
Gefallener Schnee.
(„Engel“)
Dieselbe schmerzlich-schöne Klarheit ist in „Nördlicher Juni“ zu finden.
An anderer Stelle werden sämtliche Eigenschaften von Jahreszeiten nicht mehr wahrgenommen. Verzweiflung regiert die Bildwelt, ein Gefühl des Gefangenseins und der Ausweglosigkeit:
Fenster und Türen sind
Auf immer vernagelt und
Gänzlich verschlossen.
(„Wintergarten II“).
War so nicht auch das Empfinden im Ghetto der Mauer, dem sie doch entronnen war? Schließlich sieht sie sich selbst visionär als Tote, ausgestreckt unter dem Eis. („Wintergarten I“)
Das Tödtchen als skurrile Figur schlich sich vor einem Jahr in den Bänden Schwingrasen und Spreu erstmals in Sarah Kirschs literarische Bildwelt ein, in einem „Fuder Heu oder Stroh“. Da war vom dürren Hippenmann die Rede, der schon nach ihr Ausschau hielt, wenn auch vorläufig noch vergebens. Der Gedanke an den Tod durchbrach den harmonischen Gang der Tage, zeigte sich hier und da, auch als schwarzes Auto mit der Nummer 444, das unvorhergesehen auftauchte. Konnte sie dem Alligator Tod in Spreu noch lässig abwinken: „See you later green green Alligator“, so begegnet sie dem heimtückischen „Tödtchen“ als Erlkönigs Tochter immer öfter und unausweichlich. Aus zufälligen Begegnungen wächst die Gewißheit, daß sich diese Figur „auswachsen wird“. Visionen vom eigenen Tod gewinnen Überhand, beherrschen die Bildwelt etlicher Gedichte ganz („Wintergarten I“, „Engel“ u.a.). Der Tod erscheint nun übergroß als Herrscher am „Ziel des Wegs“. Die Gedanken an den eigenen Tod gehen mit Weltuntergangsstimmung einher: die Welt, die an ihrer Umwelt erstickt. Nicht immer gelingt ihr noch Tragikomik wie in „Sonntag“, wo sie mit Selbstmord kokettiert: „Ich konnte glatt einen gefüllten Trommelrevolver vergeuden an mir“. Von dieser Erde will sie sich keck „empfehlen“. Ernsthafter sind Verse wie „Nördlicher Juni“, „Wintergarten I“ und „Engel“, die ohne diese Koketterie auskommen. In ihnen ist Sarah Kirsch traurig, müde und ohne Trost – ein neuer Ton, der mit Erlkönigs Tochter Einzug in ihr Schreiben hält.
Nicht neu, aber verstärkt tritt jene Hexenhaftigkeit zutage, die seit den Zaubersprüchen präsent ist. Gespenstisches durchgeistert die Landschaften, die sie beschreibt, von den Wesen mit „kalten Pupillen“ („Erdenliebe“) bis zum Totenschiff („Ungewisses Licht“), von ominösen „brüchigen Stimmen“ („Stimmen“) bis zu den Trollen und Hexen, die „Verwünschungen ausspeien“. Aus nordischen Märchen, Sagen und Mythen hat Sarah Kirsch Motive und Figuren des Bösen entlehnt, die den tödlichen Touch des neuen Buches unterstreichen.
Wo die Dichterin sonst Tragisches leicht ins Tragikomische wenden konnte, bleibt immer öfter das Tragische allein präsent.
Nicht alle Gedichte des Bandes scheinen gelungen, manches wirkt fragmentarisch. Gedichten wie „Seither“ und „Königlich“ hätte man mehr Zeit zum Reifen gegönnt. Sie wirken in ihrem Stenogrammstil lediglich wie Skizzen.
In keinem anderen Buch stellt die Autorin ihr eigenes Schreiben so in Frage wie in diesem.
Sie spricht von „eigenen Unwahrheiten“, von „sich selbst den Buckel vollügen“, gebraucht sogar Worte des Selbsthasses: „Mein schwermutiges / Sumpfherz vergißt sein Quäken“, reflektiert über Schönheit, wo sie sonst schöne und formvollendete Gedichte schrieb. Von Selbstzweifel gepackt und verzweifelt an der Welt.
Dann wieder Verse, die eine sagenhafte Spannung zwischen zwei Worten der ersten und letzten Zeile entfalten, etwa zwischen dem Wort „schön“ und dem Wort „Bomben“ („Brief“). Selbstgespräch in einer großen Krise, so liest sich das Gedicht „Kalt“ mit den aufschlußreichen Zeilen:
Sonst greint die Sehnsucht
Ihren verlorenen Traum von der Schönheit der Welt die so
Verloren darnieder
liegt…
Auch hier wird reflektiert statt gestaltet. Wo die Lyrikerin sonst an den Dingen ganz dicht dran ist, muß sie sich diese mühselig vorstellen, ist sie auf Vermutungen angewiesen. Woher kommt diese plötzliche Distanz zu Menschen und Dingen? „Ich stelle mir Menschen vor“, die „Besitzer des Lichts bleiben Gegenstand meiner Sorge“ heißt es pur prosaisch und wenig kunstvoll in „Geschöpfe“. Solche noch wenig durchgestalteten Texte zu veröffentlichen hat doch die Sarah Kirsch gar nicht nötig.
Geblieben ist die Weltoffenheit. Noch immer trägt Sarah Kirsch „Reisekleider“. Sie hat auch Erlkönigs Tochter, geschrieben als eine Weltbürgerin. Reisegedichte über Norwegen, Island, die Inseln Moen und Foer, auch über England bereichern den Band wesentlich. Die Akustik von Meer und Wind, die nuancierte Beschreibung des Lichts, die heitere Phantastik der Reiseepisoden bringen Bewegung in die metaphorische Welt der Kälte. Aber die Phantasie der Kirsch, die die Dinge verwandelt und zu geheimnisvollen Zeichen und neuen Spielanleitungen macht, hat sich im Eis verfangen.
Die unmittelbare Berührung mit den Elementen, das ursprüngliche Leben in und mit der Natur, das ihre Texte so authentisch macht, ist zugunsten einer zeichenhaften Überhöhung zurückgedrängt, die zwar immer auch vorhanden war, aber nie so im Zeichen des Erstarrens von Welt stand wie in diesem Buch.
Immer
Sprang ich auf das letzte
Fahrende Schiff im September.
So resümiert die Autorin ihr Leben.
Warum wählt sie so früh, zu früh, die Vergangenheitsform, warum nicht die des Präsens, der Gegenwart? Nur die Dichterin selbst könnte darauf eine Antwort geben.
Dorothea von Törne, Neue Zeit, 12.9.1992
Sarah Kirsch: Erlkönigs Tochter
„Meine Töchter führen den nächtlichen Reihn / Und wiegen und tanzen und singen dich ein“. Diese Worte spricht der Erlenkönig zum verängstigten Knaben in Goethes bekannter Ballade. Die Lyrikerin Sarah Kirsch identifiziert sich zumindest mit einer dieser Töchter. Stimmt diese Identifikation oder haben wir es nur mit einem hübschen, nicht ganz durchdachten Titel zu tun?
Von den Töchtern des Erlenkönigs wissen wir nur, daß sie den Jungen in ihr Reich holen wollen, dorthin, wo es anscheinend kein Leid, sondern nur Freude gibt. Auch die Lyrikerin bemächtigt sich des Lebendigen, sie ist sich der Magie, oder vielleicht eher des Zaubers ihrer Sprache bewußt. (Vgl. etwa ihren Lyrikband Zaubersprüche, 1972). Der Unterschied zwischen den Elementarwesen und der Lyrikerin liegt darin, daß letztere nach der Ungebrochenheit dieser von der Psychoanalytikerin Emma Jung als Animafiguren bezeichneten Wesen verlangt. Oder sollen wir aus dem Begehren der Töchter des Erlenkönigs schließen, daß auch sie nach einer Komplettierung ihrer unvollständigen Natur verlangen?
Sarah Kirsch hält sich viel in der Fremde auf. Diesmal in Schweden, auf Island und in den USA. Sie sucht wahre Harmonie von Mensch und Natur, begegnet aber Anstößigem und verarbeitet es zu Gedichten. Auch daheim in Schleswig-Holstein will sie sich nicht von einer bösen Normalität vereinnahmen lassen. Das Gedicht „Malmöer Segen“ schließt mit den Zeilen:
Gefeit machen gegen Verrat und
Samtige Sprüche
Die Welt ist trostlos und tröstlich zugleich. Das fragile Gleichgewicht ist ständig bedroht von der Unwahrheit und vom Elend der Welt. Deswegen liegt es nahe, folgendes Gedicht nicht als Tribut zu deuten, sondern es an erster Stelle auf die Dichterin selbst zu beziehen:
KELTISCH
Ich sehe eine Erde die mir
Gar nicht gefällt Sommer
Vogellos Kühe
Milchlos Männer
Mutlos werde mich
Lieber! empfehlen
Sarah Kirsch schöpft aus dem Arsenal des Mythischen und Märchenhaften. Sie bilden die Grundsteine ihrer Gegenwelt. Sie verbindet ihre Gedichtzeilen sehr häufig durch Enjambement. Scheint der Lesefluß dadurch begünstigt zu werden, die verwirrende Fortsetzung des Gedankens in der nächsten Zeile bewirkt jedoch das Gegenteil. Obwohl dieses Verfahren dem Leser von Sarah Kirsch‘ Werk inzwischen vertraut ist und fast als Handelsmarke dieser Lyrikerin erkennbar wird, ist es immer noch effektiv und überraschend. Störend dagegen, weil klischeehaft, wirkt allmählich die Übernahme umgangssprachlicher Formen wie:
Braunschwarz das Ödland wien
Isländischer Abendkaffee
Sarah Kirsch schreibt interessante Lyrik. Wirklich überwältigend ist der vorliegende Band aber nicht.
Hans Ester, Deutsche Bücher, Heft 2, 1993
Glück im Unglück
Der Raum des Gedichts – ist das die Kammer, in die man sich von des Tages Jammer zurückzieht, um auf eben ihn zu stoßen? Lyrik hat es zu tun, so der Eindruck nach der Lektüre einiger neuer Gedichtbände, mit den Versäumnissen des Lebens, getäuschten Erwartungen, fehlgeleiteten Wünschchen, begrabenen Hoffnungen, den versandenden Lustgefühlen und wuchernden Frustrationen. Wie jeder erste Eindruck ist auch dieser recht einseitig. Vergessen ist dabei, daß das Gedicht, spricht es vom Bedrückenden des Lebens, immer auch dessen Berückendes erinnert. Allerdings, was das Rühmen betrifft, ist heutzutage Rilkes Diktum umgekehrt worden: Nur im Raum der Klage darf die Rühmung gehen.
Die Lust am Gedichtelesen ist etwas anderes als der lustige Konsum in der Erlebnisgesellschaft. Melancholie ist der Urlaut des Gedichts. Denn was es sieht, fühlt und spürt, das sieht, fühlt und spürt es wie zum erstenmal. „Zum erstenmal, das heißt: Nie wieder“, um den schönen Satz aus Ilse Aichingers „Spiegelgeschichte“ zu zitieren. Genug der Vorrede, Schauen wir in die einzelnen Gedichtbände – mit der Lust an den Eigenheiten und Unterschieden.
(…)
Bewundernswert ist das Vermögen dieser Autorin, Natur und Kunst zu trauen (das Verb passiv wie aktiv gebraucht). Sie setzt, der Band Erlkönigs Tochter stellt es erneut unter Beweis, die Tradition des deutschen Gedichts fort, das sich, von Brockes über die Droste bis zu Rilke beispielsweise, an der sicht- und fühlbaren Welt mit allen ihren Geschöpfen erfreut.
Sarah Kirsch, geboren 1935, lebt heute in Schleswig-Holstein; die Natur, die ihr gefällt, ist nicht gefällig, in ihr riecht es nach „Tang Salz und Wahrheit“; die auf Reisen nach Norwegen, Dänemark, Island erfahrenen Landschaften sind karg und urtümlich: in gewissem Sinne Gegenwelten zur vernutzten „Umwelt“. Gesang ist Abgesang; nur selten wird das direkt thematisiert, um so nachdrücklicher sind die Signale:
Jetzt wo der Planet vergeht
darf ich Abendstern sagen
(„Wolken“).
Und „Der Chronist“ bemerkt:
Zu preisen gibt es heut nicht mehr viel.
Und doch schreibt Sarah Kirsch Lob- und Preisgedichte – auf dem Untergrund „schwarzen Wissens“: geschriebenes Glück im Unglück. Beeindruckend ist der sparsame poetische Strich einer das Wesentliche erreichenden Konzentration und Verdichtung.
Im Herbst ist es die Schönheit des Abends, die mich am tiefsten bewegt, wenn ich den Krähen zusehe, die zu zweien, dreien oder vieren zu Horst ziehen.
Wiewohl die Krähen, die poetischen Urvögel, auch Sarah Kirschs Landschaften bevölkern, stammt das Zitat nicht von ihr, sondern aus Sei Schonogons Gedanken unter dem Kopfkissen. Klabund verweist auf diese Autorin in dem Kapitel seiner „Literaturgeschichte“, das den japanischen Beitrag zur Weltliteratur bedenkt. Und wenn er das Haiku des Dichters Basho preist, das in drei Zeilen Himmel und Erde beschwöre, dann rühmt er eine lyrische Intensität und Prägnanz, die in vergleichbarer Weise Sarah Kirschs Kurz-Gedichte auszeichnet. Die Lakonik der Seele, wie sie dem Geist des Haiku entspricht, war mir die eigentliche Entdeckung in Sarah Kirschs neuem Gedichtband:
Das närrische Gelb dieser Wasserrosen
Der dunkle der einverständige Fluß.
Sein Jammerlied singt mir der Herbst
Die halbe Nacht im Kamin.
(„Gelb“)
Diese Verse wären wohl der rechte Schluß für eine Betrachtung gewesen, die vom geschriebenen Glück im Unglück handelt. Wäre da nicht der alte, ewig neue Generationenkonflikt, Grünbeins Frage und Attacke. Um es kurz zu machen: Nach der Lektüre der besprochenen Bände denke ich nicht, daß „die Jungen“ die ersten sind, die das Trügerische der Identität erfahren, wiewohl sie die ersten sein mögen, die auf das Scheitern der geschichtlichen Utopien nicht mit Klage, Anklage und Schwermut reagieren, sondern frohgemut zur Kunst als Glücks-Spiel im Unglück finden. Doch haben wir diese Botschaft – nur ästhetisch läßt sich das Dasein rechtfertigen – nicht schon von Nietzsche und Benn vernommen? Wie auch immer: Ich kann des lebendigen Vorurteils nicht entraten, daß noch immer die Authentizität realen Unglücks – des „dokumentierten“ und empfundenen – als „Ausdrucksqualität“ wirksam wird: (Wort)Kunst ist – in meinetwegen „ironisch spielerischer Tarnung“ – ein ernstes Spiel, das sich von Spielerei unterscheidet.
Jürgen Engler, neue deutsche literatur, Heft 483, März 1993
Unbefangenheit der Trauer
Als Peter Huchel von Deutschland-Ost nach Deutschland-West überwechselte, sagten wir ihm und uns voraus, daß nunmehr die Dauerpreisgesänge der Rezensenten enden würden; und so war es denn auch, ohne jeden Zusammenhang mit seinem bedeutenden Spätwerk. Im übrigen sind die Superlative für die, glaube ich, hoffe ich, unbestechliche Sarah Kirsch nahezu peinlich: denn schon die Erstsemester der Universität wissen, daß es in der oberen literarischen Kategorie Superlative nicht gibt; oder soll man vielleicht abwägen, ob Mörike größer ist als die Droste?
Sarah Kirschs Arbeiten, die ohne Rühmen auskommen, verlangen als Antwort kein Rühmen; Literatur kann die Fremdheit zwischen Mensch und Welt immer nur bestätigen, nie aufheben, das verlangt Distanz. Die Desinvolture der Autorin, die auf geschliffene Kunstfiguren verzichtet (wozu, wird sie sich vielleicht fragen, diese Mätzchen, es geht um andere Dinge in diesem Leben, vor diesem Tod), dieses Saloppe beunruhigt doch ihre Bewunderer zuweilen, auch ihre Wahl, auf dem tiefsten Land zu wohnen, irgendwo in Dithmarschen, hinter dem Deich, provoziert bei den ergebenen Besuchern, denen sie mit bewunderungswürdiger Geduld antwortet, immer die gleichen Fragen nach dem Rückzug in die Resignation? oder gar in die Idylle? Leicht vergißt man, was Idylle ist; ein vorübergehend abgeschirmter Ort mitten im Chaos.
Der Titel des neuen Gedichtbands ist genial. Hinter dem – leicht abgewandelten – Zitat der Goethe-Ballade steht alle Hintergründigkeit von Sarah Kirschs Kunst und gleichwohl der Rückruf zur Realität. („Mein Vater, mein Vater, und siehst du nicht dort / Erlkönigs Töchter am düstern Ort? – Mein Sohn, mein Sohn, ich seh es genau / es scheinen die alten Weiden so grau.“) Die angstvolle Vision und die Erscheinungen der Wirklichkeit gehen jene unauflösliche Verbindung ein, die für diese Autorin kennzeichnend ist.
In fast allen Gedichten herrscht die Unbefangenheit der Trauer. Daß sie meist nicht mit Klage verbunden ist, grenzt den Ton von der Barockdichtung wieder ab, der zuweilen da ist. Auch ist Sarah Kirschs Lyrik monologischer, kaum ein Du, weder im Himmel noch auf Erden, das Ich wirft sein Netz des Schmerzes über die Welt, fischt, unbekümmert, oft selbst erstaunt, die eigenen Bilder, Spiegelbilder, aus dem Grund der See, der Luft, der Erde.
Viele Gedichte hier segeln Reisen nach, vor allem in Skandinavien, Dänemark, Norwegen, Schweden, Island, Finnland, nie ein Anhaltspunkt, Ortsnamen werden hingeworfen, Anspielungen: man könnte sich glatt nördlichen Geographiestudien widmen, die Landkarte studieren, dänische Verwandte ausfragen, die schließlich im Lexikon auch Snorri Sturluson fanden, einen isländischen Sänger und Dichterkönig des dreizehnten Jahrhunderts – die aber an der Vokabel „Gryllteiste“ auch scheiterten; man könnte den Verlag herzlich um ein paar sachdienliche Hinweise bitten – sicher viel zu mühsam; man könnte schließlich Sarah Kirsch fragen, warum sie einem so viel Skandinavisches an den Kopf wirft? Wer soll denn mit der blauäugigen Katze in Liselund etwas anfangen, wenn man nicht zufällig weiß, daß das ein Schlößchen in Dänemark ist? Die Autorin würde wahrscheinlich antworten: die Ortsnamen kamen so daher wie Wolken, flogen in die Feder und schließlich sei es doch wohl auch egal, wo man sich befände, oder nicht? Da hat sie allerdings recht.
Der Norden scheint Sarah Kirschs Gegenwelt zum Süden, der, lichtüberströmt, lichtbelastet, für Augen wie ihre noch viel bitterer ist; aber vielleicht ist das alles viel zu spekulativ; diese Autorin scheint nicht zu kalkulieren, in den besten Zeilen blitzt Unwiderrufliches auf. Hier scheint die Ambivalenz zu enden – zwei Gesichter hat die Natur, die grauen Weiden und Erlkönigs Tochter –, wer es nicht sieht, ist selber schuld.
Barbara Bondy, Süddeutsche Zeitung, 30.9.1992
Gesten der Leichtigkeit
Auch im neuen Gedichtband sind die alten Zauberwörter romantischer Poesie wieder da: sie sind auf wundersame Weise heil geblieben, ihre Substanz scheint durch den Geschichtsprozeß kaum beschädigt. Zwar werden ehrwürdige poetische Vokabeln wie „Schönheit“, „Sehnsucht“ oder „Traum“ gelegentlich durch mündliche Redefragmente und schnoddrigen Alltagsjargon konterkariert; aber der Glaube an ihren fortwirkenden Zauber scheint ungebrochen.
So wird auch im Gedicht „Wolken“ getreu klassisch-romantischem Vorbild das harmonische Verhältnis zwischen Natur und lyrischem Subjekt suggeriert, zugleich aber diese Vermischungsphantasie ernüchtert. Auch wenn es der Dichterin, wie es an anderer Stelle heißt, „Trostlos zumute (ist) auf diesem verblichenen Planeten“, beharrt sie doch auf ihrem Recht, den Abendstern poetisch erstrahlen zu lassen:
Sie verschütten den
Abendstern über dem Felsen.
Im Gebirge pflückten wir rote
Blumen auf stürzenden Pfaden
Ich sah sein übermütiges
Herz wir lachten am Abhang.
Jetzt wo der Planete vergeht
Darf ich Abendstern sagen.
So beschwört Sarah Kirsch auch hier den „verlorenen Traum von der Schönheit der Welt“ – in einem historischen Augenblick, da der „Krätzeplaner“ sein Selbstzerstörungswerk vollendet. Die Ambivalenz ihrer poetischen Naturerfahrung ist Sarah Kirsch nicht anzukreiden, im Gegenteil. Die poetischen Mittel jedoch, die sie bemüht, bleiben allzu oft im Bannkreis eines naturlyrischen Traditionalismus. Zwar wird durch schroffes Enjambement und strenge Reduktion der Satzzeichen in den meisten Gedichten ein unruhiger Rhythmus erzeugt, der eine vorschnelle Einfühlung verhindert. Aber die Dichterin kokettiert gerne mit gefälligen Märchenmotiven und Zaubersprüchen, mit Diminutivformen, putzigen Verballhornungen und allerlei preziösem Schabernack.
Eine schnörkelhafte Vokabel wie „Planete“, die ja eine allzu glatte Alliteration („Planet vergeht“) verhindern soll, ist eine typische Preziosität in ihrer Dichtung. Die apokalyptische Botschaft, die das Gedicht ausspricht, wird durch den Gebrauch dieser verniedlichenden Vokabel idyllisiert. Der poetischen Beschwörung der nahen Dinge wird so nicht selten die Wirkung genommen durch einen selbstverordneten Unschuldsblick auf die Welt, eine angestrengte Naivität und Einfachheit, die auch unversehens in Banalität umkippen kann. Wie weit ist etwa die simple Apokalyptik des Gedichts „Keltisch“ von den dürftigen Hervorbringungen der biederen „Öko-Lyrik“ entfernt:
Ich sehe eine Erde die mir
Gar nicht gefällt
Sommer
Vogellos Kühe
Milchlos Männer
Mutlos werde mich
Lieber! empfehlen.
Solche Gesten der Leichtigkeit, auch wenn sie noch so mühsam erarbeitet sein mögen, tragen wenig zu einer poetischen Erhellung lebensbedrohlicher Verhältnisse bei. Die Dürftigkeit der Eingangsverse: „Ich sehe eine Erde die mir / Gar nicht gefällt…“ hätte man einem Alltagslyriker der siebziger Jahre kaum verziehen. Auch andere Zeilen lassen sich finden, die den Leser durch forcierte intellektuelle Unterbeanspruchung langweilen. Bei der spielerischen Reformulierung romantischer Versrede, wie sie Sarah Kirsch betreibt, droht nicht selten Sentimentalität und Regression.
Michael Braun, Badische Zeitung, 6.3.1993
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Heinrich Detering: Ankunft auf dem Meeresgrund
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 29.9.1992
Eckart Krumbholz: Tochter der Weißerle
Die Weltbühne, Heft 47, 1992
Alexander von Bormann: „Zu preisen ist nicht viel“
Frankfurter Rundschau, 5.12.1992
Michael Braun: Naturlyrik am Ende der Natur
Hirschstraße, Heft 1, 1993
„Die Endlichkeit dieser Erde“
– Laudatio auf Sarah Kirsch zur Verleihung des erstmals verliehenen Literatur-Preis der Konrad-Adenauer-Stiftung am 30.4.1993 in Weimar. –
In Allerlei-Rauh, der realitätsnahen Märchen-Chronik, die Sarah Kirsch 1988 veröffentlicht hat, in einer Chronik, in welcher schon der Vorspruch, wonach in diesem Buch „alles frei erfunden und jeder Name… verwechselt“ wurde, die satirische Verkehrung der Welt anzeigt, fand die Erzählerin Gefallen daran, für unseren „Blauen Planeten eine archaische und eine augenblickliche Natur zu unterscheiden. Die eine, sagte ich mir, und sank fußbreit ins Moor, lappt manchenorts noch in die andere über, und ich war es in diesem Augenblick sehr zufrieden, an solcher Stelle mich aufzuhalten, weil eine Existenz in reiner archaischer Natur, wenn ich sie noch gefunden hätte, mir meiner Bedürfnisse wegen und der meinem Alter angemessenen körperlichen Fähigkeiten nicht mehr möglich schien, die zeitgenössische Natur jedoch, wie sie eine Stadt vielleicht abgibt, für mich nur noch ein gelangweiltes Entsetzen brachte vor Leere und Fülle, blitzendem Tand“. Dieses Bekenntnis zur Suche nach der archaisch-elementaren Natur der Welt hat nichts mit jener „bukolischen Sendung“ zu tun, auf die Sarah Kirschs Werk gelegentlich reduziert wurde. Die Unterscheidung von Zivilisatorischem und Archaischem, das in der außermenschlichen und der menschlichen Natur auch dort waltet, wo der scheinbar selbstbestimmte Mensch der Natur ganz entglitten ist, bietet eine Art von Schlüssel zu diesem großen – auch im Erzählduktus, im Kinderbuch und in den Gemälden lyrischen – Werk. Es ist mit der Sonde der Sprache, in welcher bewußt realitätsnahe Elemente gesprochener Sprache mit Stilfiguren der barocken Rede und dem Ton einfacher Formen der Poesie verbunden werden, auf der Suche nach der Natur des Menschen, nach der eigenen Natur und der der anderen, auf der Suche nach einer ursprünglichen, vom Schutt der Zivilisation noch nicht überdeckten Natur und nach deren Entfremdung. Daß weibliche Natur dabei im Zentrum der Überlegung steht, daß das hier sprechende Ich unverkennbar eine Frau ist, bedeutet keine Verbeugung vor einer kurzlebigen Mode, sondern ist, wie vieles bei Sarah Kirsch, dem Einverständnis der Jahrhunderte entnommen, wonach die Frau der unentfremdeten Natur näher steht als der Mann. In dessen Freiheitsdefinition nämlich, „frei“ von den Zwängen der Natur, hat die Entfremdung des Menschen von der Natur, auch von der Natur des eigenen Leibes, ihren Ursprung. Wenn Sarah Kirschs Texten schon in früher Zeit nichts von der Prüderie des sozialistischen Realismus anhaftet, wenn sie als frei, gelegentlich sogar als freizügig beschrieben werden, weil zum Beispiel Katharina Sprengel, von der Geschlechtsumwandlung wie von einem „Blitz aus heitrem Himmel“ getroffen, als Max unter der Dusche steht: „Max fühlte das Wasser im Rücken kälter werden und hielt das dritte Bein in die Luft“ – so erscheint darin heitere Distanz zu jener Geschlechtlichkeit, in der allein der zivilisatorische Mensch sich seiner naturhaften Herkunft gewiß sein kann. Aus der Sehnsucht nach einem Blick in die Tiefen des Elementaren, in einen Spiegel, welcher das unentfremdete Bild des Menschen zeigt, erklären sich prägende Stilzüge im Werk von Sarah Kirsch:
– die Nähe zu archaischen Formen der Poesie, zum Zauberspruch, zum Märchen und zur Magie,
– die Mitexistenz mit dem Wort der Dichter von den Anfängen bis zur Gegenwart, so daß es ist, als vereine sich in zitatgeprägter Rede die Poesie der Jahrhunderte in einer neuen zeitlos gültigen Weise phantasiegeleiteten Sprechens,
– der Versuch zur poetischen Maskierung und das Gespräch mit toten und lebenden Dichtern über alle Grenzen der Zeit, der Situation und der Gesellschaftssysteme hinweg.
Es war einmal während des letzten Krieges oder dem davor oder einem ganz anderen noch, da lebte ein Kürschner in Leipzig und war zum dritten Mal ausgebombt. Besaß noch eine ganz kleine Werkstatt und eine Frau, die war die Schönste auf der Welt und hatte Haare vom schwärzesten Schwarz und immer noch einen Zobelpelz in ihrer Truhe.
So melancholisch urvertraut und doch aktuell beginnt Sarah Kirschs Fassung des Inzestmärchens von Allerlei-Rauh, das uns in den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm überliefert ist. Günter Kunert, den Sarah Kirsch charakteristisch ihren „Freu(n)d“ genannt und das „n“ in „Freund“ dabei eingeklammert hat, weil er Freund und Seelenanalytiker zugleich ist und oft genug „seinen eigenen – gewiß gerechtfertigten – Katastrophenblick auf sie übertragen“ hat –, Kunert also hat darauf hingewiesen, daß in der ungeheuren Sanftheit von Sarah Kirschs lyrischer Sprache eine zersetzende und eine aufklärerische Kraft zugleich am Werk sind, daß diesen Gedichten „zwar keineswegs die Festigkeit der Form, wohl aber jede Härte und Schärfe fehlt. Sie sind ungeheuer sanft. Und in ihrer Sanftheit sprechen sie Erschreckendes, ja, das Schreckliche mit schöner Naivität aus, als bestünde es in Wirklichkeit nicht, sondern sei eigentlich eine Erfindung unseres Kollegen Hans Christian Andersen“. Die Beobachtung, daß Rettung und Zerstörung zugleich in einer Sprache wohnen, die „den Zwiespalt des Wirklichen selber“ benennt und deshalb Erschreckendes „sanft“ auszudrücken vermag, weist über die Gedichte und ihren Anlaß selbst hinaus in das „kosmische Erschrecken“ der Romane und Erzählungen Adalbert Stifters. Am Saum der Moderne haben die Menschen Europas, unter dem Eindruck des explodierenden Erfahrungswissens, erstmals ihre Einsamkeit in dem um das Schicksal alles Lebenden unbekümmerten All erfahren und darauf mit jenem „kosmischen Erschrecken“ reagiert, welches die Literatur seit dem Ende des 18. Jahrhunderts ebenso prägt wie das zivilisatorische Erschrecken die Literatur unserer Tage:
Niemals wird auf den
Armen Gefilden Herrlichkeit
Liegen wie in der Kindheit als noch die
Fichten grün und licht lebten.
Schwarzes
Wissen beugt mir den Hals.
Sarah Kirsch, seit der intensiven Stifter-Lektüre in ihrem Elternhaus mit dem „kosmischen Erschrecken“ des 19. Jahrhunderts ebenso vertraut wie seit der Brecht-Lektüre mit dem zivilisatorischen Erschrecken unserer Zeit, hat Stifters „sanftes Gesetz“, das heißt das immer gleich gültige und das menschliche Freude wie menschliches Leid gleichgültig ertragende, alles umfassende Gesetz des Werdens und Vergehens im Gleichnis eines, des eigenen, Erfahrungswandels dargestellt, im Spiegel einer, ihrer, Kindheit, am Beispiel der für sie selbst und die vielen geltenden Liebeserfahrung. Sie hat der eigenen Poesie die evolutive Kraft des „sanften Gesetzes“ eingeschrieben und ist damit ebensoweit von der Idyllik nachmoderner Heimatkunst, der Nostalgie des unverstellten Lebens entfernt wie vom Katastrophismus der Propheten des Weltuntergangs.
Das Zitat und im Zitat der höchst beredte Dialog mit den Dichtern aller Zeiten prägt dieses poetische Sprechen auch da, wo es dies selbst nicht zu wissen vorgibt, wo es vom Flügel der literarischen Erinnerung nur gestreift wird – und dort, wo das Bild der Vergangenheit die Folie abgibt für den gegenwärtigen Zustand, wo das sympathetische Gedicht entsteht. Von einem Besuch im Mecklenburgischen – lange vor dem Fall der Mauer – berichtet die Erzählerin in Allerlei-Rauh, von einem Besuch bei „Christa Kassandra“, und dreimal darf nur raten, wer gemeint ist, der Christa Wolfs Buch Kassandra (1983) nicht gelesen hat:
Wir saßen vor der Küchentür und sahen erst den Schwalben, später den Fledermäusen zu, die alle nicht genug kriegen konnten, ihre Schleifen zu machen, sich tragen zu lassen von den rechtmäßigen Winden des Landes, doch es schien mir unfaßbar, daß die Einwohner wieder bereit waren, vom Kleister der Hoffnung zu zehren, an ein Wunder zu glauben, das ausgerechnet von dort kommen sollte, wo Heinrich Vogeler einstmals in einem Lager verscholl.
Auch wer Gottfried Benns Herbststrophe
Noch einmal das Ersehnte,
den Rausch, der Rosen Du –
der Sommer stand und lehnte
und sah den Schwalben zu
nicht im Ohr hat, wird sich dem Zauber der spätsommerliehen Stunde nicht entziehen können, dem Zauber eines Augenblicks, in dem die Gewißheit des Untergangs angehalten ist – durch die in ihrer Vergeblichkeit bitter-süße Hoffnung auf das Wunder von dorther, wo der Maler schwermütiger Moorlandschaften, Heinrich Vogeler, 1942 im stalinistischen Kasachstan gestorben ist.
Und noch ein Beispiel – nach dem Märchenton und dem Zitatstil, die zusammen den von Peter Hacks spöttisch so genannten, aber in der Tat unverwechselbaren „Sarahsound“ prägen – will ich nennen: den Dialog der heute lebenden Autorin mit den Geschwistern aus dem 19. Jahrhundert, mit der Droste etwa, deren „jüngere Schwester“ zu sein sie im Gespräch mit Maria Frisé weit von sich weist – „,Viel zu hoch gegriffen‘, findet sie.“ –, deren Spuren sie doch auf ihren Alphabetisierungs- und Missionsreisen folgt, bis sie in Meersburg das Vorwort zu ihrer „Droste-Auswahl“ herunterbetet und meint, dem alten Laßberg, Annettens Schwager, begegnet zu sein – oder mit Bettine von Arnim, die vor zweihundert Jahren ebenso wie ihre fühlende und lebende Schwester an der Politik, den Königen des Staates, gelitten hat wie an den Königen des Herzens, die „herzlos“ mit Liebe und Vertrauen spielten. Die Existenz Bettines, die Goethe vergeblich geliebt hatte, die von ihm, Christianes wegen, aus dem Weimarer Haus gewiesen worden war, denkt das lyrische Ich in einem der schönsten Gedichte Sarah Kirschs mit; wie Bettine ist dieses Ich von den Königen des Staates ebenso enttäuscht wie von den Königen des Herzens, aus der Geborgenheit des „kleinen wärmenden Landes“ ebenso vertrieben wie aus der Gemeinschaft der Liebe. An sich selbst erfährt dieses Ich das Schicksal aller unbedingten Liebe, die Enttäuschung, die Hoffnung, den Schrecken, der zwischen der Furcht vor der Verhaftung und dem plötzlichen Glück des Wiedersehens kaum einen Abstand kennt:
DER 7. ABEND
Guten Abend Bettina
Nein, es ist gar nicht
Leichter geworden. Zwar
Müssen wir nicht mehr warten
Bis die Kinder erwachsen, bis der Mann
Frömmelnd geworden, endlich gestorben. Doch
Immer
Sind wir allein wenn wir den Königen schreiben
Denen des Herzens und jenen
Des Staates. Und noch
Erschrickt unser Herz
Wenn auf der anderen Seite des Hauses
Ein Wagen zu hören ist.
Mit diesem Gedicht aus dem Zyklus „Wiepersdorf“ von 1976 steht Sarah Kirsch in einem so lebendigen Dialog mit den toten Dichtern, daß es ist, als seien sie gegenwärtig: mit Bettine, die einst mit Achim von Arnim und ihren Kindern auf Schloß Wiepersdorf gelebt hat und dort – zusammen mit ihrem Mann – begraben ist; ihr von den Zeitgenossen als revolutionär beschimpftes Buch „Dies Buch gehört dem König“, mit der Beschreibung der Massenarmut in Preußen, entstand lange nach Arnims Tod und wurde 1843 in zwei Bänden veröffentlicht; mit Eberhard Meckel vielleicht, der 1935 mit Günter Eich und Peter Huchel eine Fahrt in die Mark Brandenburg, nach Wiepersdorf, unternahm; mit Günter Eich und seinem in der Erinnerung an diese Fahrt entstandenen Gedicht „Wiepersdorf, die Arnimschen Gräber“ und mit Peter Huchels berühmten Versen
Wie du nun gehst im späten Regen,
der Mond und Himmel kälter flößt
und auf den laubverschwemmten Wegen
den Riß in die Gespinste stößt,
flammt über Tor und Efeumauer,
die Gräber wärmend noch ein Blitz.
Und flatternd schreit im hellen Schauer
das düstre Volk am Krähensitz.
(…)
Wo gingt ihr hin? – Geliebte Stimmen,
unsterbliche, wo seid ihr wohl?
Es ist, als habe Sarah Kirsch mit ihrem Zyklus „Wiepersdorf“ auf diese Frage geantwortet, als sei in ihrem Gedicht, in der Stille des Abends in Wiepersdorf – zum Zeitpunkt der Entstehung des Gedichtes Erholungsheim für Schriftsteller in der DDR – die unsterbliche Stimme der Liebe zu vernehmen, die noch dem existentiellen Schrecken den zögernden Pulsschlag der Hoffnung abzulauschen vermag. So wird der soeben zitierte, „Der 7. Abend“ überschriebene Entwurf zur Nummer „9“ der letzten Fassung des Zyklus verkürzt, in der lakonischen Reduzierung der Entstehungssituation die „archaische“ Situation der Liebe – „immer“ – spiegelnd:
Dieser Abend, Bettina, es ist
Alles beim alten. Immer
Sind wir allein, wenn wir den Königen schreiben
Denen des Herzens und jenen
Des Staates. Und noch
Erschrickt unser Herz
Wenn auf der anderen Seite des Hauses
Ein Wagen zu hören ist.
In der Tat, Sarah Kirsch war nie eine „politische Dichterin“, jedenfalls nicht das, was man darunter seit dem 19. Jahrhundert, seit Herwegh und Freiligrath, verstehen konnte, sie ist keine politische Autorin in dem Sinne, den Goethe kurz vor seinem Tod gegenüber Eckermann gerügt hat, wenn er meinte:
Wir Neueren sagen jetzt besser mit Napoleon: die Politik ist das Schicksal. Hüten wir uns aber mit unseren neuesten Literatoren zu sagen, die Politik sei die Poesie…
Und doch ist sie eine politische Autorin in einem umfassenden Sinn, in dem Poesie und Politik, Menschlichkeit und Bürgerlichkeit nicht getrennt sind, in dem der Staatsbürger nicht nur „Betroffener“ der Politik ist, sondern selbst jenes Politik gestaltende Zoon politikon, als das die Alten die Menschen sehen wollten. „Niemand muß zwischen den Zeilen lesen“, schrieb Rolf Michaelis über die Gedichte von Sarah Kirsch.
Mit Meisterschaft – und Diskretion – gelingt der Dichterin Engführung privater und politischer Themen, Gleichlauf von Bewegungen in der Natur und in der Gesellschaft, Spiegelung innerer Vorgänge in äußeren Erscheinungen. Nie werden die Verse ,allgemein‘, pseudo-poetisch verschwommen; konkret sind sie auf Zeit und Welt dieser Dichterin bezogen, auch wenn Sarah Kirsch Traumlandschaften entwirft oder durch Märchenwälder schweift…
Der deutschen Redensart: „Wenn es in Obergau nicht mehr aufhört zu regnen, meint Obergau, die Welt gehe unter“ – ist Sarah Kirsch nicht verfallen, nicht einmal dem weiter gespannten Irrtum, daß der Untergang einer europäisch geprägten Denkwelt und die Verschiebung der Gravitationszentren dieser Erde aus dem Westen in den Osten der Welt den Anbruch der Menschheitsdämmerung verkündige, doch ist in der „Engführung“ von politischen und individuellen Themen, in der Überführung der Entstehungssituation in die nachvollziehbare konkrete Situation, in der magischen Verschränkung der Fernsehwelt mit erfahrener Natur nicht nur die Gefahr des großen Untergangs, sondern auch die Beschleunigung dieser Gefahr präsent:
Es war dieser Falkland-Sommer, als das verständige Land aber ein Königreich eben aufzuckte um seine letzten Kleinodien ein paar Schafe Farmer und Pinguine abenteuerlich Krieg zu führen begann. Wenn es tagelang regnete ich unter den ausgebreiteten sehr hohen Eichen umherging wie unter Wasser im dunkelgrünen Licht brennende Schiffe fest auf der Netzhaut glaubte ich oft ertrunken zu leben und wenn ich empor sah ins eintönigste Wasser zog etwas über mich hin das noch am ehsten den Kielen und Schatten der Kriegsschiffe glich. Hagelkörner wie Taubeneier fielen und lagen als Geschmeide unter durchschossenen Blättern auf den Viehkoppeln aus. Ein Vogel der mir ins Blickfeld geriet duckte sich eng an den Boden und starrte in grünweiße Farben.
Selten wird in modernen literarischen Texten die auf Fernsehformat geschrumpfte Welt in ihrer unheimlichen Nähe, in ihrer aus Mitleid und Verrohung, aus Bedrohung und Voyeurismus gemischten magischen Realität so deutlich wie in diesem kurzen Prosastück aus dem Band Irrstern von 1986. Mit der vom Menschen erschaffenen und zerstörten zivilisatorischen Welt ist die archaische Natur gleichfalls vom Untergang bedroht. Die Gefahr, daß der Mensch die Elemente aufbietet zur Inszenierung des globalen Selbstmordes, ist keineswegs gebannt.
Sarah Kirsch ist 1935 in Limlingerode im Südharz geboren. Nach der Schule arbeitet sie in einer Zuckerfabrik, studiert dann Forstwissenschaft und Biologie, doch erfolgt schon die Wahl dieses Studiums aus der Erfahrung von Literatur:
… weil ich so viel Stifter gelesen habe in meinem Elternhaus…
Zwischen 1963 und 1965 studiert sie am Literaturinstitut Johannes R. Becher in Leipzig und lebt dann als freie Schriftstellerin. 1969 wird ihr Sohn geboren, der 1990 ein Studium der Skandinavistik in Kiel begann. Im November 1976 unterschrieb sie die Petition gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns und wurde 1977 aus der SED sowie aus dem Schriftstellerverband der DDR ausgeschlossen. Im August 1977 verließ Sarah Kirsch die DDR und lebt seit 1983 in Tielenhemme, einem kleinen Ort in Schleswig-Holstein, in einem Schulhaus, das in vielen journalistischen Miniaturen idyllisch beschrieben ist. Erlkönigs Tochter ist der bisher letzte Gedichtband von 1992 überschrieben, Spreu nannte Sarah Kirsch das mir bisher liebste ihrer Bücher. In ihm wird nach dem Kompositionsmuster von Allerlei-Rauh der Zustand des der Vereinigung zustrebenden Deutschland als der eines strukturierten Chaos beschrieben. Auf den „Missionsreisen“ und bei ihren „Alphabetisierungsversuchen“, wie sie ironisch die eigene Tätigkeit charakterisiert, zeigt sich eine verletzbare, aber diskussionsfeste Frau, die den verbreiteten Anekdotenjagden durch die Behauptung zu entgehen versucht:
Zuverlässigkeit Menschen gegenüber kommt gar nicht mehr auf. Habe den günstigen Ruf mir lange erworben daß es gut sein kann daß ich gar nicht erscheine wie eine Frau Callas. Die ich außerordentlich liebe.
Doch findet sich inmitten der Splitter von Reisen zwischen dem 4. Mai 1988 und dem 1. Dezember 1990 in der Flucht der vorüberziehenden Bilder auch ein nachdenklich stimmender Satz: „Es ist spät auf Erden.“, der sich auf den Tag ebenso beziehen kann wie auf das Weltalter.
Wer sich auf das Werk von Sarah Kirsch, das Nachdenklichkeit und Geduld erfordert, einläßt, wird ein vielgestaltiges Œuvre entdecken, ein Bild des Menschen, der sich immer gleich bleibt und sich doch revolutionär verändert, die im Kern unwandelbare archaische Natur des Menschen in der rasenden Flucht ihrer historischen Wandlungen. Vielleicht ist die Sprache, die dieses Werk spricht, allein geeignet, „bis ins Magma der Erde“ zu sehen, wo selbst die Feuerwesen, die Salamander, sich häuten:
… ich weiß nicht, was ich der Elster antworten soll, die mich nun überfliegt in ihrem schwarzweißen Federkleid ohne verbindliche Abstufung drin, wenn sie lacht und mich fragt, was willst du, was schlägst du vor. Ich muß mit meinem Gehirn Mord und Totschlag annehmen und die Endlichkeit dieser Erde, über die der Komet wieder hinzieht, der Bethlehem-Stern.
Es ist unheimlich und schön zugleich, mit diesem Werk zu leben, denn die sanfte Schönheit dieser lyrischen Sprache ist Teil jenes Schreckens, der die Erfahrung wahren Lebens in sich birgt.
Wolfgang Frühwald, Sinn und Form, Heft 4, Juli/August 1993
Mitschnitt der Preisverleihung des Peter-Huchel-Preises vom 3.4.1993
Andrea Marggraf: Ein Besuch bei Sarah Kirsch
Versprengte Engel – Wolfgang Hilbig und Sarah Kirsch ein Briefwechsel
Lesung in der Quichotte-Buchhandlung in Tübingen am 8.12.2023 mit Wilhelm Bartsch und Nancy Hünger sowie Marit Heuß im Studio Gezett in Berlin.
Begrüßung: Wolfgang Zwierzynski, Buchhandlung Quichotte
Einleitung: Katrin Hanisch, Wolfgang-Hilbig-Gesellschaft e.V.
Zum 60. Geburtstag der Autorin:
Jens Jessen: Versteckte Aggressivität
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 15.4.1995
Zum 65. Geburtstag der Autorin:
Jürgen P. Wallmann: Verspielte Vision
Rheinische Post, 14.4.2000
Heinz Ludwig Arnold: Ein paar Abgründe überwinden
Frankfurter Rundschau, 15.4.2000
Peter Mohr: Meine schönsten Akwareller sint weck
General-Anzeiger, Bonn, 15./16.4.2000
Jürgen Israel: Das Herz hat einen Riss
Unsere Kirche, 16.4.2000
Horst H. Lehmann: Bibliophile Werkausgabe auf Büttenpapier
Neues Deutschland, 17.4.2000
Hans Joachim Schädlich: Sarah. Ein Geburtstagsgruß
Neue Rundschau, Heft 3, 2000
Zum 70. Geburtstag der Autorin:
Marion Poschmann/ Iris Radisch: Man muss demütig und einfach sein. Gespräch
Die Zeit, 14.4.2005
Michael Braun: Landschaften mit Endzeit-Boten
Basler Zeitung, 15.4.2005
Unter dem Titel Idyllische Apokalypse
Stuttgarter Zeitung, 15.4.2005
Helmut Böttiger: Hier ist das Versmaß elegisch
Badische Zeitung, 16.4.2005
Michael Braun: Die Schmerzzeitlose
Der Tagesspiegel, 16.4.2005
Johann Holzner: Das Leben verlängern
Die Furche, 14.4.2005
Christian Eger: Unter dem Flug des Bussards
Mitteldeutsche Zeitung, 16.4.2005
Alexander Kluy: Den Himmel vergleichen
Frankfurter Rundschau, 16.4.2005
Dorothea von Törne: Schütteln und weiterleben
Literarische Welt, 16.4.2005
Gunnar Decker: Fisch, der am Grund lebt
Neues Deutschland, 16./17.4.2005
Samuel Moser: Verse vom Rand der Welt
Neue Zürcher Zeitung, 16./17.4.2005
Hans-Herbert Räkel: Ein Elefant muss über die Alpen
Süddeutsche Zeitung, 16./17.4.2005
Sabine Rohlf: Läuse bei Mäusen in der Umgebung von Halle
Berliner Zeitung, 16./17.4.2005
Zum 75. Geburtstag der Autorin:
Andrea Marggraf: „Bevor ich stürze, bin ich weiter“
Deutschlandradio Kultur, 13.4.2010
Erich Malezke: Natürliche Distanz zur Außenwelt
SHZ, 15.4.2010
Jürgen Verdofsky: Remmidemmi in Tielenhemmi
Frankfurter Rundschau, 15.4.2010
Wilfried F. Schoeller: Hier bin ich gern und immerdar
Der Tagesspiegel, 15.4.2010
Sarah Kirsch zum 75. Geburtstag
Thüringer Allgemeine, 16.4.2010
Rebekka Haubold: Sarah Kirsch feiert 75. Geburtstag
Radio für Kopfhörer, 16.4.2010
Gunnar Decker: Pirol unter Krähen
Neues Deutschland, 16.4.2010
Brita Janssen: Sarah Kirsch zum 75. Geburtstag
BZ, 16.4.2010
Peter Mohr: Meine Naivität war mein Glück
literaturkritik.de, Mai 2010
Michael Braun: „Alles ist auffindbar in meinen Spuren“
Konrad Adenauer Stiftung, April 2010
Zum 5. Todestag der Autorin:
Heidelore Kneffel: 1997 bei Sarah Kirsch in Tielenhemme
nnz, 5.5.2018
Zum 10. Todestag der Autorin:
Karin Kisker: Zum zehnten Todestag der Dichterin Sarah Kirsch
Neue Nordhäuser Zeitung, 5.5.2023
Wulf Kirsten: Rede auf Sarah Kirsch zur Verleihung der Ehrengabe der Heine-Gesellschaft 1992.
Fakten und Vermutungen zur Autorin + Archiv + Internet Archive +
Kalliope + KLG + DAS&D + Georg-Büchner-Preis 1 & 2 und weiteres
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Brigitte Friedrich Autorenfotos +
deutsche FOTOTHEK
Nachrufe auf Sarah Kirsch: Spiegel ✝ FAZ ✝ FR ✝ Tagesspiegel ✝
Die Zeit ✝ Focus ✝ Die Welt ✝ SZ ✝ NZZ ✝ WAZ ✝ MZ ✝
KAS ✝ junge Welt ✝ Tagesschau ✝ titelblog


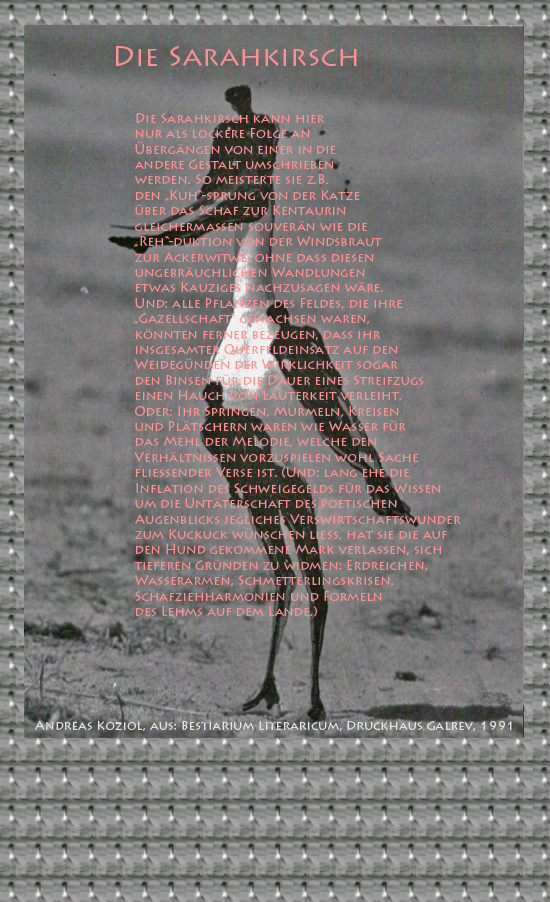













Schreibe einen Kommentar