Steffen Mensching: Erinnerung an eine Milchglasscheibe
ERINNERUNG AN EINE MILCHGLASSCHEIBE
Der Januar war schneeig.
Ich hatte eine Scheibe.
Ich wußte, wenn ich reibe,
Verwelkt der blinde Frost.
Ich drückte mit der Stirne
Und küßte lang das weiße Glas.
Einer fragte, siehst du was.
Durch sagt ich seh ich.
Ich mag seine Gedichte,
weil sie keinen vordergründigen Optimismus predigen, weil sie alles in Zweifel ziehen und sich nicht beruhigen lassen mit irgendwelchen Antworten, weil sie trotz aller Bekenntnis zu Tragik, Trauer, Ausweglosigkeit nie ausweglos bleiben. Immer sucht er zwischen bekannten Dingen und Leuten, zwischen Dichtern, Denkern, Malern und sich einen Weg, und Stück für Stück bohrt sich sein oft lakonischer Vers ins Bekannte, entwöhnt uns der alten Kenntnis und entdeckt dabei geheime Regionen, wo nicht nur Ironie blühen kann. Sein historisches herangehen rettet ihn vorm Versacken im Unmittelbaren; so kann er über sich selbst und sein Leben hinaus. Seine oft gewählte Jargonsprache und seine Gegenwarts-Sujets schützen ihn wiederum vor einer Autonomie der Kunst, vor Dualismus von Text und Welt. Seine Texte klingen: rauh! Seine besten Gedichte stärken mich, weil ich merke, daß sie keine Schmuckstücke für Vitrinen sind, sondern seine Produktionsinstrumente, mit denen er sich Sinn, Wahrheit, Experimente, Provokationen, Entdeckungen etc. schafft, sich selbst damit auflädt.
Hans-Eckardt Wenzel, Mitteldeutscher Verlag, Klappentext, 1984
Form und Haltung
Steffen Menschings erster Gedichtband wurde als literarisches Ereignis begrüßt. Der Autor erhielt den Debütpreis des Schriftstellerverbandes. Die Kritik, auch die der Tagespresse, ging an seinen Gedichten nicht vorbei. Das Wesentliche ist gesagt. Ist es das? So schnell ist Lyrik wie diese nicht ausgeschöpft. Bereits Erörtertes muß hier nicht ausführlich wiederholt werden. Über Menschings Beziehungen zu Traditionen großer sozialistischer Lyrik unseres Jahrhunderts – Majakowski, Brecht, Neruda, Ritsos und andere – ist Auskunft gegeben worden. Auch sei der Versuchung widerstanden, nochmals thematische und inhaltliche Fülle des Bandes katalogartig aufzuschließen. Vielmehr seien einige Gedanken zu und auch anhand von Menschings Gedichten notiert.
Die Kritiker nähern sich von verschiedenen Seiten her seinen Texten. Michael Franz spricht von „literarischer Rhetorik“ und von „lustvoller Pointierung“; Dorothea Gelbrich bemerkt zuerst einen Sensualismus, der sich „nicht gleich in Metapher und Symbol verflüchtigt“; Horst Haase verweist auf die Einheit des Wirklichkeitsverbundenen und Artifiziellen; Harry Riedel hebt den „reflektorisch-assoziationsfordernden Gedichttyp“ hervor (alle in: Weimarer Beiträge 7/85). Weitere, nicht minder bedenkenswerte Bestimmungen könnten angeführt werden. Wie aber gehen die alle zusammen? Die Schwierigkeiten für die Kritik, die Eigenart des Dichters Mensching genau zu bezeichnen, liegen in der Sache selbst: in der Vielfalt und Vielgestaltigkeit seiner Lyrik.
Nicht zufällig unterzogen Dieter Schlenstedt und Michael Franz das Gedicht „In einem Hotelzimmer in Meißen lese ich“ differenzierter Betrachtung, regt es doch in besonderem Maße an, über die Chancen heutiger Gedichte nachzudenken. Mensching erinnert in ihm an den griechischen Ependichter Kleophon, von dem keine Zeile blieb, nur die zweimalige Erwähnung in der Poetik des Aristoteles. Kleephon „stellt Alltagsmenschen vor uns“.
Am deutlichsten ist eine Sprache
Nur aus gemeinüblichen Worten.
Und was anders will ich. Aber sie wirkt flach.
Sagt Aristoteles. Beispiel
Ist die Dichtung des Kleophon. Und wenn
Er es geahnt hat, denke ich
Und senke den Kugelschreiber langsam
Auf das weiße Blatt Papier.
Das Bekenntnis zum „Alltagsmenschen“ und zur Alltagssprache ist kein auf dieses Gedicht begrenzter Einfall. In seinem Beitrag „Die kleine Geste“ zum Almanach DDR-Literatur ’83 im Gespräch (Aufbau-Verlag) verdeutlicht Schlenstedt, wie im Gedicht „Auf einem Bein, nachts, nackt“ das Bekenntnis eingelöst wird – in einem Gebilde, „verfertigt nur aus gemeinüblichen Worten, reimlos, in unregelmäßigen Versen und ohne Metaphern“. Zugleich zeigt er, wie sich das Programm dichterisch verwirklicht, wie bedeutungsvoll die „kleine Geste“ sich darbietet – das Gedicht kann ohne Metaphern auskommen, es ist selbst Metapher. Im lakonischen Aufzeigen und Aufzeichnen eines intimen Vorgangs ist ein Grunderlebnis aufbewahrt: Die Erfahrung von Lebensmut, der aus spontaner Zuwendung erwachsen kann.
Auf solche Erfahrungen, die uns angehen, stößt man in Menschings Gedichten: poetisch-sinnträchtige Mitteilung als Aufforderung, die Erfahrungen zu teilen (oder ihnen andere entgegenzuhalten). Ein gültiges Gedicht ist nicht allein aus Wörtern und Bildern gemacht, es bedarf der Erfahrungen als die der Literatur wesentliche Art der Verallgemeinerung. Sicher sind und bleiben diese immer ans Subjekt gebunden. Das heißt jedoch nicht, daß ihr Inhalt lediglich subjektiv ist. Vielmehr konstituieren sie sich als Einheit des Objektiven und Subjektiven: von Welt- und Selbsterkundung. Erfahrungen muß man machen – die Sprache ist genau: Sie bezeichnet sowohl das Moment des Erlebens, ja Erleidens, als auch das aktive Element. Wer sich nicht der Welt aussetzt, wird sie nicht erfahren. Der Dichter organisiert sich seine Konflikte, indem er – ungedeckt, die Welt und sich entdeckend – ins Offene geht.
Menschings Bekenntnis zum Alltagsmenschen ist ja nicht das Bekenntnis zum vor sich hin lebenden Menschen. Alltag ist in seinen Gedichten der Alltag der Epoche mit ihren zerreißenden Widersprüchen, mit ihren Ängsten – drohende nukleare Vernichtung ihr ungeheuerlichster Schrecken! –, Fortschritten und Krisen, Hoffnungen und Widerständen. Und der Blick reicht weit zurück, der „Ausflug“ in die Geschichte ist folgenreich. Sozialistische Dichtung kann nicht selektiv sein, sie muß sich der ganzen Geschichte stellen. Sie vergißt neben Marx, Engels, Lenin, Luxemburg nicht Stalin („Er betrachtet ein Foto“) und auch Trotzki nicht („Siqueiros: Unser Antlitz“). Das im Ausguß schmatzende Blut, die „traurigen Niederlagen der Jahrhunderte“, die davon unberührte, ungerührte Schönheit der Kunst zwingen den Blick auf die „Pulsader wie, auf eine Uhr, / Die man anhalten kann, / Indem man sie öffnet“. („Betrachtung eines Stillebens“). Weiter heißt es:
Aber ich will nicht.
Ich habe als Kind zu lange Steine
Und Briefmarken gesammelt, um schon zu verzweifeln.
Auch hier das Springen vom Größten zum Kleinsten, die nicht ohnmächtige Erfahrung: Aus unscheinbaren Batterien auch speist sich der Wärmestrom dieser Dichtung, die sich in all ihren Mischungen als revolutionäre „Farbenlehre“ begreift.
So wie der Begriff vom Alltagsmenschen bei Mensching eben nicht auf seine platteste Bedeutung zu reduzieren ist, so ist auch der Umgang mit der Alltagssprache alles andere als aufs Gemeinübliche beschränkt. Sie liefert den Ausgangsstoff, sein Vorhandensein ist ein Indiz für Realismus. Tradierte poetische Sprache wird nicht verabschiedet, jedoch verschmolzen mit den uns Heutigen geläufigen Begriffen und Wörtern aus Politik, Ökonomie, Industrie, Mode und Konsum. Man lese daraufhin Gedichte wie „World time table“, „Blanqui in der Boutique“, „Grenzwertberechnung“, „Romantische Ballade“. Es wurde schon darauf hingewiesen, daß der Lyriker auf die Alltagswendung und den Jargon, auf eine betont nüchterne, ja rüde Sprache zurückgreift (Mathilde Dau, Weimarer Beiträge 7/85). Aber diese Sprachgebung wird poetischem Formgesetz unterworfen, Formen oft dazu, die auf Versmaß, Reim, Strophe bauen (der von Schlenstedt hervorgehobene Gedichttyp ist ja nicht der einzige im Band): Aus dem Widerspruch von „laxer“ Sprache und „strenger“ Form (womit nicht lediglich tradierte „gehobene“ Form gemeint sei!) erwächst spezifische Wirkung. Verfasser jüngster Lyrik überlassen sich gern der Sprache, und oft genug versinken sie in ihren Wirbeln. Mensching leitet Sprache in Bahnen, kontrolliert und reguliert ihren Fluß. In fließender, reißender Zeit verspricht Form einen Halt; in ihr verkörpert sich die energische Anstrengung der poetischen Bewältigung bedrängend-widersprüchlicher Wirklichkeit. Baudelaire vertrat die Überzeugung, daß „das Schreckliche, kunstvoll ausgedrückt, zur Schönheit wird und daß der rhythmisierte, gegliederte Schmerz den Geist mit einer ruhigen Freude erfüllt“. Baudelaire findet in der Architektur sein geheimes Ideal; „schön wie ein Traum aus Stein“ soll das Gedicht aus den trüben Fluten der Geschichte ragen. So wenig die Erfahrung geschichtlichen Ruins Menschings Gedichte grundiert – er vertraut darauf, daß die in Form gebannten Ambivalenzen sich in den Lesern und durch sie wieder in Bewegtheit und Bewegung auflösen –, so sehr ist doch das Streben nach dem Muster auch die Eingebung der Not und Not-Wendigkeit. Er und wir bedürfen dieses Anhaltens und Festhaltens der historischen Prozesse:
… versuche dich
Zu erinnern. Ja, aber wo, fragte ich, fange ich an
(„Arteriosklerose“).
Stephan Hermlins autobiographischer Text „Hölderlin 1944“ beginnt mit einer nachhaltig beunruhigenden Sentenz:
Einer der schrecklichsten Aspekte der Kunst besteht in ihrer Verwendbarkeit, die um so größer ist, je mehr wir es mit bedeutender Kunst zu tun haben.
In einem der schönsten und tiefsten Gedichte des Bandes, „Betrachtung eines Stillebens“, reflektiert Mensching über die widersprüchliche Beziehung von Kunst und Geschichte, den geschichtlichen Gebrauch und Mißbrauch von Kunst. In der Konfrontation der Leuchtkraft des Stillebens von Francisco de Zurbarán mit den Dunkelheiten, Versehrungen und Verheerungen andauernder menschlicher „Vorgeschichte“ liegt mehr als eine Paraphrase barocker Vergänglichkeitsmotive.
Und sie duftet noch immer,
Die Rose, nach der Lorcas Finger angelten,
Die Rose, mit der General Franco
Durch das stille zerschossene Madrid ritt,
neunzehnhundertneununddreißig,
Als du schon weg warst und ich noch ungeboren,
Du Königsmaler, damals strahlten
Deine Zitronen wie faschistische Leuchtkugeln.
Künstlerisches Erbe ist widersprüchlich in sich: Beruht seine Wirkung auf zeitenüberdauerndem Ausdruck menschlichen Daseins in vollkommener Form, so ist darin seine Menschlichkeit gleichsam dinghaft geronnen. Seine Macht gegenüber den Zumutungen des Unmenschlichen ist zugleich seine Ohnmacht; es bedarf, um in wahrhaft menschlichem Sinne werk-tätig zu sein, der Einbeziehung in revolutionäre Bewegung. Die Grundhaltung von Peter Weiss’ Ästhetik des Widerstands ist auch Menschings Gedicht eingeschrieben: Im Kampf erst der Arbeiterklasse und ihrer Verbündeten um eine von Ausbeutung und Unterdrückung freie Welt erfüllt sich das Humanum der Kunst.
Poetische Form und somit Erkenntnis bei Mensching verdanken sich einer Haltung, die sich in Widersprüchen findet, anwachsenden „lokalen und temporären Verirrungen“ („London, fünfzehnter März dreiundachtzig“), ohne sich in sie zu finden, sich in ihnen zu verlieren. Noch das Uneindeutige und Zwiespältige, erst recht das Neben- und Ineinander von Liebe und Haß wird von Mensching eher kühl denn ungebärdig aufgeregt formuliert. Denn auch dort, wo er auf feste Formen nicht zurückgreift, kennt er keine ausufernden Sätze, flutenden Satzsequenzen, rauschhaften Bildfolgen. Lakonismus und Präzision kennzeichnen seine Fest-Stellungen. „Meine Funktion ist eindeutig uneindeutig“, wird definitiv und definitorisch im Gedicht „Grenzwertberechnung“ die Aufgabe des Dichters benannt, in einem Text, der im metaphorischen Vergleich von Wasser und Poet Alltags- wie Wissenschaftssprache dichterisch ausbeutet und ausdeutet. Das Wasser ist „offensichtlich für jedermann“ – poetische Definitionen dieser Art haben die Genauigkeit der Dinglyrik Francis Ponges. Wird in dieser jedoch alle Menschlichkeit den Dingen zugeschrieben, so sind Menschings Gedichte ganz mit Ich-Gefühl durchtränkt; freilich durchdringt es die Dinge und Vorgänge, aus ihnen ist es zu erfahren.
Lyrik, wenn sie nicht hermetisch oder sprachexperimentell strukturiert ist, bedarf durchaus des rhetorischen Elements. Dennoch bleibt als Frage, ob Franz’ Begriff pointierter Rhetorik am Platze ist angesichts einer Vielzahl von Gedichten, in denen sich das in ihrem jeweiligen Vorwurf und Vorgang Enthaltene wie von selbst zu entfalten scheint. Der Eindruck artistischer Mühelosigkeit, wie ihn solche Gebilde wecken, ist letztlich auf Menschings Vertrauen zum konkret Gegenständlichen zurückführbar, dem Mißtrauen gegen Gefühligkeit und verbale Deklaration. Er auch mag Michael Franz zu dem Urteil geführt haben:
Virtuosität sollte kein Vorwurf sein; ich habe jedoch den Eindruck, daß Mensching seine eigene Sprache und Form noch nicht gefunden hat.
Ob und inwieweit diese Anmerkung berechtigt ist, wird sich zeigen. Wir sollten aber keinesfalls eigene Sprache mit Manier als leicht erkennbarem subjektivem Markenzeichen verwechseln. Charakterisiert es doch Mensching, daß er seine lyrische Subjektivität jeweils der konkreten ästhetischen Idee – nach Immanuel Kant eine Idee, die viel zu denken Anlaß gibt, ohne daß ihr doch ein bestimmter Gedanke adäquat sein könne – zu unterstellen und die ihr gemäße Gestalt zu finden sucht.
Jürgen Engler, neue deutsche literatur, Heft 395, November 1985
„… Dich zu treiben bis aufs Blut“
Mensching/Wenzel. Das Namenspaar hat sich längst eingeprägt. Es verbindet sich fest mit den Programmen der Gruppe Karls Enkel. Und diese Programme erregten ein nachhaltiges Interesse, weil sie sich dem Sog kunstgewerblich betriebener Verliederung widersetzten: Sie zu genießen wie einen rötlich überhauchten Herbert-Roth-Abend, das ging (und geht) nicht.
Indessen publizierten beide auch schon in Zeitschriften und Anthologien; 1979 gab es ein Mensching-, 1983 ein Wenzel-Poesiealbum; und nun liegt von beiden je ein umfangreicherer, den Ertrag etlicher Jahre präsentierender Gedichtband vor: Mensching bündelte 61 lyrische Texte, Wenzel 51 sowie einen Essay. Und dieses buchpublizistische Doppeldebüt ist natürlich fällig gewesen. Kein Zweifel aber auch, daß ihm hochgespannte Erwartungen galten: Erwartungen, welche man den als gültig ausgewählten Versen zweier – und nicht etwa noch blutjunger – Schreibender entgegenbrachte, die eben die Bürde eines Rufs schon besitzen und die als Exponenten ihrer Generation bereits im Bewußtsein sind. Und insofern handelt es sich nicht um gewöhnliche Debütbünde. (Auf ihre Weise belegt dies übrigens die Kaufbegierde der Literaturfreunde: Beide Bücher waren sogleich vergriffen.) In ihnen lesend, mißt man – unwillkürlich – das nackte und bloße Wort an einem Anspruch, den die möglichkeitsreichen Akteure des Liedertheaters zustande kommen ließen.
Wer gewöhnt ist, sich das Titelgedicht eines Lyrikbandes vorab anzusehen, der dürfte bei Menschings „Erinnerung an eine Milchglasscheibe“ erst einmal sehr enttäuscht sein. Hier der Text:
Der Januar war schneeig.
Ich hatte eine Scheibe.
Ich wußte, wenn ich reibe,
Verwelkt der blinde Frost.
Ich drückte mit der Stirne
Und küßte lang das weiße Glas.
Einer fragte, siehst du was.
Durch sagt ich seh ich.
Erste Reaktion nach der Lektüre: Ein frostiger Januar, der Fensterscheiben vereisen läßt, ist mit „schneeig“ nicht sinnfällig bezeichnet. Doch dieses „schneeig“, so erwägt man sogleich, wurde aus Reimgründen (: „seh ich“) gewählt; das prägnantere „eisig“ kam nicht in Frage. Ein solches „eisig“ allerdings, dies als nächste Überlegung, verbot sich wohl auch deswegen, weil es eine Klarheit assoziierbar machte, die für den Januar, von dem das Gedicht sprechen möchte, gerade nicht charakteristisch sein soll: Ein schneeverhangen sichtbenehmender Januar ist gemeint. Und das – an sich unschöne – Wort „schneeig“ erweist sich demnach gewiß als treffend. Aber ist es nicht trotzdem anfechtbar? Weil es der nachfolgend so wichtigen Eiseskälte eben doch kaum angemessen vorarbeitet?
Zweite Reaktionsstufe: Nein, hier hat man es nicht nur mit mangelhafter Präzision in puncto Wortwahl zu tun. Der Schaden sitzt tiefer; und er ist beträchtlich für das Gedichtganze. Denn es ist ja so: Der schneeverhangene Januar, den Vers 1 de facto bezeichnet, erscheint ab Vers 2 plötzlich auf eine Fensterscheibe projiziert. Dementsprechend verwandelt sich die „schneeige“ Trübheit unversehens in eine dicke (sichtbenehmende) Eisschicht – womit zusammenhängt, daß vom Autor, und erst jetzt, jener starke Frost „herbeigezogen“ werden muß, den dick vereiste Fensterscheiben voraussetzen. Derart freilich sieht sich der Leser mit einer gedanklichen Unredlichkeit konfrontiert: Vermittels einer bildsprachlichen Manipulation wird die Trübheit der Außenwelt auf ein Fensterscheibenproblem reduziert, dem das Ich gewiß beizukommen vermag: Es kann sich ja nun befähigt wissen, durch Reiben/Drücken/Küssen den Eisbelag zu tilgen; und jene „Durchsicht“, auf die das Gedicht hinwill, läßt sich jetzt verhältnismäßig leicht erreichen. Im übrigen bezeugt noch die Pointe, in die der Text einmündet, das Fadenscheinige des Erfolgserlebnisses. Befragt, was er sieht, fertigt der Fensterlochgucker den Frager mit jenem „Durch“ ab, das lediglich über die Sichtmöglichkeit als solche Auskunft gibt; und das Pseudo-„Schlagende“ der Pointe besteht also darin, daß sie eigentlich nur kaschiert, was an Fatalem wohl doch einzugestehen wäre. Denn wie? Was anders soll dieser Fensterlochgucker schon sehen können als einzig wieder jenen „schneeig“-trüben Januar des Eingangsverses? Und wäre das Gedicht von gedanklich-bildsprachlicher Konsequenz, müßte es dann nicht auf eine Version von „Ein Hund kam in die Küche…“ hinauslaufen?
Dritte Reaktionsstufe schließlich: Der Text trägt den Titel „Erinnerung an eine Milchglasscheibe“. Der mitgeteilte Vorgang wird also als denkwürdig apostrophiert und hervorgehoben. Und das Vergegenwärtigen steht dabei ja wohl im Zeichen von Selbstermunterung, im Zeichen der Aufforderung ans eigene Ich, sich durch wahrnehmbare „Aussichtslosigkeit“ nicht deprimieren zu lassen, ihr vielmehr vermittels einer intellektuellen und sinnlichen Aktivität zu begegnen, die „Durchblick“ denn doch zu erzwingen vermag. Zu weitgreifend interpretiert? Sicher nicht. Immerhin wählte der Autor den Gedichttitel zum Bandtitel; der Gedanke an Programmatisches – was sonst? – hat ihn gewiß geleitet. So aber hat man es mit dem Ärgernis zu tun, daß jenes Programmatische durch einen „exemplarischen“ Text zum Ausdruck gebracht wird, der in sich nicht stimmt und in dem sich das Ich etwas vormogelt.
Dabei möchte man dem Anspruch, den Mensching aufrechtzuerhalten strebt, nur allzu gern ungeteilten Beifall zollen. Keine Frage nämlich: Was Mensching im verunglückten Titelgedicht bündig zu artikulieren suchte, bemüht er sich – als Haltung – allenthalben im Band für viele Verse konstitutiv zu machen. Und das schlägt sich nicht zuletzt darin nieder, daß er momentane Erfahrungswelt immer wieder kontrapunktiert: Er arbeitet daran, sich den engen Horizont, den diese Erfahrungswelt ihm bietet, entschieden zu öffnen; und die Beharrlichkeit, mit der er das tut, unterscheidet ihn auch ganz beträchtlich von den meisten seiner schreibenden Generationsgefährten. Natürlich ist deren Sehnsucht auch die seine; und er überhebt sich nicht. Im Gedicht „World time table“ ist sie prägnant ausgesprochen:
… und daß ich
Nicht weg darf hier
Und kann, aus meiner weltoffnen Haut.
Aber bei ihm fehlt im wesentlichen die anderweitig – in verschiedenen Schattierungen – so oft anzutreffende Larmoyanz; das Wort von der „weltoffnen Haut“ ist keine bloße Behauptung; und, er holt sich bewegte geschichtliche Welt, überlieferte Kämpfe, Zeugen und Zeugnisse, Gestalten und Bilder herzu. So fordert sich der in seiner empirischen Existenz Beschränkte, in eine verhältnisstabile Kleinwelt Hineingeborene (und in ihr Aufgewachsene) Akt um Akt einer blickerweiternden Auseinandersetzung ab: sentimentalische Aktivitäten eines Ichs, das Ungenügen empfindet, sich aber weigert, lediglich Klage und Verdrossenheit zu artikulieren.
Freilich gewinnen von den einschlägigen Gedichten nur diejenigen – und es sind wenige – den Ausdruck unbedingter existentieller Verbindlichkeit, in denen das Ich der spürbar starken Versuchung trotzt, sich selber denn doch wieder zurückzunehmen und damit die eröffnete Kontaktbeziehung ihrer spannungsvollen Authentizität zu berauben. Jedenfalls läßt sich einem (schon etwas älteren) Gedicht wie „Traumhafter Ausflug mit Rosa L.“ nicht viel an die Seite stellen. Dieses Luxemburg-Gedicht aber ist ein wirklich überzeugender lyrischer Text. Hier gibt es keinerlei Verschlierung und keinerlei Zurückweichen vor einer Ich-Kundgabe, die das wache Bewußtsein der Situation, aus der heraus dieses Ich spricht, aufs wahrhaftigste mit ins Gedicht einbringt. Und solche Rückhaltlosigkeit bleibt im Text bis zum Ende, ja in den letzten Versen gelingt es gar, die schöne Souveränität der Verse insgesamt noch einmal nachdrücklich hervorzukehren:
… und ich ruf einen Gruß
Und hab Angst, daß du stirbst, und hab Angst,
Daß du lebst und spring auf
Und mein Fuß
Verfängt sich in Marmor, Schleifen und Lilien.
Doch gerade in Anbetracht dieses Luxemburg-Gedichts muß dann die Lektüre eines Textes wie „Späte Elegie“ eher Mißvergnügen bereiten. Gewidmet ist er dem Komponisten Eberhard Schmidt, der 1936 bis 1939 auf seiten der Internationalen Brigaden im Spanischen Bürgerkrieg kämpfte. Dabei handelt es sich um ein Gedicht, dessen erster Teil verheißungsvoll anhebt und in dem zunächst auch die Sprache zu spannungsvoller Intensität findet:
Spanien, Tropfen Jod
In meiner unordentlichen Erinnerung,
Ich werde
Dein Knabengesicht in meinem Hinterkopf,
Dein Lächeln, nicht los.
Du
Von menschlichen Mistsäuen zerbissener Mund,
Der das Wort Bruder ausgrub…
Nur erstarrt dieses Gedicht sodann im Floskelhaft-Banalen:
Auf dich
Komme ich immer wieder zurück…
Und schließlich nimmt es eine Wendung ins Digressive, wenn am Ende einzig noch der leibliche Vater des Ichs erinnert und dieser nun als negative Kontrastgestalt zu den Spanienkämpfern vergegenwärtigt wird:
… als mein Vater
Im Kirschbaum in Görlitz herumturnte,
Abrutschte und sich die neue
Braune Hose zerriß.
In seinem Verlauf, so erweist es sich, verliert sich das Gedicht mehr und mehr ins Unverbindliche – und zwar auch dann noch, wenn man bereit ist, die Vater-Reminiszenz als eine von Selbstgerechtigkeit weit entfernte zu interpretieren. Denn die Frage wäre ja wohl die, wie sich der heute lebende und aus seiner Situation heraus reagierende Sohn des Wunschvaters Schmidt ihm, diesem Wunschvater, gegenüber zu artikulieren wüßte.
Indessen gibt es auch das lange Gedicht „Betrachtung eines Stillebens“; und indem hier die Spanien-Reminiszenz wiederum präsent ist – präsent diesmal als lastendes Exempel vergeblichen Kampfes –, weicht das Ich nicht aus. Da heißt es:
Was soll ich anfangen. Ich esse
Die traurigen Niederlagen der Jahrhunderte.
In der fünften Stunde dieser Nacht
Blick ich auf meine Pulsader wie auf eine Uhr,
Die man anhalten kann,
Indem man sie öffnet. Aber ich will nicht.
Ich habe als Kind zu lange Steine
Und Briefmarken gesammelt, um schon zu verzweifeln.
Derartige Verse sind lyriksprachlich kaum stark. Aber noch in ihrer mangelhaften Verdichtung lassen sie ein Ich hervortreten, das diesmal kein Versteckspiel treibt: Was es sich vergegenwärtigt, macht ihm sein Elend bewußt – als dasjenige des Heißherzigen in der Geschichte –; und das Ausharren, von dem schließlich die Rede ist, wird denn auch nicht mit einem forschen Trotzdem in Beziehung gebracht, sondern in einer Weise reflektiert, die aller aktivistischen Mumm-Boxerei (vgl. etwa „Trinkspruch für Weisbach“) enträt.
Und auch im Gedicht „Im Spätsommer“ ist ein solch klar seiner Situation ins Auge blickendes Ich anzutreffen. In diesem Text allerdings bricht sich wortgewaltiger Zorn Bahn: Rückhaltlos-zorniges Pathos als die andere Möglichkeit, dem Leiden an der Geschichte Ausdruck zu geben. Gewiß, ganz ohne Selbstheroisierung, ohne heldengymnastische Ich-Gebärdung kommt dieses Gedicht nicht aus; und auch das poetische Muster (durch Volker Braun „aufgehobener“ Hölderlin) scheint durch. Aber der Text beeindruckt noch immer durch seine sprachliche Dichte (der übrigens auch die kunstvoll eingearbeitete Brecht-Reminiszenz dienlich ist) sowie durch die ehrliche Kundgabe jener Not, die zu wenden das Ich keine Möglichkeit wahrzunehmen vermag:
Wo
Ist der Stöpsel im Schlamm der epochalen Badewanne. Ich bin
Kein Fisch, ich bin natürlich auch kein U-Boot. O
wie ich rudre, schiffe, trinke und treib
Wahnwitzig den Schweiß mir auf die Haut, daß verdunste
Der Dreck, ehe der eiserne Herbst kommt
Und die Sonne spärlicher noch unsere Häupter bescheinet.
Allerdings läßt das „Spätsommer“-Gedicht ein Problem denn doch unausgetragen. Gleich eingangs benennt dieses Gedicht die „Freunde“, abstrahiert hernach aber völlig von ihnen; und lediglich im Schlußvers ist dann von „unseren“ Häuptern die Rede. Und einmal aufmerksam geworden, bemerkt man bei neuerlicher Band-Lektüre eine „Freund“-Berufung immer wieder, ohne daß die Ich-Freund(e)-Beziehung – als eine spannungsvolle – ernstlich thematisiert worden wäre. Natürlich könnte man das Gedicht „Mein Kopf, sage ich grinsend, und der deine…“ in diesem Sinne namhaft machen; und jedenfalls kommt hier eine latente Gefährdung des Bruder-Bruder-Verhältnisses zur Sprache. Aufs Ganze gesehen, hat es der Leser jedoch mit dem Widerspruch zu tun, daß Freundschaft einerseits als verläßliche Gegebenheit apostrophiert wird, daß andererseits aber das Ich ganz als ein einzelnes, ja einzelgängerisches und auf sich verwiesenes erscheint. Und die im „Hölderlin“-Gedicht berufenen „Freunde“ – wären sie, wenn sie die „Tor“-Schreier sind, wirklich so zu nennen? Oder aber: Wären sie, wenn sie mit diesen Schreiern unidentisch sein sollten, nicht lediglich eine pur fiktive, rhetorisch beschworene Schar? Wie dem auch sei: Das Freundschaftsthema stellt sich in Menschings Band als ein potentiell angelegtes, nicht jedoch entfaltetes dar; wiederum bemerkt man hier jenes Zurückweichen, das auch anderweitig so deutlich zu registrieren ist. Es fällt dies übrigens noch dadurch besonders auf, daß Menschings Liebesgedichte ein derartiges Zurückweichen keineswegs erkennen lassen.
Und es sind denn auch diese Liebesgedichte, die zu dem Besten des Bandes insgesamt zählen und die recht eigentlich – und überzeugend – den Talentnachweis für Mensching liefern. Selbst ein (wohl relativ frühes) Gedicht wie „Umkehr“ in seiner vers- und reimstrukturellen Konventionalität läßt aufhorchen:
Manchmal in den frühen Stunden
Kehrn wir uns zurück,
Pressen unsre wunden
Körper aneinander in ein Stück.
…
Und wir haben keinen Ton mehr,
Uns noch zu verwunden,
Sprachlos in der Umkehr
In den frühen Stunden.
Erst recht aber prägt sich so dann das Gedicht „An einem Nachmittag“ ein, in dem ein vergleichbarer Vorgang zur Sprache kommt – mit welch einer Konkretheit freilich! Und mit welch einer ungeschönten, nackten assoziatorischen Wahrhaftigkeit, auf der schließlich auch die letzten Verse des Gedichts, in ihrer sinnlich-intellektuellen Prägnanz, unmittelbar hervorwachsen:
Durchsuchen die verfitzten Organe. Er kniete
Am Bettrand und zerbog sie zu einem Ypsilon
Mit der Zunge.
Sie riß sein Hemd auf, die Knöpfe spritzten
Zwischen die Bücher.
Einen Essay über das Gedicht „Auf einem Bein, nachts nackt…“ hat Dieter Schlenstedt vorgelegt (vgl. DDR-Literatur ’83 im Gespräch); gäbe es diesen klug interpretierenden Essay nicht, müßte auch auf dieses Gedicht hier eigens eingegangen werden. Und so bleibt denn nur, auf jenen Sechszeiler hinzudeuten, ohne den die Gruppe der hervorzuhebenden Texte noch nicht hinreichend bestimmt wäre:
Es wäre gut
Nachts, wenn die Eiben
Im Schnee sich an den Boden schmiegen,
Auf deiner flachen Brust zu liegen
Und dich zu treiben
Bis aufs Blut.
Da ist ein hoher Grad an Verdichtung erreicht. Und die metaphorische Leistung der Verssprache erweist sich sich nicht zuletzt darin, daß das angesprochene Du ja zugleich als das Land faßbar wird – dem seinerseits die Begierde gilt, dem das Ich die „flache Brust“ pressen möchte und das es also durch die Energie liebender Aktivität sich zu verlebendigen sehnt. Schade nur, daß durch die (offenbar reimbedingte) Verwendung des Verbs „schmiegen“, welches die hier unangemessene Assoziation von Zärtlichkeit auslöst, eine Einbuße in puncto Präzision entsteht.
So gibt es denn in Menschings Band durchaus Gedichte, die nicht nur Erwartungen erfüllen, sondern die auch – in Hinblick auf weiteres – neue Erwartungen stiften. Und eingedenk zumal der lyriksprachlichen Fähigkeiten, die Mensching hier beweist, möchte man auch fest damit rechnen, daß er die im übrigen noch registrierbaren Leichtfertigkeiten und bramarbasierenden Attitüden sehr bald schon überwindet. Seine Sprache selbst deutet auf gute Lehrmeister hin; Brecht, Mickel, Braun sind einige von ihnen. Bemerkbar aber zugleich der Wille zum Originären; und durch die Sprache seiner Vorbilder hindurch ist er dabei, zu einer eigenen zu finden. Zu einer solchen, die das Kantig-Unbequeme bewahren, es jedoch dem Ausdruck individueller Wahrhaftigkeit konsequenter als bisher verpflichten wird? Freilich ist es ein anstrengender Weg, der sich damit für Mensching abzeichnet. Und als fraglich muß es auch erscheinen, ob er ihn, den Weg einer unbedingt authentischen dichterischen Selbstkundgabe, in Gemeinschaft wird gehen können. Denn der Gefährte, Hans-Eckardt Wenzel, dürfte sich seinerseits für einen solchen Weg kaum disponiert wissen: Zu sehr ist seine künstlerische Existenz diejenige eines schreibenden Akteurs auf dem Liedertheater.
(…)
Bernd Leistner, Sinn und Form, Heft 5, September/Oktober 1985
Vivisektion mit stumpfen Skalpell
– Zu Bernd Leistner: „… dich zu treiben bis aufs Blut“. –
Wir waren schon sehr gespannt, denn wir kannten die scharfe Klinge, die Bernd Leistner als Literaturkritiker zu führen in der Lage ist. Und wir kannten die Verse Menschings und Wenzels, von denen viele in unterschiedlichen Kommunikationsformen – als gesprochenes Wort, als chorisches und solistisches Lied, aber auch unabhängig von der Bühne als gedruckter Text in Büchern und Presseorganen – ihre Wirksamkeit und ihre Lebenskraft bereits unter Beweis gestellt hatten. Vom Zusammenstoß der beiden bisher umfangreichsten Text-Sammlungen von Steffen Mensching und Hans-Eckardt Wenzel mit dem erst jüngst gewürdigten Poesie- und Sprachbewußtsein ihres Rezensenten versprachen wir uns, daß polemische Funken sprühen, und zwar so, daß sich interessante Einblicke in die Stärken und Schwächen der Autoren eröffnen, ihnen vorantreibende Impulse verliehen werden. Unsere Erwartungen waren um so höher, als sie vom (persönlichen und öffentlichen) Bedürfnis nach einer wahrhaft kritischen Literaturkritik getragen waren und von der Überzeugung, daß sie sich in diesem Falle auf Gegenstände richtete, die der höchsten – also auch kritischen – Förderung würdig sind. Handelt es sich doch um jeweils eigenständige, in der gegenwärtigen Lyrik keineswegs selbstverständliche Versuche, wesentliche Traditionen revolutionärer, „eingreifender“ Poesie fortzusetzen.
Desto größer war dann unsere Enttäuschung, ja unsere Verblüffung. Ganz offensichtlich war es dem Kritiker nicht gelungen, Zugang zur künstlerischen Eigenart und damit zu den realen Leistungen der beiden Autoren zu gewinnen. Auch ihr Verhältnis zur Wirklichkeit unserer Epoche und zu deren revolutionärer Veränderung bleibt, obwohl den Texten deutlich ablesbar, eigenartig unterbelichtet. Kaum etwas darüber, welche Entdeckungen in der Wirklichkeit gemacht, welche poetischen Wege dazu erprobt wurden, welchen Platz die beiden Autoren in der Lyrik-Landschaft einnehmen, worin das ästhetisch-weltanschauliche „Geheimnis“ der Wirksamkeit auch der Texte (nicht nur der Bühnen-Aktion und der musikalischen Komponente) besteht. Mehr noch: es scheint Bernd Leistner gar nicht darum zu gehen – um ihn selbst zu zitieren:
es schert ihn einfach nicht
Schon in den ersten, scheinbar achtungsvollen Sätzen der Rezension spürt man die fragwürdige Ausgangsposition: Da kommen zwei eigentlich interessante, vielversprechende „Akteure des Liedertheaters“, erfolggewohnt und publikumswirksam (die Bücher sind daher sofort vergriffen); nun wollen wir doch einmal sehen, was von den beiden nicht mehr so ganz taufrischen Burschen, die sich fürwitzig ins Pantheon der hohen und hehren Poesie vorgewagt haben, eigentlich übrigbleibt, wenn sie mit ihrem „nackten und bloßen Wort“ vor den gestrengen Tempelwächter treten. Der Wächter waltet dann auch sofort – ausführlich und mit dem scholastischen Eifer des Mißtrauens – seines Amtes, um den Tempel rein zu halten, sprachrein vor allem, aber auch rein von all jenen empirischen und ideellen Elementen der Wirklichkeit, die nicht „Ausdruck unbedingter existentieller Verbindlichkeit“ sind. Bleiben wir zunächst bei letzterem, und diesmal ganz im Ernst: Bernd Leistner operiert mit einem Lyrik-Begriff, der nicht von dieser Welt ist. (Dabei ist nicht nur „diese“, unsere sozialistische Welt gemeint, sondern die Welt überhaupt!) Der Irrtum beginnt bereits mit dem „nackten und bloßen Wort“, das es nirgends gibt als in den Köpfen einiger Theoretiker des poetischen Hermetismus. Gerade in der lyrischen Dichtung bringt das Wort eine Fülle-kommunikativer (außer-, inner- wie intertextueller) Beziehungen mit sich, durch die es auch nicht eine einzige Sekunde „nackt und bloß“ dasteht. Ebenso unerfindlich bleibt, warum Lyrik auf den „unbedingt authentischen“ Selbstausdruck eines Ich von „unbedingter existentieller Verbindlichkeit“ reduziert wird. Letztlich muß sie damit aus dem Kreis fiktionaler literarischer Gattungen, also aus dem Reich der Dichtung, herausfallen. Das ist sicher nicht gemeint, der theoretische Ansatz führt aber dazu, daß legitime und außerordentlich kommunikative Erscheinungsformen der Lyrik (Lied, Ballade, chronikalische oder „agitatorische“ Textstrukturen) beliebig „des Platzes verwiesen“ werden können, sowie sie als gedruckte Texte auf dem mehr oder weniger geduldigen Papier auftauchen und mit den vom Rezensenten goutierten Ausdrucksformen, deren Legitimität hier nicht in Zweifel gezogen wird, konkurrieren. Die Willkür der Grenzziehung (bei Leistner ist es gar Entgegensetzung) besteht darin, daß niemand – allenfalls noch der Dichter selbst – entscheiden kann, was „Ausdruck individueller Wahrhaftigkeit“ ist. Als gewöhnliche Sterbliche halten wir uns an die sprachlich (d.h. auch rhythmisch und klanglich) objektivierten, künstlerisch bewußt geformten und in diesem Sinne immer „erfundenen“ Gestalten und anderen Gegenständlichkeiten, die uns im Gedicht entgegentreten, um sie mit ihren Artgenossen in anderen Werken der Kunst, vor allem aber mit der objektiven Realität und unseren eigenen Erfahrungen genußvoll-erkennend in Beziehung zu setzen. Spätestens hier wird dem Leser der Rezension aber offenbar, daß auch der Wirklichkeits-Begriff, mit dem da operiert wird, nicht von allerbester Herkunft ist. Objektive gesellschaftliche Realität und subjektive Aktivität verflüchtigen sich zu abstrakten Unverbindlichkeiten, die mittels einer ebenso allgemein bleibenden „existentiellen“ Tragik des ewig gegen seine Umwelt anrennenden Individuums metaphysisch aufgebläht werden. Vom „engen Horizont, den diese Erfahrungswelt ihm bietet“, ist da die Rede, weshalb das Ich gezwungen ist, sich die „bewegte geschichtliche Welt“ von außen und aus der Vergangenheit „herzuholen“. Es ist ja auch „in eine verhältnisstabile Kleinwelt“ hineingeboren. Mit der „herzugeholten“ Geschichte scheint es aber auch nicht weit her zu sein, denn wichtige Gedichte wie „Betrachtung eines Stillebens“ und „Im Spätsommer“ erscheinen lediglich als die eine oder „die andere Möglichkeit, dem Leiden an der Geschichte Ausdruck zu geben“, als einem immerwährenden „Elend“ des „Heißherzigen in der Geschichte“. Ganz abgesehen einmal davon, was dem Kritiker da des Lobes würdig erscheint: man glaubt in einem ganz anderen Buch, bei ganz anderen Texten zu sein (vielleicht stammt der Schwung zu solch „existentieller“ Unverbindlichkeit noch aus Leistners überaus mitgehender Besprechung zu Wolfgang Hilbigs Gedichten?).
Immerhin werden Mensching noch „sentimentalische Aktivitäten eines Ichs“ zugesprochen, „das Ungenügen empfindet, sich aber weigert, lediglich Klage und Verdrossenheit zu artikulieren“. Das ist gewiß die sublimste Art von „Verweigerung“, von der wir im Zusammenhang mit jüngerer Lyrik bislang Kenntnis erhalten haben. Sie scheint uns aber ebensowenig die wirkliche Leistung Menschings abzudecken wie das positive Hervorheben der Liebesgedichte oder das hymnische Lob auf das Luxemburg-Gedicht, von dem es – wiederum in „existentieller“ Verkürzung – lediglich heißt:
Hier gibt es keinerlei Verschlierung und keinerlei Zurückweichen vor einer Ich-Kundgabe, die das wache Bewußtsein der Situation, aus der heraus das Ich spricht, aufs wahrhaftigste mit ins Gedicht einbringt.
Welcher Art diese Situation ist und was das wache (im konkreten Fall allerdings träumende) Bewußtsein des Ich dabei zustandebringt, all das scheint völlig uninteressant zu sein. So ist es kein Zufall, wenn Gedichte mit einer stärkeren Direktheit der Reflexion von Zeitproblemen – besonders dann, wenn poetische Gestalten außerhalb des „existentiellen“ dichterischen Ichs hinzutreten – entweder verschwiegen oder sprachkritisch „vernichtet“ werden: „Angenommene Farbenlehre Erich Mühsams“, „London, fünfzehnter März dreiundachtzig“, „Blanqui in der Boutique“, „Hegel bei den Skulpturen“, „Späte Elegie“, „Trinkspruch für Weisbach“, „Urlaub Majakowskis…“, „Siqueiros: Unser Antlitz“, „Amtliches Fernsprechbuch…“ U.a.m. Nicht in jedem Falle sind das gelungene Gedichte, unter ihnen sind aber auch einige, die zu dem besten gehören, was in der DDR-Lyrik des zurückliegenden Jahrzehnts an politischer Dichtung hervorgebracht wurde. Darüber kann man im einzelnen sicher streiten, uns geht es hier um die Methode der radikalen Reduktion lyrischer Dichtung auf den „existentiellen Selbstausdruck“, der dazu noch durch das weitgehende Abschneiden gegenständlicher und kommunikativer Verknüpfungen mit dem ganzen Reichtum der „Außenwelt“ seines lebendigen Inhalts beraubt wird. So hört der Leser der Rezension manches von „Leiden“, von „Ungenügen“, vom Bemühen, die Grenzen der Erfahrungswelt zu durchbrechen; er erfährt jedoch nicht, woran der Dichter oder die von ihm gestalteten Figuren leiden, woran er welche Kritik übt, aus welchen geschichtlichen Erfahrungen und weltanschaulichen Prämissen er die Kriterien für seine Kritik gewinnt und wo er die Ansatzpunkte, aber auch die Hemmnisse für sein „Eingreifen“ sieht. Dafür erfährt er, wie gefährlich die Freundschaft und die Zusammenarbeit mit Wenzel für die poetische Existenz von Mensching ist, weil sie seine „authentischen dichterischen Selbstkundgaben“ in eine allzu große Nähe zur künstlerischen Existenz „eines schreibenden Akteurs auf dem Liedertheater“ bringen würde. Da könnte ja etwas abfärben von der lebendigen Unmittelbarkeit der Kontakte zu einem real existierenden Publikum, das sofort reagieren kann. Sehen wir einmal von der Geschmacklosigkeit und der Impertinenz eines solchen Ansinnens ab – es geht uns um Grundfragen. Sicher sollten poetische Kommunikationsweisen, die nicht primär über das bedruckte Papier und die stille häusliche Lektüre gehen, keineswegs verabsolutiert werden. Und wir haben hohe Achtung vor einem Dichter wie Georg Trakl, der – gepeinigt von ständiger Berührungsangst gegenüber dem realen Leben – tiefe und schöne Verse hinterlassen hat, in denen seine Entfremdung einen poetisch gültigen Ausdruck fand. Für kämpferische sozialistische Lyrik jedoch, und in diesem Kontext sehen wir die Bemühungen Menschings und Wenzels, war stets charakteristisch, daß alle, auch außerliterarische, Möglichkeiten der Kommunikation (einschließlich der Massenkommunikation) gesucht wurden, um die Poesie in die Wirklichkeit und die Wirklichkeit in die Poesie zu bringen. Ist es wirklich nötig, hier an die Beziehungen Weinerts, Bechers, Brechts, Fürnbergs, KuBas oder auch Majakowskis und vieler anderer zum Kabarett, zum Theater, zur Agitpropgruppe, zur Rednertribüne, zum Film oder zum Rundfunk zu erinnern? Das Ergebnis war nicht zuletzt „innerliterarisch“ bedeutsam, schlugen sich jene „empirischen“ Beziehungen zum Publikum, zu realen Bewegungen und massenwirksamen Medien doch in einem reichen Genreensemble, in stofflicher und thematischer Vielfalt, aber auch in produktiven sprachkünstlerischen Experimenten nieder. Es ging da also nicht allein um Chancen größerer Verbreitung! All diese Erfahrungen scheinen für Bernd Leistner nicht zu existieren. Er gebärdet sich erschrocken, wenn unter dem Titel „Gedichte“ in Wenzels Band auch Lied-Texte abgedruckt werden, und dann auch noch Noten, die ihn ganz zu verwirren drohen, weil sie ihm den Blick auf das „nackte und bloße Wort“ trüben. (Bei Dramen-Texten, die ja auch „nur“ Teilelement einer komplexen künstlerischen Daseinsform sein wollen, hat ihn solche Prüderie gottlob noch nicht angewandelt, sonst wären wir um manche Analyse aus Leistners Feder ärmer!) Da nun aber das Lied für Wenzel eine verhältnismäßig dominante Rolle spielt, steht das Urteil des Kritikers von vornherein fest:
Das Wort hingegen, das für sich selbst einzustehen hat, ist seine Sache nicht.
Hier haben wir es wieder, das total vereinsamte, allein auf sich selbst gestellte Wort. Vergessen ist die ehrwürdige historische Herkunft jeder lyrischen Poesie aus dem Lied (oder aus dem „Zauberspruch“, der ja auch eine sehr reale „außerliterarische“ Kommunikationsform war). Vergessen ist die Tatsache, daß jener (wichtige, durch nichts zu ersetzende!) Teil der Lyrik, den Leistner zum absoluten Maßstab erhebt, verschwindend klein ist im Vergleich zu dem weltweiten und massenhaften Gebrauch, den die Menschheit von gesungener Poesie macht. (Wenn darunter viel schwache Poesie oder auch Poesie-Ersatz ist – Leistner dürfte sich darüber am wenigsten wundern, da er einen talentierten Dichter wie Mensching ausdrücklich davor warnt, sich auf solcherlei Dinge einzulassen.) Unter solchen Voraussetzungen mußte der Wenzel-Abschnitt der Doppel-Rezension noch weniger ergiebig ausfallen als der zu Mensching, von dem immerhin noch einiges anerkannt wurde. Leistner glaubt, man müsse bei einem Lied davon abstrahieren, daß es ein Lied ist, wenn es einem als gedruckter Text vorgesetzt wird. Weshalb eigentlich? Hat er so wenig Vertrauen zur Phantasie und zur kulturellen Erfahrung der Leser, die sich schon „einen Vers darauf machen“, wenn ihnen in einem Lese-Buch liedhafte Strukturen entgegentreten? Sie können auch dann vorhanden sein, wenn es noch gar keine Melodie dazu gibt, und können oder müssen entsprechend rezipiert werden. Schließlich hat ja die Sprache ihre eigene Melodie. Mit den sinnlichen Qualitäten der Poesie scheint der Rezensent überhaupt seine Schwierigkeiten zu haben. Hält er doch das schöne, auf seine Weise sehr gelungene und in sich geschlossene Huldigungsgedicht nach und für Erich Mühsam, „Ich braue das bittere Bier“, für eine „Auflistung abstrakter Behauptungen“. Abstrakt ist an dem Text nun gar nichts, und mit „Auflistung“ ist wohl die Reihentechnik gemeint, derer sich besonders ein Lied gern bedient. Das Vorurteil des Kritikers war so groß, daß eine nähere Besichtigung dessen, was da mitgeteilt wird, unter seiner Würde war. (Man vergleiche die Lesarten, die Mensching zu diesem Lied vonWenzel beisteuert: „Lyriker im Zwiegespräch“, 1981).
Vorurteilvolles Am-Text-Vorbeireden findet sich auch in anderen Teilen der Rezension, nicht nur im Hinblick auf Wenzels Lieder. Leistner demonstriert seine sprachkritische Sezier-Arbeit gleich am Anfang sehr ausführlich an Menschings Titelgedicht „Erinnerung an eine Milchglasscheibe“. Die vorgebliche Subtilität und Akribie erweist sich jedoch rasch als brüchig, teilweise sogar unlauter. Von einem Januar mit Schnee ist im Gedicht die Rede (also einem richtigen Winter), demzufolge von frost-blinden Fensterscheiben. Der Interpret redet aber fortwährend von einem „trüben Januar“, von der „Trübheit der Außenwelt“, die zu den zugefrorenen Scheiben gar nicht passen würde (und daher im Gedicht auch nicht vorkommt). Außerdem hindert der erlesene Sprachgeschmack den Rezensenten daran, den Doppelsinn der Fügung „Ich habe eine Scheibe“ – also auch ihre plebejisch-umgangssprachliche Bedeutung überhaupt wahrzunehmen, von dem der Spannungsbogen zum „Ich sehe durch“ hinläuft. Die „Durchsicht“ erfolgt am Ende nicht auf eine „trübe“, „verhangene“ Außenwelt (und wäre demzufolge keine Durchsicht), sondern auf eine winterklare Landschaft. Leistner kritisiert also ein Gedicht, das er sich streckenweise selbst zurechtgedichtet hat. Die grimmigen Invektiven, mit denen er seine Interpretation (die als Modellfall hingestellt wird) begleitet, fallen so auf den Interpreten zurück.
Nicht nur Vorurteile gegenüber „außerliterarischen“ Zwecksetzungen und kommunikativen Bindungen poetischer Texte kommen folglich bei Leistners massiver Kritik an Mensching, vor allem aber an Wenzel, zur Geltung, sondern auch ein sehr elitäres Sprachverständnis. Bestimmte Sprachschichten (aus „niederen“ Regionen) scheinen im Bewußtsein des Kritikers gar nicht präsent zu sein. Andere Beispiele („Ich plane die Schmerzen mit ein“) offenbaren zumindest ein Zurückscheuen davor, die poetische Integration von Umgangssprache – denn dazu ist „Einplanen“ längst geworden – als solche zu erkennen und zu werten, einschließlich auch des dabei mitschwingenden ironischen Untertons (weil solche Dinge in der von Leistner angesprochenen „Bürokraten“-Sphäre eben gerade nicht eingeplant werden). Mit anderen Worten: Leistner neigt dazu, die Sprache der Poesie allzu hermetisch gegenüber der „wirklichen“, der massenhaft gebrauchten Sprache abzuschotten. Damit stehen seine Beweisführungen aber auf einer sehr brüchigen Plattform. Rein linguistisch ist der Differenzpunkt zwischen Lyrik- und „Gebrauchs“-Sprache wohl kaum auszumachen. Außerdem zeigen klassische Beispiele der „Moderne“ von Rimbaud bis Ginsburg, von Brecht bis Jandl, welche poetische Sprachgewalt auch dem „gemeinen“ Wort aus poesiefremden Sphären abgewonnen werden kann. Auch dort, wo Leistners Sprachkritik von der Sache her berechtigt ist, geht sie von falschen Voraussetzungen aus und verliert so an Überzeugungskraft. Am Ende bleibt also selbst von den sprachkritischen Stärken des Rezensenten – ganz abgesehen vom beckmesserischen und oberlehrerhaften Umgang mit diesem Instrumentarium – im konkreten Fall nicht sehr viel übrig. Eine Chance hat Leistners Besprechung aber noch: als einer der klassischen Fälle „danebengegangener“ Verrisse in die Geschichte der Literaturkritik einzugehen.
Mathilde Dau / Rudolf Dau, Sinn und Form, Heft 2, März/April 1986
Laudatio für Steffen Mensching
Wer spricht heute gern vom Zufall? Die beiden Seelen, ach, in meiner Brust haben lange darüber in Streit gelegen, ob es opportun sei, ihn zu bemühen, wo es eigentlich darum gehen soll, einen Dichter zu loben. Am Ende behielt, was immer mal zu leichtsinnigem Tun drängt, die Oberhand. Wußte es sich doch damit zu rechtfertigen, daß allein vom Gegenstand der Lobrede soviel Ernsthaftigkeit ausgehen würde, wie sie einem solchen Unternehmen nun einmal ansteht.
Der Zufall also. Beinahe alle Tage lese ich die Zeitung. Daraus eine Gesetzmäßigkeit abzuleiten, will ich lieber unterlassen, und sei es nur darum, mir die Freiheit zu bewahren, dies nach Laune irgendwann nicht tun zu müssen. Zwingender erscheint mir, daß eines Tages ein Buch auf meinen Schreibtisch geriet. Ein nicht eben dicker Band, dessen Umschlag links oben den Namen eines Steffen Mensching trug, dessen in die Mitte gerückter und dennoch leicht angekippter Titel meine Neugier weckte, dessen Zuordnungsbegriff knapp und bescheiden links unten erschien und dennoch von mir als Herausforderung begriffen wurde: Gedichte.
Gehört es doch zu den Gesetzmäßigkeiten unseres Lebens, daß man, sobald man einer Organisation nicht lediglich als zahlendes Mitglied angehören will, es immer mal wieder mit Phänomenen zu tun bekommt, die einem auf Anhieb nicht liegen. Auf meinem Schreibtisch lagen Gedichte.
Ich verkehre mit Hervorbringungen solcher Art gewöhnlich wie die meisten Leute. Wenn ich sie nicht übersehe, lese ich sie. Und wenn sie mich nicht gleichgültig lassen, dann kann es schon passieren, daß ich amüsiert bin oder mich betroffen, gepackt, hingerissen, ertappt und so weiter fühle. Manchmal – wir wollen es bei dem unbestimmten Wort lassen –, manchmal schüttelt auch etwas in mir sein weises Haupt oder kann sarkastisch klingende Ausrufe nicht unterdrücken. Nun sind dergleichen Reaktionen dem Gegenstand immerhin angemessen. Diesmal aber waren sie nicht so sehr gefragt. Man erwartet vielmehr ein Urteil von mir. Ein Urteil über Gedichte.
Unter dem Eindruck dieser Aufgabe las ich die Zeitung. Fand ich die Überschrift „Täglich pro Kuh ein halbes Liter mehr“ und im Text des Artikels das Wort Milchglasscheibe. Das wage einer einen Zufall zu nennen, wo doch in meinem Schreibtisch der Lyrikband lag, in dem ich freilich längst herumgelesen hatte, der mir schon lange nicht mehr gleichgültig war, dessen Gedichte mich betroffen gemacht hatten, der jedoch immer noch beurteilt werden wollte. Wie hieß er doch gleich im Ganzen? ERINNERUNG AN EINE MILCHGLASSCHEIBE.
Sieh an, dachte ich plötzlich voller Enthusiasmus, die Dinge um uns führen lange ein höchst unbeachtetes Dasein. Doch eines Tages kommt ihre Zeit, und sie geraten in das Zentrum allgemeiner Aufmerksamkeit. Es kann doch wohl kein Zufall sein, wenn sich die Hersteller von Gedichten und die Produzenten von Nahrungsgütern auf die eigentümliche Wesenheit der Milchglasscheibe besinnen. Selbst wenn die einen sie als Metapher und die anderen sie in ihrer gegenständlichen Erscheinung nutzen. Etwa als Teil einer viel frequentierten Tür im Melkhaus und zugleich als Tableau für Ziffern, die man nicht aus dem Auge verlieren wollte. „Tagesplan November!“ stand dort, „3.000 Liter, Fettgehalt 4%“. Ein tüchtiger Journalist übersieht solche Bezüge heutzutage nicht mehr, der läßt sich das Wortspiel vom Milchplan auf der Milchglasscheibe auf keinen Fall entgehen. Was, wenn er den Titel des Gedichtbandes auf meinem Schreibtisch gekannt hätte?!
Ich verließ mich nicht auf Mutmaßungen, sondern gedachte, was ihm entgangen war, auf eigene Rechnung weiterzuführen. Von wegen Zufall. Hier walteten gesetzmäßige Zusammenhänge, hier ging es schon lange nicht mehr um die Milchglasscheibe an sich und als Metapher, sondern darum, was sich hinter ihr offenbarte: Die selbst bei dieser Gelegenheit zutage tretende Einheit unseres Wollens und Tuns, das übergreifende, sich ergänzende und gegenseitig anspornende Verbündnis zwischen Kunst- und Produktionssphäre, die Solidarität zwischen Dichter und Bauer, gerichtet auf hohe, ja Höchstleistungen auf beiden Seiten. Das war es doch!
Genug des bösen Spiels. Es ist Zeit, mit aller Ernsthaftigkeit, die mir zu Gebote steht, zu versichern, daß sich Menschings Gedichte so gar nicht für Geistesblitze eignen, die ja dann doch nur das Ergebnis unserer Kurzschlüsse sind. Ich habe mir den frivolen Einstieg in diese Laudatio nur erlaubt, um am eigenen schlimmen Beispiel nachzuweisen, wie schnell unsereins bereit ist, überalterten Hoffnungen nachzuhängen, welche diffusen Zusammenhänge uns genügen, um unsere Utopien zu pflegen, wie schnell wir bei der Operette sind, wenn wir die Dialektik des Lebens preisgeben. Dabei genügt schon ein erster, flüchtiger Blick in das Buch, um herauszufinden, welchen Schulterschluß Mensching in seinen Versen sucht, um allen wohlfeilen, gleichwohl immer noch und immer wieder gehandelten Vereinfachungen zu entgehen. Da werden Rosa Luxemburg und Louis Auguste Blanqui angerufen, wird die Revolutionärin „barfuß im Mohn“ gefunden und der französische Kommunist im verschlissenen radikalutopischen Gewand zwischen den Regalen einer Exquisit-Boutique ertappt, da werden Hölderlin – wie denn auch nicht – und Majakowski beschworen, da wird dem Mühsam die Stimme geliehen und dem Hegel das lyrische Ich, da wird den Skrupeln eines Simonow nachgefühlt und die fordernde Berührung des so früh gestorbenen Weisbach erfleht. Damit ist freilich der Kreis noch lange nicht ausgeschritten, aber man kann ihn schon mit Welt füllen. Mit einer, die von Widersprüchen reich gesegnet ist, mit der, die sich über Pan Am und world time table empfiehlt und unerreichbar bleibt, mit der anderen, die sich aus der Begegnung zwischen dem Heute und der Geschichte, der Kunst und der Liebe, der Wissenschaft und dem Mythos öffnet und deren planetare Bedrohung von Mensching so erfahren wird, daß er, als einer von wenigen, den Mut faßt, der Ästhetik des Widerstandes den eigenen Vorschlag hinzuzufügen. Freilich, die Welt des Kohlenhändlers fährt ihm im Tatra davon, und von der Welt der Melker wird bei ihm nicht gehandelt.
Auch das ist eine Vereinfachung, gewiß. Mensching hält gegen, indem er, im Meißner Hotelzimmer den Aristoteles lesend, das Schicksal eines gewissen Kleophon bedenkt, der mit „gemeinüblichen Worten“ „Alltagsmenschen“ vorgestellt haben soll. Wer solche Entdeckung begierig genießen möchte, dem wird sie dennoch bitter schmecken, denn der Dichter von heute weist auf das Beispiel des Dichters von gestern. Nicht eine Zeile von ihm ist auf uns gekommen, vergessen wäre er, hätte nicht ein Philosoph seinen Namen benötigt, um die Schlüssigkeit seines Systems, zu stützen. Es gehört indes durchaus zu den Eigentümlichkeiten Menschings, wenn er, wo anderen der Brocken im Halse steckenbleibt, kräftig schluckt, wenn er, trotz alledem, den, wie es bei ihm heißt, Kugelschreiber langsam auf das weiße Papier senkt. Zum Glück für uns, möchte man rufen. Denn vom Geist des „Trotz alledem“ ist vieles in dieser Dichtung erfüllt, wenngleich es nicht trotzig daherkommt, eher leise, ironisch verhalten, manchmal von Trauer beschwert, manchmal das Heil in deftig-saloppen Wendungen suchend. Oft entspringt die eigentliche Provokation der Lakonie einer Schlußzeile, beinahe immer spürt man gleichsam vor dem Gedicht den Prozeß seiner notwendigen Entstehung. So auch in jenen Versen, die dem Band den Titel gaben. Zuerst der Einstieg über eine jugendübliche Redewendung in die Situation des lyrischen Ichs: Es hatte eine Scheibe, ja, doch anstatt in Klagen über die kalten Tage auszubrechen, wird schon in der dritten Zeile die Reibung gesucht, die Berührung der im Frost erblindeten Materie durch Stirn und Lippe, wird zum Tauen gebracht, was endlich den Durchblick ermöglicht. Weil Mensching nie darauf verzichtet, auch das lyrische Subjekt zu provozieren, und sei es auch nur mit dem plebejischen Gebrauch mancher Metapher, fühlen wir uns in den Prozeß einbezogen. Weil um nicht der Status des Beobachters zugemutet wird, bleiben wir beteiligt, und weil uns der Dichter über das betroffene Ich an der Betroffenheit teilhaben läßt, können wir uns nicht raushalten.
Die Mitten auf dem Mischpult des Lebens sind seine Sache nicht. Nach eigenem Zeugnis bevorzugt er die „hohen Höhen“ und die „tiefen Tiefen“. Er ist sich mancher Übersteuerung bewußt und hat die Aufforderung zu mischen durchaus im Ohr. Zum Glück schlägt er sie in den Wind, wo es gilt, das Unvereinbare in seiner verletzenden Schroffheit darzustellen. Der englisch getönte Gesang von der Schneeflocke am Sommerhimmel bringt ihn bei der Gewerkschaft in den Ruf eines komischen Talents. Der unbeabsichtigten Behinderung einer „Specklocke Unbekannt“ in der Kaufhalle folgt die ernst zu nehmende Drohung:
Ich schlag dich tot.
Der Realismus in den Gedichten von Mensching bezieht seine Überzeugungskraft nicht aus den auf Harmonie bedachten Empfehlungen von Vordenkern Er bedient auch jene Erwartungen nicht, die auf poetische Um-Schreibung von Lehrsätzen gerichtet sind. Er entspringt authentischer Erfahrung, die Mitwissen fordert und davon Gebrauch macht. Er wird uns zum Ereignis in jenem Augenblick, in dem wir bereit sind, unsere Erfahrung hinzuzutun. Er ist kein Realismus des Postulats. Was bei anderer Gelegenheit Berührungsängste hervorruft, wird hier zur Tugend, denn die Prüfung auf Wahrhaftigkeit findet im Saale statt.
Ich nenne eine solche Haltung jung, obwohl sie natürlich auch von Älteren eingenommen werden kann. Aber weil wir vom Saale reden, noch ein Wort. Ihn gibt es ja, was Mensching angeht, in Wirklichkeit. Mal steht er in Dessau, mal in Meißen und Berlin oder anderswo. Dort tritt der Dichter auf als Schauspieler, dort spielt er Lieder-Theater gemeinsam mit anderen, die sich „Karls Enkel“ nennen. Wer sich derart einem Publikum stellt, dem hilft es wenig, sich auf große Namen zu berufen. Der hat gelernt, der Programmatik mit einem stets produktiven Angebot zu entsprechen. Der führt sich immer wieder und zuallererst selbst ins Feld der Auseinandersetzungen. Wäre das die Anspruchsebene, auf der sich Lyriker und Landwirt doch noch treffen könnten?
Aber ehe ich noch einmal zu Kurzschlüssen anstifte, will ich mir ein Beispiel bei dem nehmen, den es zu loben galt. Will ich zur Tat schreiten, die hoffentlich andauernde und erfreuliche Folgen haben wird. Der Debütpreis des Schriftstellerverbandes der DDR – übrigens der einzige Preis, den er vergibt – wird heute zum zweiten Male verliehen. Wir schätzen uns glücklich, daß er einem Lyriker von solcher Jugend und solcher Reife zuerkannt werden konnte.
Joachim Nowotny, neue deutsche literatur, Heft 3, März 1985
Laudatio
– Heinrich-Heine-Preis 1989 und 1999 für Steffen Mensching und Hans-Eckardt Wenzel. –
Ungewohnte Form – zu einer Doppel-Preisverleihung haben wir uns versammelt, am Schnittpunkt der Jahre, für die die Ehrungen gedacht sind: der Heine-Preis für 1989, der Steffen Mensching, und der für 1990, der Hans-Eckardt Wenzel zuerkannt wurde. Zusammengehörigkeit der beiden Poeten wird so signalisiert, und zugleich wird ihre Differenz festgehalten. Manchen, die bloß die theatralischen Aktionen des Freundespaares erlebten, mag eine Art Kollektivwesen Wenzelmensching in Erinnerung geblieben sein, dessen zwei Gesichtern sie kaum die richtigen Namen geben können. Doch sind die Sprachen der Dichter ganz verschieden in den Bänden Erinnerung an eine Milchglasscheibe und Tuchfühlung von dem einen, in den Bänden Lied vom wilden Mohn und Antrag auf Verlängerung des Monats August von dem anderen.
Mensching: Spruchhaft verknappt die Erfahrung vorn Aufeinanderangewiesensein:
In dieser dunklen Welt
findet Halt nur
der einen anderen hält
oder:
All dies trage ich allein
Liebe Kälte Haß: Angst und mein
Verlassensein
nur nicht das
allein dies nicht
Zuversicht.
Metaphorik der Realität im poetischen Bild, Verweis auf Intermundien und in ihnen, drohend, auf offene Enden der Geschichte:
der eisenbeschlagene Stiefel tritt gegen die offene Tür, doch im Türspalt
steht dein nackter Fuß, mit sanfter Gewalt
eroberte Zwischenräume,
mehr, sagst du, trauen sie uns nicht zu,
ich sage, daß sie sich bloß nicht irren,
in diesem Licht ist vieles möglich
Lakonisch ist die Rede auch im lyrikbiographischen Selbstzeugnis, zurückgenommen ins Bild die poetische Stimmung, die die Äußerung anregte. – Wenzel dagegen: Eher rhetorisch ausgreifend-schweifend, satirisch, elegisch, reflektierend – ein Ich, gehetzt durch seine Gegensätze:
Ich lebe gern.
Um Verzeihung bitt ich für meine Hast,
Wenn die Schwalben aufbrechen oder Freunde
Verdächtigt werden, um Vergebung
Bitte ich euch für all die Niederlagen,
Die sich mit mir zu Tisch setzen,
Für die Verzweiflung über uralte Geschichten,
Die ich in zwei Minuten aufklären möchte.
… Ich weiß nicht, ist dabei von Belang:
In meinen Fingern, das Morsen
Fernster Stationen, unaufhörlich
Dieser Rhythmus, der meine Zeit
Kleinhackt in winzige Einheiten;
Oder die telepathische Sehergabe
Beim Abzählen der Sekunden, Sekunden
In denen ein Mensch stirbt.
Vielleicht ist das normal, und nur
Meine Unrast und irgendetwas mit Europa
Ist daran schuld. Aber ich lebe gern.
Und liedhaft einfach kann es zugehen in seinen Versen:
Immer Regen, morgen werden
Wieder Regen auf uns fließen
Immer Regen hier auf Erden
Immer so ein Tränengießen.
So verschieden also die, denen heute die Preise gelten, und doch gehören sie zusammen. Im Stil einer poetischen Arbeit zunächst, die Direktheit zum Prinzip macht, von Verkunstung nichts hält und auch zur heftigen Polemik sich bereit hält gegen das Verlangen zum rein Artistischen, zu vollendeten Sublimierungen, in denen, wie vermutet wird, sich die Probleme aufheben könnten, die den zwingenden Anlaß zum Sprechen gaben. Offenheit für den Widerspruch gehört zu dieser Direktheit, Vorzeigen der Risse der Welt, die, Heine hat das Bild vorgegeben, durch die Brust des Poeten gehen, und – gegen die Gefährdungen der Indifferenz – die Bereitschaft zur Aktion; sie kennzeichnet die Gestalten von den Ichs, die in den Gedichten der beiden Autoren auftreten, nicht weniger aber ihre poetische Tätigkeit selbst in ihrem Vermögen, sich in die Öffentlichkeit zu stellen und Öffentlichkeit herzustellen.
„Poetisch“ sage ich hier immer mit Bedacht: als „literarisch“ nämlich, in einem strengeren Sinn auf Schrift bezogen, das gedruckte Wort, wäre die Tätigkeit der beiden sehr unzureichend bezeichnet. Die Printmedien und die Wortsprache bilden nur eines der Felder, auf denen sie sich und uns versuchen. Ihr poetischer Ort ist ursprünglicher und moderner die Bühne, ihr Instrument der Körper, Ausdrucksmittel sind Mimik, Gestik, die Bewegungen der Finger, die Musik machen, die Stimme, die spricht und singt, flüstert und schreit. Die großen Programme von Karls Enkeln – Abende zu Mühsam, zum Sozialistengesetz, zu Marx’ „18. Brumaire“, zu Becher oder Goethe – habe ich in lebendiger Erinnerung, die Hammer-Revue und später, in anderen Gruppierungen, die Sichel-Operette oder die Clowns-Programme der Herren Wenzel und Mensching, die Auskunft gaben über Neues, Altes und Letztes aus der DaDaeR. Theaterarbeit am Berliner Ensemble und am TiP gesellte sich hinzu und Versuche für den Film. Kollektivität bei all dem, eine intensive, streitbare, vereinheitlichende und auch auseinandertreibende gemeinsame Arbeit im Entwurf und im Ausarbeiten der Programme, Zusammenspiel bei ihrer Realisierung, in die jeder von den beiden und von ihren Freunden und Freundinnen das Seine/Ihre einbrachte. Der Stil der Direktheit, Widerspruchsoffenheit, Aktionsbereitschaft prägte sich hier aus, die Un-Verschämtheit des Auftretens und nicht zuletzt der Wille, die poetischen Äußerungen zugänglich zu halten.
Des Preisens wohl würdig – aber steht uns der Sinn nach Preisen heute und hier? Was Wenzel und Mensching von Preisverleihungen hielten und halten, von jenem formalisierten Ritus in festlichem Rahmen, von jenen Massenausschüttungen aller möglichen Orden und Ehrenzeichen, die in regelmäßigen Intervallen Repräsentativbedürfnisse des Staates mit seinen absolutistischen Einbindungsversuchen koppelten – das haben sie in einer Szene des DaDaeR-Programms gezeigt, die sie in alle seine drei Fassungen aufnahmen: Es war ihnen Gegenstand eines Clowns-Spiels, das die Clownerie der Wirklichkeit enthüllte und auf groteske Weise ihren tödlichen Sinn: die empfindlicher Betroffenen wanden sich und sanken zu Boden.
Nicht nur Bücher, auch Preise haben ihre Schicksale. Als auf Initiative von Rudolf Leonhard 1947 der Heine-Preis zum zweiten Mal begründet wurde (zum ersten Mal stiftete ihn der Schutzverband deutscher Schriftsteller im antifaschistischen Exil 1936), war er ein Gemeinschaftsunternehmen des damals existierenden Schutzverbandes deutscher Autoren und einer Reihe von Verlagen, die die Gabe finanzierte. Als Preisrichter berief das Gremium eine Persönlichkeit ihres Vertrauens. Der Intuition und Urteilskraft eines einzelnen wurde hier die Entscheidung gegeben – wohl wissend, daß über künstlerischen Wert nicht abgestimmt werden kann und daß er einem institutionellen Beschluß nicht unterliegt. Solche Vorstellungen aber gerade werden womöglich in das spätere Preisverfahren eingegangen sein, in die Neustiftung des Heine-Preises 1956, die seiner staatlichen Usurpation gleichkam. Dem Literaturhistoriker, der sich für die Geschichte der literarischen Verhältnisse interessiert, sei diese Abschweifung verziehen; sie wird als Anregung vorgetragen, darüber nachzudenken, ob die Zeit nicht gekommen ist, dem Heine-Preis die ältere Würde zurückzugeben.
Hätte ich an Mensching und Wenzel gedacht, gesetzt, ich wäre der für die Preisverleihung Berufene gewesen? Ja, und dafür habe ich zumindest drei Gründe.
Erstens wäre ich gewillt gewesen, den Preis an einen von denen zu geben, die zu der jüngeren Generation von Autoren dieses Landes gehören. Seit ihrem deutlichen Auftreten Ende der siebziger Jahre – das mit einem Mißtrauen beobachtet wurde, welches nicht wenige von ihr außer Landes oder in die Bereiche der kleinen literarischen Kommunikation trieb – ist diese Generation längst zu einem entscheidenden Teil der Literatur in der DDR geworden. Sie hat mit Energie neue Erfahrungen eingebracht, die Empfindung von bleierner Zeit, von Stagnation, von verlogener Sprache und Sprachlosigkeit und den spöttischen, wütenden, trauernden oder sich ganz verweigernden Protest gegen die Katastrophe, die das Gegebene darstellte. Sie hat früh auf Haltungen verwiesen, die sich schließlich jüngst in der Rebellion auf den Straßen äußerten, welche in ihrem Anfang ja wesentlich auch – Analysen sind bis heute kaum vorhanden – eine Rebellion der Jugend war. Leute aus dieser Generation also hätte ich sicher gewählt, weil Preise ja nicht nur ein Werk ehren, ein Talent fördern, sondern auch Aufmerksamkeiten lenken können. Die große Verschiedenheit unter den Jungen und die nicht selten heftig geführte Auseinandersetzung zwischen ihnen, die sich an der ungleichen Art entzündete, sich der Realität zu stellen, hätte dabei verboten, an die Wahl eines Repräsentanten dieser Generation zu denken. Mensching und Wenzel sind besondere Exempel dieser Altersgenossenschaft, nicht Leute, die einfach für andere stehen können.
Was mir an ihnen seit langem auffiel und was ich an ihnen erstaunt bewundern konnte – das wäre mein zweiter Grund für eine Preis-Zuerkennung gewesen –, war ihre Art, sich gegen die Enge der Provinz zu wehren, in der sie zu leben hatten, sich gegen den Stillstand der Zeit kritisch zu behaupten, den sie scharf zu spüren bekamen: ihr poetischer Wille, sich vielfältig in Beziehung zu setzen zur Welt, über „Europas verzollte Sanitärkonstruktion“ hinaus, wie es bei Wenzel hieß, das „Verbindungsstück“ zu all den Unbegreiflichkeiten unserer Erde zu suchen, der poetische Wille, als „Student der ,Ästhetik des Widerstands‘“, wie Mensching es sagte, sich in Beziehung zur Geschichte zu bringen, sich im Prozeß der Kämpfe um ein anderes, lebenswertes und Leben ermöglichendes Dasein zu sehen, Rhythmen der revolutionären Bewegung zu begreifen, das Leid ihrer Unterbrechung, die Qual ihres schrecklichsten Abbruchs im Stalinismus, die Gewißheit ihrer Erneuerung aus der Not. Und bei all dem war mir ihr Bestreben wichtig, aus „allen Quellen“ – ich zitiere Mühsam, den Mensching und Wenzel zitieren – zu schöpfen, die Mut geben können, über Trauer, und Verzweiflung hinweg?, nein, durch sie hindurch diese Anstrengung weiterzuführen. Antifaschismus war ein Kernstück dieser Bezüge – das Programm Spanier aller Länder belegte es, wie es ein Film über die, Herbert-Baum-Gruppe hätte belegen können, an dem sie gearbeitet haben, den man aber nicht haben wollte. Und Gedichte zeigen es, wie der böse Text Wenzels zu einem Foto aus dem Lager Janovsk mit dem Ausruf der Schergen, die die Welt ausrotten: „Arbeit geht nie aus vom Totmachen von Schweinen“, oder wie Menschings Spruch „Ich lehne den Kopf an die graue Mauer / der Mahn- und Gedenkstätte / mehr als ich wünsche, weggehen zu können, möcht ich hier bleiben müssen.“ Daß dieses Thema quälend unerledigt ist, zeigt unsere Gegenwart.
Und mein dritter Grund, ihnen den Preis zu geben, wäre der Bezug auf Heine gewesen, der sich bei beiden findet und den Wenzel nun auch in seinem jüngsten Band Reisebilder ausdrücklich benennt, in dem er den Älteren als seinen „Lehrer“, als seinen „Wahlverwandten“ charakterisiert. Zwar ist es längst üblich geworden, im Zwang der Ehrenregularien Preise mit Namen auch an Autoren zu geben, die mit diesem Namen nicht viel zu tun haben – das jedoch hat mir nie gut gefallen. Bei Mensching und Wenzel liegt es aber nahe, weil sie ihm nahestehen mit ihrem Spott und Biß, mit ihren Träumen und ihrer Phantasie, mit ihrer Melancholie, mit ihrem Fernesein von einer mit sich beschäftigten Artistik wie von einer abstrakt politischen Tendenzpoesie. Heines Text „Verschiedenartige Geschichtsauffassung“ setzten sie an den Anfang der Revolutionsfeier, mit der ihr Spanienprogramm endete, die Erörterung der entgegengesetzten Ansichten von der Geschichte: ihrer Auffassung als eines ewig ergebnislosen Kreislaufs, in dem alle Zivilisation nur wieder der Barbarei, aller Enthusiasmus dem Fatalitätsgedanken weichen müsse, und ihrer Auffassung als eines sinnvoll gerichteten Vorgangs, in dem alle irdischen Dinge einer schönen Vervollkommenheit entgegenreifen, alle Menschen nur Staffeln, Mittel sind zu einem gottähnlichen, alle beglückenden Dasein. Beide Ansichten, so Heine und so Mensching und Wenzel, die ihn zitierten, wollen mit ihren lebendigsten Lebensgefühlen nicht übereinstimmen, sie verbieten es, die Kräfte an das ergebnislos Vergängliche zu setzen oder an eine Zukunft als Zweck, für den wir Mittel sind.
Das Leben ist weder Zweck noch Mittel; das Leben ist ein Recht. Das Leben will dieses Recht geltend machen gegen den erstarrenden Tod, gegen die Vergangenheit, und dieses Geltendmachen ist die Revolution. Der elegische Indifferentismus der Historiker und Poeten soll unsere Energie nicht lähmen bei diesem Geschäfte; und die Schwärmerei der Zukunftbeglücker soll uns nicht verleiten, die Interessen der Gegenwart und das zunächst zu verfechtende Menschenrecht, das Recht zu leben, aufs Spiel zu setzen. – ,Le pain est le droit du peuple‘, sagte Saint-Just, und das ist das größte Wort, das in der ganzen Revolution gesprochen wurde.
Le pain – das Brot – ein Recht! Was aber ist Brot heute für diese beiden, für Mensching und Wenzel, wonach geht der Hunger, was will er sättigen? Sie sehen einen Hunger, der in üppig-gefährlichem Konsum zu befriedigen wäre, in einer bloß quantitativen Erweiterung unserer bisherigen Lebensweise, in Sättigung auf Kosten anderer und auf Kosten derer, die nach uns kommen. Ihr Hunger aber ist der nach einer anderen Qualität, für die Kunst als Bild des Immer-Anderen eine Ahnung geben kann. Was sie gegen erneute Provinzialität und ihre abzusehenden Defizite zu setzen bestrebt sind, ist der Versuch, die globalen Entfremdungsverhältnisse aufzuheben, wie sie in der Rüstung, in der Versehrung der Natur und im wirklichen Hunger der vielen in der Welt extrem sich äußern, ist – auch wenn sie dem geringe Chancen geben – der Versuch, eine alternative, linke Kultur zu schaffen; die den Namen sozialistische Kultur verdient, die ein sinnvolles, offenes Dasein, ein Solidarischsein der Menschen ermöglicht. Und das Verlangen gilt einer poetischen Aktion, die Lebens-Not-Wendigkeiten verdeutlicht, die fortfährt, den Druck drückender zu machen durch das Bewußtsein des Drucks, die hart auf Not verweist und auf die Vernunft nicht zu verzichten bereit ist im Verfechten des Menschenrechts, die die Interessen der Gegenwart verficht, ohne Zukunft aufzugeben. Welche Wege Kunst dabei zu gehen hat, welche Haltungen nun nötig werden und welche Mittel brauchbar – dazu scheinen jetzt mehr Fragen als Antworten bereitzuliegen. Mensching und Wenzel wissen das, und es gibt Zuversicht, daß beide gute Frager sind.
Dieter Schlenstedt, neue deutsche literatur, Heft 448, April 1990
Hans Sarkowicz: Ein Kristallisationskünstler mit vielen Talenten. Laudatio auf Steffen Mensching zum Thüringer Literaturpreis 2021.
Zum 60. Geburtstag des Autors:
Ulrike Kern: Intendant, Autor und Clown Steffen Mensching wird 60
Ostthüringer Zeitung, 27.12.2018
Jegor Jublimov: Martens, Mensching
junge Welt, 27.12.2018
Fakten und Vermutungen zum Autor + KLG + IMDb
Porträtgalerie: Autorenarchiv Susanne Schleyer +
Dirk Skibas Autorenporträts + Brigitte Friedrich Autorenfotos +
deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口 1 + 2
Steffen Mensching & Hans-Eckardt Wenzel bei Verlorene Lieder – verlorene Zeit am 2. Dezember 1989 im Haus der Jungen Talente in Ost-Berlin.


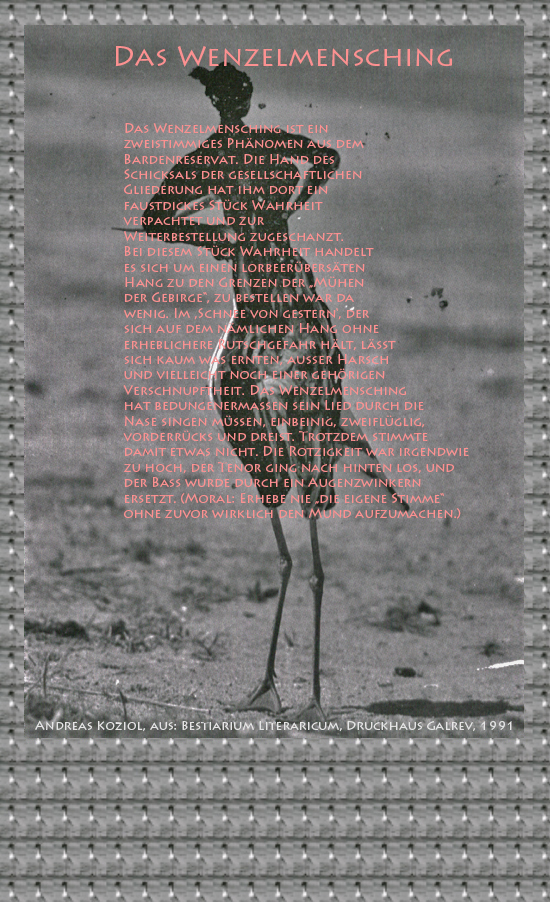












Schreibe einen Kommentar