Stephan Hermlin: Gedichte und Nachdichtungen
DU STEHST AUF
Du stehst auf: die Wasser entfalten sich
Du legt dich: die Wasser blühn auf
Du bist Wasser das seinen Gründen entwunden
Du bist Erde die Wurzeln geschlagen
Und wo alles sich gründet
Du machst Blasen aus Stille in der Wüste der Geräusche
Du singst nächtliche Hymnen auf den Saiten des Regenbogens
Du bist überall du hebst alle Straßen auf
Du opferst die Zeit
Der ewigen Jugend der genauen Flamme
Die Natur verschleiert wenn sie sie neu schafft
Frau du bringst einen immer gleichen Leib zur Welt
Den deinen
Du bist was sich ähnlich ist.
Spätbürger und Kommunist: Stephan Hermlin
– Ein Porträt. –
Die Nacht kommt über die Berge. Nein, wir wollen noch nicht auseinandergehen, laßt uns noch das kleine Beethoven-Trio spielen, nicht eines von den großen, das kleine, op. 11, soviel Zeit haben wir noch, ich liege ja schon, es ist mein Bett, ich bin aufgewacht und schaue durch das Fensterviereck nach oben, der zweite Satz hebt an mit einer aufsteigenden Quarte, der eine aufsteigende Quinte folgt, ein großer Augenaufschlag, die Welt könnte gut sein, und ihr könnt ertragen, was ihr tragt, ohne zu erblassen, ohne aufzuschreien.
So wie der Autor mit diesen Zeilen, spricht zu uns das ganze Buch: Abendlicht von Stephan Hermlin. Ein Buch voller Schönheit und Schmerz, ein Buch nicht ohne Hoffnung und einem Anflug von Trauer und Abschied. Das Buch eines Autors, der den Namen des Dichters verdient, der den Anspruch einlöst, den oft zitierten Widerspruch aufzulösen, der beides ist: spätbürgerlicher Schriftsteller und Kommunist.
Stephan Hermlin kommt aus einer kunstliebenden wohlhabenden Unternehmerfamilie, er besuchte Gymnasien in Chemnitz und Berlin, ein Internat in der Schweiz und war durchaus kein Einzelgänger:
Ich boxe, reite, treibe Leichtathletik, fahre Rad. Bei den städtischen Juniorenmeisterschaften schwimme ich die 100 m Freistil, werde vierter.
Das wirkliche Leben lernt er jedoch nicht im Leben, sondern in Büchern kennen.
Ich lese nach einem Plan, in rasender Eile: die antiken Dichter, die mich in der Schule langweilen, die Elisabethaner, Hölderlin, Novalis, Des Knaben Wunderhorn, Büchner, die Russen, die Franzosen des 19. Jahrhunderts. Die Bücher schützen mich vor dem Leben, das ich fürchte. Abends im Bett las ich Oliver Twist (…) Mich erfaßte heftiges Mitleid mit armen Kindern, die es glücklicherweise nur in Büchern gab.
Nicht aus eigener Lebenserfahrung, sondern aus Leseerlebnissen, aus der Beschäftigung mit Kunst und insbesondere Musik erwuchs mithin die Überzeugung.
Das Leben, so wie es ist, muß verändert werden; die Kunst meint mehr, als sie vordergründig sagt. In einem Gedicht Rilkes über ein Kunstwerk fand ich den Satz: Du mußt dein Leben ändern. Man weiß: es ist das Kunstwerk, ein apollinischer Torso, der so spricht. Mir wurde allmählich klar, daß auch zwischen Kunst und Leben keine Wand steht: wenn man auf die Kunst hört, muß man handeln.
Ungefähr zur gleichen Zeit schrieb Hermlin seine ersten Gedichte. Natürlich waren die Versuche des elf-/zwölfjährigen Jungen keine Werke für die Ewigkeit: „Noch mitten im Versuch begriff ich, daß das, was ich da schrieb, nichts taugte“, erinnert sich Hermlin in Abendlicht und schildert dann, wie sein erstes Gedicht entstand.
Regungslos sah ich auf die Verse nieder, die ich gerade geschrieben hatte. Ich wußte nicht, ob, was da stand, wirklich gut war, aber ich fühlte, daß es mein erstes Gedicht war. Ich war damals fünfzehn Jahre alt.
Ein Jahr später, 1931, trat Hermlin in den Kommunistischen Jugendverband Deutschlands ein; an einer Berliner Straßenecke schrieb er seinen Namen auf einen zerknitterten Zettel; das Aufnahmeformular.
Ich wußte damals nicht, was alles ich unterschrieb; die Verpflichtung, mit den Unterdrückten in einer Front zu kämpfen, von vielen, die mir bis dahin vertraut gewesen waren, als Feind behandelt zu werden, beharrlich, kaltblütig, verschwiegen zu sein, zu lernen und das Erlernte weiterzugeben, Prüfungen verschiedener Art zu ertragen, den Sinn höherzustellen als das Wort.
Jäh vollzieht Hermlin in diesem Jahr, 1931, den Bruch mit seiner bürgerlichen Herkunft. Er trägt das sogenannte Räuberzivil, Schaftstiefel, Jackett und Schirmmütze und benutzt den Dienstboteneingang, wenn nachts Plakate geklebt oder Parteiveranstaltungen geschützt werden müssen. Wenig später, schon in der Illegalität, gibt es nur noch eine Verständigungsmöglichkeit mit dem Vater: „wir spielten Mozartsonaten“.
Die Jahre nach der faschistischen Machtergreifung bis zur Emigration 1936 erlebt Hermlin als eine Zeit der Feigheit, des Verrats. Freunde wechseln aus dem Kommunistischen Jugendverband in die Reihen der SA, ein langjähriger Freund der Familie schlüpft in eine Seitenstraße, um nicht grüßen zu müssen. Drei Jahre arbeitet Hermlin illegal in Berlin. Seinen Lebensunterhalt verdient er als Druckerlehrling. Dann muß er emigrieren. Die Flucht geht durch Länder und Lager, führt Hermlin nach Palästina, England, als Widerstandskämpfer nach Spanien. In der französischen Armee dient er bei Ausbruch des 2. Weltkrieges als Prestataire; er wird nach dem Einmarsch der Deutschen interniert, flieht schließlich mit Hilfe des Maquis in die Schweiz. Seine ersten gültigen Gedichte schreibt Hermlin seit 1939:
Um sich zu behaupten in einer Umwelt, die mir und meinesgleichen das Lebensrecht versagte.
Einzelne Balladen erscheinen zuerst in französischer Übersetzung in Paul Eluards Eternelle Revue, einer illegalen Zeitschrift der Resistance und auf Flugblättern der Bewegung Freies Deutschland in der Schweiz. Bereits mit seinem ersten Gedichtband Den Balladen von den großen Städten, der Weihnachten 1944 in der Schweiz erscheint, hat Hermlin sein Thema und seine Ausdrucksmittel gefunden. Leid und Einsamkeit sind die Grunderlebnisse dieser Zeit, Erlebnisse, die bis zur Unerträglichkeit ausgemalt werden, und gegen die angesprochen, geschrien, gestöhnt wird, in einer expressionistischen Bilderwucht und Wut, die an die apokalyptischen Metaphern Georg Heyms erinnern.
Hört den beleidigten Schwachen, ihr irdischen Richter, Städte!
Wäre eure Stimme gleich einer Säule erwacht,
Als es Zeit war, in unserer Mitte, jählings sie hätte
Uns den Vernichtern entrissen und ihrer tierischen Nacht.
Hört den beleidigten Schwachen, ihr irdischen Richter, Städte!
…
Hier aus den rattenerfüllten Kellern, gräßlichen Stollen
Brüll ich euch sterbend zu: Errettet uns aus der Haft!
Rettet uns aus dem sanften spitzfingrigen Griffe der tollen
Folterer und vor des Wahnsinns süßem mohnfarbenen Saft,
…
Macht eure Plätze leer und erwartend und stellt das Entsetzen
Riesig am Horizont auf und laßt einen lautlosen Sturm
Auf euern Schultern liegen – von rauschenden Bannern verletzen,
Imaginären, schreienden, laßt euern mächtigsten Turm!
Macht eure Plätze leer und umstellt euch mit stummem Entsetzen!
Denn seht dort eure Schwestern: der Feind peitscht ihre Fassaden,
Doch die geöffneten Flanken spein Haß. So stehen sie nackt.
Aus einem Wald von Fahnen wehen der Abschüsse Schwaden,
Halten die fleischlosen Kiefer den Feind an der Kehle gepackt –
So sind euere Schwestern: und peitscht auch der Feind die Fassaden!
Darum erwarten wir euch: die Schatten vom Städtgeschlechte.
So sind verschworen wir euerer Zukunft oder dem Fall
In die staubigen Gräber der Nacht. Doch unsere Rechte
Krönt euch mit Zuversicht. Und unserer Stimme ersterbender Hall
Sagt euch von der Erwartung der Schatten vom Städtgeschlechte.
Der Dichter tritt auf als Verkünder, als einer, der an die Möglichkeit des überzeugenden Wortes glaubt, glauben muß, da ihm nichts anderes geblieben ist als dieses Wort, um sich aus seiner Einsamkeit zu lösen. Denn auch das enthalten die Balladen: den unbeugsamen Willen, die Einsamkeit, wenn auch mit letzter Anspannung aller Kräfte, abzuschütteln für die Gemeinsamkeit in einem Wir, einem Wir der Widerstandskämpfer gegen den Faschismus. Leid und Leidüberwindung, Einsamkeit und ihre Aufhebung im Widerstandskampf: das ist die Haltung Hermlins in diesen Gedichten.
Da beschlossen wir endlich, alles zu ändern,
Unseren Traum und unsre Wirklichkeit.
Für die Dörfer und Städte in allen Ländern
Hielten wir die leere Ebene bereit.
Aus unsern Händen begannen sich jählings zu leeren
Auf sich duckende Plätze und Straßen erstarrt
Bündel von Flinten und Maschinengewehren,
Und im Wind der Zukunft verstob eine Gegenwart.
Und nun fuhren wir, ein Sturm, in die Straßen,
Und unser Atem hat pfeifend die Nebel geteilt.
Mit den Augen deckten wir. Dächer ab. Gassen
Rissen wir weg, über Hochhäusern angeseilt.
An jeder Ecke erschossen wir Hunger und Sterben,
Wahnsinn, Pest und Verrat. Wir reichten der zögernden Hand
Waffen und Bücher. Und gegen das große Verderben
Schmiedeten wir wie beflügelt den Großen Verband.
Und so bauten aufs neue im Traum wir. Die Städte
Schritten wie Wälder aus Marmor und Licht um uns her.
Ungeheurer Gesang übertönte Gebete.
Glückliche Flotten befuhren gewaltig das Meer.
Auch bei den fernen Brüdern warn wir zu Gaste,
Weilten in leuchtenden Städten, wo Dschungel geraucht
Glühend noch gestern. Und selbst am weitesten Maste
Schlug das Banner des Lebens in Stürme getaucht.
Auf den dröhnenden Feldern der Sang der Traktoren.
Ebenen warteten riesig auf uns überall.
Und der mächtige Tag, im Osten geboren,
Flog aus unserer Hand wie ein feuriger Ball.
Für den Kommunisten Hermlin war es selbstverständlich, daß er seine Zukunftsvision nach Osten, in die Sowjetunion verlagerte. Doch bereits seine ersten Gedichte verleugnen auch den „Spätbürger“, genauer die Verbundenheit mit deutscher Literatur und Musiktradition, nicht. Von „Percy Friedrich Wolfgang“, von Shelley, Hölderlin, Mozart also ist die Rede, Sonaten, „das Wort toter Dichter“, der „Poeten Brüderschaft“ weisen als Zeugnisse großer Menschlichkeit in eine menschlichere Zukunft. Gleichrangig neben dem Widerstandskampf gehören Literatur und Musik für Hermlin zu den unzerstörbaren Werten, die ein Weiterleben ermöglichen.
Deutlicher jedoch als einige Motive zeigt die lyrische Technik der Balladen, wie Hermlin literarische Tradition seinem poetischen Anliegen gefügig macht. Der Luther Choral, das Kirchenlied des Barock, Fleming, Spee, Paul Gerhardt, Gryphius, Günther nennt Hermlin selbst als direkte Einflüsse. Daß er sich besonders auf Dichter aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges zurückbesinnt, ist aufschlußreich: In der Klage des einsamen, verzweifelten Menschen erkannte er seine eigene Situation wieder. Den Leser, der bei Balladen an die „Kraniche des Ibikus“ oder „Die Bürgschaft“, also an spannende außergewöhnliche Begebenheiten denkt, müssen die Balladen Hermlins jedoch befremden.
Hermlin schuf sich einen neuen Typ der Ballade: Sie gibt den äußeren inmitten des inneren Berichts. Der unbeteiligte Erzählerton früherer Balladen ist preisgegeben; denn die Berichte aus unserer Zeit verlangen Entscheidungen und Stellungnahmen, sie kennen kein ,interessenloses Betrachten‘. Vor allem verlangen sie Antwort
schrieb Hans Mayer 1945 in seiner Rezension, die die Balladen als „Bilanz eines Menschen und Dichters in unserer Zeit, eines Sprossen der großen Werke und der großen Meister“ lobte.
Andere waren da anderer Meinung. In den meisten Balladen „beeinträchtigt das Übermaß des Irrationalen die Klarheit (…) Hermlin steht mit diesen Gedichten in der Linie der verfallenden bürgerlichen Dichtung“, heißt es in einem Lehrbuch für den Literaturunterricht an den Ober- und Fachschulen in der DDR aus dem Jahre 1953. Und das Neue Deutschland mäkelte, als 1952 der Gedichtband Der Flug der Taube erschien:
Zu oft noch muß der nach dem Sinn forschende Leser raten, deuteln, interpretieren. Warum? Offenbar, weil Hermlin noch immer die Rolle unterschätzt, die dem gestaltenden Bewußtsein auch in der Lyrik gebührt. (…) Sich von subjektiven Gedankenverbindungen treiben zu lassen, (…) das ist ein Rest von Glauben an die Spontaneität im künstlerischen Schaffen.
Man kann sich vorstellen, welche Art von Literatur der Verfasser dieses Artikels bevorzugt, der dem Autor die Spontaneität, dem Leser die Lust am Interpretieren ersparen möchte!
Im Widerstand gegen die Lyrik Hermlins feierte selbst die Kritik im geteilten Deutschland eine seltsame Wiedervereinigung. Machte sich Hermlin drüben durch seine Poesie verdächtig, tat er es hierzulande durch seine Politik. Während man hüben politische Eindeutigkeit vermißte, mißtraute man hier seiner poetischen Mehrdeutigkeit als besonders raffiniertem Mittel politische Eindeutigkeit zu verschleiern: „Die Balladen Hermlins verraten einen Lyriker von echtem Gefühl und Formvermögen (…) Hier ist wieder ein erfolgreicher Ansatzpunkt für eine rote Infiltration (…) die sich Erfolg versprechen kann“, hieß es in der Welt.
Offenbar konnte man sich in den beiden deutschen Staaten nicht so recht vorstellen, daß sich eine Freude an Form und Spiel mit ernstem politischen Engagement durchaus verbinden läßt.
Die meisten Gedichte schrieb Hermlin im Exil und kurz danach, 1958 entstand sein bislang letztes Gedicht „Tod eines Dichters“ für Johannes R. Becher. Die zentrale Faschismus- und Widerstands-Thematik wird kaum einmal erweitert: „Hermlin ist dialektischer Denker und musikalischer Künstler. Dialektik aber und Musik verlangen gemeinsam, daß bereits das Thema alle Elemente einer Wandlung und Veränderung in sich trägt“, schrieb Hans Mayer.
Sind Hermlins Gedichte durch diese eingeschränkte Thematik heute überholt? Können sie nur noch als Zeitdokumente und Sprachmonumente gelesen werden, die das politische Verantwortungsbewußtsein und die gewandte literarische Technik ihres Autors bezeugen? Sicher sind die meisten Gedichte vom Autor zum Zeitpunkt ihrer Niederschrift politisch, zeitbezogen gemeint. Aber sie sind immer mehr als ästhetische Dokumente; wären sie nur das, sie erreichten uns heute nicht mehr als Bekenntnisse. Als „Bruchstücke einer großen Konfession“ wenden sich die Gedichte an Leser für die der Anlaß, der reale Hintergrund ihrer Entstehung gar nicht von Belang sind. Solange es Leser gibt, die sich die Lust am Interpretieren von Texten bewahren, sind diese Gedichte immer wieder neu zu begreifen, neu zu entdecken. Und solange jüngste deutsche Vergangenheit nicht wieder gut gemacht ist – nämlich nie – müssen Gedichte wie „Die Asche von Birkenau“ Scham und Bestürzung hervorrufen und das Bedürfnis wecken, dem Aufruf des Dichters zur Wachsamkeit zu folgen.
Die da Frieden sagen
Millionenfach,
Werden die Herren verjagen,
Bieten dem Tode Schach,
Die an die Hoffnung glauben,
Sehen die Birken grün,
Wenn die Schatten der Tauben
Über die Asche fliehn:
Lied des Todes, verklungen,
Das jäh dem Leben gleicht:
Schwer wie Erinnerungen
Und wie Vergessen leicht.
Ebenso wie die meisten Gedichte entstand auch die novellistische Prosa Hermlins vor nahezu 30 Jahren. Auch ihr Thema ist der antifaschistische Widerstand in Illegalität und Emigration in KZ und Ghetto, und auch die Prosa wurde geschrieben gegen das Vergessen.
„Alles, was ich fürchte, ist wohl nur das eine: Werden sie an uns denken?“, sagt eine junge Jüdin in der Erzählung über den Aufstand im Warschauer Ghetto, „Die Zeit der Gemeinsamkeit“. Hier wie im Gedicht ist es zum einen das Thema, der Stoff, der die Aktualität dieser Erzählungen garantiert. Sie konkretisieren Geschichtsbewußtsein, warnen vor denen, die heute mit nunmehr unsichtbaren SS-Gerten an nunmehr unsichtbare Stiefelschäfte schlagen vor Ungeduld, daß, was oben war, wieder oben sein wird. Aber der Feind in diesen Erzählungen ist nicht nur der Faschismus. Der Feind ist auch die Stumpfheit, Feigheit, Apathie in den eigenen Reihen, in der eigenen Brust.
„Ich weiß nur, daß wir keinen gefährlicheren Gegner besitzen als die Apathie; daß sie vor allem bekämpfenswert ist“, sagt der Ich-Erzähler in „Die Zeit der Gemeinsamkeit“. Zu spät entschließen sich die zaudernden Freunde des „Leutnant Yorck von Wartenburg“ in der gleichnamigen Erzählung zum Widerstand. Mit der Floskel „man wird weitersehen“ richtet sich der Maler Reichmann im Elend ein. Furcht, Entfremdung und Vereinsamung verzögern die Entscheidung des Emigranten Neubert in „Die Zeit der Einsamkeit“, sich wieder dem illegalen Widerstand einzugliedern. Und schließlich finden wir diese lähmende Verzweiflung, diese duldende Ergebenheit, am deutlichsten in der Erzählung „Die Zeit der Gemeinsamkeit“, wo zehntausende jüdischer Menschen das Warschauer Ghetto ertragen, bevor sie sich zum Aufstand entschließen.
(…)
Es ist viel darüber spekuliert worden, inwieweit die mißtrauische Aufnahme, die Hermlins Werk in den eigenen Reihen fand, zu seinem Verstummen als Lyriker und Epiker beigetragen hat. HermIin selbst hat in der Öffentlichkeit diesen Zusammenhang immer geleugnet, zuletzt in dem bewegenden Bekenntnis über das Gedichteschreiben in Abendlicht. Doch schon Jahre vorher beschreibt er seine Situation so:
In Wirklichkeit hat es überhaupt keine Stunde ohne Konflikt gegeben. Es gibt nur eine Konfliktsituation, die ist ununterbrochen. Aber auf der anderen Seite wäre es wieder sehr schwerwiegend und ungerecht zu sagen, daß der Dauerkonflikt sozusagen nachteilige Folgen für meine Produktion gehabt hat. Es gibt einfach Perioden, in denen ich fast nichts schreibe. Da ich Geld verdienen muß, lebe ich u.a. vom Übersetzen von Büchern. Das ist meine vorwiegende Beschäftigung. Aber dieser, sagen wir fast nie aufhörende Konflikt, hat sowohl Negatives als auch Positives. Denn erstens prüft man sich selbst und seine eigenen Ansichten in einer solchen Situation viel genauer und zweitens, wenn man ein Anhänger der Lehre von Marx ist, dann kann man Konflikte nicht von vornhinein für negativ halten.
Daß die Folgen dieser Konflikte jedoch mitunter für den Autor eindeutig negativ aussahen, steht fest. Oft zitiert wird der Lyrikabend in der Ostberliner Akademie der Künste Ende 1962, den Hermlin als Sekretär der Sektion Dichtkunst und Sprachpflege veranstaltet hatte, und wo er u.a. die damals noch unbekannten Autoren Sarah Kirsch, Volker Braun, Wolf Biermann vorstellte. Die Partei mißbilligte das Unternehmen, Hermlin übte Selbstkritik mit unüberhörbarer Ironie, und verlor seinen Posten.
1976 initiierte er den ersten Protest von Autoren gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns, 1979 ergriff er als einziger öffentlich das Wort gegen den Ausschluß von neun Kollegen aus dem Berliner Schriftstellerverband. Fast schien es, als habe sich Hermlin ganz auf publizistische Veröffentlichungen zurückgezogen, als greife er nur noch als moralische Instanz ins literarische Leben ein, da strafte ein schmales Prosabändchen das Geraune vom verstummten Dichter Lügen.
In Abendlicht, so der Titel des Buches, erinnert sich Hermlin an die Jahre um 1930 in Deutschland; dennoch lesen wir weder eine Zeitchronik noch Memoiren. In 27 kapitelähnlich gegliederten Abschnitten skizziert und reflektiert Hermlin gelebtes Leben, Träume, Kunsterlebnisse in locker assoziierter Reihenfolge. So entsteht ein Geflecht aus Wahrheit und Wahrscheinlichkeit, aus – im Goetheschen Sinne – Dichtung und Wahrheit. Lebenswelt und Kunstwelt, durchlebte Geschichte und das geistige Leben in der Kunst erscheinen als gleichzeitiges, gleichwertiges, untrennbares Miteinander. Die Verstärkung des subjektiven Ausgangspunkts, die sich in Prosastücken wie „Cassberg“ und „Corneliusbrücke“ schon Jahre vorher ankündigte, geht Hand in Hand mit einer Verschiebung der Prioritäten im politischen Bereich. Die Freiheit des Individuums wird nun als wichtigste Voraussetzung für die Freiheit aller angesehen, nicht umgekehrt.
Ein philosophischer, ein politischer Text ist Abendlicht jedoch keineswegs, es ist, wie Hans Mayer sagt, „ein schönes, ein bewegendes Buch“. Die Hommage an den Bruder, der als Jagdflieger in der englischen Armee von der deutschen Luftwaffe abgeschossen wurde, die knapp berichteten Lebensläufe von Schulkameraden, Konturen von Verwandten und zuallererst das Portrait des Vaters zeigen, daß der oft strapazierte Begriff vom Geschichtsbewußtsein für den Autor bei der Geschichte der eigenen Person seinen Anfang nimmt. Schrieb Hermlin in den fünfziger Jahren noch: „Alles, was ich von meinem eigenen Leben wußte, war, daß es mit seinen humanistischen Studien, seinen Reitstunden, seiner behaglichen Liberalität nicht stimmte“, so weiß er heute, im Unterschied zu manchen Zeit- und Parteigenossen, daß Geschichte nicht teilbar ist, weder im privaten noch im politischen und kulturpolitischen Bereich. Geschichts- und Selbstbewußtsein gehören zusammen, Kommunist und Spätbürger stehen in einer Tradition.
In der Tat ist ein kommunistischer Schriftsteller ein Sohn aller nach vorn und rückwärts gewandten Utopien, ein Sohn von Ketzern und heiliggesprochenen Märtyrern, die vor ihm haben die 10 Gebote geschrieben und die Bergpredigt, er stammt von Spartakus ab, aber auch von Franz von Assisi.
Einen bequemen Verkehr mit der Gesellschaft, aber auch mit sich selbst, erlaubt dieses Geschichtsbewußtsein als Selbstbewußtsein keineswegs. Und es ist auch nichts, was man einmal erwerben und sich dann dauerhaft aufs Hirn stülpen kann wie eine Perücke. Gefordert wird vielmehr eine unermüdliche Tendenz zur Genauigkeit, zur unablässigen Radikalisierung von Erfahrungen. Das aber bedeutet, daß eigene Fehler und Irrtümer so unnachgiebig ausgesprochen werden wie die der Gesellschaft. Selbst-Vertrauen schließt Selbst-Kritik mit ein.
„Die Widersprüche der Zeit spiegeln sich in seinen eigenen“, sagt Hermlin von dem polnischen Dichter Mickiewicz. Dies trifft auch für ihn zu. In dem Band Aufsätze – Reden – Reportagen Interviews, der publizistische Arbeiten Hermlins vorstellt, antwortet er auf die Frage, was er heute nach dreißig Jahren empfinde, wenn er seine stalinistischen Verurteilungen von Dichtern wie Mandelstam oder Gumilew wiederlese:
Was soll ich empfinden, wenn nicht Scham und Bitterkeit (…) Ich könnte mich darauf hinauszureden suchen, daß ich schlecht informiert war. Aber ich war schlecht informiert, weil ich nicht wirklich informiert sein wollte. Viele Jahre hindurch war ich von der Angst besessen, eine Wahrheit zu erfahren, die mir unvereinbar mit der Sache zu sein schien, für die ich kämpfte. Später erst begriff ich, daß die ,gute Sache‘ nur zu verteidigen war, daß sie erst wirklich zur guten Sache wurde, wenn man ihre Fehler, ihre Irrtümer, ihre Untaten beim Namen nannte. Ich nannte Gumilew einen ,Dichter‘; diese Anführungsstriche sind besonders schmachvoll. Denn Gumilew, von dem ich, nebenbei bemerkt, damals keine Zeile gelesen hatte, war ein wirklicher Dichter, einer der größten russischen Dichter des Jahrhunderts. Er war kein Weißgardist. Daß Mandelstam ein Opfer des Regimes wurde, ist seit vielen Jahren bekannt. Wenn Jessenin dem Trunk erlag – nach den Gründen seiner Trunksucht fragte ich damals nicht, obwohl ich bereits Majakowskis erschütterndes Abschiedsgedicht an Jessenin kannte. Und Majakowski, der vier Jahre danach Jessenins Weg folgte – ihn peinigten nicht die zu Tode, die ich verdächtigte, sondern seine eigenen (und auch meine) Gesinnungsgenossen, deren Namen ich später erfuhr, von denen ich manche selber kannte. Jahre später sagte ich in einer Rede, die ich in Wien hielt, einige Worte, die in diesem Zusammenhang vielleicht zu zitieren sind: „Oft dachte ich an das Wort des jungen Karl Marx, das etwa lautet: ,Das Volk, das sich wirklich zu schämen vermag, gleicht dem Löwen, der sich zum Sprung in sich selber zurückzieht.‘“ Zugleich verstand ich, daß meine neuen, meine jüngeren Freunde mir durch ihr Dasein die Verpflichtung auferlegten, meine Forderungen an sie auch selber zu erfüllen. Ich hatte etwas zu erkennen und danach zu handeln.
Ulla Hahn, die horen Heft 124, 4. Quartal 1981
Für festliche Stunden
Arnold Friedrich Vieth von Golßenau, der Sproß einer sächsischen Uradelsfamilie, hatte für sein erstes Buch ein plebejisch klingendes Pseudonym gewählt: Ludwig Renn. Auch im Leben bediente er sich fortan dieses Schriftstellernamens. Damit sollte ein grundsätzlicher Schritt angedeutet werden: Der Verfasser hatte sich ein für allemal von seiner feudalen Umwelt losgesagt, um sich dem revolutionären Kampf der Arbeiterklasse anzuschließen. Das war eine ideologische und politische Entscheidung, die durch zeitgeschichtliche Ereignisse und persönliche Erlebnisse bedingt wurde. Liest man jedoch Renns autobiographische Bücher, so spürt man, daß hier neben ideologischen und politischen Überlegungen noch ein Motiv anderer Art eine gewiß untergeordnete, aber doch nicht ganz unwichtige Rolle gespielt hat: Der dekadenten Atmosphäre in seiner Umgebung überdrüssig, suchte der von Golßenau das Einfache, Saubere und Gesunde, das Primitive und das Kräftige. Das alles glaubte er im Proletariat finden zu können. Der einsilbige Name Renn – schlicht, knapp, hart – symbolisiert also auch eine von Politik und Zeitgeschehen unabhängige elementare Sehnsucht.
Der Dichter, von dem hier die Rede sein soll, stammt ebenfalls aus Sachsen – er wurde 1915 in Chemnitz geboren –, kommt jedoch nicht aus einem adligen, sondern aus einem bürgerlichen oder großbürgerlichen Haus. Als Sechzehnjähriger tritt er in Berlin dem Kommunistischen Jugendverband Deutschlands bei. Hatte Renn als Fahnenjunker in einem besonders exklusiven Regiment des königlichen Sachsen gedient, um die Offizierslaufbahn einzuschlagen, so war unser Dichter Lehrling in einer Druckerei, bereitete sich also für einen proletarischen Beruf vor.1 Der junge Kommunist, der sich auch in der Illegalität politisch betätigte, emigrierte 1936. Sein Weg führte ihn über Ägypten, Palästina und England nach Frankreich, wo er zeitweise interniert war und sich an der Widerstandsbewegung beteiligte, und schließlich nach der Schweiz, wo er abermals ein Internierungslager kennenlernen mußte. In Zürich erschien im Frühjahr 1945 seine erste selbständige Publikation: Zwölf Balladen von den großen Städten. Name des Verfassers: Stephan Hermlin. In Wirklichkeit hieß der Debütant Rudolf Leder.
Daß wir es hier mit einem Pseudonym zu tun haben, ist nicht bemerkenswert – übrigens mußten die nach der Schweiz emigrierten deutschen Schriftsteller meist ihre Arbeiten anonym oder pseudonym veröffentlichen. Hingegen scheint die getroffene Wahl aufschlußreich zu sein. Während Leder ein unauffälliger, alltäglicher Name ist, ruft das Pseudonym Hermlin die Erinnerung an jene edlen Pelze wach, mit denen Könige traditionsgemäß ihre Mäntel schmückten. Dieser Name läßt an etwas Wertvolles und Kostbares denken, an Erlesenes und Feierliches. Und der Vorname? Stephan mag zwar ebenso gebräuchlich wie Rudolf sein, ist jedoch der Vorname von zwei bedeutenden Lyrikern der letzten hundert Jahre – von Mallarmé und George. Hermlin hatte wohl eher den Franzosen gemeint, worauf – von allen anderen Umständen abgesehen – die von ihm gewählte Schreibweise hindeutet. Gleichviel, ob Mallarmé oder George – bei beiden Namen stellen sich im ersten Augenblick ähnliche Assoziationen ein: Erhabenes und Dunkles, formale Strenge, festlicher Tonfall und priesterliche Würde, das Weihevolle und das Majestätische.
Hat der Debütant derartige Assoziationen angestrebt? Das kann ich nicht behaupten. Aber daß er, ein Feinschmecker der Sprache, ein sensibler Kenner der Symbole, Bilder und Anspielungen, sich ihrer nicht bewußt war, ist ausgeschlossen. Unlieb waren sie ihm jedenfalls nicht. Und mögen auch in diesem Fall bei der Wahl des Pseudonyms ideologische und politische Motive keine Rolle gespielt haben – Hermlin blieb im Exil dem Kommunismus treu –, so darf man doch von einem psychologischen Symptom sprechen. Wird nicht hier die gleiche Sehnsucht deutlich wie einst bei dem von Golßenau, als er sich Renn nannte – allerdings in umgekehrter Richtung? Hat der Autor der Zwölf Balladen vielleicht seinen gewöhnlichen, schlichten Namen in einen ungewöhnlichen, anspruchsvoll-wohlklingenden umgewandelt, weil er, der ehemalige Lehrling in einer Druckerei, der kommunistische Klassenkämpfer, der umhergetriebene Emigrant, vom Vornehmen und Distinguierten träumte und sich im Grunde seiner Seele nach dem Exklusiven und dem Aristokratischen sehnte?
Dies sei, wird man sagen, eine menschliche, eine harmlose Sehnsucht. Natürlich – nur kann sie unter bestimmten gesellschaftlichen und politischen Voraussetzungen unversehens ihre Harmlosigkeit einbüßen und sogar den Künstler in schwierige Konflikte bringen. Aber wie auch immer: als sich der junge Dichter für den Namen „Stephan Hermlin“ entschied, bekannte er sich bewußt oder unbewußt zu einem persönlichen ästhetischen Programm. Denn die Assoziationen und Reflexionen, zu denen dieses Pseudonym Anlaß gibt, werden durch sein literarisches Werk bestätigt und potenziert.
Schon die frühe Lyrik, enthalten in dem erwähnten Erstling Zwölf Balladen von den großen Städten und in den kurz darauf in Deutschland erschienenen kleinen Sammlungen Die Straßen der Furcht (1946) und Zweiundzwanzig Balladen (1947), läßt eine außerordentliche sprachliche Gewandtheit, eine geradezu artistische Formulierungsbegabung erkennen. Zugleich erweist es sich, daß der Autor sehr belesen und für heterogene literarische Einflüsse empfänglich ist. Barock, Symbolismus, Neuromantik und Expressionismus machen sich in seinen Versen bemerkbar; man glaubt das Echo vieler Lyriker zu hören – von Rilke, Hofmannsthal und George über Heym, Stadler und Trakl bis zu Brecht und Benn. Vor allem aber ist das Vorbild der Franzosen deutlich: von Rimbaud und Mallarmé bis Eluard und Aragon. Die vom Surrealismus kommende literarische Widerstandsbewegung Frankreichs, deren einzelne Vertreter er während des Krieges kennenlernte, hat ihn wohl am stärksten geprägt. Diese nicht immer rühmliche stilistische Anpassungsfähigkeit und Vielseitigkeit und die sprachliche Geläufigkeit prädestinieren übrigens Hermlin zum Nachdichter: Wir verdanken ihm beachtliche und teilweise meisterhafte Übertragungen von Versen Paul Eluards, Pablo Nerudas, des Türken Nazim Hikmet, des Ungarn Attila Jozsef und amerikanischer Negerlyriker.
Was indes seine eigenen Verse betrifft, so lassen sich über alles Eklektische hinaus doch gemeinsame Kennzeichen feststellen. Denn welchem Meister Hermlin auch nacheifert, welcher stilistischen Anregung er auch folgen mag – es entstehen immer Strophen für festliche Stunden. Er liebt das edle Wort, den gewählten Ausdruck, den getragenen Tonfall, den feierlichen Rhythmus, die elegische Melodie, die dunkle Metapher, die tiefsinnige Anspielung, die strenge Form. Er bevorzugt romanische Versgebilde: die Stanze und das Triolett, die Terzine und das Sonett.
Vor allem liebt er das Poetische schlechthin. Er hat offenbar das dringende Bedürfnis, das Dasein zu stilisieren. Was er schildert, wirkt malerisch und dekorativ. In Hülle und Fülle werden geboten: Kathedralen, Dome, Paläste und Türme, Brunnen, Fontänen und Schwäne, Haine, Hügel und Gestade, Fahnen, Marmor und Glocken. Alle Musikinstrumente werden für dieses poetische Universum bemüht: von der Geige bis zur Orgel und mit einer besonderen Vorliebe Blasinstrumente – es gibt Flöten, Oboen, Saxophone, Trompeten, Fanfaren und Posaunen. Und was dieser Lyriker auch sagen mag, es wirkt würdig und erhaben. Er singt und kündet, er raunt und beschwört. Das Preziöse ist sein Element. Eine Strophe des „1940–1941“ datierten Gedichts „Die toten Städte“ lautet:
Senkt sich des Abends Kühle
Auf die traumsüchtige Welt,
Ist auf der Hügel Gestühle
Wolkenschatten gestellt,
Geistert die Klage der Hähne
In der Fiebernden Ruh,
Fliegen die Ungebornen
Dem Asphodelenhain zu.
Im selben Gedicht findet sich auch folgende Strophe:
Sonnen, wohin vergangen
Ist euer tönendes Rad?
Von der Schönheit umfangen
Apollinische Saat,
Flöten und marmorne Bilder,
Sterne im Abendbaum,
Lächelnde Mädchen, du milder,
Wohin starbst du, Traum?
Ein „Manifest an die Bestürmer der Stadt Stalingrad“, datiert „Dezember 1942“, beginnt:
Weil diese Nacht euer Haupt umlohte
Und der Vernichtung eure Stirn sich neigt…
Die zweite Strophe dieses Manifests hebt an:
Ich bin das Echo auf den weißen Treppen
Im Turme eures Haupts. Wie lang die Nacht…
In der „Ballade von den Städteverteidigern“ lesen wir:
… aus der Seide
Einer taubengrauen Dämmerung schimmert das Salz
Der Gesichter gefallener Kämpfer in tönender Heide.
Städte schreiten in dieser Lyrik „wie Wälder aus Marmor und Licht“. Vom „Flug dämmernder Schwalben“ hören wir und von „des Domgestühls Wind“. Um die „Nüstern“ eines Giganten „flackert vergeblich des Bienenflugs goldene Glut“. In einem Gedicht vom Jahre 1945 erklärt Hermlin:
… Nimmermehr mag ich deiner entraten,
Bis am schattenden Turme die Lanze mich trifft.
Oder:
Vor Domen senkt sich meine Stirn.
Daß der Autor dieser Verse Kommunist ist, geht nur aus wenigen Gedichten hervor – dann allerdings unmißverständlich. In der „Ballade von den weitschauenden Augen“ besingt er die „ruinenbesternten“ Türme des Kremls und die zweihundert Millionen, die die „morgige Welt“ säen. „Und deine Beschwerde“ – versichert der Dichter – „wird schon metallen vom Kreml aus Glockenmündern genannt.“ Verwunderlich ist allerdings das Entstehungsdatum dieser Ballade: 1940. Es drängte also den jungen Hermlin, der Sowjetunion gerade zur Zeit des Hitler-Stalin-Pakts zu huldigen.
Ansonsten ist in seinen Versen aus jenen Jahren vom revolutionären Optimismus nichts zu spüren, vielmehr dominieren Einsamkeit und Müdigkeit, Resignation und Todessehnsucht. Nicht militante Gedichte sind es, wohl aber Klagelieder, deren Trauer jedoch ebenso selbstgefällig anmutet wie ihre Form:
Ihr toten Dichter, die ihr für mich spracht,
Ihr verließt mich, doch ich euch nie.
Ich versank in der Bitterkeiten Meer,
Und ihr hörtet nicht, als ich schrie.
Hermlin teilt mit:
Ich bin die Müdigkeit, das dumpfe Grauen.
Und ruft:
Doch wir sind krank
Und würgen an des Alpdrucks Speis.
Und bittet:
O Bruder Tod, erhör uns, wieg
Uns ein, eh sich das Graun erfüllt!
Er entwirft eine makabre poetische Landschaft – mit „blauen Kinderkadavern“ und „endlos hinreichenden Zügen von Leichen“, mit „rattenerfüllten Kellern“ und „gräßlichen Stollen“. Und die Nacht ist „von Sirenen, den sterbenden Tieren, zerfetzt“. In den Versen häufen sich Todesmotive und Todessymbole. Die Rede ist von „des Todes Bienenstock“ und „des Todesweins Rest“, von der „Totenuhr in jedem Haus“ und von des „Todes murmelnden Schleusen“; da heißt es: „Und in den Trümmern baden / Tote im Abendschein“, und „Die toten Tänzer in den Höfen / Hängen im Drahtgesträuch.“
Um seine Stimmung anzudeuten, glaubt Hermlin in düsteren Farben schwelgen zu müssen. Kaum ein Gedicht, in dem das Wort „schwarz“ nicht vorkäme. Es gibt „schwarzes Blut“, „schwarze Sonnen“, „schwarze Lippen“, „schwarzen Mohn“, „schwarze Rosen“ und „schwarze Rosse“, einen „schwarzen Schlangenhag“, „nachtschwarze Minuten“, „geschwärzte Fassaden“; und Blut zischte wie „schwarzes Bier“.
Alles in allem: Eine Lyrik voll krampfhafter Wendungen, banaler Verse, pathetischer Töne, konventioneller Symbole, blasierter Posen. Allerdings braucht man nicht lange zu suchen, um Strophen oder – noch häufiger – einzelne Zeilen zu finden, denen ein subtiler Reiz nicht abgesprochen werden kann, deren Musikalität ihren Eindruck nicht verfehlt. Mögen es auch nur kurze Passagen sein, in denen Hermlin seine Gefühle und Visionen, zumal seine Leiden zu beglaubigen vermochte – sie zeugen doch von einem unzweifelhaften künstlerischen Temperament. Und schon diesem Umstand mußte früher oder später ein Konflikt zwischen ihm und seiner Partei entspringen.
Allem Anschein nach hat Hermlin schon damals gespürt, daß seine düster-vornehme Dichtung sich beim besten Willen nicht mit den Forderungen der kommunistischen Kulturpolitik in Einklang bringen läßt. Er war entschlossen, diesen Widerspruch zu überwinden. 1945 wurde die Frage aktuell – denn nun ergab sich für den deutschen kommunistischen Dichter die Möglichkeit, zu den Massen zu sprechen. Jetzt mußte er der Aufgabe gerecht werden, die ihm die Partei gestellt hatte. Hermlins Sprache war für diese Aufgabe ungeeignet. Offen erklärte er in der 1945 geschriebenen, bekenntnishaften „Ballade von den alten und den neuen Worten“:
Genügen können nicht mehr die Worte,
Die mir eine Nacht verrät,
Die beflügelte Magierkohorte,
Wie vom Rauch der Dämonen umdreht…
Der Abschied fällt schwer:
Daß an meinen Worten ich leide!
Und die Worte waren schön…
Dennoch gibt der Dichter kund:
Drum gebt mir eine neue Sprache!
Ich geb euch die meine her.
Und:
Ich will eine neue Sprache,
Wie einer, der sein Werkzeug wählt.
Allein, auch dieses programmatische Gedicht, offenbar schon in jener gewünschten neuen Sprache geschrieben, klingt elegisch aus:
Am Boden liegt das Glas
Und das Brot gewürzt mit Qualen.
Die notwendige Umstellung will nicht gelingen. „Forderung des Tages“ ist – wiederum programmatisch – ein anderes Gedicht aus dem Jahre 1945 betitelt. Hier versichert der Dichter:
Ich vernehme des Kommenden süßeste Geigen.
Sogleich fügt er jedoch hinzu:
Die Oboen der Toten bezaubern mein Blut.
Todesmotive häuft Hermlin auch in der 1947 entstandenen „Ballade nach zwei vergeblichen Sommern“. Während des Krieges hatte er eine „Ballade von der Königin Bitterkeit“ geschrieben. Jetzt hingegen, 1947, im Jahre seiner Übersiedlung nach Ostberlin, wartet er mit einer „Ballade von der Dame Hoffnung“ auf. Aber in Wirklichkeit ist dieses Gedicht nicht weniger bitter. Sein Fazit lautet:
Verbotener Brunnen du, nach dem wir bohren:
Von den Bedrängten Hoffnung bist genannt.
Auch den ebenfalls 1947 datierten Stanzen mit dem Titel „Die Zeit der Wunder“ kann man schwerlich den vom Sozialistischen Realismus geforderten Optimismus nachrühmen. Sie enden gar mit den einfach und schön formulierten Feststellungen:
Der Worte Wunden bluten heute nur nach innen.
Die Zeit der Wunder schwand. Die Jahre sind vertan.
So war die Lyrik, die der Umsiedler Hermlin mitbrachte, für die Kulturpolitiker der Zone wenig brauchbar und ziemlich suspekt. Die Zweiundzwanzig Balladen erschienen 1947 zwar in Ostberlin, wurden jedoch nicht mit einem sowjetzonalen, sondern mit einem westdeutschen Literaturpreis bedacht. Vielversprechend schien freilich für die Kulturpolitiker Hermlins Ruf zu sein:
Drum gebt mir eine neue Sprache!
Der Wunsch ließ sich erfüllen: Von kommunistischen Autoren erwartete man damals, daß sie sich die lyrische Sprache des Johannes R. Becher zum Vorbild nahmen.
Indes hatte Hermlin in dieser Angelegenheit durchaus eigene Anschauungen. Von 1945 bis 1947 in Frankfurt ansäßig, war er am dortigen Rundfunksender tätig, für den er eine Reihe von Buchbesprechungen verfaßt hatte. Sie erschienen – zusammen mit ähnlichen kleinen Arbeiten von Hans Mayer – Anfang 1947 in einem westdeutschen Verlag. In diesem Buch rühmte er unter anderem gerade jene Autoren, die in der DDR ignoriert oder bekämpft werden sollten: Kafka und Karl Kraus, Joyce und Eliot. Nach seiner Übersiedlung nach Ostberlin wird das Buch dort ebenfalls ediert, jedoch erweitert um „Bemerkungen zur Situation der zeitgenössischen Lyrik“. Hier äußert sich Hermlin über den repräsentativen kommunistischen Dichter:
Tragisch ist der Fall eines der bedeutendsten Lyriker des heutigen Deutschlands, der Fall des Johannes R. Becher. Sein letzter Gedichtband (Heimkehr, Aufbau-Verlag, Berlin) beweist neuerlich daß Becher in seiner von sehr ernsten politisch-ästhetischen Motiven bestimmten Erneuerung, die er seit etwa fünfzehn Jahren unternommen hat, über jedes mit seiner hohen dichterischen Begabung verträgliche Ziel hinausgeschossen ist. Dieser Fall ist sehr kompliziert und erfordert eine gründliche Auseinandersetzung. Es liegt aber unleugbar der Beweis vor, daß die Bemühung um einen neuen Realismus hier die Substanz und Eigengesetzlichkeit des Lyrischen zerstört hat: Becher ist in neo-klassizistischer Glätte und konventioneller Verseschmiederei gelandet. Er hat eine politisch richtig gestellte Aufgabe mit dichterischen Mitteln falsch gelöst.2
Hermlin, der übrigens dieses Urteil ein Jahrzehnt später demütig widerrief, hat damit die Gefahr bezeichnet, die ihn selber bedrohte. Denn er stand vor einem ähnlichen Dilemma wie Becher in den zwanziger Jahren. Einerseits mußte er für seine politische Dichtung eine den Massen des Volkes verständliche, klare und einfache Sprache finden (dies nennt er „die Bemühung um einen neuen Realismus“), andererseits wollte er nicht der Modernität verlustig gehen, dem Primitivismus verfallen und am Ende „die Substanz und Eigengesetzlichkeit des Lyrischen“ zerstören. Die Ergebnisse dieser Bemühungen sind vor allem in dem Band Der Flug der Taube (1952) zusammengefaßt.
Es wäre falsch, anzunehmen, die kulturpolitischen Forderungen, deren Berechtigung Hermlin freiwillig anerkannte, hätten auf seine Dichtung nur einen ungünstigen Einfluß ausgeübt. Manche dieser Verse, geschrieben Ende der vierziger und Anfang der fünfziger Jahre, beweisen, daß es ihm gelungen war, verschiedene Extravaganzen der frühen Balladen und ihre bisweilen ausgeklügelte, krampfhaft-ambitionierte Metaphorik zu überwinden. Hier und da wirkt seine Diktion strenger und disziplinierter und hat an Natürlichkeit und Anschaulichkeit gewonnen.
Zugleich ist aber zu den vielen literarischen Vorbildern die sich in Hermlins Lyrik bemerkbar machten, nun auch die sowjetische Poesie hinzugekommen; die Hemmungen, die bisher seiner Neigung zum Feierlichen und Erhabenen doch Grenzen gesetzt hatten, werden vom patriotischen Enthusiasmus weggeschwemmt. Er wählt fast ausschließlich heroische Stoffe oder zumindest solche die sich für eine heroisch-pathetische Behandlung eignen. So besingt er in zyklischen Gedichten die bolschewistische Oktoberrevolution von 1917 und die Verteidigung Leningrads im Zweiten Weltkrieg. Stalin und Pieck und die Heldentaten junger Kommunisten in Griechenland und Frankreich. Uneingeschränkt triumphiert das Monumentale. Das griechischen Partisanen gewidmete Poem „Epon“ endet:
Wie einen Mantel haben den Tod sie sich um die Schulter geschlagen.
Sie trinken die Zukunft durstig, als sei sie schon da.
Schon überrollt sie der Strom von Schreien und Schüssen und Tagen,
Und ihr Schweigen erzählt die Legende Attika.
Ein Poem zu Ehren von Wilhelm Pieck hebt an:
Der Zeiten Vorhang schwankt im Winde der Geschichte.
Wer wartet auf das Stichwort in den schweren Falten?
Es raunt die Nacht von Stimmen, längst verhallten…
Wie ferner Tubaruf dröhnt die Geschichte
Im Schritt der Straße enden die Legenden.
Der Tod, das Leitmotiv der früheren Lyrik Hermlins, kann in seiner Poesie als der stalinistischen Zeit, die programmatisch optimistisch zu sein hat, nur eine untergeordnete Rolle spielen: An seine Stelle tritt als geheimnisvoll-erhabenes Motiv die Nacht. Das zyklische Gedicht „Aurora“, das beste Stück des Bandes Der Flug der Taube, beginnt:
In dieser Nacht ist der Wind für immer umgeschlagen,
Nichts konnte mehr so sein, wie es bisher gewesen war,
Neu lasen sich die alten Bücher mit ihren Sagen,
Das Verborgene lag offen, und das Unverständliche ward klar.
Und:
Um dieser einen Nacht willen ward alle Musik geschrieben,
Um dieser einen Nacht willen ward jeder neue Gedanke gedacht.
Jedes Herz hatte in der Welt seine Heimat. Jeder Verlassene konnte lieben.
Was immer geschehen war, geschah für diese Nacht.
Mannigfaltige Aufgaben kommen dem Nachtmotiv in Hermlins poetischem Universum zu: Die Nacht kann das Gute und das Böse symbolisieren, den Fortschritt und die Reaktion. Sie kann auch eine lediglich dekorative Aufgabe erfüllen. „Die Nacht hat die Taube verschlungen“ – heißt es im Poem „Der Flug der Taube“. In der Dichtung „Die Jugend“ wird behauptet:
Die Nacht weckt die Zukunft auf.
Im Stalin-Gedicht „änderte sich unmerklich die Architektur der Nacht“, im „Flug der Taube“ triefen Tau und Nacht von den Schwingen der Titelheldin, in der „Jugend“ „wächst ein Wald von Musik um das Gebirge der Nacht“, und im Pieck-Poem bildet die Nacht das Spalier für Fahnen, die wie Rosen blühen.
Hermlins Huldigungen an die sowjetischen Genossen erreichen in diesem Band ihren Höhepunkt. Alle poetischen Vergleiche und Umschreibungen, die die Dichter der DDR in jenen Jahren für die Sowjetunion zu finden bemüht waren, übertrumpfte er, indem er schlicht feststellte:
Wie die Sonne gehört sie jedem.
Das Stalin-Poem hat Hermlin in eine spätere Sammlung seiner Lyrik nicht mehr aufgenommen. Daher soll es in diesem Zusammenhang nicht zitiert sein. Es genügt, auf das Gedicht vom „Flug der Taube“ hinzuweisen, in dem sich folgende Passage über Stalin findet:
Dann schritt vom Gebirg herab
Der Rufer, der Lehrer.
Aus den Toren der Klüfte
Trat er hervor, der Mann von Gori.
Er raffte den Vorhang der Nebel.
Quer über der Stirn
Stand ihm des Wasserfalls Regenbogen.
Für einen anderen Typ der Hermlinschen Lyrik dieser Jahre sind folgende Verse aus dem Gedicht „Der November ist die Heimat“. charakteristisch:
Es stürmten die Kommunisten
Das Land, das Gebirge, die See.
Es nahmen die Rotgardisten
Die Fabrik, das Korn und den Klee.
So erwies es sich, daß die Synthese, die Hermlin anstrebte, sich nicht verwirklichen ließ. Er wollte ein subtiler Lyriker und zugleich ein revolutionärer Agitator, ein westlicher Ästhet und doch ein östlicher Barde sein. Er wollte das Volk beglücken – und sich dabei nicht beschmutzen, die Massen hinreißen – und doch einsam und vornehm bleiben. Er träumte von einer Rednertribüne in einer gigantischen Halle – und vom Turm aus edlem Elfenbein. Eine Synthese aus Hofmannsthal und Majakowski war wohl sein Ideal. Im Grunde ist er ein weicher Poet, der sich sehr männlich geben möchte, ein Mann der stillen Töne, der sich zwingt, zu schreien. Einst, 1942, schrieb er:
Wenn nichts mehr blieb als Bitterkeit,
Kann die abschiedsmüde Hand
Jäh sich ballen zur Faust.
Die Bitterkeit und die abschiedsmüde Geste vermochte er bisweilen glaubhaft zu machen. Aber sein Schrei und die drohende Faust wirkten immer künstlich, theatralisch und krampfhaft. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, daß er ein Dandy ist, der mit dem Parteiausweis kokettiert. Ernsthaft bemüht, Künstler und Kommunist gleichzeitig zu sein, mußte auch er – wie Becher – „in neo-klassizistischer Glätte und konventioneller Verseschmiederei“ landen. Mit dem Band Der Flug der Taube war der Lyriker Stephan Hermlin in eine Sackgasse geraten.
Die Versuche auf dem Gebiet der Prosa, sieben Erzählungen zumal, runden das Bild dieses Schriftstellers ab, ohne ihm überraschend neue Züge hinzuzufügen. Er schreibt einen gepflegten und exquisiten Stil, dem man es anmerkt, daß der Autor Kleist und Büchner, Fontane, Thomas Mann und Kafka ebenso sorgfältig studiert hat wie Hemmingway, Sartre und Camus. Über die Ausdrucksmittel der modernen Prosa braucht man ihn nicht aufzuklären. Auch seinen Freud kennt er gut. Hermlins psychologisches Einfühlungsvermögen ist beachtlich. Kein Zweifel: die vielen Rückblenden und Halluzinationen, die unmerklichen Übergänge von der Realität zum Traum, die eingeflochtenen Reflexionen und die retardierenden Einschübe, die knappen Hinweise auf die Atmosphäre und die psychologischen Details – das alles zeugt von einem großen Können.
(…)
Nach dieser von allen Seiten abgelehnten Geschichte sieht Hermlin keine Möglichkeit mehr, sein künstlerisches Werk fortzusetzen. Er sammelt seine Dichtungen (1956) und seine Nachdichtungen (1957); wie Bredel, Uhse und Kuba schreibt auch er rasch die obligate China-Reportage („Ferne Nähe“, 1954). Er veröffentlicht, meist aus aktuellen Anlässen, eine Anzahl von Aufsätzen und Artikeln, die freilich gegen Ende der fünfziger Jahre nur noch sporadisch erscheinen (Begegnungen, 1960).
„In den Zeiten der äußersten Zuspitzung des gesellschaftlichen Kampfes“ – tröstet sich Hermlin in einer „Rede über Michiewicz“ – „hat die Dichtung keine andere Wahl als sich entweder, für das zum Absterben Verurteilte Partei nehmend, zu prostituieren oder, auf der Seite des Fortschritts, ihre eigentliche Domäne einzuschränken.“3 So überflüssig es scheint, gegen eine derartige, haarsträubend primitive Entweder-Oder-Formel zu polemisieren, so aufschlußreich ist doch das hier angedeutete persönliche Bekenntnis. Hermlin hatte sich entschlossen, den sich aus „der äußeren Zuspitzung des gesellschaftlichen Kampfes“ ergebenden politischen Erfordernissen gerecht zu werden und daher freiwillig die „eigentliche Domäne“ der Dichtung „einzuschränken“. Der Künstler war zu einem Kompromiß bereit, aber nicht zur bedingungslosen Kapitulation. Als sich herausstellte, daß die Partei gerade dies von ihm verlangte, sah er sich gezwungen, ins Schweigen zu fliehen.
Nur gelegentlich versucht er, den Bereich der Dichtung mit publizistischen Mitteln zu verteidigen. Er beruft sich dabei mit Vorliebe auf jene, die einst Kunst und Kommunismus, zumindest zeitweise, zu vereinigen wußten. Er erinnert an Majakowski, der sich der Forderung, die Poesie müsse für die Massen des Volkes verständlich sein widersetzte und der meinte:
Die Kunst ist nicht von ihrer Geburt an eine Kunst für die Massen… Je höher die Qualität des Buches ist, desto weiter ist es den Ereignissen voraus.4
Als sich Hermlin Ende 1962 öffentlich junger Lyriker der DDR annahm und dabei nicht nur politische Kriterien berücksichtigte, hielten es die Kulturfunktionäre für notwendig, gegen ihn einzuschreiten. Auf einer Beratung des Politbüros des Zentralkomitees und des Präsidiums des Ministerrates mit Schriftstellern und Künstlern im März 1963 erklärte er:
Vor etwa zwei Jahren wählte mich meine Sektion in der Deutschen Akademie der Künste zu ihrem Sekretär. Jetzt berief mich die Parteigruppe der Akademie und anschließend die Sektion von dieser Arbeit ab. Diese Entscheidung war richtig, und ich stimmte mit allen anderen für sie. Ich war nicht der richtige Mann am richtigen Platz… Ich versuchte uns, die Sektion, in besseren Kontakt mit jungen Schriftstellern zu bringen, aber ich beging gleichzeitig eine Reihe von Fehlern… Das hängt wohl damit zusammen, daß ich Dichtung und Kunst, die mein Leben fast ausfüllen, oft unabhängig von Zeit und Ort betrachte, da und wo sie sich äußern. Ich erkenne das als einen Fehler an; aber ich weiß auch, daß ich vor der Wiederholung dieses Fehlers nicht gefeit bin.5
Man muß wohl den Ritus der kommunistischen Selbstkritik kennen, um die Ungeheuerlichkeit dieser Erklärung ermessen zu können: Hermlin bezichtigt sich schwerer politischer Fehler, deren Ursache er in seiner prinzipiellen, mit der Kunsttheorie der Partei im Widerspruch stehenden Einstellung zur Dichtung sah. Aber er weigerte sich, diese Einstellung zu ändern, und warnte daher vor der Wiederholung seiner Fehler.
Mag auch die Selbstkritik mit dem üblichen Treuebekenntnis schließen – Hermlins Weigerung und Warnung entspringen einer tiefen Einsicht in das Wesen ebenso der Kunst wie der kommunistischen Kulturpolitik. Ob sich aus dieser Einsicht Folgen für sein weiteres künstlerisches Werk ergeben werden, bleibt abzuwarten. Die organisatorischen Konsequenzen ließen freilich nicht auf sich warten: Auf der Zentralen Delegiertenkonferenz des Schriftstellerverbandes der DDR Anfang Juni 1963 wurde Stephan Hermlin in den Vorstand dieser Organisation, dem er seit seiner Übersiedlung nach der DDR angehört hat, nicht mehr gewählt.
In einem seiner frühesten Gedichte, den „Toten Städten“, datiert 1940/41, heißt es:
Verlassen von Blumen und Tieren
Schlägt um uns das Meer
Des Schweigens. Und wir frieren
Und ängstigen uns sehr.
Marcel Reich-Ranicki, Neue Rundschau, Heft 3, 1963
Zeugenschaft
Ich weiß von erlebten Zeiten
Und was zu erleben ist…
(Stephan Hermlin: „Die Erinnerung“)
Es kann geschehen, daß das Buch eines Autors alles von ihm bis dahin Geschriebene übertrifft, weil es uns das eigentliche Anliegen seines immerwährenden Bestrebens wie in einem Vollzug offenbart. Ein solches Buch ist Stephan Hermlins Abendlicht: eine Prosa, die reales Geschehen traumhaft und visionär, Träume hingegen wirklich wie die Verheißung einer Musik in der Modulation eines Satzes aufklingen lassen kann. Das Buch entfernt sich weit von üblichen autobiographischen Betrachtungen und hat nichts gemein mit indiskreten, wichtigtuerischen Memoiren. In dem der Autor einzelne Szenen privater und öffentlicher Ereignisse erinnernd an- und aufruft, behält das Vergangene seine freudige oder beklemmende Unmittelbarkeit, sieht sich der gegenwärtige Augenzeuge selbst im gebrochenen Licht unablässiger Ängste und Hoffnungen. Die immer wiederkehrenden Motive seiner Dichtung werden heraufbeschworen und bis in die Kindheit verfolgt. Man kann sie jetzt – auf Grund solcher Erfahrungen – noch gewisser mit Worten wie Einsamkeit und Gemeinsamkeit, Herkunft und Weiterstreben umschreiben: Begriffe, die sich auf eine weiter zurückreichende Tradition berufen wie auf die Utopie von einer „wunderbaren Gesellschaft“. Hermlin hat sein Selbstverständnis als Dichter zur gleichen Zeit, da er an diesem Buch arbeitete und in heftige kulturpolitische Debatten verwickelt war, in einer Rede programmatisch konstatiert:
Ich bin ein spätbürgerlicher Schriftsteller – was könnte ich als Schriftsteller auch anders sein. Ich hörte nicht auf, einer zu sein, während ich Jahrzehnte hindurch Kommunist war und blieb… Wenn ich diese Herkunft verleugnen oder verdrängen würde, müßte ich mich selbst verlieren und könnte demnach für etwas Anderes, Neues gar nicht nachhaltig eintreten.
Man kann eine solche Standortbestimmung wohl von verschiedenen Seiten her in Frage stellen oder kritisieren – an entsprechender Polemik hat es nicht gefehlt –, aber sicher finden wir in ihr den Schlüssel zu Hermlins Biographie und Werk.
Er kommt aus einer gutsituierten, kunstsinnigen bürgerlichen Familie, erhält erste Bildung und Bildungserlebnisse durch Hauslehrer und in einem Internat in den Schweizer Alpen, besucht das Gymnasium in seiner sächsischen Geburtsstadt Chemnitz (dem heutigen Karl-Marx-Stadt), später in Berlin, und spürt schon als Kind sensibel, „daß es in der Welt Versäumtes, Mißlungenes, daß es Reue gab“, Disharmonien, die ihn schon früh seine Außenseiterposition wahrnehmen lassen. Wird ihm zunächst für seine politische und künstlerische Entscheidung bestimmend, daß alles an diesem Leben
falsch war, daß es mit seinen humanistischen Studien, seinen Reitstunden, seiner behaglichen Liberalität nicht stimmte, so, wie die ganze Republik nicht stimmte…,
so vergewisserte er sich später – die Einseitigkeit schützender Abwehr und absoluter Urteile korrigierend – gerade der musischen Atmosphäre in seinem Elternhaus, das ihm Bleibendes gibt: Musik und bildende Kunst, die Malerei der Moderne und das Verständnis und die Toleranz für ihre Leistungen auch „in untoleranten Zeiten“.
Hermlins Leidenschaft, Musik und Literatur zu rezipieren und auszuüben, wird seitdem unwiderruflich. Er berichtet, wie er spielt, boxt und schwimmt wie seine Mitschüler, doch auch, daß er das „wirkliche Leben aber nicht vom Leben, sondern aus Büchern“ kennen lernt und bereits mit dreizehn Jahren „in rasender Eile“ liest; „die antiken Dichter… Hölderlin, Novalis, Des Knaben Wunderhorn, Büchner, die Russen und Franzosen des 19. Jahrhunderts. Die Bücher schützen mich vor dem Leben.“ Er liest schon damals zum erstenmal das Kommunistische Manifest. Gewisse Vorfälle – wir entnehmen es den verschiedenen biographischen Mitteilungen seit den fünfziger Jahren – prägen sich grell ein und sind nach Jahrzehnten noch unvergängliche Bilder herrschender Antinomien, die ihn in zunehmendem Maße direkt angehen, etwa wenn er schon mit sieben Jahren bei der Nachricht von der Ermordung des Außenministers Rathenau, mit dem sein Vater bekannt war, in Angstzustände fällt; wenn er in der stillen Straße des „Kassbergs“ (Erzählung, geschrieben 1965) die Zeitungsmeldung von der Ermordung der Sacco und Vanzetti in den USA liest und auf dem Weg zur Schule an der Litfaßsäule das Plakat: „Adolf Hitler spricht“. Unten in der Ecke lautet ein Vermerk: „Juden haben keinen Zutritt“. Die böse Empfindung, daß Vertrautes bedrohlich, Fremdes nah und vertraut, daß Normales absurd sein kann, wird ihm nur allzufrüh bekannt. Aus den autobiographischen Prosastücken kann man ermitteln, daß Hermlin bereits als Schüler Gedichte und Erzählungen schrieb, daß erste Verse von ihm in einer verschollenen Anthologie und in Zeitschriften der sterbenden Weimarer Republik erschienen; auch daß der Dichter Gottfried Benn seine „poetischen Versuche ermutigt hatte“. Benn, der 1933 der nationalsozialistischen Erhebung zustimmte. Hermlin tritt 1931 in den Kommunistischen Jugendverband ein; in Abendlicht heißt es dazu:
Ich wußte damals nicht, was alles ich unterschrieb… Auch ich lernte Augenblicke kennen, in denen eine Stimme, die sich wie die Stimme der Vernunft anhörte, mir zuredete, könne denn diese Unterschrift noch gelten, in der ein später so oft enttäuschter guter Wille gelegen habe… Aber eine andere Stimme erhob sich hartnäckig gegen die erste: Der Kampf der Unterdrückten sei der Kampf der Unterdrückten, auch wenn neuerlich Hoffart und Dünkel, Verachtung und Beharren im Irrtum sichtbar würden, der Kampf führe zu neuen Bedrückungen, selbst zu Untaten, er dauere ewig, aber er trage auch das edle Siegel des Strebens nach Menschlichkeit, nach Freiheit und Gleichheit für alle.
Hermlin hat von Eindrücken berichtet, die ihm die frühe sowjetische Literatur machte, er nennt Gladkow und Fadejew, ein Gedicht beschwört den Überlebenswillen Nikolai Ostrowskis; das Beispiel Majakowskis, dem er sich später in Essays zuwendet, hat ihn immer bewegt. Der stürmische Aufbau in der Sowjetunion der dreißiger Jahre, von dem ihm Genossen als Augenzeugen vermelden, inspiriert noch künftige Verse, nennt die Städte, „die ich in meinen Träumen und später in einem Gedicht die weißen Städte nannte, weil ich sie weiß und vollkommen… sah“. Im Deutschland des Jahres 1933 marschieren von seinen Genossen bald etliche bei den Nazis mit, „unbezähmbar ist der Drang, bei den Stärkeren zu sein…“ Hermlin ist Mitglied einer Zelle der illegalen kommunistischen Partei bis 1936 in Berlin, Unterwerfung und Widerstand werden zu täglichen Ereignissen, dann muß er emigrieren.
Das Exil wird ihm zum zweiten Dasein, Gefährdung und Rettung, Flucht durch Länder und Lager, es führt ihn in das gegen den Faschismus kämpfende Spanien, bei Ausbruch des zweiten Weltkrieges als „Prestataire“ in die französische Armee, als Partisan in den Maquis, schließlich ins Asyl in der Schweiz, dort in die „Bewegung Freies Deutschland“, 1944 ist er einer der Redakteure der Flüchtlingszeitung Über die Grenzen. Von den lebensgefährdenden Bedrohungen für ihn und seine Familie erfährt man nur aus den Erinnerungen von Zeitgenossen; er selbst hat eines der Stücke in Abendlicht seinem Vater gewidmet, der im Konzentrationslager Sachsenhausen umkam, weil er Jude war:
Er war zuvor in immer tiefere Einsamkeit geraten in dem Land, das er nicht hatte aufgeben wollen.
Seit 1939 schreibt Hermlin Gedichte, um sich „zu behaupten in einer Umwelt, die mir und meinesgleichen das Lebensrecht versagte“. Einzelne Balladen erscheinen zuerst in französischer Übersetzung in Paul Eluards Eternelle Revue, einer Zeitschrift der Resistance, auch als Flugblätter in der Schweiz; eines seiner ersten Lyrikbücher trägt den Titel Wir verstummen nicht (1945). Die Erinnerung an die Gefährten wird – Verpflichtung gegenüber den Opfern und Kämpfern – zum Generalthema seines Schreibens überhaupt. In einem großen Essay aber spricht er nahezu enthusiastisch „Vom Geist deutscher Dichtung“ (1948), deren Tradition er sich mit seinen eigenen Bemühungen für immer verbunden fühlt; Geist, der sich für ihn in den späten Hymnen Hölderlins, in den „Lamentierungen“ der Gryphius und Fleming, in der hintergründigen Naivität eines Matthias Claudius und Clemens Brentano, in den Metaphern Trakls und Georg Heyms, schließlich in Rilkes apollinischem Torso – „Du mußt dein Leben ändern“ – zeigt. Blickt man heute auf die Arbeiten zurück, die Hermlin danach den hier Genannten zukommen läßt, wird deutlich, wie beharrlich er sein frühes Bekenntnis eingelöst hat; versteht man, daß er sich rechtens auf das Bild vom Baum deutscher Literatur beruft, der seit über einem Jahrtausend grünt, „seit jeher daran gewöhnt, über mehr als einem Staat zu rauschen“. Hermlin hat Gedichte Trakls und Georg Heyms herausgegeben, ein repräsentatives Deutsches Lesebuch – Von Luther bis Liebknecht (1976) und hat über den Dichter, den er immer wieder zitiert, das Hörspiel Scardanelli (1970) geschrieben. Das poetische Credo von damals aber hat auch für seine jüngste Prosa Geltung und könnte einer Würdigung des Buches Abendlicht vorangestellt werden:
jeder künstlerische Akt erscheint uns als der Versuch, eine niemals ganz ausgesagte Brüderlichkeit herzustellen, und was wäre Brüderlichkeit anderes als Harmonie? In Harmonie sein mit den wachsenden Dingen, die uns umgeben, mit unseresgleichen, mit uns selbst, ist der ungeheure Urtrieb, der jeder menschlichen Handlung menschlich in des Wortes reinster Bedeutung – zugrunde liegt.
Es sei die Unvollkommenheit deutscher Zustände, die der machtvollste Antrieb der Dichtung werde – „Unruhe und Schmerz“.
Hermlin, der bereits 1945 in das „Land der großen Schuld“ zurückkehrte und zunächst in Frankfurt am Main lebte – Radio-Essays aus dieser Zeit sind in dem Band Ansichten über einige neue Schriftsteller und Bücher (zusammen mit Hans Mayer, 1947) nachzulesen –, nahm 1947 seinen Wohnsitz in der künftigen Deutschen Demokratischen Republik, in Berlin, und er hat in einem Gespräch (mit Klaus Wagenbach) ausführlich erläutert, was ihm diese Republik, „die erste staatliche Verkörperung der deutschen Arbeiterbewegung“, bedeutet, daß für ihn als Schriftsteller jedoch „die deutsche Frage“ seine eigentliche Heimat sei: „Letzten Endes bin ich aber beheimatet in der deutschen Dichtung und der deutschen. Musik, in der bin ich zuhause.“
Stephan Hermlins Werk im Überblick: Gedichte, drei, vier Bände, die er selbst in einer vielleicht allzu strengen Auswahl Dichtungen (1956) gesichtet und deren Erstfassung er überarbeitet hat. Prosa, die er in dem Band Erzählungen (1970) zusammenfassen ließ. Sein Buch Abendlicht von 1979. Der Band Die erste Reihe (1951) enthält Porträts ermordeter deutscher Widerstandskämpfer, er wird zu ihrem angemessenen Memorial, geschrieben in einem Stil von überlegtem Lakonismus. Reiseberichte und Reportagen wären zu nennen. Dazu die gewichtige publizistische Arbeit, welche, läge sie uns als Ganzes vor, sicher das Gewicht hätte, deutsche Zeit- und Kulturgeschichte der letzten vierzig Jahre transparent zu machen. Ereignisse und Daten „in den Kämpfen dieser Zeit“, an denen Hermlin, streitbar Partei nehmend, seinen Anteil hatte; bisher sind uns diese Beiträge nur in unterschiedlichen Auswahlbänden präsent: Die Sache des Friedens (1953), Begegnungen (1960), Lektüre (1973), Aufsätze – Reportagen – Reden – Interviews (1981), Äußerungen 1944–1982 (1983). Dazu kommen Übersetzungen und Nachdichtungen (1957) vor allem der Poesie anderer Sprachen, von denen wir hier nur die Übertragung von Gedichte Paul Éluards, Pablo Nerudas und Attila Józsefs erwähnen wollen, weil sie auch für Hermlins eigene Lyrik wohl nicht ohne Einfluß blieben. Alle diese Arbeiten aber stehen in einem inneren Zusammenhang und offenem Kontext. Die literarische Betrachtung verdeutlicht immer auch den eigenen künstlerischen Standort; der Publizist wiederum verleugnet bis ins Argument seiner Beweise und Pamphlete nicht den Dichter. Freilich steckt Hermlin die Grenzen zwischen den Gattungen präzise ab. Prosa und Vers dulden nicht das feuilletonistische, kommentierende Attribut mißverstandener „Zeitdichtung“. Dokumentarisch belegte Zitate hingegen sind nicht selten Anstoß oder integrierender Bestandteil des Textes. Poesie aber nennt Hermlin „die genaueste, die ergiebigste Haltung der Realität gegenüber“.
Erlebnisintensität und Formbewußtsein zeigen schon die Zwölf Balladen von den großen Städten (1944), „mit einer Kühnheit der Bilder gestaltet, die für einen jungen Dichter erstaunlich waren“ (Peter Huchel, 1958). Gedichte in vier-, fünf- oder achtzeiligen Strophen, die noch die Maße klassischer Stanzen durchscheinen lassen – Stanzen, wie sie neben Gesängen und Sonetten in dem Band Die Straßen der Furcht (1946) stehen –, dynamisch in ihrer Bild- und Metaphernfolge, daß man überkommene Muster sogleich vergißt, inspirierende Verse:
Hier aus den rattenerfüllten Kellern, gräßlichen Stollen
Brüll ich euch sterbend zu: Errettet uns aus der Haft!
Rettet uns aus dem sanften spitzfingrigen Griffe der tollen
Folterer und vor des Wahnsinns süßem mohnfarbenen Saft,
Hier in den rattenerfüllten Kellern und gräßlichen Stollen!
…
Denn seht dort eure Schwestern: der Feind peitscht ihre Fassaden,
Doch die geöffneten Flanken spein Haß. So stehen sie nackt.
Aus einem Wald von Fahnen wehen der Abschüsse Schwaden,
Halten die fleischlosen Kiefer den Feind an der Kehle gepackt –
So sind euere Schwestern: und peitscht auch der Feind die Fassaden!
(„Ballade von unserer Zeit mit einem Aufruf an die Städte der Welt“)
Man muß schon weit vorgreifen – etwa zu den Schilderungen, wie sie Peter Weiss in seinem Roman Die Ästhetik des Widerstands mit der Deutung der Fresken des Pergamon-Altars gibt –, um für die Wucht solcher Bilder entsprechende Vergleiche zu finden. Hintergrund der elegisch oder pathetisch skandierten Gedichte – 1947 zu Zweiundzwanzig Balladen erweitert – ist das entfremdete Leben in den modernen Städten des Westens, erfahren in Berlin und Paris zwischen Frieden und Krieg, in Kontrast gesetzt zur heroisch geschauten Landschaft der „Städteverteidiger“ im Osten, Leningrad, Stalingrad, Sewastopol. Aber weniger äußere Tatsachen werden nacherlebt, vielmehr deren Wirkungen auf den betroffenen Sprecher, der sich ihnen verwundbar aussetzt, sie mit seiner ganzen Existenz zu ergreifen sucht und ihnen seine Sprache gibt, Sprache, deren Worte „eine proteushafte Vieldeutigkeit“ haben, „die sie von Begriff zu Begriff führt, vom Heutigen aufs Gewesene, vom Möglichen ins Phantastische“, so daß sich im Gedicht, manchmal, in einer Verszeile, verschiedene Erlebnisebenen und Zeitschichten überlagern. Schwierige menschliche Situationen wollen nicht als Beispiel oder Lehre, sondern in ihrer ganzen Widersprüchlichkeit erfahren und verstanden sein, im Augenblick des Geschehens, in der nicht wiederholbaren Bewegung, mit der sie uns trifft.
Kritiker haben von barocker „Hypertrophie“, von „Hermlins Hang zum Erlesenen und Preziösen“, von einer „Regression“ auf die apokalyptisch-mythischen Wortballungen des Expressionismus gesprochen, wenn sie diese Gedichte „von eigentümlicher Art“, „moderne, ungemein musikalische Texte“, einordnen wollten. Tatsächlich greift ja Hermlin auf die kräftige, Polarität wortreich akzentuierende Lyrik aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges zurück („Ballade von der Königen Bitterkeit“, „Ballade für die guten Leute“); er erinnert an einen Dichter wie Johann Klaj, um gegen die „fortschreitende Auslaugung“ zeitgenössischer lyrischer Diktion anzugehen. Er bezieht Luthers De-profundis-Psalm „Aus tiefer Not schrei ich zu dir“ nicht auf Gott, sondern auf sein Volk, entdeckt für moderne Haltungen einfache, alte Wendungen wieder („Ballade von einem Städtebewohner in tiefer Not“). Mit Georg Heym vernimmt er den „dunklen, gewalttätigen todesbesessenen Ton Rimbauds“, gibt der Untergangs- und Freiheitsapotheose aber auch die Perspektive sozialistischer Revolution, wie sie sich für ihn seit dem Großen Oktober 1917 historisch vollzieht; metaphorische Sprechweise, die ihm eine Utopie des Künftigen erlaubt („Ballade von den Städteverteidigungen“, „Manifest an die Bestürmer der Stadt Stalingrad“):
Da beschlossen wir endlich, alles zu ändern,
Unseren Traum und unsre Wirklichkeit.
Für die Dörfer und Städte in allen Ländern
Hielten wir die leere Ebene bereit.
…
An jeder Ecke erschossen wir Hunger und Sterben,
Wahnsinn, Pest und Verrat. Wir reichten der zögernden Hand
Waffen und Bücher. Und gegen das Große Verderben
Schmiedeten wir wie beflügelt den Großen Verband.
(„Die Ebene“)
Hatte Brecht in den balladesken Lektionen und Exerzitien seiner Taschenpostille expressionistische Metaphorik sozial versachlicht und parodistisch aufgehellt, so wandelt sich in Hermlins exemplarischen Städteballaden deutscher Exillyrik expressionistische Apokalyptik zur Prophetie von einer inständig herbeigesehnten Welt, die freilich stärker seinen Wunschvorstellungen entspricht als der Realität.
Aber indem er diese Welt als bereits wirklich mögliche setzt, konfrontiert er uns gleichzeitig mit den Spannungen, die ihn als Dichter mit der ihn umgebenden existierenden Gesellschaft, für die er sich engagiert, in ständige Konflikte bringt. Denn:
Vom Geist einer Dichtung sprechen heißt, beinah wehrlos sich auf den gefahrvollen Pfad begeben, der durch die Tiefen des Gefühls, das Unterholz von Ängsten, Halluzinationen und Träumen… auf wunderliche, verwirrende und oft kaum zu verfolgende Weise ins Gebiet des Bewußten und Nachprüfbaren, ins Historische, Politische, Gesetzmäßige – kurz, ins Konkrete – führt.
Vielleicht bezeugt das 1947 geschriebene Gedicht „Die Zeit der Wunder“ besonders eindrucksvoll und sinnfällig, was solche Lyrik zu leisten vermag. Hermlin ist damals wenig über dreißig Jahre alt, und er tritt in diesem Gedicht souverän mit persönlichen Erinnerungen auf, beschließt mit ihnen einen ganzen Lebensabschnitt.
Die Jugend ging. Die Zeit der Wunder, ist vorbei.
Es folgt eine Reihe schöner Verse, die von Frankreich sprechen, wie es im Krieg unterlag und wie sich sein Volk freikämpft; der Sprecher, er wiederholt den Satz „Ich weiß…“, war dabei. Man skandiert unwillkürlich Louis Aragons unvergeßliches „Der Flieder und die Rosen“ („Ich weiß die tückische Leere noch der Rückzugsstraßen“) und versteht, woran Hermlins locker gefügte Strophen „im Wechsel von Leichtdahingesagtem und Gewichtigem“ geübt sind.
Der Treue Farben brachen durchs Gewölk der Phrasen.
Eine Majakowski-Zeile wird erinnert:
Ich weiß noch, wie im Strom das Boot der Liebe sank.
Sie stammt aus Majakowskis Testament, bevor er sich erschoß. Und das Gedicht, das von Kämpfen, Tränen, Racheschwüren und Siegeshoffnungen spricht, schließt in der letzten Strophe nach der sechsten Zeile plötzlich mit der erbitterten Wendung:
Der Worte Wunden bluten heute nur nach innen.
Die Zeit der Wunder schwand. Die Jahre sind vertan.
Natürlich wäre es einfach, das Gedicht nur als Resultat enttäuschter Hoffnung nach zwei Nachkriegsjahren zu interpretieren. Aber es ist noch etwas ganz anderes im Spiele, das jeder erleben kann: der schockierende Moment, wenn man innehält und sein Leben rückblickend überschaut. Eine zweite Dimension des Gedichts macht es für spätere Zeiten und Generationen erregend wie Zum Zeitpunkt seiner Niederschrift.
Gedichte wie diese werden nicht alt, der einstige Anlaß mag verblassen, sie haben die innere Kraft, über die fliehende Zeit zu dauern – magisch, das Wort kommt bei Hermlin in diesem Sinne vor und gibt seiner dichterischen Skepsis recht. „Ich will eine neue Sprache“ heißt es in einer Ballade, die Hermlins Streben postuliert, künftig einfacher und „zeitgemäßer“ zu sprechen. Die Gedichte unter dem Titel Flug der Taube (1952) zeigen die Tendenz zu einprägsamen, suggestiven, spruchhaften Verkürzungen, Worte, die „Wegbereiter“ sein wollen, Sprache, „die euch tröstet“, nicht mehr herausfordernd „euch quält“. Aber bildliche Argumentation und Didaktik ist sowenig Sache dieses Dichters wie politische Apologetik und totale Glücksverheißung.
Wir gingen durch Zeiten, die zu kennzeichnen manche den Allerweltsaudruck ,kompliziert‘ gebrauchten. Eigenen Überzeugungen entsprechend unternahm ich manchen Versuch, mich zu ändern. Der Wunsch, nützlich zu sein, wurde eine Weile beherrschend…
Hermlin hat in einer Passage von Abendlicht, die wohl kaum einen Leser ungerührt lassen wird, die innere Bewegung beschrieben, aus der heraus er begann, Verse zu schreiben, auch von seinem Anspruch an Poesie und von seinem eigenen Vermögen. Wir wollen diese Gedanken weder kommentieren noch billig zu Rate ziehen, sondern nur respektieren, was dort über Zwänge und Zusammenhänge gesagt oder angedeutet wird, in die er sich mit seiner Dichtung zunehmend gestellt sah. Von seinen Versen nach 1950 beeindrucken Strophen aus dem Zyklus „Aurora“ durch die kommunikative Kraft der Sprache, deren Sätze einfallen wie die Sätze einer Sinfonie, und doch hält sich ihr Sprecher streng an historische Vorgänge der Oktoberrevolution. Eine Dichtung „Die Jugend“, 1951 aus Anlaß des Weltjugendfestivals in Berlin geschrieben, schlägt noch persönliche Dissonanzen mit an, versucht aber, sie in forcierten Behauptungen zu überflügeln („Doch die Zeit des Glücks ist da“), Apostrophierungen, wie sie damals in sozialistischer Lyrik nicht selten waren und wie wir sie auch bei Hermlin finden (Gedichte „Flug der Taube“, „Stalin“). Das „Mansfelder Oratorium“, ein Chorwerk für große Öffentlichkeit, das „diese bedeutenden Menschen bei Namen“ nennt, die ihre früheren kapitalistischen Betriebe in Volkseigentum genommen haben, kann mit liedhaften, erzählenden Strophen bestehen, die tradiertes Liedgut in Choral und Solostimme gegen berichtendes Rezitativ absetzen. Die 1957 geschriebenen Sonette, die, aktuelle Meldungen zitierend, auf die atomare Bedrohung hinweisen, die bereits die Natur dieser Erde verändert, haben mit ihrer verhaltenen Diktion als Warngedichte nichts von ihrer Aktualität eingebüßt:
Laßt diese Änderung euer Herz erschüttern…
(„Die Vögel und der Test“)
Eine Reihe von Gedichten, zwischen 1943 und 1953 entstanden, hat Hermlin zu dem Zyklus „Die Erinnerung“ vereint, Totenklage und Gedenken für die vom Faschismus Ermordeten in Mont-Valerien und Plötzensee, in Auschwitz und irgendwo:
Die Uhren schlagen ihre Namen fort…
Das erste Gedicht verwendet die Terzine, die Dante-Strophe, von der Goethe sagte, „daß sie gar keine Ruhe hat und wegen der fortschreitenden Reime nirgends schließen kann“.
Die Worte warten. Keiner spricht sie aus…
Die Ruhe der Toten aber ist die Unruhe der Lebenden. Die folgende Triolette, eine alte französische Strophe, in welcher Verse und Reime, sich kreuzend, ständig wiederkehren gleich einer fortlaufenden Kette, macht das Eingangsmotiv unwiderleglich:
Mondverschwistert will ich für sie wachen.
Singende, von Schüssen überschrien…
Das Wort Erinnern ist, in die Sprache der Lyrik übertragen, ein Thema nicht mehr nur vom „Stoff“ her, sondern ganz im Sinne der als Fuge komponierten Dichtung. Der volksliedhafte Refrain „Werden beisammen wir sein…“ im 3. Satz dieser Fuge kann die schmerzvolle Gewißheit „Sie sehen einander nicht wieder“ nicht mildern; der Sprecher, sich der Liebenden entsinnend und anvertrauend, bewahrt ihr Vermächtnis:
Ich kenne all eure Namen…
Bleibt mir nahe: du und du…
Die strenge Einführung des Erinnerungsthemas aber wird in den folgenden Sätzen der Fuge nicht durchgehalten, sie öffnen sich zu vier- und achtzeiligen Strophen wechselnder Verslänge und Taktfüllung. Erst das abschließende Stück „Die Asche von Birkenau“ setzt die Themen Erinnerung und Vergessen noch einmal kontrapunktisch gegeneinander, hebt sie in Besinnung und Anruf am Schluß auf:
Doch die sich entsinnen,
Sind da, sind viele, werden mehr.
Kein Mörder wird entrinnen,
Kein Nebel fällt um ihn her.
Wo er den Menschen angreift,
Da wird er gestellt.
Saat von eisernen Sonnen,
Fliegt die Asche über die Welt.
Allen, Alten und Jungen,
Wird die Asche zum Wurf gereicht,
Schwer wie Erinnerungen
Und wie Vergessen leicht.
Neben Paul Celans „Todesfuge“ und den klagenden Stimmen in den Gedichten der Nelly Sachs hat die Bestürzung über den Tod von Millionen nirgends im deutschsprachigen zeitgenössischen Gedicht so ihre Sprache gefunden wie in Hermlins „Erinnerung“, nicht mit der Geste endgültiger Verzweiflung, sondern aus der tiefen Unruhe um die menschliche Existenz in dieser und künftiger Zeit. Ein Offenhalten des maßvollen Verses durch tragische, paradoxe Gleichnisse und Imaginationen rauht die Harmonie übernommener Versfügungen auf, daß sie seltsam gegenwärtig wirken. „Er glaubt, man brauche in einer von Tränen und Blut überfluteten Zeit, in einer Zeit entfesselter elementarer Kräfte, graniterne Dämme und schwierigste klassische Formen“, sagte Ilja Ehrenburg von Hermlins Gedichten. „Ich fühlte mich heimatlos und geborgen zugleich, vielleicht wie ein auf den Wogen treibender Gegenstand, besäße er Bewußtsein, fühlen würde. Hier könnte die geographische Mitte meines Lebens sein, sagte ich mir…“ Solche Sätze finden sich zu Anfang der Erzählung „Die Zeit der Gemeinsamkeit“ (1950), mit denen sich ihr Berichterstatter im zerstörten Warschauer Ghetto sieht als einem existierenden und zugleich gespenstisch unwirklichen Ort, an den er, und nur er, gerufen ist, um Zeuge zu sein. Unmerklich macht Hermlin den Ort seiner Erzählung zur Grundsituation eigener Widerfahrung.
„Ich war nie wacher und nüchterner gewesen, nie abgeneigter, mich Halluzinationen hinzugeben, nachdem ich schon mit Widerstreben die Unterbrechung meiner Träumerei hingenommen hatte…“, läßt er den sich so direkt an den Leser wendenden Sprecher sagen, der uns den Brief eines Unbekannten überliefert, der die letzten Tage des Warschauer Ghettos in tagebuchartigen Notizen festhält, „weil er ihn für mich, allein für mich bestimmt hatte, und weil mir seine Züge so nahe, so ähnlich sein mußten wie das Gesicht, das ich jeden Morgen im Spiegel erblicke“. Es ist oft gesagt worden, daß Furchtbarkeit und Entsetzen, „die einmalige Todesmaschinerie der Deutschen, die den Opfern selbst unglaubhaft“ (Rolf Hochhuth) erschien, sich der Kunst verweigern, sie scheinen nicht überbietbar. Literatur konnte ihre grauenhafte Unmenschlichkeit nur darstellen, wenn sie ihr durch Zeugenschaft entsprach. Nur der Zeuge kann solches der Nachwelt weitergeben, als Flaschenpost, als Postskriptum, und nur er kann sie uns entschlüsseln, weil er es selbst als Betroffener in mehrfachem Sinne erfahren hat (wie der Autor der Reportage „Das Ghetto“). Hermlin hat im Kontext mit Heinrich Heine davon gesprochen, wie die Leiden der Zeit, die Befürchtungen, Wünsche, Auseinandersetzungen, „innere Geschichte“ werden, „was das erste und letzte beim Dichter ist“. So wird der Report des Chronisten unversehens und doch sicher zur Schilderung eines verbürgten Infernos, Schilderung, die der Autor durch die Brechung der Berichtsebenen legitimiert. (Später fand man tatsächlich Aufzeichnungen dieser Art über den Ghettoaufstand von 1943, die im Warschauer Ringelblum-Archiv erhalten sind.)
„Meine Pflicht, mein Vorsatz war gewesen, zu berichten, Dir ein Zeichen zu geben“, heißt es bei dem anonymen Tagebuchschreiber, der „erklären, klarmachen“ will – und doch, befallen von Zweifeln „an der Beschreibbarkeit der Desintegration“, öfter stockt und die Mitarbeit des unbekannten Adressaten – also des Lesers – voraussetzt, „eine Kontinuität herauszulesen, um die ich mich beim Schreiben vergeblich bemühte“. Schon hier deutet sich die Methode an, daß auch Nichtgesagtes gehört werden will; Hermlin nimmt den Vorgang des Schreibens mit in seine Prosa hinein, nicht als essayistisches Meditieren, vielmehr um „In einer dunklen Welt“ (1966) Orientierungspunkte zu finden, die das einzelne menschliche Schicksal in einer schwer durchschaubaren Wirklichkeit fixieren. Die Frage „Was wäre geschehen, was alles wäre vermieden worden, wenn man das da hätte aufhalten können?“ wird zum Grundgestus des Erzählens.
So wird der Maler Reichmann der Erzählung „Reise eines Malers in Paris“ (1947) in antizipierenden Visionen aus einem heiteren Vorkriegstag des Jahres 1938 jäh in ihm sonst unerreichbare Gegenden versetzt, die ihn das Gesicht der Zeit schauen lassen, das ihm vor der Staffelei nicht sichtbar war: Er befindet sich in einem Konzentrationslager, dann in einem Zentrum der chinesischen Revolution in Yenan. Er erwacht, und „er wußte seine Wohnung nahe, sein Atelier, seine Arbeit… Von Gewalten überkommen, er wußte nicht wie, hatte er eine lange Reise beendet, die ihm aufgetragen gewesen war.“
Nicht nur in dieser Erzählung verflechten sich divergierende Schauplätze und Zeitabläufe zu einem dichten Gewebe ohne falschen Faden. Die Novelle „Der Leutnant Yorck von Wartenburg“ (1946) drängt in die Todesminute ihres Helden die Erwartungen eines möglichen sinnvollen Lebens zusammen, um ein bisher verfehltes damit einzulösen. Wieder ist ein dokumentarisch belegter Vorgang Ausgangspunkt für den Erzähler, der auf die tatsächlich erfolgte Hinrichtung eines der Offiziere vom 20. Juli 1944 durch die Hitlerjustiz sein Korrektivbild projiziert: Aus dem Aufstand der Generäle wird der folgenreiche Umsturz zur Rettung des deutschen Volkes vor dem endgültigen Zusammenbruch des Naziregimes durch Kräfte progressiver antifaschistischer Befreiungsbewegung. Aber diese „Wendung“ bleibt eine Todesvision; ein Hölderlinzitat intoniert die düstere Szenerie:
Und es ergreift ihr Schicksal
den, der es leidet und zusieht,
und ergreift den Völkern das Herz…
Die Novelle ist der Erzählung des Amerikaners Ambrose Bierce „An Occurence at Owl Creek Bridge“ nachgestaltet, deren Eindruck für Hermlin „so imperativ war, daß ich ihn nur durch den Versuch bewältigen konnte, selber… etwas nach dem unnachahmlichen Modell… zu versuchen“.
Die Erzählung „Die Kommandeuse“ (1954) kehrt dieses Verfahren sozusagen um: Die Freisetzung der ehemaligen SS-Kommandeuse aus einem Gefängnis in der DDR erfolgt durch Leute, welche, die berechtigte Unzufriedenheit der Arbeiter ausnutzend, deren Streik zu einem konterrevolutionären Putsch mißbrauchen wollen. Anlaß zu dieser Episode sind Vorfälle vom 17. Juni 1953 in Halle. In der Psychologie einer Person werden scheindemokratische Phrasen von „Freiheitskampf“ und „nationaler Erhebung“ entlarvt, der novellistische Zugriff erlaubt eine polemische Zuspitzung, wie man sie aus damaligen Stellungnahmen Hermlins zu politischen Tagesereignissen kennt, Widersprechende Meinungen dazu ließen nicht auf sich warten, sie forderten zu einer Diskussion über realistisches Erzählen heraus.
Daß Hermlin immer mehr davon absieht, Selbsterfahrung durch fiktive Handlung, historische Personen in fiktiven Gestalten agieren zu lassen, zeigen die folgenden Prosaarbeiten.
Glich die linear, chronologisch ablaufende Geschichte „Die Zeit der Einsamkeit“ von 1950 mehr einem nüchternen Protokoll über die Tage aus dem Leben eines deutschen Emigranten in Frankreich, dessen Frau, von einem Beamten erpreßt, ihrem Mann entfremdet, sinnlos stirbt, worauf dieser Mann den Erpresser tötet und flieht, um wieder den Kontakt zu den Genossen zu suchen und die tödliche Einsamkeit zu durchbrechen – so erhält die Objektivität und Fiktion dieser Geschichte jetzt eine bodenlos-bestürzende Authentizität. In einem Kapitel von Abendlicht – der Autor hat es wohlerwogen in die Mitte des Buches gerückt wird der Name des Mannes wieder genannt. In diesem Kapitel, das eigentlich nur aus einem einzigen Satz besteht, der mit dem Wort „Damals“ einsetzt und dessen Glieder alle mit „als ich…“ beginnen und in rasender Folge nie zu enden scheinen, heißt es am Schluß: „als ich Neubert hieß als“.
Schien,die epische Distanz einst die einzige Möglichkeit, naheliegende Teilnahme oder Betroffenheit überhaupt äußern zu können, so erreicht Hermlin jetzt, indem er ganz nah an Persönlichem bleibt und zu dieser Person diskret Distanz behält, den Stil, der nur ihm zugehört, seine unverwechselbare Prosa.
Manches, was in Abendlicht seine erzählerische Konsequenz gefunden hat, deutet sich schon zuvor in Stücken des Bandes Begegnungen und in kurzen Prosaetüden („Kassberg“, „In einer dunklen Welt“, „Corneliusbrücke“) an. Einstige Genossen und Freunde, oft nur durch die Anfangsbuchstaben ihres Namens oder ihrer Vornamen bezeichnet, die wir in der 1960 veröffentlichten Skizze „Die Straße“ trafen, begegnen uns wieder, Kämpfer aus der „ersten Reihe“, Standhafte, Überläufer, Sichanpassende aus den zwölf Jahren der Nazizeit, die ihre Schatten bis weit in unsere Tage hinein wirft. Hermlins vorsichtig abwägende Perspektive läßt ihnen allen Gerechtigkeit zukommen und gibt zugleich Raum für weitergreifende Schlußfolgerungen. Wie er jenen Unbekannten nicht vergessen kann, der ihn damals nicht verriet – „Ich sehe diesen Blick… und darunter den Mund, der schweigt, immer nur den Blick dieser Augen, der Augen meines Volkes“ –, schreibt er jetzt, auch für unsere Tage gültig:
Wenn jene, von denen die Rede war, ihre Mission verrieten – es kann nicht vergessen werden, daß sie, die Zahlreichsten, auch die Schwächsten waren, die am meisten Unterdrückten, die am meisten Abhängigen. Sie, die nicht mit Leben beschäftigt waren, sondern mit der Reproduktion ihrer Arbeitskraft, sündigten an sich selber, als sie nicht bereit, als sie unfähig waren, sich zu einigen. Sie bezahlten ihre Rechthaberei, ihren Trotz, ihre Überhebung mit Zehntausenden von Erschlagenen und Gefolterten, dazu mit der Erniedrigung, sich selber nicht mehr Proletarier nennen zu dürfen.
Wie weit der Verfasser solcher Sätze von Selbstgerechtigkeit und Besserwisserei entfernt ist, zeigt besonders die Stelle des Buches, an der Hermlin von seiner Kenntnis marxistischer Schriften spricht, und wie ihm beim Wiederlesen des Kommunistischen Manifests aufgeht, daß er einen Kernsatz – einem allgemeinen Verständnis und Anwendungsprinzip über Jahrzehnte hin folgend – falsch gelesen hat:
An die Stelle der alten bürgerlichen Gesellschaft mit ihren Klassen und Klassengegensätzen tritt eine Assoziation, worin die freie Entwicklung aller die Bedingung für die freie Entwicklung eines jeden ist. Ich weiß nicht, wann ich begonnen hatte, den Satz so zu lesen, wie er hier steht. Ich las ihn so, er lautete für mich so, weil er meinem damaligen Weltverständnis auf diese Weise entsprach. Wie groß war mein Erstaunen, ja mein Entsetzen, als ich nach vielen Jahren fand, daß der Satz in Wirklichkeit gerade das Gegenteil besagt: … worin die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist.
Man kann solches Entsetzen und Erstaunen über eine verkehrt verstandene Maxime – die ja zugleich einer ausgeübten Ideologie das Urteil sprechen – in vielen Episoden des Buches spüren, das ansonsten gar nicht vorgibt, in die Literatur einer radikalen Abrechnung eingereiht zu werden, die einer historischen Epoche die Leviten liest. Reinhard Lettau hat von der „Ästhetik des versteckten Zeigens, der verschweigenden Sprache, der Stille“ und von ihrer subversiven Kraft in einer Zeit hemmungsloser Selbstentblößung und einseitiger Schuldzumessung gesprochen. Hermlin selbst spricht sich nicht frei von den Verfehlungen der sozialistischen Bewegung, der er sich zugehörig weiß:
… ich teilte ihre Reife und Unreife, ihre Größe und ihr Elend.
Das Bezwingende dieser Prosa ist ganz anderer Natur. Sie drückt – um es mit Hermlins Wendungen zu sagen die Art von Verstörung aus, die er als Zeitgenosse davongetragen hat, und gleichzeitig ein Erhaltendes, Bewahrendes, das ihm ermöglicht, weiter zu existieren. Wir finden es in einer Musik Bachs, in Liedern Schuberts, die diese Prosa leitmotivisch durchziehen, in den Tag-Träumen des Kindes von einst, in der Vision vom Einswerden mit der unwirklichen Bergwelt und der Stille nach allem Getöse am Schluß. Es ist romantische Prosa in einem neuen Sinne, der sich ständig auf die unerbittliche Realität bezieht; von der „hintergründigen Naivität“ deutscher Romantik, von der Hermlin einst sprach, und man denkt sofort an Novalis, ist etwas mit im Spiele. Stille – und Schrei. Wir wollen nicht die Stücke hier nennen, die Hermlin über den Vater, einen Bruder dieses Vaters und seinen Bruder – „mein hochgemuter, mein einziger Freund“ – schreibt, nicht alles ist geeignet, es literarisch zu würdigen oder kritisch zu kommentieren. Was man dazu sagen müßte, ist mehr ein Gefühl als eine Meinung; man müßte über die Trauer sprechen, die hinter den Sätzen steht. Hermlin hat sie in einem Text „Mein Friede“, den er als Rede auf dem Kongreß des internationalen PEN 1975 in Wien hielt, mit den Worten umschrieben:
… meine toten Freunde sind so lange schon fort, sie treiben immer weiter ins Endlose, ich bin da und habe jüngere Menschen um mich, ich spüre ihre Nähe und einen Augenblick lang den schon gewohnten, den kaum wahrnehmbaren Schmerz.
Der Dichter der „Städteballaden“ wurde von der antifaschistischen Jugend nach dem zweiten Weltkrieg als ihr poetischer Repräsentant empfunden. Er gehört heute zu den wenigen überlebenden Antifaschisten, die als Sprecher dieser Generation anerkannt sind, nicht zuletzt legitimiert durch ein Buch wie Abendlicht. Hat Stephan Hermlin für den Dichter das Vorrecht beansprucht, „vernunftslos zu träumen“, ist er zugleich mit dem ganzen Einsatz seiner Persönlichkeit eines der Mitglieder der führenden Gremien der Weltfriedensbewegung gewesen, hat er als Initiator die Berliner Begegnung zur Friedensförderung im Dezember 1981 ins Leben gerufen, die – wie kaum zuvor nach dem zweiten Weltkrieg – wieder Schriftsteller aus beiden deutschen Staaten zu einem Meinungsaustausch darüber zusammenführte, „wie man Menschenleben und die Kultur der europäischen Völker vor der Vernichtung bewahren kann“. Hermlin hat sich mit diesem Treffen, wie er im Schlußwort der Tagung sagte, „einen Traum erfüllt“. Er hat sich als Schriftsteller der Herausforderung gestellt, vor der wir uns heute alle sehen; sein Werk hat auch für die Zukunft dabei das entscheidende Gewicht.
Gerhard Wolf, neue deutsche literatur, Heft 4, 1985
Nicht beendetes Gespräch
– Zum 60. Geburtstag Stephan Hermlins 1975. –
Werden unserer Literatur die Briefwechsel fehlen – „bei diesen postalischen Verhältnissen“ –, werden die Tagebuchzeugnisse wegfallen? Da die öffentlichen Aussprachen meist durch Schattengefechte ersetzt sind – man kennt, was die Redner X in Sachen Y vorzubringen haben und weiß, was sie heimlich trinken – scheinen auch die Gespräche zwischen Personen seltener zu werden.
Jedesmal aber, zumindest oft, wenn wir ihn verlassen – zu manchen Zeiten, nicht den ruhigsten, häufiger, zu anderen seltener, und auch darüber gaben wir uns wenig Rechenschaft – immer redeten wir weiter. Übereinstimmend oder streitend, besänftigt oder erregt: so daß wir die Rollen im Gespräch oft tauschen, indem einmal sie, das andere Mal er, zustimmt oder Einwände macht.
Gerhard Wolf: Warum geht man immer wieder zu ihm?
Christa Wolf: Ein Ort, um Urteile zu hören, an denen man die eigene Meinung überprüfen kann.
Gerhard Wolf: Wie kommt das, ist er besonders klug, mutig, gebildet?
Christa Wolf: Natürlich, aber –
Gerhard Wolf: Aber er hat noch einen Vorteil, der immer seltener wird: Politisches und Künstlerisches treffen bei ihm nicht nur zusammen, sie sind beide, mit der gleichen Leidenschaft durchlebt, in seiner Person verschmolzen. Die authentische Erfahrung ist es, die man akzeptiert, manche sagen, er nimmt ja alles persönlich.
Christa Wolf: Wegen des apodiktischen Tons, der manchmal angeschlagen wird, der subjektiven Empörung…
Gerhard Wolf: Du meinst, man ahnt vorher, was er sagen wird?
Christa Wolf: Schließlich kennen wir uns inzwischen ein wenig. Ihm wird das mit uns ähnlich gehen.
Gerhard Wolf: Ich werde noch immer überrascht durch prononcierte Urteile, Abneigung, ja Widerwillen, die er autoritativ äußern kann. Wir tauschen dann unseren Blick: er ereifert sich. Nennt einen Vorgang, einen Mißstand, den wir schon ,normal‘ finden wollten, auf einmal wieder ,ungeheuerlich‘ – und oft ist er es. (Übrigens: ,ungeheuerlich‘ ist eines seiner Lieblingsadverbien, vor allem, um Perfides abzuqualifizieren.)
Christa Wolf: Aber er kann auch loben, ausschweifend, maßlos, neidlos. Ein Mensch, in manchem sein Widerpart, kann als ,sehr guter Schriftsteller‘ von ihm respektiert werden…
Gerhard Wolf: Selbst, wenn er auf einer dieser Sitzungen aus vorhersehbarem Anlaß mit ihm aneinandergerät, schneidend: Herr… Man wartet darauf. Ich möchte ihn nicht zum Feind haben.
Christa Wolf: Wenn ich unter seinen Wörtern eins nennen müßte, ich glaube, ich würde ,nobel‘ nehmen. Wer gebraucht sonst noch solche Wörter?
Und wenn ich ausdrücken müßte, was ihn von Grund auf treibt oder lähmt, jenen Grund-Widerspruch, an dem man wächst, leidet, sich bewähren muß – ich glaube, es ist eine ungeheure, unstillbare Sehnsucht nach Vollkommenheit.
Gerhard Wolf: Die er wohl nur in der Kunst für möglich hält (übrigens: er schreibt das Adjektiv oft ,ungeheuer‘ und weiß um seinen Doppelsinn), in der Kunst…
Christa Wolf: Die ja, ungeheueres Zusammentreffen, auch sein Metier ist.
Gerhard Wolf: Du spielst auf seine Verletzlichkeit an. Die fällt einem ja auf, wenn man in Disput kommt. Er hört in Meinungen, unschuldigen Äußerungen oft Untertöne heraus, die man selbst nicht wahrgenommen hat. Man will ja nicht verletzen, schon gar nicht ihn, und ist dann bestürzt über empfindliche Reaktionen.
Christa Wolf: Mir scheint, diese Art von Verletzbarkeit entsteht, wo ein absoluter Anspruch – der nach Vollkommenheit – sich an der Einsicht reibt, daß dieser Anspruch nicht zu erfüllen ist. – Erzählte ich nicht von jenem Abend in Stockholm? Von dem psychologischen Sprachspiel, das eine Holländerin mit uns machte? Es waren spontan drei Wörter zu nennen. Er nannte ,Schatten‘ und ,Abendlicht‘. Die zweite Spielstufe erforderte einen rhythmischen Zusammenschluß dieser Wörter – er machte sogar einen Reim, „à la Conrad Ferdinand Meyer“, sagte er. Als nun die Wörter durch Vokalverschiebungen verwandelt werden sollten, verweigerte er strikt die Mitwirkung: diese Binnenreime habe er niemals für gut gehalten.
Ich provozierte ihn durch den Vorwurf, er wolle nur nicht unter sein Niveau gehen. Aber er sei doch schon ganz schön unter sein Niveau gegangen, antwortete er. ,Zweitrangig‘ ist eines seiner ätzenden Worte.
Gerhard Wolf: Seine Großzügigkeit gegenüber Leistungen von Zeitgenossen überträgt er kaum auf sich. Er ist in dieser Hinsicht – es mag manchem unwahrscheinlich klingen – bescheiden, wenn es um die eigene Leistung geht; was er von sich gelten läßt…
Christa Wolf: Weiß aber wiederum, was es gilt.
Gerhard Wolf: Läßt sich aber zu einer Rigorosität hinreißen, die schon das Maß übersteigt, das man anerkennen könnte (von dem man manch anderem wenigstens eine Ahnung wünschte). Das schließt – seltsames, aber nicht unverständliches Paradoxon – nicht aus, daß es ihn maßlos erbost, sich und seine Arbeit mißachtet zu sehen – was ihm nicht selten geschehen ist. Sein Zorn darüber steht auf einem anderen Blatt.
Christa Wolf: Er kann, schreibend, nicht leichtsinnig sein. Ich fühle ihm die Hemmung nach, die entstehen muß, wenn der Zwang im ästhetischen Sinn gültig zu sein, dem Zwang begegnet, vollkommen wahrhaftig zu sein. Die Produktion, die ja oft genug ein gewagter Prozeß der Annäherung an das Ideal ist, kann einem unmöglich werden.
Gerhard Wolf: Das absolute Diktat Brechts: Du sollst produzieren! hat er für sich so wenig akzeptiert wie vieles andere an der Haltung dieses Antipoden.
Er sucht keine Schüler und hat nichts von einem weisen Lehrer (wenn manche auch von ihm lernen). Von den Jüngeren wird er, soweit ich sehe, bewundert oder mißkannt; bewundert wegen der kühnen Attitüde des Dichters, die sonst hier nicht vorkommt. Er sagte einmal: Ich bin eigentlich ein Pathetiker und deutete damit an: Nun stellt euch einen solchen heutzutage vor!
Christa Wolf: Was mir nachgeht, als er einmal sagte: Wenn von allen meinen Gedichten nichts übrigbleiben sollte, eine Zeile habe ich geschrieben, die vollkommen wahr ist:
Was ich ganz scheine, dessen bin ich bar.
Die Ahnung dieser Wahrheit geht durch seine Gedichte, durch die Prosastücke, die mich am meisten bewegen. Wir zitieren ihn ja oft…
Gerhard Wolf: Und sagen ihm auch davon nichts. Denken wir, das sei nicht angängig?
Christa Wolf: Es ist auch Scheu dabei von unserer Seite, die man überwinden muß.
Gerhard Wolf: Ich lasse sein oft berätseltes, ja mißbilligtes ,Schweigen‘ (das man höchstens dem Lyriker vorwerfen könnte) ohnehin nicht gelten. Er hat, wie ich es sehe, wie kaum ein anderer seiner Generation und Art sich unserer Vergangenheit gestellt. Auf schmerzhafte Weise. Es ist ihm nicht gegeben, sich blind oder taub zu stellen, oder gar nicht betroffen. Wo es für ihn nichts mehr zu sagen gibt, ist er sprachlos. Aufzubessern, umzudeuteln, umzukehren, zu verdrängen, ist er nicht der Mann.
Christa Wolf: „Nie reimt sich Liebe auf Beflissenheit“ – eine Zeile, die mich seit Jahren begleitet hat.
Gerhard Wolf: Die Zeit der Wunder ist vorbei.
Christa Wolf: Und in der Dämmrung sind die Katzen wieder grau.
Gerhard Wolf: Der Treue Farben brachen durchs Gewölk der Phrasen
Christa Wolf: Ich weiß noch, wie im Strom das Boot der Liebe sank
Gerhard Wolf: Die Worte warten. Keiner spricht sie aus
Christa Wolf: Aus ihrem Säumnis ist mein Traum gemacht
Gerhard Wolf: Wenn falsche Worte sprach mein Mund
Christa Wolf: Mein Herz blieb wahr und wahr mein Mühn
Gerhard Wolf: Das traf unser Gefühl, das wir ja aus Selbstverleugnung so gern mit dem Präfix Leben verbunden haben. Lebensgefühl…
Christa Wolf: Es hat dazu beigetragen, es zu bilden. Diesen schrecklich schweren Bogen vom Glauben zur Nüchternheit, ein Gang, auf dem alles möglich ist, Trauer, Zweifel, Melancholie (Verzweiflung will er nicht nennen), nie aber: Zynismus, Gleichgültigkeit, Versteinerung, Resignation.
Gerhard Wolf: Und du fragst, warum wir zu ihm gehen?
Christa Wolf: Warum?
Gerhard Wolf: Das ist vielleicht noch ungesagt.
Christa Wolf: Ungern stelle ich mir vor, diese Begegnung hätte nicht stattgefunden, wäre nicht immer neu weiterhin möglich…
aus Stephan Hermlin: In den Kämpfen dieser Zeit, Wagenbach Verlag, 1995
ZU HERMLIN, DIE EINEN UND DIE ANDEREN
Er hat sie genannt. Und kein Wind
Wird diesen Steckbrief aus der Brust reißen.
Wir wissen nun, wie die und jene heißen.
Und wer die einen und die andern sind.
Und sind gewarnt. Denn in den andern Zeiten
Wenn so viel anders wird, bleibt eines gleich
Wir werden vergehn vor unserm Fleisch
Wenn wir uns nicht bei jedem Schlag entscheiden
Wenn wir uns immer nicht zu andern machen
Und wieder andern, die das andre wollen
Als was die einen sehn, die andre waren
Zu ihrer Zeit, die aber ist im Rollen.
Und wieder hören wir die Türen krachen.
Und durch die Wände brechen andre Scharen
Volker Braun
Hanjo Kesting: Der Worte Wunden bluten heute nur nach innen. Der Lyriker Stephan Hermlin, Merkur, Heft 401, November 1981
Hans Magnus Enzensberger: Überlebenskünstler Stephan Hermlin
Gespräch & Interview: Stephan Hermlin und ein unbekannter Gesprächspartner. Sammlung „Verlag Klaus Wagenbach“: Tonkassetten 31 und 32 und Tonband 13.
Gespräch Alexander Reich mit Andrée Leusink über ihren Vater Stephan Hermlin:
Teil 1: „Ein beliebtes Wort war: Lies!“
Teil 2: „Auf einmal war er wie Stein“
Teil 3: „Klein beigeben wäre Verrat gewesen“
Fakten und Vermutungen zum Autor + Archiv + KLG + IMDb +
Internet Archive + Kalliope
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Brigitte Friedrich Autorenfotos +
deutsche FOTOTHEK
Zum 75. Geburtstag von Stephan Hermlin: Sinn und Form 1 + 2 + 3
Nachrufe auf Stephan Hermlin: Der Spiegel ✝ Sinn und Form
Zum 100. Geburtstag von Stephan Hermlin: junge welt + der Freitag +
Kölner Stadt-Anzeiger
Zum 25. Todesstag von Stephan Hermlin: nd
„Welch eine Abendröte“ Stephan Hermlin – zum 100. Geburtstag eines spätbürgerlichen Kommunisten


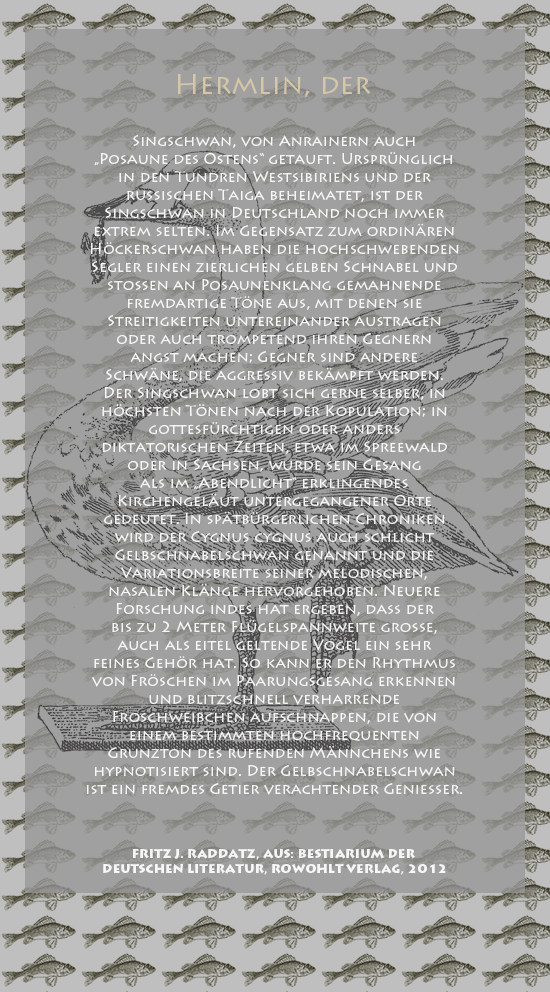












Schreibe einen Kommentar