TEXT+KRITIK: Durs Grünbein – Heft 153
ARKADIEN FÜR ALLE
Nicht nur das Zentrum, menschenleer am
aaaaaSonntagvormittag,
Die Briefe, gestempelt mit dem Vermerk Empfänger
aaaaaunbekannt.
Das Meeresrauschen am Telephon, in die Stille das
aaaaa„Bitte?“
Die tausenden Autos, von den Besitzern verlassen am
aaaaaStraßenrand,
Auch die Reklametafeln mit den Dichterplagiaten, die keiner liest,
In den Parks, grell beschmiert, die Monumente der Schulbuchidole,
Dies und alles und manches, wovor man die Augen gern schließt,
Nährt den einen Verdacht. So also sieht, aufgeschwollen zur Metropole,
Der Ort aus, an dem man den Gott einst begrub wie einen Hund.
Arkadien, Friedhof der Himmlischen, ihm gleicht jede Stadt,
Wo der Tod ein- und ausgeht, das Leben auf privatisiertem Grund.
Von wegen Idylle, Landschaft der Seligen, bukolisches Reservat.
Was immer Hirten besangen, wovon die Reisenden träumten −
Dies ist der Schauplatz. City und gorod, metropolis oder ville.
Hier geht man, sein eigener Geist, unter stoischen Bäumen,
Ein gläserner Mensch, schlaflos, sich spiegelnd im Vielzuviel.
Den Takt geben Blicke, urbane Reflexe, nicht die Eklogen,
In denen Daphnis flirtete, Milon und Lakon einander beschützten.
Man spürt sein Skelett, Vertebrat im Vibrato der Brückebogen,
Verliert das Gesicht, geblendet vom metallischen Glanz der Pfützen,
Und ist doch nirgends so heimisch. Erst hier, im gewohnten Exil,
Wo man nachts in sein Mauseloch kroch, gab es Krümel vom Glück.
Wann sonst, wenn nicht im dichten Vekehr, unterwegs ohne Ziel,
War man je so vital, so dem faulen, posthumen Frieden entrückt?
Oktober 2001
„VOM RAND HER VERLÖSCHEN DIE BILDER“
− Zu Durs Grünbeins Lyrik und Poetik des Fragments. −
I
Als Durs Grünbein am 21. Oktober 1995 im Staatstheater Darmstadt den Georg-Büchner-Preis erhielt, sprach er weder über den politischen Rebellen noch über den poetischen Avantgardisten Georg Büchner, sondern über den jungen Naturwissenschaftler und angehenden Privatdozenten, der im Winter 1834/35 in einem kleinen Straßburger Studierzimmer seine Zürcher Probevorlesung „Über Schädelnerven“ konzipiert hatte. Ersichtlich ist in Grünbeins Rede „Den Körper zerbrechen“ das eigene poetische Programm mitskizziert. Büchner ist für Grünbein ein „Dichter, der seine Prinzipien der Physiologie abgewinnt wie andere vor ihm der Religion oder der Ethik“. Sein Interesse für das anatomische Detail, für das Erkunden und Sezieren des Körperinneren habe Büchner zum Vorläufer eines „anthropologischen Realismus“ gemacht, dem es auf Isolierung, nicht auf Synthese der Teile der kreatürlichen Existenz angekommen sei. Unter dem Primat des Naturstudiums waren – summiert Grünbein – „Fragmente die Folge, fieberhafte Notate, somatische Poesie“.
II
Grünbeins eigener Lebensweg ist von der „verlornen Liebe“ zu den Naturwissenschaften geprägt. Seine Mutter war Chemielaborantin, sein Vater Flugzeugingenieur. Früh wurde das Interesse an Technik und Elektronik geweckt. Doch Durs Grünbein zog, obwohl er bereits einen Studienplatz hatte, seine Bewerbung für ein Ingenieursstudium Elektronischer Bauelemente im damaligen Karl-Marx-Stadt zurück. Vorher schon war ihm die Idee, Veterinärmedizin zu studieren, ausgetrieben worden „durch Horrorszenarien, was man da im Studium machen müsse“. Auch der während der Militärzeit unter dem Eindruck der Brecht-Lektüre entstandene Wunsch, das Massenfach Germanistik zu studieren, scheiterte an dem Fehlen politischer Vorleistungen; Grünbein hatte sich geweigert, an der Staatsgrenze der DDR zu patrouillieren. So kam es ab 1985 zu einem Studium der Theaterwissenschaft an der Berliner Humboldt-Universität, das Grünbein jedoch nach vier Semestern wieder abbrach, enttäuscht über die durchkreuzten Möglichkeiten, sich einen unabhängigen Studienplan mit Nebenfächern wie Philosophie und Psychologie zu machen. Weil er in der DDR „überhaupt keine Perspektive“ mehr sah, stellte er 1986 einen Ausreiseantrag, der bis zum Ende der DDR verschleppt wurde. Grünbein kehrte 1987/88 nach Dresden zurück, arbeitete im Zwinger als Hilfsarbeiter im mathematisch-physikalischen Salon, jobbte im Theater, trat in Galerien auf und wirkte bei Performances mit. Ein Glücksfall wurde die Begegnung mit Heiner Müller, noch 1986 in Berlin. Dieser empfahl ihn Siegfried Unseld, dem Leiter des Suhrkamp Verlags, der einen Brief ans Kultusministerium der DDR schrieb und damit erwirkte, dass der junge Autor, der bis dahin noch ein unbeschriebenes Blatt in der literarischen Welt war, im Herbst 1988 mit einem befristeten Transitvisum zur Frankfurter Buchmesse reisen durfte: der Beginn von Grünbeins Aufstieg zu einem der „wichtigsten jungen Poeten dieses Landes“.
Der zweite wichtige Einfluss auf den literarischen Werdegang sind die Kindheitsmuster der Diktatur, die sich in einem „produktiven Verlust und Mangel, an Jugend vor allem“, bemerkbar machen. Geboren – am 9. Oktober 1962 – und großgeworden ist Grünbein in der Dresdner Vorstadt Hellerau, am Rande von Müllbergen und russischen Truppenübungsgeländen, gegen deren Leere und Tristesse er sich mit Kälte wappnete, Aus diesen „Fundstücken der frühen Jahre“ im „Niemands Land“ der DDR entstanden erste Gedichte, nüchterne Notate zerfallener Landschaften „ohne Ausblick“ und „Horizont“:
Gezeugt im verwunschenen Teil eines Landes
Mit Grenzen nach innen, war er Märchen gewöhnt,
Grausamkeit. Daß der Himmel zu hoch hing,
Grund für die Kindheitsfieber, machte ihn platt.
Später ließ es ihn kalt. Dicht wie die Fenster
Hielt er dem Außenraum stand, – ohne Ausblick.
Hinter den Hügeln, gespenstisch, zog den Schluß-
Strich kein Horizont, nur ein rostiger Sperrzaun.
Landeinwärts … gehegte Leere. Sein Biotop, früh
War ein riesiger Müllberg, von Bulldozern
Aufgeworfen, am Stadtrand. Ein Manöverfeld
Naßkalter Sand, übersät mit Autoreifen und Schrott,
(…)
Als Angehörigem einer Generation, die nichts anderes kannte als die ummauerte DDR, lieferte ihm das zerbröckelnde Regime den Stoff für die literarische Produktion. „Müllhalden“ und „Abrißhäuser“, Schrottplätze und Schutthaufen sind aus Grünbeins Epiphanien der DDR ebenso wenig wegzudenken wie aus Wolfgang Hilbigs erzählerischen Ruinenlandschaften. Wie der Erzähler Hilbig, so bewegt sich der Lyriker Grünbein auf einem Boden, der jederzeit einbrechen kann.
Den Fall der Mauer erfuhr Grünbein als Befreiung aus der hermetischen Umschlossenheit des Systems. In dem Essay „Transit Berlin“ (1992) registriert er aber auch die Beschleunigungs- und Auflösungserscheinungen der Nachwendezeit:
(…) das von Mauern, Grenzen, Baracken, Satellitensiedlungen und Kasernen gebildete Flächenraster reißt im Zeitraffer auf, und darunter implodiert wie eine alte Bildröhre der Raum. Dem Auswandern der Ikonen und unerfüllbaren Visionen folgt die Einfuhr der Waren und Werte.
Befreiung – das bedeutet für den Künstler einen Anlauf zu „triebhafter Wachsamkeit inmitten einer Dingwelt, in der das Ich millionenfach zerlegt und aufgelöst wird in ein Vielerlei von Reizen“. Das poetische Mittel, das Grünbein konsequenterweise wählt, um diese Zerstreuung der Einzelphänomene zu organisieren, ist der Zyklus. Die zyklischen Strukturen dokumentieren den Willen, der dispergierenden Erscheinungsfülle der Welt, dem „Wirrwarr abgestandener Bilder“ eine letzte Form abzuringen. So verortet sich das Ich in dem Zyklus „Niemands Land Stimmen“ des Bandes Schädelbasislektion (1991) als unterirdischen Städtebewohner, der die kleinsten Anzeichen von Auflösung und Zerfall in den Schächten der U-Bahn wahrnimmt:
Blinder Fleck oder bloßer Silbenrest … (-ich),
aaaaazersplittert und wiedervereinigt
aaaaaaaaaaim Universum
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaavon Tag zu Tag,
Gehalten vom Bruchband der Stunden
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaazusammengeflickt
Stückweise
aaaaaund in Fragmenten
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa„I feel so atomized.“
Das zersplitterte Zeilenbild veranschaulicht die Zerrissenheit des Ichs, das sich als „bloßen Silbenrest“ wiederfindet. Die Klammern und der Suffix-Strich heben den Flickwerkcharakter der lyrischen Subjektivität ebenso hervor wie die Kleinschreibung: das „(-ich)“ ist Relikt einer nicht mehr vorhandenen Ganzheit, „bald Wrack, bald Ruine“.
III
Grünbeins Poetik des Fragments ist vor allem den Aufsätzen „Ameisenhafte Größe“ (1990) und „Mein babylonisches Hirn“ (1995) zu entnehmen. Die Titel deuten es an: Hier wird der Deutlichkeit halber in Extremen und Paradoxen gesprochen. Unübersehbar richtet sich das ästhetische Interesse wiederum auf die modernen Naturwissenschaften, auf „Quantenmechanik, Astronomie, Hirnphysiologie, Kybernetik, Ethnologie“. Kontrastiv dazu spannt Grünbein einen weiten Bogen „zwischen Antike und X“, wobei er sich vor allem auf Stoffe und Personen der römischen Antike beruft. Nicht politische Formeln oder historische Lektionen aber sind Durs Grünbeins Sache, sondern anthropologische Erkundungen der Lage „,Ergründe die Menschennatur“’ heißt die Devise. In der Tradition von Friedrich Nietzsche und Gottfried Benn verabschiedet er die Tröstungen der Metaphysik und das Pathos der Utopie, will er ein „Monologisches Gedicht“ schreiben „ohne alle meta- // physischen Raffinessen“ und ohne den „Stelzengang der Geschichte“. Grünbein beschäftigt die Frage, „ob man nicht das, was seit drei- oder vierhundert Jahren mit dem Begriff Seele verbunden wird, jetzt durch Erkenntnisse der Genetik oder der Physiologie erweitern soll“. Das Gehirn ist das neue „Steuerorgan“ des Menschen, das die Stelle einnimmt, die Jahrhunderte lang von der Seele besetzt wurde. Die griffige Formel für diesen historischen WandeI der Lyrik lautet: Vom „Babylonischen Herzen“ (Baudelaire) zum „Babylonischen Hirn“.
Jenseits der „Paradoxa von Autonomie und Engagement“ entscheidet sich der Dichter für den „dritten Weg einer Suche nach positiver Erkenntnis auf dem Feld seiner Kunst, allseits gefährdet“. Diese Poetik ist der „zerebralen Seite der Kunst“ zugewandt und entsprechend mit neurologischen und bioethischen Begriffen aufgerüstet. Doch Grünbein ist kein Epigone eines „neuen Naturalismus“, sondern spricht von einer „Neuro-Romantik“. Gemeint ist eine „biologische Poesie“, welche jene Trennung von Wissenschaft und Poesie aufzuheben bestrebt ist, als deren Ursprung Grünbein Galileis pedantische Vermessung der Danteschen Hölle namhaft macht. Galilei reduzierte – in einer Florenzer Vorlesung von 1587 – Dantes „Inferno“ auf eine geometrische Konstruktion und rückte den Erzeugnissen der Poesie mit den Messinstrumenten der neuzeitlichen Physik zu Leibe:
Galileis Beobachtungen mit dem bewaffneten Auge finden jenseits jener eschatologischen Sphäre statt, in der Physik und Ethik, Natur- und Geisteswissenschaft nicht mehr geschieden sind.
Die Aufgabe des Künstlers sieht Grünbein darin, das „Stimmengewirr vieler Zeiten“ aufzunehmen, um auf diese Weise „Trümmerschau“ zu halten und die „Zitate und Sprachfetzen seiner Gegenwart“ mit „jenen Splittern“ zusammenzufügen, aus denen „sich vormals der Weltsinn ergab“. Ein solches Mosaik aus den überlieferten Fragmenten der Vergangenheit und aus denen der Gegenwart herzustellen, ist allerdings kein leichtes Unterfangen. Denn der „Transformator von Sprachen“ steht auf den nachmodernen „Müllhalden künstlicher Paradiese“, die sich vor jener „zersprengten, in immer kleinere Bruchstücke zerfallenden infiniti ragioni“ auftürmen, als welche Leonardo da Vinci einmal die grenzenlose Vernunft bezeichnet hat. Der Dichter muss daher den Körper zerlegen, um die Kluft zwischen Artefakt und Wirklichkeit zu überbrücken. Er wird, mit Leonardos Wort, zu einem „Schüler der Erfahrung“. Bezeichnenderweise ist das Wappentier dieser neo-empirischen Poesie die Ameise, deren Größe in der unermüdlichen „Akzeptanz aller Schwierigkeiten und Hindernisse“ liegt; Schiller spricht einmal von der „Ameise Vernunft“.
IV
Grünbeins bevorzugte Ausdrucksform ist der Sarkasmus. Damit setzt er sich ab von den Versuchen der modernen Lyrik, sich zu legitimieren durch „Verschrottung der Symbolismen, Sprengung der Metaphorik, Sinnzertrümmerung und Absurdmachung des dichterischen Sprechens überhaupt, schließlich Auflösung der Referenzen, aller Referenzen“. Dem Sarkasmus eigen ist eine schneidende, im ursprünglichen Wortsinn „unter die Haut“ gehende Sprache. Nicht zufällig ist der Knochen als „physiologischer und physiognomischer Rest“ ein beliebtes Motiv in Grünbeins Lyrik. Der Sarkast schreibt „poetry from the bad side“; er trennt die Bedeutungen von den Dingen und entblößt diese in ihrer Erstarrtheit und Abgestorbenheit; er ist überzeugt, dass Dichtung „den Knochenbau skandiert“ und den „Schädel von innen“ erkundet. Dem „Sezieren am Nerv der Zeit“ entsprechen eine härtere Grammatik und ein kälterer Ton: Stilmittel, die Grünbein in seinem zweiten Lyrikband Schädelbasislektion (1991) mit großer Virtuosität erprobt hat.
Ähnlich wie Benn fegt Grünbein den metaphysischen Schutt hinweg, den sich die Menschen in Gestalt von identitäts- und ganzheitsstiftenden Weltbildern geschaffen haben. Grünbeins Antwort auf die Identitätsfrage ist nicht die Psychologie (wie bei Max Frisch), sondern die Biologie. Physiologisches und Pathologisches wandert ein in Gedichte wie „Mensch ohne Großhirn“, „Biologischer Walzer“ oder „Im Museum der Mißbildungen“, durch das der Dichter streift wie ehemals Benn durch die Krebsbaracke. Entscheidend ist hier wie dort die Frage, was an humaner Substanz übriggeblieben ist nach der restlosen Entzauberung der Welt und Umwertung der Werte. In suggestiven Bildern kommt Grünbein wie Nietzsche zu der Diagnose der Partikularisierung und Vereinsamung des Menschen – des „alphabetisierten Tiers“ – inmitten der Fülle endlos variierbarer Erscheinungsweisen der Wirklichkeit; wie Nietzsche verabschiedet er jede Vorstellung des Ganzen, das „zusammengesetzt, gerechnet, künstlich, ein Artefakt“ ist.
Auch die Epitaphe des 1994 erschienenen Bands Den Teuren Toten umkreisen in 33 Variationen das Thema menschlichen Verfalls. Epitaphe waren als Begräbnisinschriften, Leichencarmina und Epicedien schon im 17. Jahrhundert verbreitete Zeugnisse einer städtisch-bürgerlichen Gebrauchskunst, die sich als Einzeldrucke, in Sammelschriften zu Todesfällen, im Anhang zu gedruckten Leichenpredigten, in Lyrikbänden, in zeitgenössischen Anthologien finden. In pointierter Form fasst das Epitaph die einzelnen Zweckbestimmungen der Leichenpredigt – Trost der Trauernden, Vergänglichkeitsklage, Kondolation und Nachruf – in einer abschließenden Betrachtung zusammen und stellt den Menschen in seiner Hinfälligkeit und Zerbrechlichkeit dar. Immer aber schwingt auch ein scherzhaft-lehrreicher, selbstkritischer Ton mit, etwa in Martials satirischen Grabepigrammen oder in Christian Hoffmann von Hoffmannswaldaus „Poetischen Grab-Schrifften“ (1680), die keinen Unterschied machen zwischen gefallenen historischen Größen und verendeten Tieren, oder bei Brecht, der wünschte, „keinen Grabstein“ gesetzt zu bekommen. Grünbein ist poeta doctus genug, um an diese satirische Epitaph-Tradition anknüpfen zu können. Den Teuren Toten ist den Toten gewidmet, aber zugleich an die Lebendigen gerichtet.
Grünbeins Epitaphe sind 33 alltägliche Unfallgeschichten (die Zahl spielt auf die Lebensjahre von Christus an). Sie werden erzählt von einem fiktiven Herausgeber, einem „Thanatologen des Alltags“, der auf ein explizites „Memento mori“ verzichtet, um sarkastisch auf die Anonymität und Banalität des Sterbens in der Massengesellschaft zu verweisen. In der Lyrik nach 1945 war es Nelly Sachs, die mit ihren schon 1943/44 entstandenen „Grabschriften in die Luft geschrieben“, war es Paul Celan, der mit dem Gedicht „Kenotaph“ auf die fehlenden Gräber der ermordeten Juden hinweisen wollte. Grünbeins Epitaphe hingegen stellen, mit einem Anflug von hintergründiger Komik, den Sinn von Grabinschriften prinzipiell in Frage. Seine Nachrufe auf die „Teuren Toten“ sind epigrammatische Schwundformen des Totengedenkens, fixiert „auf die kalten Aspekte der Welt“. Den Nachbarn, die nicht merken, dass einer der ihren dreizehn Wochen lang tot im Fernsehsessel gesessen hat und seinen Tod mit dem Satz kommentieren: „Es war ein fraglos schönes Ende“, oder dem Ehemann, der schockiert vom Unglückstod seiner Frau aussagt „,Die dreizehn Ehejahre waren hin wie nichts‘“, fehlen die Worte für den Tod. Aber dabei lassen es Grünbeins Epitaphe nicht bewenden. Die Texte selbst sind Widmungen an die „Teuren Toten“ und üben auf diese Weise Kritik an der Partikularität eines Todes, den man nicht mehr als Trauerfall im eigenen Haus erfährt, sondern als „sachliches Fazit, verkürzt zur Notiz“, aus Tageszeitung und Fernsehen. So wird das Gedicht zum „kollektiven Grabstein“.
Die Vergänglichkeitsthematik wird erweitert in dem Band Falten und Fallen, der im Frühjahr 1994 erschien. Die Gedichte sind Fallstudien physiologischer Wahrnehmungskomplexe. Thematisch reichen sie von der Geburt bis zum Tod und suchen das „Dunkel von Urne zu Uterus“ zu erhellen. In diesem weitgespannten Kosmos könnte sich der Leser bisweilen verloren vorkommen, gäbe ihm der Dichter nicht die einzige paradoxe Gewissheit mit, dass die Routine des Wechsels das einzige Dauerhafte des Lebens ist: „Jeder Tag brachte, am Abend berechnet, ein anderes Diagramm / Fraktaler Gelassenheit“.
Grünbeins Vorliebe für mehrdeutige Titel bestätigt sich auch hier. Schon Grauzone morgens ließ sich lesen als Abgesang auf den „immerwährenden Morgen“ einer Grau in Grau getauchten Gesellschaft, aber auch als „Codewort für die subversiven Möglichkeiten des Gehirns“, als „Kurzformel für das Gehirn“. Mit „Falten“ können Faltungen von Haut, Hirn oder Gebirge, mit „Fallen“ Tierfallen oder Öffnungen von Türfallen gemeint sein. Zugleich drücken die Titelwörter eine Tätigkeit des bewussten oder unbeabsichtigten Kleinmachens aus: Falten ist eine Kunst, Fallen ein Fauxpas. In dem Titelgedicht „Falten und Fallen“ heißt es:
Zwischen Stapeln Papier auf dem Schreibtisch, Verträgen, Kopien,
Baute der Origami-Kranich sein Nest, eine raschelnde Falle.
Origami ist die alte japanische Kunst des Papierfaltens. Das Nest des gefalteten Papiervogels als „raschelnde Falle“ zu bezeichnen, zeugt von der Nähe beider Begriffe; umgangssprachlich wird auch das Bett als „Falle“ bezeichnet. Damit ist eine poetologische Lesart gewonnen: Das Kranichnest ist der Text, in dem sich der Schreibende sowohl verkriechen wie auch verfangen kann. Nicht zufällig gilt der Kranich als Wappentier des Dichters. Schillers „Kraniche des Ibykus“ sind die treuen Begleiter und Rächer des unter die Räuber gefallenen Dichters.
V
Das Gesetz der Mehrdeutigkeit strukturiert auch ein anderes Gedicht aus Falten und Fallen, das wie kein anderes Aufschluss gibt über Grünbeins Poetik des Fragments:
Nach den Fragmenten
1
Lesbias Käfig steht leer. Aus Aphrodites Geleitzug
aaaEntlassen („Passer, deliciae…“), arbeitslos
aaaaaaSchwirren die Spatzen umher.
Brotbettler im Straßenstaub sind diese kleinen
aaaaaaGefiederten Widerhaken
aaaVerloren auf ihren Inseln im Autolärm.
aaaaaaaaaWirbelnd in Auspuffschwaden,
Alarmiert unterm Blick des Voyeurs stieben sie weg
aaaUm kurz darauf
aaaaaaaaaNiederzuregnen als graues Konfetti.
aaaaaaaaaaaaIhr Aschermittwochspatzen …
aaaaaaHungrig, zerzaust, fast erstickt
Im Mief einer Sex-Kabine, in Peepshow-Einsamkeit (Klick!)
Jeder Aufflug ein Quickie, ein Zank um Speisereste,
aaaaaaaaaaaaSchrill zwitschernd, ein Münzenregen
aaaaaaaaaaaaaaaAus einem Automatenloch.
Ehemals Gardeflieger auf Zypern, heute Maskottchen
aaaNervöser Großstadtlieben, sich rempelnd im Zoff,
aaaaaaaaaaaaSind sie, wie immer zur Stelle,
aaaaaaaaaaaaaaaNur ohne Auftrag, dem Tod
Um ein kurzes Flügelschlagen voraus.
2
Cattleya, Cannabis, Clit … mit den Wurzeln nach oben
aaaaaaaaaaaaSaugt ein Wort als Fetisch
aaaaaaaaaaaaaaaSo gut wie ein andres
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaEmpfindungen an.
aaaEine Flora aus Allusionen
Überwuchert die Oberflächen und spuckt ins Gesicht
aaaDieser Schönen Giorgiones
aaaaaaPazifische Wellen aus Badeschaum
aaaaaaaaaaaaaaaaaaSamt Strandgut und totem Fisch.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa… Zufall
aaa(wie Geilheit an Schönheitsfehlern sich reibt)
Treibt die Namen ins Fleisch, hält in Achseln versteckt
aaaKleine Blumen des Bösen, im Haar
aaaaaaMona Lisas ein Stethoskop.
Spitze Schreie und Blutpipetten, Orchideen aus Draht,
aaaaaaaaaGlasstaub im Hinterhalt eines Nackens −
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaRisse beim Küssen verklebt, Zeit
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaIns Gedächtnis geätzt.
Kritzeln und Kitzeln, – old Zeus
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa(noch als Juckreiz ein Gott)
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaKannte auch diese List, ameisenklein
Eingenistet … wo das Geschlecht am empfindlichsten ist.
Das Gedicht ist entstanden in zwei Anläufen. Ende der achtziger Jahre schrieb Grünbein einen dreiteiligen, noch titellosen Zyklus, der Mitte der neunziger Jahre auf zwei Teile verkürzt wurde. Auch die Stellung des Gedichts in Falten und Fallen verdient Beachtung. Der Text steht in dem neunteiligen Zyklus „Variation auf kein Thema“, der den Band einleitet. „Variation auf kein Thema“: so ist auch der längste Teil des Zyklus überschrieben, eine Reihe von 40 Madrigalen über eine „Welt voller Totschlag“. Das ist jedoch kein explizites Thema, lediglich ein Anreiz für den Sprecher, aus postkatastrophischer Sicht „skeptisch, belesen, gereizt“ von den Teilen und Rissen des Ganzen her, „von den Wundrändern her“ zu denken.
Dem Titel gemäß gibt sich das zweiteilige Gedicht als eine Nachdichtung zu erkennen, doch ist das wiederum – ähnlich wie der Titel von Grünbeins letztem Band Nach den Satiren (1999) – in doppelter Hinsicht zu verstehen: Einerseits ist hier das Dichten nach Art der Fragmente der Alten gemeint, etwa der Vorsokratiker, deren Gedanken nur bruchstückhaft und in Abschriften aus zweiter oder dritter Hand überliefert sind; andererseits bedeutet der Titel auch das Schreiben nach dem Zeitalter der Fragmente, die nicht mehr pathetisch beschworene Phänomene von „Ausdruckskrisen“ sind, sondern selbstverständliche Begleiterscheinungen unseres Alltags. „Nach den Fragmenten“ ist eine Bilanz der Grenzen der Menschheit am Ende des 20. Jahrhunderts: „Einerseits wird der Mensch zum Objekt der Erkenntnis ernannt und mit den Mitteln der Analyse in seiner Erklärbarkeit und physischen Hinfälligkeit vorgeführt, andererseits erfährt er sich gerade dort wesenhaft, wo er mehr als die Summe seiner Teile darstellt und sich der Erkenntnis entzieht.“
Schon das Zeilenbild erweckt den Eindruck großer Zerrissenheit. Kein Vers hält sich an die metrische, rhythmische und typografische Ordnung des vorhergehenden. Der erste Vers ist ein antikisierender Hexameter mit Zäsur in der Mitte, die durch den Satzpunkt deutlich markiert ist. Als Grundvers epischer Langdichtung ist der Hexameter Grünbein gut vertraut, liegt seine Stärke doch gerade in episierender Lyrik. Freilich, ein festes Metrum läßt sich nicht ausmachen; der Tonfall wechselt rasch vom elegischen Langvers zum prosaischen Parlando und changiert zwischen hohen und niederen Stillagen. Begriffe aus der Vulgär- und Sexualsprache („Sex-Kabine“, „Peepshow“, „Quickie“, „Zoff“, „Clit(oris)“, „Geilheit“) mischen sich mit Namen aus Literatur, Kunst und Mythologie („Lesbia“, „Giorgone“, „Aphrodite“) und naturkundlichen Fachausdrücken („Cattleya“).
Wie eine zersprengte Ode wirkt das Gedicht, und auch die dichte Bilderfolge überwuchert es wie eine „Flora aus Illusionen“. Doch gerade dadurch wird die Aufmerksamkeit auf die poetischen Strategien gelenkt, die das Gedicht strukturieren: „(…) von der gestörten Analogie bis zur Verwirrung der sprachlichen Hierarchien, vom leichten Schwindel der Arhythmie und der bildlichen Kontamination bis zur gewaltsamen Vereinigung des Unvereinbaren“.
Beide Gedichtteile lassen sich gliedern in zweimal elf Verse; die Zäsur ist im ersten Teil durch drei Auslassungspunkte, deutlicher im zweiten durch eine Leerzeile angezeigt. Die ersten elf Verse des ersten Teils entwerfen ein Bild der im Dickicht der Städte wie „verloren“ wirkenden Spatzen. Der Spatz – der in der Antike noch nicht vom Sperling unterschieden wurde – gehörte als paarungsfreudiges Tier zum Tross der Aphrodite; von daher ist der Kosename ,Spatz‘ abgeleitet, der im zweiten Vers im Mantel eines lateinischen Zitats auftaucht: „(,Passer, deliciae…‘)“. Wer um Grünbeins Vorliebe für römische Dichter weiß, dem dürfte es nicht schwerfallen, als Quelle jene Liebesgedichte ausfindig zu machen, die der römische Lyriker Catull einer verheirateten Römerin gewidmet hat: Lesbia, der Schwester des Volkstribunen Clodius, die wegen ihrer Schönheit und Leichtfertigkeit begehrt war: „Passer, deliciae“, „Spatz, du meines Mädchens kleiner Liebling“, so umschwärmt Catulls erstes Gedicht die Geliebte. Doch müssen Aphrodites Liebesvögel in den Abgaswolken heutiger Großstädte buchstäblich Federn lassen, verloren, „arbeitslos“ und verjagt von Menschen, die auf eine andere Art von Liebe erpicht sind. Die Adepten der Liebe, deren „Aufflug ein Quickie“ ist, sind jene „nervösen Großstadtlieben“, die ihren Körper „unterm Blick des Voyeurs“ in Peepshows entblößen. Ähnlich wie die Spatzen hungern auch sie, zanken sich „um Speisereste, / schrill zwitschernd“.
Die Kontrastierung von Großstadtspatzen mit „Großstadtlieben, sich rempelnd im Zoff“ unterstreicht ebenso wie die aktualisierende Metapher „Gardeflieger auf Zypern“, wie heruntergekommen der antike Liebesmythos in heutiger Zeit ist. Durs Grünbein wagt den „Versuch, in einer vollkommen irrwitzig gewordenen Medienwelt zu den Quellen zurückzuschwimmen“. Dabei geht es um „die Vergegenwärtigung des Mythischen anhand der Vorstellungen von Liebe und Eros“. Aus „Lesbias Käfig“ ist eine miefige „Sex-Kabine“ geworden, und die einstigen Liebesboten der Aphrodite, die nach einem weniger bekannten Schauplatz des Geburtenmythos der Göttin auch Kypris genannt wurde, haben sie in triste „Aschermittwochspatzen“ verwandelt, in zerzauste Mahner der Vergänglichkeit, die dem Tod nur um „ein kurzes Flügelschlagen voraus“ sind. Das ist das vorläufige Resümee des ersten Teils: „Nach den Fragmenten“ wird der Verlust naturhafter Einheit und liebevoller Ganzheit mit mikroskopischer Genauigkeit und Gelassenheit registriert.
Der zweite Gedichtteil beginnt mit einer alliterierenden Nominalreihung: „Cattleya, Cannabis, Clit…“. Solche Zusammenballungen von Wortmaterial, das aus lexikalisch weit voneinander entfernt liegenden Sprachregionen stammt, kommen häufig bei Grünbein vor; er nimmt sich die Freiheit, Dinge zu konfrontieren, die die „Konvention trennt und die Schicklichkeit meidet“. Dabei entstehen mitunter manieristische Bilder, die schwer zu entschlüsseln sind und an die Grenzen des Interpretierbaren stoßen. Auch dies ist eine Konsequenz des Schreibens „nach den Fragmenten“: Es scheint unmöglich, den Text als Ganzes zu verstehen.
Im Ton einer sachlichen Feststellung wird Klangmagie reduziert auf einen verbalen Affektreiz. Was Wörter aus so unterschiedlichen Sprachbereichen wie Biologie und Anatomie indessen gemeinsam haben, ist eine höchst reizbare „Flora aus Allusionen“: der Assoziationsspielraum des Einzelwortes. Mit der „Flora“ hat Grünbein dem alten poetologischen Vergleich des Gedichts mit der Blume – Hölderlin spricht von der „Blume des Mundes“ und von „Worten, wie Blumen entstehn“ – eine eigentümliche Wendung gegeben. Das Wort kann aufgehen wie eine Blüte, aber „Empfindungen“, die es ,ansaugt‘, bleiben ihm doch äußerlich wie die Oberfläche des Flors. Evoziert werden somit die Austauschbarkeit und die schillernde Mehrdeutigkeit der Wörter. In den „Massen zersplitterter Bilder“ vermag das reizüberflutete Bewusstsein lediglich die „wenigen Bruchstücke“ festzuhalten, die ein „unbekanntes Bewußtsein ihm überläßt“.
Doch redet das Gedicht keiner Ästhetik der Beliebigkeit das Wort. Eher artikuliert sich ein deutliches Unbehagen an einer bunt bebilderten Oberflächenästhetik, die schwerlich zum Wesen der Dinge vordringen kann, weil sie auf die Fragmente der Dinge – und der Sprache (wie die Wortellipse „Clit…“ unterstreicht) – beschränkt bleibt. Die „Flora aus Allusionen“, das Subjekt des Satzes, bestimmt Rezeption und Produktion des Kunstwerks. Im Gesicht der „Schönen Giorgones“ – wahrscheinlich ist die „Schlafende Venus“ des venezianischen Malers gemeint – sammeln sich positive und negative Assoziationen, „Pazifische Wellen aus Badeschaum“ (die Daktylen machen den Wellengang rhythmisch hörbar) lassen wiederum den Geburtsmythos der Liebesgöttin anklingen; von „Aphrodites Schaum“ ist in einem der erotischsten Gedichte des Zyklus „Im Zweieck“ die Rede. „Strandgut und totem Fisch“: In diesen Ideenresten und Fetischen, mit denen sich nichts mehr anfangen läßt, läuft die poetische Phantasie aus; bezeichnenderweise endet der Vers mit einer stumpfen Kadenz.
Syntaktisch scheint die zweite Versgruppe an die erste anzuschließen; das Subjekt ist nach wie vor die „Hora der Allusionen“, die freilich ins Klinisch-Kühle hinüberwechseln. Angesichts medizinischer Begriffe wie „Stethoskop“ oder „Blutpipetten“, die in sonderbaren, nicht leicht zu entschlüsselnden Zusammenhängen auftreten, im „Haar / Mona Lisas“ etwa, kann man an ein Operationstrauma denken, wie es Grünbein immer wieder im Blick auf das Geburtstrauma beschwört:
Mit einem Schock („Soviel Licht!“), einem Schnitt
aaaFlinker Scheren und Messer
In das einzige Fleisch, das nicht du warst.
aaaDer Nabel erinnert den Faden,
Die Zerreißlust der Parzen von Anfang an.
Die Oberfläche einer „beobachtererzeugten Realität (der Denkbilder)“ nimmt nun bedrohliche Züge an. Wer dächte bei den „Kleinen Blumen des Bösen“, die wie Krebsgeschwulste „in Achseln versteckt“ sein können, nicht an Baudelaires provozierende Gedichte über die Hinfälligkeit und Vergänglichkeit des Menschen? Doch sind die „Risse“ der menschlichen Natur nicht nur Verfallssymbole, ins „Gedächtnis geätzt“ wie ein modernes Memento mori. Bei genauerem Hinsehen sind es die „Namen“, die sich wie Stigmata ins Fleisch brennen: Namen aus der Tradition und aus der Gegenwart, aus der Literatur und der Kunst, aus der Fachsprache und der Alltagssprache. Nicht also Klagen oder Rühmen obliegt dem Dichter „nach den Fragmenten“, sondern Sagen und Benennen. Für Grünbein ist der Sprache ihre Botschaft abhanden gekommen. Sie ist bewusst manieristisch, polyglott und eklektizistisch wie das Vokabular, das aus unterschiedlichsten Bereichen zusammenschießt und allein in der körperlichen Wirklichkeit einen größten gemeinsamen Nenner findet.
Im „Metapherngestöber“ (Celan) der Schlussverse kommen sich Anatomie und Poesie immer näher. Unter dieser Prämisse fallen „Kritzeln und Kitzeln“ (ein Reim, den als letzter wohl Mörike verwendete), das entwerfende Notat und der dieses auslösende Sinnesreiz in eins. Welcher List die Menschen diese Reizempfänglichkeit immerhin zu verdanken haben, geht aus einer saloppen Apostrophe hervor: „old Zeus“, der griechische Göttervater, ist selbst „noch als Juckreiz ein Gott“. Das erinnert an die Klage von Büchners Danton: „Puppen sind wir von unbekannten Gewalten am Draht gezogen; nichts, nichts wir selbst.“
Insgesamt lässt sich der zweite Teil als poetologischer Kommentar des ersten lesen: Die Theorie im Gedicht erscheint als Poetik des Fragments. Grünbein hat betont, dass ein Gedicht „Bruchstücke einer früheren Erinnerung“ aufbewahre:
Wie ganzheitlich es auch daherkommt, immer muß noch ein Teil ergänzt werden, und dabei ist es die Vergeblichkeit selbst, die sich hier demonstriert, ein unmögliches Verlangen nach umfassender Verständigung.
Es geht darum, dass der Dichter im postideologischen Vakuum der neunziger Jahre am Verschwinden des Ganzen, an der Liquidation des Vollkommenen, an der Verflüchtigung der Werkautonomie arbeitet. Das Fragment hat – nach der Erschütterung der Ganzheitsästhetiken im Fin de siècle und den Verlustbilanzen lyrischer Totalität nach 1945 – für Grünbein seine eigenständige Gattungsfunktion eingebüßt und ist nur noch Teil anderer, ebenfalls überlebter Ausdrucksformen, Zeichen eines „Postfragmentarismus“, der in die Künste Einzug gehalten hat. Der Zusammenhang, auf den sich das Fragment immer bezogen hatte oder beziehbar war, geht vollends verloren und wird selbst versuchsweise nicht mehr hergestellt. Ohne Kontext fällt das Teil infolgedessen aus dem Rahmen und verselbstständigt sich zur offenen Form. „Aber das Fragmentarische selbst kann nie beweisen, dass es diesen größeren Zusammenhang wirklich gibt“, schreibt der schwedische Schriftsteller Lars Gustafsson. Kein „Verlust der Mitte“ (Sedlmayr) also ist zu beklagen. Das Fragmentarische ist ein Gewinn, weil es – als konsumierbares und kommunizierbares Kunstprodukt – auch der selbstreferenziellen Inszenierung fähig geworden ist.
Damit löst sich die traditionelle Werkaura auf, ohne dass ein adäquates Pendant benannt werden könnte: „Nichts wäre unsinniger, als angesichts der temporären Installationen, unsichtbaren Feldstudien, kurzzeitig exponierten und sofort wieder in den Kreislauf eingebrachten Fundstücke noch von einem Werk zu sprechen.“ Stattdessen kommt es darauf an, „ein Register / All der Dinge, die dir jetzt wichtig sind“, zu erstellen. So erreicht Grünbein sein Ziel, „den Fragmenten (der Überlieferung) wie den Fraktalen (des eben Wahrgenommenen) zu einem konfabulierenden Sprechen“ zu verhelfen. Der Dichter wird zum Gedächtniskünstler, der die Lücken der Tradition rekonstruiert, die Splitter der faktengesättigten Realität einsammelt und das Gedicht auf diese Weise zu einem Archiv der Fragmente „Nach den Fragmenten“ macht.
Michael Braun
Inhaltsverzeichnis
− Durs Grünbein: Arkadien für alle
− Michael Braun: „Vom Rand her verlöschen die Bilder“. Zu Durs Grünbeins Lyrik und Poetik des Fragments
− Hermann Korte: Habemus poetam. Zum Konnex von Poesie und Wissen in Durs Grünbeins Gedichtsammlung Nach den Satiren
− Roman Fischer: Materia medica – zur Innenansicht von Sprache
− Durs Grünbein: Zwei Männer in Betrachtung des Mülls
− Klaus Völker: Die Schrecken der Auflösung. Zu Durs Grünbeins Arbeiten für das Theater
− Fabian Lampart: „Jeder in seiner Welt, so viele Welten…“. Durs Grünbeins Dante
− Manfred Fuhrmann: Juvenal – Barbier – Grünbein. Über den römischen Satiriker und zwei seiner tätigen Bewunderer
− Durs Grünbein: Zwischen Antike und X
− Helmut Böttiger / Durs Grünbein: Benn schmort in der Hölle. Ein Gespräch über dialogische und monologische Lyrik
− Ilonka Zimmer: Durs Grünbein – Auswahlbibliografie 1988–2001
Durs Grünbein
gilt als einer der wichtigsten Vertreter der jüngeren Lyriker-Generation. Seine Gedichte und Essays sind Gegenwartsanalysen der komplexesten Art, weil sie noch im Fixieren von Beobachtungen deren wissenschaftliche Prämissen mitreflektieren und Bezüge zur literarischen Tradition, vor allem zur Antike, herstellen. Dieser Komplexität im Werk des Autors geht das vorliegende Heft nach.
edition text + kritik, Klappentext, Januar 2002
Zeitschriftenlese
Es gehört wohl zu den stärksten Passionen junger, selbstbewusster Zeitschriftenmacher, die jeweils amtierenden Literaturpäpste zu grimmigen Bannflüchen zu reizen. Auch im Falle von Heinz Ludwig Arnold, dem Erfinder der Zeitschrift Text + Kritik, kam es zu Verwerfungen, als der junge Germanistikstudent im November 1962 den großen Friedrich Sieburg, seines Zeichens Chefkritiker der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, um ein existenzsicherndes Inserat für seine neue Zeitschrift anging. „Sie scheinen nachgerade an einem hoffnungslos gewordenen Qualitätsbegriff festhalten zu wollen“, so komplimentierte Sieburg artig den jungen Editor, um anschließend die Peitsche zu zücken: „Sie nennen für die erste Nummer drei Namen, die mir alle drei gleich widerwärtig sind, nämlich Günter Grass, Hans-Henny Jahnn und Heinrich Böll. Das ist … eine trübe Gesellschaft, dem deutschen Waschküchentalent entstiegen und gegen alles gerade Gewachsene feindselig gesinnt.“ Zwei Jahrzehnte später, so behauptet die Legende, war es Sieburgs Nachfolger Marcel Reich-Ranicki, der mit derben Beschimpfungen der „Schweine-Bande“ um „Arnold-Dittberner-Kinder“ nicht geizte.
Der so Attackierte ließ sich nicht einschüchtern. Der damals 22-jährige Arnold setzte in seinen ersten beiden Heften unverdrossen auf seine Hausgötter Grass und Jahnn – und es gelang ihm scheinbar mühelos das, was bei Rainer Maria Gerhardt, dem heute vergessenen Literaturgenie der Nachkriegszeit, noch in astronomisch hohen Schulden und einem tragischen Freitod geendet hatte. Unter dem ursprünglich von Arnold gewünschten Zeitschriftentitel fragmente hatte Gerhardt schon 1951/52 in seinem großartigen literarischen Journal dem restaurativen Nachkriegsdeutschland die Leviten gelesen, war aber an notorischem Geldmangel und ästhetischer Kompromisslosigkeit schon früh gescheitert.
Heinz Ludwig Arnold und seine frühen Mitstreiter Gerd Hemmerich, Lothar Baier und Joachim Schweikart hatten mit Text + Kritik mehr Glück. Das Konzept, sich in kritischen Aufsätzen immer nur einem wichtigen Gegenwartautor zu widmen, schien zunächst nur auf ein germanistisches Fachpublikum zu zielen. Nachdem er aber auf listige Weise beim Chefmanager von HAPAG-Lloyd eine Spende von 1000 DM rekrutiert hatte, begann Arnold mit seinem neuen Literaturblatt von Göttingen aus die literarische Welt zu erobern. Das Debütheft über Günter Grass, ein 32 Seiten-Heftchen, ist noch heute, in stark erweiterter und aktualisierter Fassung, zu haben. Für den Eröffnungsbeitrag, eine „Verteidigung der Blechtrommel“, hatte Arnold den Brüsseler Germanisten Henri Plard gewinnen können, den er während seiner literarischen Lehrjahre als Sekretär Ernst Jüngers kennen gelernt hatte. Auf sein literarisches Adjutantentum bei Ernst Jünger, das von 1961 bis 1963 währte, blickte Arnold später mit einigem Ingrimm zurück, zuletzt in seinem Text + Kritik-Heft zu Jünger, das die schärfste Kritik am Anarchen aus Wilflingen enthält, die jemals aus literaturwissenschaftlicher Perspektive geübt wurde.
Die Lust an der literaturkritischen Auseinandersetzung zeichnet ja nicht nur das Jünger-Heft, sondern viele andere Projekte der edition text + kritik aus, die 1969 im juristischen Fachverlag Richard Boorberg ein festes verlegerisches Fundament gefunden hatte und dort ab 1975 als selbständiger Verlag agieren konnte. Text + Kritik war nie ein Forum für urteilsschwache Germanisten, die jede interpretative Wendung mit einem Überangebot an Fußnoten absichern, sondern ist bis heute die bevorzugte Schaubühne für philologische Feuerköpfe, die cum ira et studio für oder gegen einen Autor und sein Werk eintreten. So muss jeder Autor, dem die Ehre zukommt, in einem Text + Kritik-Heft analysiert und seziert zu werden, mit kritischen Dekonstruktionen des eigenen Werks rechnen.
Mittlerweile hat die öffentliche Aufmerksamkeit nachgelassen, aber die angriffslustige Essayistik ist auch nach insgesamt 157 Heften das Markenzeichen von Text + Kritik geblieben. In Neuauflagen und Aktualisierungen wurden veraltete Urteile revidiert, beim Wechsel der Denkschulen und Interpretationsmethoden aber auch so mancher Purzelbaum geschlagen. In der 5. Auflage des Ingeborg Bachmann-Heft exponierte sich z.B. eine schrille feministische Literaturwissenschaft, der Sonderband Nr. 100 über „Literaturkritik“ publizierte massive Attacken auf Marcel Reich-Ranicki. Einem euphorischen Sonderheft über „die andere Sprache“ der „Prenzlauer-Berg-Connection“ folgte mit der Nummer 120 alsbald die Selbstkorrektur im desillusionierten Blick auf den Zusammenhang von „Literatur und Staatssicherheitsdienst“. Die subtilsten, stilistisch funkelndsten Schriftsteller-Entzauberungen haben in den letzten Jahren Hermann Korte und Hugo Dittberner verfasst. Über Sarah Kirsch, in der Nummer 101, findet man z.B. die wunderbare Sentenz, die Dichterin schreibe „Gedichte, die durch forcierte intellektuelle Unterbeanspruchung langweilen“. Diesen Königsweg literaturkritischer Unruhestiftung will Text + Kritik nicht mehr verlassen.
Michael Braun, Saarländischer Rundfunk, April 2003
Fakten und Vermutungen zu TEXT+KRITIK
Fakten und Vermutungen zu Durs Grünbein + Archiv + KLG + IMDb +
Facebook + DAS&D + Georg-Büchner-Preis 1 & 2 +
Orden Pour le mérite + PIA
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Galerie Foto Gezett +
deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Durs Grünbein–Sternstunde Philosophie vom 14.6.2009.


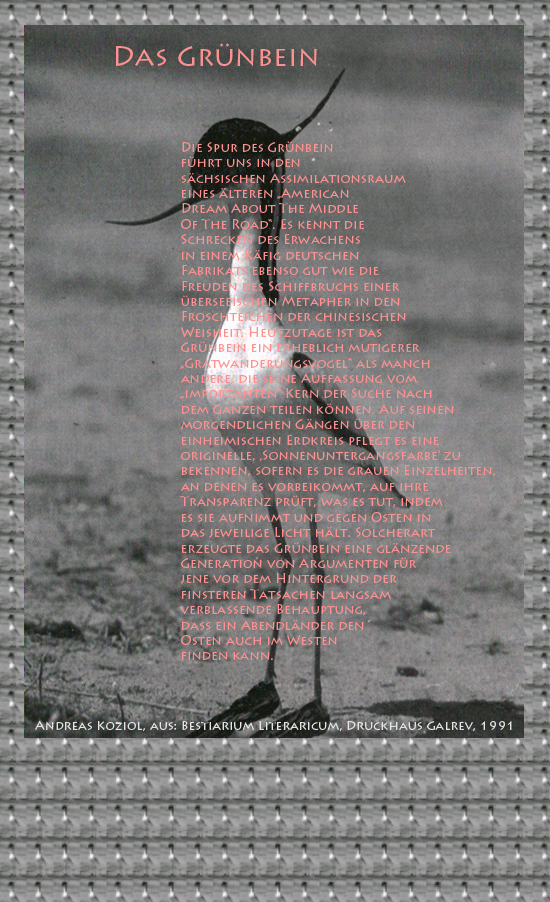
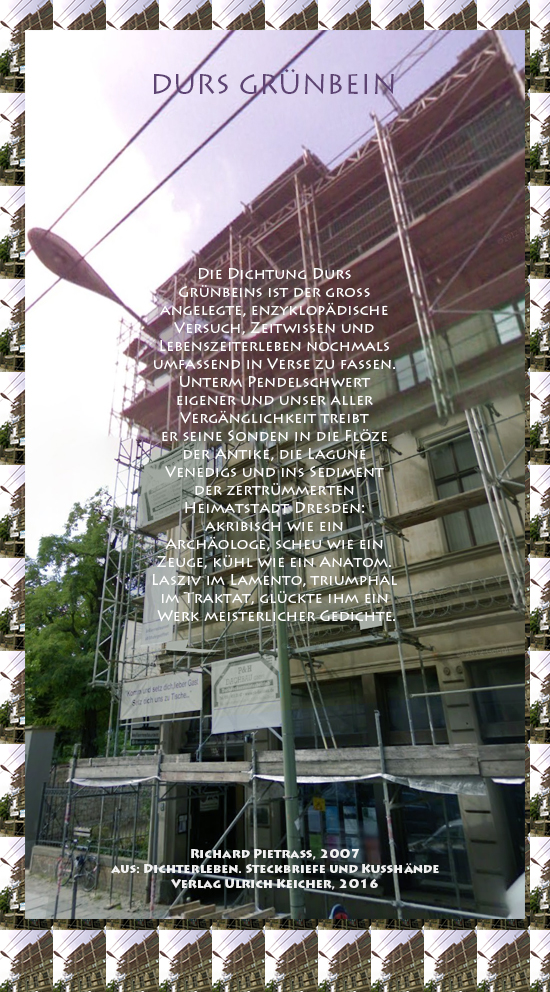












Schreibe einen Kommentar